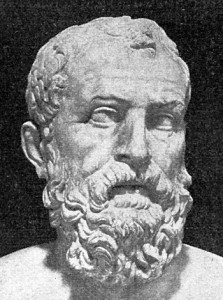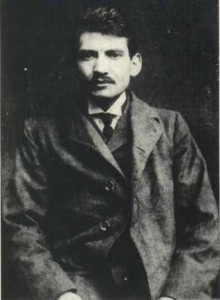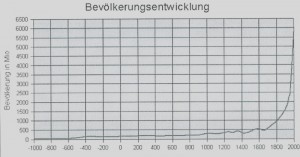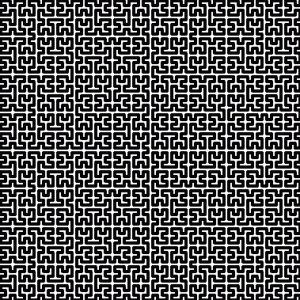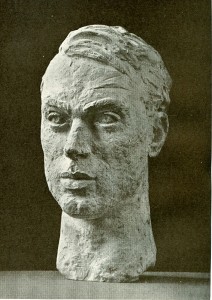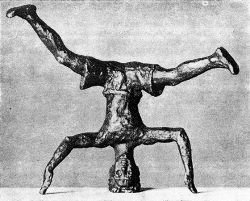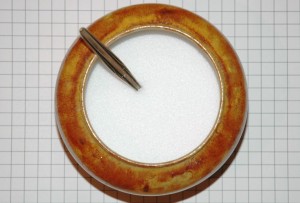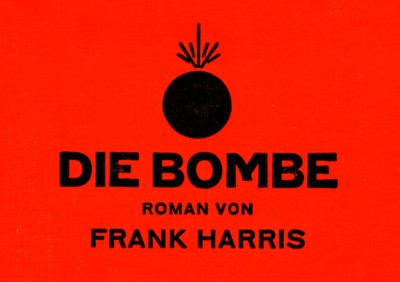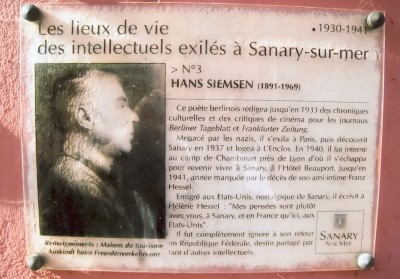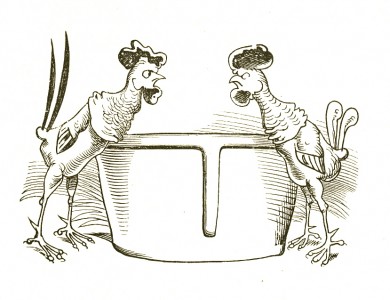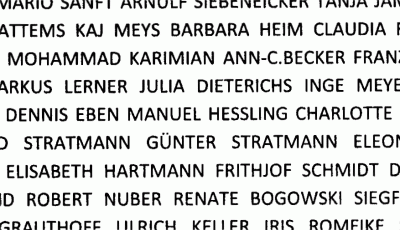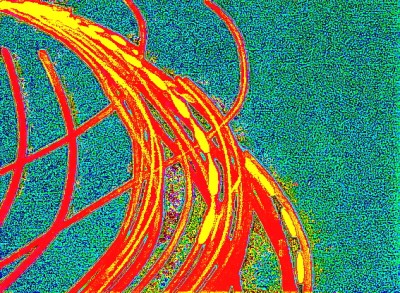[Wegen Familienfeier heute kein Blog.]
Hochzeit
Friday, 28. November 2008Zugzwang
Monday, 24. November 2008
Das Schach hat, als Grenzfall zwischen Sport, Kunst, Spiel und Wissenschaft, Schriftsteller immer wieder dazu angeregt, es zum wesentlichen Motiv ihrer poetischen Werke, von Romanen und Novellen, Gedichten und Dramen zu erwählen. Als Spiegelbild der wirklichen Menschenwelt mit ihren unversöhnlichen Gegensätzen eignet es sich offensichtlich besonders gut, die Tragödie unseres Scheiterns en miniature abzubilden. Dennoch scheint die Schnittmenge zwischen schachspielerischem und literarischem Genie enttäuschend gering zu sein – und der Roman, der sowohl auf der ästhetischen Höhe seiner Gattung steht als auch der gedanklichen Tiefe des Schachspiels gerecht wird, wartet nach manchen respektablen und etlichen erbärmlichen Versuchen noch immer auf seinen großmeisterlichen Autor. – In lockerer Folge werde ich hier, als halbgebildeter Laie beider Hemisphären, einen groben Überblick wagen.
2006 erschien als Vorabdruck, mit Illustrationen von Marc Quinn versehen, im Londoner Observer der Roman Zugzwang von Ronan Bennett (* 1956), der mittlerweile auch als Buch in deutscher Übersetzung vorliegt. (Ronan Bennett: Zugzwang. A. d. Engl. v. Stefanie Röder. Berlin: Bloomsbury im Berlin Verlag, 2007.) Ort und Zeit der Handlung: St. Petersburg im März 1914. Der Ich-Erzähler, ein Psychoanalytiker namens Dr. Otto Spethmann, wird von seinem Freund, dem polnischen Geigenvirtuosen R. M. Kopelzon, um seelische Unterstützung für einen polnischen Schachmeister gebeten. Dieser (fiktive) Awrom Chilowicz Rozental, für den vielleicht Akiba Rubinstein Modell gestanden hat, hätte gute Aussichten, das Petersburger Schachturnier zu gewinnen, an dem neben dem amtierenden Weltmeister Emanuel Lasker unter anderen auch der Kubaner José Raúl Capablanca, Siegbert Tarrasch aus dem Deutschen Reich, die Russen Alexander Aljechin und Ossip Bernstein, der Brite Isidor Gunsberg und der US-Amerikaner Frank Marshall teilnehmen. Allerdings wird Rozental von einer (fiktiven) Fliege belästigt, und sein Sieg bei diesem damals größten Schachwettkampf aller Zeiten scheint gefährdet. Hier soll Spethmann in Kopelzons Auftrag Abhilfe schaffen, indem er den psychisch angeschlagenen Polen vor Beginn des Meisterturniers von seiner „Fliege” befreit. Kopelzon handelt aber, wie sich bald herausstellt, nicht etwa aus lauteren, rein schachlichen Motiven, sondern weil der verwirrte Pole, so er denn den Sieg in diesem Turnier davonträgt, seine Trophäe aus der Hand des Zaren Nikolaus II. persönlich entgegennehmen wird – und dabei die seltene Gelegenheit erhält, als Kopelzons Marionette ein Attentat auf den despotischen Monarchen zu verüben.
Die Romanhandlung schreitet zügig voran und ist zudem, wie ein saftiger (und vielleicht etwas überwürzter) Braten, gespickt mit mancherlei Nebenthemen. Der lange verwitwete Psychoanalytiker hat Erziehungsprobleme mit seiner widerspenstigen Tochter Catherine. Er verliebt sich knapp vor seinem 50. Geburtstag in seine Patientin Anna Petrowna Siatdinow, Tochter des reichsten Industriellen der Stadt, des herrschsüchtigen Peter Arsenjewitsch Sinnurow, mit dem Spethmann bald schon unliebsame Bekanntschaft schließen wird. Hat der allmächtige Geldmogul seiner Tochter Gewalt angetan, als sie ein 13-jähriges, ahnungsloses Mädchen war? Oder hat er gar, vor Annas unschuldigen Augen, damals seine eigene Mutter ermordet? Die Ereignisse überschlagen sich, Spethmann findet kaum Zeit zum Atemschöpfen, er ist ständig in Zugzwang.
Und zu alledem spielt der Ich-Erzähler nebenher noch eine Schachpartie gegen seinen Freund Kopelzon, deren Fortschritte der Leser auf zahlreichen in den Text eingestreuten Diagrammen mitverfolgen kann. Der Autor verrät uns im Anhang, dass er diese Partie von seinem Freund und fachlichen Berater übernommen hat, dem englischen Großmeister Daniel King (ELO 2514), der als Weißer bei der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft 2000 den überlegenen Russen Andrej Sokolow (ELO 2565) besiegte, indem er ihn im Endspiel geschickt in Zugzwang brachte. Das Wort „Zugzwang” wurde ursprünglich von dem Verleger und Schachmeister Max Lange 1858 in der von ihm herausgegebenen Berliner Schachzeitung geprägt und vier Jahre später in seinem Handbuch der Schachaufgaben etwas umständlich so definiert: „Der Zugzwang besteht in einer solchen Combination, welche der handelnden Partei aus dem Umstande, dass die Gegenpartei der Anforderung des Zuges genügen muss, entscheidende Vortheile erwachsen. Diese Erscheinung, dass die Erfüllung der Zugpflicht an sich die Stellung compromittiert, entspringt entweder aus Mittellosigkeit der Gegenpartei, welche bei geringer Auswahl an Zügen durch deren gezwungene Ausführung den Stand verschlechtert, oder sie ergiebt sich aus einer so ungünstigen Postirung aller Stücke, dass diese bei jeder nur möglichen Bewegung ihre Wirksamkeit gegenseitig behindern und hierdurch wesentlich den Angriffsplan der handelnden Partei fördern.” (Max Lange: Handbuch der Schachaufgaben. Leipzig: Verlag von Veit & Comp., 1862, S. 315.) Das Wort Zugzwang, das das Grimmsche Wörterbuch (Bd. 16, 3. Lfg. v. 1924) noch nicht verzeichnet, ist ins Englische und Russische als fachsprachlicher Germanismus übernommen worden und im Deutschen sehr bald auch in den nicht-fachlichen Sprachgebrauch eingegangen. Umgangssprachlich bedeutet „Zugzwang” allgemeiner, dass jemand durch eine Bedrohung zu einer bestimmten Handlung oder zumindest zu einer Reaktion gezwungen wird.
Mit dieser doppelten Wortbedeutung spielt Bennett, indem er seinen Helden Otto Spethmann in den sich überschlagenden, dramatischen Ereignissen der Handlung ständig unter Zugzwang (im allgemeinsprachlichen Sinn) setzt, ihm in der parallel laufenden Schachpartie aber die seltene Gelegenheit gibt, über seinen Kontrahenten zu triumphieren, indem er ihn auf dem Brett in Zugzwang (in des Wortes ursprünglicher Bedeutung) bringt. Das Verständnis der gewiss für Schachkundige interessanten Partie ist aber durchaus entbehrlich, um der verwickelten Romanhandlung zu folgen – und es bleibt sogar fraglich, ob es zu deren Deutung einen wesentlichen Beitrag leistet. Es drängt sich der Verdacht auf, dass Bennett mit dieser Zugabe, die insofern wie „aufgepfropft” erscheint, nicht lediglich den Kreis seiner Leser um die nicht unbeträchtliche Zahl der Schachbegeisterten erweitern wollte. Mein Fazit: Das spannende Buch bietet unterhaltendes Lesevergnügen vor historisch gut recherchiertem Hintergrund und mit psychologisch glaubwürdig entwickelten Protagonisten. Das Verhältnis des Schachpiels zur gelebten Wirklichkeit hingegen lässt Ronan Bennetts Roman kaum in einem neuen Licht erscheinen.
[Titelbild: Bengt Ekerot als Tod und Max von Sydow als Kreuzritter Antonius Blok in Ingmar Bergmans Film Det sjunde inseglet von 1957.]
Rückspiegelei (VIII)
Saturday, 22. November 2008Als ich noch schlecht bezahlter Gast-Blogger bei Westropolis war, vom 5. April 2007 bis zum 31. August 2008, da dachte ich von Zeit zu Zeit laut über meine persönlichen Erfahrungen mit diesem neuen Medium nach, in insgesamt sieben Rückspiegeleien. Diese Serie setze ich hier fort, in meinem eigenen Haus, das ich am 24. März 2008 bezog und in dem mir niemand mehr den Mund verbieten kann. Der Preis für diese Unabhängigkeit ist schnell ausgerechnet. Das alltägliche Veröffentlichen meiner Kurzprosa wird jetzt nicht einmal mehr mit einem Hungerlohn honoriert. Und die Aufmerksamkeit, die diesen „Gedanken zum Tag in fünf Absätzen” widerfährt, hat sich ebenfalls deutlich reduziert: auf zwei Kommentatoren, die mir von Westropolis her unverdrossen die Treue halten (Matta Schimanski und Günter Landsberger).
Dass ich den faulen Kompromiss aufkündigte, unterm Dach eines Medienkonzerns zu bloggen, dessen im Revier seit Jahrzehnten ihre Monopolstellung behauptenden Printprodukte (Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Neue Ruhr Zeitung, Westfälische Rundschau und Westfalenpost) mir in ihrer billigen Mache seit jeher ein Dorn im Auge waren, habe ich trotzdem nie bereut. Die ungefährdete, absolute Dominanz eines solchen Meinungsmachers schien mir immer schon obskur – und das nicht einmal, weil ich vom konkurrenzlosen Einfluss dieses Alleinherrschers eine Manipulation der Stimmung im Revier befürchtet hätte, sondern wegen seiner alle strittigen Fragen unserer endzeitlichen Gegenwart neutralisierenden Gleichgültigkeit. (Im Nachhinein kann man die gescheiterten Versuche der Süddeutschen Zeitung und der taz, wenigstens im Kulturressort in diesem verteufelt wichtigen und höllisch verkommenen Revier einen Fuß in die Tür zu zwängen, gar nicht laut genug loben, haben sie uns doch immerhin gezeigt, dass hier Hopf und Malz verloren sind.)
Warum habe ich mich dann aber für 17 lange Monate auf dieses WAZ-Abenteuer Westropolis eingelassen und dort im Laufe dieser Zeit 362 meist ausführliche, akribisch recherchierte, stets mit eigenen Bildern versehene, gründlich verlinkte Beiträge veröffentlicht? Weil ich der naiven Hoffung aufgesessen bin, einem solchen Konzern könnte wirklich daran gelegen sein, sein journalistisches Selbstverständnis aus Anlass der radikal neuen Publikationsform Internet und via Weblog zu reformieren. Zudem imponierte mir, dass die WAZ Mediengruppe ihren Mitte Februar 2007 gestarteten Versuchsballon ausgerechnet vom Kulturressort aus aufsteigen ließ, bekanntlich nicht gerade ein Schmuckstück ihrer Printmedien. Erst als dann am 29. Oktober 2007 DerWesten online ging, wurde auch mir klar, dass die Kultur gerade deshalb als Experimentierfeld herhalten musste, weil dort inhaltlich wenig anbrennen konnte. Viel schlechter als das, was der Zeitungsleser im Revier aus diesem Haus geboten bekommt, konnten auch die Texte der bei Westropolis versammelten Laienspielschar, größtenteils ohne journalistische Vorbildung, kaum sein.
Dass Westropolis heute immer noch im Netz steht, ist nur damit zu erklären, dass diese Spielwiese kaum Kosten verursacht, gemessen am Zwei-Milliarden-Euro-Umsatz der WAZ Mediengruppe und bei einer Rendite im zweistelligen Bereich. Dass die Investitions-Philosophie der Brost- und Funke-Clans, die das Unternehmen groß gemacht hat, nach wie vor die Geschäftspolitik bestimmt, wird auch bei einer Petitesse wie Westropolis deutlich. Alle Macken und Mucken dieses Portals, von der willkürlichen thematischen Struktur bis zur nie richtig funktionierenden Suchfunktion, wurden nie einer Revision unterzogen. Diese totale Gleichgültigkeit gegenüber allen inhaltlichen und formalen Qualitätsansprüchen kann man sich eben leisten, wenn keinerlei Konkurrenz zu fürchten ist. Den bekannten Satz „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich’s gänzlich ungeniert!” kann man in diesem traurigen Fall leider noch toppen: „Im Land der Blinden gelten selbst Hühneraugen als sehend.”
Aber ich will nicht undankbar sein, schließlich sind alle meine Westropolis-Beiträge unverändert und mit allen Kommentaren unter der bekannten Adresse nach wie vor online. Dort findet man auch noch meine ersten sieben Rückspiegeleien: (I) Wer seid ihr? Wo bin ich? vom 7. Mai 2007; (II) Blogophilie vom 11. August 2007; (III) No Comments vom 7. Oktober 2007; (IV) Im Garten Eden vom 25. Dezember 2007; (V) Constant Message vom 28. Januar 2008; (VI) Eine nette Spielwiese vom 20. Februar 2008; und schließlich (VII) Exitus gem. §§ 186 und 187 StGB vom 28. Februar 2008. – Dass bei der Suche unterm Stichwort „Rückspiegelei” lediglich die Beiträge IV, V und VII angezeigt werden, ist eins der vielen ungelösten Rätsel, die dieser peinliche Weblog-Friedhof seinen Lesern aufgibt – wie ein orakelnd-paradoxer Grabspruch, in Stein gehauen, à la Timm Ulrichs: „DENKEN SIE IMMER DARAN MICH ZU VERGESSEN.”
Pedant
Friday, 21. November 2008Mein Bekenntnis zur Genauigkeit warf die Frage (eines ehemaligen Lehrers) auf, wann diese Arbeitseinstellung in Pedanterie übergeht und somit eine eigentlich doch bewunderungswürdige Tugend zur Zwanghaftigkeit degeneriert, die unseren Spott verdient. Die Bezeichnung Pedant ist schließlich im heutigen, spätestens seit dem 17. Jahrhundert üblichen Sprachgebrauch stets abfällig gemeint, während ein genau, sorgfältig und gründlich arbeitender Meister, gleich welchen Fachs, kaum einen Vorwurf zu fürchten hat.
Μηδέν άγαν – Nichts zu sehr! Dies riet schon Solon [siehe Titelbild], einer der sieben Weisen im antiken Griechenland, seinen athenischen Mitbürgern. Einen verlässlichen Maßstab, wann denn aber des Guten zu viel getan wird, hat er freilich nicht mitgeliefert und solch ein allgemeingültiges Maß ward bis heute nicht gefunden. Wann schlägt tugendsame Sparsamkeit in lasterhaften Geiz um? Was ist noch heldenhafter Mut und was schon sträflicher Leichtsinn? Wer darf sich seiner Großzügigkeit rühmen und wer muss sich schämen, ein haltloser Verschwender zu sein? Zu bald jeder erstrebenswerten Charaktereigenschaft lässt sich eine Übertreibung finden, die aus ihr eine charakterliche Deformation macht, mag man sie nun in der biblischen Tradition als Laster, nach Charles Baudelaire als Spleen oder nach Sigmund Freud als Zwangsneurose bezeichnen. (Als großartige Kenner und Gestalter dieser allzu menschlichen Verstiegenheiten fallen mir noch ein: der Dramatiker Molière und William Hogarth, der Graphiker, vom kongenialen Georg Christoph Lichtenberg interpretiert.)
Bevor ich mich mit der Etymologie des Wortes Pedant beschäftigte, fragte ich mich, was es mit dem Fuß zu tun haben könnte, denn ich leitete es irrtümlich aus dem Lateinischen von pēs, pedis ab. Nun bin ich klüger und weiß, dass es vor vierhundert Jahren auf dem Umweg über das französische pédant und italienische pedante (für „Schulmeister; engstirniger Kleinigkeitskrämer”) vom griechischen Verb παιδεύειν („erziehen, unterrichten”) stammend ins Deutsche gelangte und insofern mit „Pädagoge” eng verwandt ist. (Vgl. Duden Band 7: Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim / Wien / Zürich: Bibliographisches Institut, 1963, S. 499; und Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1975, S. 536.) Dazu passt ja vortrefflich, dass heute jeder, der sich über die zunehmende Nachlässigkeit des Sprach- und Schriftgebrauchs im Internet beschwert, umgehend mit dem Vorwurf abgewatscht wird, er wolle sich bloß mit seiner oberlehrerhaften Arroganz wichtigtun.
Ich stelle mir vor, dass es die faulen Schüler waren, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts dem Wort Pedant (ursprünglich ganz neutral für „Lehrer”) seine bis heute gültige, negative Konnotation verliehen haben, als Racheakt nach den Rutenstreichen, die sie von ihren erbosten Vätern nach jedem vor Fehlern nur so strotzenden Diktat empfingen. Und gerade so bringen unsere heutigen nachlässigen Blogger, weil sie schlicht zu faul sind, Genauigkeit, Sorgfalt und Gründlichkeit walten zu lassen, dieses Tadelwort in Anschlag.
Ach, wie froh wäre ich doch, wenn man mich als einen Pedanten im ursprünglichen Sinn dieses Wortes annehmen wollte – und somit als Vorbild, dem zu folgen zwar Fleiß erfordert und den einen Schreibenden viel Zeit kostet, seinen möglicherweise zahlreichen Lesern jedoch ein Vielfaches an Zeit und Verdruss erspart, die sie, wie mittlerweile üblich und allseits akzeptiert, beim stammelnden Entziffern fehlerhafter Texte vergeuden müssen.
Schreibzwang (I)
Thursday, 20. November 2008Das Phänomen ist bekannt und wird hie und da in Weblogs beschrieben: Nach einem hoffnungsvollen Start mit befriedigenden Ergebnissen stellt sich plötzlich völlige Leere ein. Der Blogger schaut ratlos aufs leere weiße „Blatt” auf seinem Monitor und sucht krampfhaft nach einem Thema. Das kann doch wohl nicht wahr sein! Wo ist nur die Inspiration geblieben, die in den vergangenen Wochen und Monaten in zuverlässiger Regelmäßigkeit für die konkreten Anlässe zum Schreiben sorgte? Soll ich tatsächlich heute über die Nominierung von Johannes Bultmann als Kaufmann-Nachfolger in der Intendantur der Essener Philharmonie schreiben? Und wo bleibt der notwendige Drive, daraus einen lesbaren Text zu zaubern?
Die meisten Kolleginnen und Kollegen überwinden diese Schrecksekunde sehr bald und fahren achselzuckend ihren Rechner runter. Ganz cool bleiben! Ein paar Tage später fällt ihnen dann wieder was ein, worüber sie schreiben können. Sie haben den heldenhaften Mut zur Lücke, schließlich zwingt sie kein Mensch, täglich ihre Geistesprodukte im Internet abzuliefern. Oft lässt sich in der Folge eines solchen ersten Zugeständnisses an den inneren Schweinehund beobachten, dass die Lücken immer größer werden, bis der Elan der frühen Tage völlig versiegt ist. Ich habe schon Weblogs entdeckt, deren jüngstes Posting bereits ein paar Jährchen auf dem Buckel hat.
Die diszipliniertere Minorität scheut die Unterbrechung wie der Teufel das Weihwasser und wringt sich an schwachen Tagen lieber irgendeinen unausgegorenen Stuss aus dem ermatteten Hirn, notfalls eine Meditation über die Schreibblockade selbst. Für diese zum täglichen Schreiben verdammten Blogger ist das ursprünglich so unschuldige Vergnügen zur Sucht geworden, sie leiden unter Schreibzwang. Ein Tag ohne Blogbeitrag ist für sie ein verlorener Tag. Ich gehöre offenbar zu dieser zweiten Sorte.
Aber machen wir uns nichts vor: Diese Symptome und Syndrome sind ja nicht erst im Webspace entstanden. (Allenfalls sind sie hier unmittelbarer zu diagnostizieren.) Die bekanntesten Beispiele für eine akute, dann chronisch werdende Schreibhemmung aus der neueren deutschen Literaturgeschichte, Wolfgang Koeppen und Uwe Johnson, will ich nicht aufwärmen, von Hölderlin und Nietzsche ganz zu schweigen. Stattdessen serviere ich ein Zitat von einem unverdientermaßen nahezu vergessenen Zwangsschreiber, dem gebürtigen Essener und ungebärdigen Kiffer Helmut Salzinger [Titelbild, mit Fernglas im Kreis seiner Freunde, 1986]:
„Ein Joint. Zeitweise habe ich einen fürchterlichen Produktionsdruck, aber nichts zu produzieren. Es fällt mir einfach nichts ein und rein, das ich sagen wollte, raus. Also muß ein Joint her, ders lockert. – Es ist die Zwanghaftigkeit, was mich daran stört. Nicht bloß am Joint. Auch am Produzieren. […] Das gewonnene Terrain ist längst wieder verloren. Daß ich in meinem Geschriebenen alles, mich ganz, geben müsse, diese Anstrengung übersteigt alles. Daneben bleibt nichts. Ich kann nicht mehr im Garten arbeiten, keine Wanderungen machen, wenn ich darüber schreiben will, auch das krieg ich nicht mehr hin. – Als es nicht ums schreiben ging, da konnte ich machen, was mir einfiel, und sei es schreiben, und konnte es tun. – Jetzt ist mir da wieder ein regelrechter Leistungszwang angewachsen.” (Helmut Salzinger: Nackter Wahnsinn. Die Wirklichkeit und die Suche nach ihr zwischen Konsens und Nonsens. Hamburg: Verlag Michael Kellner, 1984, S. 154.) Das Schreiben ist, wenn es mit Ernst betrieben wird, ein lebensgefährlicher Beruf.
Schleuse
Wednesday, 19. November 2008Genauigkeit
Tuesday, 18. November 2008In diesem Weblog kommt es auf jedes i-Tüpfelchen an. Das mag manchem lässigen Zeitgenossen wie Pedanterie erscheinen, ich halte es dennoch für meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, einwandfreie Arbeit abzuliefern, wenn ich auf diesem Wege schon vor die Weltöffentlichkeit trete. Die verbreitete Schluderei, die einem in diesem neuen Medium allenthalben ins Auge springt, empfinde ich als einen üblen Missbrauch von Möglichkeiten der unbeschränkten Mitteilung, nach denen sich unsere sorgfältigeren Ahnen die Finger geleckt hätten.
An einem konkreten Beispiel will ich verdeutlichen, wie weit meine Fürsorge für die Richtigkeit meiner hier veröffentlichten Texte geht. In meinem Artikel AtD II.8 stand bis heute der Satz: „Der Arzt Leslie E. Keeley (1834[?]-1900) gründete 1879 in Dwight (Illinois), 110 Kilometer südwestlich von Chicago, ein Sanatorium für Suchtkranke.” Das Fragezeichen in eckigen Klammern war nötig, weil die Internetquellen zu besagtem Dr. Keeley unterschiedliche Geburtsjahre angaben: 1832, 1834 und 1836. Ich entschied mich vorläufig für den Mittelwert, wenngleich mir bewusst blieb, dass dies ein fauler Kompromiss war.
Da Keeleys Sanatorium in Dwight, die Keimzelle seines Gesundheits-Imperiums, noch immer existiert, schrieb ich mit Unterstützung meiner Lektorin dorthin einen Brief: “Dear Sir or Madam, A friend of mine and I are doing some research concerning certain facts in Thomas Pynchon’s novel Against the Day, and we have also come across Dr. Leslie E. Keeley and his cure. – We do know that he opened his first sanatorium at Dwight in 1879, we do know that he died in 1900, and we do know several more facts – but we do not know when he was born. Different internet sources give different dates of birth: some tell us it was in 1832, others say it was in 1834, still others claim it was in 1836. It seems that Dr. Keeley died in L. A. but was buried in Dwight. This leads to our request: Could it be possible to get a photograph of his tombstone (if there is one still) proving his date of birth? – We would very much like to thank you in advance for answering our letter! – Yours sincerely, M. H.”
Die Antwort folgte wenige Tage später per E-Mail: “Manuel, I was given your letter on Monday by the Dwight Village Administrator. I am the one who takes care of genealogy requests that come to Dwight. This evening we went over to the Dwight Historical Society Museum to look on the newspaper microfilm records for Dr. Keeley’s obituary. This states that he was born in 1832. I made a copy of the whole page obituary to send to you via US postal service mail. I also copied the article that appeared in the newspaper the following week about his funeral to send to you. Yes, he is buried in Dwight. We will go out to the cemetery within the next few days and photograph the Keeley tomb for you. It is a big one. He was a very important person in Dwight. I assume the address on the top of your letter is the correct one to send the articles to. Please email us to make sure you wish to have these mailed to you. For this service, we would appreciate a small donation to the historical society. Marylin Thorsen”. Ich schickte einen Zehn-Dollar-Schein per Post nach Dwight und erhielt gestern die Todesnachricht und den Nachruf auf Leslie E. Keeley (Dwight Star and Herald, Vol. XXXV, 24. Februar und 4. März 1900).
Dort heißt es klipp und klar: “Leslie E. Keeley was born in Potsdam, N. Y., in 1832.” Da diese Jahreszahl aus einer zeit- und ortsnahen Quelle stammt, ist ihr wohl am ehesten zu trauen, weshalb ich sie für meinen Beitrag nun als gesichert übernehme. – Ich habe an diesem Einzelfall zeigen wollen, wie sehr mir an der sachlichen Richtigkeit und Genauigkeit aller meiner Veröffentlichungen in diesem Weblog gelegen ist. Dies scheint mir auch deshalb kein müßiges Unterfangen, weil sich gerade in Internet-Publikationen eine allgemeine Schlampigkeit epidemisch ausbreitet, die in wenigen Jahren zu einer erschreckenden Degression journalistischer Qualitätsstandards geführt hat. Es steht allerdings zu befürchten, dass eine stetig wachsende Zahl von Lesern die Einhaltung solcher Standards in Zukunft gar nicht mehr zu schätzen wissen wird.
[Titelbild: Leslie E. Keeley, LL. D.; aus: Dwight Star and Herald.]
Abrakadabra
Monday, 17. November 2008Ob das Zauberwort nun „Segne, heilger Wunderspruch” (aus dem Hebräischen von bracha und dabar) bedeutet, sich von der arabischen Beschwörungsformel abreq ad habra, dem „Donner, der tötet” ableitet oder, was mir am liebsten wäre, auf das aramäische Avrah KaDabra zurückgeht, zu Deutsch: „Ich werde erschaffen, während ich spreche” – seit Urzeiten gilt Abrakadabra als geheimnisvoller Bannfluch gegen das Böse, gegen Blitzschlag, Krankheit und finstere Mächte. Ich kenne es seit meiner frühesten Kindheit von der Kasperl-Bühne her, wo es der Zauberer, seinen schwarzen Stab schwingend, zu einem blechernen Donnergrollen aussprach: „Abrakadabra – dreimal schwarzer Kater!”
In neuerer Zeit, von Aleister Crowley bis Joanne K. Rowling, stehen diese elf Buchstaben für die magische Wirksamkeit des Unverständlichen, Rätselhaften, für die irrationale Heilkraft scheinbar bedeutungsloser Glossolalie. Im Grimmschen Wörterbuch kommt das Wort nicht vor, aber in meinem Großen Brockhaus von 1953, schon auf Seite 26 des ersten Bandes, wo es „allgemein” als Synonym für „verworrenes Gerede oder Geschreibsel” steht. Und dann gibt es da noch den „Nigger Vojan, der mal in Chicago bei einem Würfelspiel 175.000 Dollar gewonnen und an drei Stellen Abrakadabra eintätowiert hatte”, in Dashiell Hammetts Story The Big Knockover. (Dt. in Raubmord. A. d. Am. v. Renate Steinbach. Frankfurt am Main / Berlin: Ullstein, 1969, S. 56.)
Abrakadabra ist, sei es wie es will, eine gute Überschrift für die geheime, geheimnisvolle, irrationale Struktur, die diesem Weblog zugrunde liegt und die unablässig wächst und wuchert, in alle Richtungen, nicht als ein von Anfang an vorgegebenes Prinzip, sondern als ein organisch sich anpassendes System, ebenso buchstabengetreu wie unberechenbar, mir selbst als seinem Schöpfer ein ewiges Rätsel, der ich mich alltäglich von den Winkelzügen des Schicksals überraschen lasse.
Dass alles mit allem zusammenhänge, ist nur eine dumme Redensart. Dass aber manches mit diesem und jenem in Verbindung zu bringen ist, mag schon eher mit Fug und Recht zu behaupten sein.
Zusammenhänge sind in diesem Weblog nicht beabsichtigt, können aber beim besten Willen nicht ganz vermieden werden. Und wie sonst allüberall steckt auch hier der Teufel im Detail.
Literarische Soiree
Sunday, 16. November 2008Meine achte Essener Wohnung (1. April 1988 bis 18. September 1991) war ein Schnäppchen: ein Altbau im Stadtwald mit einem riesigen Wohnzimmer, parkettiertem Fußboden, vielen Fenstern, hohen Decken, einer endlos langen Wand für meine ständig wachsende Bibliothek – wie geschaffen, um dort gelegentlich Feste zu feiern oder auch Gäste zu Veranstaltungen einzuladen. Ich packte die Gelegenheit beim Schopfe und lud vom 1. April 1989 regelmäßig zum Ersten eines jeden Monats meine an Literatur interessierten Freunde zu abendlichen Vorlesungen ein, die ich Literarische Soireen nannte und bei denen ich zu Gehör brachte, was mich selbst gerade begeisterte:
1989 I Eröffnungsprogramm 1. April – II Geschlecht & Gute Sitte 1. Mai – III Erleuchtungen 1. Juli – IV Totentanz 1. August – V Walter Serner: Hirngeschwuere 1. September – VI Der schwarze Fleck: Melancholie 1. Oktober – VII Das große Treffen 1. November – VIII Tolstoj: Die Kreuzersonate 1. Dezember 1990 IX Romane des Jahres 1989 1. Januar – X Gemeinheiten Reime Ungereimtheiten 1. Februar – XI Rendezvous im Zoo 1. März – XII Oskar Panizzas Urwald 1. April – XIII Der weiße Fleck: Arctica 1. Mai – XIV S/M 1. Juni – XV Sechs Beispiele für sechs Gattungen 1. August – XVI Spannungen 1. September – XVII Ziegeuner 1. Oktober – XVIII Frauen 1. November – XIX Vier Rosen für Gertrude Stein 1. Dezember 1991 XX Romane des Jahres 1990 1. Januar – XXI Männlein oder Weiblein? (mit Susanne Peter-Stierle) 1. Februar – XXII Streitigkeiten 1. März – XXIII Melville: Bartleby 1. April – XXIV Zwanzig Roman-Anfänge aus hundert Büchern 1. Mai – XXV Rückblick auf vierundzwanzig Soireen 1. Juni – XXVI Kafka: Ein Hungerkünstler 1. Juli – XXVII Poe: In schlimmer Klemme & Grube und Pendel 1. August – XXVIII/XXIX Puschkin: Dubrowskij 1. September / 1. November – XXX Rimbaud: Das trunkene Schiff 1. Dezember 1992 XXXI Romane des Jahres 1991 1. Januar – XXXII Liliput 1. Februar – XXXIII David Carkeet: Die ganze Katastrophe 1. März – XXXIV/XXXV Lawrence: Der Zigeuner und die Jungfrau 1. April / 1. Mai – XXXVI Das Floß der Medusa 1. Juli – XXXVII SOS 1. August – XXXVIII Ein schiefes Bild von Thomas Mann 1. September – XXXIX Lichtenberg: Sudeleien 1. Oktober – XL Oscar Wilde: Der eigensüchtige Riese & Die Nachtigall und die Rose 1. November – XLI Kalendergeschichten 1. Dezember 1993 XLII Romane des Jahres 1992 1. Januar – XLIII Die Blinden 1. Februar – XLIV-XLVII Nabokov: König Dame Bube 1. März bis 1. Juni – XLVIII In Sachen Felsch ./. Schmidt 1. Juli – IL Das zwanzigste Jahrhundert in Tagebuchblättern vom ersten August 1. August – L Hunger auf Hamsun 1. Oktober – LI Buchstabensuppe 1. November – LII Häppchen 1. Dezember 1994 LIII Roman des Jahres 1993 1. Januar – LIV Echolot 1. Februar – LV Pfennigfuchsereien und markige Wörter 1. März – LVI Suchsogsüchte 1. April – LVII Menschen-Esser 1. Mai – LVIII Der verlorene Hain: Früheste Kindheiten 1. Juli – LIX Geburt 11. Juli – LX Die Elemente (Folge 1 / Blei): Hans Henny Jahnn 1. August – LXI Träume 1. September – LXII/LXIII Nerval: Aurelia 1. Oktober / 1. November – LXIV Alfred Hitchcocks Vorlagen 1. Dezember 1995 LXV Bücher des Jahres 1994 1. Januar – LXVI Von den Neffen & Nichten 1. Februar – LXVII Die Jungfernfahrt der Titanic 1. März – LXVIII Wasserwerfer unterm Regenbogen 1. Mai – LXIX Vom Gehen 1. Juni – LXX Nachrichten aus Nord und Süd 1. Juli – LXXI Künstliche Paradiese I: Bhang 1. August – LXXII Alfred Döblin: Ein weiteres Feld in achtzehn Krumen 1. September – LXXIII Klemperer / Rühmkorf: Zwei Tagebücher 1. Oktober – LXXIV Cechov: Die Reise nach Sachalin 1. November – LXXV Wilhelm Busch 1. Dezember 1996 LXXVI Reisemärchen und Märchenreißer der Brüder Grimm 1. Juni – LXXVII Rausch der Sprache: Gedichte von Kurt Schwitters 11. Juli – LXXVIII Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 1. September – LXXIX Brecht: Gedichte 2. Oktober – LXXX Der Kuss in Theorie & Praxis 1. November – LXXXI Falsch verbunden! 1. Dezember 1997 LXXXII Helden in Not. Ein Romanfeuerwerk 1. Januar – LXXXIII-LXXXVI Gombrowicz: Die Besessenen 1. Februar bis 1. Mai – LXXXVII Max Kommerell: Das verbesserte Biribi & Was ist der Mensch? 1. Juni – LXXXVIII Hundert Jahre Wilhelm Reich 1. Juli – LXXXIX Künstliche Paradiese II: Opium & Psychotomimetica 1. August – XC Vom Glück 1. Oktober – XCI Über Bücher 1. November 1998 XCII Todesarten 1. Februar – XCIII Mord & Totschlag 1. März 1999 XCIV Peinlichkeiten 1. Januar – XCV Die Wiener Gruppe 1. Februar – XCVI Schluss! 1. April 2002 XCVII Fünf Grotesken 1. November 2003 XCVIII Krieg 1. Mai – IC Inger Christensen: Das 1. November 2004 C Zwei Erzählungen aus tausendundeiner Nacht 1. Mai 2005 CI Hans Christian Andersen zum 200. Geburtstag 1. April 2008 CII Ein Interview / Alice Schwarzer und André Müller (mit Michaela Coerdt) 1. Mai CIII Alfred Polgar 1. August CIV Zwei Orgasmen 1. November.
Als wir im September 1991 leider wieder einmal umziehen mussten, suchten wir uns eine Wohnung aus, zu der ein großes Souterrain gehörte. Die Literarischen Soireen waren gerettet! Eintrittsgeld habe ich nie genommen – ich war vielmehr meinen Gästen dankbar, dass sie diese sehr „anspruchsvollen” Rezitationsabende über sich ergehen ließen und manche von ihnen mir viele Jahre lang die Treue hielten, ganz gleich, auf welchen Wochentag der Erste zufällig fiel. – Hier die alphabetische Liste dieser vielen Heldinnen und Helden des aufmerksamen Zuhörens:
STEPHANIE ABTMEYER CHRISTOPH ALBRECHT KLAUS APPEL CHRISTIANE ARNDT ANNE-KATHRIN BALSCHEIT THOMAS BÄRMANN KARL BAUER IRENA BAYER STEFAN BAYER MATTHIAS BEITSCH ELKE BEYER HANNELORE BOBE ANDREAS BÖGEL DAGMAR BOHNENKAMP EVA BRANDECKER GEB. GLUNZ GESA BRASTER RITA BRAUN SUSANNE BRAUN THOMAS BRAUN ANNETTE BREITHAUPT TOM BREITHAUPT KARIN BREITHAUPT GÜNTER BREITHAUPT EVA BRESLEIN TOM BRIELE CHRISTOPH BUHL ELISABETH BUHL NORBERT BUHL BOŻENA CHOŁUJ LUDGER CLAßEN MICHAELA COERDT ROBERTA CORRENTI WOLFGANG CZIESLA DÉDÉ ULRICH DEUTER PETRA DIEHL MARTIN DISTELKAMP KAMILLUS DREIMÜLLER ARMIN EICHENHART SABINE ELBERT ANNE EL-HASSAN BUSCHE ERIK ELKE FASTENRATH CHRISTIANE FELDMANN CORNELIA FISCHER TOM FORGER CHRISTINA FRANKENBACH SUSANNE FREESE AMELIE FREYTAG SHIRLEY FÜLLBRUNN EDZARD FÜLLBRUNN HEINRICH FUNKE MICHAEL FUNKE MONIKA FUNKE EVA GABRIEL HERBERT GALLE GERDA GEBAUER-FUNKE TANJA GEBHART HARTMUT GEERKEN SANDRA GELLINGS BRIGITTE VAN GEMMEREN CHRISTOF GERVINK MAITE GERVINK ROYHIEH GHORBAN PAULI GIRARDET GERD GOCKEL-FELDMANN SABINE GÖDERSMANN-HINSENKAMP PETER GOERTZ BEATE GOLLNOW ECKHARD GOLLNOW ELKE GREVEL ULRIKE GÜHNEMANN REINHILD GUSY THOMAS HAMANN MONIKA HANISCH THOMAS HANNAPPEL WERNER HANNAPPEL KAREN HANNAPPEL UTA HANSEN BEATRIX HANSON-WEIß WOLF HAUG ELISABETH HEEG-RASCHE ANDREAS HEITMANN SIBYLLE HEITMANN DIETMAR HEMMERDEN GUDRUN HILTERHAUS GERD HINSENKAMP SASCHA HÖHNE-MÜLLER ASTRID HORST HANS-DIRK HOTZEL EMANUELA HOUMOUDA MICHAEL HUHN ERIKA JAENSCH MARIANNE JAKOBS IMAN JAUER RITA JURGENS-KRÜSSMANN STEFANIE JUNCKER MATEJ KELC THOMAS KERKEWITZ BIRGIT KERNEBECK HANNELORE KESSEL KLAUS KIEFER HERBERT KLEIN JOHANNES KLINGEN ANDREAS KLODT ANJA KNECHT RALF KOBER-SONDERFELD BARBARA KÖHLER GABI KOHN CLAUDIA KÖRNER DIETRICH KOSKA CHRISTOPH KRONE HOLGER KRÜSSMANN ANNETTE KUHLMANN CARSTEN KÜMPERS ANGELA KUNERT-PFISTERER ANDREAS KUNZE GÜNTER LANDSBERGER & GATTIN GRETE LAVIER ROLF-DIETER LAVIER JÜRGEN LECHTRECK HOLGER LEISTNER GEORG LÜMMEN BEATE LÜTTENBERG-BAUER SANDRA MAROTTA FRIEDHELM MARX CLAUDIA MERKEL MECHTHILD MERZNICH-SCHÖNEWEIS ANTJE MEYER KLAUS MEYER HEINER MEYER AUF DER HEYDE RUTH MEYERING GABRIELE MÜLLER HELMUT MÜLLER MARTINA MÜLLER THOMAS NEUHAUS HEIDE NIEMANN DIRK NOTTEBAUM KLAUS OERTERS ARZUM ÖZDEMIR EMIN ÖZYURT JALE ÖZYURT CHRISTIAN PAULSEN BEATRIX PESCHKE SUSANNE PETER-STIERLE DETLEF PEUSER-BRAUN JÜRGEN PFISTERER KAREN PIENE ILSE PIETRASS REINHARD PIETRASS DAVID PORSCH RENATE PORSCH IRINA PORZLER VIOLETTA POSSÉL EVA POSPISIL GEB. REIMANN SABINE PREUß SIMONA PROTTI RUPRECHT PÜLZ MICHAEL RASCHE HEIKO RATH ROLF REXHAUSEN STEFANIE REXHAUSEN FRANZ WILHELM ROHDE JUTTA ROHDE SILVIA RÜHL-HAUG JULIA RÜTHER VALERIA SASS SYLVIA SCHACHOW RAPHAELA SCHEIDMANN BEATE SCHERZER REINER SCHIEFLER CHRISTINA SCHLEGEL KATHARINA SCHLIMMGEN-EHMKE EVA SCHMIDT SUSANNE SCHMITZ BETTINA SCHNEIDER KLAUS SCHROER SABINE SCHWIETERT ANNE SILKENAT-GRAHE REGINE SOLIBAKKE ROSE SOMMER SUSANNE SONDERFELD GUDRUN STEMPELMANN-BLANKENHAUS TILL SUPAN MICHEL TAFFIN GITTA TAPPERT MAGDA TARONI MICHAEL THOMAS JOCHEN THORANT WOLFGANG TIETZE HAKKI TOKER BIRGIT TOKER EDITH TOKER TIMI TOPUZI EVA TRÖSTRUM TANIA VOLLMER MANFRED VOLLMER VALENTIN VOLLMER EVA WEBER NORBERT WEHR HARTMUT WEYH SABINE WIENERT GABRIELE WILPERS KERSTIN ZIMMERMANN SABINE ZIX & DIE VIELEN VERGESSENEN UND UNENTZIFFERBAREN
Seit dem 1. Januar 2005 wohnen wir nun in meiner zehnten Behausung. Literarische Soireen finden nur noch sporadisch statt, wenn nämlich der Erste des Monats auf einen Freitag oder Samstag fällt. Doch wenn der Zufall mich wieder einmal begünstigt, dann findet diese Veranstaltungsreihe vielleicht schon bald eine neue Heimat. Mein Repertoire ist ja reichhaltig genug – und über einen Mangel an Projekten und Ideen für zukünftige Vorleseabende kann ich nicht klagen.
Geschlossen
Saturday, 15. November 2008Dorfgeschichte (II)
Friday, 14. November 2008Sieben Wochen nach seiner fristlosen Kündigung als Intendant der Essener Philharmonie hat Michael Kaufmann vorgestern zu den gegen ihn in einem dezidierten Fragen- und Antwortkatalog der Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP) erhobenen Vorwürfen Stellung bezogen. Sich bei einer öffentlichen Pressekonferenz den Medienvertretern zu stellen, dazu reichte offenbar die Courage nicht. Stattdessen vermittelte der wirtschaftlich gescheiterte Konzerthaus-Chef seine Sicht der Dinge vor einem kleinen Kreis handverlesener Medienvertreter, sekundiert von seinem Anwalt, denn schließlich muss Kaufmann fürchten, dass jedes falsche Wort in dem nun bevorstehenden Arbeitsgerichtsverfahren gegen ihn verwendet wird.
Letzteres kann ich ihm nicht verübeln, schließlich hat auch die TuP ihren Katalog mit dem Vorbehalt versehen, „dass es sich bei diesem Papier nicht um eine juristische, sondern um eine rein informatorische Zusammenstellung handelt.” Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, und Scherben hat es in dieser unseligen Affäre ja nun wahrlich schon genug gegeben. Außerdem kennen beide Seiten wohl das alte Sprichwort: Coram iudice et in alto mare in manu dei soli sumus. Bei aller gebotenen Neutralität des vorurteilsfreien Beobachters einer solchen Posse komme ich aber auch nach Kenntnisnahme von Kaufmanns Gegendarstellung zu keinem neuen Ergebnis. Im Vergleich zu den detailliert nachgewiesenen Pflichtversäumnissen des Intendanten, mit Zahlen, Daten und Fakten, nimmt sich seine Selbstverteidigung sehr dürftig aus. Wenn ihm nicht mehr einfällt, als die Hauptschuld an seinen eklatanten Etatüberschreitungen dem vermutlich nicht mehr haftbar zu machenden TuP-Geschäftsführer Otmar Herren in die Schuhe zu schieben, der im Sommer dieses Jahres in den Ruhestand ging, dann kann Kaufmann mir fast schon wieder leidtun. Und dass er gar die ausgewiesenen und mittlerweile auch von der Düsseldorfer Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft Warth und Klein testierten Zahlen, die unterm Strich für die beiden letzten Spielzeiten eine Etatüberschreitung von 1.700.000 € ausweisen, achselzuckend hinnimmt, mit Kommentaren wie „im Wesentlichen nicht in meiner Verantwortung” und „kenne ich im Einzelnen gar nicht” – dann ist das doch mindestens für den gut dotierten Kaufmann Kaufmann ein Armutszeugnis.
Dass die Wogen nun überhaupt so hoch schlagen, hat zweifellos seinen Grund darin, dass Michael Kaufmann andererseits ein großartiger Impresario dieser Kulturinstitution gewesen ist. Der international renommierte Dirigent Kurt Masur meint zum Beispiel, Kaufmann sei „der fähigste und wertvollste Intendant, den es in Deutschland gibt”. Und auch das feinnervige und hochgebildete Publikum der Essener Philharmonie steht treu zu seinem Ex-Intendanten und versammelt sich zu einer „Solidaritätsbekundung” anlässlich des besagten Pressegesprächs vorm Sheraton-Hotel neben der Philharmonie, um mit einem kleinen Ständchen dem Wunsch Ausdruck zu verleihen, dass Kaufmann seine Arbeit fortsetzen solle. Einerseits rührt diese fromme Hoffnung unser kunstsinniges Herz zu Tränen, andererseits zählt uns der Verstand in Heller und Pfennig vor, dass ein solcher Wunsch kaum realisierbar sein dürfte.
Halbwegs realistisch ist hingegen das Fazit, das der Essener Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Reiniger zur „Episode Kaufmann” an der Essener Philharmonie jüngst gezogen hat: „Das Problem des Michael Kaufmann besteht darin, dass dieser im persönlichen Umgang so gewinnende Mensch nicht willens und bereit war, finanzielle Vorgaben zu akzeptieren und sowohl das Programm der Philharmonie als auch sein persönliches Ausgabeverhalten hieran auszurichten. Es ist die intellektuelle Arroganz des Künstlers, der glaubt, sich über alles hinwegsetzen zu können.” (Leider nur halbwegs realistisch, lieber Herr Oberbürgermeister, denn statt „des Künstlers” hätte es richtiger wohl „des Kunstmanagers” heißen müssen. Ansonsten kann ich Ihrem Statement aus meiner jetzigen Sicht auf die Dinge, wie sie nun mal liegen, durchaus zustimmen.)
Wie weit sich aber bornierte Hochkultur-Fanatiker in ihrem Feuereifer zu geschmacklosen Vergleichen versteigen konnten, das hat mich anlässlich dieser Provinzposse dann doch überrascht – als ich nämlich lesen musste, mit welchen Worten der Verleger und Herausgeber Theo Geißler (*1947) in seinem Hausorgan Neue Musikzeitung – nmz diese Stellungnahme des Essener Oberbürgermeisters kommentierte: „Das Vokabular wird langsam gespenstisch, mit dem sich Essens Stadt-Obere vom gefeuerten Philharmonie-Intendanten Michael Kaufmann zu distanzieren suchen. Mit Formulierungen aus dem Repertoire der Reichs-Kulturkammer mischt sich jetzt Essens OB Wolfgang Reiniger in die Diskussion. Nach Rückkehr von einer Reise mit einer städtischen Delegation nach Tunis (zu viel Sonne?) erklärte Oberbürgermeister Wolfgang Reiniger zur Diskussion um den ehemaligen Philharmonie-Intendanten Michael Kaufmann … [es folgt das besagte Reiniger-Zitat]. Mit dem Vorwurf ,intellektueller Künstler-Arroganz‘ begründeten seinerzeit unter anderem die Nazis Bücherverbrennungen, Aufführungsverbote, Vertreibungen. Wie weit ist es in Essen gekommen, dass die Verantwortlichen für die Ausrichtung der Kulturhauptstadt 2010 vermutlich auch noch unbewusst in den Argumentations-Dreckkübel der kulturlosesten Zeit unserer jüngeren Geschichte greifen müssen? Sind in der Administration unserer ,Kulturhauptstadt 2010‘ nur noch geschichtslose Dilettanten und Erbsenzähler am Werk? Hart wie Kruppstahl[,] aber ein wenig weich in der Birne?” Um zum Reiniger-Kommentar anlässlich der Entlassung eines Philharmonie-Intendanten die Hetzreden der Goebbels-Meute bei der Bücherverbrennung in der Nazi-Zeit zu assoziieren, dazu bedarf es wohl schon eines gerüttelten Maßes an historischer Verblendung. Unwillkürlich musste ich bei diesem maßlosen Vergleich an den Fauxpas des Präsidenten des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung Hans-Werner Sinn (*1948) denken, der neulich die in die Kritik geratenenen Manager des Spätkapitalismus mit den verfolgten Juden im Dritten Reich gleichsetzte. – Gewährt die „Gnade der späten Geburt” (Helmut Kohl) eine Generalabsolution für Geschmacklosigkeit? Dann will ich sie jedenfalls nicht für mich reklamieren, obwohl noch ein paar Jahre jünger als die beiden hier erwähnten Herren.
Popularität (I)
Thursday, 13. November 2008Anfang 1966 erschien in einer Londoner Tageszeitung ein Interview, das der Beatle John Lennon der Reporterin Maureen Cleave, einer guten Freundin, gegeben hatte. Nach seinen Ansichten zum Thema Religion befragt, schwang sich der damals bereits weltberühmte Popstar zum Propheten auf: “Christianity will go. It will vanish and shrink. I needn’t argue about that; I’m right and I will be proved right. We’re more popular than Jesus now; I don’t know which will go first – rock’n’roll or Christianity. Jesus was all right but his disciples were thick and ordinary. It’s them twisting it that ruins it for me.” (Maureen Cleave: How Does a Beatle Live? John Lennon Lives Like This; in: Evening Standard v. 4. März 1966; Hervorhebung von mir.)
Ob Lennons Behauptung, die Beatles seien populärer als Jesus, für das Jahr 1966 zutraf, lässt sich nicht überprüfen, doch seit es Google gibt, kann man immerhin sehr einfach per Suchabfrage ermitteln, wieviele Belegstellen zu „Beatles” und zu „Jesus” im weltweiten Internet heute zu finden sind. Die Band aus Liverpool bringt es dort auf 59,9 Millionen Treffer, der Nazarener auf mehr als das Dreifache (183 Mio.). Ein solcher „Googlefight” ist übrigens auch auf einer kleinen animierten Website gleichen Namens im Internet verfügbar.
Dieser Popularitätstest ist aufschlussreich und je nach Gemütslage erheiternd oder deprimierend. Nachfolgend ein paar Beispiele, wie der Kampf „Hochkultur der Weltgeschichte vs. Trivialmythen der neueren Zeit” ausgeht (alle Zahlen in Mio.):
Sokrates vs. James Bond 3,0 : 37,3
Leonardo da Vinci vs. Ronaldinho 9,7 : 23,1
Shakespeare vs. Madonna 41,3 : 92,9
Philosophen vs. Rapper 3,8 : 21,6
Askese vs. Shoppen 0,5 : 14,0
Karl Marx vs. Karl May 6,4 : 10,1
Hamlet vs. Harry Potter 18,7 : 79,2
Orgel vs. Percussion 5,3 : 25,7
Julius Caesar vs. Barack Obama 3,1 : 94,2
Pyramiden vs. World Trade Center 1,4 : 31,1
Ich überlasse den geneigten Leser für ein paar Tage seinen eigenen Erwägungen und melde mich dann wieder zum gleichen Thema, wenn meine Melancholie verflogen ist und ich fähig bin, diesen Abstimmungsergebnissen der Web-Community mit wieder erstarktem Geist vielleicht ein paar nüchterne Erkenntnisse abzugewinnen.
[Fortsetzung: Popularität (II).]
Panizza
Wednesday, 12. November 2008Der erste Exzentriker, mit dem ich mich vor nunmehr dreißig Jahren eingehend beschäftigte, war Oskar Panizza (1853-1921): ein glühender Antipapist, der (1895-1896) für sein satirisches, „gotteslästerliches” Drama Das Liebeskonzil ein Jahr Gefängnisstrafe in Amberg abbüßen musste, dann nach Zürich ins Exil ging, wo er ab 1897 seine kuriosen Zürcher Diskußjonen im Selbstverlag herausgab, um nach einer Anzeige wegen Unzucht mit einer minderjährigen Prostituierten mit seiner 10.000 Bände umfassenden Privatbibliothek weiter nach Paris zu fliehen. Halbwegs bekannt geworden war Panizza bei seinen zeitgenössischen Lesern durch seine düsteren Erzählungen in der Tradition von E. T. A. Hoffmann und Edgar Allan Poe, durch seine Dämmerungsstücke (1890) und Visionen (1893).
Was mich damals an Panizza entzückte, das waren sein radikales Einzelgänger- und Außenseitertum, der mutige Trotz, mit dem er allen weltlichen und himmlischen Mächten die Stirn bot, seine bis in die „Ortografie” hinein eigenwillige Schreibweise, die imposante, offenbar autodidaktisch erworbene Vielbelesenheit und schließlich sein sarkastischer Fürwitz. Dass André Breton diesen Meister des schwarzen Humors in seiner Anthologie de l’humour noir (1940, dt. 1971) nicht berücksichtigt hat, scheint mir noch heute unverzeihlich.
Oskar Panizzas nicht ganz schmales literarisches Œuvre – Wilpert-Gühring I verzeichnet immerhin 22 Erstausgaben – galt damals in den Antiquariaten als „selten und gesucht” und war somit für einen arbeitslosen Schulabbrecher wie mich völlig unerschwinglich. Wie groß war daher meine Freude, als ich entdeckte, dass die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf nahezu alle Werke des verehrten Autors im Bestand führte und auch auslieh. Und wie groß war mein Entsetzen, als ich dort in einer halbledergebundenen Kompilation der drei frühen Gedichtbände von Oskar Panizza – Düstre Lieder (1886), Londoner Lieder (1887) und Legendäres und Fabelhaftes (1889) – auf dem Vorsatzblatt den Stempel entdeckte: „Eigentum Reichsleiter Bormann”; und darunter in Bleistift dessen eigenhändige Unterschrift.
Diese Irritation hielt mich aber nicht davon ab, wenig später nach Berlin zu reisen und in der „Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz” weiterhin dem verehrten Exzentriker nachzuforschen. In deren Handschriftenabteilung ließ ich mir Panizzas lange verschollen geglaubten Spätling Imperjalja vorlegen, darin der im Pariser Exil immer tiefer in geistige Umnachtung versinkende Schriftsteller 1903 bis 1904 seinen persönlichen Hass und seine paranoiden Spekulationen gegen Kaiser Wilhelm II. zu Papier gebracht hat. Eine freundliche Bibliothekarin, die vermutlich von dem Feuereifer dieses ganz unakademischen jugendlichen Forschers gerührt war, schickte mir wenig später per Post eine Kopie der Mikroverfilmung dieses Manuskripts. Da ich natürlich nicht über ein Lesegerät für einen solchen Film verfügte, zerschnitt ich ihn in Einzelbilder und klemmte sie in Dia-Rähmchen, um anschließend via Projektor das Spätwerk meines Herrn und Meisters Wort für Wort von der Leinwand herab zu dechiffrieren.
Wie so viele Projekte aus dieser Zeit meines jugendlichen Überschwangs blieb auch dieses in den Anfängen stecken. Jürgen Müller hat zwei Jahrzehnte später diese mühevolle Arbeit, an der ich scheiterte, zu einem sehr erfreulichen Ende gebracht und das „Manuskript Germ. Qu. 1838″ mustergültig transkribiert und editiert. Das letzte Buch von Oskar Panizza, bevor er endgültig verrückt wurde, erschien 1993 im Guido Pressler Verlag in Hürtgenwald in der Reihe „Schriften zu Psychopathologie, Kunst und Literatur” – und wurde vor ein paar Jahren beim Bärendienst Buchversand für nur 14,00 Euro verramscht.
Durcheinander
Tuesday, 11. November 2008Uwe Johnson erzählt in seinem Hauptwerk Jahrestage die Geschichte von der Ermordung Robert Kennedys vor vierzig Jahren auf seine ihm sehr eigene Weise. Aus der Perspektive seiner Heldin Gesine Cresspahl. Unter anderem in der Form von Notizen ihrer Tochter Marie zu einem Aufsatzthema der Klasse 6b. (Uwe Johnson: Jahrestage. Band 3. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1973, S. 1281 ff.)
Das habe ich eben noch mal nachgelesen, in dem mir vom Autor am 14. März 1982 gewidmeten Exemplar dieses Buches. Johnson hält die Biographien von Robert Francis Kennedy (1925-1968) und Sirhan Bishara Sirhan (* 1944) gegeneinander, die verschiedener nicht sein könnten und sich dennoch an einigen Stellen berühren. „Nicht geraucht, nicht getrunken, kaum mit Mädchen gegangen” heißt es dort (S. 1302) über den 21-jährigen Robert. Und vom zwanzig Jahre jüngeren Sirhan liest man zur Zeit kurz vor seiner Tat: „Raucht nicht, trinkt nicht. Kann keinen Befehl ertragen.” (S. 1305)
Die Urne mit der Asche von Robert liegt seit vierzig Jahren auf dem Nationalfriedhof Arlington im US-Bundesstaat Virginia. Der verurteilte Mörder Sirhan lebt seit ebenfalls vierzig Jahren in einer Zelle des Hochsicherheitstrakts der Strafvollzugsanstalt Corcoran im US-Bundesstaat Kalifornien – sozusagen Zelle an Zelle mit Charles Manson.
„Auf dem Wege zur Pressekonferenz, in einem Küchenkorridor wurde er von hinten in den Kopf geschossen. […] Lag auf dem Boden, die Frau kniete neben ihm. Die Sache mit dem Rosenkranz.” (Johnson, a. a. O., S. 1299) – Doch hier irrt der Dichter. Neben dem sterbenden Robert Kennedy kniete keine Frau, sondern der mexikanische Hoteldiener Juan Romero (17); und er war es, der seinen Rosenkranz aus der Tasche zog, um ihn in die Hand des tödlich verletzten Präsidentschaftskandidaten zu legen.
Vermutlich wurde das Bild, das Uwe Johnson sich ein paar Jahre später von diesem Ereignis machte, von einem anderen, fast auf den Tag genau ein Jahr älteren überblendet [siehe Titelbild]. So fließt eins ins andere. Und es ist nicht mehr zu trennen, was gut und böse, was wahr und falsch ist; wer im Recht und wer ein Sünder war; wer Verderben säte und wer die Rettung hätte bringen können. Je genauer wir auf die Vergangenheit schauen, desto verwirrender erscheint sie uns. Nur jene Zeitgenossen, die getrübten Blicks nach einer Erklärung für das Gewesene suchen, finden schnell ihren Seelenfrieden. Die kleine Minderheit der gründlicheren Zuschauer, der ich mich verbunden fühle, quält sich tagtäglich damit ab, mehr zu finden als eine billige Lösung vom ideologischen Patentamt. Aber welche?
Mittwoch, 5. Juni 1968: 34°3′ N, 118°15′ W
Tuesday, 11. November 2008Der Tag war gerade fünf Minuten alt, als ein aus christlichem Elternhaus stammender, 24 Jahre alter Palästinenser namens Sirhan Bishara Sirhan in der Kaltküche des Ambassador Hotel in Los Angeles aus seinem Iver-Johnson-Revolver .22 caliber Cadet 55-A alle acht Kugeln abfeuerte und mit den ersten drei den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Robert F. Kennedy, lebensgefährlich verletzte. Kennedy starb trotz aller ärztlichen Bemühungen 26 Stunden später im Krankenhaus.
Das politisch motivierte Attentat ist ein tragisches „Markenzeichen” des vergangenen Jahrhunderts und hat dessen Verlauf nicht unwesentlich beeinflusst, ganz gleich, ob die Anschläge auf das Leben von mächtigen Entscheidungsträgern nun „glückten” oder scheiterten. Hätte Adolf Hitler am 8. November 1939 nur eine Viertelstunde länger im Münchner Bürgerbräukeller verweilt, dann wären vielleicht durch Georg Elsers Bombe Millionen unschuldige Menschenleben gerettet worden. Und hätte Sirhans Pistole im Ambassador versagt, dann wäre der erst 42-jährige Robert F. Kennedy vielleicht statt Richard M. Nixon zum 37. Präsidenten der USA gewählt worden, der Vietnamkrieg wäre sieben Jahre früher beendet worden und infolgedessen hätten 30.000 US-Soldaten und weit mehr als eine Million Vietnamesen nicht unnötig ihr Leben lassen müssen.
Dass die mörderische Tat eines einzelnen Menschen, wenn er nur den „Richtigen” zum günstigsten Zeitpunkt niederstreckt, für Millionen Menschen so folgenreich sein kann, ist für viele Zeitgenossen nicht hinnehmbar. Darum ranken sich um die berühmten Attentate des 20. Jahrhunderts regelmäßig Verschwörungstheorien, die zu beweisen suchen, dass hinter den oft unbedarften Wirrköpfen mächtige Drahtzieher am Werke waren. Hinter dem Anschlag des Türken Mehmet Ali Ağca auf Papst Johannes Paul II. wurden beispielsweise die sowjetischen Geheimdienste KGB und GRU und der Staatssicherheitsdienst der DDR vermutet. Auch Lee Harvey Oswald, der Mörder von John F. Kennedy, konnte nach der festen Überzeugung solcher Skeptiker nicht mehr als ein „Sündenbock” gewesen sein. Sie brachten wahlweise Kennedys Vize und Nachfolger Lyndon B. Johnson, die CIA, die Mafia, Fidel Castro oder US-amerikanische Privatbankiers als Hintermänner des Attentats ins Gespräch. Und regelmäßig stecken in diesen und ähnlichen Fällen immer die Ermittlungsbehörden und Gerichte mit den vermeintlichen Verschwörercliquen unter einer Decke.
Ich halte von all diesen bestrickend zusammenfabulierten Theorien, was ihren Wahrheitsgehalt betrifft, grundsätzlich nichts, lese sie aber dennoch gern, als Liebhaber phantasie- und liebevoll erzählter „moderner Märchen”. Schließlich sind sie ja auch bedeutend interessanter und geheimnisvoller als die tristen Geschichten nichtssagender Einzeltäter, deren Motive angesichts der Folgen ihrer Taten so furchtbar kümmerlich erscheinen.
Wenn es aber eine Lektion für die Zukunft gibt, die uns die Attentate der vergangenen hundert Jahre erteilen, dann ist es die beängstigende Einsicht, dass auch der bestgeschützte Politiker in der „Freien Welt” und „Offenen Gesellschaft” kaum gegen einen Mordanschlag durch einen entschlossenen Einzeltäter zu schützen ist. Offen gestanden hat es mich insofern überrascht, dass Barack Obama den fast zwei Jahre währenden Wahlkampf bis zu seiner erfolgreich errungenen Präsidentschaft wohlbehalten überstanden hat.
Uhr aus
Monday, 10. November 2008In § 6, Abs. 8c der Laws of Chess des Weltschachbundes FIDE (Fédération Internationale des Échecs) in der letzten, gegenwärtig gültigen Fassung vom 1. Juli 2005 heißt es: “The players must handle the chess clock properly. It is forbidden to punch it forcibly, to pick it up or to knock it over.” Unfreiwillig komisch lautet die offizielle deutschsprachige Version dieses Passus: „Die Spieler müssen die Schachuhr angemessen behandeln. Es ist verboten, auf sie draufzuhauen, sie hochzuheben oder umzuwerfen.” Offenbar kommen solche handgreiflichen Wutausbrüche gegen die gnadenlos davonlaufende Zeit und ihr unschuldig objektives Messgerät bei Schachturnieren in aller Welt häufig vor, sonst bedürfte es im Regelwerk ja nicht eines solchen drohenden Fingerzeigs.
Nachdem die FIDE vor acht Jahren beschlossen hatte, die Bedenkzeit der Schachspieler zu verkürzen, denen seither in Turnierpartien für die ersten 40 Züge nur noch 75 Minuten zur Verfügung stehen, plus 30 zusätzliche Sekunden pro Zug und 15 Minuten für den Rest der Partie, nahm der Schachhistoriker Ernst Strouhal dieses Zugeständnis an die medialen und organisatorischen Forderungen der Gegenwart zum Anlass, in dem „kulturellen Schachmagazin” KARL einen geistreichen Artikel zum Thema „Schach und Zeit” zu veröffentlichen. Sein Titel: Schach im Zeitalter der Ungeduld.
Strouhal erinnert daran, dass Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Eisenbahnen in England schon pünktlich auf die Minute verkehrten, Schachpartien noch keinerlei zeitlicher Begrenzung unterworfen waren und gelegentlich bis zu 20 Stunden dauern konnten. Lange Zeit hinkte das Schachspiel den fortwährenden Tempoverschärfungen unterm Zwang der industriellen Massenproduktion hinterher. Schließlich galt das Spiel ganz allgemein ja traditionell als ein mußevoller Ausgleich zur Arbeit und der Unrast des Erwerbslebens, als ein freier Spielraum unbeschwerten Vergnügens, wo die drückende Last der schmerzlich erkannten Vergänglichkeit und das drohende Unheil der Endlichkeit – wenngleich auch diesmal nur vorübergehend und für kurze Zeit – beiseitegeschoben werden konnte.
Dass nun, 150 Jahre später, das allmächtige Postulat der Zeitökonomie auch das Spiel unter seine Kontrolle gebracht hat, mag man beklagen, doch ist diese Entwicklung wohl unaufhaltsam und kaum umkehrbar. „Eine Geschichte der Zeit im Schachspiel könnte zeigen, dass das Spiel nicht nur ein Ort der Freiheit und Kontrast zur Welt der Arbeit ist,” so Strouhal, „sondern bei aller Autonomie auch ihr getreuliches Echo. Wenn heute gelebt und gearbeitet werden soll wie in einer Blitzpartie, warum sollte dann das Schachspiel anders aussehen?”
Als Motto für seinen Aufsatz hat Ernst Strouhal die Tempoangabe Robert Schumanns zu einem seiner Klavierstücke gewählt: „Schnell, noch schneller, so schnell wie möglich.” – Als anachronistisches Gegenstück zu diesem zeitgemäßen Kommando und trotzige Antwort darauf fällt mir der Titel eines Feuilletons von Hans Siemsen aus dem Jahr 1930 ein: „Nein – langsam! Langsam!” Uhr aus.
Ein Remiseur
Sunday, 09. November 2008Am kommenden Mittwoch, dem 12. November, wird in Dresden die 38. Schacholympiade eröffnet, das größte Schachturnier der Welt, das seit 1927 im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgetragen wird. Diesmal kämpfen über 2.000 Spielerinnen und Spieler aus 152 Nationen um die begehrten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Einer der stärksten Spieler der zwanzigköpfigen deutschen Nationalmannschaft ist der 29 Jahre alte Großmeister Jan Gustafsson (ELO 2620), der aus diesem Anlass ein ausführliches Interview gegeben hat. (Michael Eder: „Im Pokern ist mehr zu holen als im Schach”; in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Nr. 45 v. 9. November 2008, S. 24.)
Nahezu alles, was Gustafsson über das Schachspiel sagt, mehr aber noch, wie er es sagt, erregt meinen leidenschaftlichen Widerspruch. Schon das Motiv, sich für eine Karriere als Schachprofi und gegen sein Jurastudium zu entscheiden, ist mir suspekt: „[…] wenn man faul ist und irgendwann merkt, da kannst du sogar ein bisschen Geld damit verdienen, dann ist das ganz verlockend. Es ist ein angenehmer Lebensstil, man kann ausschlafen, reisen.” (Konsequenterweise hat Gustafsson sich nebenher auch dem professionellen Pokerspiel zugewandt und 2007 gemeinsam mit dem niederländischen Zocker Marcel „The Flying Dutchman” Luskey [auch Lüske] ein Buch zu diesem Spiel veröffentlicht: Poker für Gewinner.)
Mit beeindruckender Offenheit bekennt Gustafsson: „[…] vom Spielstil her neige ich eher zur Feigheit, das ist ein negatives Wort, sagen wir: zur Vorsicht. Im Schach gibt es ja die Möglichkeit des Remis. Es gibt zwei Typen von Schachspielern, es gibt die, die gern gewinnen, und die, die nicht gern verlieren. Es gibt spekulative Spieler, die versuchen, das Gleichgewicht zu stören. Ich gehöre zu den anderen, den Korrekten, den Risikovermeidern. […] Mir machen Niederlagen immer sehr zu schaffen, vielleicht bin ich deshalb auch übervorsichtig. Ich fand schon immer Verlieren viel schlimmer als Nicht-Gewinnen.” Wie schrecklich! Wenn alle Schachspieler mit der gleichen Einstellung am Brett säßen wie Gustafsson, dann gäbe es bald nur noch Remis-Partien – und das Schach wäre ein totes Rennen ohne jede Spannung, ohne jeden Reiz.
Dazu passt, was der junge Mann auf die Frage antwortet, welches seine schönste Partie gewesen sei: „Ich habe im Schach nicht so den Zugang zu Schönheit. Ich freue mich über jeden Sieg, und wenn ich gewonnen habe, bin ich zufrieden. Mir ist es eigentlich egal, ob das ästhetisch war oder nicht, ob das ein Fallrückzieher war oder ein Abstauber, das ist mir wurscht. Ich berausche mich nicht an schönen Kombinationen.” Solche lässigen Bekenntnisse machen mich tatsächlich sprachlos.
Wie kann man dieser edlen Kunst sein Leben widmen – ohne eine Spur von Leidenschaft? Und es offenbar auf diesem Weg, mit solch einer furztrockenen Grundeinstellung zum „königlichen Spiel”, langfristig bis an die Weltspitze der Großmeister schaffen? Dieses Interview stimmt mich einerseits traurig, bestätigt mich aber andererseits in meiner Auffassung, dass die interessanten, aufregenden und ästhetisch reizvollen Schachpartien längst nicht mehr zwischen den mit allen Wassern der Eröffnungstheorie gewaschenen Profispielern geboren werden, sondern – wenngleich auch dort nur äußerst selten – im Mittelspiel der Dilettanten.
Panik
Saturday, 08. November 2008Einer der wesentlichsten Gründe, warum ich Schach spiele: Weil ich hoffe, dabei etwas über mich selbst herausfinden zu können. Eine vermeidbare Verlustpartie ist zwar immer schmerzhaft, doch werden die eingebüßten ELO-Punkte oft von dem Erkenntnisgewinn mehr als aufgewogen. Vorgestern spielte ich in der „Schacharena” als Schwarzer gegen den schwächeren Mike Lariah (ELO 1362) – und verlor. Hier der für mich sehr lehrreiche Verlauf dieser vor Fehlern auf beiden Seiten strotzenden Partie.
1. d2-d4 d7-d5 2. e2-e4. – Ich bin, was die Eröffnungstheorie angeht, vollkommen unbeleckt. Was ich bereits in meinem zweiten Zug ausprobiere, muss wohl gänzlich wertlos sein, denn es kommt in der ECO-Liste der gebräuchlichen Spielweisen gar nicht erst vor: 2. … e7-e6. (Stattdessen wird laut ECO-Code D00 hier grundsätzlich 2. … d5xe4 gespielt, das Blackmar-Gambit.) 3. Sb1-c3 Sg8-e7 4. Sg1-f3 d5xe4 5. Sc3xe4 Se7-d5 6. Lf1-b5† Lc8-d7 7. Lb5-c4 h7-h6 8. Se4-c5.
Kaum hatte die Partie begonnen, schon befand ich mich in arger Bedrängnis. Die Bedrohung meiner Dame durch 9. Sc5xb7 wollte ich nicht hinnehmen und zog darum 8. … Lf8xc5 9. d4xc5 0-0 10. b2-b4. – Jetzt schon 10. … Sd5xb4 zu spielen, schien mir zu riskant, stattdessen sicherte ich zunächst erst mit 10. … a7-a6 11. Lc1-b2 Sd5xb4 und stand doch jetzt eigentlich mit einem Mehrbauern nicht schlecht da.
12. Dd1-d4? – Hier sah ich nun nur noch das drohende Matt durch 13. Dd4xg7 – und übersah fatalerweise die einzig richtige Antwort 12. … b4xc2†, durch die ich zu dem weiteren Bauern auch die Dame hätte kassieren und damit die Mattdrohung aus der Welt schaffen können. Zwar hätte ich nach 13. Ke1-d2 Sc2xd4 14. Sf3xd4 einen Springer verloren, aber bei diesem Stand wäre die Partie für mich wohl so gut wie gewonnen gewesen. Stattdessen ging es nun weiter abwärts, weil mich die Panik blind gemacht hatte: 12. … f7-f6 13. 0-0-0 c7-c6 14. Sf3-e5.
Ich war durch den verpassten Damengewinn völlig aus dem Gleichgewicht gebracht und übersah, dass ich hier ohne Gefahr 14. … f6xe5 hätte spielen können, denn 15. Dd4xe5 hätte mich nach Tf8-f6 vorläufig nicht in Bedrängnis gebracht. Weiter diktierten Frustration und Panik mein Spiel: 14. … Tf8-e8? 15. Dd4-g4 Dd8-a5?? (Was mache ich da nur? Besser gewesen wäre doch beispielsweise 15. … g2-g4. Aber offenbar trauerte ich noch immer dem verpassten 12. Zug nach, statt mich mit der längst nicht aussichtslosen Situation abzufinden und meine Chancen zu nutzen.) 16. Se5xd7 Sb8xd7 17. Td1xd7 Da5xc5?? 18. Dg4xg7 matt. – Danach war ich für mindestens eine Stunde sehr schlecht gelaunt. Übrigens stand ich überhaupt nicht unter Zeitdruck. Das Spiel dauerte gerade mal 16 Minuten, bei 30 Minuten Bedenkzeit für jeden Spieler. Mein spielentscheidendes Defizit wurde dabei offenkundig: Was mir fehlt, nicht nur auf dem Schachbrett, ist Gelassenheit.
Dorfgeschichte (I)
Friday, 07. November 2008Leider viel zu spät veröffentlicht jetzt die Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP) einen „Fragen- und Antwortkatalog” zur fristlosen Entlassung des Intendanten der Philharmonie Essen, Michael Kaufmann, die deren 13-köpfiger Aufsichtsrat am 23. September mehrheitlich (mit fünf Stimmenthaltungen) beschlossen hat. Wer die ausführlichen Antworten auf die dort gestellten 17 Fragen vorurteilsfrei zur Kenntnis nimmt, kann kaum zu einem anderen Ergebnis kommen: Die Kündigung von Kaufmann war nicht nur berechtigt, sondern auch hoch an der Zeit. Und selbst gegen den Vorwurf, dass sie zu spät erfolgt sei, muss man die Befürworter des Antrags, die sich mit ihrem Votum glücklicherweise durchgesetzt haben, in Schutz nehmen. Sie haben damit Courage bewiesen und einen allerdings schmerzlichen und unpopulären Schritt vollzogen, was ihnen nachträglich gar nicht hoch genug anzurechnen ist. (Und ich habe ihnen in meinem ersten Beitrag zu diesem Thema wohl in einigen Punkten Unrecht getan, was sie durch ihre behäbige Informationspolitik allerdings selbst verschuldet haben.)
Der Vorwurf des „Provinzialismus”, der sich gegen diese einzig richtige Entscheidung erhob, fällt nach Veröffentlichung dieses Katalogs auf die unsachlichen Lamentierer zurück, die in den folgenden Tagen unisono in einen empörten Krakeel verfielen, allen voran auf unser meinungsführendes Provinzblättchen mit Millionenauflage, die WAZ, mit ihrem der deutschen Sprache nur für den Hausgebrauch seines Arbeitgebers mächtigen Zampano Wulf Mämpel, der mit seinen wetterwendischen Meinungsäußerungen als „Schaf im Wolfspelz” unter dem Pseudonym Lupus tagtäglich bei seinen treuen Lesern, den Wertschätzern unfreiwilliger Komik, für Erheiterung sorgt.
Den Leserbriefschreibern und Blogkommentierern, die sich zu diesem „peinlichen Eklat” äußerten, dürfen wir ihre unbedarften Stellungnahmen nicht verübeln, denn sie wissen es ja nicht besser, da sie schließlich in ihrer meinungsbildenden Grundversorgung auf besagtes Krawallblatt und seine gleich tönenden Ableger angewiesen sind.
Dass unser aller Boulevard-Berthold vom hohen Hügel herab über den Entscheid der „Wilden Dreizehn” die Nase rümpfte und dem verantwortungsvoll handelnden Gremium der TuP postwendend einen Tritt in den Hintern verpasste, das ist wiederum provinziell und weit eher mit der Gattungsbezeichnung „Schmierenkomödie” zu versehen als der gut begründete Kaufmann-Rausschmiss, der mehrfach so genannt wurde. Doch für Beitz gilt ja längst unumschränkte Narrenfreiheit, er schwebt als „Guter Gott von Ruhropolis” über den unruhigen Wassern der Kulturhauptstadt – und niemand außer einem Enfant terrible wie mir, das nichts mehr zu verlieren hat, traut sich – auch eine Art von Narrenfreiheit – ihm auf seine alten Tage dies zu sagen. „Sancta senilitas!”
Die tiefste Niederung der Provinzialität wurde aber schon zuvor durchschritten, als sich der prominenteste Mann des TuP-Aufsichtsrats, der Kulturdezernent der Stadt Essen und Geschäftsführer der RUHR.2010 GmbH, Oliver Scheytt, bei der Abstimmung am 23. September seiner Stimme enthielt (vgl. WAZ Nr. 236 v. 9. Oktober 2008). Das ist nicht mehr nur provinziell, diese Feigheit hat schon dörflichen Charakter: „Was sollen bloß die Nachbarn denken?” Ich bin, durchaus im wörtlichen Sinn, Nachbar dieses stimmlosen Entscheiders. So steh ich hier und kann nicht anders, als zu sagen und zu bekennen: „Du bist ne Kneifbüx, Olli!”
Stunde Null
Thursday, 06. November 2008So sehr ich den „Internetmarktplatz für antiquarische Bücher” in den vergangenen zehn Jahren schätzen gelernt habe – das Stöbern in den nicht-virtuellen Angeboten möchte ich dennoch nicht missen. Während ich dort, bei ZVAB und anderen Anbietern, in aller Regel finde, was ich gezielt suche, entdecke ich in den Regalen der Antiquariate, auf den Büchertischen der Trödelmärkte und in den Ramschkisten der Buchhandlungen gelegentlich Schmankerl, die mir auf meinen gründlich geplanten Wegen durch die Literatur niemals begegnet wären. – So zieht mich seit ein paar Tagen ein Buch in seinen Bann, das ich vor der Tür eines hiesigen Großbuchhändlers zum Spottpreis von nur 3,95 € aus dem Kasten vor der Tür fischte: Stunde Null. Deutschland unter den Besatzungsmächten. Berlin: Matthes & Seitz, 2004.
Die Namen der beiden Autoren, Tüngel und Berndorff, sagten mir nichts – und vermutlich aus gutem Grund, gehörten sie seit den 1960er-Jahren, als sich mein politisches Bewusstsein zu entwickeln begann, doch keineswegs zur damals tonangebenden intellektuellen Elite der Linken. Richard Tüngel (1893-1970) war zwar von den Nazis 1933 aus seinem Amt als Baudirektor in Hamburg gedrängt worden, musste aber als Mitbegründer und späterer zweiter Chefredakteur der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit nach der von ihm veranlassten Veröffentlichung eines Artikels des NS-Staatsrechtlers Carl Schmitt und nach seinem Veto gegen einen kritischen Beitrag über den amerikanischen „Kommunistenjäger” Joseph McCarthy dort seinen Hut nehmen. Und auch sein Freund Hans Rudolf Berndorff (1895-1963), der unter dem Pseudonym Rudolf van Wehrt national-heroische Bücher über die Schlacht bei Tannenberg (Wie Hindenburg die Russen schlug, 1922) und über den siegreichen „Blitzkrieg im Westen” (Frankreich auf der Flucht, 1941) geschrieben hatte, konnte sich nach der deutschen Niederlage nicht damit legitimieren, in der Zeit der Verblendung zum „inneren Widerstand” gehört zu haben. Beide überstanden offenbar die langen zwölf Jahre des kurzen Tausendjährigen Reichs zwischen Hoffen und Bangen, wie Millionen betrogener „Volksgenossen” mit ihnen – und fanden sich wieder in einem Scherbenhaufen. Auf die nationale Megalomanie folgte ein Absturz ins Nichts, in die totale Ohnmacht, in Not und Armut.
In ihrem gemeinsamen Buch, das zuerst 1958 unter dem Titel Auf dem Bauche sollst du kriechen im Christian Wegner Verlag in Hamburg erschienen ist und in der Neuauflage um ein Nachwort des ungarischen Essayisten und Literaturkritikers László F. Földényi ergänzt wurde, schildern die beiden Verfasser, Kapitel für Kapitel abwechselnd, ihre Erlebnisse und Erfahrungen als Journalisten im besetzten Deutschland der Jahre von 1945 bis 1949. Berndorff erlebt von September bis November 1945 als Prozessbeobachter in Lüneburg das erste große Gerichtsverfahren gegen die KZ-Verbrecher und anschließend den Nürnberger Prozess (ab November 1945). Tüngel kämpft währenddessen in Hamburg um Publikationsmöglichkeiten und um eine unabhängige deutsche Presse. Die erbärmlichen materiellen Bedingungen, unter denen sie ihrem Beruf nachgehen, werden in aller Drastik deutlich – aber auch die geradezu sklavische Abhängigkeit von den Besatzern, ohne deren Goodwill gar nichts geht.
Einiges war dabei für mich auch in der Sache durchaus neu und erhellend. So hatte ich mir zum Beispiel nie recht klargemacht, mit welch düsteren Erwartungen die Generation meiner Eltern und Großeltern in den späten 1940er-Jahren in die Zukunft blickte. Die Besiegten waren offenbar mehrheitlich davon überzeugt, dass die Besatzungszeit und ihre Entmündigung als Bürger eines selbstbestimmten Volkes viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte andauern würde. Sie gingen außerdem fest davon aus, dass es mindestens ebenso lange dauern würde, bis die deutsche Wirtschaft und Industrie wenigstens wieder den Stand der Vorkriegszeit erreichen würde. Sie waren vollkommen entmutigt, ohne jede Perspektive, bar jeder Hoffung auf ein menschenwürdiges Leben. Und selbst intelligente Menschen wie Berndorff und Tüngel, mit relativ unbehindertem Zugang zu den Informationsquellen der „Siegermächte”, teilten diese pessimistische Ansicht. Erst vor dem Hintergrund dieser deprimierenden kollektiven Gemütslage wird das Wunderbare am „Wirtschaftswunder” der 1950er-Jahre so recht verständlich.
Berndorff zitiert die Aussage des SS-Hauptsturmführers Dieter Wisliceny vor dem Tribunal in Nürnberg, die ich ebenfalls noch nicht kannte. Ende Februar 1945 war Wisliceny seinem Vorgesetzten Adolf Eichmann zum letzten Mal in Berlin begegnet. Er wurde gefragt, ob Eichmann damals irgendetwas über die Zahl der getöteten Juden gesagt habe. Wisliceny: „Ja, er drückte das in einer besonders zynischen Weise aus. Er sagte, er würde lachend in die Grube springen, denn das Gefühl, daß er fünf Millionen Menschen auf dem Gewissen hätte, wäre für ihn außerordentlich befriedigend.” (S. 150) Und gerade vor dem Hintergrund, dass in dieser Woche der Spiegel groß mit einer Titelstory über Heinrich Himmler aufmacht, der dort dämonisierend als „Hitlers Vollstrecker” verkauft wird, ist sehr lesenswert, was Berndorff über die Vernehmung von Ernst Kaltenbrunner, Chef des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA), in Nürnberg schreibt (S. 195-204). „,Heydrich war viel intelligenter und noch entschlossener als Himmler‘, sagte Kaltenbrunner im Zeugenstand.” Nicht Himmler, diese „kleine Leuchte”, sondern der musisch begabte Intellektuelle Reinhard Heydrich war das Zentralgestirn des Bösen am faschistischen Firmament. Aber dessen „Biografie eines Dämons” hat ja der Stern schon vor sechs Jahren ausgeschlachtet.
[Titelbild vom Schutzumschlag des besprochenen Buches: Der Goetheforscher Ernst Beutler mit seinem Sohn in der Ruine des Frankfurter Goethe-Hauses, Sommer 1945.]
Pullunder
Wednesday, 05. November 2008Der „personifizierte Durchblick” (Isolde Schaad 1999) hat dem Spiegel wieder einmal ein Interview gegeben, „über die aus der Finanzkrise geborenen Schreckensszenarien, die Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus an unterschiedliche Staatsformen und die Langeweile von Spielcasinos”, wie es im dreizeiligen Untertitel heißt. Der Spiegel zahlt vermutlich gut. Anders wäre kaum zu erklären, warum sich ein längst pensionierter „Vordenker der Linken” wie Hans Magnus Enzensberger (78) zu einem solchen Plauderstündchen hergibt. (Matthias Matussek und Markus Brauck: „Phantastischer Gedächtnisverlust”; in: Der Spiegel Nr. 45 v. 3. November 2008, S. 76-78.)
Zur Weltwirtschaftskrise, die spätestens seit dem Crash der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers Inc. am 15. September 2008 Realität geworden ist und die die „Bewusstseins-Industrie” (Enzensberger 1970) euphemistisch eine Finanzkrise zu nennen sich mittlerweile angewöhnt hat – zu diesem Thema fallen HME, dem einstmaligen „Wasserzeichen für geistige Erstklassigkeit” (Schaad), zwar allerlei flotte Sprüche, provokante Aperçus und naseweise Eulenspiegeleien ein. Aber unterm Strich bleibt dem Leser seiner schadenfrohen Sticheleien nur der fade Nachgeschmack eines selbstzufriedenen Grandseigneurs, dessen Gleichgültigkeit gegenüber der Zukunft sich noch einen pikanten Akzent verleiht: Ich hab’s doch schon immer gewusst!
Enzensberger konstatiert „Zyklen von Boom und Crash, von Größenwahn und Panik” und hält diesen beständigen Wetterwechsel der ökonomischen Verhältnisse für ein Naturgesetz des Kapitalismus: „Das war schon immer so.” Und er streut, posierend im knallroten Pullunder [siehe Titelbild], hier eine „Prise Marxismus” und dort „die eine oder andere Brechstange aus der Werkstatt des Herrn Marx” in seine pessimistischen Verzichtserklärungen auf jede positive Utopie ein. Offenbar hat sich HME damit arrangiert, dass die Welt und mit ihr seine erlesene Andere Bibliothek zu Grunde gehen muss. Kinder hat er ja wohl keine, insofern ist solche Abstinenz kein Kunststück. Dass Enzensberger nun aber auf seine alten Tage ausgerechnet an einem Filmprojekt (von Peter Sehr) über das Leben von Georg Christoph Lichtenberg mitwirkt, lässt mich schaudern. Wäre Schopenhauers Vita nicht ein geeigneteres Sujet gewesen?
Ich hätte ja aber schon längst gewarnt sein müssen, als rechtschaffener Großaktionär mit spekulativen Optionen auf zukünftige Werte. In seinem Gedicht Paxe finden sich die Zeilen: „Mühselige sind es und Beladene / aus Wuppertal und Chicago. / Weiß der Himmel, warum / sie vergessene Götter verehren, / wofür sie Vergebung suchen / und wundertätige Heilung.” (Zit. nach du. Die Zeitschrift der Kultur; Heft Nr. 699 v. September 1999, S. 50.)
Nein, der Himmel weiß es nicht. Schon damals war Enzensberger offenbar ratlos und überfordert. Dieses Versagen kann man sich nur leisten, wenn man mit dem Leben abgeschlossen hat. Und dann sollte man besser schweigen. So groß kann das Spiegel-Honorar doch wahrlich auch wieder nicht gewesen sein.
Konfluenz
Tuesday, 04. November 2008Für diesen Nonsens, der den imponierenden Namen Degree Confluence Project trägt, bedurfte es zweier geodätischer Errungenschaften der Neuzeit: erstens der Einführung eines verlässlichen Koordinatensystems aus Breiten- und Längengraden, das jedem Punkt auf dem Globus eine eindeutige, zweiteilige Zahl aus Grad, Minuten und Sekunden zuweist; und zweitens der technischen Entwicklung eines weltweit funktionierenden Messsystems mittels künstlicher Satelliten und erschwinglicher Empfangsgeräte der von ihnen ausgesandten Signale, das eine präzise, auf die Gradsekunde genaue Ortung ohne großen Aufwand und besondere Fähigkeiten erlaubt.
Die erste Voraussetzung war im Wesentlichen 1884 erfüllt, als sich der Null-Meridian durch Greenwich als willkürlich festgesetzte Bezugsgröße für die Längengrade gegen bis dahin konkurrierende Koordinaten durchsetzte. Nach der Inbetriebnahme des Global Positioning Systems (GPS), das im April 1995 seine volle Funktionsbereitschaft erreichte, sollte nur noch ein knappes Jahr vergehen, bis der Amerikaner Alex Jarrett das Degree Confluence Project aus der Taufe hob. Am 20. Februar 1996 begab er sich mit seinem Freund Peter Cline an den Schnittpunkt des 43. nördlichen Breiten- und des 72. westlichen Längengrads und hielt die Lokalität und das Ereignis dieser Eroberung in ein paar Fotos fest. Damit war der erste Konfluenzpunkt „im Kasten” und der Startschuss zu einem weltweiten Wettrennen abgefeuert, dessen Ende vorläufig noch in den Sternen steht.
Schließlich gibt es auf der Erdkugel exakt 64.442 Konfluenzpunkte, von denen 21.543 an Land, 38.409 auf Meeresflächen und 4.490 im Bereich der Polkappen liegen. Ein Konfluenzpunkt ist per definitionem der Schnittpunkt eines ganzzahligen Längen- und eines ebensolchen Breitengrades. Die Aufgabe, die sich den Teilnehmern an diesem Projekt stellt, lautet in wenigen Worten: „Suche einen bislang noch nicht dokumentierten Konfluenzpunkt auf, fotografiere von diesem Punkt aus in alle vier Himmelsrichtungen die umgebende Landschaft, stelle die Authentizität deiner Eroberung durch ein Foto von der Digitalanzeige deines GPS-Geräts unter Beweis und veröffentliche diese Fotos, wenn möglich ergänzt durch einen Erfahrungsbericht, im Internet.”
Dieser Einladung folgten in den vergangenen zwölf Jahren zahlreiche Konfluenzpunkt-Jäger in aller Welt. Mittlerweile kann man sich schon Umgebungsbilder von über 6.000 ganzzahligen Koordinaten-Schnittpunkten ansehen. Das auf den ersten Blick erstaunlichste Ergebnis einer solchen Weltbetrachtung ist, dass nur auf einer verschwindend kleinen Teilmenge dieser Bilder Spuren menschlicher Existenz auszumachen sind. So ist der erst vor zehn Tagen „eroberte” Punkt 32° N und 36° O in der Stadt Marka [siehe Titelbild, Blickrichtung gen Norden], nur wenige Kilometer von der jordanischen Hauptstadt Amman entfernt, eine seltene Ausnahme. Meist sieht man auf den Bildern nichts als unberührte Natur: Wald, Steppe, Wüste – und Wasser.
Bei der Betrachtung dieser vielen menschenlosen Bilder wurde mir so deutlich wie nie zuvor, dass wir an grenzenloser Selbstüberschätzung leiden. So gravierend uns selbst die Spuren erscheinen mögen, die wir in unserer gerade einmal 6.000 Jahre währenden Karriere als Spezies mit einem im Verhältnis zu unserem Körpergewicht beeindruckend schweren Gehirn auf der Oberfläche „unseres” Planeten hinterlassen haben, so marginal sind doch diese Zeichen unserer vorübergehenden Dominanz der belebten Natur auf Terra. Und so erteilt uns in unserer Hybris Befangenen dieses Nonsens-Projekt nebenbei eine wertvolle Lektion. Wenn das nicht tröstlich ist …
[Einen früheren Blogbeitrag zum gleichen Thema veröffentlichte ich bei Westropolis, er ist dort Anfang 2011 der Komplettlöschung zum Opfer gefallen. Eine überarbeitete Fassung dieses Artikels findet der interessierte Leser hier.]
Pedifest (I)
Monday, 03. November 2008[1] In der Flanerie kehrt der Mensch, am Ausgang des inhumanen Zeitalters grenzenloser Beschleunigung, zu seiner ihm gemäßen Bewegungsform zurück. Der Flaneur, die Flaneuse von heute sind Pioniere bei der Erprobung jener natürlichen Fortbewegung, die nach dem unausweichlichen Zusammenbruch der automatisierten Mobilitätsgesellschaft allein noch übrig bleiben wird. Zugleich sind sie die ersten Wiederentdecker jener archaischen Erfahrungsmöglichkeiten vor Erfindung des Rades, als noch der Schritt und nicht die Umdrehungszahl den Rhythmus menschlichen Lebens und Erlebens bestimmte.
[2] Mit der Heimkehr zum Gehen und der Abkehr vom Fahren und Fliegen leisten Flaneur und Flaneuse bewussten Verzicht auf eine Bequemlichkeit, die von Anbeginn ihrer Entwicklung auf Kosten der natürlichen Umwelt ging. Neben dem Raubbau an der Natur nahmen die Passagiere der immer schneller werdenden Fahrzeuge aber auch eine schleichende Zerstörung ihrer Sinnlichkeit hin. Der vermeintliche Komfort des Ortswechsels stahl den durch die Landschaft katapultierten Körpern einen großen Teil ihres unmittelbaren Empfindens. Die Flanerie ist das Projekt der Rückeroberung dieser verlorenen Welt.
[3] Die Erfahrung der Langsamkeit ist die ursprünglichste Passion des Flanierenden, seine Leidenschaft und zugleich sein bewusst gelebtes Leiden. Unsere allein auf Schnelligkeit zugerichtete Umwelt erlebt er von außen, als Außenseiter und Anachronist, spürt unmittelbar ihre morbide Hässlichkeit, Schmutzigkeit, Verkommenheit. So gewinnt er eine unverstellte Einsicht in den Zustand dieser menschgemachten Wirklichkeit, die den vorbeirasenden Gefangenen in ihren Fahrgastzellen lebenslänglich fremd bleiben muss. Flanieren ist somit in einer hierfür nicht ausgelegten Realität das Beschreiten, Beschreiben eines Passionswegs.
[4] Flaneur und Flaneuse der urbanisierten Welt zu Beginn des dritten Jahrtausends sind keine Romantiker mehr wie ihre Vorgänger seit Charles Baudelaire. Zwar mag sich der gebildetere Teil von ihnen mit Sympathie auf die großen Vorbilder besinnen: auf die Spaziergänger Johann Gottfried Seume und Robert Walser, auf die großstädtischen Flaneure der 1920er-Jahre wie Walter Benjamin, Franz Hessel, Victor Auburtin, Siegfried Kracauer, Hans Siemsen und Walther Kiaulehn – oder gar auf einen nahezu völlig unbeachteten Tippelbruder im Geiste wie Hans Jürgen von der Wense. Doch die Zukunft des Flanierens sieht notgedrungen anders aus.
[5] Nebenbei hält auch eine philosophische Avantgarde den schützenden Schirm übers Haupt des modernen Flaneurs. Hierzu zählen nicht erst die französischen Situationisten um Guy Debord und Raoul Vaneigem, sondern viel früher schon die Peripatetiker der Antike und der Wandersmann Giordano Bruno. In neuester Zeit haben sich Denker wie Günther Anders, Paul Virilio, Joseph Weizenbaum und Neil Postman um die erkenntnistheoretische Durchleuchtung des „rasenden Stillstands” und der zunehmenden Virtualisierung unserer Lebenswelt verdient gemacht. Doch das Lesen ist nur eine Entspannungsübung nach der Arbeit: dem Flanieren.
[Fortsetzung: Pedifest (II).]
Dingwelt (VI)
Tuesday, 28. October 2008Dies sind die beiden Gegenstände, die als allererste in meinen Besitz gelangten und noch immer zu meinem Eigentum an beweglichen Sachen gehören: Der Löffel und die Gabel aus Silber mit meinem eingravierten Vornamen waren ein Geschenk meiner Großeltern väterlicherseits zu meiner Geburt.
Messer, Gabel, Schere, Licht /sind für kleine Kinder nicht! Dieser „Zuchtreim” unbekannter Herkunft, der für den Beginn des 20. Jahrhunderts nachgewiesen, aber vermutlich bedeutend älter ist und noch ganz in der Tradition der „Schwarzen Pädagogik” (Katharina Rutschky 1977) steht; dieser Spruch, der auch gut in Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter (1844) stehen könnte, fällt mir ein, wenn ich die Gabel betrachte. Ihre stumpfen Zinken lassen den Warnhinweis in diesem Punkt obsolet erscheinen, nachdem schon das Wort „Licht” als Synonym für „offenes Feuer, Flamme” längst antiquiert und kaum einem Kind mehr verständlich war. (Erstaunlich übrigens, dass der altertümliche Reim 1965 durch den gleichnamigen Schlager von Vicky Leandros, ihren allerersten Hit, eine Wiederauferstehung erleben durfte – als Metapher für die Gefahren vorehelichen Geschlechtsverkehrs.)
Nicht mehr in meinem Besitz befindet sich eine kleine Kinderschere, an die ich mich noch sehr gut erinnere, weil sie eins meiner Lieblingsspielzeuge war. Auch sie hatte abgerundete Spitzen, was mich allerdings nicht hinderte, eines Sonntagmorgens – meine Eltern schliefen noch – mit dem Scherchen mein blond gelocktes Kopfhaar, meine Augenbrauen und sogar meine Wimpern zurechtzustutzen.
Das silberne Löffelchen wäre mir vor etlichen Jahren um ein Haar abhandengekommen. Bei einer nächtlichen Fete in meiner Wohnung hatte sich eine Besucherin, die ich nur flüchtig kannte, so sehr in diesen Löffel verliebt, dass sie mir allerlei verlockende Angebote machte, wollte ich ihn ihr überlassen. Der Ausgang dieses Kampfes mit meinem inneren Schweinehund ist offenkundig [siehe Titelbild], das Schicksal der erfolglosen Sirene hingegen war wohl unausweichlich. Sie starb bald darauf am „Goldenen Schuss”.
Das silberne Gäbelchen hingegen ist auf seine alten Tage neuerdings wieder in Gebrauch und findet eine vergleichsweise ganz unschuldige Verwendung. Wenn mein Enkel, gut ein Jahr alt, gelegentlich über Nacht bei uns zu Gast ist, dann jauchzt er wie ein Schneekönig, sich mittels solch noblen Bestecks an seinem Gemüsebrei delektieren zu dürfen.
Jacob
Monday, 27. October 2008
In gewissen Kreisen des individualistischen Anarchismus wird er in seinem Heimatland Frankreich noch heute als Held verehrt, hierzulande ist er hingegen nahezu unbekannt: Alexandre „Marius” Jacob (1879-1954), der „anarchistische Meisterdieb”, der angeblich Maurice Leblanc als Vorbild für seinen berühmten Gentleman-Einbrecher Arsène Lupin gedient haben soll.
Als der 17-jährige Alexandre Jacob, an einem rätselhaften Virus erkrankt, seine erste Berufstätigkeit als Matrose aufgeben muss, hat er schon viel von der Welt gesehen. Im zarten Alter von elf Jahren hatte er als Schiffsjunge angeheuert, überquerte mehrmals den Atlantik, lernte die Südsee kennen – und die rauen Sitten an Bord, wo er sich den sexuellen Nachstellungen älterer Seefahrer ausgesetzt sah und schließlich auf einem Piratenschiff landete. Angewidert von den Metzeleien auf den gekaperten Handelsschiffen, an denen sich zu beteiligen er gezwungen wurde, desertierte er und wurde bei seiner Rückkehr in Frankreich wegen dieses Vergehens vor Gericht gestellt, allerdings freigesprochen. Seine Bilanz dieser frühen Jahre als Abenteurer auf den Weltmeeren offenbart seine Ernüchterung und sollte sein weiteres Leben bestimmen: „Ich habe die Welt gesehen, sie war nicht schön. Überall eine Handvoll Verbrecher, die Millionen Unglückliche ausbeuten.”
Durch einen zufälligen Bekannten wird er in die Gedankenwelt des Anarchismus eingeführt, liest die theoretischen Schriften von Michail Bakunin, Pjotr Alexejewitsch Kropotkin – und nimmt sich besonders den berühmten Satz von Pierre Joseph Proudhon zu Herzen: « La propriété c’est le vol! » – Eigentum ist Diebstahl!
Nun beginnt eine große Karriere als illegalistischer Streiter für soziale Gerechtigkeit, als Robin Hood der Moderne, bei der Jacob bemerkenswertes handwerkliches Geschick, Organisationstalent, Kaltblütigkeit und eine geradezu geniale Erfindungsgabe an den Tag legt. Er umgibt sich mit einer Bande hochspezialisierter „Fachleute” und betreibt das Einbruchsgeschäft in die Villen der Reichen in schon fast „industriell” zu nennendem Maßstab. Bis zu tausend Diebeszüge werden allein für die Zeit von 1901 bis 1903 auf das Konto dieser politisch motivierten „Expropriateure der Expropriateure” gerechnet, wobei ein fester Anteil der Beute stets der anarchistischen Bewegung und den Armen zufließt.
Doch hat dieses Handwerk, bei aller Perfektion, nur vorübergehend goldenen Boden, und bald bewahrheitet sich die andere Redensart, dass sich Verbrechen am Ende nicht lohne. Jacob wird mit seinen Komplizen verhaftet, vor Gericht gestellt und zu lebenslänglicher Zwangsarbeit in der „Hölle von Guyana” verurteilt. Die Jahre von 1905 bis 1925 verbringt Jacob auf der berüchtigten Sträflingsinsel Île Saint-Joseph – und unternimmt in dieser Zeit 17 Fluchtversuche, die allesamt scheitern. Auch nach seiner Rückkehr nach Frankreich muss er noch zwei Jahre Zuchthaus absitzen, erst am 30. Dezember 1928 wird er endlich in die Freiheit entlassen. Ohne seine anarchistischen Überzeugungen aufzugeben, tritt „Marius”, wie er sich nun nennt, doch etwas kürzer. Zwar versucht er zur Zeit des Spanischen Bürgerkriegs (1936-39) noch, die anarchistischen Truppen von Buenaventura Durruti mit Maschinengewehren zu beliefern, doch als dies scheitert, zieht er sich endgültig aufs Altenteil zurück. Er fährt als fliegender Händler in Konfektionswaren mit einem Wohnwagen über Land und setzt sich schließlich in einem kleinen Häuschen in Reuilly (Indre) zur Ruhe. Nachdem seine körperlichen Gebrechen, Folgen der langen Haftzeit, ihm das Leben zur Qual machen, beendet er sein Dasein durch eine Überdosis Morphium, nachdem er zuvor eine Reihe von Abschiedsbriefen an seine zahlreichen Freunde zur Post gebracht hat. Bevor ihm die Sinne schwinden, kritzelt er noch auf einen Zettel: „Wäsche gewaschen, gespült, getrocknet, aber nicht gebügelt. War zu faul. Tut mir leid. Ihr findet zwei Liter Rosé neben dem Brotschrank. Auf euer Wohl!”
[Viele Informationen zu diesem Beitrag verdanke ich der kleinen Broschüre von Michael Halfbrodt: Alexandré Marius Jacob – Die Lebensgeschichte eines anarchistischen Diebes. Moers: Syndikat-A Medienvertrieb, 1994 – und deren schwierige Beschaffung meiner Freundin Michaela.]
Das war’s
Sunday, 26. October 2008Nachher fällt mir all das ein, was ich zu sagen vergaß. Nachher ist erwiesen, dass meine größte Sorge unbegründet war und die Zeit und Geduld der Zuhörer gereicht hätte, noch ein, zwei Siemsen-Stückchen mehr zu Gehör zu bringen. Nachher zweifle ich, ob ich allen Gästen deutlich genug gesagt habe, wie sehr ich mich über ihr Kommen freute.
Die Kurzprosa jener Meister der ,Kleinen Form‘ aus den 1920er-Jahren wird ja häufig auch mit der Ortsangabe ,Unterm Strich‘ gekennzeichnet, weil sie in den Tageszeitungen jener Zeit genau dort zu lesen war: unter einem mehr oder weniger dicken Strich, der diese literarischen Preziosen von den aktuell so viel wichtigeren Meldungen aus Politik und Wirtschaft trennte. Unterm Strich darf ich nun sagen, dass ich bei allen Zweifeln mit dem Ergebnis dieser Veranstaltung im Café Central des Essener Grillo-Theaters, meinem ersten öffentlichen Auftritt als Vorleser, zufrieden bin.
Wenigstens gab’s keine größeren Katastrophen, deren gedankliche Vorwegnahme einen phantasievollen Menschen wie mich ante festum das Fürchten lehren kann. Und wenn die freundlichen Zusprüche der Gäste beim Abschied nur zur Hälfte ihrem tatsächlichen Empfinden entsprachen, dann habe ich keinen Grund, auch die kommende Nacht unruhig zu schlafen.
Mit größerer Sorge erfüllt mich eher die Frage: Was wird nun aus Siemsen – und mir, dem vermutlich besten Siemsen-Kenner östlich von Santa Fé? Die Luft ist raus, da die Veranstaltung jetzt über die Bühne gegangen ist, auf die ich in den letzten sieben Monaten mit Fleiß und Liebe hingearbeitet habe.
War’s das? Vielleicht nicht. Hans Siemsen als Filmkritiker der ersten Stunde, der „den Film ernst nahm und ihn als eine neue Kunst, die Kunst dieses Jahrhunderts begrüßte und interpretierte” (Hans Sahl) – dieser Hans Siemsen harrt auch nach den verlegerischen Abenteuern von Michael Föster und Peter Moses-Krause noch immer einer fälligen Wiederentdeckung.
[Titelbild: Beate Scherzer und der Revierflaneur bei der Lesung. Foto: Valentin Heßling.]
Weißröckchen
Saturday, 25. October 2008Nein, nichts mehr
Friday, 24. October 2008Hans Siemsen verband nicht viel mehr mit Essen als sein Sterben, das sich allerdings lange 15 Jahre hinzog. Im Otto-Hue-Heim der Arbeiterwohlfahrt in Holsterhausen verbrachte er diese lange Zeit. Er hatte mit dem Interesse am Leben auch das am Schreiben verloren – oder umgekehrt.
Er kannte diese Stadt von Besuchen bei seinem älteren Bruder August, der hier von 1912 an als Oberlehrer am Reformgymnasium in Rüttenscheid tätig war und in der Alfredstraße 23 wohnte.
Den sonntäglichen Blick aus dem Fenster dieser Wohnung, in Richtung des 1913 fertiggestellten Gerichtsgebäudes an der Zweigertstraße, beschreibt Siemsen in einem kleinen, melancholischen Text in seinem zweiten, 1920 bei Kurt Wolff erschienenen Buch Wo hast du dich denn herumgetrieben?
Das ist zum Spucken nah bei dem Haus, in dem ich die ersten 18 Jahre meines Lebens verbrachte, von 1956 bis 1975. Fünf Minuten Fußweg, vielleicht auch sechs.
„Fragte man ihn, ob er nicht Papier haben wolle, damit er etwas schriebe, antwortete er mit großer Geste: ,Nein, nichts mehr.‘” (Michael Föster: Vorwort; in: Hans Siemsen: Schriften I. Verbotene Liebe und andere Geschichten. Essen: TORSO Verlag, 1986, S. 7.) Das ist mir auch zum Spucken nah.
Finish
Thursday, 23. October 2008Noch drei Tage bis zu meiner Hans-Siemsen-Matinee im Café Central des Essener Grillo-Theaters. Das wird dann also mein erster öffentlicher Auftritt als Vorleser, nachdem ich mich und meine Fähigkeiten in dieser Profession nun schon in über hundert Veranstaltungen meiner Literarischen Soireen seit dem 1. April 1989 erprobt und vermutlich unter Beweis gestellt habe – denn sonst wäre ja schließlich keiner mehr gekommen.
Kein Grund also, die Nerven zu verlieren. Und doch kann ich nicht leugnen, dass mich ein leichtes Lampenfieber beschleicht und mir tausend Fragen die Nackenmuskulatur verspannen. Was nehme ich denn jetzt aus dem überreichen Fundus der Siemsen-Texte ins Programm? Wie ist es möglich, ein ausgewogenes, vollständiges, zutreffendes Bild von diesem Autor zu zeichnen, in nur einer guten Stunde – und wenn die Panflötenspieler an diesem verkaufsoffenen Sonntag auf der Kettwiger verschlafen haben, günstigstenfalls auch in zwei?
Wieviele zwölf Euro Eintrittsgeld zu zahlen willige Gäste werden erscheinen? Nachdem ich mich seit über einem halben Jahr in ungezählten Stunden mit diesem vergessenen, verdrängten und verschollenen Autor beschäftigt, seine Bücher aus Antiquariaten für ein kleines Vermögen beschafft, seinen Lebenslauf aus entlegenen Quellen rekonstruiert habe, muss das Ergebnis dieser Mühen dann doch schließlich auch für den erbrachten Aufwand stehen, oder? Das ist nun freilich eine völlig neue Fragestellung für mich, denn in den vergangenen fast zwanzig Jahren als kostenloser Vorleser interessierte mich dieser materielle Aspekt gar nicht – weil ich es nicht nötig hatte, mich mit einem dermaßen profanen Thema zu befassen.
Jetzt muss ich mich aber fragen: Wenn jemand zwölf Euro Eintrittsgeld zu einer solchen Vorlesestunde auf den Zahlteller legt, welche Erwartung verbindet er dann mit seiner Investition?
Der Leser spürt hoffentlich, dass ich ein reichlich gestörtes Verhältnis habe zu Heller und Groschen, Mark und Pfennig, Euro und Cent – oder wie die Detailwaren in dieser billigen Klimperkiste immer heißen mögen. Ich muss doch sehr bitten! Das ist schließlich nicht mein Thema und wird es auch nie werden. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr.
Titelpuzzle
Wednesday, 22. October 2008In den englischsprachigen Weblogs gibt es seit einiger Zeit eine neue Denksportaufgabe für Vielleser: „Stelle ein paar Bücher aus deinem Regal so zusammen, dass sich die Rückentitel als ein (mehr oder weniger) sinnvoller Satz lesen lassen!” Ergebnisse des müßigen Titel-Scrabbelns kann man sich hier und hier und hier ansehen.
Ich verdanke den Hinweis auf diese Entspannungsübung für überstrapazierte Intellektuelle, dessen Grundgedanke einer Kurzgeschichte des blinden Bibliothekars von Buenos Aires entsprungen sein könnte, der deutschen Bloggerin Anke Gröner. (Und hier der erste Nachahmer.)
Auf der Suche nach einem lesenswerten Filmkritik-Weblog – ein unlesbares hatte mich lange genug geärgert – bin ich schließlich bei ihr gelandet und dort schnell heimisch geworden.
Dort findet man – neben den einerseits ganz subjektiv urteilenden, andererseits aber in gutem, fast fehlerfreiem Deutsch abgefassten und somit störungsfrei lesbaren Filmbesprechungen – auch mancherlei anderes, was das Herz hüpfen und den Kopf nicken lässt. Der lesens- und bedenkenswerte Artikel von Stefan Niggemeier (zu dem ich sonst ein eher ambivalentes Verhältnis habe), über die verbreitete Gleichgültigkeit der Blogger, was die sprachliche Qualität ihrer Geisteskinder betrifft – dieser Artikel wäre mir ohne Anke Gröners Hinweis vermutlich entgangen.
Danke, Anke! (Ein solcher Kalauer muss in diesem Zusammenhang erlaubt sein, da der heutige Würfelwurf doch puren Nonsens zum Anlass nimmt.)
Unverrottbar
Tuesday, 21. October 2008Vor gut acht Monaten schrieb ich, noch unter anderer Adresse [*], über eine ärgerliche Verunstaltung meiner näheren Umgebung. Damals hatte sich bei einem starken Sturm eine grüne Plastiktüte von der allerbilligsten, federleichten, raschelnden Sorte im Wipfel eines Rotdorns hinter unserem Haus verkrallt. Was tun? Ins morsche Geäst klettern und einen Absturz riskieren? Eine Leiter lässt sich aus verschiedenen Gründen hier nicht nutzen. Der Baum steht in Hanglage. Die Entfernung vom schrägen und morastigen Boden bis zum Corpus Delicti beträgt locker 20 Meter, und an das dünne Astwerk kann man eine solche lange und entsprechend schwere Leiter kaum sicher anlegen. Sie an den Stamm zu lehnen, bringt uns einer Lösung auch nicht näher, denn von dort bis zur Tüte sind es immer noch acht Meter Luftlinie, verstellt von einem dichten Gewirr aus Ästen, Zweigen, Laub und Blattläusen. Selbst mit einer extralangen Teleskop-Astschere, wie sie der Nachbar hat, langt man von da aus nicht hin, das ist vollkommen ausgeschlossen und mindestens lebensgefährlich. Die Aussicht, dass uns dieses nie verrottende Tütchen nun den ganzen kommenden Frühling und Sommer hindurch mit seinem Geflattere und Geknistere auf den Wecker fallen könnte, fand ich wenig erquicklich, aber sehr wahrscheinlich.
Ich sollte leider Recht behalten. Als der Baum Ende Mai in voller rosafarbener Blüte stand, stach die Tüte besonders unangenehm ins Auge – und tat dies auch weiterhin, einen schönen Sommer lang. Und selbst jetzt noch, im wiederum stürmischen Herbst, krallt sich das schäbige Missgebilde weiter unverdrossen an die Astspitzen und verdirbt mir den täglichen Gartenspaziergang. Zwar ist es bei einem nächtlichen Unwetter neulich in zwei Teile zerrissen, deren jedes aber weiterhin mein empfindliches Auge beleidigt.
Bei den regelmäßigen Geburtstags- und sonstigen Feiern auf unserer Terrasse mangelte es nicht an guten Ratschlägen unserer Gäste. Man sollte doch vielleicht einen Pfeil an einem langen Seil hochschießen, nach dem Prinzip einer Harpune, in der Hoffnung, er würde sich dort durch einen Glückstreffer irgendwann so verheddern, dass man das grüne Monstrum mit herunterreißen könnte. Oder vielleicht könnte man von einem Zirkusartisten ein dressiertes Äffchen ausborgen, das auf freundliches Bitten und um den Preis einer Banane das Flatterding herunterapportierte.
Woche für Woche – es sind mittlerweile genau vierzig Wochen verstrichen seit dem Eintreffen des unwillkommenen Flugobjekts – wuchs mein Hass auf die Erfinder, Erzeuger und Nutzer eines solchen Unrats, der in der Herstellung so billig ist, dass er von den Händlern großzügig verschenkt wird und dem kein Mensch hinterherläuft, wenn ihn eine unerwartete Böe auf Nimmerwiedersehen davonträgt – um ein paar hundert Meter weiter jemanden durch Immerwiedersehen zu malträtieren.
So wurde mir mit der Zeit die eigentlich unbedeutende grüne Plastiktüte zum Wahrzeichen jener verhängnisvollen Kurzsichtigkeit unserer industriellen Massenproduktion, die milliardenfach unverrottbares Zeug in die Welt schleudert und sich einen Teufel darum schert, was draus wird und wo es bleibt, wenn es seinen kurzzeitigen Zweck erfüllt hat. Und als solches, als Fanal einer Einsicht, die vermutlich für uns alle zu spät kommt, ist mir schließlich die Tüte ans Herz gewachsen. Sollte der Baum irgendwann gefällt werden und die Tüte mit ihm von dannen gehen, wird sie mir fehlen. (Aber nicht so sehr wie der Baum.)
[* … nämlich bei Westropolis, dem Kulturblog der WAZ, das seit dem 4. Januar 2011 abgestellt ist. Deshalb übernehme ich Schritt für Schritt meine dort zuerst veröffentlichten Texte, sofern ihr Verfallsdatum noch nicht überschritten ist, in mein Revierflaneur-Blog. Der hier erwähnte Artikel erschien zuerst bei Westropolis am 8. Februar 2008 unter dem Titel Freitag, 8. Februar 2008 in meiner Reihe Journal intime und ist nur noch im Cache über eine passende Google-Suche auffindbar. Eine aktualisierte Neuauflage findet der Leser bei Ostropolis. (20.01.2011 MH)]
5 °C
Monday, 20. October 2008Überraschung! Am vergangenen Freitag meldete meine Tageszeitung auf der Titelseite eine neue „Rekordtemperatur in der Arktis“. Die Temperaturen dort lägen derzeit um 5 °C über dem Normalwert – und seien damit höher als jemals zuvor in dieser Jahreszeit seit Beginn der Messungen. Der Artikel war verhältnismäßig klein, verglichen mit den neuesten Nachrichten über die weltweite Finanzkrise und den Wahlkampf in den USA. Zudem wurden solche Hiobsbotschaften in den letzten Jahren so oft bekannt gegeben, dass sich selbst bei gründlichen und empfindsamen Zeitungslesern mittlerweile fatalistische Resignation eingestellt hat. Was soll man da machen?
Außerdem ist die Arktis weit weg, und die beschriebenen Veränderungen schreiten in der Wahrnehmung des Menschen, der von Tag zu Tag lebt, nur unmerklich langsam voran. So kommt es, dass der aktuelle Wetterbericht für die Region mehr Aufmerksamkeit findet als eine Nachricht über globale Klimaprognosen. Ob wir fürs kommende Wochenende einen Spaziergang am Baldeneysee bei strahlendem Sonnenschein einplanen können, interessiert uns allemal mehr als die Frage, ob durch den Anstieg des Meeresspiegels um 2,5 Millimeter pro Jahr in einigen Jahrzehnten große Teile von Bangladesh überflutet werden.
Hinzu kommt noch, dass das kurzfristige Wetter- und langsfristige Klimageschehen auf unserem Planeten dermaßen komplexe Ereignisse sind, hervorgerufen von einer nahezu unüberschaubaren Anzahl variabler Faktoren, dass selbst die leistungsstärksten Großrechner und weltweit vernetzte Computersysteme sehr bald an ihre Grenzen stoßen, wenn es darum geht, zuverlässige Vorhersagen für die nähere oder fernere Zukunft zu treffen. Die aktuellen Warnmeldungen in den Medien basieren sämtlich auf dem am 16. Oktober veröffentlichten Annual Arctic Report der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in Washington (DC), an dem 46 Wissenschaftler aus zehn Ländern beteiligt waren. Deren Sprecher, James Overland, warnte bei der Bekanntgabe der neuesten Forschungsergebnisse vor einem „Dominoeffekt”, bei dem durch die stetig steigenden Temperaturen das auf der Wasseroberfläche schwimmende Eis schmelze, die Sonneneinstrahlung von diesem nicht mehr reflektiert werden könne und sich damit die Eisschmelze weiter beschleunige.
Auch hierbei handelt es sich offenbar wieder um einen exponentiellen Prozess und längst nicht mehr um einen linear sich entwickelnden Vorgang – ganz ähnlich wie bei der Weltbevölkerungskurve, die Mitte des 17. Jahrhunderts aus dem linearen Ruder gelaufen ist. Unveränderlich ist allerdings die Landfläche auf der Erde als menschlicher Siedlungsraum. Sie umfasst seit etlichen Jahrtausenden 149,4 Millionen km². Und diese Zahl wird, so wie es aussieht, in Zukunft allenfalls sinken.
«Après nous le déluge!» Der Ausspruch der Madame de Pompadour aus dem Jahr 1757 erweist sich heute gerade in seiner Ambivalenz als wahrhaft prophetisch. Wir wissen ja nicht, was die Mätresse Ludwig XV. damit sagen wollte. „Mir als kaltschnäuziger Zynikerin ist völlig schnuppe, ob die Sintflut alles hinwegspült, wenn ich erst das Zeitliche gesegnet habe?” Oder aber: „Ich als schicksalsergebene Fatalisten kann leider ohnehin die Sintflut nicht verhindern?” – Karl Marx wiederum hat im ersten Band seines Kapital (1863) die kurzfristigen Nutznießer einer solchen selbstzerstörerischen Verzweiflungshaltung gegenüber unserer Zukunft und der unserer Kinder und Kindeskinder beim Namen genannt: „Nach uns die Sintflut ist der Wahlspruch jedes Kapitalisten und jeder Kapitalistennation.”
Dreckschleuder
Sunday, 19. October 2008Was das Fernsehen angeht, dessen inhaltliche Qualitäten seit einer Woche mal wieder durch den Veitstanz eines greisen Fernsehstars ins Gerede gekommen sind, bin ich Fundamentalist – und Totalverweigerer. Ich habe kein Empfangsgerät in der Wohnung stehen, ich sehe mir auch anderswo keine Fernsehprogramme an, gleich ob öffentlich-rechtliche oder private, ich ernähre mich intellektuell rein vegetarisch, bereite mir meine Nahrung ausschließlich aus Texten und Bildern der papierenen Provenienz, angereichert durch bequem verfügbare Zutaten aus dem Internet. Selbst wenn es weltweit keine niveauloseren Sender als Arte und 3sat gäbe, würde das an meiner prinzipiellen Abneigung gegen dieses Massenmedium keinen Deut ändern. Ganz einfach gesagt: Nicht die jetzt wieder an den Pranger gestellten idiotischen Inhalte des Fernsehens veranlassen mich zu meiner konsequenten Abstinenz; vielmehr habe ich längst schon die Form ihrer Darbietung in diesem Medium als für mich grundsätzlich schädlich und insofern absolut entbehrlich erkannt.
Die sich gegenseitig verstärkende Wechselwirkung zwischen der fortschreitenden Trivialisierung der Inhalte im Fernsehen und den sinkenden Ansprüchen seiner Zuschauer vor der Mattscheibe ist eine Gesetzmäßigkeit, die diesem Medium von Anfang an, also seit der Nierentisch-Epoche, immanent war und die durch keine noch so gut gemeinte Gardinenpredigt eines gebildeten Großkritikers umzukehren oder auch nur zu bremsen ist. Indem die Einschaltquote, von der die Werbeeinnahme abhängt und damit die Finanzierung dieses Massenspektakels, das Programm bestimmt, reguliert sich dieses Unterhaltungssystem selbst. Ein erfolgreicher Intendant zeichnet sich schon längst nicht mehr durch Phantasie, Experimentierfreude und innovative Ambitionen aus. Vielmehr lässt er den Dingen ihren Lauf und sitzt die regelmäßig über ihn niedergehenden Medienschelten großkopferter Arroganskis lieber aus, als einen Rückgang der Quoten (und damit der Werbeeinnahmen) für seinen Arbeitgeber resp. Gehaltszahler in Kauf zu nehmen.
Weder die Empfänger noch die Sender haben in diesem sich selbst regulierenden System einen Handlungsspielraum. Das ist ein geschlossener Kreislauf, eine unablässig rotierende Turbine des Elends. Letztere, „die Fernsehmacher”, müssen produzieren, was gewünscht wird; erstere, „unsere lieben Zuschauer”, müssen konsumieren, was geboten wird. – Die Wahlmöglichkeit zwischen Dutzenden von Programmen, jenes „Switchen” per Fernbedienung, das die einst auf zwei Sender und die anstrengenden „Dritten” reduzierte Schmalspurofferte zum Scheinbild einer großen weiten Welt hochpushte, ist dabei nur eine Farce. Und die wenigen anspruchsvollen Sendungen erfüllen lediglich eine Alibifunktion. Entscheidend aber ist der Mainstream, jener reißende Fluss, der immer breiter und schneller wird und alles mit sich in den Abgrund spült, was einmal „humanistische Bildung”, „kritischer Geist” und „gepflegter Geschmack” hieß. – Das Fernsehen ist der letzte Sargnagel zur vordem schon gescheiterten Aufklärung.
Marcel Reich-Ranicki hat diese destruktive Allmacht des Fernsehens nicht erkannt. Sonst hätte er sich in den Jahren seines Literarischen Quartetts nicht zum Hofnarren machen lassen. Und selbst in der Abgeschiedenheit des Ruheständlers ist er offenbar noch nicht aus dem Spuk schlau geworden, auf den er sich da eingelassen und zu dessen Abrakadabra er erfolgreich beigetragen hat. Wenn er von dem „Dreck” angeekelt war, den er stundenlang bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises aus nächster Nähe, als unmittelbarer Augenzeuge geboten bekam und ertragen musste, dann spricht das nicht für seine intellektuelle Redlichkeit, sondern ist kläglicher Ausweis seiner erschreckenden Naivität. (Alter schützt vor Torheit nicht.) Und wenn er glaubt, durch seine trotzige Ablehnung eines Plexiglas-Obelisken und einen halbstündigen Dialog mit Thomas Gottschalk über die inhaltliche Qualität des Fernsehens diesbezüglich eine Trendwende auslösen zu können, dann muss man’s wohl schon Größenwahn nennen.
Die überschaubar kleine Zahl jener Zeitgenossen, die wie ich einige vermeintliche „Segnungen” unserer Zivilisation zu Beginn des dritten Jahrtausends bewusst verweigern – das Fernsehen, das Handy, das Auto, den Tourismus – wird regelmäßig mit einer ebenso überschaubaren Zahl von Invektiven bedacht: arrogant, weltfremd, antagonistisch, kulturpessimistisch. Das nehmen wir aber liebend gern in Kauf – und zwar nicht aus messianischen Motiven, um der Rettung der Welt willen, sondern aus rein egoistischen Gründen. (Hierzu wird in nächster Zeit noch einiges zu sagen sein.)
Kofferbombe
Saturday, 18. October 2008Gestern um 17:22 Uhr. Aus Richtung Köln-Düsseldorf kommend fährt die S6 in den Bahnhof Essen-Werden ein. Ein etwa 45 Jahre alter männlicher Fahrgast steigt zu und legt seinen Koffer in die Gepäckablage über den Sitzen. Dann springt er aus dem Zug und flüchtet. Mitreisende, die zufällig Zeugen dieses verdächtigen Vorgangs werden, informieren per Handy die Polizei.
Um 17:31 Uhr läuft der Zug am S-Bahnhof Essen-Süd ein und wird evakuiert. Ich verlasse meine nahe gelegene Wohnung, um an der Bude Ecke Schnutenhausstraße Zigaretten zu kaufen, und werde so zufällig Zeuge, wie die Rellinghauser Straße vor und hinter der Brücke über die Bahngleise von der Polizei mit rot-weißem Flatterband abgesperrt wird. Der Auto- und Straßenbahnverkehr kommt zum Erliegen, Fußgänger dürfen die Brücke nur noch „auf eigenes Risiko” passieren.
Um 17:49 Uhr fährt plangemäß die S6 aus der Gegenrichtung ein. Fahrgäste steigen aus und verlassen die mutmaßliche Gefahrenstelle über die Treppe zur Brücke. Ich hole meine Kamera und schieße zwischen 18:00 Uhr und 18:10 Uhr ein paar Fotos von der Sperrung [siehe Titelbild]. Gegen 19:30 Uhr rückt ein Entschärfungskommando an, untersucht den herrenlosen Koffer mit einem Röntgengerät und öffnet ihn schließlich. Er enthält Unterhemden, einen alten Bademantel und Spraydosen. Hinweise auf den Eigentümer werden nicht gefunden. Wenig später kann der Verkehr wieder freigegeben werden.
Seit den nur durch technisches Versagen gescheiterten Kofferbomben-Anschlägen auf zwei Regionalzüge aus Köln in Richtung Dortmund und Koblenz am 31. Juli 2006 ist die Aufmerksamkeit von Fahrgästen öffentlicher Verkehrsmittel für herrenlose Gepäckstücke verständlicherweise geschärft – und die Sicherheitskräfte sind angehalten, jeden Hinweis auf ein mögliches Attentat ernst zu nehmen und alle möglichen Vorkehrungen zu treffen, um Gefahr für Leib und Leben unbeteiligter Passanten abzuwenden. Unser vergleichsweise freies Land befindet sich erneut in „ständiger innerer Alarmbereitschaft” (Wolfgang Neuss), einem Klima der Verunsicherung, das zuerst in den frühen 1970er-Jahren den Alltag vergiftete.
Die Spraydosen im Trolli des unbekannten Trittbrettfahrers, der solche verständlichen Ängste missbraucht, um seine ganz private Profilneurose mit Allmachtsphantasien zu besänftigen, deuten darauf hin, dass er es den Durchleuchtern seiner Hinterlassenschaft in der S6 nicht allzu leicht machen wollte. Die gestrige zweieinhalbstündige Verkehrsunterbrechung ist morgen schon vergessen – aber die latente Angst, dieses „Tabu der Abwehrgesellschaft” (Rainer Taëni), sie dauert fort.
Eccentrics (VIII)
Friday, 17. October 2008mce>
Neben dem „Pferdenarren” war viele Jahre lang der „zwitschernde Leierkastenmann” in Essen ein stadtbekanntes Original. Das kleine Männlein saß mit Zylinder und im schwarzen Ledermantel sommers wie winters an der Kettwiger Straße, der ältesten Fußgängerzone Deutschlands. Sein Stammplatz in der kalten Jahreszeit war zwischen zwei Schaufenstern an der Ostseite des Eick-Hauses, im Schutze des Vordaches von Peek & Cloppenburg (heute Ansons). Bei schönem Wetter fand man ihn auch an anderen Stellen der „Kettwiger”, vor Lederwaren Langhardt am Baedeker-Haus etwa oder am Glockenspiel von Uhren Deiter.
Sein treuer Begleiter war ein frecher kleiner Yorkshire-Terrier. Die Musik aus seiner Drehorgel begleitete er mit Gezwitscher, das er durch Vogl-Pfeiferl erzeugte, jene halbmondförmigen Plättchen, die zwischen Zunge und Gaumen gelegt und durch geschickte Atemtechnik in Vibration versetzt werden.
Böse Stimmen behaupteten, jener Herbert Oberländer – so hieß der Mann – sei durch seine Orgelei und Zwitscherei mittlerweile längst zum Millionär geworden. Man wollte beobachtet haben, wie er nach getaner Arbeit, also nach Ladenschluss um halb sieben, sein Musikinstrument in einen Mercedes Kombi einlud, den er im nahe gelegenen Bankenviertel parke, um anschließend mit quietschenden Reifen davonzupreschen.
Irgendwann Ende der 1990er-Jahre war er dann plötzlich verschwunden. Jetzt habe ich ihn wiederentdeckt [siehe Titelbild], nämlich in einem jüngst erschienenen opulenten Bildband zur Geschichte meiner Heimatstadt. (Herbert Westphalen: Essener Bilderbogen 1880-2007. Die Stadt Essen und ihre Geschichte in mehr als 1.200 Ansichtskarten und Fotos. Essen: Klartext Verlag, 2008, S. 118.) Dort erfährt man auch, dass Oberländer 1998 im Alter von 82 Jahren verstorben ist.
Bei dieser Gelegenheit kann ich mir ein paar kritische Bemerkungen zu diesem Buch nicht verkneifen. Erstens ist es leider, was die Bildunterschriften betrifft, sehr schlampig lektoriert; noch deutlicher: Es strotzt vor sprachlichen Fehlern aller Art. Zweitens folgt die Anordnung des Bildmaterials keinem wirklich einleuchtenden Prinzip. Drittens vermisse ich umso mehr ein Register, das wenigstens so die Orientierung in diesem Durcheinander erleichtern würde. Aber alle diese Mängel werden mehr als wettgemacht durch die sensationelle Vielfalt und Originalität der hier überwiegend erstmals, und dazu in tadelloser Druckqualität, veröffentlichten Bilder. Man kann, was das betrifft, durchaus auf mein fachmännisches Urteil vertrauen, denn ich habe zur Bildgeschichte dieser Stadt so ziemlich alles gesammelt, was in den vergangenen Jahrzehnten im Buchhandel erschienen ist. Speziell was das Baedeker-Haus und das Hansa-Haus betrifft, dachte ich eigentlich, alle verfügbaren historischen Bildquellen zu kennen – und wurde durch Westphalens Buch erfreulicherweise eines Besseren belehrt. Wenngleich nicht unbedingt ein ungetrübtes Lesevergnügen, so bietet es somit doch immerhin einen wahren Augenschmaus für jeden am Gestaltwandel dieser Großstadt interessierten Essener.
Auch ich, auch du.
Thursday, 16. October 2008Als 75. Band der berühmten expressionistischen Buchreihe Der Jüngste Tag erschienen 1919 im Verlag Kurt Wolff in Leipzig Hans Siemsens „Aufzeichnungen eines Irren” unter dem Titel Auch ich, auch du. Heinz Schöffler hat 1970 alle 86 Hefte dieser Reihe, mustergültig kommentiert und im Faksimile gedruckt, in zwei dicken Bänden im Scheffler-Verlag neu herausgegeben; 1981 erschien ein Nachdruck in sieben Bänden im Societäts-Verlag (beide in Frankfurt am Main).
Dass das Erstlingswerk des 28-jährigen Siemsen in dieser „Bücherei einer Epoche” erschien, neben den Büchern so bedeutender Dichter und Schriftsteller wie Gottfried Benn, Karel Čapek, Paul Claudel, Iwan Goll, Franz Kafka, Carl Sternheim, Georg Trakl und Franz Werfel, das dürfte der hoffnungsvolle junge Autor sicher als eine starke Ermutigung empfunden haben, künftig das Schreiben zu seinem Hauptberuf zu machen.
Auf den knapp zwanzig Seiten des Bändchens, in diesen „Phantasien eines am Krieg irre gewordenen Frontsoldaten” (Michael Föster), verarbeitet Hans Siemsen seine Kriegserlebnisse als Soldat an der Westfront 1917, die durch Feldpostbriefe an seine Mutter und seine neun Jahre ältere Schwester Anna dokumentiert sind. Im Schützengraben las er die Pensées von Pascal, die Lebens-Ansichten des Katers Murr von E. T. A. Hoffmann, Flauberts November, Eckermanns Gespräche mit Goethe, Kasimir Edschmids Novellensammlung Timur (die er „albern” fand), den Hasenroman von Francis Jammes, Professor Unrat von Heinrich Mann, Das grüne Gesicht von Gustav Meyrink (eine „Enttäuschung” nach dessen Golem) sowie Romane von Fielding und Balzac. – Vor allem aber las er, offenbar hingerissen und überwältigt, den Tristram Shandy und urteilte: „Welch ein Buch! Ich bin so stolz darauf, als ob ich es selbst geschrieben hätte. Es ist mein Bißchen Begabung zur Vollendung erhoben – aber wir sind durchaus von derselben Familie – und es ist verdammt ein glorioses Gefühl, solche Verwandte zu haben!” (Undatierter Brief an die Mutter; zit. nach Schriften III. Briefe von und an Hans Siemsen. Hrsg. v. Michael Föster. Essen: TORSO Verlag, 1988, S. 26.)
Jenes „Bißchen Begabung” und die behauptete Familienzugehörigkeit gab zu den gewagtesten Hoffnungen Anlass, die durch Auch ich, auch du dann allerdings leider nicht eingelöst wurden. Vielmehr schmiegt sich Siemsens Prosa an den 1919 schon wieder modischen Stakkato-Ton der Expressionisten an: „Namenlos bin ich genannt. / Namenlos irr ich von Land zu Land. / Namenlos elend. / Namenlos tot. / Einmal hatte ich einen Namen. Wie lange ist das her? / Weiß Gott! Wie oft bin ich seit dem gestorben!” Der junge Poet beginnt seine schriftstellerische Laufbahn als Epigone.
Aber ein solches Urteil, über fast ein Jahrhundert hinweg, ist doch andererseits auch wieder eine Anmaßung. Aus der warmen Stube, nach mehr als sechzig Jahren Frieden zumindest hierorts, lässt sich leicht die Nase rümpfen. Wir wissen ja gar nicht, wie gut es uns geht. Ich habe noch in keinem Schützengraben gelegen. Ich kenne den Wald nicht, von dem Siemsen schreibt: „Ich will lieber in unsern Sterbewald! Da warten auf mich, daß ich komme, die lieben Brüder. Ich habe sie so lieb gehabt. Ich habe sie so von Herzen lieb.” Ich habe keine Brüder. Und ich kenne den Krieg bisher nur vom Hörensagen.
Apfel
Wednesday, 15. October 2008Seit einigen Wochen lese ich zum zweiten Mal ein Buch, das vor nun wohl 36 Jahren meinen Blick auf die Menschenwelt entscheidend und nachhaltig verändert hat. Man könnte sagen, dass ich seinerzeit durch dieses Buch meine kindliche Unschuld verloren habe. Es ist die Dokumentation Der Auschwitz-Prozeß von Hermann Langbein, zuerst erschienen 1965 in der Europäischen Verlags-Anstalt, wiederaufgelegt 1995 im Verlag Neue Kritik, beide in Frankfurt am Main.
Wenn in meinem Freundes- und Bekanntenkreis heute das Thema „Konzentrationslager im Nationalsozialismus” aufkommt, dann ist ein vielfach verwendetes Adjektiv zur Benennung des dortigen Geschehens „unvorstellbar”. Dort seien unvorstellbare Verbrechen begangen worden, unvorstellbares Leid sei den Juden und anderen Häftlingen zugefügt worden und es sei unvorstellbar, wie Menschen anderen Menschen so etwas antun konnten. In Auschwitz sei eine unvorstellbar große Zahl von unschuldigen Opfern vergast worden. Und dass es heute noch immer Menschen gebe, die dies ernsthaft leugnen, sei wenn nicht unvorstellbar, so doch schwer nachvollziehbar. – Jede einzelne dieser Aussagen ist falsch.
Dank des Frankfurter Auschwitz-Prozesses (20. Dezember 1963 bis 21. August 1965) ist in weit über 200 ausführlichen Zeugenaussagen in allen erdenklichen Einzelheiten dokumentiert, was dort geschah, wie es geschah und warum es geschah. Es sich in aller Deutlichkeit vorzustellen, dazu bedarf es allerdings der Bereitschaft, es sich vorstellen zu wollen – doch wer will das schon? Wer setzt sich freiwillig dem Risiko aus, bei solchen Vorstellungen seine Lebensfreude und seinen Glauben an die Menschheit aufs Spiel zu setzen und zu einem sauertöpfischen Misanthropen zu werden? Das Lachen zu verlernen? Vor Kummer und Scham darüber im Boden zu versinken, zum Volk der Täter zu gehören, wofür es keine bessere Entschuldigung gibt als die fadenscheinige Ausrede von der „Gnade der späten Geburt” (Helmut Kohl)?
Ein Beispiel: Am 41. Verhandlungstag erklärte die aus Mexiko angereiste Zeugin Dounia Zlata Wasserstrom, geb. am 18. Januar 1909 in Gitomir (Russland), Häftling im KZ Auschwitz vom 23. Juli 1942 bis zur Evakuierung, Häftlingsnummer 10.308, Dolmetscherin in der Politischen Abteilung (Abt. II) in Auschwitz: „Im November 1944 kam ein Lkw an, auf dem sich Kinder befanden. Der Lkw hielt in der Nähe von der Baracke. Ein kleiner Junge im Alter von vier bis fünf Jahren sprang vom Lkw herunter. Er hatte einen Apfel in der Hand. Woher die Kinder kamen, weiß ich nicht. In der Tür stand[en] [Wilhelm] Boger und [Hans] Draser. Ich selbst stand am Fenster. Das Kind stand neben dem Lkw mit dem Apfel. Boger ging zu dem Kind hin, packte es an den Füßen und warf es mit dem Kopf an die Wand. Den Apfel steckte er ein. Dann kam Draser zu mir und befahl mir, ‚das an der Wand‘ abzuwischen. Das tat ich auch. Eine Stunde später kam Boger und rief mich zum Dolmetschen. Dabei aß er den Apfel. Das Ganze habe ich mit eigenen Augen gesehen. Das Kind war tot. Ein SS-Mann hat das tote Kind weggebracht.”
Dem Angeklagten Boger, der das Lachen offenbar noch nicht verlernt hatte [siehe Titelbild], fiel vor Gericht dazu nichts anderes ein als das knappe Statement: „Die Sache ist frei erfunden.” Ich bin da phantasievoller und denke an den 137. Psalm: „Tochter Babel, du Verwüsterin, / wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast! / Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt / und sie am Felsen zerschmettert!”
Eklat
Tuesday, 14. October 2008Die meisten Quotenknüller des Fernsehens verdanken ihren Erfolg der Hoffnung des Zuschauers auf ein ungeplantes Missgeschick. Die erregtesten Gespräche nach Live-Übertragungen von der Formel I und der Tour de France gab es in der Betriebskantine meines früheren Arbeitgebers immer nach Unfällen, je schlimmer, desto doller. Peinliche Patzer von sonst so perfekten Nachrichtensprechern, der schweigende Boxer Norbert Grupe, Trapattoni und sein „Ich-habe-fertig!”-Wutausbruch, Zlatkos schlechte Manieren im „Big-Brother”-Container, Eva Hermans Nahezu-Rausschmiss bei Johannes B. Kerner, die gegenseitigen Beleidigungen von Marcel Reich-Ranicki und Sigrid Löffler im gesitteten „Literarischen Quartett”, Zinédine Zidanes Kopfstoß gegen die Brust von Marco Materazzi in den letzten Minuten des WM-Finales – das waren einige der vielen mittlerweile legendären Spontanereignisse der Fernsehgeschichte, auf die jeder Zuschauer insgeheim stets hofft, wenn er sich vor die Glotze hockt und nach spannender Entspannung giert.
Wem das wirkliche Leben keine Abwechslung bietet und schon gar keine Überraschungen, für den ist die Sehnsucht, zum Zeugen solcher ungeplanten Regelverstöße in aller Öffentlichkeit zu werden, ein starkes Motiv, sich den langweiligsten Quatsch aus alter Gewohnheit und in Ermangelung einer Alternative Abend für Abend, Stunde um Stunde, Jahr auf Jahr in unverbrüchlicher Treue reinzuziehen. Welch ein Elend! Welche Vergeudung von Lebenszeit, Kreativpotenzial und mentalem Volksvermögen!
Was für den im Live-TV übertragenen Sportevent der blutige Unfall oder das brutale Foul, das ist für die Talkshows, Quizsendungen oder Preisverleihungen der Eklat: ein kostenloser Quotenbringer allererster Güte. Seine Effizienz ist zu einem guten Teil von der Fallhöhe abhängig: der Differenz zwischen den Erwartungen des Publikums an die Akteure auf dem Bildschirm und deren skandalösem Verhalten. Wenn Dieter Bohlen bei DSDS einen vernehmlichen Furz ließe, wäre das für zarte Gemüter, die sich wild zappend in ein solches Format verirrt haben, vielleicht momentweise degoutant, für seine hartgesottenen Fans würde er damit aber bloß eine weitere stinkende Blase in jenem Schlammbad produzieren, in dem die Unappetitlichkeit längst vorherrschende Konvention des gewöhnlichen Umgangs miteinander geworden ist. Solche Entertainer haben’s schwer, es mit einem Ausraster noch mal auf die erste Seite der Bild-Zeitung zu schaffen. Wenn aber – ich phantasiere mal – ein vor Seriosität und Beherrschtheit sonst nur so strotzender Tagesschau-Sprecher beim Verlesen einer Unfallmeldung in Tränen ausbräche, weil seine eigene Tochter zu den Opfern zählte, dann wäre dies ein Ereignis, das „Fernsehgeschichte” schriebe und tausendfach wiederholt würde.
Marcel Reich-Ranicki war ein erfolgreicher Literaturkritiker in den „anspruchsvollen” Printmedien der 1960er- bis 1980er-Jahre (Zeit und FAZ), dem aber schon in dieser Tätigkeit die Zurschaustellung seiner hochrichterlichen Würde, Unabhängigkeit und Allmacht mehr bedeutete als die Wertbeständigkeit und Kommensurabilität seiner für den Tag geschriebenen Urteile. In einer Zeit, als das formale Experiment und die politische Provokation die dominierenden Kräfte der ehemals „Schönen Literatur” waren, stand sein Name für ein Beharren auf stockkonservativen Positionen, zu deren Begründung er nie viel mehr anzuführen wusste als die Rückbesinnung auf die Ideale der Klassik – und sein Lieblingsparadigma lautete allenthalben: „Literatur darf den Leser nicht langweilen.” (Mit der allerdings stets unterschlagenen Voraussetzung: „Der Leser bin ich.”) Im März 1988 schloss der nachmalige „Literaturpapst” dann einen Pakt mit dem Teufel und ging gegenüber seiner Würde, um seiner Eitelkeit willen, einen Kompromiss ein: Marcel Reich-Ranicki bereicherte das ZDF um ein „Format”, das zuvor niemand für möglich gehalten hätte, eine „anspruchsvolle Literatursendung”, in der es ausschließlich um Bücher ging und in der nicht mehr zu sehen und zu hören war als das Gespräch zwischen vier kontrovers argumentierenden Fachleuten.
Rückblickend betrachtet hat der mittlerweile 88-jährige Mann damit immerhin dem deutschen Buchhandel einen großen Dienst erwiesen und dafür gesorgt, dass Abermillionen Bücher, vorzugsweise die von ihm verrissenen, über den Ladentisch gingen. (Wie viele von ihnen tatsächlich von den braven Käufern gelesen wurden, das steht freilich auf einem anderen Blatt.) Ein solcher Pakt hat nun aber, wie der an der deutschen Klassik geschulte Großkritiker zweifellos wissen wird, immer seine zwei Seiten. Und so sind wir kritischen Zeitzeugen dieses traurigen Schauspiels nun dazu verdammt, einem unaufhaltsamen Niedergang zusehen zu müssen. Marcel Reich-Ranicki kann nach der Einstellung des Literarischen Quartetts Ende 2001 auf seine alten Tage nun doch nicht auf die öffentliche Aufmerksamkeit verzichten; er nutzt – welch ein Eklat! – die Verleihung des „Ehrenpreises der Stiftung des Deutschen Fernsehpreises” dazu, sich noch einmal ins Rampenlicht zu stellen, pünktlich zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse, indem er in die Hand beißt, die ihn viele Jahre gefüttert hat – und schafft es endlich wieder zu einer Bild-Schlagzeile. Wenn man sich allsonntäglich seine peinlichen Briefantworten in der FAS anschaut, dann hätte man allerdings gewarnt sein müssen. – Am kommenden Freitag von 22:30 bis 23:00 Uhr erhält der unsterbliche MRR die Gelegenheit, im Gespräch mit dem ebenfalls unsterblichen Thomas Gottschalk vor Millionen Fernsehzuschauern darzulegen, warum er so lange gebraucht hat, bis ihm die Erkenntnis dämmerte, dass das Fernsehen das bislang wirkungsvollste Instrument zur Kulturvernichtung in der Menschheitsgeschichte ist. Die Quoten dürften sich sehen lassen.
Dingwelt (V)
Monday, 13. October 2008Seit ein paar Jahren bin ich Hypertoniker. Wann genau sich bei mir der erhöhte arterielle Blutdruck eingestellt hat, kann ich nicht sagen, denn als er von meinem damaligen Hausarzt festgestellt wurde, waren mein systolischer und mein diastolischer Gefäßdruck seit vielen Jahren nicht mehr gemessen worden.
Die Therapie der Wahl gegen dieses chronische Volksleiden war in meinem Fall eine medikamentöse Kombinationstherapie aus einem ACE-Hemmer (Ramipril) und einem Betablocker (Metoprolol). Das eine Präparat nehme ich morgens zum Frühstück, das andere abends vorm Zubettgehen.
Bald wurde mir diese Tagesroutine so selbstverständlich, dass ich gelegentlich im Zweifel war, ob ich nun meine Pille schon geschluckt hatte oder noch nicht. Sicherheitshalber eine zweite Tablette zu nehmen empfiehlt sich nicht, denn Überdosierungen können zu einem gefährlichen Blutdruck-Abfall führen. Eine Tagesdosis ganz auszulassen ist aber ebenfalls riskant.
Also entschloss ich mich, in der Apotheke eine dieser praktischen Vorratsdosen zu erwerben, die es erlauben, den Medikamentenbedarf einer Woche vorzuhalten, übersichtlich sortiert nach Tagen und Tageszeiten der vom Arzt verordneten Einnahme (siehe Titelbild). Bei dieser Anschaffung hatte ich zum ersten Mal das unabweisliche Gefühl: Jetzt kommt das Alter.
Die sieben „Schubladen” des Kästchens wandern in ihrem Gehäuse Woche für Woche von hinten nach vorn. Wenn ein Tag vorbei ist, wird das leere Kästchen nach hinten gesteckt, wenn die Woche endet, befülle ich das Magazin mit weiteren 14 Pillen: ein Kreislauf – der allerdings irgendwann an sein Ende kommen wird. Die Botschaft lautet: Deine Tage sind gezählt – wenngleich die Zahl dank der täglichen Pilleneinnahme größer ist als ohne.
Masterplan
Sunday, 12. October 2008Dem eiligen Passanten, der dieses Weblog mit flüchtigem Blick streift, kein eindeutiges Thema findet, keinen Zusammenhang herstellen kann, sich nicht zurechtfindet und nicht heimisch wird und darum durch den erstbesten Notausgang davonstrebt und das Weite sucht – diesem so konzentrationsschwachen wie atemlosen und ungeduldigen Zeitgenossen sei hiermit gesagt: Das Werk des Revierflaneurs folgt einem Masterplan.
Dieser Plan wird allerdings erstens nur aus der Vogelperspektive überschaubar – und ist zweitens verlässlich bloß für den Tag, weil er sich ständig, wenngleich in kleinen Schritten, verändert. Sein Meister findet ja keine Landschaft vor, die es nun gälte, mit dem Plan in der Hand zu erkunden und zu verstehen. Vielmehr erschafft er diese Landschaft selbst erst Schritt für Schritt und muss die Karte nach jeder neuen Landgewinnung den veränderten Gegebenheiten anpassen.
Die Bewegungsrichtung dieser Flanerie ist exzentrisch („weg von der Mitte”), ihre Geschwindigkeit anachronistisch („in kleinen Schritten”). Jedes beliebige Zwischenergebnis und Zustandsbild dieser schleichenden Expedition ähnelt in doppelter Hinsicht einem Labyrinth. Es scheint chaotisch für den unerfahrenen Besucher, der sich bei seiner planlosen Inspektion wohl bald verirrt und keinen rechten Überblick findet – und ist doch nach einem streng geordneten Plan angelegt, regelmäßig wie eine Hilbertkurve [siehe Titelbild].
Ein alphabetischer Kompass zur Orientierung auf dem Weg durch diesen strukturierten Irrgarten sind die „Kategorien” am rechten Rand. Gegenwärtig gibt es auf erster Ebene deren drei (Allgemein, Würfelwürfe und Zeitsprünge), auf zweiter unter der mittleren schon ein ganzes Dutzend (Against the Day, Baggesen, Caissa, Dingwelt, Eccentrics, Godzilla, Hans Siemsen, Kistenflimmer, Märchen, Oikos, Snapshot und Tauchen).
Die Hierarchie dieser Schubladen bleibt aber, das sei zur Warnung einem ernsthaften Expeditionsteilnehmer in diesem Wörterdschungel mit auf den Weg gegeben, jedenfalls immer nur eine vorläufige. Und schon erst recht sollte sich ein gewogener Leser dieses Weblogs nicht dazu verführen lassen, aus der Zahl der Beiträge zu einer Kategorie voreilige Schlüsse auf deren relative oder gar absolute Bedeutung zu ziehen. (Vielleicht endet dereinst das voluminöse Kapitel Against the Day auf einer vierten Ebene der Kategorien, unter Würfelwürfe / Roman / Epigonen.)
Siemsens Kopf
Saturday, 11. October 2008Seit gut einem halben Jahr versuche ich, mich dem Leben und Werk, nicht zuletzt aber auch der Person des nahezu unbekannten Flaneurs Hans Siemsen anzunähern. Bei einer solchen intensiven Beschäftigung ist nur natürlich, wenn man bald einmal wissen will: Wie sah der Mann eigentlich aus, dem du nun schon so viele Lesestunden gewidmet hast? Bildnisse Siemsens, gleich welcher Art, haben sich indes nur sehr wenige erhalten.
Erstens ein Porträtfoto des jungen Hans Siemsen, wohl aus den frühen 1920er-Jahren, das auch auf Dieter Sudhoffs Hans Siemsen Lesebuch (2003) in graphisch entstellter Form zu sehen ist; zweitens ein Gruppenfoto in der Autobiographie Der Lebensanfänger seines Neffen Pieter Siemsen (2000) aus der gleichen Zeit, mit der Mutter und dem Bruder Karl; drittens ebendort ein weiteres Gruppenfoto von 1935 mit dem Bruder August, dessen Ehefrau Christa, geb. Springmann, und der Schwester Paula, verh. Eskuchen; viertens ein Porträtfoto en profil im Fiche de Renseignements von 1940, das auch für die Gedenktafel in Sanary-sur-mer verwendet wurde; und fünftens schließlich eine Karikatur von B. F. Dolbin, ebenfalls im Profil.
Aus den Daten zu Leben und Werk, die Michael Föster im Anhang (S. 251 ff.) zum ersten Band seiner Siemsen-Ausgabe (1986) zusammengestellt hat, wusste ich, dass die Freundin Renée Sintenis 1924 [recte: 1923] eine Büste von Hans Siemsen modelliert hat. Es waren aber schon einige Recherchen vonnöten, immerhin ein Foto dieses Bildnisses zu finden [siehe Titelbild].
Das sechste und gewiss aussagekräftigste Porträt des 33-jährigen [recte: 32-jährigen] Schriftstellers Hans Siemsen ist reproduziert auf Seite 38 der von Hanna Kiel herausgegebenen Bildmonographie Renée Sintenis, erschienen 1935 im Rembrandt-Verlag, Berlin. Ob die Büste selbst den Weltkrieg überstanden hat und in wessen Besitz sie sich in diesem Fall heute befindet, das konnte ich bisher leider noch nicht herausfinden.
Sehr gern würde ich das Original einmal sehen – und betasten. [Siehe hierzu auch die Kommentare.]
Und dann?
Wednesday, 01. October 2008Nun geht also der US-amerikanische „Rettungsplan”, $ 700.000.000.000 Steuergelder für marode Banken bereitzustellen, in die zweite Runde. Die 228 Abstimmungsgegner, die ihm am vergangenen Mittwoch im House of Representatives eine Abfuhr erteilt haben, wollten nicht einsehen, dass das Versagen der Banker, das überhaupt erst zu dieser weltweit größten Finanzkrise seit 1929 geführt hat, durch ein solches Geschenk nachträglich noch gratifiziert wird. Dass diese „Blockierer”, mehrheitlich Republikaner, dabei vielleicht weniger von ihrem Gewissen als von der Sorge um ihre Wiederwahl am 4. November bestimmt waren, schmälert nicht den Erkenntniswert ihrer Entscheidung. Wäre das fertig geschnürte „Rettungspaket” gleich im ersten Anlauf durchgewunken worden, dann hätte die Botschaft an die freie, man kann auch sagen: ungezügelte Finanzwirtschaft doch gelautet: „Ihr könnt Scheiße bauen, so viel ihr wollt, im Ernstfall tritt immer der Staat für den entstandenen Schaden ein!”
Die Unterstützer dieser größten staatlichen Nothilfe der Geschichte – vom noch amtierenden Präsidenten George W. Bush über die 205 Befürworter der vorläufig gescheiterten Initiative im Repräsentantenhaus bis zu den beiden Präsidentschaftskandidaten, John McCain und Barack Obama – argumentieren mit der Alternativlosigkeit des von Finanzminister Henry Poulsen vorgeschlagenen Bremsmittels: Wenn wir diese bittere Pille nicht schlucken, und zwar so schnell wie möglich, dann geht weltweit alles den Bach runter, was uns in den letzten Jahrzehnten in den Staaten der Ersten Welt als wohlvertrauter Lebenskomfort zur angenehmen Selbstverständlichkeit geworden ist: Wohlstand, Freiheit, Sicherheit, Mobilität, Gesundheit, Sozialfürsorge, Bildung und Entwicklung – unsere ganze spätbürgerliche Saturiertheit im Turbokapitalismus steht plötzlich vorm Abgrund.
Ein Satz, der in der Berichterstattung über die aktuelle Finanzkrise immer wieder zu hören war, lautet etwa so: „Das Vertrauen in die Selbstregelungsmechanismen der freien Wirtschaft steht auf dem Spiel.” Nun mag man sich fragen, ob denn die Macher der herrschenden Verhältnisse ihre Macht in der Vergangenheit tatsächlich auf nicht mehr gegründet haben als auf dieses Vertrauen. Und man mag sich weiter fragen, warum den vertrauensseligen Nutznießern dieser Blauäugigkeit, den verbleibenden 99,9 Prozent der Menschheit in den Wohlstandsländern, kaum jemals wirksame Zweifel gekommen sind, ob denn angesichts der alltäglichen Hiobsbotschaften in der Tagesschau das Prinzip „grenzenloses Wachstum” auf einem naturgemäß begrenzten Globus nicht bald einmal zum globalen Kollaps führen müsse. Aber die sedierende Macht der Gewohnheit ist offenbar stärker als die kritische Kraft der Vernunft.
Ein Wort, das in den vergangenen Tagen in den Medien ebenfalls Hochkonjunktur hatte: „Panik”. Die Panik an der Börse, die Panik der Anleger usw. Das Wort bezeichnet ja ein Bewegungsphänomen irrationaler Beschleunigung von Massen. Gestern etwa wurden mindestens 147 hinduistische Pilger in der indischen Stadt Jodhphur totgetrampelt, weil sich das Gerücht verbreitete, in dem Tempel Chamunda Devi, dem Tausende entgegenstrebten, ticke eine Bombe. Panik löst eine Fluchtbewegung aus, die mindestens für einen Teil der Fliehenden tödlich endet.
Ganz gleich, wie die für heute Abend angekündigte Abstimmung im US-Senat über Poulsens 700-Milliarden-Paket ausgeht: Die Panik wird kommen, wenn nicht heute, dann morgen. Und dann?
Wahn hoch 64
Tuesday, 30. September 2008Vom 11. bis zum 30. Oktober findet in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn der Kampf um die Schachweltmeisterschaft zwischen dem amtierenden Weltmeister, dem 38-jährigen Inder Viswanathan Anand (ELO 2783), und seinem Herausforderer, dem 33-jährigen Russen Wladimir Kramnik (ELO 2772), statt. Am gleichen Ort verlor Kramnik Ende 2006 in einem auf sechs Partien festgesetzten Wettkampf gegen das Schachprogramm Deep Fritz, nachdem ihm in der zweiten Partie der „Patzer des Jahrhunderts” (Susan Polgar) unterlaufen war: zum Wahnsinnigwerden.
Foster Wallace zitiert in seinem Buch über den Mathematiker Georg Cantor (1845-1918) den englischen Schriftsteller G. K. Chesterton: „Dichter werden nicht verrückt, Schachspieler schon. Mathematiker werden verrückt und Kassierer, schöpferische Künstler sehr selten. Ich wende mich nicht gegen die Logik: Ich sage nur, dass diese Gefahr [verrückt zu werden] in der Logik, nicht in der Vorstellungskraft liegt.” (David Foster Wallace: Georg Cantor. Der Jahrhundertmathematiker und die Entdeckung des Unendlichen. München: Piper Verlag, 2007, S. 12.)
Anand hat gerade der verbreiteten Auffassung widersprochen, dass professionelle Schachspieler unverhältnismäßig häufig im Wahnsinn enden: „Man braucht ein Leben abseits des Schachs, dann besteht keine Gefahr. Man muss sich andere Interessen bewahren. Wirklich krank wurden nicht so viele. Nur werden diese Fälle gleich einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Bestimmt gibt es ebenso viele verrückte Ärzte oder Busfahrer.” (Ansbert Kneip u. Maik Großekathöfer: „Schach ist Schauspielerei”. Interview mit Viswanathan Anand; zit nach: Spiegel online, 29. September 2008.)
Na, ich weiß nicht. Zumindest nach der Lektüre des Standardwerks zum Thema, von dem erstklassigen Schachspieler (ELO 2762) und Psychoanalytiker Reuben Fine (1914-1993), kommt man zu einem anderen Ergebnis. Abgesehen davon, dass etliche Großmeister des Schachspiels einen ausgeprägten Hang zum Größenwahn bis hin zu Allmachtsphantasien hatten, was man noch mit ihrem unvermeidlichen Weltruhm entschuldigen mag: Die Liste der verrückten Meister auf den 64 Feldern ist lang. Paul Morphy und Wilhelm Steinitz litten unter psychotischen Wahnvorstellungen. Auch Aaron Nimzowitsch und Akiba Rubinstein zeigten gelegentlich ein, gelinde gesagt, auffälliges Verhalten. Ersterer machte neben dem Schachbrett Kopfstandübungen, Rubinstein sprang aus dem Fenster, wenn er sich von einem Zuschauer bei einer Partie „verfolgt” fühlte. José Raúl Capablanca litt unter Donjuanismus, der paranoide Antisemit Alexander Aljechin war ein ausgesprochener Sadist und verfiel dem Alkohol, ebenso wie Joseph Henry Blackburne, genannt „the Black Death”. Und in neuerer Zeit hat Bobby Fischer mit seinen zahllosen Spleens am Schachbrett und mit seinen abstrusen politischen Ansichten diese Ahnenreihe der Schachverrückten würdig fortgesetzt. (Vgl. Reuben Fine: Die Psychologie des Schachspielers. A. d. Am. v. Reinhard Kaiser. Frankfurt am Main: Syndikat Autoren- und Verlagsgesellschaft, 1982.)
Zugegeben: Es gibt auch namhafte Gegenbeispiele, großartige Schachspieler, die zeitlebens bei völliger geistiger Gesundheit auf höchstem Niveau spielten, daneben ein ausgeglichenes Familienleben pflegten und sogar einem bürgerlichen Beruf nachgingen, wie etwa Adolf Anderssen, Max Euwe, Siegbert Tarrasch oder Emanuel Lasker. Ich schlage zwischen den beiden Standpunkten folgende argumentative Rochade vor: Man muss nicht verrückt sein, um Schachweltmeister zu werden; aber man läuft Gefahr, verrückt zu werden, wenn man das Schachspiel zu seinem einzigen Daseinsmittelpunkt macht.
[Titelbild: Joseph Henry Blackburne. Karikatur aus Vanity Fair.]
Dingwelt (IV)
Monday, 29. September 2008Diese aparte Skulptur, gefeilt, geschliffen und poliert aus Speckstein (Steatit), acht Zentimeter lang und fünf Zentimeter breit, 72 Gramm schwer, ist keine Plastik von Henry Moore, sondern Ergebnis häuslicher Handarbeit meiner Freundin Sabine P., ein Geschenk zu meinem 40. Geburtstag.
In seiner zweckfreien Existenz, nutzlos wie ein Kropf, hätte sie ein utilitaristischer Zeitgenosse als Staubfänger denunziert und, ohne auch nur ein Wort darüber zu verlieren, in den Abfall befördert. Nicht so ich.
Zwar hat das Figürchen, das mich in seiner spiraligen Form je nach Perspektive manchmal an den Oberkörper einer lockenden Marketenderin, manchmal an eine aus trüben Untiefen auftauchende Qualle erinnert, in den vergangenen zwölf Jahren leicht gelitten. Vom Kopf der bleichen Mutter Courage, bzw. von einem Tentakel der Meduse, ist ein kleines Stückchen abgesprungen, wie ich gerade erst feststellen musste. Und über dem unteren Teil – aber wer will sagen, wo hier unten und oben ist? – hat sich ein feiner Riss gebildet. Darum könnte ich diesen Handschmeichler dennoch niemals wegschmeißen.
Meine Ehrfurcht vor dem namenlosen Gegenstand hat übrigens nichts mit meiner Freundschaft zu Sabine P. zu tun. Es ist vielmehr gerade seine reine Bedeutungs- und Zusammenhanglosigkeit, die mich verpflichtet, ihm meine Treue zu bewahren. Vielleicht ist es sogar angebracht, dass ich hier mein Mitleid mit ihm bekunde.
Es lag mir noch nie besonders, Befehle zu erteilen. Sonst würde ich vielleicht verfügen, mir ihn – oder es? oder sie? – mit ins Grab zu legen, wenn ich für wahrscheinlich hielte, dass mir dereinst ein Grab beschieden ist; und dass es, wenn mein Stündlein geschlagen hat, noch Menschen gibt, die ihre Aufmerksamkeit den Bestattungswünschen eines Ahnen widmen können. Aber wer will das hoffen? Und warum? Der Schmelzpunkt von Steatit liegt übrigens bei lächerlichen 1635 °C.
Oikos
Sunday, 28. September 2008Ich trachte in jeder wachen Minute nach Einsicht und Erkenntnis. Das ist kein leichtes Los. Nur zu oft stoße ich dabei an meine Grenzen, niemals meines Interesses, sondern an jene, die mir meine beschränkte Vorbildung setzt. Weil mir mein Mathematiklehrer ab der Obertertia die Grundlagen der Infinitesimalrechnung nicht vermitteln konnte, scheitere ich nun bei dem Versuch, das Buch von David Foster Wallace über den „Jahrhundertmathematiker” Georg Cantor und seine „Entdeckung des Unendlichen” zu verstehen. (A. d. Am. v. Helmut Reuter u. Thorsten Schmidt. München: Piper Verlag, 2007.) Solch ein Handicap wurmt mich schrecklich und kann mir das ganze Wochenende versauen.
Aber das Essener Gymnasium, das ich in den Jahren 1967 bis 1976 besuchte, hat mich noch mit ganz anderen Defiziten ins Leben entlassen. So standen dort weder Ökonomie noch gar Ökologie auf dem Lehrplan. Deshalb bin ich weit davon entfernt, die Ursachen des gegenwärtigen Finanzdebakels in den USA zu durchschauen. Immerhin weiß ich aus dem Geschichtsunterricht, dass durch den New Yorker Börsencrash vom 24. Oktober 1929, dem legendären „Black Thursday“, eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst wurde, die nicht unwesentlich zur Massenarbeitslosigkeit im Deutschen Reich beitrug – und damit zu Hitlers „Machtergreifung”, zum „Ausbruch” des Zweiten Weltkriegs und zum größten Genozid der (bisherigen) Menschheitsgeschichte. Was sich jetzt in unserer globalisierten Weltwirtschaft seit dem 15. September abspielt, als die US-amerikanische Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz anmelden musste, das kommt den verhängnisvollen Ereignissen vor 79 Jahren jedenfalls näher als jedes vergleichbare Krisengeschehen zuvor. Der aktuelle Wirtschafts-GAU verhält sich zur Ölkrise von 1973 und zur New-Economy-Krise im Gefolge von 9/11 wie die Pest zu einem gewöhnlichen Schnupfen, das begreife sogar ich mit meinem beschränkten ökonomischen Verstand. Wenn selbst der dem rechten SPD-Flügel zuzurechnende Finanzminister Peer Steinbrück angesichts dieses Debakels im Spiegel-Gespräch einräumt, „dass gewisse Teile der marxistischen Theorie doch nicht so verkehrt sind”, dann ist das schon alarmierend.
Hinzu kommt, dass die Pleitewelle mitten in die heiße Phase des Wahlkampfs in den USA fällt, in dem sich der Republikaner John McCain als Fachmann für die Außenpolitik (Krieg gegen die Taliban und al-Qaida im Irak, Afghanistan und Pakistan) zu profilieren sucht, während sein Widersacher, der Demokrat Barack Obama, seinen Wählern verspricht, die marode Wirtschaft im Lande zu sanieren und ihnen wieder zu Arbeitsplätzen und Wohlstand zu verhelfen. Kein Wunder also, dass nach der Lehman-Pleite Obamas Umfragewerte nach oben schossen. McCain benötigt nun – horribile dictu! – dringend ein schweres islamistisches Attentat, möglichst auf heimischem Boden, um wieder Anschluss zu gewinnen. Dabei gerät freilich das noch wichtigere Thema, die bevorstehende ökologische Katastrophe, völlig aus dem Blick.
Die beiden Ö-Wörter, Ökologie und Ökonomie, leiten sich ja einerseits vom griechischen „Oikos” ab, das zugleich Haus, Haushalt, Familie, Großfamilie, Sippe, Stamm, Abstammung, Geschlecht und alle zu einem Haus gehörenden Menschen einschließlich der Sklaven bedeutet. Andererseits unterscheiden sich die Fachbegriffe durch ihre Endungen: -logie (von griech. „Logos”, Lehre) bzw. -nomie (von griech. „Nomos”, Gesetz). Interessant ist der Vergleich mit dem ähnlichen Begriffspaar Astrologie und Astronomie. Letztere ist ursprünglich die Wissenschaft von den Gesetzen, nach denen die Himmelskörper sich bewegen, während Erstere, die Sterndeutung, eine mittlerweile eher obskure Lehre ist, kaum seriöser als reine Kaffeesatzleserei. Und so werden auch die klugen Einsichten und Warnungen der Ökologen von den Mächtigen in Politik und Wirtschaft noch immer nicht so ernst genommen, wie sie’s verdienten.
Das griechische Wort Oikos kommt in der Bibel an zahlreichen Stellen vor. Eine besonders bedenkenswerte Ermahnung findet sich im Neuen Testament, wo Jesus bei der Tempelreinigung zu den Taubenhändlern sagt: „Schafft das hier weg, macht das Haus [oikos] meines Vaters nicht zu einer Markthalle!” (Joh. 2.16) Genau dies jedoch ist in den letzten zweitausend Jahren geschehen. Und jetzt steht diese Markthalle erneut unmittelbar vor dem Konkurs – mit katastrophalen Folgen für das „Haus des Vaters”, den Tempel der Natur: die Biosphäre.
Spiel (II)
Saturday, 27. September 2008Partie in der „Schacharena“, Sargon – Revierflaneur (26.09.08, 15:47 bis 16:52 Uhr): 1. Sg1-f3. Das ist die nach dem polnisch-deutschen Schachmeister Johannes Hermann Zukertort (1842-1888, s. Titelbild) benannte Eröffnung. Als der zeitweise neben Steinitz stärkste Schachspieler der Welt sie in die Turnierpraxis einführte, erregte er damit einiges Aufsehen. „Bizarr” – so das Urteil der Zeitgenossen. Ich hatte mit dieser selten gespielten Eröffnung (ECO-Code A04-A09) keinerlei Erfahrung und spielte 1. … d7-d5, was sich wohl auch als gebräuchlichste Erwiderung durchgesetzt hat (A06-A09). – Als spielbar gelten auch die passiveren Entgegnungen 1. … Sg8-f6 (A04) und 1. … g2-g3 (A05).
Sargon spielte nun weiter wie der klassische Zukertort: 2. d2-d4. Dies ist spätestens seit den 1920er-Jahren außer Gebrauch gekommen, als der tschechoslowakische Großmeister Richard Réti (1889-1929) den Zug 2. c2-c4 einführte und damit als Schöpfer der Réti-Eröffnung (A09) in die Schachgeschichte einging. Geläufig sind daneben heute noch die Züge 2. b2-b4 (A06) und 2. g2-g3 (A07). – Und so ging’s weiter: 2. … e7-e6 3. Dd1-d3 Sb8-c6 4. a2-a3 a7-a6 5. Lc1-f4 Lf8-d6 6. Lf4xd6 Dd8xd6 7. e2-e4. Sg8-e7. (Hier hätte ich offensiver 7. … Dd6-f4 spielen können, mit der Drohung Df4-c1† und Verlust des Ta1. Stattdessen droht nun 8. e5-e6 und meine Dame wäre zum Rückzug gezwungen, doch Weiß spielt anders.) 8. Dd3-e3 d5xe4 9. De3xe4 f7-f5 10. De4-e3 Se7-d5.
Ein riskantes Spiel, auf das ich mich da einlasse: 11. De3-g5. Möglich wäre 11. … g7-g6, aber die Rochade schien mir besser: 11. …0-0 12. c2-c3, womit mir Weiß die Offensive überlässt: 12. … h7-h6 13. Dg5-g3. Dieses Tauschangebot wollte ich nicht annehmen: 13. … e6-e5 14. Sf3xe5 Sc6xe5 15. d4xe5 Dd6-b6 – mit der erneuten Drohung, über Db6xb2 den Ta1 zu schlagen, die mit 16. b2-b4 zunächst aus der Welt geschafft wird. Aber es gibt ja noch ein viel attraktiveres Opfer unter den Weißhäuten: 16. … f5-f4 17. Dg3-f3 c7-c6 18. Lf1-c4 Lc8-e6 19. 0-0 Tf8-f5 20. Tf1-e1 Ta8-e8 21. a3-a4 Db6-c7 22. g2-g4. – Wie schön, dass vor einem halben Jahrhundert die En-passant-Regel eingeführt wurde! 22. … f4xg3 23. Df3xg3. Das ist natürlich verhängnisvoll, aber ich sehe auch keinen besseren Zug. Der Verlust der weißen Dame ist wohl unvermeidbar: 23. … Tf5-g5 24. Dg3xg5 h6xg5 25. Lc4xd5 Le6xd5 26. Sb1-d2 Te8xe5 27. c3-c4 Te5xe1 28. Ta1xe1 Ld5-f7 29. Sd2-e4 g5-g4 30. Sg4-e3 g7-g6 (um dem Se3 die Felder h5 und f5 zu verstellen). 31. b4-b5 a6-a5 32. c4-c5 Lf7-b3 33. Te1-e4 Dc7-d7 34. b5-b6 Dd7-d1† 35. Sg3-f1.
Und nun mache ich meinen spielentscheidenden Fehler! Nach 35. … Dd1-f3 hätte noch 36. Te4-e8† Kg8-g7 37. Te8-e7† Kg7-f6 folgen können. Entweder droht Weiß nun der Verlust des Turms, oder er rettet ihn vorläufig (38. Te7-h7 oder Te7xb7). Doch mein Zug 38. … Lb3-d5 hätte anschließend unausweichlich zum Matt geführt. (Auch 38. Te7-d7 verzögert dieses Matt bzw. den Turmverlust nur um einen Zug mit 38. … Kf6-d6.)
Stattdessen ziehe ich 35. … Lb3-d5, und die schon gewonnen geglaubte Partie geht verloren, zumal ich nach 36. Te4-e7 zum zweiten Mal das sichere Matt durch 36. … Dd1-f3 verpasse und stattdessen 36. … Ld5-h1 ziehe. 37. Te7-e3 Kg8-f7 38. h2-h3 g4xh3 39. Te3xh3 Dd1-g4† 40. Th3-g3 Dg4-e4 41. Sf1-d2 De4-e1 42. Sd2-f1 Lh1-e4 43. Tg3-e3 De1-b4 44. Sf1-g3 Db4-b1† 45. Kg1-h1 Le4-f5 46. Sg3-e2 Db1-f1 47. Kh2-g3 Df1-h3 48. Kg3-f4 Dh3-g4† 49. Kf4-e5 Dg4-c4 50. Ke5-d6 Dc4-d5† 51. Kd6-c7 Dd5-d7† 52. Kc7-b8 Dd7-d8† 53. Kb8-a7 Lf5-d3 54. Te3-f3† Kf7-e6 55. Se2-f4† Ke6-e5 56. Se4xd3 Ke5-d4 57. Tf3-f7 Kd4xd3 58. Tf7xb7 Dd8-d4 59. Tb7-f7 Dd4xa4 60. b6-b7 Da4-b5 61. b7-b8D Db5xc5† 62. Db8-b6 Dc5xb6† 63. Ka7xb6 a5-a4 64. Kb6xc6 Kd3-e2 65. f2-f4 a4-a3 66. Kc6-d5 Ke2-f3 67. Kd5-e5 a3-a2 68. Tf7-a7 Kf3-g4 69. Ta7xa2 g6-g5 70. f4-f5 Kg4-h4 71. f5-f6 g5-g4 72. f6-f7 g4-g3 73. f7-f8D g2-g3 74. Ta2xg2 Kh4-h3 75. Df8-g8 aufgegeben. Wieder mal erweist sich, dass ich auf der Siegerstraße übermütig werde und meinen kühlen Kopf verliere. Selbst nach den beiden verpassten Siegchancen hätte ich vermutlich das Ruder noch rumreißen können und mindestens ein Remis herausholen müssen. Aber das will ich hier gar nicht mehr im Detail analysieren. Schade!
Volksopium
Friday, 26. September 2008Es gibt eine, vielleicht zwei Handvoll Sätze, die in ihrer durchschlagenden Wirkung auf das Bewusstsein der Menschen folgenreicher gewesen sein mögen als tausend kluge Bücher. Einer dieser Sätze lautet: „Religion ist Opium fürs Volk.” Seine Strahlkraft reicht bis in die Gegenwart und in die Popkultur. So brachte die Düsseldorfer Punkrockband Die Toten Hosen 1996 eine Platte mit dem Titel Opium fürs Volk heraus. Im Booklet zur CD ist u. a. Lenin als Redner vor Arbeitern zu sehen, vermutlich aber nicht, weil er öfter mal als Urheber des Zitats genannt wird, sondern weil auch die kommunistische Propaganda als eine modernere Form von „Opium fürs Volk” bloßgestellt werden soll. Schließlich hatte Campino schon zehn Jahre vorher prophezeit: „Das Ende ist nah, / für Lenin und Marx, / das Ende ist nah.” (Refrain von Disco in Moskau auf Damenwahl).
Die unverbesserlichen Besserwisser weisen dankenswerterweise ein ums andere Mal fröhlich pfeifend darauf hin, dass der Satz erstens nicht von Lenin stammt, sondern von Karl Marx; und dass er zweitens richtig lautet: „Religion ist das Opium des Volkes.” Nichts macht bekanntlich mehr Spaß, als Besserwisser zu belehren, besonders dann, wenn sie ihren Spitzfindigkeiten den Ritterschlag einer tieferen Bedeutung geben wollen. In diesem Falle meinen sie, dass ein entscheidender Unterschied bestehe zwischen „Opium fürs Volk” und „Opium des Volkes”. In der ersten Variante werde der Schwarze Peter den Herrschenden zugeschoben, die das willenlose Volk mit der Droge Religion vergiften, während das Marxsche Originalzitat dem Volk die Schuld gebe, das nach dem Trost spendenden Rausch selbst verlange. Wenn wir im Bilde bleiben, wird die Absurdität dieser Argumentation schnell offenkundig. Wir müssten dann die Junkies in unseren Städten hart bestrafen, statt ihnen Therapieangebote auf Kosten der Allgemeinheit zu machen, während die Dealer straffrei davonkämen.
Auch mit ihrem Nachweis der Urheberschaft des berühmten, viel zitierten Satzes liegen die Besserwisser nur halb richtig. Auf Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin, kann man sich durchaus auch berufen. In seinem heute noch lesenswerten Aufsatz Über das Verhältnis der Arbeiterpartei zur Religion schreibt er: „Die Religion ist das Opium des Volkes – dieser Ausspruch von Marx bildet den Eckpfeiler der ganzen Weltanschauung des Marxismus in der Frage der Religion. Der Marxismus betrachtet alle heutigen Religionen und Kirchen, alle religiösen Organisationen stets als Organe der bürgerlichen Reaktion, die die Ausbeutung verteidigen und die Arbeiterklasse verdummen und umnebeln sollen.” (Zuerst ersch. in: Proletary, Paris, Nr. 45 v. 13. Mai 1909.)
Dieser „Ausspruch von Marx” findet sich in der Einleitung zu dessen Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie und lautet im Zusammenhang: „Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. – Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist.” (Zuerst ersch. in: Deutsch-Französische Jahrbücher. Paris 1944.) – Übrigens hört man den Satz oft falsch betont. Es muss nicht heißen: „Religion ist das Opium des Volkes.” Denn das würde ja unterstellen, dieses Rauschmittel sei eigentlich eine Droge der herrschenden Klasse gewesen, was weder in Asien noch in Europa je der Fall war. Vielmehr ist der Ausspruch nur mit dieser Betonung plausibel: „Religion ist das Opium des Volkes.”
Einiges spricht dafür, dass Karl Marx sich zu seinem Satz von Heinrich Heine inspirieren ließ, den er 1843 persönlich kennen gelernt hatte. Der Dichter hatte 1840 in seiner Denkschrift Über Ludwig Börne geschrieben: „Heil einer Religion, die dem leidenden Menschengeschlecht in den bittern Kelch einige süße, einschläfernde Tropfen goß, geistiges Opium, einige Tropfen Liebe, Hoffnung und Glauben!”
Langsam!
Thursday, 25. September 2008Gestern stellte der Berliner Verleger Peter Moses-Krause (65) in der Stadtbibliothek Essen Hans Siemsen vor, dessen Feuilletons aus den Jahren 1919 bis 1950 er in einem Auswahlband vorgelegt hat. Ins Programm seines seit 1977 ebenso tapfer wie unverdrossen gegen die Übernahme durch die seelenlosen Branchenriesen kämpfenden Verlages Das Arsenal passt Siemsen insofern gut, als dort auch andere Meister der „Kleinen Form” eine Heimat gefunden haben: Victor Auburtin, Béla Balász, Arthur Eloesser und Franz Hessel.
Gleich eingangs stellte Moses-Krause klar, dass erstens sein Auftritt an diesem Ort eigentlich auf einem Missverständnis beruhe. Der Veranstalter hatte Hans Siemsen in seiner Ankündigung als einen „wiederentdeckten Essener Autor” propagiert, der er ja nun keineswegs war. Seine letzten sechzehn Lebensjahre verbrachte Siemsen zwar im Otto-Hue-Haus, einem Altersheim der Arbeiterwohlfahrt in Essen, wo er schließlich auch am 23. Juni 1969 im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Aber in dieser Zeit hat er keine Zeile mehr zu Papier gebracht. Und zweitens, so der Verleger, müsste eigentlich ein anderer, berufenerer Siemsen-Kenner vor uns auf der Bühne sitzen, nämlich Dieter Sudhoff, der Herausgeber der Sammlung, der im vorigen Jahr im Alter von nur 52 Jahren einem Herzinfarkt erlag.
Moses-Krause widerstand dankenswerterweise der Versuchung, seinen Vortrag mit allzu vielen Kostproben aus Siemsens Werk zu überfrachten. Diese ebenso kurzen wie konzentrierten Texte führen, wollte man einen nach dem anderen „weglesen”, recht bald zur Übersättigung und stehlen sich sozusagen dann gegenseitig die Schau. Nur fünf Feuilletons wurden zu Gehör gebracht: Der Floh im Tasso; Baggesen im Wintergarten; Gartenhaus, I. Etage; Zerstörte Schönheit; Döblin. Eine zwar subjektive, aber durchaus stimmige Auswahl.
Da ich nun aber genug Lob gespendet habe, kann ich mir eine kleine Kritik nicht verkneifen: Moses-Krause las zu schnell, sowohl für seine Verhältnisse, denn er verhaspelte sich des Öfteren; als auch und erst recht für Siemsens Ansprüche. „Nein! Langsam! Langsam!” – so steht’s doch ausdrücklich vorn auf dem schönen schmalen Buch (das, nebenbei bemerkt, sogar fadengeheftet ist), über der Zeichnung von George Grosz [Bei Aschinger, siehe Titelbild]. Warum so eilig? Dies der Titel eines anderen Textes in der verdienstvollen Sammlung. Ja, warum nur?
Hauptsächlich aber erzählte der Verleger von dem tragisch scheiternden Menschen Hans Siemsen. Wer er war und was er wollte. Was er konnte und woran er zerbrach. Kenntnisreich und ohne gravierende Fehler. Gern würde Moses-Krause, glaubt man seinem Bekenntnis, einen weiteren Band von diesem vergessenen Autor veröffentlichen; etwa mit Siemsens Schriften zum Film, die unbedingt eine Wiederentdeckung lohnen. Doch dazu bedürfte es der Ermutigung durch das Interesse der Leser, die allerdings in der Essener Stadtbibliothek am gestrigen Abend leider ausblieb: Die zahlenden und kaufenden Zuhörer waren an den Fingern einer Hand abzuzählen.
[Hans Siemsen: Nein! Langsam! Langsam! Herausgegeben und mit einem Nachwort von Dieter Sudhoff. Berlin: Verlag Das Arsenal, 2008.]
Ausgezählt
Wednesday, 24. September 2008Zur Abwechslung mal eine Kulturnachricht aus der Provinzhauptstadt an der Ruhr. Am vergangenen Montag wurde der Gründungsintendant der Essener Philharmonie, Michael Kaufmann (47), im sechsten Jahr seiner Tätigkeit vom 13-köpfigen Aufsichtsrat der Essener Theater und Philharmonie GmbH (TuP) „wegen wiederholter Etatüberschreitung” fristlos entlassen. Mit diesem „Höhepunkt einer hässlichen Sinfonie voller scharfer Dissonanzen” (Neue Osnabrücker Zeitung) ziehen die wirtschaftlich für dieses Abenteuer Verantwortlichen nun die Notbremse.
Allerdings muss sich diese “Wilde Dreizehn” wohl die Frage gefallen lassen, warum sie zwei Spielzeiten lang der eigenmächtigen Etatüberschreitung ihres Intendanten um mittlerweile 1,5 Millionen Euro zugesehen haben. Und warum sie dessen blauäugige Hans-guck-in-die-Luft-Mentalitat erst im vorigen Jahr mit einer Vertragsverlängerung bis 2013 belohnt haben. Wie soll ein solches Konzerthaus Bestand oder gar eine Zukunft haben, wenn von seinen 1.900 Stühlen im Durchschnitt pro Veranstaltung nur 722 (38 Prozent) besetzt sind, und davon noch etliche durch Besucher mit Freikarten? Das sollte selbst einem schlechten Kaufmann einleuchten, Sponsoren hin oder her. Zum Thema der unzureichenden Auslastung der Essener Philharmonie habe ich schon im April 2007 einen kritischen Beitrag geschrieben, damals noch bei Westropolis: „Jetzt sind unkonventionelle Ideen gefragt, um neue Besucher zu gewinnen. […] Und diese Ideen müssen von Kaufmann recht bald einmal kommen – sonst sind (nach meiner unmaßgeblichen Einschätzung) seine Tage in Essen gezählt.” Die Ideen kamen nicht in den seither verstrichenen 515 Tagen – und jetzt ist Kaufmann ausgezählt.
Offenbar haben sich der Aufsichtsratsvorsitzende der TuP, Hans Schippmann (CDU), und seine zwölf Verschworenen zu lange von den unbestreitbaren künstlerischen Erfolgen des guten Prof. Kaufmann blenden lassen. Immerhin zeichnete der angesehene Deutsche Musikverleger-Verband ihn erst neulich noch für das beste Konzertprogramm der letzten Spielzeit aus. Der immer optimistisch strahlende Intendant war zudem bei seinen Mitarbeitern überaus beliebt. So beliebt, dass seine Pressesprecherin ihm nach dem Rauswurf noch mit einer offiziellen Presseerklärung der Philharmonie ihre Solidarität bekundete – und dafür gleich auch ihren Hut nehmen durfte.
Mindestens vorübergehend war Michael Kaufmann auch erfolgreich beim Eintreiben von Sponsorengeldern. Seit aber feststand, dass Essen die Kulturhauptstadt 2010 ist, waren die Wartezimmerstühle vor den Vorstandsbüros in den großen Firmen wohl deutlich besser besetzt als die Stühle des Musentempels an der Huyssenallee. Die Gelder wurden knapper. Erstaunlich immerhin, dass noch vor wenigen Tagen die Gründung eines „Kuratoriums der Philharmonie Essen” bekannt gegeben wurde, initiiert vom Vorstandsvorsitzenden der MAN Ferrostaal AG, Dr. Matthias Mitscherlich, und mit Beteiligung weiterer sieben Großunternehmen. Nun nennt Mitscherlich die Entlassung Kaufmanns „absolut unwürdig für eine Kulturhauptstadt, schädlich für Essen und abschreckend für Geldgeber”.
Dass die Entlassung Kaufmanns falsch war, sagt der MAN-Vorstandschef freilich nicht. Er stört sich bloß an der Form des „Vorgangs” – vermutlich, weil er davon erst aus der WAZ erfuhr. Solche gekränkte Eitelkeiten von Leuten, die fremdes Geld verteilen, fehlen noch, um das Bild einer Provinzposse zu vervollständigen. Und als i-Tüpfelchen möchte ich noch den Kommentar des Leiters der Stadtredaktion des hiesigen Provinzblättchens zitieren: „Dass auch ein Intendant sich an sein Budget halten muss, ist unstrittig. Das muss heute jede Führungskraft in seinem [!] Unternehmen.” Sollte Kaufmann von einer Intendantin abgelöst werden, muss Wulf Mämpel auf seine alten Tage noch deutsche Grammatik lernen. Dann sind wir endlich gewappnet für die Kulturhauptstadt Europas.
Der Flüsterer
Tuesday, 23. September 2008Ein Dutzend Buchveröffentlichungen zu Lebzeiten, dazu über 200 Zeitungsartikel zwischen 1913 und 1950 verzeichnet meine Hans-Siemsen-Bibliographie mittlerweile, und es kommen ständig neue Textfunde hinzu. Siemsen, dessen literarischer Leistung man wohl am ehesten gerecht wird, ohne seine Bedeutung überzubewerten, wenn man ihn einen „Kleinmeister der kleinen Form” nennt, wurde nach seinem Tod 1969 im Otto-Hue-Altenheim der Arbeiterwohlfahrt in Essen-Holsterhausen gleich zweimal wiederentdeckt. In den 1980er-Jahren gab der Essener Verleger Michael Föster-Düppe in seinem Torso-Verlag eine dreibändige Ausgabe von Siemsens Schriften heraus. Und erst jüngst stellte der Literaturwissenschaftler Dieter Sudhoff zwei Sammlungen seiner Feuilletons zusammen. Sowohl Föster-Düppe (1942-1996) als auch Sudhoff (1955-2007) sind leider allzu jung verstorben.
Siemsen hat sich schon in einer Zeit, als dies noch mit großen persönlichen Risiken verbunden war, offen zu seiner Homosexualität bekannt, was ihn posthum, in der Zeit des Coming-out seit den 1970er-Jahren, zu einem Vorkämpfer der Schwulenbewegung gemacht hat. Dabei steht dieses Thema in seinem Werk durchaus nicht im Vordergrund, von den „Jungensgeschichten” in Das Tigerschiff (1923) einmal abgesehen.
Wenn man um seine sexuelle Orientierung weiß, dann erklärt man sich vielleicht die Zartheit seines Tonfalls, seine geschärfte Sensibilität, seinen Blick auf das Unscheinbare damit und findet bei ihm möglicherweise gar den typischen Ausdruck einer „schwulen Ästhetik”. Das kann aber ebenso gut auch reine Einbildung sein und der Leser sollte sich hüten, sich im Zuge einer solchen Interpretation zu neuen Vorurteilen verleiten zu lassen.
Folgende Schwerpunkte in der Themenwahl des Feuilletonisten Hans Siemsen in den Jahren zwischen den Weltkriegen lassen sich ausmachen: Film, Varieté, Kunst, Literatur und Reiseimpressionen. Ein im engeren Sinne politischer Autor war er nicht, wenngleich die Zeitläufte ihn zwangen, Stellung zu beziehen. Mit seinem Reisebuch Russland ja und nein (1931) und seinem Erlebnisbericht Die Geschichte des Hitlerjungen Adolf Goers (engl. 1940, dt. 1947) hat er zuletzt zwei hochpolitische Werke vorgelegt, deren Tendenz aber nicht ideologisch determiniert ist, sondern – wie zuvor schon Die Geschichte meines Bruders (1923) – einem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden folgt.
Was mich aber hauptsächlich an Hans Siemsens Texten fasziniert, das ist ihr völliger Verzicht auf kraftmeierisches Auftrumpfen. Nirgends sagt er direkt oder auch nur hinter vorgehaltener Hand Sätze wie diese: ,Ich weiß, was wahr und was falsch ist! Ich hatte ein starkes Erlebnis! Was ich jetzt erzähle, haut euch garantiert vom Hocker, denn es ist völlig neu und überraschend!‘ Ganz im Gegenteil ist seine Tonlage die einer leisen Behutsamkeit – und das in den Roaring Twenties, die uns im Rückblick erscheinen mögen wie ein nicht enden wollendes Silvesterfeuerwerk vor den tausendjährigen Jahren der Finsternis.
GEZ
Monday, 22. September 2008In der vorigen Woche bekamen wir unangemeldeten Besuch. Vor der Wohnungstür stand ein ernster Herr mittleren Alters, nennen wir ihn Spyri, der mir ein Schreiben mit dem Briefkopf des Westdeutschen Rundfunks (WDR) unter die Nase hielt, seinen Namen nannte und mich mit den Worten begrüßte: „Sie sind, wie ich hier in meiner Liste sehe, ja auch Kunde bei uns.” Ohne mit der Wimper zu zucken, bestätigte ich dies, schickte allerdings gleich die Einschränkung hinterher: „Ja, allerdings nur als Radiohörer. Ein Fernsehgerät haben wir nach wie vor nicht.”
Erst nachträglich wunderte ich mich, warum sich der Kontrolleur – denn um einen solchen handelte es sich ja wohl – als WDR–Mitarbeiter ausgewiesen hatte und nicht als Emissär der Gebühreneinzugszentrale (GEZ). Inzwischen weiß ich aber, dass diese auf Provisionsbasis tätigen Gebühreneinzugsbeauftragten, wie die Leute im Amtsdeutsch heißen, von den jeweiligen Landesrundfunkanstalten ausgesandt werden. Die GEZ ist lediglich ein Dienstleistungszentrum der Sender und keine rechtsfähige Institution, die einen eigenen „Secret Service” betreiben dürfte.
„Haben Sie kein Fernsehgerät – oder nutzen Sie es nur nicht?” Herr Spyri blätterte dabei in seinen Unterlagen, als könnte er mit ihrer Hilfe den Wahrheitsgehalt meiner Antwort auf diese bohrende Frage unverzüglich überprüfen. Das Rascheln der Papiere hätte einem Schuldbewussten nun wohl wie ein drohendes Donnergrollen erscheinen können, für mich aber galt: ‘A quiet conscience sleeps in thunder!’ „Nein, wir haben keinen Fernseher, ob Sie’s glauben oder nicht!” Daraufhin verabschiedete sich Herr Spyri auch schon wieder. Das war ja, für beide Seiten, ein kurzes Vergnügen.
Zufällig befand ich mich gerade im Begriff, meinen Papierkorb zu den Abfalltonnen zu tragen, als der GEZ-Mann klingelte. Diesen Vorsatz setzte ich nun in die Tat um und trat vors Haus. Da bemerkte ich einen Polizeiwagen, der im Schritttempo unsere stille Einbahnstraße entlangfuhr und dreißig Meter weiter neben Herrn Spyri anhielt. Es kam zu einem kurzen, aber intensiven Austausch zwischen den Ordnungshütern und dem Gebührenfahnder, ganz so, als kenne man sich und kooperiere im besten Einvernehmen.
Ich will mich jetzt aber davor hüten, unbegründbare und erst recht unbeweisbare Verdächtigungen gegen staatliche Beamte oder einen selbstständig tätigen Subunternehmer im Auftrag einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt auszustoßen. Vielleicht haben die Polizisten Herrn Spyri bloß nach dem Weg gefragt? Vielleicht kam er ihnen ja sogar verdächtig vor, wie er da von Haus zu Haus ging, mit seinem Klemmbrett und seinen raschelnden Formularen: „Dürfen wir mal fragen, was Sie hier eigentlich machen?” Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König. Auch ist wohl ein rein’s Gewissen stets ein gutes Ruhekissen.
Dingwelt (III)
Sunday, 21. September 2008Heute: Schachuhr. – Meine habe ich 1981 bei Spielwaren Roskothen am Kornmarkt 7 in der Essener Innenstadt gekauft. Sie hat damals 69,00 D-Mark gekostet, Gehäuse aus Buchenholz, 150 mm breit, 80 mm hoch und 40 mm tief, Uhrenwerke mit goldenen Blenden. Ein zum Verwechseln ähnliches Modell ist heute noch im Handel. Der Preis dafür hat sich erstaunlicherweise nahezu gehalten, während Roskothen vor ein paar Jahren gegen die übermächtige Konkurrenz von Toys “R” Us die Segel streichen musste. Jetzt lockt am Kornmarkt ein 1-Euro-Shop mit seinen Supersonderangeboten: „Nix Teuro – nur ein Euro!”
Für den Schachlaien erkläre ich mal kurz und bündig die Funktionsweise dieses Uhrenzwillings. Die Zifferblätter zeigen die verbleibende Zeit der beiden Spieler an. Bei Blitzschachpartien ist die Bedenkzeit für jeden Spieler auf insgesamt fünf oder zehn Minuten begrenzt, bei Turnierpartien auf ein oder zwei Stunden. Entsprechend werden die beiden Uhrwerke voreingestellt. Die Schachuhr steht an einer Seite des Bretts zwischen den Spielern. Der anziehende Spieler mit den weißen Figuren betätigt nach seinem Eröffnungszug als erster das Knöpfchen über seiner Uhr und setzt damit das Laufwerk der gegnerischen Uhr in Gang. Wenn Schwarz seinen ersten Zug gemacht hat, verfährt er ebenso, und nun tickt wieder die Uhr von Weiß. Wenn die Bedenkzeit eines der beiden Spieler abgelaufen ist, bevor ein reguläres Spielergebnis (Matt, Remis oder Spielaufgabe) erreicht wurde, dann hat dieser durch Zeitüberschreitung verloren. An der Uhr ist dies erkennbar, indem der Minutenzeiger das kleine rote „Fallbeil” kurz vor der Zwölf auf dem Zifferblatt anhebt und schließlich fallen lässt.
Ich habe mich auf dem hölzernen Brett ans Schachspielen mit begrenzter Zeitvorgabe nie gewöhnen können. Immer wieder vergaß ich im Eifer des Gefechts, mein Knöpfchen zu drücken und geriet dadurch in Zeitnot. Darum gab ich, zumal ich nur ein Hobbyspieler bin, das Spiel mit der Schachuhr bald wieder dran. Insofern war die Geldausgabe für diesen speziellen Zeitnehmer eine Fehlinvestition.
Seit ich gelegentlich dem Online-Schachspiel fröne, habe ich aber den besonderen Reiz des Spielens auf Zeit entdeckt. Hier muss man sich um die Schachuhr nicht weiter kümmern. Das Drücken aufs Knöpfchen erübrigt sich, denn die Umstellung auf die Uhr des Gegners erfolgt automatisch, sobald ich meinen Zug vollendet habe.
Was tun mit der Schachuhr in Buchenholz? Neulich kam mir in den Sinn, dass man sie für Streitgespräche zwischen zwei Kontrahenten nutzen könnte. Wie oft hört man doch in solchen verbalen Konflikten den Vorwurf: „Du lässt mich ja nie ausreden!” Oder die rhetorische Frage: „Darf ich vielleicht auch mal etwas sagen?” In solchen Begegnungen könnte die Schachuhr als unbestechlicher Richter über die Einhaltung des fairen Gleichheitsgrundsatzes wertvolle Dienste tun. Wer weiß? Vielleicht wäre manche gescheiterte Ehe mit diesem so einfachen und neutralen Zeitmessgerät zu retten gewesen.
Snapshot (II)
Saturday, 20. September 2008Die Vorhaltungen, die ich häufig von mir wenig gewogenen Fremden zu hören bekomme: dass ich ein unleidlicher Stänkerer sei, ein verkappter Spießer, wie ja schon mein Familienname sagt, ein bornierter Möchtegern-Intellektueller mit Hang zum Elitarismus, ein langweilender Faktenhuber und zugleich cholerischer Haudrauf – geschenkt! Da geht die Kritik der näheren Mitmenschen, die einen Blick auf die Person und nicht bloß auf ihr Geschreibsel tun, schon eher an die Nieren.
Richtig weh tut mir aber nur der Selbsthader. Das unbarmherzige Über-Ich macht mir mit seinem distanzlosen Geraune oft genug das Leben zur Hölle. Schon dass es mich ungefragt duzt! Und immer trifft es mich an meinen jeweils empfindlichsten Punkten. Heute zum Beispiel blies es mir diesen vernichtenden Tadel aufs Wernicke-Areal: ,Du fängst viel an – und führst nichts zu Ende!‘ So hatte ich vor einem Vierteljahr hier eine Serie von Schnappschüssen eröffnet, die über den ersten Beitrag nicht hinauskam.
Ist ja schon gut: ,Wird gemacht, Chef!‘ Setzen wir die Reihe also fort mit einem abgründigen Selbstporträt. Es zeigt den Autor, reflektiert von einer verspiegelten Fensterfront, sich selbst fotografierend und darum sein Gesicht hinter der Kamera verbergend. Das Foto ist von heute Mittag. Unter der Fensterfront, nicht mehr im Bild, befand sich früher eine ölig stinkende Imbissstube, in der ich vor 38 Jahren erstmals auf eigene Faust für 60 Pfennig eine Portion Pommes Mayo pickte.
Das Foto ist eine Fälschung insofern, als ich es bei der Bildbearbeitung vertikal gespiegelt habe. Sonst könntest Du die Firmeninschrift des gegenüberliegenden Geschäfts nur in Spiegelschrift lesen. Ich wollte es Dir aber leicht machen, damit Du auf den ersten Blick begreifst, warum dieser Schnappschuss für mich so aufgeladen ist mit Bedeutung. Dass ausgerechnet ein Geigenbauer jenen Familiennamen trägt, der in meiner Heimatstadt und weit darüber hinaus eine so unrühmliche Bekanntheit erwarb.
(Ich möchte noch aufmerksam machen auf den weißen Stoffbeutel, der unscheinbar zu Füßen des Fotografen an der Trennscheibe zum Gleis der Straßenbahnlinie 106 an der Haltestelle Rüttenscheider Stern lehnt. Er enthält vier soeben erworbene Dinge: drei panierte Fischfilets und eine Portion Kartoffelsalat, die dazu bestimmt sind, die Körperfunktionen des Fotografen für eine weitere Weile in Gang zu halten; und mit diesen das Erinnern, das Nachdenken, das Schreiben – und sein schlechtes, nun besänftigtes Gewissen.)
Montag, 16. Juli 1945: 33°40′ N, 106°28′ W
Friday, 19. September 2008Das Ereignis hat wohl keinen seiner 260 Augenzeugen unbeeindruckt gelassen. Einige lachten, einige weinten. Die meisten schwiegen. Aber keiner würde es je vergessen können. Dass es stattgefunden hatte, sollte der Rest der Menschheit erst drei Wochen später erfahren. Bis dahin wurde das Ereignis vor der Öffentlichkeit als ein Unfall kaschiert, die bedauerliche Explosion eines Munitionsdepots in der Wüste von New Mexico.
Das Experiment „glückte” – wenn man in diesem Fall von Glück sprechen will. Die zur Entfaltung kommende Zerstörungskraft übertraf um ein Vielfaches alles, was der Mensch bisher auf dem Weg von der Steinschleuder bis zur V2 an Mordwerkzeugen ersonnen hatte. Zwei Milliarden Dollar Steuergelder hatten die Vorbereitungen verschlungen. Nun musste die Bombe auch zum Einsatz kommen, um sich bezahlt zu machen.
Die Augenzeugenberichte der Wissenschaftler, die die Wirkung der neuen Waffe berechnet hatten, machen den naiven Leser noch heute schaudern. Diese Mischung aus Erleichterung und Entsetzen, die aus ihnen spricht, sollte zu denken geben. „Ich glaube, einen Augenblick lang dachte ich, die Explosion könnte die ganze Atmosphäre in Brand setzen und so der Welt ein Ende bereiten, obwohl ich wußte, daß das nicht möglich war.”
Emilio Segrè, der italienische Physiker und spätere Nobelpreisträger, der als Jude 1936 zur Emigration aus dem faschistischen Italien gezwungen wurde, seit 1943 als Gruppenleiter am Manhattan-Projekt des Los Alamos National Laboratory mitwirkte und den ich hier zitiere, bewahrte sich bei aller mathematisch-physikalischen Gewissheit jenen Rest irrationalen Zweifels, der vielleicht den besseren Teil unseres begrenzten Verstandes ausmacht.
Gerade einmal 63 Jahre nach dem Experiment bei Alamogordo im US-Bundesstaat New Mexico spielen Prometheus’ Urenkel in der Nähe von Genf wieder einmal Russisches Roulette. Der Large Hadron Collider, den die Physiker dort jüngst in Betrieb genommen haben, ist ebenfalls nicht mehr zu stoppen, hat er doch stolze drei Milliarden Euro Steuergelder verschlungen. Diesmal geht es nicht um den beschleunigten Endsieg über die „Japsen”, sondern um die Sicherung des Energiebedarfs der nach wie vor exponentiell wachsenden Weltbevölkerung. Das kontrollierte „Schwarze Loch” könnte ja vielleicht die Trumpfkarte gegen das bevorstehende Versiegen der Ölquellen sein. Die Bedenken gegen diesen neuesten Eingriff in die Gesetze der Schöpfung werden wie üblich als sektiererische Nörgeleien ins Abseits befördert – und Beschwerden beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg eilends abgewiesen. Probieren geht über Studieren? Na, ich weiß nicht.
[Die Fakten und Zitate zum Trinity-Test sind entnommen aus Richard Rhodes: Die Atombombe oder Die Geschichte des 8. Schöpfungstages. A. d. Am. v. Peter Torberg, Karl Heinz Siber, Johannes Bohmann, Herbert Allgeier, Uda Strätling u. Ulrike Bischoff. Nördlingen: Greno Verlagsgesellschaft, 1988. – Das Titelbild zeigt Robert Oppenheimer unterm weißen Cowboyhut und rechts neben ihm General Leslie Groves am Ground-Zero-Punkt des Trinity-Tests nach der Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki.]
Orwell, well?
Thursday, 18. September 2008Ich erinnere mich noch gut ans Eric-Arthur-Blair-Jahr. So heißt ja sein vielleicht folgenreichster Roman: Nineteen Eighty-Four, von – die letzten beiden Ziffern vertauschend – 1948. Da hat sich Mr. Always, wie er sich auch nannte, einiges zugetraut: den Blick in die Zukunft über drei Dutzend Jahre hinweg. Die meisten Romane, die die Zukunft ausfabulieren, entwickeln ein Bild, das hauptsächlich von den wissenschaftlichen Fortschritten und ihren möglichen Folgen bestimmt ist. Nicht ohne Grund heißt das Genre ja auch Science Fiction.
Das verstellt dem vorurteilsbeschränkten Leser, der seine Lektüre nach solchen oberflächlichen Genre-Kriterien ausfiltert, leider den Blick auf ein Dutzend überaus lesenswerter, dem Verständnis der Gegenwart zuträglicher Romanciers. George Orwell ist unter diesen ein Sonderfall, weil seine Verfolgungswahnideen, ähnlich denen Franz Kafkas, heute offenbar ein zutreffendes Bild der Ängste eines kultivierten Mitteleuropäers ergeben.
Beider Romanwerke taugen dann gemäß Erlass des Kultusministers als Schullektüre in der Oberstufe deutscher Gymnasien. Wäre man böswillig, dann könnte man sagen: Oberstufenbildung im Bereich der Geisteswissenschaften deutscher Gymnasien verfolgt das Ziel, Angst zu verbreiten. Da man aber gutwillig ist, gratuliert man der Bildungsbürokratie zu ihrer Arglosigkeit: Eine bessere Auswahl konntet ihr nicht treffen als diese beiden zum Selbstzweifel ermunternden Visionäre!
Die Welt vor zwei Dutzend Jahren, die nun auch bald wieder zur Geschichte des vorletzten Jahrhundertviertels gehört, hat sich der Kämpfer im spanischen Bürgerkrieg auf Seiten der trotzkistischen POUM als Überwachungsstaat ausgemalt. Seine Inspirationsquelle für diese Paranoia war die britische BBC, wo er von 1941 bis 1943 als Kriegspropagandist arbeitete. So bezwingend die Vorstellung sein mag, dass die Freiheit des Individuums durch einen totalitären Überwachungsstaat gefährdet ist, so harmlos ist sie doch angesichts der ernsteren Bedrohungen unserer Fortdauer auf diesem Planeten mittlerweile geworden.
Ich frage mal ketzerisch: Was ist an dem Satz “Big Brother is watching you!” eigentlich so bedrohlich? Mein großer Bruder passt auf mich auf, achtet auf mich, behält mein Wohlergehen im Auge. Das ist doch nicht beunruhigend, sondern schafft vielmehr ein angenehmes Gefühl von Sicherheit. Die Gesinnungspolizei hat ja schließlich nur einer zu fürchten, der was zu verbergen hat, oder? (Fortsetzung demnächst unter dem Titel „GEZ”.)
Dingwelt (II)
Thursday, 18. September 2008Heute: Zuckerpott mit Löffel. – Ulla hat ihn vor vielen Jahren auf einem Basar an der Essener Freien Waldorfschule zum Spottpreis von zwei Mark erstanden. Wie lange ist das her? Das könnten wohl fast zwanzig Jahre sein, in denen er uns nun schon täglich gute Dienste leistet. Es ist ein kleines Wunder, dass er unterdessen nicht irgendwann einmal in Scherben gegangen ist, denn das Porzellan ist für seine Größe verhältnismäßig dünn und an unserem Frühstückstisch herrschte, als unsere Kinder noch klein waren, oft ein rechtes Tohuwabohu. Klopf auf Holz: toi, toi, toi!
Seine braune, wie hingewischte Glasur weist den Zuckerpott als ein bodenständiges, etwas hausbackenes, zünftiges, grundehrliches Gefäß aus. Er ist alles andere als ein artifizieller Luxusgegenstand für den großbürgerlichen Teetisch, wie die Zuckerdosen mit Deckel von Villeroy & Boch oder Hutschenreuther, die man alle paar Tage nachfüllen muss. Dieses Gefäß fasst gut ein Pfund Zucker, angemessen für eine Großfamilie. Kein Tag vergeht, an dem ich es nicht zur Hand nähme und mich aus ihm bediente, um meinen Kaffee zu süßen.
Soweit man das von einem toten Gegenstand sagen kann, liebe ich diesen Zuckerpott und würde ihm gewiss eine Zeit lang nachtrauern, wenn er doch einmal zerbräche. Dabei habe ich zu seiner praktischen Funktion, zu dem Dienst, den er mir leistet, ein mindestens zwiespältiges Verhältnis. So unkritisch bin ich ja nicht, dass ich nicht um die schädlichen Folgen raffinierten Zuckers für meine Gesundheit wüsste. Im Gegenteil! Ich habe mich mit dieser speziellen Ernährungsgewohnheit einmal sehr gründlich beschäftigt und mit Gewinn zwei Bücher zu diesem Thema gelesen.
Dass C12H22O11 kein harmloses Genuss-, sondern ein auf Dauer krank machendes Suchtmittel ist, für eine vollwertige, abwechslungsreiche und schmackhafte Ernährung absolut entbehrlich, das lernte ich aus William Duftys Zucker Blues (a. d. Am. v. Annemarie Telieps. Frankfurt am Main: Zweitausendeins, 1996). Dufty kam zu dieser Erkenntnis durch Gloria Swanson, den legendären Stummfilmstar, deren sechster und letzter Ehemann er 1976 wurde, im gleichen Jahr, als sein Sugar Blues zuerst im amerikanischen Original erschien. Die Einsicht, dass der internationale Zuckermarkt ein kaum weniger mafiöses Krebsgeschwür ist wie der weltweite illegale Drogenhandel mit Heroin und Kokain, das wurde mir klar, als ich das Buch Zucker des Schweizer Journalisten Al Imfeld gelesen hatte (Zürich: Unionsverlag, 1983).
Rationale Erkenntnis ist ein erster Schritt – aber daraus ganz persönliche Schlüsse zu ziehen und eine lebenslange liebe Gewohnheit aufzugeben, ist ein langer und schmerzvoller Weg. Bis dahin habe ich weiter mein tägliches Tête-à-Tête mit dem Zuckerpott, den ich um seiner Treue willen liebe und wegen seines tödlichen Inhalts hasse. Vielleicht würde mir der endgültige Abschied vom Zucker leichterfallen, wenn ich wüsste, wozu ich den Pott anschließend nutzen könnte?
[Titelbild: Zuckerpott mit Silberlöffel und Zucker auf Raster 10 x 10 mm.]
Dingwelt (I)
Wednesday, 17. September 2008„Bundesbürger besitzen laut Statistik im Durchschnitt 10.000 Dinge. Sie helfen ihnen im täglichen Leben, steigern das Wohlbefinden, verschaffen soziales Ansehen und dienen oft auch der Kompensation unerfüllter Wünsche.“ So heißt es im Klappentext des Katalogs zu einer Wanderausstellung, die 1995/96 in fünf deutschen Museen gezeigt wurde und im Titel die interessante Frage stellte: Welche Dinge braucht der Mensch? (hrsg. v. Dagmar Steffen. Gießen: Anabas-Verlag, 1995.)
Ich weiß nicht, ob sich die Zahl der Dinge im Besitz von Otto Normalverbraucher und Erika Mustermann seither noch erhöht hat. Im Klappentext heißt es weiter: „Und noch immer lautet die Maxime unseres Wirtschaftens: ,Je mehr, desto besser.‘“ Dieser konsumistische Lebensgrundsatz bestimmt wohl nach wie vor das Verbraucherverhalten, auch wenn die Reallöhne und damit die Kaufkraft in Deutschland seither gesunken sind. Fragwürdig ist zudem der Ding-Begriff, der solchen Zählungen zugrunde liegt. Wenn acht gleiche Stühle um meinen Wohnzimmertisch stehen, gehen sie vermutlich jeder für sich in die Summe meiner Dinge ein. Aber wie steht es mit hundert Heftzwecken oder tausend Büroklammern? Hier wird wohl die Packung mit Inhalt als ein Ding bewertet und das Einzelstück steht Pars pro Toto für seine ununterscheidbar gleichen Geschwister.
In lockerer Folge werde ich hier einige bemerkenswerte Dinge aus meinem Besitz vorstellen und sie auf ihre – im weitesten Sinne – Brauchbarkeit hin prüfen: dauerhafte und verderbliche, schöne und hässliche, täglich genutzte und längst vergessene, erworbene und gefundene, gestohlene und ererbte, winzig kleine und sperrig große. Die vielgestaltige Dingwelt, mit der wir uns umgeben, ist ja manches zugleich: Kokon, Werkzeugkasten, Heimat, Luftschloss, Rumpelkammer und Herd.
Im Titelbild will ich das jeweilige Ding im Foto zeigen, bevor ich mich ihm forschend, erklärend und deutend zuwende. Heute, beim Eintritt in meine private Dingwelt, präsentiere ich ein Lineal aus gelbem Plastik, Werbegeschenk eines Telefonbuchverlags, 30 Zentimeter lang, 30 Gramm schwer, wohl aus den 1970er-Jahren.
Auf seiner Rückseite erklärt es kurz und bündig eine Fertigkeit, die ich dank meiner Ausbildung zum Buchhändler vor dreißig Jahren noch perfekt beherrsche, die aber dank der komfortablen Suchfunktionen des Internets im Aussterben begriffen ist: das Auffinden eines Begriffs in einem alphabetisch nach DIN 5007 geordneten Verzeichnis. In dieser praktischen Gebrauchsanweisung steht schwarz auf gelb der berückende Satz: „Für alle Dinge, die nicht nur zur eigenen Orientierung bestimmt sind, muß eine Regel gefunden werden, nach der sich alle Anwender richten müssen.“ Sooft ich diesen Satz schon gelesen habe – noch nie konnte ich seinen gewiss tiefen Sinn ergründen. Und nie könnte ich mich von diesem flexiblen Maßstab trennen. (Das Plastik knistert leise, wenn man es biegt.)
Bloody Print
Tuesday, 16. September 2008Manch helfende Hände wirken uns zu Diensten im Verborgenen, schemenhaft hinter den Kulissen unseres Alltags oder im Dunkel der Nacht, während wir noch in süßen Träumen schweben, gelegentlich auch uns unter der Last eines Albdrucks im schweißgetränkten Linnen wälzen. So der Bote, der frühmorgendlich die Tageszeitung meiner Wahl durch den Briefkastenschlitz schiebt, irgendwann zwischen halb sechs und halb sieben.
Ich bin, seit Eintreten meiner Andropause, obwohl Spät-zu-Bett-Geher doch ein Frühaufsteher, kurzum: ein „Wenigschläfer“. Diese unterdurchschnittliche Verweildauer in Morpheus’ Armen mag meine Lebenserwartung, nach Jahren gerechnet und statistisch betrachtet, zwar verkürzen. Per saldo gesehen jedoch erreiche ich vermutlich auf diese ungesunde Art die gleiche quicklebendige Wachzeit wie ein Langschläfer und kann die entgangenen Tiefschlafphasen dann ja post mortem nachholen.
Ein eher unbeträchtlicher der vielen Vorteile, die dieser untypische Lebensrhythmus mit sich bringt, ist der, dass ich gelegentlich vom unbekannten Zeitungsboten wenigstens einen akustischen Eindruck empfange. Wenn ich früh genug erwache und er spät genug kommt, vernehme ich deutlich das Klappern des Briefkastendeckels. Heute kam ich verhältnismäßig spät zur Besinnung, so gegen sechs Uhr. Und da mein Haupt durch keine unabweislichen Gedankengänge mehr zum Verweilen auf dem Federpfühl veranlasst ward, erhob ich mich, um nach dem Morgenblatt zu schauen.
Zufällig just in dem Moment, als ich den Kasten von innen öffnete, wurde von außen die Zeitung hereingeschoben. Das Hineinstecken jenseits und das Herausnehmen diesseits verschmolzen, wohl für beide Beteiligten gleichermaßen überraschend, zu einer fließenden Bewegung. Dieser Zufall, nach tausend distanzierteren Zustellungen ein Fall mit hohem Seltenheitswert, war wunderlich genug. Noch wunderlicher speziell für mich war aber, dass ich auf der Frontseite meiner Zeitung eines roten Flecks gewahr wurde, der sich bei näherer Betrachtung als frischer Blutstropfen erwies. [Siehe Titelbild.]
Solche merkwürdigen Flecke hatte es auf der Zeitung früher schon öfter mal gegeben, allerdings konnte ich mir bisher ihre Herkunft, da sie bereits abgetrocknet und nachgedunkelt waren, nicht recht erklären. Woher nun dies? Meine Theorie: Der Zeitungsbote ist Diabetiker, der in regelmäßigen Abständen eine Blutzuckermessung vornehmen muss. Gerade in unserer stillen Straße findet er dazu die passende Gelegenheit. Und wenn er kurz darauf die Zeitung falzt, damit sie durch den Briefkastenschlitz passt, hinterlässt er besagte Spur. Wüsste ich nicht aus nahezu unmittelbarer Erfahrung, welches Päckchen die von dieser scheußlichen Krankheit Betroffenen zu tragen haben, ich würde mich vermutlich als zahlender Abonnent bei der Telefonhotline meiner Tageszeitung beschweren. So aber lege ich meine schützende über diese helfende Hand – und schweige.
The Bomb
Tuesday, 16. September 2008Ich lese gerade einen Roman des Iren Frank Harris: Die Bombe. Das Buch erschien im Original zuerst 1908 in London. Der Ich-Erzähler, ein Rudolf Schnaubelt aus Lindau bei München, stellt sich gleich eingangs als jener Mann vor, der am 4. Mai 1886 am Haymarket in Chicago bei einer sozialistischen Kundgebung die Bombe warf, die „acht Polizisten getötet und sechzig verwundet hat. Jetzt liege ich hier in Reichholz in Bayern unter falschem Namen, todkrank an Schwindsucht und habe endlich den Frieden gefunden.“ (Frank Harris: Die Bombe. A. d. Engl. v. Antonina Vallentin. Berlin: E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, 1927, S. 9.)
Tatsächlich war Rudolph Schnaubelt (1863-1901) einer der vielen Tatverdächtigen, die für das nie aufgeklärte Verbrechen verantwortlich gemacht wurden. Dank Harris’ Roman stand er sogar zeitweise ganz oben auf der Liste – und in der Wikipedia steht er dort noch immer, obwohl Zeitgenossen, die Schnaubelt persönlich gekannt hatten, energisch widersprachen. Auch die anarchistische Freiheitskämpferin Lucy Parsons (~1853-1942), Witwe eines der „Haymarket Eight“, hatte keine hohe Meinung von The Bomb, das 1909 auch in den USA erschienen war: “A lie from cover to cover!” (Brief v. 17. Januar 1933 an Carl Nold; zit. nach Henry David: The History of the Haymarket Affair. New York: Farrar & Rinehart, 1936.)
Der Roman hat aber noch ganz andere Schwächen. Frank Harris gibt darin dem Leser einen Vorgeschmack zu kosten auf jene unfreiwillig komischen Schilderungen seiner zahllosen Liebschaften, die den schwächsten Teil seiner fünfbändigen Autobiographie My Life an Loves (1922-1927) ausmachen. Die Liebesaffäre zwischen Schnaubelt und der Stenotypistin Elsie Lehmann trägt zum Thema des Romans, der „Haymarket Affair“, kaum etwas bei. Vielleicht hat der Autor sie eingestreut, um auch bei seiner weiblichen Leserschaft Anklang zu finden?
Eine Kostprobe kann ich mir nicht verkneifen: „Meine Leidenschaft war voller Zwischenfälle, schien mir immer neu und überraschend. Das erstemal, als ich ihren Nacken küßte (der Gedanke daran treibt mir noch heute das Blut ins Gesicht), bildete eine neue Epoche in meinem Leben, jede Umarmung war ein Rausch […]. Ich war von einer unsinnigen Neugier nach ihrem Körper gequält. Ihre Hände waren so schmal und schön; ich wollte ihre Füße sehen und fand sie zu meinem Entzücken ebenfalls schmal und gewölbt mit zarten Fesseln. Aber sie stieß mich zurück.“ (Harris, a. a. O., S. 127.)
Durchaus heute noch lesenswert hingegen sind die Schilderungen der unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Senkkammern beim Bau der Brooklyn Bridge in New York (Ebd., S. 33-40) und in den Chicagoer Streichholzfabriken (S. 106 f.) sowie über die katastrophalen hygienischen Zustände in den Schlachthöfen (S. 146-148), die zuvor schon Upton Sinclair in seinem großen Roman The Jungle (1906) zum Thema gemacht hatte. – Ich habe das Buch erst zur guten Hälfte gelesen und will immerhin wissen, wie es ausgeht. Vielleicht folgt dann noch eine abschließende Bewertung.
FINITE JEST CABLE
Monday, 15. September 2008+++ POSTMODERN WRITER IS FOUND DEAD AT HOME +++ AUSDRUCK REINSTER VERZWEIFLUNG STOP GESCHICHTEN VOLL DER UNGEWOEHNLICHSTEN TODESARTEN STOP WIE DROGENBEFEUERTES SCHREIBEN STOP TRUNKEN VON ABSCHEU UEBER DIE WARENWELT STOP LUFTSCHNAPPEN IM MEER DER DIESSEITIGKEIT STOP UNENDLICH TALENTIERTER UND NICHT BLOSS SCHLECHT GELAUNT STOP MIKROSKOPISCH GENAUE SCHILDERUNG STOP VERZWEIFLUNG UEBER DEN NIEDERGANG AMERIKAS STOP BEIM TOD WEISS AUCH DIE LITERATUR NICHT MEHR WEITER +++
+++ DER SPRACHMAECHTIGE BELESENE HOCHGRADIG REFLEKTIERTE UND GENIALISCHE SCHRIFTSTELLER STOP MEDIALISIERUNG UND POPKULTURALISIERUNG UNSERER GEGENWART STOP EINER DER BEGABTESTEN TENNISSPIELER STOP UNTER DIE OBERFLAECHE STOP HINTER DEN SCHEIN STOP KOMPLEX VERSCHLUNGENE MANCHMAL VERSTOERENDE MANCHMAL BEWUSST STILLOSE PROSA STOP MITUNTER TOXISCHE WIRKUNG STOP NICHT IMMER EIN REINES VERGNUEGEN STOP QUAELEND FAST ABSTOSSEND +++
+++ DER WICHTIGSTE KOMISCHSTE ANREGENDSTE SCHRIFTSTELLER DER AMERIKANISCHEN LITERATUR DER LETZTEN ZWANZIG JAHRE STOP UM DEN WAHNSINN ZU KOMPLETTIEREN ANZUSPITZEN ZU VERDICHTEN STOP IN DER VERBLOEDETEN KORRUPTEN UND VERFETTETEN MEDIEN UND KONSUMWELT STOP ARTISTISCH HOCHKOMISCH GNADENLOS STOP DER GANZE KREUZFAHRT WERBE FERNSEHMIST STOP THERAPIE BEDUERFTIGKEITS GEBRABBEL STOP SEINEN EIGENEN NACHRUF VORWEGGENOMMEN STOP NACH LEISTUNGSSPORT DROGEN MATHEMATIK UND WORTMONSTEREXISTENZ +++
+++ DER ZU REDEN NICHT AUFHOEREN KONNTE STOP DER ERZAEHLEN UND ABSCHWEIFEN MUSSTE STOP ZWANGHAFT KOMMENTIERTE STOP NOCH VON DER ABSCHWEIFUNG ABSCHWEIFTE STOP IM MANISCHEN BEMUEHEN EINER UEBERKOMPLEXEN WELT GERECHT ZU WERDEN STOP SCHLEUDERTE BLITZE UND GROLLTE WIE DONNER STOP HOCHINTELLIGENTES WOERTERBUCHVERLIEBTES TENNISASS STOP UNTER GENIE VERDACHT STOP AUF DEM KAMM EINES LACHENS HOCH UEBER EINEM GAEHNENDEN ABGRUND +++
+++ AUGENZWINKERNDE IRONIE STOP WIE KAUM EIN ZWEITER STOP AUSRUFEZEICHEN HINTER EINEM LEBEN DAS VON INSTITUTIONEN GEPRAEGT WAR STOP KASCHIERTE BRUECHIGKEIT STOP SUMMA CUM LAUDE STOP DER OFFENBAR FOLGSAME UND VORBILDLICHE STOP TYPISCHERWEISE BIRST DER TEXT VOR FABULIERKUNST STOP DASS ER BISWEILEN STUNDENLANG AN KOMMAS FEILE STOP IM ZENTRUM STEHEN UND ZUM EXZELLENT BEOBACHTETEN SCHRILLEN DOCH GLAUBWUERDIGEN PANOPTIKUM DER GEGENWARTSGESELLSCHAFT WERDEN +++ ALAS POOR DAVID STOP I KNEW HIM STOP A FELLOW OF INFINITE JEST +++
[Dieser Nekrolog auf David Foster Wallace, geb. am 21. Februar 1962 in Ithaca, New York, gest. am 12. September 2008 in Claremont, Kalifornien, ist im Wesentlichen eine Montage aus folgenden Würdigungen in den deutschsprachigen Feuilletons v. 14./15. September 2008. – Abs. 1. Willi Winkler: Die unentrinnbare Unterhaltung; in: Süddeutsche Zeitung. – Abs. 2. Gerrit Bartels: In Zukunft ohne mich; in: Tagesspiegel. – Abs. 3. Guido Graf: Manischer Zweifler; in: Frankfurter Rundschau. – Abs. 4. Wieland Freund: Sterben ist nicht schlimm; in: Die Welt. – Abs. 5. Thomas Leuchtenmüller: Am Ende der grossen Freiheit; in: Neue Zürcher Zeitung.]
Märchen (II)
Thursday, 04. September 2008Neulich habe ich hier von dem grausamen Mord an der libanesischen Popsängerin Suzan Tamim berichtet, nicht um den blutrünstigen Skandalmeldungen der Weltpresse Konkurrenz zu machen, sondern weil mich an diesem speziellen Fall die Wirksamkeit von Zensurmaßnahmen über die Grenzen eines halbtotalitären Staates wie Ägypten hinweg bis hinein in unsere angeblich doch so freie Medienwelt hinein empörte.
Der Spiegel hatte sich über die Nachrichtensperre mokiert, die dort die Nennung des Namens eines einflussreichen Immobilen-Tycoons unterdrücken wollte. Jener Hesham Talaat Mustafa war in dringenden Verdacht geraten, den Mord an Tamim in Auftrag gegeben zu haben. Peinlich fand ich, dass der Spiegel eine dicke Lippe riskierte, den Namen aber ebenfalls unterdrückte. Inzwischen wurde der Milliardär verhaftet. Und jetzt traut sich auch der Spiegel, seinen Namen zu nennen.
Nicht so die Süddeutsche Zeitung, die heute auf ihrer „Panorama“-Seite unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Associated Press meldet: „Kairo – Der Mord an der arabischen [!] Popdiva Susanne [!] Tamim ist aufgeklärt: Die Polizei verhaftete einen der reichsten Unternehmer Ägyptens. Oberstaatsanwalt Abdel Maguid Mahmud sagte, der Mann werde verdächtigt, einem ehemaligen Polizisten zwei Millionen Dollar für die Tat bezahlt zu haben. […] Der festgenommene Unternehmer ist Mitglied der regierenden Nationaldemokratischen Partei und soll für das Kabinett [von Staatspräsident Muhammad Husni Mubarak] in Erwägung gezogen worden sein. Die ägyptische Regierung hatte die Berichterstattung über den Fall untersagt. Mehrere Zeitungen beklagten [sich] daraufhin, die Regierung schütze den Geschäftsmann. Er machte sein Vermögen mit Immobiliengeschäften in der Golfregion. Staatsanwalt Mahmud erklärte, der ebenfalls verhaftete Expolizist sei Tamim nach Dubai gefolgt und habe sie dort ermordet.“ (SZ Nr. 206 v. 4. September 2008, S. 10.)
Von der Bild-Zeitung unterscheidet sich die Süddeutsche dadurch, dass sie die Gelegenheit verstreichen lässt, ihren Lesern zum Frühstück noch einmal die grausamen Details der Tat in Erinnerung zu rufen. Von einem ernst zu nehmenden Nachrichtenmedium unterscheidet sie sich dadurch, dass sie allerlei unterschlägt, was doch unbedingt zur Sache gehört: dass der gedungene Auftragskiller Mahmoud el-Sukkary nach seinem Ausscheiden aus dem Polizeidienst Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes von Hesham Talaat Mustafa war; dass er nach seinem Geständnis im Kairoer Gefängnis selbst auf unbekannte Weise zu Tode gekommen ist; dass der mutmaßliche Auftraggeber des Mordes Beziehungen zur ägyptischen Muslimbruderschaft hat und Mitglied des Schura-Rates, des Oberhauses des ägyptischen Parlaments, ist – und natürlich seinen Namen: Hesham Talaat Mustafa. (Stattdessen wissen die SZ-Leser nun, wie der ermittelnde Oberstaatsanwalt heißt.)
Und einen solchen Artikel setzt die Süddeutsche Zeitung in vollem Ernst unter die Überschrift: „Mord an arabischem Popstar aufgeklärt“! Tatsächlich ist doch bloß durch die Verhaftung des Hesham Talaat Mustafa noch gar nichts aufgeklärt. Auch für ihn gilt bis zur Verurteilung in einem ordentlichen Gerichtsverfahren die Unschuldsvermutung in dubio pro reo. Und alle in diesem Fall wirklich interessanten Fragen wurden noch gar nicht gestellt, geschweige denn beantwortet: Was war das Tatmotiv von Hesham Talaat Mustafa, wenn er denn der Auftraggeber des Mordes an Suzan Tamim war? Was veranlasste die Machthaber in Ägypten, die Berichterstattung über den Mord wochenlang zu verhindern? Wie kann der wichtigste Belastungszeuge, der beauftragte Mörder, kurz nach seinem Geständnis in einem ägyptischen Gefängnis zu Tode kommen? – Und was soll man von einer angesehenen überregionalen Tageszeitung in Deutschland halten, wenn sie hinter den Mord an Suzan Tamim einen banalen Haken setzt, statt mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln des investigativen Journalismus nachzubohren und dem einzigen Geschäft nachzugehen, das ihre Existenz rechtfertigt: der Aufklärung?
Tauchen (I)
Wednesday, 03. September 2008Als ich dem Essener Historiker Dr. Ernst Schmidt vor zwanzig Jahren das Foto von der Bücherverbrennung am 21. Juni 1933 auf dem Gerlingplatz übergab, das ich kurz zuvor zufällig bei einem Freund entdeckt hatte, revanchierte er sich mit einem Gegengeschenk. Seine Sammlung zur Geschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus in Essen enthielt auch den Nachlass von Paul Waldhorst, einem Kommunisten, der in Sachsenhausen und Oranienburg im KZ gesessen hatte. Dieser Mann, den ich als Kind noch persönlich kennen gelernt und in lebhafter Erinnerung habe, war mit einer älteren Schwester meiner Großmutter mütterlicherseits verheiratet.
Dr. Schmidt übergab mir also eine zehn Zentimeter hohe Messingskulptur auf grauem Marmorsockel, die aus dem Vorbesitz dieses angeheirateten Großonkels stammte. Dieser „Onkel Päule“, wie er in unserer Familie genannt wurde, konnte mit seinen alten KZ-Geschichten die holdselige Stimmung jeder Weihnachtsfeier erbarmungslos auf den Nullpunkt treiben. Als Mitte der 1960er-Jahre die „Hippies, Rocker und Gammler“, wie die jugendlichen Rebellen gegen das Wirtschaftswunderland BRD damals summarisch genannt wurden, ihre Verweigerungshaltung durch lange Haare, lässige Kleidung und provokantes Herumlungern zur Schau stellten, empörte sich „Päule“, der Rebell einer anderen Zeit, mit dem mir unvergesslichen Ausspruch: „Bei uns im KZ hätte es das nicht gegeben!“
Das goldige Figürchen, das ich gestern mal wieder hervorgekramt und entstaubt habe, zeigt sechs unbekleidete Männer vor einem Pfahl, an dem sie ihre Hinrichtung durch ein faschistisches Exekutionskommando erwarten (siehe Titelbild). Die aufgeklebte Inschrift auf dem Marmorsockel lautet: „Souvenir de Châteaubriant“. Paul Waldhorst hat es von einer Frankreichreise mit der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“ (VVN) aus dem kleinen Städtchen in der Bretagne mitgebracht.
Wie ich jetzt dank einer Internet-Recherche weiß, handelt es sich um eine miniaturisierte Nachbildung des Denkmals an der Carrière des Fusillés in Châteaubriant, das an ein blutiges Verbrechen der deutschen Besatzer erinnert. Am 22. Oktober 1941 wurden dort zur Vergeltung für die Ermordung des Feldkommandanten von Nantes, Oberstleutnant Karl Hotz, 27 kommunistische Häftlinge aus dem Internierungslager Châteaubriant erschossen. Das jüngste Opfer war der gerade einmal 17 Jahre alte Guy Môquet. Sogar zwei Fotos des Originalmonuments habe ich im Internet gefunden.
Dieses Hinabtauchen in die Geschichte mit den Mitteln moderner Technik, ausgehend von einem rätselhaften Gegenstand aus ferner Zeit, der konkret greifbar vor mir auf dem Tisch steht, hat für mich etwas Berauschendes, eine Wirkung, die ich mir rational gar nicht erklären kann. Mit dem neuen Wissen um die Bedeutung der kleinen Skulptur, die sich schon so lange in meinem Besitz befindet, hat meine Beziehung zu ihr zugleich etwas gewonnen und etwas verloren. Sie ist nun nahezu restlos erklärt – aber sie hat mit ihrer Rätselhaftigkeit auch etwas von ihrem Zauber eingebüßt.
Abwege
Tuesday, 02. September 2008Die Beschäftigung mit dem Schicksal des nahezu vergessenen deutschen Schriftstellers Hans Siemsen hat mein Interesse für jenes malerische Fischerstädtchen an der Côte d’Azur geweckt, das in den Jahren nach 1933 und erst recht nach 1940 so vielen Intellektuellen auf der Flucht vor dem Naziregime eine vorübergehende Bleibe bot.
Die meisten der 36 Personen, die die Gedenktafel in Sanary-sur-Mer verzeichnet und die in jener dunklen Zeit an der „französischen Riviera“ zusammentrafen, waren mir längst vertraut. Auch mit einigen heute weniger Bekannten aus dieser geistigen Elite – wie Franz Hessel und Mechtilde Lichnowsky – hatte ich mich aus anderen Gründen früher einmal intensiv beschäftigt. Andere Namen kannte ich nur vom Hörensagen – wie Franz Theodor Csokor oder Valeriu Marcu. Und wieder andere hatten zwar gelegentlich mein Interesse geweckt, das immerhin so weit ging, ihre verstaubten Bücher zu Spottpreisen von den Flohmarkttischen aufzupicken, aber doch nicht weit genug, um anschließend die Nase hineinzustecken. Zu diesen zählen etwa Arnold Zweig, Alfred Neumann und Bruno Frank.
Wenn meine seltenen Gäste ihre Augen über meine Bücherregale schweifen lassen, mit einem Blick, der zwischen Staunen und Spott kein rechtes Mittelmaß findet, und wenn sie dann die banausische Frage über die Lippen bringen, ob ich das etwa alles gelesen habe, dann vergeht mir jede Lust, sie in den Keller hinabzuführen und ihnen die eigentlichen Schätze meiner Büchersammlung zu zeigen, aufbewahrt in glücklicherweise staubfreien, trockenen Katakomben. Oben ist Repräsentation, unten lockt das ungelüftete Geheimnis.
Die Beschäftigung mit dem Schicksal des nahezu vergessenen deutschen Schriftstellers Hans Siemsen hat mich auf Umwegen, die abzuschreiten an dieser Stelle leider zu weit führen würde, gestern wieder einmal veranlasst, im Chaos dieses bibliomanen Verlieses, mit der Taschenlampe in der zitternden Hand, nach den Büchern eines Autors zu suchen, den ich zunächst aus reinem Trotz ins Visier genommen hatte: Ludwig Marcuse. Nein, er war offenbar weder verwandt noch verschwägert mit jenem in den 68er-Jahren so populären Vordenker der Studentenbewegung, Herbert Marcuse, dessen Repressive Toleranz uns ein durchgeknallter Heidegger-Schüler als Philosophielehrer am Essener Helmholtz-Gymnasium zu lesen zwang, um uns unsere libertäre Gesinnung auszutreiben. Aber dass jener Ludwig Marcuse ein Büchlein mit dem Titel Obszön geschrieben hatte, die „Geschichte einer Entrüstung“, das machte ihn mir sympathisch genug, ihn nicht allein wegen seiner zufälligen Namensgleichheit mit dem unverstandenen dialektischen Materialisten ganz links liegen zu lassen .
Der Jude Ludwig Marcuse lebte von 1933 bis zu seiner zweiten Emigration 1939 in die USA in Sanary-sur-Mer und hat dem Ort im ersten Teil seiner Autobiographie, Mein zwanzigstes Jahrhundert, ein eigenes Kapitel gewidmet, wo er ihn die „Hauptstadt der deutschen Literatur“ jener Jahre nennt. Gerade dieses Buch ist leider (noch) ein Desiderat in meiner Büchersammlung, aber seine Fortsetzung, den zweiten Teil, habe ich gestern in tiefer Nacht zu lesen begonnen und darin den Satz von Johann Gottlieb Fichte zitiert gefunden: „Es sollen erst alle satt werden und fest wohnen, ehe einer seine Wohnung verziert, erst alle bequem und warm bekleidet sein, ehe einer sich prächtig kleidet.“ (Ludwig Marcuse: Nachruf auf Ludwig Marcuse. Zürich: Diogenes Verlag, 1975, S. 19.) Ich liebe solche Sätze, die mich bis ins Mark treffen und alles, was ich bin und lebe und denke, in Zweifel ziehen.
Ramadan
Monday, 01. September 2008Heute beginnt für die Muslime in Deutschland der Fastenmonat Ramadan. Erstmals haben sich alle annähernd zweitausend Moscheen, vertreten durch den Koordinationsrat der Muslime in Deutschland (KRM), auf einen einheitlichen Termin geeinigt. Mit der Morgendämmerung ist den Gläubigen das Essen und Trinken verboten, ebenso das Rauchen und der Geschlechtsverkehr. Erst nach Eintreten der Nacht darf bis zum 29. September wieder gegessen und getrunken, gequalmt und gevögelt werden.
Nun ist die Dämmerung eine etwas vage zeitliche Bestimmung, wie ja übrigens auch die Begriffe Sonnenauf- bzw. -untergang nicht ohne Weiteres exakte Zeitpunkte definieren. Ist der Sonnenaufgang jener Augenblick, in dem die Sonnenscheibe am Horizont ihr allererstes Licht aufscheinen lässt? Oder meint man mit diesem Begriff den etliche Minuten später eintretenden Zustand, wenn sie mit ihrem ganzen Rund aufgetaucht ist? „Tatsächlich ist der Moment des Aufgangs bei der Sonne definiert als der Moment, in dem die Oberkante der Sonnenscheibe den Horizont überschreitet[,] und unterscheidet sich um etwa 5 Minuten vom theoretischen Wert. Diese Zeitdifferenz, um welche die Sonne früher aufgeht, hängt mit dem scheinbaren Sonnenradius (0,5°) und der astronomischen Strahlenbrechnung (etwa 0,6°) zusammen.“ (Wikipedia)
Solchen Spitzfindigkeiten ist der Koran bewusst aus dem Wege gegangen, indem er den täglichen Fastenbeginn ganz praktisch wie folgt festlegte: „…esst und trinkt, bis ihr in der Morgendämmerung einen weißen von einem schwarzen Faden unterscheiden könnt!“ (Koran, Sure 2, Vers 187.) Im Jahre 1429 islamischer Zeitrechnung, in dem wir leben, stellt der Fadentest die Anhänger dieser Religion hierzulande allerdings vor das Problem, dass sie gewöhnlich in Räumen leben, essen, trinken, rauchen und vögeln, die nächtens künstlich beleuchtet werden. Die Glühbirnen muss man am frühen Morgen also schon ausgeschaltet lassen. Und dann erreicht das Licht der Sonne bei ihrem Aufgang die beiden Fäden nur, wenn die Fenster auf der Ostseite des Hauses liegen.
Aber vielleicht ist das ja auch Haarspalterei und auf solche Differenzen von ein paar Minuten kommt es nicht an. Dennoch scheint mir die Frage angebracht, warum der Prophet gerade zwei Fäden für diese Art Lackmustest auf den Eintritt der Dämmerung vorgeschrieben hat. Es hätten doch auch zwei Würfel oder zwei Kugeln sein können, jeweils schwarz und weiß. Ist es nicht so, dass man deren Unterschiedlichkeit eher bemerkt als die von zwei dünnen Fäden? Und offenbart sich damit nicht eine gewisse Großzügigkeit des Religionsgründers, der seinen Gefolgsleuten noch ein paar Minuten gönnen wollte vor Beginn der harten Askese?
Unmündige Kinder sind übrigens vom Fasten ausgenommen. Die Mündigkeit ist allerdings nicht auf ein bestimmtes Lebensalter festgesetzt, sondern bemisst sich danach, ob der junge Mensch über Unterscheidungsvermögen (mumayyiz) verfügt, wobei jedoch nicht gesagt ist, was er unterscheiden können soll. Mann und Frau? Gut und Böse? – Oder bloß Schwarz und Weiß?
Schlüsse
Sunday, 31. August 2008Heute endet mein Engagement beim Kulturblog der WAZ-Mediengruppe: Westropolis. Vor gut 17 Monaten, am 28. März 2007, habe ich dort meinen ersten Beitrag veröffentlicht, schon eine Woche später rückte ich in die kleine Gruppe der ständigen Gastautoren ein, seit September 2007 wurde meine Tätigkeit dort monatlich pauschal honoriert. Drei Beiträge pro Woche sollte ich laut Vertrag publizieren. Dies ist mein 349. und letzter Artikel für Westropolis. Neun Monate habe ich abgerechnet. Die Arbeitszeit pro Beitrag belief sich durchschnittlich auf vier Stunden. Überschlägig kam ich damit auf einen Stundenlohn von 2,50 Euro. Um des schnöden Mammons willen habe ich’s also gewiss nicht getan. Warum aber dann?
Bei meinem „Einstellungsgespräch“ am 27. März 2007 waren zwischen mir und der verantwortlichen Westropolis-Mitarbeiterin im Wesentlichen zwei Fragen zu klären. Erstens: Ob ich Vorbehalte hätte, als Blogger für einen Medienkonzern zu arbeiten? Bekanntlich gilt ja in weiten Kreisen der Blogosphäre ein solches Engagement als Verrat am libertären Geist dieses neuen Mediums. Solche Bedenken hatte ich zwar, aber ich stellte eine Gegenfrage: Würde ich bei der Wahl meiner Themen und ihrer Ausgestaltung, natürlich im Rahmen der gesetzlichen Grenzen („Keine Pornographie! Keine verfassungsfeindliche Propaganda!“), freie Hand haben? Nachdem dies bejaht wurde, ließ ich mich auf das Abenteuer Westropolis ein.
Ich habe diese Entscheidung nie bereut und bereue sie auch heute nicht. Mein anderthalbjähriger Gastauftritt bei Westropolis ermöglichte mir, Erfahrungen zu sammeln, von denen ich noch lange zehren werde. Das Kulturblog der WAZ gestattete mir großzügig, mancherlei auszuprobieren, mit Reizthemen zu experimentieren, meine teils provokanten Widersätzlichkeiten gegen den Zeitgeist öffentlich zu machen und die Grenzen der Toleranz auszuloten. Was mir dabei widerfuhr – von Kollegen, von Kommentatoren, von meinem „Arbeitgeber“ – das gäbe genug Stoff für ein lehrreiches Buch über diesen durchaus ja noch brandneuen Schauplatz des öffentlichen Diskurses.
Ein solches Buch werde ich jedoch gewiss nicht schreiben, es wäre ja schließlich ein formaler Anachronismus. Ich habe mich stattdessen darauf verlegt, am 24. März 2008 mein eigenes Weblog zu starten, in dem ich täglich genau einen Beitrag publiziere. Mein Blog wird bis heute von nahezu niemandem gelesen, aber es ist „worldwide“ präsent, nicht nur heute, sondern für alle Zukunft; oder jedenfalls so lange, wie die Webserver in aller Welt noch unter Strom stehen. „Das Web vergisst nie!“ In den Ohren der Paranoiker von Orwells Gnaden klingt dieser Satz wie eine schreckliche Drohung – in meinen aber, der ich nichts vor mir selbst und insofern erst recht nichts vor der Welt zu verbergen habe, ist er gleichsam die Garantie-Erklärung für den Triumph der Aufklärung im Posthistoire.
Das durchaus versöhnliche Fazit meiner Arbeit bei Westropolis lautet in zehn knappen Punkten: 1. Das war wohl nur ein Pilotprojekt für DerWesten, leider aber 2. ohne Pilot, mit einer 3. von Anfang an recht dilettantischen thematischen Struktur, die 4. anzupassen offenbar die Mittel fehlten, wie auch 5. ein engagiertes Management, das die Emphase und Energie aufgebracht hätte, die durchaus vorhandenen Potenziale über die Minimalvorgaben der Geschäftsführung hinauszuführen, geschweige denn 6. über deren vermutliche Bedenken, also 7. ein vorhersehbares (und auch vorhergesehenes) Scheitern, bei dem es 8. schließlich nun nur noch darauf ankommt, die Peinlichkeit in Grenzen zu halten, was 9. gewiss auch gelingen wird und das mir 10. für die Dauer meiner Teilnahme allerlei Illusionen beschert hat, die ich nicht missen möchte und deren schmerzvolle Zerstörung mich auf meinem Weg ein gutes Stück vorangebracht hat. So sage ich: Danke!
Stimmt so!
Saturday, 30. August 2008Die akribische und scharfsinnige Untersuchung unscheinbarer Einzelheiten und Kleinigkeiten unseres alltäglichen Lebens hat mich schon immer fasziniert. Das scheinbar Nebensächliche und Selbstverständliche unter der Lupe wissenschaftlicher Gründlichkeit zu betrachten, erschien mir oft interessanter als manche weit ausholende Darstellung vermeintlich großer und bedeutender Themen. Eine noch zu schreibende Kulturgeschichte des Schnullers würde mich eher in ihren Bann ziehen als Ratzingers Buch über Jesus von Nazareth.
Jetzt ist zum Preis von 7,90 € eine „Kleine Geschichte des Trinkgeldes“ erschienen, das ja bekanntlich in kleiner Münze entrichtet wird und insofern ein für die Gattung solcher hoch spezialisierten Monographien ideales Sujet liefert. (Winfried Speitkamp: Der Rest ist für Sie! Kleine Geschichte des Trinkgeldes. Stuttgart: Reclam Verlag, 2008.) Der Buchhändler, dem ich zehn Euro für den schmalen Band auf den Zahlteller lege, wäre erstaunt und vielleicht sogar beleidigt, wenn ich die Zahlung mit einem „Stimmt so!“ kommentierte. Vielleicht würde er sich, nähme er dieses Trinkgeld an, sogar eines Verstoßes gegen den festen Ladenpreis im Buchhandel schuldig machen. Dabei ist das hier zu annoncierende Büchlein mir durchaus diesen aufgerundeten Preis wert – und den Service des Buchhändlers, es vorrätig zu haben und mir damit den zweiten Weg zur Abholung nach einer sonst nötigen Bestellung zu ersparen, würde ich ihm gern mit 2,10 € vergelten.
Wenn ich hingegen vom Essener Hauptbahnhof per Taxi nach Hause fahre und der Taxameter in der Messelstraße 7,90 € anzeigt, dann kostet es mich schon einige Überwindung, stur zu bleiben, wenn ich den Zehn-Euro-Schein gezückt habe und auf Herausgabe des Wechselgeldes bestehe. Dabei habe ich mich unterwegs darüber ärgern müssen, dass ich als Fahrgast ungefragt von den peinigenden Klangereignissen eines Radiosenders namens 102.2 Radio Essen belästigt wurde. Wäre ich nicht, wie wir alle, ein Sklave der gesellschaftlichen Konventionen, dann würde ich dem Chauffeur einen Fünf-Euro-Schein in die Hand drücken mit der trockenen Bemerkung: „Stimmt so! Der Rest ist Schmerzensgeld.“ Ich bin schon stolz, wenn es mir gelingt, auf Rückgabe von zwei Euro zu bestehen und durch das lächerliche Trinkgeld von zehn Cent meinen Unmut kundzutun.
Geld regiert die Welt – und der persönliche Umgang mit ihm sagt viel aus über das wirtschaftende Subjekt. Wie ich mit dem Geld umgehe, das ist mindestens so bezeichnend für meinen Charakter wie mein Verhältnis zu meinem eigenen Körper, zu meinen Mitmenschen, zur Sexualität oder zur Kultur. Und das Trinkgeld, das ein anarchisches Randphänomen der klassischen Ökonomie ist, wie die unrentable Spende an den mittellosen Bettler, eine Leerstelle in der sonst lückenlosen Buchführung bürgerlichen Effizienzdenkens, könnte das monetäre Prinzip unseres Wirtschaftslebens vielleicht ad absurdum führen, wenn man es in den Fußstapfen von Ratzingers biographischem Gegenstand unbefangen betrachtete.
Vielleicht sollte ich künftig, um mir die Qual der Entscheidung über die Höhe des Trinkgelds zu ersparen, grundsätzlich immer 30 Cent drauflegen, zur Erinnerung an die 30 Silberlinge des Judas Ischariot?
< ![endif]-->
Friday, 29. August 2008“Never change a running system!” Ich bin ein eifernder Fan dieser konservativen Grundhaltung, was meinen PC-Arbeitsplatz betrifft. Der Einwand meiner Söhne, dass man sich mit dieser biederen Einstellung niemals sinnvolle Innovationen nutzbar machen kann, mag ja berechtigt sein. Aber das Risiko, durch die Installation eines schnuckligen kleinen Tools mein ganzes fehlerfrei laufendes Arbeitsinstrumentarium aus dem Gleichgewicht zu bringen, ist mir einfach zu groß.
So könnte ich friedlich und ungestört vor mich hin werkeln bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wären da nicht die nervenden Update-Angebote, die mich ebenso regelmäßig wie ungefragt behelligen und mich in Versuchung führen, meine Prinzipien für einen schwachen Moment über Bord zu werfen. Neulich war es ein Java-Update, das sich bei jeder Anmeldung meines Rechners penetrant bemerkbar machte. ,Jetzt nicht!‘ So lautete Tag für Tag meine halbherzige Antwort, weil mir wohl schwante, was mir blühen könnte, wenn ich mich darauf einließe. Doch steter Tropfen höhlt bekanntlich den Stein – und vorgestern wurde ich schließlich schwach.
Jetzt haben wir den Schlamassel! Vermutlich unterlief mir ein kleiner Fehler, als ich das Update startete, um endlich Ruhe zu haben. Mein Internet-Security-Programm meldete sich nämlich und stellte mir ein paar höfliche Fragen: Ob ich dies und jenes wirklich zulassen wolle? Was ich darauf geantwortet habe, weiß ich leider nicht mehr so genau. Und seither ist mein Weblog plötzlich strubbelig.
Über jedem neu veröffentlichten Blog-Beitrag steht die kryptische Phrase < ![endif]–>. Mein als Word-Dokument in Times New Roman entworfener Text wird beim Kopieren in WordPress nicht mehr automatisch in die dort bisher von mir verwendete, serifenlose Schrifttype umgewandelt. Und selbst rückwirkend erscheinen die letzten fünf Beiträge plötzlich in Times und mit falscher Absatzformatierung. Zu allem Überfluss ist mein gesamtes Weblog, bis auf den Titel-Banner, via Internet-Explorer überhaupt nicht mehr darstellbar. Was tun?
Am ehesten könnte mir noch mein ältester Sohn aus der Patsche helfen, doch der weilt momentan in Istanbul, um sich die im Laufe der Jahrhunderte von Abermillionen barfüßiger Muslime und Touristen durchgelatschte Steinschwelle zur Hagia Sophia anzusehen, und kehrt erst in einer guten Woche nach Berlin zurück. Was das betrifft, lautet meine nicht minder konservative Lebensregel: „Reise nie! Bleibe im Lande und nähre Dich redlich!“ Aber auf mich will ja keiner hören. Es ist zum Knöchelchenspeien!
< ![endif]–>
< ![endif]–>
Sanary-sur-Mer
Thursday, 28. August 2008Nachdem Hans Siemsen über die Schweiz Anfang 1934 ins Pariser Exil geflohen war, lernte er dort im Februar 1936 den 21-jährigen Walter Dickhaut kennen und verliebte sich in ihn. Gemeinsam mit Dickhaut schrieb er 1937 Die Geschichte des Hitlerjungen Adolf Goers, die dessen Erlebnisse in der Jugend- und Nachwuchsorganisation der NSDAP zum Thema hat. Ein deutscher Verleger fand sich für das Buch nicht, was Alfred Döblin im Frühjahr 1939 in einem Artikel in der Exilzeitschrift Das neue Tagebuch (Paris) beklagte. Im Jahr darauf erschien es dann in englischer Übersetzung (Hans Siemsen: Hitler Youth. Translated by Trevor and Phyllis Blewitt. With a foreword by Rennie Smith. London: Lindsay Drummond Ltd., 1940).
Ende 1938 hielt sich Siemsen in Südfrankreich auf. Möglicherweise besuchte er zu dieser Zeit erstmals das malerische Küstenstädtchen Sanary-sur-Mer am Mittelmeer, in der Nähe von Toulon, das sich in diesen Jahren zu einem Treffpunkt vieler deutscher und österreichischer Emigranten entwickelte. Die Liste jener Literaten, die auf der Flucht vor der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft hier eine vorübergehende Zufluchtstätte fanden, ist lang. Eine Gedenktafel in Sanary-sur-Mer verzeichnet in alphabetischer Reihenfolge eine Reihe prominenter und (zumindest heute) weniger prominenter Namen von Dichtern und Schriftstellern, Journalisten und Verlegern.
Hans Siemsens Name fehlt auf dieser Tafel. Verbürgt ist, dass er im August 1939 mit seinem Geliebten Walter in Sanary-sur-Mer Urlaub machte und dort Besuch von Hubertus Prinz zu Löwenstein (1906-1984) erhielt, der im gleichen Jahr die “American Guild for German Cultural Freedom” gründete und sich später von seinem Exil in den USA aus für die Rettung verfolgter Schriftsteller, Künstler und Wissenschaftler aus dem besetzten Europa einsetzte. Nach seiner vorübergehenden Internierung in den Lagern von Colombes bei Paris (Ende 1939) und Chambaran bei Lyon (Mai/Juni 1940) floh der inzwischen ausgebürgerte und somit staatenlose Siemsen mit Walter Dickhaut nach Sanary-sur-Mer ins unbesetzte Frankreich. Seine Pariser Wohnung wurde von der Gestapo ausgehoben, er verlor seinen gesamten Besitz.
Am 22. Januar 1941 berichtete Hans Siemsen aus Sanary in einem Brief an seinen Freund, den Schweizer Maler und Buchkünstler Max Hunziker (1901-1976), von seiner prekären Lage: „Max, wir leben noch, der Walter und ich. Es ist fast ein Wunder – aber wir leben. Seit Anfang August [1940] leben wir sogar zusammen. Nachdem wir elf Monate getrennt gewesen waren. Ich habe ein Visa für U. S. A. Walter wird eins bekommen. Nur – wie wir hingelangen und ob wir noch können, das wissen wir nicht. Alles, aber auch alles, was wir hatten, haben wir verloren. Nicht nur Kleidung und Wäsche, sondern auch Deine lieben Bilder – und alles andere, was wir lieb hatten. Wir führen ein sonderbares Leben. Jeden Tag und jede Nacht kann sich alles zum Guten – aber auch zum Allerschlimmsten ändern. Wir haben aber vorgesorgt und können rechtzeitig Schluß machen. – Ebenso gut aber ist es möglich, daß wir nach U. S. A. kommen. Für mich lohnt es sich kaum. Aber den Walter hätt‘ ich gern drüben und in Sicherheit. Er ist noch so jung. […] Laßt einmal von Euch hören. Charles Walter, Hotel Beauport, Sanary (Var.) – das genügt. Nichts weiter! Euch allen von Herzen alles Gute! Immer! Dein alter Hans.“ (Hans Siemsen: Schriften III. Briefe von und an Hans Siemsen. Hrsg. v. Michael Föster. Essen: TORSO Verlag, 1988, S. 257 f.) Unter dem Pseudonym „Charles Walter“ hatte sich offenbar Walter Dickhaut in Sanary angemeldet, während Hans Siemsen vorsichtshalber namentlich gar nicht in Erscheinung treten wollte. Im Februar 1941 begaben sich die beiden Freunde von Sanary-sur-Mer aus wieder auf die Flucht. Über Marseille und Spanien erreichten sie im März mit Hilfe von Varian Fry Lissabon, von wo aus sie im Juni auf der SS Guinee New York erreichten.
Ganz in Vergessenheit geraten ist Hans Siemsen an seinem Fluchtort Sanary-sur-Mer übrigens nicht. Am dortigen Place Albert Cavet betreiben noch die hochbetagten Geschwister Louis, Marcelle und Paulette Cavet die „Villa de l’Enclos“, fünf Reihenhäuser als Pensionsbetrieb für Feriengäste in einem kleinen Park. Sie erinnern sich noch gut an den Flüchtling aus Deutschland. Eines dieser Häuser bewohnte einst der deutsch-polnische Kunsthistoriker und Maler Erich Klossowski (1875-1949), Vater des Schriftsteller Pierre Klossowski (1905-2001) und des Malers Balthasar Klossowski, gen. Balthus (1908-2001). Und in einem anderen Haus fanden Siemsen und Dickhaut für ein paar Monate Unterschlupf. An dessen Fassade ist die Gedenktafel angebracht, die das Titelbild zeigt, mit einem Foto von Hans Siemsen im Profil, das ich sonst nirgends gefunden habe.
[Für die Informationen im letzten Absatz danke ich sehr herzlich Prof. Dr. Gernot Lucas (Konstanz), der mir auch freundlicherweise das Foto der Gedenktafel zur Verfügung stellte.]
< ![endif]–>
Abgeschnitten
Wednesday, 27. August 2008Mein jüngster Sohn hat seit ein paar Tagen ein neues Handy mit allem Schnick und Schnack. Aus Gründen, die mich nicht interessierten, fahndete er seither in meinen Papieren nach irgendwelchen Zugangsdaten und IPs für unser Wireless-LAN, nach seiner schlechten Stimmung zu urteilen erfolglos. Auch dies interessierte mich nur am Rande, bis ich gestern früh feststellen musste, dass ich von meinem Rechner aus nicht mehr ins Internet kam. Und auch die drei anderen PCs in unserem Haushalt konnten nicht mehr online gehen.
Keine E-Mails, kein Google, keine Wikipedia, kein Online-Schach – ich fühlte mich von einem Augenblick auf den anderen, als hätte man mir alle vier Extremitäten amputiert, mich zugleich geblendet, taub und stumm gemacht. Solche plötzlichen Aussetzer unserer überzüchteten technischen Hilfsmittel und Werkzeuge erinnern mich immer an meine Kindheit in den 1960er-Jahren, wenn der Fernseher seinen Geist aufgab. Dann wurde fieberhaft nach der Telefonnumer eines Reparaturdienstes gesucht: „Kein Bild, kein Ton? Ich komme schon!“ Geschah dies gar kurz vorm Wochenende, dann führte ein solcher Blackout zur familiären Katastrophe. Die Stimmung sank in den Keller, alle waren äußerst gereizt, jeder dachte an seine nun verpassten Lieblingssendungen, die Vorfreude wandelte sich in Verbitterung und die Zeit dehnte sich zur Ewigkeit, bis die Kiste endlich wieder lief.
Noch früher gab es gelegentlich mal Stromausfälle, die besonders wirkungsvoll waren, wenn sie uns in den dunklen Abendstunden überraschten. Für diesen Fall lag in der Besenkammer eine Taschenlampe bereit, damit man wenigstens noch den Weg zum Klo fand, ohne sich den Kopf einzuschlagen. Die möglichen Ursachen dieser Unterbrechungen der gewohnten Versorgungsleistungen waren überschaubar: ein Kabelbruch bei Straßenbauarbeiten, eine durchgebrannte Bildröhre. Und um die Behebung des Schadens musste man sich auch nicht weiter kümmern, dafür gab es fachkundige Spezialisten. Allenfalls fielen Reparaturkosten an – aber die waren meist zu verschmerzen und alle Familienmitglieder atmeten erleichtert auf, wenn das elektrische Licht wieder brannte oder man sich wieder vor der Glotze versammeln konnte.
Warum ich nicht mehr ins Internet kam, das konnte hingegen tausend Gründe haben. Hatte bei den zahlreichen Gewittern in den vergangenen Wochen das NTBA im Keller Schaden genommen? Gab es Übertragungsprobleme oder eine Störung von Seiten meines Telefonanbieters? War der W-Lan-Rooter defekt? Hatte mein Sohn Veränderungen in der Rooter-Software vorgenommen, die er jetzt nicht mehr rückgängig machen konnte? Oder hatte ich mir etwa trotz Firewall einen Trojaner eingefangen? Die Ein- bzw. Ausgrenzung der verschiedenen Möglichkeiten kostete mich einen ganzen Arbeitstag und reichlich Nervenkraft. Zudem war die Fehlersuche stark behindert, weil wir ja eben nicht mehr im Internet recherchieren konnten. So biss sich die Katze in den Schwanz.
Ein hinzugezogener Experte aus dem Freundeskreis meines zweitältesten Sohnes machte sich am späteren Abend zu schaffen, während ich nur noch apathisch in der Ecke saß und schon alle Hoffnung hatte fahren lassen. Schließlich war der Computercrack an einen Punkt gelangt, von wo aus er nicht mehr weiterkam, obwohl er meinte, alles richtig gemacht zu haben. Ich warf einen flüchtigen Blick auf den Monitor und sah auf Anhieb, dass der Name meines Telefonanbieters in einer Befehlszeile falsch geschrieben war. Ein „R“ fehlte. Das war’s. Seither funktioniert unser Internet wieder. Wer den Namen falsch eingegeben hatte, war nicht mehr festzustellen. Ich habe da aber so einen Verdacht.
< ![endif]–>
Blackout
Wednesday, 27. August 2008Olympia
Monday, 25. August 2008Endlich ist auch dieses Spektakel wieder vorbei und die Bundesliga-Berichterstattung muss nicht länger ein Schattendasein auf den letzten Seiten des Sportteils meiner Tageszeitung fristen. Es ist ja nicht so, dass mich dieser populärste Mannschaftssport in seinen nationalen Begrenzungen mehr interessieren würde als der internationale Multimega-Event im Vierjahrestakt, bei dem die ganze Palette fein- und grobmotorischer Spezialisierungen der physischen Leistungsfähigkeit jener Primatenart namens Homo sapiens, der ich unglücklicherweise angehöre, in 302 Wettkämpfen medien- und werbewirksam dargeboten wird. Aber der gewöhnliche Fußballzirkus ist mir insofern lieber als das schaltjährliche Völkersportfest, als ich dieses nicht ganz ignorieren kann, während ich gegen jenen hinlänglich abgestumpft bin.
Laienhafte Leibesübungen und erst recht professioneller Sport erschienen mir schon immer als krankhafte Auswüchse menschlicher Allmachtsphantasien, die es nicht hinnehmen können, hinter der körperlichen Überlegenheit eines Leoparden, Elefanten, Kängurus oder Delfins zurückstehen zu müssen. Statt sich damit zu trösten, dass Homo sapiens seine vorübergehende Überlegenheit allein der exorbitanten Größe seines Zerebrums verdankt, bleibt dieser Flickschuster der Schöpfung nicht bei seinen Leisten, sondern sucht in Disziplinen zu reüssieren, deren Beherrschung ihm nun einmal nicht in die Wiege gelegt ist. Alfred Polgar hat über diese groteske Verirrung ein glanzvolles Feuilleton geschrieben, das ich mit meinem kleinen Hirn nicht zu übertreffen vermag. (Der Sport und die Tiere; in: Kleine Schriften. Bd. 3: Irrlicht. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1984, S. 95-98.)
Mens sana in corpore sano? Wenn das stimmt, müssen wir uns mit der Widerlegung von Stephen Hawkings astrophysikalischen Theorien nicht länger beschäftigen. Fragen wir stattdessen besser Michael Phelps oder Usain Bolt, wo die „Schwarzen Löcher“ im Kosmos herkommen. Oder gleich den Delfin oder Leoparden? Die hehre Idee des Barons de Coubertin in allen Ehren, aber war sie deshalb so erfolgreich, weil sie zu Frieden und Verständigung unter den Völkern beigetragen hat, wie er es sich vor über hundert Jahren erträumte? Oder gründet ihr dauerhafter Bestand nicht vielmehr auf einer infantilen Sehnsucht unserer Art, dem Rest der Schöpfung auch ohne trickreiche Waffen und Werkzeuge die Stirn zu bieten?
Do Ping ist nicht der Name des chinesischen Ministers für volksrepublikanische Körperentwicklung, sondern eine Falschschreibung des Wortes, das für die vorläufig letzte Beschleunigung jenes olympischen Karussells sorgt, das ohne Rekordergebnisse zum rasenden Stillstand käme. Dabei unterscheidet sich doch die Verabreichung von EPO oder Anabolika nur graduell von den klassischen Methoden körperlicher Leistungssteigerung: der gezielten Selektion, den hochgradig spezialisierten Trainingsmethoden, der technizistischen Evolution von Schwimmtrikots, Sprintschuhen und Glasfiberstäben. Die verschämte Zurückweisung neuer Möglichkeiten der Perfektionierung menschlicher Körper ist kaum mehr als ein lästiges Bremsmittel auf dem Weg zu seiner zukünftigen Vermarktung.
Und überhaupt: Was werfen sich denn die gastgebenden Chinesen mit ihren 51 Goldmedaillen so in die Brust? Das ist doch nichts im Vergleich zu den 87 Goldmedaillen, die die 27 Staaten der Europäischen Union diesmal abräumten. (Bloß Luxemburg, Malta und Zypern gingen ganz leer aus.) Und erst recht darf man als Europäer mit stolzgeschwellter Brust aus dem „Vogelnest“ von Herzog & de Meuron schreiten, wenn man die Bevölkerungszahlen der olympischen Siegermächte gegeneinander hält. Auf eine Million Europäer kamen 0,57 Medaillen, auf die gleiche Zahl US-Amerikaner 0,36 – und die Chinesen brachten es gerade mal auf lächerliche 0,07. Wer triumphiert denn hier?
Siemsens Neffe
Sunday, 24. August 2008Wenn man sich längere Zeit gründlich mit dem Lebenswerk eines nahezu vergessenen Autors beschäftigt, dann will man auch alles über sein Leben wissen – und nicht zuletzt, wie er ausgesehen hat. Im Falle von Hans Siemsen (1891-1969) ist die Quellenlage zu beidem allerdings äußerst dürftig. Ein Foto aus den jüngeren Jahren dieses Flaneurs schmückt das von Dieter Sudhoff zusammengestellte Hans Siemsen Lesebuch (Köln: Nyland Stiftung, 2003), doch hat der für die Umschlaggestaltung laut Impressum zuständige Robert Ward es so zurechtgestutzt, dass nur Siemsens linke Gesichtshälfte zu sehen ist. Dieser Buchkünstler hatte den zweifelhaften Einfall, aus zwei Siemsen-Porträts ein Ausrufezeichen zu formen. Den Strich bildet das halbierte Porträtfoto – und den Punkt darunter eine (auch im Buch auf S. 139 reproduzierte) Karikatur des älteren Siemsen von Benedikt Fred Dolbin.
So hoffte ich, in der Biographie der wesentlich bekannteren älteren Schwester des Dichters, Anna Siemsen (1882-1951), fündig zu werden, die der ebenfalls namhafte Bruder Dr. August Siemsen (1884-1958) verfasst hat. Dieses schmale Buch enthält aber, wie sich leider herausstellte, keine Fotos der Geschwister Siemsen, sondern ledigleich vier Bilder auf Tafeln von Anna. Auch zur Lebensgeschichte ihres Bruders Hans gibt es, außer der knappen Schilderung einer gemeinsamen Radtour im Jahre 1910 durch Holland (S. 29), nicht viel her. (August Siemsen: Anna Siemsen. Leben und Werk. Hamburg u. Frankfurt [am Main]: Europäische Verlagsanstalt, [1951].)
So hegte ich wenig Hoffnung, dass ein weiteres Erinnerungsbuch aus der Siemsen-Familie meine Neugier würde stillen können. Der wohl einzige Sohn von August Siemsen, Pieter Siemsen (1914-2004), hat kurz vor seinem Tod auf sein wechselvolles Leben zurückgeblickt und unter dem Titel Der Lebensanfänger seine Memoiren veröffentlicht. Wie groß war meine freudige Überraschung, als ich in diesem Buch kürzlich nicht nur ein ausführliches und aufschlussreiches Kapitel über Pieter Siemsens „Onkel Hans“ fand (S. 18-22), sondern auch gleich zwei Familienfotos, auf denen Hans Siemsen mit abgebildet ist. (Pieter Siemsen: Der Lebensanfänger. Erinnerungen eines anderen Deutschen. Situationen eines politischen Lebens: Weimarer Republik – Nazi-Deutschland – Argentinien – DDR – BRD. Berlin: trafo verlag dr. wolfgang weist, 2000.)
Bisher hatte ich mir Hans Siemsen als eher kleinen, korpulenten Mann vorgestellt. Wie ich mich zu diesem inneren Bild versteigen konnte, vermag ich beim besten Willen nicht zu erklären. Nun erweist sich [s. Titelbild, aus den 1920er-Jahren], dass er vielmehr groß und schlank war, seine Mutter Anna Siemsen, geb. Lürßen (1854-1931), weit überragte und auch deutlich größer war als sein älterer Bruder Karl Siemsen (1887-1968). Und auf dem zweiten Foto sieht man, dass Hans Siemsen, zumindest Mitte der 1930er-Jahre, Zigaretten rauchte.
Zum Verständnis und zur Bewertung von Siemsens Schriften trägt die Kenntnis seiner persönlichen Eigenschaften und Lebensgewohnheiten zwar kaum bei, handelt es sich doch bei solchen Äußerlichkeiten um bloße Akzidenzien der geistigen Erscheinung. Und doch fehlt mir etwas, wenn ich mir kein äußerliches Bild von einem Autor machen kann. (Thomas Pynchon, der sich diesem Bedürfnis seiner Leser konsequent verweigert hat und dennoch nicht verhindern konnte, dass ein Jugendbild von ihm veröffentlicht wurde, steht vor meinem inneren Auge nun bis auf weiteres da als der Mann mit den Hasenzähnen.)
Webstalking
Saturday, 23. August 2008In der Parallelwelt des Weblogs sammelt man als „Betreiber“ allerlei Erfahrungen, gute wie ungute. Es hält sich unterm Strich die Waage, wie im wirklichen Leben. Das gelobte Land der unbeschränkten Kommunikation entpuppt sich mitunter als ein engherziges Krähwinkel privater Denunziation. Beide Sphären sind für sich schon kompliziert genug. Wenn sie sich aber vermischen, kann es ungemütlich werden.
Nachdem ich bereits unangenehme Erfahrungen mit einer Westropolis-Kommentatorin machen musste, die ihre Sympathien und Antipathien wechselte wie Automysophobiker die Unterwäsche, und die mich, ohne je ein Wort in der realen Welt mit mir gewechselt zu haben, vom gemutmaßten Status eines „sehr geschätzten“ Autors im Handumdrehen zum lüsternen Blaubart degradierte, hat es sich nun offenbar eine andere Dame, diesmal aus meinem weitläufigen persönlichen Bekanntenkreis, in den Kopf gesetzt, durch mal mehr, mal (bewusst) weniger gut getarnte Kommentare zu diesem Weblog ihre albernen Spielchen mit mir zu treiben.
Im ersten Fall bekommt man es mit Phantomen zu tun, die die virtuelle Welt vorschnell für bare Münze nehmen und mit ihren wetterwendischen Phantasien Original und Fälschung nicht mehr auseinanderhalten können. Im zweiten Fall hat man einen Stalker bzw. eine Stalkerin am Hals, die es nicht verkraften kann, dass man ihr im realen Leben den Laufpass gegeben hat. So spielt das Leben, so wirkt die Kunst.
Offenbar will das Vögelchen, das da so viel Zeit aufbringt, sein gekränktes Mütchen im Schutz der Anonymität bei diesem Hase-und-Igel-Spiel an mir zu kühlen, sich selbst etwas beweisen. Aber was? Dass es das Stärkere ist? Dass sein zerstörerisches Potenzial es allemal aufnehmen kann mit meinem kreativen, dem ich hier zum Ausdruck verhelfen möchte? Na, diese Konkurrenz ist doch schon entschieden, bevor sie überhaupt begonnen hat.
Es ist immerhin bemerkenswert, zu welchen destruktiven Anstrengungen sich Menschen in der virtuellen Welt des Weblogs verleiten lassen, weil ihr wirkliches Leben bei allen realen Herausforderungen offenbar fade bleibt. Da ist der Ehepartner, da sind die Kinder, da ist eine nach eigenem Bekunden reizvolle berufliche Tätigkeit, da ist das ererbte Portefeuille, das ein komfortables Leben gestattet – und dennoch: Langeweile! Ich könnte fast Mitleid empfinden, wenn es nicht so lästig wäre.
Baggesen
Friday, 22. August 2008
Exzentriker, die zu Lebzeiten im Mittelpunkt des Interesses stehen, geraten anschließend umso schneller in Vergessenheit, während Exzentriker, von denen zeitlebens kaum jemand Notiz nahm, posthum zu Weltstars werden können. Die Vertreter der zweiten Kategorie, ich nenne nur Pars pro Toto Vincent van Gogh, kennt heute jedes Kind, wohingegen der einst weltberühmte dänische Artist und Jongleur Carl Emil Baggesen (geb. ~1863 Odense, gest. 21. Mai 1931 Thurö) nahezu spurlos aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist, das sich fatalerweise inzwischen fast ausschließlich auf Google und Wikipedia beschränkt.
Auf Baggesen war ich durch zwei Feuilletons von Alfred Polgar und Hans Siemsen aus dem Jahr 1927 aufmerksam geworden. Das Internet gibt zu ihm so gut wie nichts her, aber wenn man die Fachleute fragt, bekommt man schon noch so einiges raus. Bevor er in den 1890er-Jahren seine Nummern mit dem stürzenden Tellerstapel und dem klebrigen Fliegenpapier ersann, trat Baggesen erfolgreich als Kontorsionist auf. So war er 1885 sechs Monate lang im sog. „Wellblech-Circus“ A. Krembser am Friedrich-Karl-Ufer in Berlin als „anatomisches Weltwunder“ zu sehen.
Solche „Schlangenmenschen“, die dank einer angeborenen oder durch hartes Training erworbenen extremen Gelenkigkeit ihre Körper zu ungewöhnlichen Figuren verbiegen können, waren schon damals sehr zahlreich im Schaustellergewerbe vertreten, die Konkurrenz war hart, selbst wenn, wie bei Carl Baggesen, noch die perfekte Beherrschung der Jonglage hinzukam. Erst durch eine außergewöhnliche Choreographie bzw. Dramaturgie, die außer durch die verblüffende Extremgymnastik auch noch als ästhetische oder humoristische Attraktion bestehen konnte, war Weltruhm zu erringen, was The Baggesens („1 Dame, 1 Herr“) unzweifelhaft mit ihrem „Laughing Hit“ sehr bald gelang. Zahllose internationale Engagements künden von ihren Erfolgen: Chicago 1895, London und Berlin 1898, Paris, Amsterdam, Hamburg, München, Nürnberg, Brüssel, Wien und Paris 1899, Berlin und Leipzig 1900, Frankfurt am Main, Breslau, Berlin, Kopenhagen 1901 – so beginnt die lange Liste der Auftritte und endet erst 1927, vier Jahre vor Baggesens Tod. Die stattliche, in würdevoller Haltung jonglierende Dame, die ihm auf der Bühne assistierte, war seine Ehefrau Sophia, die sich als Artistin Saphira nannte (geb. 1864, gest. 15. [?] Dezember 1943).
In seinen Erinnerungen schreibt der Berliner Varieté- und Zirkusagent Robert Wilschke über das berühmte Paar: „Einen Extralorbeer […] winden wir […] den Baggesens. Wer hat noch nicht über Baggesens gelacht? Ihre Szene spielte in der Küche, sie hantierten mit Tellern und Bergen von Geschirr, die immer in Gefahr waren, ihnen aus den Händen zu gleiten und dann auch in Trümmer stürzten. Wenn Baggesen in seinem alten, viel zu weiten Frack mit dem Berg von Tellern über die Bühne hatschte, wenn sich der Berg der Teller neigte und Baggesen durch Verrenkungen seines Körpers das Gleichgewicht wieder herzustellen suchte, dann ging schreiendes Lachen durchs Haus. Es schrien die Hausfrauen, die aus ihrem eigenen Etat wußten, was Teller kosten, es schrien die Kinder, es lachten die Männer aus vollem Halse – man kann wohl sagen, daß Baggesens die Nummer waren, über die in allen Häusern der Kontinente das schreiendste Lachen ausbrach. Die Tragikomödie zerbrechenden Geschirrs war etwas, was jeder irgendwie einmal an sich selbst erlebt hatte, darin lag das Geheimnis des Erfolges dieser Nummer. Dazu kam noch die heitere Episode mit dem Fliegenpapier. Hatte Baggesen wieder seine Teller in Unordnung gebracht, dann kam das Unheil des Fliegenpapiers, das sich an seine Finger klebte. Strich er’s von der einen Hand ab, klebte es schon wieder an der anderen. Hatte er die Hände davon befreit, klebte es am Rock oder an den Hosen oder am Gesicht, und schließlich war das Fliegenpapier schuld, daß die ganze Küche in Trümmer ging … Baggesens Nummer hatte der Zufall erfunden. Ursprünglich war er Kautschukmann. Als er einmal in einem Artistenrestaurant speiste, war er Zeuge, wie einem durchs Lokal gehenden Kellner ein ganzer Stapel von Tellern von den Armen rutschte. Der Anblick brachte Baggesen auf die Idee, eine Nummer daraus zu bauen. So entstand ein Welterfolg.“ (Robert Wilschke: Im Lichte des Scheinwerfers. Berlin: Kranich Verlag, 1941, S. 144 f.; daraus auch das Titelbild, Taf. XX.)
Eine Filmaufnahme der legendären Nummer, die vermutlich im Laufe der Jahre Millionen Menschen „zu Thränen der schrankenlosesten Heiterkeit“ rührte, wie es in einem Bericht von 1899 heißt, scheint leider nicht erhalten zu sein. So sind wir, wenn wir uns ein Bild von der komischen Wirkung der Baggesens machen wollen, auf einige wenige Schilderungen in den Werbetexten und Feuilletons jener Zeit angewiesen – und auf die Kraft unserer Phantasie.
[Für wertvolle Hinweise zu diesem Beitrag danke ich dem Sammler Martin Dahm (Düsseldorf) und Hermann Sagemüller vom Jongleurarchiv in Nördlingen-Baldingen; sowie Brigitte Aust vom Essener Markt- und Schaustellermuseum und Johnny Markschiess-van Trix (Berlin) für die Vermittlung.]
Märchen (I)
Thursday, 21. August 2008
In der Nacht auf den 28. Juli 2008 ereignete sich in einem Luxusapartment auf den Palm Islands in Dubai ein grausamer Mord. Die 30-jährige libanesische Popsängerin Suzan Tamim wurde durch zahlreiche Messerstiche getötet und anschließend verstümmelt. Der Täter entkam zunächst nach Ägypten, wurde dort aber bald gefasst, weil er am Tatort ein eindeutiges Beweisstück zurückgelassen hatte. In der kurzen Zeit, die er noch zu leben hatte, gestand Mohsen al-Sukkari der Polizei, dass er Suzan Tamim im Auftrag eines schwerreichen ägyptischen Geschäftsmannes umgebracht habe. Am 10. August wurde er tot in seiner Zelle aufgefunden.
Heute rangierte der Artikel Tod einer Pop-Prinzessin von Ulrike Putz (Beirut) bei Spiegel online kurzfristig auf Platz 1 der „Most Wanted“-Artikel. Die Autorin beschäftigt sich darin eingehend mit der Frage, wer der ominöse Geschäftsmann war: „Anfangs sprachen die Teilnehmer der großen Talkshows im ägyptischen Fernsehen den Namen noch ganz offen aus. Etablierte Zeitungen wie der englischsprachige Daily Star erzählten die Gerüchte nach: Der mutmaßliche Mörder sei ein Bodyguard des Besitzers zahlreicher Luxus-Hotels gewesen. Es dauerte nicht lange, dann schritt Ägyptens oberster Staatsanwalt ein und verpasste der Presse einen Maulkorb: Keine Berichte über eine mögliche Verbindung des Mordopfers zu dem Unternehmer, der im ägyptischen Oberhaus sitzt. Trotzdem brodelte die Gerüchteküche – und die Kairoer Börse verzeichnete für seine Firma, die Hotels und Ressorts vermarktet, dramatische Kurseinbrüche. Der Kursverfall gehe eindeutig auf die ,anhaltende Berichterstattung über den Vorstandsvorsitzenden‘ zurück, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters Händler an der Kairoer Börse.“ Nachdem sich Suzan Tamim von ihrem zweiten Ehemann, dem Popmusik-Produzenten Adel Matuk, im Streit getrennt hatte, floh sie zunächst nach Kairo, wo sie dem ägyptischen Immobilien-Mogul begegnet sein soll, der sie anschließend unter seine Fittiche genommen habe. Doch vor etwa acht Monaten sei auch dieses Verhältnis in die Brüche gegangen. Daraufhin flüchtete sich Tamim nach Dubai, wo sie zuletzt bis zu ihrem gewaltsamen Tod wieder erfolgreich als Sängerin in Clubs auftrat.
Nachdem der Spiegel sich selbstgefällig einerseits über die „Klatschreporter der arabischen Welt“ ausgelassen hat, von denen seine Korrespondentin Ulrike Putz doch den größten Teil ihrer „Informationen“ bezieht; und nachdem der Spiegel andererseits die Zensur in Ägypten anprangert, die es möglich macht, den scheinbar guten Namen eines der mächtigsten Männer des Landes aus der Sache und aus den Medien herauszuhalten, obwohl es gute Gründe gibt, seine Beziehungen zu dem Mordopfer öffentlich zu hinterfragen – erwartet man nun doch vom Spiegel, wir sind hier schließlich nicht in Ägypten, dass er seinen Lesern den Namen dieses Mannes verrät. Das tut er aber nicht. Und da drängt sich die Frage auf, warum der Spiegel sich in diesem Punkt eine solche, gelinde gesagt: befremdliche Zurückhaltung auferlegt, zumal es relativ einfach ist, dieses kleine Rätsel zu lösen. Man findet den Namen dieses „Egyptian businessman“ z. B. in einem Artikel der gulfnews vom 12. August und auch in dem englischsprachigen Wikipedia-Artikel über Suzan Tamim. Er lautet Hesham Talaat Mustafa.
Mit diesen 19 Buchstaben kann der interessierte Leser nun weiter googeln und findet dann sehr bald einen aufschlussreichen Artikel von Barry Rubin in Heartland über die Muslimbruderschaft, in dem es über deren Aktivitäten in Ägypten heißt: “To carry out their operations, the Brotherhood groups are reasonably well funded. Their money seems to come from four major sources. First, rich adherents to the movements give donations. This is especially true of Egyptians who emigrated to Saudi Arabia or Kuwait and became rich there. One of the main Islamist Egyptian businessmen is Hisham Talaat Mustafa who is partner of the Saudi billionaire Prince al-Waleed ibn Tata’al al-Saud Saud.” [Hervorhebung von mir.]
Die 1928 von Hassan al-Banna gegründete Muslimbruderschaft ist eine der einflussreichsten islamisch-fundamentalistischen Bewegungen im Nahen Osten. Alle militant islamistischen Gruppierungen der Gegenwart, von der Hamas über die al-Dschama’a al-islamiyya bis hin zu al-Qaida sind ursprünglich aus der Bruderschaft hervorgegangen bzw. haben sich von ihr abgespalten. Wirklich interessant könnte es für einen investigativen Journalisten der freien Welt sein, die Gunst des Zufalls zu nutzen, dass ein trotteliger Auftragsmörder ein „eindeutiges Indiz“ am Tatort zurückließ, um an diesem Fall mehr zu enthüllen als das traurige Schicksal einer Pop-Prinzessin. Beim Spiegel aber werden offenbar nur noch Klatschreporter beschäftigt, zu dumm oder zu feige, um sich mit der rauen Wirklichkeit zu befassen. Und denen als Schlusssatz kein besserer einfällt als dieser: „Es ist ein Märchen.“
Summertime ’69
Wednesday, 20. August 2008Ende Juli, Anfang August machte unsere kleine Familie zum letzten Mal Urlaub in Noordwijk aan Zee. Bevor wir mit unserem weißen Ford Taunus in Richtung Holland aufbrachen, erlebten wir noch am 21. Juli um vier Uhr in der Frühe wie 500 Millionen Menschen in aller Welt vorm Fernseher die erste Mondlandung: “That’s one small step for a man, one giant leap for mankind!” Zehn Tage vorher hatte ich meinen 13. Geburtstag gefeiert, nun freute ich mich auf Sonne, Strand und Meer.
Wie üblich wohnten wir im Hotel Op De Hoogte, ganz in der Nähe der Tennisanlage und nicht allzu weit vom Strand entfernt. Ich erinnere mich, dass mein Vater, es muss am Vormittag des 10. August gewesen sein, wohl zum ersten und einzigen Mal eine Bild-Zeitung kaufte, weil die WAZ überall ausverkauft war. In riesigen Lettern wurde ein schrecklicher, fünffacher Mord in Kalifornien bekannt gegeben. Das prominenteste Opfer war die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate. Der Hausbesitzer, ihr Ehemann Roman Polanski, hielt sich zur Tatzeit in Europa auf.
Bei unserer Heimkehr nach Essen wenige Tage später fühlte sich mein Vater unwohl. Er konnte nach Ablauf seines Urlaubs nicht an seinen Arbeitsplatz bei der Ruhrgas zurückkehren und musste sich zum ersten Mal in seinem Leben von unserem Hausarzt krank schreiben lassen. Im Februar dieses Jahres hatte er bei bester Gesundheit seinen 43. Geburtstag gefeiert, im Jahr zuvor hatte er, kurz bevor dies infolge der „Trimm-dich!“-Kampagne in den frühen 1970er-Jahren zum Massentrend wurde, auf der Schillerwiese sein Goldenes Sportabzeichen „gemacht“ und sich vorher einem allgemeinen Gesundheits-Check unterzogen, der keinerlei körperliche Beeinträchtigungen ergeben hatte. Nun lag er im Bett und schlief.
Am 15. August eröffnete Richie Havens mit Motherless Child nahe der Kleinstadt Bethel im amerikanischen Bundesstaat New York jenes legendäre Open-Air-Festival, das unter dem Namen „Woodstock“ als Höhepunkt der Hippie-Bewegung in den USA in die Geschichte eingegangen ist. Seinen Refrain („Freedom“) wird niemand vergessen, der damals jung war und sein Herz seither nicht verkauft hat. Als Jimi Hendrix am frühen Morgen des 18. August mit Hey Joe das Festival ausklingen ließ, lag mein Vater schon im Krankenhaus und wartete auf eine Notoperation.
Da war aber nichts mehr zu machen. Am Mittwoch, dem 20. August, ging ich mit meinem Cousin Jörg ins Kino. In seiner Nachmittagsvorführung zeigte das Filmstudio im Glückaufhaus Ken Annakins Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten (1965). Ich schüttete mich aus vor Lachen und kam in bester Laune heim. Meine Mutter brachte es nicht übers Herz, mir am gleichen Tag noch die traurige Nachricht zu überbringen, die mich am nächsten Morgen dann wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf. Ich hatte keinen Vater mehr.
[In memoriam Hans Heinz Heßling, gen. „Hanno“, geb. am 1. Februar 1926, gest. am 20. August 1969.]
Spiel (I)
Tuesday, 19. August 2008
Partie in der „Schacharena“, rdtd80 – Revierflaneur (18.08.08, 13:56 bis 14:12 Uhr): 1. e2-e4 e7-e5 2. Sg1-f3 Sb8-c6 3. Lf1-c4. Das ist die Italienische Partie, auch bekannt als Giuoco Piano. Sie wurde bereits im 15. Jahrhundert in der Göttinger Handschrift (Philos 85) erwähnt und zählt damit zu den ältesten dokumentierten Schacheröffnungen überhaupt. Die üblichen Erwiderungen sind 3. … Lf8-c5, 3. … Sg8-f6 oder gelegentlich noch die Ungarische Verteidigung mit 3. … Lf8-e7 (ECO-Code C50-C59).
Wie man erfahrungsgemäß dann weiterspielt, das wissen die starken Spieler in dieser Arena besser als ich. Ich habe nie den Fleiß aufgebracht, das kleine Einmaleins der Schacheröffnung zu pauken, vom großen ganz zu schweigen. Darum versuche ich vorzugsweise mein Glück mit Varianten, die man weder hier noch dort findet und wähle in dieser Situation öfter mal die gewiss längst widerlegten Züge 3. … Sg8-h6 oder wie in diesem Fall 3. … Dd8-f6, mit denen ich durchaus schon Erfolg hatte. Nachteilig ist, dass die Dame in dieser Position schnell in Gefahr geraten kann, dass das Feld f6 für den Sg8 verstellt ist und dass Weiß seine Dominanz im Zentrum weiter ausbauen kann. Der einzige für mich entscheidende Vorteil besteht darin, dass Weiß schon in dieser frühen Phase gezwungen ist, die vertrauten Pfade der Eröffnungsroutine zu verlassen, was viele Spieler mit ELO-Werten unter 1500 offenbar irritiert. (Ich selbst trat diesmal mit einem ELO von 1434 an, mein Gegner hatte 1475 ELO-Punkte.) Danach folgten 4. Sb1-c3 Sg8-e7 5. Sc3-b5.
Das sieht bedrohlich aus, denn nach 6. Sb5-c7 † droht der Verlust des Ta8. Der Bauer c7 muss also verteidigt werden, was nur durch den König möglich ist, mit Preisgabe der Rochade: 5. … Ke8-d8 6. Sb5-c3 Sc6-b4. Dies schien mir nötig, um der Dame einen Fluchtweg auf der 6er-Reihe zu eröffnen und 7. Sc3-d5 zu verhindern. 7. a2-a3 Df6-c6 8. Lc4xf7. Auch nach 7. Lc4-b5 hätte ich den Sb4 nicht mehr retten können. So aber kann ich immerhin mit einem Entwicklungszug dem Lf7 den Rückweg versperren: 8. … d7-d5 9. a3xb4. 9. … d5-d4. 10. Sf3xe5. Weiß hat einen Bauern und einen Springer kassiert und steht scheinbar deutlich auf Gewinn.
Aber jetzt findet die bedrohte Dame ein Feld, auf dem sie sich pudelwohl fühlt: 10. … Dc6-f6 – und im Handumdrehen sieht die Welt für Schwarz viel freundlicher aus. Drei weiße Figuren (Sc3, Se5 und Lf7) sind gleichzeitig angegriffen, nur der Läufer ist (noch) gedeckt. Weiß gerät unter Druck und greift mit der Dame ins Spielgeschehen ein: 11. Dd1-h5. Doch auch so ist der Se5 nicht mehr zu retten: 11. … g7-g6 12. Lf7xg6 h7xg6 13. Dh5-f3 Df6xe5 14. Sc3-a4. Nicht noch den zweiten Springer verlieren, sagt sich Weiß. Aber zur Ruhe kommt er auf a4 noch nicht: 14. … b7-b5 15. Sa4-c5 Se7-c6.
Weiß ist offenbar durch die überraschende Wendung des schon gewonnen geglaubten Spiels aus dem Gleichgewicht gebracht und meint, nun dringend etwas für die eigene Sicherheit tun zu müssen – ein verhängnisvoller Fehler: 16. 0-0. Vielleicht will der Gegner mich unbewusst auch damit ärgern, dass er mich jetzt daran erinnert, mir schon mit seinem 5. Zug die Rochade verbaut zu haben. Doch jetzt folgt 16. … De5xh2 matt. (Besser gewesen wäre z. B. 16. Sc5-d3 oder 16. d2-d3.) – Ein blinder Hahn findet auch mal ein Korn. Und seine Chancen steigen, wenn er sich vom zentralen Futtertrog des sehenden Geflügels fortbegibt. Wie lautet doch noch gleich mein Motto? Kleine Schritte weg von der Mitte.
[Titelbild von Wilhelm Busch aus Der Hahnenkampf. Zuerst erschienen in: Münchener Bilderbogen (1862).]
Romane lesen?
Monday, 18. August 2008
Der große Alfred Polgar hat einmal in einem seiner unnachahmlich konzisen Bravourstücke nur vermeintlich kleinmeisterlicher Kurzprosa bekannt: Ich kann keine Romane lesen (zuerst erschienen in Der Tag, Wien, 4. April 1926; hier zit. nach: Kleine Schriften. Bd. 4: Literatur. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1984, S. 259-263). Und seine knappe Erklärung dieses persönlichen Unvermögens ist, gerade für einen Romanvielleser wie mich, tatsächlich bezwingend.
Eingangs führt Polgar uns erbarmungslos vor Augen, dass es auf der Welt „entschieden zu eng“ ist. Wohlgemerkt: Das konstatierte er bereits vor gut acht Dezennien; um wieviel mehr gilt es heute? „Es gibt sehr viele Menschen auf dem Planeten Erde – alle, natürlich, sollen gesund sein und leben bis hundert! – in China allein hausen eine halbe Milliarde, und das so dreieckige wie dreckige Zimmer im XVIII. Bezirk, wo mein Schuster Potzner mit Familie wohnt, beherbergt sechs Personen.“ Ganz aktuell, was die Zahlen und Fakten betrifft, ist Polgars Text zwar nicht mehr, wie man hieran schon sieht. Denn heute hausen in China bereits 1,321 Mrd. Menschen, weit mehr als doppelt so viele, trotz der dort seit 1980 konsequent verfolgten Ein-Kind-Politik. Was die Folgen aus Polgars längst veralteten Voraussetzungen angeht, ist er aber nur umso aktueller. (Nebenbei – und bei Polgar offenbart sich ja nicht selten die Hauptsache in einem solchen „Nebenbei“ – erklärt er uns, warum er „furchtbare Angst“ vor dem Kommunismus hat. Auch da sind wir mittlerweile einen Schritt weiter. Wir wissen, ohne durch diese Erkenntnis glücklicher geworden zu sein, dass Polgars Angst begründet war.)
Und so fährt der Meister fort: „Doch das führt ab von Weg und Ziel dieser Betrachtung. Eigentlich wollte ich sagen, daß der Mensch, obwohl er oft, ich zum Beispiel, wirklich gar nichts dafür kann, erschütternd viele Menschen kennt. Indem du lebst, setzt sich Bekanntschaft an wie Zahnstein, und die Laden deines Bewußtseins füllen sich mit Sachen der Nebenmenschen wie die deines Tisches mit Briefmüll. Man sollte jene ausräumen können gleich diesen. Aber das Leben rieselt jeglichen Tag, und auf nein und nein hat es dich ganz versandet und verschüttet. In tausend Schicksale bist du durch Neugier, Gefühl, Nötigung hineingeknüpft, tausend Atem wehen Hauch und Sturm in deine Segel, immer schreckhafter wird die unentrinnbare Vision von Figuren, Gesichtern, Stimmen, die deine Szene hintergründig abschließt.“ (Ebd., S. 260 f.) Dies alles ist mir nur allzu vertraut. Und nun stellt Polgar die ketzerische, bohrende, unabweisliche Frage: „Und da soll man Romane lesen?“
Ja, warum eigentlich? Hat man denn noch nicht mehr als genug Ablenkung vom Eigentlichen des Eigenen durch das quirlige Tohuwabohu der frei- und unfreiwilligen Sozialkontakte, wie der moderne Begriff für diese alte, strapaziöse Unübersichtlichkeit lautet? „Bei dieser Übervölkerung des Bewußtseins,“ so Polgar weiter, „noch Leute hineinzulassen, die gar nicht sind oder waren? Dem bis zum Niederbrechen in Anspruch genommenen Interesse für das Leben, seine Figuren und Schicksale, auch noch konstruiertes Leben, erfundene Figuren, zusammengelogene Schicksale aufladen? Wie, bei dieser schrecklichen Antlitze-Inflation, die das Dasein ohnehin mit sich bringt, soll ich noch Antlitze aus der Phantasie-Münze des Romanschreibers in meinen geistigen Umlauf setzen? Zubauen statt abbauen?“ (Ebd., S. 261)
Alfred Polgar hat Recht – aber cum grano salis. Ganz möchte ich auf die Gegenwelt der Romanfiktion nicht verzichten. Allerdings bin ich sehr wählerisch geworden. Vom unüberschaubaren Personal der aberhundert Romane, dem ich in meinem langen Leserleben Zutritt zu meinem Bewusstsein gewährte, sind nur sehr wenige Antlitze noch deutlich erkennbar. Neben diesen allerdings verblasst manche Fratze, die mir im wirklichen Leben in den Weg trat. Und gelegentlich baue ich diesseits ab, um für die jenseitigen Figuren und Schicksale eines Romans Raum zu schaffen. Und außerdem, lieber Bruder Alfred: Sind nicht auch die Schicksale vieler realer Nebenmenschen zusammengelogen? Unwirklicher und bedeutungsloser als eine wahre Erfindung? Eine Real-Münze zwar, für die ich mir aber dennoch nichts kaufen kann?
Demokratie
Saturday, 09. August 2008Ich hätte „die Möglichkeiten diese[s] demokratischen Kommunikationsmodells nicht zu nutzen gewußt“, meint per E-Mail meine Ansprechpartnerin bei Westropolis, indem sie mir mitteilt, dass mein zum 31. August auslaufender Vertrag mit der WAZ NewMedia GmbH & Co. KG nicht verlängert wird. Warum? Weil „wir uns bezüglich Ihres konfrontativen Kommentarstils nicht verständigen konnten“ und „aufgrund der Entwicklung der letzten Wochen“.
Da fällt mir ja ein Stein vom Herzen! Komischerweise erinnert mich die Begründung für diesen Rausschmiss an das Parteiausschlussverfahren gegen Wolfgang Clement. Aber nur ganz von Ferne, nämlich weil in diesem Zusammenhang neulich ein Satz des früheren SPD-Politikers Heinrich Albertz zitiert wurde: „In einer Gesellschaft, die sich demokratisch nennt, wird man sich daran gewöhnen müssen, dass manche den Mund auftun, wenn sie es für richtig halten, und auch Zeitpunkt und Ort ihrer Äußerungen selbst bestimmen.“
Nun konnten sich die Verantwortlichen bei Westropolis offenbar nicht daran gewöhnen, dass einer ihrer Gastautoren immer mal wieder, auch als Kommentator zu fremden Beiträgen, seinen Mund auftat und offen seine unbequeme Meinung sagte, dabei auch die Konfrontation mit anderen Gastautoren und Kommenatoren nicht scheute, insofern die Möglichkeiten dieses demokratischen Kommunikationsmodells nicht bloß nutzte, sondern voll ausschöpfte.
Im Unterschied zu Wolfgang Clement habe ich mich allerdings zu keiner Parteiraison verpflichtet, als ich am 7. August 2007 meinen Honorarvertrag mit der WAZ NewMedia GmbH & Co. KG unterschrieb. Verpflichtet fühlte ich mich ausschließlich meinen eigenen Ansprüchen an journalistische Qualitätsstandards, meinen politischen und ästhetischen Überzeugungen und meinen vertraglich vereinbarten Aufgaben. Dieses Selbstverständnis befremdete offenbar nicht nur die an allerlei Loyalitätsversprechen gebundenen Journalisten der WAZ-Mediengruppe, die hier neben ihrer schweißtreibenden Tätigkeit für die Printmedien noch als Blogger zwangsverpflichtet wurden, sondern auch manchen Leser und Kommentator, der es nicht gewohnt war, für seinen öffentlich gemachten Blödsinn öffentlich Spott zu ernten.
Dass ich schon recht bald, und keineswegs erst in den letzten Wochen, die Grenzen der Möglichkeiten dieses „demokratischen Kommunikationsmodells“ erfuhr, hat mich zwar stutzig gemacht, aber leider nicht zu einem raschen Abschluss dieses Experiments bewegt. Mitte Oktober vorigen Jahres veröffentlichte ich einen kritischen Beitrag über eine Kollegin aus der Galerie der Gastautoren und handelte mir damit einen scharfen Verweis meiner Ansprechpartnerin ein. Dass ich nicht bereits damals das Handtuch warf, sondern meinen Beitrag löschte, ist die einzige Inkonsequenz, die ich mir im Rückblick auf dieses lehrreiche Intermezzo vorzuwerfen habe.
[© Titelbild: Ausschnitt aus dem Schutzumschlag von Simone Barck / Siegfried Lokatis: Zensurspiele. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag, 2008.]
Protected: Stirnkuss
Thursday, 07. August 2008Elchtest
Wednesday, 06. August 2008Neulich machte meine Ex-Kollegin, die Kleinschreiberin Else Buschheuer, in ihrem Hypochondrie-Blog (als „fundstück des tages“ unterm 30. Juli 2008) auf einen acht Jahre alten You-Tube-Clip aufmerksam, in dem sie sich mit dem Ex-Großkritiker Marcel Reich-Ranicki in der SFB-Kulturtalkshow Alex über die Frage zauselt, von wem denn nun eigentlich jener bekannte Reim stammt: „Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche.“
Der ehemalige Elch verfiel in den altbekannten Fehler und plädierte energisch für Robert Gernhardt. Die damals, lang ist’s her, als aktueller Shooting Star der gesamtdeutschen Literaturszene gefeierte Autorin von Ruf! Mich! An! wusste es besser und beharrte auf Bernstein. Davon wollte Reich-Ranicki nichts wissen, bis ihm dämmerte, dass vielleicht doch etwas dran sein könnte an dieser Zuschreibung des Zweizeilers. Er hatte, wie er offen bekannte, bei diesem Namen an den US-amerikanischen Komponisten, Dirigenten und Pianisten russisch-jüdischer Abstammung Leonard Bernstein gedacht. So zeugt gute Komik ihre ungewollten Kinder.
Nach glaubwürdigem Bekenntnis des Autors der legendären zwei Zeilen, der mit bürgerlichem Namen Fritz Weigle heißt und sich Mitte der 1960er-Jahre als ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift Pardon unter dem Pseudonym F. W. Bernstein bemerkbar machte, entstand das Elchgedicht in einer Winternacht in einem Volkswagen auf der Fahrt von Paris nach Colmar, als Ergebnis eines poetischen Brainstormings, an dem neben ihm noch die mittlerweile verstorbenen Pardon-Kollegen Robert Gernhardt und F. K. Waechter beteiligt waren.
Die Geburt des unsterblichen Reims erfolgte auf schneeglatter Straße mühevoll in vielen kleinen Schritten. Zuletzt dichtete Bernstein: „Die schärfsten Kritiker der Elche / wären gerne selber welche.“ (Man beachte den kleinen, aber feinen Unterschied zum bis heute tradierten „Klassiker“!) Darauf erwiderte Gernhardt eine Sekunde später: „Die größten Kritiker der Molche / waren früher eben solche.“ Somit ist das so überaus erfolgreiche Mini-Gedicht doch eigentlich eine Koproduktion von Gernhardt und Bernstein. Und insofern hatten Reich-Ranicki und Buschheuer beide Recht.
Aber nur Recht im Unrecht. (Wie könnte mehr auch rauskommen im Nonsens-Format einer gesamtdeutschen Kulturtalkshow, zwischen solchen inkompatiblen Gesprächspartnern, die nichts gemein haben als ihre Gier nach Prominenz?) Denn das alleinige Urheberrecht auf die ja viel bessere, treffendere, zu Unrecht vergessene Fassung des Gedichts gebührt allein Fritz Weigle alias F. W. Bernstein: „Die schärfsten Kritiker der Elche / wären gerne selber welche.“
[Titelbild: signierte und datierte Illustration von Hans Traxler; aus dem Besitz des Autors.]
Versprechen
Tuesday, 05. August 2008
Die heroischen Denkmale früherer Jahrhunderte sind nach zwei totalen Kriegen im letzten mindestens in Europa wohl endgültig aus der Mode. Die Bismarcktürme stehen zwar noch immer unschön in der Landschaft herum; und auch Kaiser Wilhelm II., den keiner mehr wiederhaben will, reitet stumm und starr hoch zu Ross vor mancher Kirche und auf manchem Platz, ohne vom Fleck zu kommen. Doch finden an diesen steinernen oder bronzenen Relikten nur noch die Tauben Gefallen.
Wenn heute Denkmäler in den öffentlichen Raum gestellt werden, von der öffentlichen Hand und privaten Sponsoren finanziert, dann ist ihr Thema längst nicht mehr die Heldenverehrung und ihr Motiv kaum die Verkündung einer glorreichen Zukunft. Vielmehr sind’s heute meist Mahnmale, die die wenig glorreichen Folgen solch verblendeter Verehrung in Erinnerung rufen sollen. Und die Künstler, die solche Werke schaffen, arbeiten nicht länger mit Hammer und Meißel, diesen brutalen Werkzeugen eines kreativen Archaikums, in staubigen Ateliers, wie zu Arno Brekers Zeiten. Schlechte Aussichten also für Steinmetzen und Bildhauer aller Art, zumal es auch mit der Sepulkralkultur erkennbar bergab geht. Die anonyme Bestattung in einem namenlosen Gräberfeld erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Dieses Renommiergehabe noch über den Tod hinaus war ja auch wirklich zu albern und keines aufgeklärten Geistes würdig.
Vielleicht ist das, in groben Zügen, der geistesgeschichtliche Hintergrund, vor dem man sich einem neuen „Denkmal“ des Konzeptkünstlers Jochen Gerz nähern sollte, das seit 2007 an der evangelischen Christuskirche in Bochum entsteht, auf dem Platz des europäischen Versprechens. In der 1931 angelegten „Helden-Gedenkhalle“ im Turm dieser Kirche liest der Besucher die Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen Bochumer. Daneben sind in einer zweiten Liste die 28 damaligen „Feindstaaten Deutschlands“ aufgezählt, als sollte in wacher Erinnerung gehalten werden, an wem der Opfertod der Erstgenannten in einem Zweiten Weltkrieg zu rächen sei. (Ganz ging dieses Konzept bekanntlich nicht auf, denn die früheren Feindstaaten Italien und Japan wurden 1940 durch den Dreimächtepakt die wichtigsten Bündnispartner des Dritten Reiches.)
Von diesen Gegebenheiten an historischem Ort inspiriert, lädt Gerz nun „die Bewohner der Stadt [Bochum], des Ruhrgebiets und die Bürger Europas“ dazu ein, „Autoren eines neuen Platzes zu werden. Alle Teilnehmer tragen ihren Namen bei, und jeder Name steht, eingeschrieben in den Platz, für ein Versprechen. […] Das Versprechen gibt jeder nur sich selbst. Es ist geheim und frei. So entsteht ein unsichtbares Manifest aus vielen Stimmen und Kulturen – das neue Europa. Der Platz des europäischen Versprechens entsteht im Auftrag der Stadt Bochum als Beitrag zur Europäischen Kulturhauptstadt Ruhr 2010. Er soll am 31. Dezember 2010, dem letzten Tag des Kulturhauptstadtjahres, der Öffentlichkeit übergeben werden.“
Ich habe mich vor ein paar Wochen mal probehalber an diesem Projekt beteiligt und meinen Namen gestiftet. Heute entdeckte ich ihn dann endlich im unregelmäßig aktualisierten PDF der Versprechens-Homepage (Ausschnitt s. Titelbild). Was ich Europa versprochen habe, verrate ich natürlich nicht, denn Diskretion ist Ehrensache und gehört ja offenbar zum Konzept. Hätten die Teilnehmer sich offen und ehrlich, Wort für Wort zu ihren Versprechen bekennen müssen, wären wohl kaum (bis heute) 6065 Namen zusammengekommen. Versprechen, die man ausschließlich sich selbst gibt, sind wunderbar unverbindlich. Kein Mensch merkt zudem, wenn ich mich bar jedes Versprechens in die Liste eintrage, allein von dem eitlen Wunsch getrieben, meinen Namen auf einem öffentlichen Platz verewigt zu sehen. Und außerdem kommt so nicht raus, dass ich mich beim Aussprechen meines Versprechens im stillen Kämmerlein peinlicherweise versprochen habe. Seither frage ich mich allerdings, ob Jochen Gerz die Doppeldeutigkeit von „versprechen“ intendiert hat. Was wäre eine taugliche Alternative zu diesem ambivalenten Wort gewesen? Gelöbnis! Doch das geht aus oben genannten Gründen ja heute gar nicht mehr.
Findling (I)
Monday, 04. August 2008Beim Stochern in der Weltbühne, auf Siemsens Fährte, stolperte ich heute zufällig über eine kleine Gerichtsreportage zum Mordfall Helmut Daube in Gladbeck, der seinerzeit im ganzen Deutschen Reich für Aufsehen sorgte. Ihr Autor leitet den justizkritischen Text mit einem Kurzporträt des Ruhrgebiets ein, den es sich noch heute zu lesen lohnt:
Der Tatort „Gladbeck ist ein kleiner Bezirk in jener riesenhaften Aneinanderreihung von Fabrikorten, die von Dortmund und Hagen über die Provinzgrenze hinweg bis nach Crefeld und Düsseldorf reicht. Mit der elektrischen Straßenbahn kann man das ganze Gebiet durchqueren, aber doch ist es keine Großstadt. Vor sechzig, siebzig Jahren wurden aus kleinen westfälischen und rheinischen Bauerndörfern plötzlich Industriestädte. Fremdes Proletariat wanderte in Massen zu, und die Städte wuchsen zusammen. Eine Einheit sind sie nicht geworden, es sind Kleinstädte in Mammutformat. Kleinstädtisch aber bleiben auch die geistigen und kulturellen Bedürfnisse. Die Zahl der in künstlerischen, wissenschaftlichen, buchhändlerischen Betrieben beschäftigten Personen im ganzen Industriegebiet liegt weit unter dem für Deutschland berechneten prozentualen Durchschnitt. Eine Großstadt kann man nicht mechanisch schaffen; die einzelnen Orte im Industriegebiet haben doch stets ihr eignes Geschäfts- und Industriezentrum behalten, um das sich dann Wohnbezirke gliedern.“ (Wolf Zucker: Gladbeck; in: Die Weltbühne, 24. Jahrgang, Nr. 45 v. 6. November 1928, S. 719.)
Das ist doch gut erkannt, klar gesagt – und stimmt im Kern auch heute noch, wenngleich sich das Industrie- mittlerweile zum Dienstleistungsgebiet gewandelt hat. Schon an der Aufgabe, eine identitätsstiftende Dachmarke für die gesamte Region zu finden, beißen sich renommierte Marketingagenturen regelmäßig die Zähne aus. Die Kirchturmspolitik der vielen Städte und Landkreise treibt immer wieder seltsame Blüten und verhindert jene Bündelung der Kräfte, die das Revier wenn schon nicht voranbringen, so doch seinen spürbaren Niedergang bremsen könnte.
Angesichts der Herausforderung, sich in zwei Jahren als Europas Kulturhauptstadt präsentieren zu sollen, droht das Ruhrgebiet gleich doppelt zu scheitern: Es vermag als Kleinstadt-Konglomerat, das es nach wie vor ist, kein großstädtisches Flair zu entfalten – und es weiß den kulturellen Ansprüchen dieses Mega-Events nur durch künstliche Implantate internationaler Highlights zu begegnen. Es fehlt eben nach wie vor an kultureller Substanz und einem selbstbewussten Identitätsgefühl der Bürger an der Ruhr.
Wer als junger, ehrgeiziger Kulturschaffender aus dem Ruhrgebiet vorankommen will, der sieht zu, dass er Land gewinnt. Das war schon immer so und wird auch nach dem Jahr 2010 so bleiben. Eine inspirierende Großstadtatmosphäre, ein unverwechselbarer urbaner Charakter und ein markantes bauliches Antlitz, solche Wohn-, Freizeit- und Lebensqualitäten lassen sich nicht mit noch so vielen Museen, Konzerthäusern und Universitäten aus dem Boden stampfen. Das Schlüsselwort in der 80 Jahre alten Diagnose von Wolf Zucker ist „plötzlich“. In der belebten Natur wächst so kein gesundes Organ, sondern nur ein Krebsgeschwür. – Warum um alles in der Welt ich dann noch hier bin? Sehr einfach: aus einem leidenschaftlichen Interesse für „Sozial-Onkologie“.
[Fortsetzung: Findling (II).]
Geschmacksache
Monday, 04. August 2008„Olympische Spiele, das bedeutet: Wochen eines schönen, frohen Festes, bedeutet für die Fremden, die daran teilnehmen: eine wunderbare Reise […] in ein interessantes Land, umfassende Gastfreundschaft dortselbst, Empfang bei Hohen und Höchsten, Jubel und Ehrungen ohne Zahl, großartige Kämpfe mit den Besten auf gleichem sportlichen Gebiet und vielleicht herrlichen Sieg, Möglichkeit, dem Vaterland Ruhm zu erwerben und den eigenen Namen mit der Goldschrift des Triumphes ins Buch der Weltpopularität einzutragen.“
Wen wundert’s, dass Athleten aller olympischen Disziplinen alles daran setzen, um an diesem glanzvollsten aller sportlichen Wettkämpfe teilnehmen zu dürfen? Alfred Polgar jedenfalls, den ich hier zitiere, hatte wenig Verständnis für die Erwartung kindlicher Phantasten, „es könnte Kulturmenschen geben, die sich an solchem Fest nicht beteiligen werden, wegen des kleinen Schönheitsfehlers, daß es in einem Reich stattfindet, dessen Herren kaltblütig und systematisch ein paarmal hunderttausend schuldloser Mitbürger zur Verzweiflung und zum Selbstmord treiben.“ (Alfred Polgar: Zuviel verlangt; hier zit. nach Schriften, Bd. 1. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1982, S. 135 f.)
Schon vor 72 Jahren wussten die Gastgeber, was sie der Jugend der Welt und ihrer naiven Zuversicht schuldig waren. Kurzfristig wurden antisemitische Parolen an den Berliner Hauswänden übermalt und sogar die Judenverfolgung vorübergehend eingestellt. Das antisemitische Hetzblatt Der Stürmer durfte in Berlin für die Dauer der Spiele nicht öffentlich am Kiosk ausliegen. Konnte man einem solchen Regime tatsächlich weiter Rassismus vorwerfen, wo doch sogar ein Neger namens Jesse Owens an den Start gehen und gleich vier Goldmedaillen gewinnen durfte? Der erinnerte sich noch Jahrzehnte später voller Dankbarkeit an die Gastfreundschaft: „Als ich am Kanzler vorbeikam, stand er auf, winkte mir zu und ich winkte zurück. Ich denke, die Journalisten zeigten schlechten Geschmack, als sie den Mann der Stunde in Deutschland kritisierten.“ (Das Bild zeigt ihn beim Fachsimpeln mit seinem arischen Konkurrenten Lutz Long.)
Die Hoffnungen des Internationalen Olympischen Komitees werden sich auch diesmal erfüllen. Die Spiele in Peking werden nicht zum Eklat. Das Land der Mitte zeigt sich von seiner freundlichsten Seite, selbst die katastrophale Luftverschmutzung konnte immerhin so weit reduziert werden, dass den Marathonläufern kein Erstickungstod droht. Und sogar die Vollstreckung der Todesstrafe, in China für 68 verschiedene Delikte wie selbst Diebstahl und Steuerhinterziehung an der Tagesordnung, wird für die Dauer des Events ausgesetzt.
Aber gleich nach dem 24. August 2008, wenn das olympische Feuer erloschen ist, heißt es dann wieder: “The butchery must go on!”
Entschleunigung
Saturday, 02. August 2008Selbstbewusster Anachronismus ist das Allheilmittel des frohgemuten Pessimisten gegen die Wunden, die ihm die immer auf Beschleunigung gestellte Kommunikationsturbine unserer Tage mit Klingen Marke Gillette ins wehe Fleisch schlägt.
Ich Ahnungsloser habe für ein Weilchen geglaubt, als Trittbrettfahrer eines Medienkonzerns von der Gunst jener Stunde profitieren zu können, als dessen Chefsesselwärmern der Arsch auf Grundeis ging und sie befürchteten, dass ihnen ihre Leser und Abonnenten vom neuen Medium Weblog weggebaggert würden. Ich habe mich von der Illusion verführen lassen – ungeachtet aller Stupidität der Blätter, durch deren alltägliche Veröffentlichung besagter Konzern, leider nicht nur er, die Wälder dieser Welt auf dem denkbar kürzesten Weg in die blaue Tonne befördert –, meinen bescheidenen Beitrag leisten zu können zu einem künftigen, ressourcenorientierten und zudem demokratischeren Kommunikationsmodell.
Tempi passati! Nach anderthalb Jahren als Gastautor bei Westropolis bin ich schlauer. Die fruchtbaren Erfahrungen, die ich in der Zeit meiner anfänglich blauäugigen Hospitanz gesammelt habe – ich ziehe untertänigst meinen Zylinder – kompensieren allemal das karge Honorar, das währenddessen aus der prallen Kasse des Reviermonopolisten und Meinungsmachers auf mein darbendes Konto floss.
Nun gilt es, auf die Bremse zu treten und Schritt für Schritt, ich habe ja schließlich die nötige Muße für eine gediegene Reflexion des lehrreichen Intermezzos, die Höhen und Tiefen dieser Erfahrung Revue passieren zu lassen – zumal ich der Flüchtigkeit und Vergesslichkeit des neuen Mediums ein Schnippchen geschlagen und alles Geschehene sorgfältig dokumentiert habe. (Auf die Cache-Funktion von Google habe ich mich nur einmal, ein entscheidendes Mal zu viel verlassen.)
Und was das Schönste ist: Ich habe zu diesem Recycling vorbeigehuschter Abfälle des Medienspektakels alle Zeit der Welt. Der Undercover-Agent ist über die grüne Grenze entwichen und hat seine Tagebücher, nahezu lückenlos geführt, mit sich genommen. Ob es jemanden interessiert, interessiert ihn immerhin am Rand; denn am Rande hausen jene, denen die Mitte längst schon fremd geworden ist. Und auf diese Marginalisierten kommt es vielleicht irgendwann, vielleicht schon bald in Zeiten der Beschleunigung einmal an.
Vorlesenachlese
Saturday, 02. August 2008Das war’s also wieder einmal, der Polgar-Abend liegt hinter mir. Immerhin ertrugen die 18 Gäste ohne zu murren eine gleiche Zahl von Texten, drei Stunden reine Vorlesezeit. Keiner brach vorzeitig auf. Die Erheiterung war gelegentlich überbordend, wie man wohl sagt. An einigen Stellen, an denen ich Lacher erwartet hatte, kamen sie nicht – weil Polgars Humor oft so fein ist, so listenreich versteckt in seinen mit harter Punze ziselierten Sprachkunstwerklein, dass er beim notwendig flüchtigeren Zuhören, im Unterschied zum gemächlicheren Selbstlesen, dann und wann bei aller Liebe und Mühe des Vorlesers unbemerkt auf der Strecke bleiben muss.
Der Meister selbst war skeptisch, ob seine Prosa zum Vortrag tauglich sei. In einem Bericht über sein Debut als Vorleser eigener Texte zitiert er eine kleine „Stegreifrede“, die er zu diesem Anlass gehalten hat: „Ich lese heute zum erstenmal öffentlich, lege vor Ihnen meine Jungfernschaft als Vorleser ab. Obwohl mir die gute Mutter alles gesagt hat, was da bevorsteht und daß es ganz ohne Schmerzen nicht abgehe, bin ich doch ein wenig unsicher. Erstens, weil ich nicht weiß, ob, was ich schreibe, überhaupt zum Vorlesen taugt – das Beste liegt in der Luft zwischen den Zeilen, und wenn es nicht gelingt, diese Luft mitschwingen zu machen, bekommen Sie gewissermaßen nur die schlechtere Hälfte des Textes zu hören – und zweitens, weil ich nicht weiß, ob ich für mein Geschriebenes der richtige Sprecher bin, ob ich ihm als Vorleser vielleicht eher schade als helfe oder am Ende keines von beiden, und dann die komische Figur eines Reiters mache, der neben seinem Pferdchen herläuft.“ (Alfred Polgar: Vorleser; zuerst in Berliner Tageblatt v. 26. April 1928; hier zit. nach Kleine Schriften. Bd. 3: Irrlicht. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1984, S. 380.)
Diese Bedenken musste ich als Routinier beim Vorlesen nicht haben – eher schon Sorge tragen, dass mir mein Gaul unterwegs durchgehen würde, den ich in wochenlanger Arbeit für diesen weiten Ausritt präpariert hatte: gehätschelt, gefüttert, gestriegelt und gesattelt. Wenn das gelegentlich auf abschüssigem Gelände doch einmal geschah, dann gelang mir immerhin, bei aller Bescheidenheit sei’s gesagt, ihn mit ein paar sanften Ermahnungen wieder auf den goldenen Mittelweg zurückzubringen.
Nachher, wie üblich, fiel mir all das ein, was ich zu Polgar, seinen Lebens- und Schaffensumständen, seiner tragischen Verkanntheit und einsamen Größe noch hätte sagen müssen. Bis vier Uhr in der Frühe wälzte ich mich in den Federn und suchte vergeblich nach Entschuldigungen für diese unentschuldbaren Unterlassungssünden – während meine Gäste derweil längst, hoffentlich beseligt, in Morpheus’ Armen ruhten.
Schließlich schlief ich dann doch irgendwann ein. Das geschah vermutlich, als mir jener aus dem Pausengeplaudere der Zuhörer aufgeschnappte Kommentar durch den Sinn ging, dieser Polgar sei wohl in seiner Zeit gewesen, was etwa ein Dieter Nuhr für heute ist. Polgar beschließt seinen erwähnten Aufsatz mit den Worten: „Es wäre mir peinlich, wenn Sie von diesem Abend sagten: ,Heute war ich zweimal bei einer Vorlesung des P.: zum ersten- und zum letztenmal.‘“ Auch mir wäre dies peinlich – aber nur dann, wenn ich Talent zum „Fremdschämen“ hätte.
[Photographie: David Porsch.]
Aus der Mitte (I)
Friday, 01. August 2008Die junge Mutter, vierzig plus, muss für ein halbes Stündchen Ruhe haben. Sie erwartet den Anruf ihres Scheidungsanwalts. Drum hat sie das knallrote Plastikeimerchen fürs Töchterchen, vier minus, mit Wasser gefüllt und auf die Umfassung des Sandkastens gestellt: „Naaa-ooo-miii! Kuuu-chen-baaa-cken!“ Ein zartes Stimmchen aus dem Wäldchen hinterm Gärtchen hinterm Häuschen signalisiert kindliche Anerkenntnis des kindgerechten Beschäftigungsangebots: „Geiiiil!“
Kurz drauf spielt das Handy der treu sorgenden Mutter die ersten fünfzehn Töne der Ode An die Freude aus Beethovens „Neunter“ vor. Bevor aber Karoline Dorffmann-von Hochstengel mit dem rechten Daumen den Knopf zur Entgegennahme des Anrufs drückt, halbiert sie mit dem linken Daumen auf der Fernbedienung den Dezibelwert einer Kurzreportage über den holländischen Friseur, der aus dem homöopathischen Guru Dragan Dabić gestern wieder den psychopathischen Psychiater und Massenschlächter Radovan Karadžić gemacht hat.
„Dorffmann?“ – „Frau Dorffmann-von Hochstengel, ich grüße Sie an diesem schönen Sommertage. Dr. Wagner am Apparat. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche wollen Sie zuerst hören?“
Unterdessen ist Naomi mit kleinen, aber zielsicheren Schritten aus dem Wäldchen durchs Gärtchen zum Sandkasten gestapft, ein fröhliches Liedchen aus der Kindertagesstätte auf den Lippen, die jetzt leider Sommerpause hat. Das blondzopfige Mädchen hat aus dem Unterholz einen großen weißen Kieselstein mitgeschleppt, so schwer, dass die Kleine ihn kaum tragen kann. Den lässt sie jetzt vergnügt in das rote Plastikeimerchen plumpsen. Wie das spritzt! Dann stellt sie sich, den Henkel des Eimers mit beiden Händen fest umklammernd, mit gespreizten Beinen in die Mitte des Sandkastens und lässt das schwere Gefäß unter sich pendeln wie ein olympischer Hammerwerfer die Kugel am Seil. Obwohl Naomi die physikalischen Gesetze der zentripetalen und zentrifugalen Kräfte niemals erklärt wurden, die auf einen in Rotation um einen gedachten Mittelpunkt versetzten Körper wirken, erfährt sie das Wunder, dass der Kiesel nicht aus dem um sie kreisenden Eimerchen fällt und selbst das Wasser darin haftet wie angeklebt.
Nach sechs oder sieben solcher staunenswerten Rotationen draußen im Gärtchen ist Dr. Wagners Telefonstimme drinnen im Salon gerade bei der schlechten Nachricht angelangt. Er kommt aber nicht mehr dazu, sie auszusprechen. Frau Dorffmann-von Hochstengel gar wird sie niemals erfahren. Der letzte Satz, den sie vor dem ohrenbetäubenden Knall hört, kommt aus dem Fernseher und lautet: „Der Bart ist ab!“ Und Herr von Hochstengel, ihr ansonsten fröhlicher Witwer, wird sechs Wochen später mit Bedauern zur Kenntnis nehmen müssen, dass die 24 Quadratmeter große Panoramascheibe seines Häuschens am Waldrand gegen Schäden dieser Art nicht versichert war.
[Fortsetzung: Aus der Mitte (II).]
Polgar-Soiree
Thursday, 31. July 2008Das Polgar-Programm steht. Ich habe aus den 424 Feuilletons der ersten drei Bände seiner Kleinen Schriften ganze 26 ausgewählt. Es war eine rechte Quälerei, immer wieder zu streichen und zu opfern. Und doch ist das ja immer noch zu viel, denn wollte ich übermorgen alle Texte lesen, käme wieder ein Drei-Stunden-Programm dabei heraus. So überlasse ich die Auswahl und Reihenfolge dem Zufall und der Tagesform des Publikums. Jeder Gast darf ein Los aus dem Zylinder ziehen: 26 Lose mit den Titeln der 26 Texte. Tatsächlich stehen 25 Namen auf der Gästeliste – das letzte Los bleibt dann für mich.
Ulla meint, ich müsse aber doch zu Beginn etwas über Alfred Polgar sagen, den kenne ja schließlich heute keiner mehr. Auch das noch! Ich habe soeben die Biographie von Ulrich Weinzierl ausgelesen (Alfred Polgar. Wien · München: Löcker Verlag, 1985), könnte insofern munter ein gutes Stündchen damit füllen, seine Lebensgeschichte herzuerzählen. Aber bringt das was? Trägt es zum Verständnis oder auch nur zum Genuss der Polgar’schen Erzählkleinodien bei? Wohl kaum. Außerdem schalten die meisten Zuhörer ab, wenn man ihnen Jahreszahlen um die Ohren haut.
Am ehesten geht’s noch so: Ich erzähle von meiner Großmutter mütterlicherseits, Luise Wilhelmine, geborene Leipe, verheiratete und geschiedene Heß, wieder verheiratete und verwitwete Koch, die im Oktober 2005 im gesegneten Alter von gerade 98 Jahren verstorben ist. Zehn Tage nach der Geburt meiner Oma wurde Polgar 34 Jahre alt. So gewinnt man doch ein viel deutlicheres Bild, wann der Mann gelebt hat und wie lang das schon her ist. Neben die Jahreszahlen in den obligatorischen biographischen Zeittafeln schreibe ich mir immer das Alter der Betreffenden. Diese subjektive Zahl sagt ja meist mehr als das objektive Jahr.
Alfred Polak, der sich erst mit 40 offiziell in Polgar umbenennen ließ, wurde am 17. Oktober 1873 als drittes Kind eines jüdischen Klavierlehrers in Wien geboren. Dort besuchte er die Volksschule und anschließend das Leopoldstädter Gymnasium bis zur Untertertia, die er (erfolglos) wiederholen musste, dann lustlos eine Handelsschule. Ein missratener Sohn. Mit 22 trat er in die Redaktion der Wiener Allgemeinen Zeitung ein und schrieb dort unter dem Pseudonym „Alfred von der Waz“, später als Alfred Polgar mit 29 für den Simplicissimus (München), mit 32 für die Berliner Schaubühne (ab 1918 Weltbühne). In seinem 36. Jahr erscheint sein erstes Buch. Den 1. Weltkrieg verbringt er als 41- bis 45-Jähriger im Kriegsarchiv in Wien. Danach sehr produktives Schaffen als Redakteur für verschiedene Zeitungen: mit 47 erste Beiträge zum Tage-Buch, mit 49 zum Tag und zum Morgen (alle Wien). Mit 52, mitten in den „Goldenen Zwanzigern“, verlegt Alfred Polgar seinen Arbeitsschwerpunkt nach Berlin, behält aber seine Wiener Mansarde als Zweitwohnsitz. Seine Feuilletons erscheinen u. a. im Berliner Tageblatt, seine Bücher im Rowohlt-Verlag Berlin. Als 56-Jähriger heiratet er Elise Loewy, geb. Müller (gen. „Lisl“). Noch in der Nacht des Reichstagsbrands verlässt der mittlerweile 59-Jährige Berlin in Richtung Prag, hält sich anschließend aber meist in Zürich auf. Dort Freundschaft mit Carl Seelig, der ihn vergeblich zu fördern sucht. Depression. Paris-Reise mit 62, später dort dauernder Aufenthalt. Mit 64 verliert er durch den „Anschluss“ Österreichs seinen Hauptwohnsitz in Wien, mit 65 die deutsche Staatsbürgerschaft, welche ihm doch erst kürzlich zwangsweise verliehen wurde. Mit 66 flieht er mit Lisl vor dem Einmarsch der Deutschen in Paris nach Marseille und anschließend zu Fuß über die Pyrenäen nach Lissabon. Kurz vor seinem 67. Geburtstag trifft Polgar in New York ein und reist von dort aus weiter nach Hollywood, wo er mit wenig Erfolg als Drehbuchautor Fuß zu fassen sucht. Im Alter von 72 Jahren wird Alfred Polgar Bürger der Vereinigten Staaten. Mit 75 besucht er erstmals wieder und anschließend mehrfach Europa, mit Stationen in Paris, Zürich, Wien, Salzburg, München, Berlin und Rom. Am 24. April 1955 stirbt Polgar im Alter von 81 Jahren nach einem Kinobesuch in einem Hotelzimmer in Zürich.
Die „Abenteuer“ dieser Biographie, so scheint es, waren ausschließlich durch äußere Katastrophen bedingt: zwei Weltkriege, Vertreibung ins Exil, Armut und Entwurzelung. Wäre dies nicht „dazwischen gekommen“, hätte Alfred Polgar seine Welt, das Café Central in der Wiener Herrengasse 14, vermutlich nie verlassen. Er hätte dort Schach und Bridge gespielt, geistreiche Frauen wie Ea von Allesch umflirtet und seine unübertrefflich feinnervigen Theaterkritiken geschrieben – und wäre heute nahezu vergessen, wie Luise Wilhelmine, meine Oma.
15 Kilo Buch
Wednesday, 30. July 2008Bei meiner Beschäftigung mit Hans Siemsen und Alfred Polgar, zwei literarischen Flaneuren und Meistern der „Kleinen Form“ aus dem ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts, bedauerte ich in den vergangenen Wochen wieder einmal, die legendäre Berliner „Wochenschrift für Politik – Kunst – Wirtschaft“ jener Zeit nicht zur Hand zu haben: Die Weltbühne.
Ich erinnere mich noch gut, dass Ende November 1978, ich erlebte mein erstes Weihnachtsgeschäft als Buchhandelsgehilfe bei Baedeker in Essen, die Männer im Wareneingang ächzend und fluchend ein paar außergewöhnlich schwere Pakete auf den Packtisch wuchteten. Die kamen aus Königstein im Taunus und enthielten den Nachdruck aller vom 14. April 1918 bis zum 7. März 1933 erschienen 778 Hefte der Weltbühne. Der Preis für die 16-bändige Ausgabe in rotem Leineneinband betrug damals 580 DM – für ein solches Riesenwerk mit über 26.000 Seiten durchaus angemessen, Maß genommen hingegen am schmalen Gehalt einer ungelernten Hilfskraft leider unerschwinglich.
Dass sich der Athenäum-Verlag überhaupt zum Wagnis eines solchen Mammut-Reprints entschloss, verdankt sich vermutlich der Pioniertat eines in mancher Hinsicht damals revolutionären Konkurrenten, der den konventionellen Verlegern und Sortimentsbuchhändlern seit 1969 Feuer unterm Hintern machte. Der Vertrieb und Verlag Zweitausendeins in Frankfurt am Main hatte nämlich im Vorjahr (1977) mit einer Sensation aufgetrumpft und Die Fackel von Karl Kraus nachgedruckt, zwölf Bände mit insgesamt 10.000 Seiten, zum Spottpreis von 148 DM und mit überraschendem Erfolg. Bis dahin war das Verlagsgeschäft mit Reprints ausschließlich Sache von ein paar spezialisierten Fachverlagen gewesen, wie z. B. Georg Olms (Hildesheim), Kraus Reprint (Nendeln / Liechtenstein) oder K. G. Saur (München), die hauptsächlich für Bibliotheken produzierten, in entsprechend niedrigen Auflagen und zu Preisen, die selbst die Möglichkeiten betuchter Privatkunden oft überstiegen.
Seither sind drei Jahrzehnte ins Land gegangen und die Buchhandelslandschaft hat sich gründlich verändert. Erstens werden heute umfangreiche Periodika-Sammlungen und Nachschlagewerke der Vergangenheit raumsparend auf CD-ROM angeboten, mit dem zusätzlichen Vorzug komfortabler Recherche-Funktionen. Als 1999 der Deutsche Taschenbuchverlag in München das Grimmsche Wörterbuch in 33 Bänden zum Preis von 1.200 DM offerierte, wurde dies noch als verlegerische Großtat gewertet. Mittlerweile gibt es längst, wieder mal bei Zweitausendeins, den Digitalen Grimm auf einer Silberscheibe für nur 49,90 €; und wer selbst die noch sparen will, wird im Internet blitzschnell auf dem Server der Universität Trier fündig.
Zweitens aber sind die Preise der Antiquariate – auch dies eine Folge des Internets – gerade für solch platzraubende Monsterwerke im freien Fall. Nur noch ein paar Papiernostalgiker wie ich sind bereit, 55 € zuzüglich Versandkosten für den Athenäum-Reprint der Weltbühne hinzublättern. Gestern traf die Apfelsinenkiste von einem Antiquariat in Kaiserslautern ein. Der Kurierbote ächzte und fluchte, ganz ähnlich wie vor dreißig Jahren die Männer im Wareneingang von Baedeker, obwohl es sich doch „nur“ um die kartonierte Ausgabe handelte. Der Antiquar hatte nämlich ein Dutzend offenbar unverkäufliche Bücher mit in den Karton gestopft. Und zur Entschuldigung schrieb er auf den Rechnungsumschlag: „Danke für die Entsorgung des ,Füllmaterials‘. Anders konnte ich nicht packen.“
Apostroph
Monday, 28. July 2008„Wie geht’s? Wie steht’s?“ Danke der Nachfrage, liebe Leserin, aber es könnte besser stehen und gehen. Ich habe mich nämlich in den letzten Tagen mit einem Problem herumschlagen müssen, das in seiner Unscheinbarkeit und Bedeutungslosigkeit kaum der Rede wert erschiene und das hier auszuwalzen mir zutiefst widerstrebt. Aber wenn die bezaubernde Leserin so anmutig und offenherzig fragt, kann ich unmöglich die Antwort schuldig bleiben. Ich will versuchen, so schnell wie möglich zur Sache zu kommen, muss aber doch leider etwas weiter ausholen, mindestens dies hier vorausschicken.
Erst jüngst habe ich mein Impressum renoviert und dort ein kleines Kapitelchen zum Thema Sorgfalt meines Weblogs eingebaut, als eine Art ethisches Tiefparterre direkt überm Basement der Grundvoraussetzungen. (In der Architektur des Impressums steht die Welt zwar auf dem Kopf und das „Basement“ thront ganz oben, dort wo sich bei den aus Stein gebauten Häusern das Dach befindet. Aber das nur nebenbei.) In diesem vollmundigen Selbstbekenntnis zu gnadenloser Sorgfaltspflicht heißt es gleich eingangs: „Der Betreiber der Website revierflaneur.de ist um Fehlerfreiheit in formaler und inhaltlicher Hinsicht bemüht. Der Text folgt den Regeln zur deutschen Rechtschreibung und Zeichensetzung in der reformierten Form von 1996 (mit den Änderungen von 2004 und 2006).“ Die versprochene Folgsamkeit ist aber, wie sich in tausenderlei kleinen Fällen und Unfällen immer wieder erweist, leicht versprochen und schwer gehalten.
Gnädigste! Wenn Du schon so harmlos und leichtin fragst, wie es um mich bestellt ist, kann ich Dir die erschöpfende Erklärung meines Verdrusses nicht ersparen. Du hast leichtfertig Deine Frage salopp verkürzt, indem Du fragtest: „Wie geht’s? Wie steht’s?“ Hättest Du Dir den Bruchteil einer Sekunde mehr Zeit gelassen und stattdessen ausführlicher gefragt: „Wie geht es? Wie steht es?“ – uns beiden wäre mancherlei erspart geblieben. Dir diese längliche Antwort, mir der Verdruss einer umständlichen Untersuchung.
Meine begnadete Lektorin, ein Geschenk des siebten Himmels, in dem zu schweben mir erst die Gnade eines unverdienten Schicksals gestatten wird, wenn der allerletzte unscheinbare, für gewöhnliche Sterbliche nahezu unerkennbare Fehler in meinen öffentlich gemachten Hirngespinsten das Zeitliche gesegnet hat, merkte nämlich schon bei früherer Gelegenheit an, vor dem Apostroph sei ein Zwischenraum zu setzen: „Wie geht ’s? Wie steht ’s?“ Dafür hatte sie gute Gründe, deren bester auf den Respekt gebietenden Namen DIN 5008 hört, das ist die Deutsche Industrienorm mit den Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung. Dort lautet die Regel: „Dem Apostroph am Wortanfang geht im Allgemeinen der regelmäßige Wortzwischenraum voran.“ Aber ’s kam anders.
Seit ich nämlich den unmissverständlichen, eindeutigen und wohlbegründeten Korrekturhinweis meiner Lektorin erhalten hatte, mühte ich mich redlich, ihn zu befolgen – so sehr mir dies aus zugegeben gänzlich irrationalen, nicht DIN-beständigen Gründen widerstrebte. Ich las nämlich so allerlei, Pynchon, Polgar etc. pp., und auf Schritt und Tritt sprangen mir all die macht’s, hat’s, kann’s, will’s, schlägt’s, schreit’s, geht’s und steht’s ins Auge – alleweil ohne den industriell geforderten Zwischenraum. Schließlich meldete ich bei meiner Lektorin Bedenken an, die wieder einmal keine Mühen scheute und die Frage der Lücke der höchsten Instanz für solche Fragen vortrug, dem „Rat für deutsche Rechtschreibung“ in Mannheim. Von dort kam prompt die ebenso freundliche wie salomonische Antwort: „Liebe Frau C., ganz allgemein ist zu sagen, dass der Apostroph im Deutschen eine Auslassung kennzeichnet. Dabei gibt es Gruppen, bei denen der Gebrauch des Apostrophs vorgeschrieben ist und solche, bei denen der Gebrauch freigestellt ist. Zu erster Gruppe gehören beispielsweise Wörter, die bei fehlender Kennzeichnung schwer verständlich wären (In wen’gen Augenblicken). Dem Schreibenden freigestellt ist der Gebrauch des Apostrophs bei Wiedergabe von Auslassungen der gesprochenen Sprache (Das war’n Bombenerfolg!) – vergleiche dazu §96 und §97 im amtlichen Regelwerk. In Ihrem Beispiel wie geht’s handelt es sich um eine Auslassung, die aus der gesprochenen Sprache resultiert. Eine fehlende Kennzeichnung wie bei wie gehts würde nicht zu Missverständnissen führen. Demnach ist ein Apostroph nicht zwingend zu setzen. Die im Duden angegebene DIN-Norm für Textverarbeitung gibt an, dass vor dem Apostroph am Wortanfang ein Leerzeichen steht, dass aber in der umgangssprachlichen Abkürzung für es dieses Leerzeichen meistens weggelassen wird. Ihr Beispiel kann also folgerndermaßen geschrieben werden: wie geht’s oder wie gehts.“ – Meine Söhne sagen in solchen Fällen verquaster Indifferenz immer: „Geht’s noch?“ Und zwar ohne Lücke.
Qual der Wahl
Sunday, 27. July 2008Vorbereitungen zur CIII. Literarischen Soiree: Alfred Polgar. – Ich werde mich, das steht schon lange fest, auf Kostproben aus den Kleinen Schriften (Band 1 bis 3) beschränken, die Ulrich Weinzierl unter dem Patronat von Marcel Reich-Ranicki 1982 bis 1984 im Rowohlt-Verlag herausgegeben hat. Aus den insgesamt 424 Feuilletons des Meisters der „Kleinen Form“ gilt es nun, ein bis zwei Dutzend auszuwählen, die für den mündlichen Vortrag geeignet sind und ein wenn schon nicht vollständiges, so doch möglichst facettenreiches Bild seiner großen Sprachkunst ergeben.
Der Zufall will es, dass sich die insgesamt 1.272 Textseiten dieser drei Bände ohne Rest durch 424 teilen lassen. Demnach ist ein durchschnittliches Polgar-Feuilleton exakt drei Seiten lang. Drei Seiten dieser Ausgabe – ich hab’s gerade mit der Stoppuhr in der Hand an dem Text Ein stolzes Mädchen ausprobiert, der genau diesen Umfang hat – lese ich „ohne Not“ in sechs Minuten, was heißen soll: mit einer komfortablen Reserve für bedeutungsschwere Atempausen. Nach meinen langjährigen Erfahrungen als Vorleser muss das Äußerste, was man an Geduld und Aufmerksamkeit einer geneigten und gebildeten Zuhörerschaft abverlangen soll und kann und darf, sich mit einem Zeitrahmen von einer Stunde und dreißig Minuten bescheiden.
Dass es folglich bei der Zusammenstellung meines literarischen Menüs auf genau fünfzehn Gänge hinauslaufen wird, ist nicht mehr als das schlichte Ergebnis einer Rechenaufgabe für die zweite Klasse. Aus dem überreichen Repertoire der Polgar’schen Delikatessen gerade die für eine solche Tafelrunde am besten geeigneten herauszufischen und sie sodann noch in einer idealen Abfolge zu servieren – dazu bedarf es mehr als einer mit Auszeichnung bestandenen Matura des routinierten Küchenchefs.
Ich würde es mir jedenfalls zu leicht machen, folgte ich dem bekannten Rezept des Theaterdirektors im Vorspiel zu Goethes Faust: „Die Masse könnt Ihr nur durch Masse zwingen, / Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus. / Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen; / Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.“ (Werke. Hamburger Ausgabe, Bd. 3. München: C. H. Beck, 1986, S. 11.) Schon eher hilfreich ist dieser Aphorismus von Polgar selbst: „Erfahrung lehrt, daß es beim Dichten wie beim Pistolenschießen immer ein wenig die Hand verreißt. Meist nach unten. Man muß höher zielen, als man treffen will.“ (Kleine Schriften. Bd. 3. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1984, S. 409.)
Ich stehe vor der paradoxen Aufgabe, als Maître de Plaisir und Küchenchef ausschließlich Amuse-Gueules reichen zu dürfen, von denen jedes einzelne jedoch schon Völlegefühle erzeugte, wenn der wahre Genießer es sich langsam und bedächtig auf der Zunge zergehen ließe – und zugleich meine Gäste beschwingt und leichten Herzens in die hoffentlich laue Sommernacht des 1. August entlassen zu wollen. Wie soll das gehen? Aber schließlich ist wahre Kunst ja immer die Bewerkstelligung von etwas Unmöglichem.
Protected: Samstag, 26. Juli 2008: St. Martin
Saturday, 26. July 2008In eigener Sache
Friday, 25. July 2008Nach dem deutschen Telemediengesetz (TMG) vom 1. März 2007 sind Anbieter von elektronischen Informations- und Kommunikationsdiensten, somit auch die Betreiber von Weblogs im Internet verpflichtet, bestimmte personenbezogene Informationen über sich auf ihrer Website zu veröffentlichen, soweit sie ihre Internetpräsenz „geschäftsmäßig“ betreiben (§ 5 TMG). Diese Zusammenstellung von Informationen, landläufig „Impressum“ genannt, müssen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar gehalten werden.
Ab wann eine Website als „geschäftsmäßig“ gilt, ist allerdings in der Rechtsprechung bisher umstritten; und somit auch die Frage, ob privat betriebene Websites impressumspflichtig sind. Im Zweifelsfall raten Juristen, sich an die Vorgaben des § 5 TMG zu halten. Nun verdiene ich mit meinem Weblog keinen einzigen Eurocent. Ich erhebe von den Lesern keine Gebühren und schalte keine Werbung auf kommerzielle Angebote. Allerdings empfehle ich in meinen Texten gelegentlich Bücher und andere Medien. Ist dies vielleicht schon eine „geschäftsmäßige Tätigkeit“, selbst wenn ich von den Herstellern und Anbietern dieser Angebote für meine Empfehlung nicht entlohnt werde? Ich will da lieber auf Nummer sicher gehen und habe deshalb ein Impressum veröffentlicht, das den Mindestanforderungen des TMG entspricht.
Bei dieser Gelegenheit habe ich dort zugleich ein paar weitere „Grundsätze“ und „Spielregeln“ veröffentlicht, die für mein Weblog, für mich und für seine Nutzer gelten: eine Definition der Inhalte und Absichten dieser Website; mein Bekenntnis zur Sorgfalt bei der Erstellung der Inhalte; die Begrenzung meiner Haftung, insbesondere auch für Inhalte, auf die ich durch Links verweise; Regeln für den Umgang mit Kommentaren; meinen Anspruch auf das Urheberrecht an den von mir hier veröffentlichten Texten; und schließlich eine Erklärung zum Datenschutz.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! Ich habe mir sagen lassen, dass es Beutelschneider gibt, gewerbsmäßige Abmahnvereine, die nur darauf lauern, einem harmlosen Blogger wie mir nicht vorhandenes Geld aus der leeren Tasche zu ziehen. Und auch vor übelwollenden Konkurrenten im unüberschaubaren Webspace müsse man auf der Hut sein, die sich durch ein ehrliches Wort auf den Schlips getreten fühlen und auf Rache sinnen.
Da ich mir aber keine unnötige Blöße geben und weiterhin ganz unbefangen auf Schlipse meiner Wahl treten möchte, wann immer mir dies im Rahmen der Meinungsfreiheit möglich und in der Sache angezeigt erscheint, habe ich einen Arbeitstag geopfert und mich notgedrungen dieser Pflicht entledigt. Meine treuen Leser bitte ich zu entschuldigen, dass ich ihnen heute keinen unterhaltsameren Lesestoff anbieten kann. Dafür wird der Lesestoff der Zukunft vielleicht aber umso interessanter.
Habent sua fata libelli (I)
Thursday, 24. July 2008
Während in den vergangenen Wochen meine Begeisterung für Alfred Polgar beim Lesen ständig wuchs, schrumpfte im gleichen Maße – die Mathematiker nennen dies wohl „umgekehrt proportional“ – mein ursprünglich fester Vorsatz: mich keineswegs in Versuchung führen zu lassen, die sechsbändige Dünndruck-Ausgabe seiner Kleinen Schriften über ZVAB zu ordern. Der Vorsatz tendierte schließlich gegen Null, und was dies für den Grad meiner Verehrung von Polgar bedeutet, mögen die Mathematiker ausrechnen. Auf dem Weg zu diesem Moment der Umkehr taten mir die ersten drei Bände der Taschenbuch-Ausgabe, Musterung, Kreislauf und Irrlicht, beste Dienste, in denen ich skrupellos annotierte und die ich ohne Rücksicht auf Soßenspritzer auch neben den Spaghettiteller legen durfte. Arbeitsexemplare eben.
Vor drei Tagen war ’s dann um mich geschehen. Ich durchsuchte das Angebot der Antiquariate nach einer möglichst gut erhaltenen Erstausgabe der Sammlung, erschienen von 1982 bis 1986 (WG 53), wobei mir deren erste Hälfte vollauf genügen sollte. Die Buchrezensionen und erst recht die Theaterkritiken, die in den Bänden vier bis sechs zusammengetragen sind, waren mir nicht so wichtig, und was Letztere betrifft, kann ich vielleicht sogar ganz auf sie verzichten. Denn zu dramatischer Literatur und Bühnenkunst habe ich nun mal ein gestörtes Verhältnis, genauer gesagt: gar keines. Der Balken in meinem Auge ist aus dem Holz der Bretter geschnitzt, die die Welt bedeuten. Shakespeare? Ich muss immer wieder nachschauen, wie sich der noch mal schreibt.
Und tatsächlich wurde ich beim Mausrädchendrehen schnell fündig. Für nur 50 € erwirbt der staunende Sammler 1.272 Textseiten Polgar, fein ausgestattet, in königsblauem Leineneinband, auf augenfreundlich-chamoisfarbenem Dünndruckpapier und nahezu verlagsfrisch. Lediglich die Schutzumschläge seien, so der Antiquar, am Rücken „leicht aufgehellt“. (Was er verschweigt: dass die sonst so edlen Bücher nicht fadengeheftet, sondern gelumbeckt sind; doch diese Barbarei war Mitte der 1980er-Jahre bei deutschen Verlegern ja leider längst Usus.) Die Polgarbände haben also beim Vorbesitzer in der Sonne gestanden? Aber da gehören sie ja schließlich auch hin! Das Vergnügen, in diesen edlen Büchern zu lesen, kostet mithin knapp vier Eurocent pro Seite: ein Spottpreis! Mit einer Tankfüllung für 50 € fahre ich per Smart von Essen nach Oldenburg und zurück. Was soll ich in Oldenburg? Da bleibe ich doch lieber smart in meinem königsblauen Ohrensessel sitzen und lese in den königsblauen Polgar-Bänden.
Dann hieß es noch in der Beschreibung des Antiquars: „Beiliegt: Verlagskorrespondenz zu der Ausgabe.“ Ein kleines Schmankerl obendrein? Da war ich aber gespannt! – Die „Verlagskorrespondenz“ erwies sich als ein maschinenschriftlicher Brief der Presse- und Informationsabteilung des Rowohlt-Verlags an Herrn Thilo Koch, 7201 Hausen ob Verena: „Sehr geehrter Herr Koch, mit Ihrem Schreiben vom 14. 10. 86 bitten Sie um die Zusendung der Polgar-Bände 4, 5 und 6. – Wir müssen an Ihr Verständnis appellieren, aber leider sind wir nicht in der Lage, Ihrem Wunsch zu entsprechen, da bei der sehr geringen Auflagenhöhe uns keine Freiexemplare für den Rezensionsversand zur Verfügung stehen. Es kommt jedoch immer wieder vor, daß einzelne Titel nicht in den Rezensionsversand gegeben werden – wir bedauern das selbst. Mit freundlichen Grüßen.“
Damit wäre also auch die Provenienz meiner drei heute eingetroffenen Polgar-Bände geklärt. Thilo Koch, der prominente deutsche Fernsehjournalist, Washington-Korrespondent und Buchautor (u. a. Porträts deutsch-jüdischer Geistesgeschichte, 1961) starb vor knapp zwei Jahren in Hausen ob Verena. Die Erben machen die Bücher des Alten zu Geld, nur zu verständlich bei den steigenden Spritpreisen. Und so flattert das Brieflein auf meinen Schreibtisch. Gibt man „Thilo Koch“ und „Polgar“ in Google ein, findet man gerade mal eine einzige relevante Belegstelle: „Tucholsky war ein großer Journalist, auf andere Weise auch Polgar.“ Das schrieb Koch in einem Essay unter dem Titel Ein Journalist und das Vaterland (in: Die Zeit, Nr. 36 v. 5. September 1957). Ob Thilo Koch deshalb so dringlich die Bände 4 bis 6 der Polgar-Ausgabe haben wollte, um seinen fragwürdigen Satz aus dem Jahr 1957 noch einmal zu prüfen? Und um uns vielleicht anschließend zu erklären, was er mit „auf andere Weise“ präzis gemeint hat? Wohl kaum. Ihn störte einfach die Unvollständigkeit dieser Werkausgabe in seinem sonnenbeschienen Bücherschrank. Und das kann ich sogar nachempfinden.
[Fortsetzung: Habent sua fata libelli (II).]
Skrivekugle
Wednesday, 23. July 2008Vor einigen Jahren erfuhr ein beruflicher Vielschreiber in der Schweiz zufällig, dass sein Tagewerk durch eine völlig neue technische Erfindung erheblich vereinfacht werden könnte. Da seine Sehkraft durch das viele Lesen sehr gelitten hatte und das Schreiben mit dem modernen Hilfsmittel nach einer Woche Übung, wollte man der Reklame glauben, der Tätigkeit der Augen gar nicht mehr bedürfe, trat er mit dem Erfinder, einem Herrn Malling-Hansen in Kopenhagen, in Korrespondenz und bestellte wenig später den Skrivekugle genannten Apparat.
Der experimentierfreudige Mann hieß Friedrich Nietzsche, man schrieb das Jahr 1882. Sein anfänglicher Optimismus wurde allerdings bald gedämpft. Die Maschine traf in beschädigtem Zustand ein, blieb auch nach der langwierigen Reparatur durch einen örtlichen Mechaniker überaus labil, von einer bequemen Handhabung konnte nicht die Rede sein. Zwar gelang es Nietzsche, seine Minutenanschlagszahl von anfänglich 15 mit der Zeit auf rund 100 zu steigern, aber das blinde Finden der Buchstaben bereitete ihm bis zuletzt einige Mühe, die das Schreibtempo verlangsamte. Nachdem die Skrivekugle, „delicat wie ein kleiner Hund“, immer wieder „viel Noth“ gemacht und schließlich einen nicht mehr behebbaren „Knacks weg“ hatte, kapitulierte er vor der Tücke des Objekts und kehrte reumütig zu Soennecken’s Kurrentschriftfeder Nr. 5 zurück.
Die Episode ist deshalb heute noch von Interesse, weil sie den Philosophen ganz nebenbei zu einer Einsicht brachte, die für technische Innovationen an Hilfsmitteln und Werkzeugen des Schreibens und Lesens ganz allgemein auch heute noch zutrifft. Als sein Freund Heinrich Köselitz von der Anschaffung der Skrivekugle erfuhr, schrieb er an Nietzsche: „Nun möchte ich gern sehen, wie mit dem Schreibapparat manipulirt wird; ich denke mir, daß es viel Übung kostet, bis die Zeilen laufen. Vielleicht gewöhnen Sie sich mit diesem Instrument gar eine neue Ausdrucksweise an – mir wenigstens könnte es so ergehen; ich leugne nicht, daß meine ,Gedanken‘ in der Musik und Sprache oft von der Qualität der Feder und des Papiers abhängen.“ – Darauf antwortet Nietzsche: „Sie haben Recht – unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Wann werde ich es ueber meine Finger bringen, einen langen Satz zu druecken!“ (Zit. nach Friedrich Nietzsche. Chronik in Bildern und Texten. Carl Hanser Verlag: München · Wien, 2000, S. 505.)
Dieser Tage erschien ein brillantes Essay von Nicholas Carr, das die Auswirkungen des Internets auf unser Lesen und Schreiben und damit schließlich auch auf unser Denken zum Thema hat. (Is Google Making Us Stupid?; in: The Atlantic Monthly, Vol. 301, No. 6, July/August 2008). Carrs kritische Einwände, gut fundiert durch aktuelle medizinisch-psychologische Studien, haben der Internet-Community reichlich Diskussionsstoff geliefert. Alex Rühle beschließt seinen Artikel in der heutigen SZ über Carrs Essay mit dem Satz: „Interessant wäre es nun noch, gemeinsam durch einige Blogs zu flanieren, die sich an Carrs These abarbeiten, wir stünden an einem evolutionsgeschichtlichen Wendepunkt, da das tiefe, entspannte Denken, das Lesen eines langen Textes, dieses richtige Lesen, bei dem man das Buch über Tage mit sich herumträgt, ins Cafe, an den Fluss, ins Bett, und mit den Figuren zu leben beginnt, dass uns all das bald schon gar nicht mehr möglich sein werde […].“ Genau dies habe ich in den nächsten Wochen oder auch Monaten im Unterschied zu Rühle vor, der sich entschuldigt: „[…] aber zum einen habe ich seit 20 Minuten keinen Youtube-Clip mehr angeschaut und Sie müssen ja sicher auch längst weiter.“ (Abgelenkt von der Ablenkung; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 170 v. 23. Juli 2008, S. 11.)
Nein, nein! Keineswegs! Ich bin nicht in Eile.
Interview mit a. p.
Tuesday, 22. July 2008Ihm sei „so zu Unmute“, dass er „in den Spiegel spucken“ möchte. So beschrieb Alfred Polgar seine Gemütsverfassung, nachdem er von Robert Musil ungefragt interviewt worden war. (Alfred Polgar: Was so ein Interviewer alles anstellt; in: Die literarische Welt, II. Jahrgang, Heft 11, 1926, S. 7; hier u. im Folgenden zit. nach Irrlicht. Kleine Schriften, Bd. 3. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2004, S. 367-369.)
Musil hatte zuvor, ebenfalls in der noch jungen Literarischen Welt des gleichfalls noch jungen Willy Haas, ein blitzgescheites Essay über den ihm so nahen und zugleich so fernen Caféhausliteraten veröffentlicht, sein Interview mit Alfred Polgar, das vieles in einem ist: Konfrontation, Schmeichelei, Infragestellung und Verbeugung vor einem mindestens gleichrangigen, aber doch so anders gearteten literarischen Phänomen – und zudem eine der klügsten Äußerungen dieser Zeit über die (wieder mal) noch so junge journalistische Gattung Interview.
Die beiden Texte sind, wenn man sie zusammen sieht, ein Glücksfall sowohl für die Musil- wie für die Polgarrezeption. Hier schlagen zwei grundkonträre Eggheads der Goldenen Zwanziger aneinander und der Ton, der dabei herauskommt, klingt lange nach, wenngleich – oder vielmehr gerade weil – er sich im Pianissimo entfaltet: allergediegenstes Edelmetall eben. Nicht umsonst hat Ulrich Weinzierl dieser Begegnung in seiner Polgar-Biographie ganze zwei Seiten eingeräumt.
Robert Musil beschreibt seine erste Begegnung mit Polgar, „auf einer Straße mit Bäumen, mitten in Wien“, durch eine Dame auf offener Straße vermittelt: „Ich konnte im Dunkel nicht mehr von ihm ausnehmen als eine schlanke Gestalt, die als jung auf mich wirkte, obgleich ich wußte, daß ich selbst um etliche Jahre jünger war […] und ich weiß auch durchaus nicht, wie er fortging, denn miteinemmal fehlte er ebenso rasch, wie er gekommen war.“ So Musil. Und der Satz, der sich daran anschließt, hat geradezu Ewigkeitswert: „So ist es bis heute geblieben.“
Alfred Polgar fühlte sich nach eigenem Bekenntnis, wenn man seiner kurzen Replik auf dieses „Interview“, das niemals geführt wurde, glauben darf, anschließend „wie auseinandergenommen und nicht mehr zusammenzusetzen, aufgetan, abgetan.“ Und zuvor schreibt er: „Der seelische Zustand, in den ein solches Interview versetzt, ist analog dem körperlichen, der sich einstellt, wenn man künstlich zum Erbrechen gereizt wird.“ Für den Gereizten mag dies ja überaus unangenehm sein. Uns Zuschauern des Vorgangs beschert er aber, wie auch schon das vorhergehende Kitzeln mit bunter Feder in der Kehle des Opfers, ein überaus reizvolles, nuancenreiches Farbenspiel.
Ivn istn, eivn istn!
Monday, 21. July 2008Jetzt muss ich mich um 180 Grad drehen, oder vom Äußersten ins Innerste wenden, indem ich vom Größten aufs Kleinste umsattle. Gerade mal zehn Tage bleiben mir noch zur Vorbereitung meiner CIII. Literarischen Soiree. Für solche Rezitationsabende eignen sich nach langjähriger Erfahrung Romane nur mäßig, schon gar nicht solche Wälzer wie Pynchons Gegen den Tag. Mit zweien habe ich ’s mal versucht, Nabokovs König Dame Bube und Die Besessenen von Gombrowicz in Fortsetzungen gelesen und dann beschlossen: Nie wieder! Es gelingt ja nicht, zwei bis drei Dutzend Zuhörer über einen Zeitraum von einem halben Jahr jeweils zum Monatsersten vollständig zu versammeln. Ein paar fehlen immer, die Konkurrenz des Fernsehprogramms ist übermächtig. Dann hat man als Veranstalter die leidige Pflicht, das Verpasste in Kurzfassung nachzutragen. Kurzum: Romane sollen die Leute gefälligst selbst lesen.
Geradezu ideal geeignet zum Vortrag auf einer solchen Literarischen Soiree ist die „Kleine Form“, wie sie Anfang des vorigen Jahrhunderts für den freien Raum unterm Strich in den Zeitungsfeuilletons ersonnen und von Männern wie Kurt Tucholsky, Franz Hessel, Victor Auburtin, Anton Kuh und – ja: auch Hans Siemsen kultiviert wurde. Der unbestritten größte Meister dieser „Kleinen Form“ heißt Alfred Polgar. Ihm werde ich am 1. August vor einem hoffentlich aufmerksamen und empfänglichen Publikum huldigen.
Der Wälzerschreiber aus dem näheren, oder, je nach Sichtweise, ferneren Umkreis der Genannten, Robert Musil, der mich mit seinem viel gerühmten und wenig gelesenen Roman Der Mann ohne Eigenschaften schon wiederholt zu optimistischen Lektüreanläufen provoziert hat, von denen der weiteste Sprung bis zur Seite 429, bis zum 92. Kapitel gelang; jener Zeit raubende Musil also, der ein ganz gegensätzliches Ziel verfolgte, bemäkelte an der Kurzprosa allgemein, dass es ihr leicht falle, „bedeutend zu tun, so ungefähr auf einem schmalen Raum, der nicht zu viel Prüfung gestattet.“ (Robert Musil: Nachlaß, Mappe IV, 3 Sig, 15087 Series Nova, S. 20 f.; hier zit. nach Ulrich Weinzierl: Alfred Polgar. Eine Biographie. Wien · München: Löcker Verlag, 1985, S. 137.) Und speziell zum konkurrierenden „Meister der Kleinen Form“ stellt er in seinem Tagebuch folgende Frage: „Aber solche Skizzenbücher ermüden; siehe Polgar. Warum ermüden sie mehr als Romane?“ (Robert Musil: Tagebücher. Hrsg v. Adolf Frisé. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, S. 896.)
Ich kann mir nicht helfen, aber beim Lesen solcher ermüdeten und müden Mäkeleien drängt sich mir ein Verdacht auf: Da neidet der verkannte Fleißarbeiter Musil seinem Mitbewerber um den Königsthron der Prosaschriftstellerei, mit einem Geringen von Schreib- und Lesezeit einen mindestens gleich großen Effekt zu erzielen. Polgar als Schöpfer einer zukunftsweisenden literarischen Gattung benötigt hierzu nur einen Bruchteil von dem Papier, das der späte Romancier Musil für sein magnum opus durch die Druckmaschinen laufen lässt. Und dann kommt Musil nicht einmal zu Rande mit seinem maßlosen Großvorhaben. Der Mann ohne Eigenschaften blieb bekanntlich Fragment. Alfred Polgars tausend Werklein hingegen sind allesamt eines im doppelten Sinn: vollendet.
Um aber immerhin auch Musil nicht Unrecht zu tun, will ich zum Abschluss doch darauf hinweisen, dass von ihm eines der schönsten zeitgenössischen Essays über Polgar stammt, vorzüglich geeignet, wenngleich leicht gekürzt, zur Einleitung in meine geplante Soiree. Es heißt Interview mit Alfred Polgar und ist zuerst erschienen am 5. März 1926 in Die literarische Welt. Dieses Essay ist als Einstimmung auf den Meister selbst deshalb besonders tauglich, weil es den Bogen spannt von meiner letzten, der CII. Literarischen Soiree, indem es so beginnt: „Eines Tages sagte ich mir, das Interview ist die Kunstform unserer Zeit; denn das großkapitalistisch Schöne am Interview ist, daß der Interviewte die ganze geistige Arbeit hat und nichts dafür bekommt, während der Interviewer eigentlich nichts tut, aber dafür honoriert wird. – Außerdem ist es entzückend, daß man bei einem Interview einen Menschen in einer Weise ausfragen kann, die man sich selbst verbitten würde. […] Man muß ihn in Schrecken versetzen, einschüchtern; dann fragt man ihn im Namen der Kulturverpflichtung mit Erfolg um Dinge, die er niemals freiwillig preisgeben würde. – Das Schlimmste, was vorkommen mag, ist, daß er die Antwort verweigert.“ (Zit. nach Robert Musil: Gesammelte Werke II. Prosa und Stücke · Kleine Prosa, Aphorismen · Autobiographisches · Essays und Reden · Kritik. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1978, S. 1154 f.)
Kölnreise
Wednesday, 16. July 2008
Sehr selten und immer seltener, kaum aus besonderem Anlass oder triftigem Grund, sondern aus einer aufflackernden Laune juveniler Abenteuerlust heraus, weil mir der Schalk im Nacken sitzt und ich mich zu seinem Gaul machen will, wo ich üblicherweise doch immer im bequemen Herrensattel meine Prinzipien reite, also in einer recht eigentlich masochistisch grundierten Stimmungslage bequeme ich mich zu dem Entschluss, eine Reise anzutreten.
Ist der Tag der Abreise dann plötzlich da wie heute, schimpfe ich mich einen Toren und alten Trottel, der sich diesen Tag verderben musste in einem lange schon zurückliegenden, im Rückblick unerklärlichen Moment der Schwäche. ,Worauf habe ich mich da bloß wieder eingelassen!‘ Der schwarzgallige Verdruss wird allein dadurch erträglich, dass dieser Tag ja zugleich der Tag der Rückkehr ist. Und der tatsächliche Aufbruch ist mir überhaupt nur möglich durch die Aussicht auf die erfreulich nahe Rückkehr. Ohne diese frohe Erwartung müsste ich im letzten Moment noch unweigerlich stornieren.
Wie es in Köln so war? Zauberhaft – auch dank meiner staunenden Begleitung.
Die Reise galt meinem alten Freund Kamillus: dem großen Bibliophilen. Sie galt seiner kleinen, aber in jeder Kleinigkeit so bedachtsam und geschmackvoll eingerichteten Wohnung in Kalk. Sie galt dem Schrägstand seiner Augenbrauen bei konzentriert gesuchten Formulierungen, die dann in solch bewundernswerter Präzision über seine Lippen kommen, der Rechtschaffenheit seines gründlich erwogenen Urteils – das ich freilich nicht immer teile – und dem im Alter noch immer so präsenten, so vielseitigen Wissen. Sie galt seiner Lebendigkeit, die gerade vor dem Hintergrund einer tiefen, allgemeinen Resignation erst ihre Strahlkaft gewinnt. Sie galt zuletzt auch, fast schäme ich mich, es zu bekennen, seiner erlesenen Bibliothek, von der umgeben zu sein mir stets aufs Neue ein fast körperlich spürbares Gefühl intensiver Lust bereitet.
Der geplante Höhepunkt der Reise war jener Augenblick, als ich Hans Siemsens Tigerschiff in eigenen Händen hielt, seine „Jungensgeschichten“ mit den zehn handsignierten Originalradierungen von Renée Sintenis, einer ihrer bekanntermaßen schönsten Arbeiten für den Buchdruck, erschienen 1923 im Querschnitt-Verlag in Frankfurt, im Impressum zusätzlich von Siemsen und Sintenis signiert, eins von nur 250 nummerierten Exemplaren, als 26. Flechtheim-Druck erschienen. Zauberhaft – aber vorbei. Ich bin wieder daheim.
Sturm
Tuesday, 15. July 2008In der Mitte oder am äußersten Rand (oder gar noch jenseits von ihm); ganz oben an der Spitze der High Society oder tief unten im Abgrund, bei den Bettlern in der Gosse; drinnen in der warmen Stube oder draußen vor der Tür, in bitterer Kälte – diese Ortsangaben bezeichnen ganz konkret die soziale Stellung des einzelnen Menschen, seit Menschengedenken.
Die Gegebenheit solcher individuellen Unterschiede als Ungerechtigkeit zu empfinden, sie zu hinterfragen und notfalls mit Gewalt zu bekämpfen ist eine verhältnismäßig neue Entwicklung in der Geschichte der Menschheit. Zwar hat es Sklavenaufstände wohl immer schon gegeben, dass sich aber ihre Anführer nicht nur auf ihren Hunger, sondern auf den Weltgeist beriefen, ist gerade mal 219 Jahre her.
Reichtum und Armut, Macht und Ohnmacht galten bis zum 14. Juli 1789 wahlweise als natürlich oder gar gottgewollt. Dass die Nachkommen von Adam und Eva mit dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies für alle Zeiten verdammt seien, auf dem Bauch zu kriechen und Staub zu fressen, das hatten die Propagandisten der Nutznießer des christlichen Glaubens seit Jahrhunderten von der Kanzel gepredigt. Dass sie so lange Gehör und Glauben fanden, verdankten sie der existenziellen Angst ihrer Zuhörer vor dem Tod und der Reklame für ein besseres, zudem noch ewiges Jenseits.
Der Riss, der seit dem denkwürdigen Tag vor 219 Jahren durch das schöne Bild von der Gottgegebenheit der ungleichen Zustände hienieden geht, ist nie wieder geheilt. Dabei verdankt er seine symbolische Kraft einer ganz ähnlichen Mythologie, wie sie zuvor die Religionen für sich zu nutzen wussten. Auch der angebliche Ausspruch der Königin Marie Antoinette – „S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche.“ – der in seiner infamen Dummheit und feudalen Arroganz wirkte wie Öl, ins Feuer der hungernden Massen gegossen, diese ätzende Sentenz war nachweislich ein Mythos, ein klug ersonnener und auf Wirkung spekulierender Propagandatrick aus der Feder von Jean-Jacques Rousseau.
Der Sturm auf die Bastille, die Befreiung der Gefangenen aus einer grausamen Festung, in der sich die soziale Hierarchie der Gesellschaft noch einmal auf makabre Weise widerspiegelte, in der je nach Vermögenslage der Angehörigen „draußen“ die Unterbringung der Gefangenen von den privilegierten Zimmern unter den Zinnen bis in die höllischen Zellen im Keller eingerichtet wurde – dieser Sturm eines mit geladenen Waffen und heiligem Zorn versehenen Volkes war in seiner Symbolik ein historischer „point of no return“. Seither ist der messianische Gedanke ins Diesseits zurückgekehrt. So lange es noch Gefängnisse gibt, ist die Menschheit nicht frei.
Für den Tag?
Monday, 14. July 2008
Einerseits sind Weblogs eine feine Sache. Sie ermöglichen elenden Skribenten wie mir, die bislang bloß für die muffige Schublade produzierten und mangels Massenkompatibilität ihres Geschreibsels auf dem traditionellen literarischen Markt kaum eine noch so kleine Leserschaft erreichen konnten, auf bequeme Weise mindestens potenziell, von weit über einer Milliarde Menschen weltweit gelesen zu werden.
Ratgeber, wie man als Blogger Klickzahlen generiert, gibt es zuhauf. Wer sich auf das ungewisse Abenteuer namens Weblog einlässt, auf die alltägliche, weltöffentliche Schreiberei zum Tag und für niemand, ob in Kreuzberg-Mitte oder Essen-Huttrop, der sollte nicht auf Klickzahlen schielen, sondern mit festem Blick die Qualität seiner Elaborate im Auge haben.