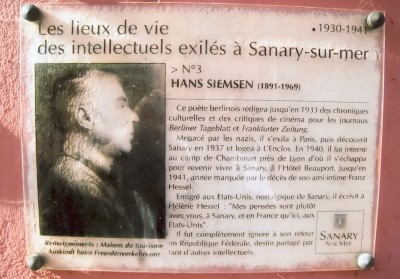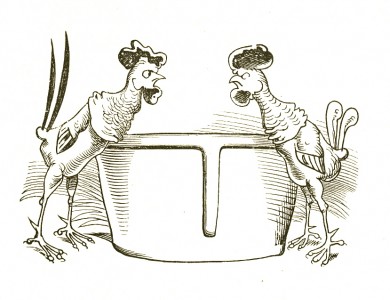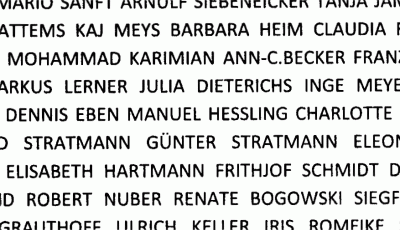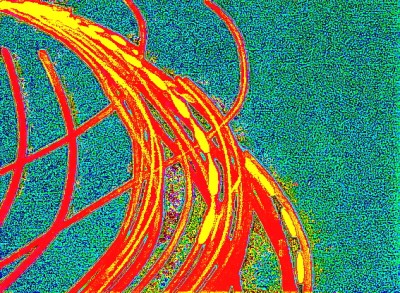Heute endet mein Engagement beim Kulturblog der WAZ-Mediengruppe: Westropolis. Vor gut 17 Monaten, am 28. März 2007, habe ich dort meinen ersten Beitrag veröffentlicht, schon eine Woche später rückte ich in die kleine Gruppe der ständigen Gastautoren ein, seit September 2007 wurde meine Tätigkeit dort monatlich pauschal honoriert. Drei Beiträge pro Woche sollte ich laut Vertrag publizieren. Dies ist mein 349. und letzter Artikel für Westropolis. Neun Monate habe ich abgerechnet. Die Arbeitszeit pro Beitrag belief sich durchschnittlich auf vier Stunden. Überschlägig kam ich damit auf einen Stundenlohn von 2,50 Euro. Um des schnöden Mammons willen habe ich’s also gewiss nicht getan. Warum aber dann?
Bei meinem „Einstellungsgespräch“ am 27. März 2007 waren zwischen mir und der verantwortlichen Westropolis-Mitarbeiterin im Wesentlichen zwei Fragen zu klären. Erstens: Ob ich Vorbehalte hätte, als Blogger für einen Medienkonzern zu arbeiten? Bekanntlich gilt ja in weiten Kreisen der Blogosphäre ein solches Engagement als Verrat am libertären Geist dieses neuen Mediums. Solche Bedenken hatte ich zwar, aber ich stellte eine Gegenfrage: Würde ich bei der Wahl meiner Themen und ihrer Ausgestaltung, natürlich im Rahmen der gesetzlichen Grenzen („Keine Pornographie! Keine verfassungsfeindliche Propaganda!“), freie Hand haben? Nachdem dies bejaht wurde, ließ ich mich auf das Abenteuer Westropolis ein.
Ich habe diese Entscheidung nie bereut und bereue sie auch heute nicht. Mein anderthalbjähriger Gastauftritt bei Westropolis ermöglichte mir, Erfahrungen zu sammeln, von denen ich noch lange zehren werde. Das Kulturblog der WAZ gestattete mir großzügig, mancherlei auszuprobieren, mit Reizthemen zu experimentieren, meine teils provokanten Widersätzlichkeiten gegen den Zeitgeist öffentlich zu machen und die Grenzen der Toleranz auszuloten. Was mir dabei widerfuhr – von Kollegen, von Kommentatoren, von meinem „Arbeitgeber“ – das gäbe genug Stoff für ein lehrreiches Buch über diesen durchaus ja noch brandneuen Schauplatz des öffentlichen Diskurses.
Ein solches Buch werde ich jedoch gewiss nicht schreiben, es wäre ja schließlich ein formaler Anachronismus. Ich habe mich stattdessen darauf verlegt, am 24. März 2008 mein eigenes Weblog zu starten, in dem ich täglich genau einen Beitrag publiziere. Mein Blog wird bis heute von nahezu niemandem gelesen, aber es ist „worldwide“ präsent, nicht nur heute, sondern für alle Zukunft; oder jedenfalls so lange, wie die Webserver in aller Welt noch unter Strom stehen. „Das Web vergisst nie!“ In den Ohren der Paranoiker von Orwells Gnaden klingt dieser Satz wie eine schreckliche Drohung – in meinen aber, der ich nichts vor mir selbst und insofern erst recht nichts vor der Welt zu verbergen habe, ist er gleichsam die Garantie-Erklärung für den Triumph der Aufklärung im Posthistoire.
Das durchaus versöhnliche Fazit meiner Arbeit bei Westropolis lautet in zehn knappen Punkten: 1. Das war wohl nur ein Pilotprojekt für DerWesten, leider aber 2. ohne Pilot, mit einer 3. von Anfang an recht dilettantischen thematischen Struktur, die 4. anzupassen offenbar die Mittel fehlten, wie auch 5. ein engagiertes Management, das die Emphase und Energie aufgebracht hätte, die durchaus vorhandenen Potenziale über die Minimalvorgaben der Geschäftsführung hinauszuführen, geschweige denn 6. über deren vermutliche Bedenken, also 7. ein vorhersehbares (und auch vorhergesehenes) Scheitern, bei dem es 8. schließlich nun nur noch darauf ankommt, die Peinlichkeit in Grenzen zu halten, was 9. gewiss auch gelingen wird und das mir 10. für die Dauer meiner Teilnahme allerlei Illusionen beschert hat, die ich nicht missen möchte und deren schmerzvolle Zerstörung mich auf meinem Weg ein gutes Stück vorangebracht hat. So sage ich: Danke!