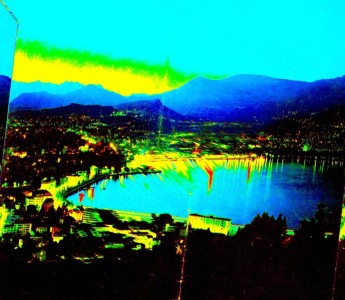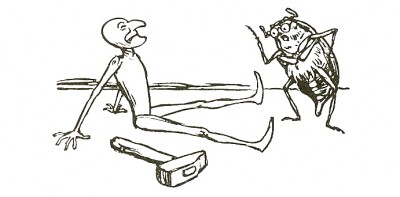Archive for September, 2009
Protected: Hörfunk (II)
Wednesday, 30. September 2009Protected: Hörfunk (I)
Tuesday, 29. September 2009Protected: Wechselwahl
Monday, 28. September 2009Orgelkonzert
Monday, 28. September 2009Nun kenne ich die Evangelische Kirche Rellinghausen auch von innen. Heute gab der international bekannt Organist und Orgelkomponist Gerd Zacher, der seit vielen Jahren in Essen lebt, ein Konzert aus Anlass seines 80. Geburtstags am 6. Juli. Er spielte zum Beginn und zum Abschluss zwei Ricercari aus dem Musicalischen Opfer von Johann Sebastian Bach, sodann drei eigene Kompositionen: Szmaty (1968), Trapez (1993) und Vocalise (1971).
Der Kircheninnenraum ist völlig unbedeutend, seine Schlichtheit bloß gewöhnlich, frei von jedem „negativen Pathos“. Vielleicht fünfzig Personen meist älteren Jahrgangs hatten sich eingefunden. Sie applaudierten der stellenweise geradezu schmerzhaft schrillen und unberechenbaren Musik, vermutlich aber wohl eher ihrem Interpreten, der hier viele seiner Werke uraufgeführt hat, mit Anstand und Ausdauer.
Die viermanualige Orgel der Firma Karl Schuke (Berlin), die hier im Jahr 1968 in Betrieb genommen worden ist, bietet nach den Worten von Sabine Rosenboom, der Kantorin der Evangelischen Kirche Rellinghausen, „reiche Möglichkeiten der klanglichen Kombination der Register (Klangfarben), da die vier verschiedenen Werke – das Hauptwerk, Rückpositiv, Brustwerk und Schwellwerk – eine für diese Größenordnung erstaunliche Vielgestaltigkeit im Miteinander und Gegeneinander des Musizierens“ erlauben.
Ebenfalls aus Anlass des Geburtstags von Gerd Zacher erschien ein Werkverzeichnis des Komponisten, Interpreten und Musikschriftstellers, das von Verena Funtenberger, der Leiterin der Musikbibliothek in der Essener Stadtbibliothek, zusammengestellt und am heutigen Abend kostenlos verteilt wurde. Das Heft hat 136 Seiten und enthält auch eine lesenswerte „Biographie mit Koordinaten“ Zachers von seinem langjährigen Weggefährten, dem chilenischen Komponisten Juan Allende-Blin, sowie ein Gespräch, das Matthias Geuting mit Zacher geführt hat, unter der programmatischen Überschrift: „Je zweckfreier die Musik bleibt, um so hilfreicher wird sie“.
Meine Gefährtin freilich, die ein so viel feineres und geschulteres Ohr hat als ich, konnte dieses Klangerlebnis nicht als reines Vergnügen empfinden. Selbst die Stücke von Bach, den sie doch sonst über alles stellt, waren in Zachers Interpretation gar nicht nach ihrem Geschmack. Ich möchte es mit meinem Interesse an Gerd Zacher damit aber dennoch vorläufig nicht bewenden lassen, gibt es doch allerlei, was meine Neugier wach hält; und sei es die bisher nur im Manuskript vorliegende, kleine Schrift Über den Zufall in der Musik „chance operation and discipline“ (John Cage), die auf S. 102 des Werkverzeichnisses genannt wird.
[Titelbild: Gerd Zacher während der Interpretation Nr. 10 No(-)Music © Anita Jakubowski 1987.]
An Land
Monday, 28. September 2009Jetzt, da ich tatsächlich schneller als gedacht eine angemessene Unterbringungsmöglichkeit für den größten Teil meiner Bibliothek aufgetan habe, bin ich auf eine Weise wunschlos glücklich, die mich schon wieder misstrauisch macht.
Ich dosiere die Aufenthaltszeiten in meinem neuen Refugium streng, als wollte ich dem Risiko vorbeugen, einer Überdosis zum Opfer zu fallen. Immerhin habe ich nun alles ausgepackt, was noch in den „Bücherkatakomben“ der vorigen Wohnung lagerte. Im nächsten Schritt gilt es, die ca. 65 Kisten aus der K.-Anstalt bei Freund R. heranzuschaffen, doch das hat keine Eile. (Obzwar: Ich brenne drauf!)
Noch reichen ja auch glücklicherweise die Geldmittel, billige Regale anzuschaffen usw. So wird es mir gelingen, zum ersten Mal seit unvordenklichen Zeiten tatsächlich all mein Papier geordnet aufzustellen und greifbar zu haben, ohne quälende Sucherei, die dann doch in der Hälfte der Fälle in ein schmerzvolles Nichtfinden mündet.
Fast ist der Gegensatz zu heftig: zwischen einerseits dem noch vor wenigen Wochen durchlittenen Hundeelend, als ich gewärtigen musste, auf Jahre und Jahre vom größten Teil meiner Schätze und Schätzchen getrennt zu sein, sie zudem eher schlecht als recht untergebracht zu wissen, allen Gefahren ausgesetzt, die mit der Zeit aus Büchern Altpapier werden lassen; und andererseits dem Glück, wie oben angedeutet und ansonsten kaum beschreiblich.
Nun klammere ich mich geradezu an die paar vom Umzug noch verbliebenen Pflichtaufgaben, lästige Trivialitäten wie die endgültige Entrümpelung der „Katakomben“, die bis zum Ende des Monats über die Bühne gegangen sein muss. Das ist das trockene Brot, das jemand hinabwürgt, damit ihm der köstliche Wein nicht zu sehr zu Kopfe steigt.
Protected: Neun Grenzen
Monday, 28. September 2009Rundgang (XI)
Monday, 28. September 2009Ich komme erst allmählich dahinter, dass unsere neue Bleibe wirklich ganz ausgezeichnete Anbindungen an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat.
Da sind zunächst die Bushaltestellen der Linien 142, 144 und 194, beinahe „direkt vor der Tür“, aber eben doch nicht so nah, dass sie störten (s. Titelbild). Der 142er bringt mich in drei Minuten zum Stadtwaldplatz (von wo ich in acht Minuten den S-Bahnhof Stadtwald zu Fuß erreichen kann), in acht nach Rüttenscheid. Mit dem 194er bin ich in elf Minuten in Bredeney, in entgegengesetzter Richtung bringt er mich in 13 Minuten nach Steele, in 24 Minuten nach Kray und in einer guten halben Stunde nach Gelsenkirchen. Der 144er ist zwar eigentlich ein „Schulbus“ der nur am frühen Morgen und zur Mittagszeit verkehrt. Aber wenn ich meine Schwiegereltern in Überruhr besuchen will, ist auch diese Verbindung sehr nützlich für mich. Die Straßenbahnhaltestelle der Linie 105 am ehemaligen Rathaus Rellinghausen erreiche ich zu Fuß ohne Eile in fünf Minuten. Mit ihr gelange ich in acht Minuten zum Bahnhof Essen-Süd (mit der S-Bahn-Verbindung Richtung Essen-Hauptbahnhof bzw. nach Düsseldorf und Köln), in 15 Minuten zum Essener Hauptbahnhof und in 24 Minuten zum Berliner Platz.
Die Linie 105 verkehrt an Werktagen im Zehn-Minuten Takt, der 142er und der 194er zwanzigminütig; frühmorgens, spätabends, samstags und an Sonn- und Feiertagen natürlich in größeren Abständen. Allerdings ist meine Heimatstadt Essen, wie übrigens die meisten Städte im Ruhrgebiet, nicht unbedingt ein Mekka für Nachteulen. Die letzte U- oder S-Bahn ab Essen-Hauptbahnhof fährt schon um um 23:23 Uhr! Das hat soeben Matthias Stolt in der immer wieder interessanten Deutschlandkarte gezeigt (in: ZEITmagazin Nr. 38 v. 10. September 2009, S. 10). Aber aus dem Alter bin ich schließlich raus, wo man Spaß daran hat, unter der Woche die Nacht zum Tage zu machen.
Wäre für mich wegen meiner Schwerbehinderung die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel nicht ohnehin bis auf einen Jahresbetrag von 60 Euro für die Wertmarke kostenfrei, dann käme ich in den Genuss der Beförderung mit Bus und Bahn am billigsten mit einem Ticket1000 9 Uhr der Preisstufe A1, für das ich gerade mal 36 Euro monatlich berappen müsste.
Es stimmt schon: Manchmal kommt ein Bus mit Verspätung, hin und wieder werden Fahrgäste in der Bahn durch laute Handytelefonate lästig oder verströmen einen säuerlichen Körpergeruch. Solche kleinen Schönheitsfehler des ÖPNV werden von den Autofahrern, also der erdrückenden Mehrheit der Menschen hierzulande, immer wieder als Begründung bemüht, warum sie sich ein Leben ohne ihre Privatkarossen nicht vorstellen können. Aber ich argwöhne, dass dies nur Ausreden sind und der wahre Grund tiefer liegt.
Reweljuschn
Saturday, 26. September 2009Merkwürdige Werbung im Schaufenster einer „alternativen“ Fahrschule. Ein Poster mit dem Bildnis eines Kindes, offensichtlich an das berühmte Che-Guevara-Porträt angelehnten. Darüber der Slogan: It’s time for another revolution – Zeit für Deine Bedürfnisse! Unter diesem Werbeplakat eine modellhafte Liliputwelt. Ein Plastik-VW-Bus, ein Streifen Sand mit ein paar Muscheln und Seesternen und dergleichen Abenteuerurlaubskitsch mehr.
Wenn ich versuche, die unterschwellige Botschaft dieses Arrangements ans Licht zu zerren bzw. deutlich werden zu lassen, dann kommt dabei ungefähr Folgendes heraus:
„Wenn du zu jenen Idealisten gehörst, die sich in der Vergangenheit überwiegend um die Mühseligen und Beladenen unserer Erde gekümmert haben und die zwangskolonisierten Völker der Dritten Welt befreien wollten, dann ist es jetzt aber höchste Zeit, dass du dich endlich auch einmal um dich selbst kümmerst. (Und hast du es noch nicht vernommen: ,Dritte Welt‘ sagt man längst nicht mehr. Heute ist ,Eine Welt‘ angesagt!)
Klar, die Revolution war ein tolles Event, Idealismus pur, aber jetzt können mal andere den Kampf weiterführen. Du hingegen hast dir redlich verdient, auf große Tour zu gehen und das Leben ab sofort mal ganz hedonistisch zu genießen. Damit du diesen Geschmack von Freiheit und Abenteuer auf die andere Art unbeschwert und sorgenfrei erfahren kannst, solltest du aber zuallererst einen Führerschein machen. Das befreit richtig!
Wenn du dann endlich die Fleppe hast, dann drück doch mal kräftig aufs Gaspedal. Wer weiß denn, wie lange das Benzin noch halbwegs erschwinglich ist?“
Whodunit?
Saturday, 26. September 2009H. erzählt mir von dem Krimiautor Janwillem van de Wetering (1931-2008), der auf der Suche nach der Wahrheit zunächst bei dem betagten Bertrand Russell (1872-1970) in London Philosophie studiert habe. Als er dort keine ihn befriedigenden Antworten auf seine vielen Fragen fand, empfahl ihm Russell angeblich, nach Japan in ein Zenkloster zu gehen.
Mal abgesehen davon, dass ich für eine Begegnung van de Weterings mit Russell keinen Beleg finde und er nach meinen Informationen vielmehr 1958 kurzzeitig als „freier Student“ Philosophievorlesungen bei Alfred Jules Ayer (1910-1989) am UCL in London hörte, bevor er sich auf den Weg nach Kyoto begab, forderte diese Einleitung zu einem offenbar von Sympathie für van de Wetering getragenen Porträt des Niederländers meinen Widerspruch heraus.
Die alte Geschichte von dem unerschütterlich Fragenden, der sich mit einfachen Antworten nicht zufriedengeben will und immer weiter und immer tiefer fragt und bohrt und beharrt – sie hat ihre ursprüngliche Faszinationskraft für mich längst vollkommen verloren. Es kommt nicht drauf an, dass man die richtigen Antworten gibt, sondern dass man die richtigen Fragen stellt? Nein! Auch das ist eine Täuschung, denn es gibt keine „richtigen“ Fragen, wie es auch keine „falschen“ und erst recht keine „dummen“ Fragen gibt.
Die Vorstellung von einem bohrenden Wahrheitssucher, der in die weite Welt hinauszieht, um dort Antworten auf seine „letzten Fragen“ zu finden, hätte mich vielleicht vor vierzig Jahren noch angeheimelt. Aus dem Alter bin ich aber längst raus. Ich erinnere mich, dass die Kunden in der Buchhandlung, die nach den Krimis mit den Amsterdam-Cops fragten, eine erkennbar andere Sorte abgaben als jene, die sich für Sjöwall-Wahlöös Kommisar Martin Beck erwärmten. Die Erfahrung, dass man die Menschen nach ihrer Krimi-Lektüre, oder ganz generell nach ihren literarischen Interessen in Gruppen sortieren kann, wo sie dann untereinander auch viele weitere Ähnlichkeiten aufweisen, hat mich entscheidend geprägt. Und ich bin für alle Zukunft zu ernüchtert, um noch annehmen zu können, dass man in einem Krimi „bedeutsamere“ Fragen finden kann als die, wer zum Teufel der Täter ist.
Ansonsten gilt bis auf Weiteres: Es gibt für uns und von uns Menschen keine „endgültigen“ Antworten und keine „letzten“ Fragen.
Stammhaus
Friday, 25. September 2009Gerade erst vor vier Jahren bei Klartext in Essen erschienen und schon wieder im Ramsch: der wunderbare große Bildband über die legendäre Krupp-Jubiläumsfeier zum hundertjährigen Bestehen der Firma im Jahre 1912. Die Bücherverschrottung findet in immer kürzeren Intervallen statt. Ich erinnere mich noch gut, dass zum Beispiel die Tagebücher von Hugo Ball, Die Flucht aus der Zeit, in der 1946er-Ausgabe des Stocker-Varlags in Luzern bis weit in die 80er-Jahre hinein ganz regulär lieferbar waren, zum Preise von dreizehneinhalb Schweizer Franken. War damals der Lagerplatz so viel billiger – oder die Geduld der Verleger einfach größer?
Verwunderlich auch, dass Autor und Verlag nicht bis zum Jubiläumsjahr 2012 gewartet haben. Da hätte die ThyssenKrupp AG doch gewiss eine stattliche Menge als Präsent für Freunde im In- und Ausland abgenommen. Nun kann man zwar in drei Jahren einen preiswerten Nachdruck herstellen, falls gewünscht mit besonderem, „individualisiertem“ Einband oder speziellen Vorsatzblättern des Unternehmens. Aber ein solches Präsent kommt doch mindestens bei jenen Beschenkten nicht gut an, die sich das Buch bereits 2005 zum Preis von ursprünglich 29,95 Euro zugelegt haben – und das sind schließlich jene, die wenigstens oberflächlich an der Geschichte Krupps interessiert sind. Bei den anderen Jubiläumsgratulanten bedankt man sich ohnehin besser mit einem Fläschchen Krimsekt.
Das Jubiläumsbuch zum Jubiläum kostet nun bei den örtlichen Großbuchhändlern, bei der Mayerschen und Thalia, nurmehr ein Drittel seines Originalpreises und wird so hoffentlich noch viele dankbare Käufer, Leser und vor allem Betrachter finden. Die verdient es nämlich, denn es bietet eine Fülle nie zuvor veröffentlichter Bilder mit großer Aussagekraft und hohem Erkenntniswert. „Herr Prof. Dr. h. c. mult. Berthold Beitz (*1913) und die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung“ haben als Inhaber des Historischen Archivs Krupp in Essen die Abdruckgenehmigung für diese Bilder erteilt. Ausdrücklich heißt es aber einschränkend: „Die Bildrechte verbleiben weiterhin beim Historischen Archiv Krupp.“
Tja, was heißt das nun für mich, den kirchenmausarmen Non-Profit-Blogger? Darf ich meinen doch ganz unschuldig für dieses schöne (und zudem jetzt selbst für mich noch erschwingliche) Buch werbenden Artikel nicht mit einem Bild aus dem besagten Buch schmücken? Zum Beispiel mit jenem Foto des „Stammhauses“ von 1935, inmitten der Werksanlagen zwischen der Rückseite des neuen Hauptverwaltungsgebäudes und dem Martinwerk 3? Na gut, dann scanne ich dieses berühmte Bild nicht von Seite 57 des neuen Buches, sondern von der Tiefdrucktafel gegenüber Seite 206 des Buches von Wilhelm Berdrow, das zum Jubiläum 150 Jahre Krupp 1937 [!] erschienen ist.
(Und der guten Form halber hier auch die vollständigen bibliographischen Angaben beider Bücher. Wilhelm Berdrow: Alfred Krupp und sein Geschlecht. 150 Jahre Krupp-Geschichte 1787-1937 nach den Quellen der Familie und des Werks. Mit über 100 Bildern im Text und auf 32 Tiefdrucktafeln. Berlin: Verlag für Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistik Paul Schmidt, 1937. – Klaus Tenfelde: „Krupp bleibt doch Krupp“. Ein Jahrhundertfest: Das Jubiläum der Firma Fried. Krupp AG in Essen 1912. Essen: Klartext Verlag, 2005.)
Protected: Ein Präsident
Friday, 25. September 2009Vorlesepein (I)
Friday, 25. September 2009Noch so ein Motiv rund ums Buch, das es mir seit Langem angetan hat: der Dichter als Vorleser. Als Buchhändler „in leitender Stellung“, zeitweise zuständig für Werbung und Marketing, hatte ich mich neben anderen honorigen Aufgaben auch um Autorenlesungen zu kümmern – ein nicht immer ganz einfaches, oft sogar nervtötendes, selten dankbares Tätigkeitsfeld. Die Autoren kamen meist schon mit Vorbehalten in unsere Stadt. Zwischen Düsseldorf gestern und Münster morgen war ihnen vom Verlag zum Überfluss und -druss noch diese langweilige Ruhrmetropole aufs Auge gedrückt worden.
Wir Buchhändler sehen den Lesungen ja auch oft mit gemischten Gefühlen entgegen. Im günstigsten Fall hat der Gast die Talente eines guten Alleinunterhalters, liest nicht viel, erzählt lieber, was ihm gerade in den Sinn kommt, führt vor, dass Dichter auch bloß Menschen aus Knochen, Sehnen und Speck sind et cetera. Als einen solchen herzlichen Menschenfreund habe ich als seltenes Beispiel Volker Elis Pilgrim in guter Erinnerung. Was für ein Buch er damals vorgestellt hat, der eigentliche Anlass seines Besuchs also? Ist mir völlig entfallen.
Gegen solche seltenen Ausnahmen stehen leider etliche Totalversager, was Rezitationskunst und Selbstdarstellung betrifft. Peter Handkes Lesung zum Beispiel, wohl aus Der kurze Brief zum langen Abschied, eine der ersten, die ich noch als namenloser Zuhörer besuchte? Ein schnell und dauerhaft wirkendes Schlafmittel, das mich ein für alle Mal gegen diesen schriftstellernden Poeten einnahm. – Und Hans Mayer mit seinen Erinnerungen, Ein Deutscher auf Widerruf? Die Herablassung in Person! Er beschwerte sich bitterlich bei seinem Publikum, dass es nicht in größerer Stückzahl erscheine, um den Ausführungen eines so bedeutenden Mannes zu lauschen, wie er doch bekanntermaßen einer sei. Er komme gerade aus Detmold oder Wesel, selbst da seien mehr Menschen erschienen als hier, in dieser „angeblichen Großstadt namens Essen“. Damals gab es das Wort „fremdschämen“ noch nicht, vermutlich ist es aber einem Buchhändler bei einem solchen peinlichen Anlass eingefallen.
Das Verhältnis unserer Dichter zu den Buchhandlungen, in denen sie auf Geheiß ihrer Verleger lesen müssen, ähnelt dem Verhältnis von uns Buchhändlern zu den Dichterlesungen, die uns die Freizeit rauben und kaum zusätzlichen Umsatz bringen, aufs Haar in der Suppe: Man mag’s nicht, man ekelt sich und könnte laufen gehen. Ein schönes Beispiel für diese Aversion habe ich gerade eben in einem veröffentlichten Tagebuch gefunden, aus der Nachbarstadt Dortmund und insofern besonders interessant für den Revierflaneur: „15. 3 [1972] – 10.33 Abfahrt nach Dortmund und ein schönes diesiges Blau über einige 100 Kilometer verheißungsvoll hingestreckt, also richtig ,Frühling läßt sein blaues Band …‘ In D. dann allerdings als erster Eindruck ein Hotelrestaurant mit dem Namen ,Bahnhofsblick‘, was mir nicht gerade einladend schien und am ehesten noch den ,drei Paßbildern‘ entsprach, die man mir im voraus für Presse u. Veranstaltungskalender abgefordert hatte. Auch war kein Abholer / Cicerone am Zug, wie es allgemein üblich ist, im Hotel kein Grußbilett oder sonstiges Aufmerksamkeitszeichen bei der Rezeption hinterlegt, nicht mal eine Telefonnummer, an die ich mich hätte wenden können, also abends allein u. zufuß zum ,Museum am Ostwall‘, wo die Lesung stattfinden sollte. Der Empfang durch die beiden Kultursachverständigen Herren Wolf u. Thiemann (o. ä.) entsprechend frostig bis unhöflich und die drei Einführungssätze vor Beginn auch nicht gerade zum lustigen Loslegen ermunternd. Das Publikum zunächst von fast einschläfernder Geduld, anscheinend schon jahrelang hinter dem Gatter gehalten u. insofern unsicher, ob man bei Bedarf lachen oder applaudieren oder wenigstens versonnen nicken dürfe. Erst in der unvermeidlichen Diskussion plötzlich von der Aggressivität losgelassener Hofhunde: ,Möchte’ mal fragen, ob Se ne unbewältigte Vergangenheit ham?!‘ War Gottseidank durch u. durch erkältet, fast schon taub, so daß ich meiner Geburtsstadt angemessen begegnen konnte: ,Nee, Vergangenheit, schon alles klar, aber Ihre Gegenwart wohl in diesem musischen Kreis eher einem Mißverständnis zu verdanken.‘ Erstes Wiedersehen mit D-Mund nach meinem Geburtstag am 25. 10. 29. – Kühler unpersönlicher Abschied. Sachlich Tasche gepackt. Blicklos lieblose Pfoten berührt.“ (Peter Rühmkorf: TABU II. Tagebücher 1971-1972. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2004, S. 208 f.)
Man möchte dem nachgehen in die Einzelheiten, der eine der beiden „o. ä.“ namhaft gemachten Gastgeber ist noch einwandfrei identifizierbar, es dürfte sich um Dr. Eugen Thiemann (1925-2001) gehandelt haben, der das Museum am Ostwall in den Jahren von 1967 bis 1987 leitete. Im Unterschied zu ihm gibt es das wenig einladende Hotelrestaurant Bahnhofsblick noch immer, die Adresse ist Königswall 18. Der Fußweg zum Museum dürfte in zehn Minuten zu bewältigen gewesen sein, man könnte ihn, quasi in memoriam, getreulich abschreiten, wenn man denn wüsste, ob Rühmkorf den weiteren, aber sichereren Weg über den Burgwall gewählt oder sich sozusagen querbeet durchgeschlagen hat, zum Beispiel über die Plätze von Amiens und Netanya zum Markt und dann durch die Brauhaus- und Viktoriastraße ans Ziel. Spätestens hier endet aber die Rekonstruktion einer peinlich missglückten Heimkehr, das Museum am Ostwall hat am 18. Juni seine Tore an diesem Ort endgültig geschlossen und wird im Mai 2010 mit neuem Schwung – „Das Kunstmuseum als Kraftwerk“ – im Dortmunder U eröffnen. – Und was sagt der Fatzke da aus der dritten Reihe? „Möchte’ mal fragen, ob Se ne unbewältigte Vergangenheit ham?!“ Na, das erinnert doch, als wär’s das Negativ zum Positiv, an dieses bekannte Gedicht des verstorbenen Meisters: „[…] Wollte nur mal fragen, wie’s so ist. / Wollte nur mal sehn, ob meine Sterne / Noch am Leuchten sind / Und man mich in der Ferne / Etwa gar vermißt … // Wollte eigentlich, / wollte, weil mein Sinn für das Posthume / wie bekannt in engen Grenzen bleibt / und der Geist auf seiner schmalen Krume / ungenetzt nur parfümierte Blumen treibt, / also, wollte fragen, ob man sich … […].“
[Hier gehts zur Fortsetzung Vorlesepein (II).]
Protected: Erstlesealter (I)
Saturday, 19. September 2009Kurzliste
Friday, 18. September 2009Heute ist die Feinauswahl jener Grobauswahl der 154 deutschsprachigen Romane bekanntgegeben worden, die zwischen dem 1. Oktober 2008 und dem 16. September 2009 erschienen sind. Eine siebenköpfige Jury hat aus den zuvor nominierten 20 Büchern nun noch einmal sechs selektiert, die sie aus gewissen Gründen für die besten hält. Der Jury gehören bei dieser fünften Verleihung des Deutschen Buchpreises sechs Literaturkritiker und ein Buchhändler an: Richard Kämmerlings (Frankfurter Allgemeinen Zeitung), Michael Lemling (Buchhandlung Lehmkuhl, München), Martin Lüdke (freier Literaturkritiker), Lothar Müller (Süddeutsche Zeitung), Iris Radisch (Die Zeit), Daniela Strigl (Literaturkritikerin und -wissenschaftlerin) und Hubert Winkels (Deutschlandfunk).
Dieser hochrangige Literaturpreis, der schon mit dem französischen Prix Goncourt und dem englischen Booker Prize verglichen wurde, bringt dem Sieger immerhin 25.000 Euro und jede Menge Publicity und seinem Verlag hohe Verkaufszahlen ein. Wo soviel Geld im Spiel ist, lässt der Verdacht nicht auf sich warten, dass die Kriterien der Auswahl und schließlichen Prämierung eben doch nicht rein ästhetische, literarische sind. Im vorigen Jahr um diese Zeit hat es eine hitzige Diskussion über diese Frage gegeben, bei der die Stellungnahme von Monika Maron mir in besonders guter Erinnerung geblieben ist, weshalb ich sie hier in voller Länge zitiere: „Es ist vollkommen gleichgültig, ob die Shortlist akzeptabel ist oder nicht, ob das prämierte Buch den Preis verdient haben wird oder nicht, weil dieser Preis kein Buchpreis, sondern ein Marketingpreis ist. Es geht nicht um Literatur, sondern um die Verkäuflichkeit von Literatur ohne großen Aufwand, vom Stapel weg wie die neueste Single vom neuesten Superstar. Diese krawallige Castingshow dient weder den Verlagen, noch weniger den Autoren, sondern vor allem den bestsellersüchtigen Buchhandelsketten, deren vielgeschmähtes Geschäft wir mit diesem Preis nun aber selbst auf die Spitze treiben. Dieser Preis gehört abgeschafft, schreibt Michael Lentz; recht hat er. Statt dessen spielen alle mit, weil sie fürchten, sonst nie mehr auf den Listen von Hugendubel und Thalia zu landen oder nie wieder, nicht einmal schlecht, rezensiert zu werden, denn die Literaturkritik ist der andere Gewinner des Spektakels. Plötzlich hat sie wieder Macht, nachdem ihre Hymnen oder Verrisse für den Verkauf nahezu wirkungslos geworden waren. Wären wir nicht so unsolidarisch wie wir sind, würden wir, die Autoren, den Buchpreis boykottieren, statt uns als Spielmaterial für Marketingstrategien vorführen zu lassen. Es gibt genügend Preise, die der ernsten und wenig glamourösen Arbeit des Bücherschreibens angemessen sind. Dieser ist es nicht.“ (Monika Maron am 17. September 2009 im „Lesesaal“ von FAZ.NET zu der Frage: „Was taugt die Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2008?“)
Da ich nun schon einmal etwas misstrauisch geworden bin, fällt mir doch auf, dass nahezu alle großen belletristischen Verlage in dieser Auswahl vertreten sind: S. Fischer, Hanser, C. H. Beck, Kiepenheuer & Witsch, Resident und Suhrkamp. Keiner kommt doppelt vor – und ein Außenseiter hat es auch nicht geschafft. Komischerweise fielen aber alle Namen der ursprünglichen Longlist, die mir mindestens vom Hörensagen vertraut waren – Sibylle Berg, Thomas Glavinic, Reinhard Jirgl und Brigitte Kronauer – dem Rotstrich der Juroren zum Opfer, mit einer Ausnahme: Herta Müller. Haben also diesmal ganz junge Schreiber eine Chance bekommen? Das kann man auch wieder nicht sagen, denn von den verbliebenen Autorinnen und Autoren der Shortlist zähle ich vier zu meiner Generation: Der Älteste, Norbert Scheuer, ist fünf Jahre älter, Rainer Merkel acht Jahre jünger als ich. Allein Stephan Thome (* 1972) und Clemens J. Setz (* 1982) kann man als Nachwuchsautoren bezeichnen. Nachdem Leseproben aus allen zwanzig Büchern schon in einem Reader präsentiert wurden, der seit dem 23. August in den Buchhandlungen ausliegt, kann man sich von den sieben Finalisten nun ein genaueres Bild machen. Alle sieben Bücher sind erschienen. Erfreulicherweise sind die meisten Romane verhältnismäßig schmal, allein der Wälzer des Jüngsten, von Clemes J. Setz, fällt mit seinen über siebenhundert Seiten aus dem Rahmen. Immerhin muss man aber doch 2.205 Seiten bewältigen und 124,50 € auf den Zahlteller legen, wenn man im Bilde sein will, was die Kenner von der lesenden Zunft in diesem Bücherherbst 2009 für lesenswert halten.
Aber da gibt es ja noch abertausende von Büchern aus den vergangenen Jahren und Jahrhunderten, die ungelesen in den Schränken und Regalen meiner Zuwendung harren. Das Vergnügen, das sie verheißen, hat teils wesentlich vertrauenswürdigere Fürsprecher als die oben genannten Herrschaften und ist zudem ganz kostenlos, denn diese Bücher sind ja längst bezahlt. Woher kommt es nur, dass wir uns immer von der vermeintlichen Brisanz des Aktuellen anstecken lassen? Schon in meiner Zeit als Buchhändler (1978 bis 1995) kam mir irgendwann der Novitäten-Hype im Halbjahresturnus reichlich albern vor. All diese Ignoranten, die an einem meterlangen Klassikerregal – das gab es damals bei G. D. Baedeker an der Kettwiger Straße noch – vorbei auf mich zusteuerten mit der Frage nach dem allerneuesten Roman: Wie degoutant! Und ich gestehe frank und frei: Ich würde mich freuen, wenn der diesjährige Kassenschlager eben nicht vom Deutschen Buchpreisträger käme, sondern von einem Geheimtipp aus der zweiten oder dritten Reihe, aus einem der zahllosen Kleinverlage von Lilienfeld bis Blumenbar, die kein Kassenwart und kein Marketingfritze auf der Rechnung hatte.
Immer schlimmer
Tuesday, 15. September 2009Wenn die Oma immer schussliger wird und schließlich ihr Rezept vom Doktor am Bankschalter vorlegt, dann ist das eher komisch, allenfalls tragikomisch. Wenn aber ein von allen Medien, Verlagen und seinen Standesgenossen bis zuletzt noch als Doyen der Literaturkritik umschmeichelter, wortgewaltiger, weitläufig belesener Mann des Geistes und der Feder allwöchentlich die Auflösungsprozesse seiner Urteilskraft öffentlich vorführt, dann ist das tragisch – und zudem eine Gemeinheit jener, die ihm dazu die Bühne stellen.
So geschieht es stets am Sonntag in „seiner“ Frankfurter Allgemeinen keinem Geringeren als dem armen Marcel Reich-Ranicki, dessen Verdienste um die TV-adäquate Popularisierung unterhaltender Literatur nicht hoch genug zu schätzen und zu loben sind. Eigentlich sollte er doch auf seine alten Tage nicht nötig haben, dermaßen minderwertige Kolumnen abliefern zu müssen. Ich habe vor über zwei Jahren, damals noch in meinem Westropolis-Blog, einen ersten Stoßseufzer in Richtung FAS-Chefredaktion abgeschickt, den armen alten Mann vor sich selbst in Schutz zu nehmen. Aber vermutlich haben Leserbefragungen ergeben, dass sein guter Name immer noch für ein paar Prozent der Abonnenten ein Beweggrund ist, das Blatt nicht abzubestellen. Anders kann ich mir jedenfalls nicht erklären, warum diese Zeitung ihm immer noch die Treue hält. Oder sind die dort Verantwortlichen schlicht zu feige, ihrem „Starautor“ die Wahrheit zu sagen? Wenn er vor Jahren im Fernsehen sein grandseigneureskes Gehabe gelegentlich überzog, dann war dies selbst mit der Dickfelligkeit eines abgehärteten Glotzeguckers kaum noch zu ertragen. Jetzt aber tritt uns kein kauziger Grandseigneur mehr entgegen, vielmehr verschleift sein Tonfall ins dumpf Onkelhafte – und das grenzt nun wirklich an Folter.
Zuletzt hatte Reich-Ranicki sein Heil in der Kürze gesucht und allerknappste Frage-Antwort-Textchen veröffentlicht nach dem Schema: „Warum ist der Autor X heute vergessen? – Weil es sich nicht lohnt, sich seiner zu erinnern.“ Dass er selten eine Begründung für seine Verbannungsurteile für nötig hielt, musste man schon deshalb durchgehen lassen, weil die Fragenden ihre Irritation ja auch nicht begründeten. An dieser Stelle sei mein Argwohn nicht verschwiegen, ob sich Reich-Ranicki nicht nur die Antworten, sondern oft auch die Fragen selbst ausdenkt. Wenn ein Peter Hausmann (Dresden) den Großkritiker was fragt, dann ist es ja schlicht unmöglich zu beweisen, dass in Dresden kein Mann dieses Namens lebt. Ein bekennender Filou war Reich-Ranicki ja immer schon. Und selbst wenn man ihm hier auf die Schliche käme, könnte ihm das nichts mehr anhaben, er wäre vermutlich noch stolz auf seine Schlitzohrigkeit und froh, endlich mal wieder in der Bild-Zeitung zu stehen.
Bei der angeblichen Waltraud Fink, die dem Briefkastenonkel von der FAS in den vergangenen beiden Wochen den folgenden Steilpass zu einer weit ausholenden Antwort lieferte, wird auf die Angabe eines Absendeortes ganz verzichtet: „Wie beurteilen Sie den Literaturkritiker Kurt Tucholsky?“ Nachdem Reich-Ranicki im ersten Teil seines wohl summarisch gemeinten Statements zu Tucholsky festgestellt hat, dass dieser Rezensent keine „Gutachten eines Sachverständigen“ verfasst habe, sondern „Bekenntnisse und Geständnisse eines Betroffenen“, kommt er in Teil zwei auf die Arbeitsbedingungen, um nicht zu sagen: auf die Arbeitsmoral seines großen Vorbilds zu sprechen. Man lese und staune: „Den meisten seiner Rezensionen kann man anmerken, wie rasch er sie schrieb und wie selten er sich bemühte, tiefer in die Materie einzudringen, und wie oft er sich mit Pauschalurteilen und mit gewöhnlichen Klischees begnügte.“ Und nun folgt eine sehr entlarvende Begründung, warum Reich-Ranicki meint, „seinen“ Tucholsky, sozusagen von Rezensent zu Rezensent, dennoch auf das Höchste loben zu müssen. Damit hat er nicht nur eine Ausrede, sondern gleich noch ein namhaftes Vorbild für seine eigene Faulheit und Schlampigkeit.
Gerade fiel mir beim Auspacken meiner Bibliothek die schöne kleine Taschenbuchausgabe von Bierbaums Kasperlegeschichte Zäpfel Kerns Abenteuer (frei nach Pinocchio) in die Hände, die der Insel-Verlag dankenswerterweise 1977 neu herausgebracht hat, und gar mit den alten Illustrationen von Arpad Schmidhammer (s. Titelbild). Der bedeutendste Kritiker unseres Landes in dieser Zeit konnte das Buch nicht finden, „in keinem Nachschlagebuch und in keiner Literaturgeschichte.“ Dafür wusste er aber neulich zu berichten, dass Thomas Manns Buddenbrooks bei ihrem Erscheinen zunächst völlig verkannt worden seien und es lange gedauert habe, bis das Urteil diesem Meisterwerk gerecht wurde. Als die Interviewerin erstaunt nachhakt, macht er wieder, was er immer macht, wenn er bei einem Fehler erwischt wird, viele Male konnten wir’s im Literarischen Quartett bewundern: Er beharrt kurz auf seinem Irrtum, im Brustton der Überzeugung, um dann blitzschnell zu einer weniger angreifbaren Behauptung überzuleiten. – Ach, es ist so fad! Und ich werde nun ganz gewiss kein Wort mehr über den Mann verlieren.
Sonntagszeitung? (II)
Monday, 14. September 2009Nachdem ich nun gestern Abend alle fünf Artikel gelesen habe, komme ich leider zu einem niederschmetternden Ergebnis. Aber der Reihe nach. – Was uns Julia Encke vom Auftritt der Oulipo-Autoren Hervé Le Tellier, Jacques Roubaud, Ian Monk, Frédéric Forte, Olivier Salon und Marcel Bénabou in einer halben Spalte mitteilt, das richtet sich an Leser, die von Oulipo noch nie zuvor gehört haben – und führt sie nach nur sechzig kurzen Zeilen zu der beruhigenden Einsicht, dass sie sich diesen Namen auch zukünftig nicht merken müssen. Die Kulturwissenschaftlerin Julia Encke hat ein viel beachtetes Buch über die Sinnesorgane im Krieg der Neuzeit geschrieben. Nach der Befassung mit einem so ernsten Thema reagiert man vielleicht notgedrungen ablehnend auf das, was Encke den „Sprachfuror von manischen Sprachformalisten […], von Grammatikfetischisten und Spielern“ nennt. Über die Oulipo-Stars, die am 11. September 2009 in Berlin auf der Bühne des Internationalen Literaturfestivals saßen und „Selbstporträts in Arbeitsproben“ zum Besten gaben, erfahren wir leider nicht viel mehr, als dass sie dabei kicherten: „Sie kicherten eigentlich ununterbrochen. […] Da kicherte man dann auch, in diesem traumhaft vergangenen Theater.“
Na, vielleicht war ja bei dem Erzählwettbewerb am Broadway mehr los, bei dem der Ungar Péter Zilahy, zurzeit Stipendiat im Einstein-Haus in Caputh, seine Geschichte Das Opfer vorgetragen hat. Das ist allerdings schon ein Weilchen her, was die Sonntagszeitung schamvoll verschweigt. Der Leser hätte sonst auf die Frage verfallen können, warum ihm ein New Yorker Bühnenauftritt vom 21. Mai dieses Jahres mit solcher Verspätung noch zum Frühstück serviert wird. Aber Zilahy ist selbst nicht einer von der schnellen Truppe, die Meldung von seiner Spoken-Word-Performance im Symphony Space steht heute noch als Ankündigung (!) auf seiner Homepage. Wenn man sich die vier Archivbilder von dem sympathischen Fabulierer anschaut, wie er da „frei sprechend, ohne Notizen“ wild gestikuliert, dann bereut man, nicht dabeigewesen zu sein, wie das Publikum, abgezählte „840 Zuschauer“, den jungen Ungarn feierten. Schwarz auf weiß nachgelesen ist der Text leider keinen Pfifferling wert. Offenbar ein Seitenfüller der FAS-Redaktion, die nun mal die Übersetzung von Matthias Fienbork bezahlt hat und sich nun mit argem Verzug gezwungen sieht, sie mangels besserer Alternativen zu verwenden.
Jochen Reinecke hat ja mit seiner Idee zum Dauerbrenner Gehen Sie ins Netz? für die nächsten tausend Jahre ausgesorgt. Er verbindet wöchentlich einen originellen Link-Tipp mit einer kleinen Denksportaufgabe, bei der eine Google-Suchabfrage gefunden werden muss, die zu einem bestimmten Ergebnis führt. Für diese Art Hirnakrobaktik habe ich keine Zeit, aber die Links schaue ich mir gelegentlich an. Diesmal wurde mir in Aussicht gestellt, dass ich hier oder dort ein Phantombild erzeugen könnte, das ich zukünftig auf meiner Website als „Porträt des Herausgebers“ zeigen könnte. Na, so ganz bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden (s. Titelbild).
Mit dem Universalgenie, dem Stettiner Studienrat Hermann Graßmann, lohnt sich‘s vielleicht, eingehendere Bekanntschaft zu schließen. Ein Kandidat für meine Eccentrics? Nach dem, was sich Sabine Wienand in der FAS über ihn abgerungen hat, komme ich zu keinem endgültigen Entschluss. Das Bild macht 825 Quadratzentimeter aus, ihr Text kommt bloß auf 370! Langsam kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass in dieser Sontagszeitungsredaktion ausgesprochene Sonntagsschreiber am Werke sind, Zeilenschinder, die sich jeden einzelnen läppischen Satz abquälen müssen wie ein Obstipierter seine Wurst.
Was bleibt? M. R.-R.s Antwort auf die Frage von Waltraud Fink, wie der Kritiker-Papst den Literaturkritiker Kurt Tucholsky beurteilt. Na, für heute habe ich mich genug geärgert, da mache ich einen eigenen Beitrag draus.
[Und der folgt morgen.]
Sonntagszeitung? (I)
Sunday, 13. September 2009Warum hält man eine Sonntagszeitung? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der eine Abonnent erträgt, zum Beispiel, die plötzliche Leere am Frühstückstisch nicht, wenn man nach sechsfacher morgendlicher Zeitungslektüre gerade an jenem Tag darauf verzichten soll, an dem man Zeit hätte, ihr ohne jede Hektik zu frönen. Ein anderer findet unter der Woche gar nicht die Zeit, sich das tagesaktuelle Weltgeschehen von der Presse erzählen und erklären zu lassen; so hofft er, am Tag des Herrn eine Zusammenfassung geliefert zu bekommen. Dieser wie jener nimmt vielleicht auch an, dass die Sonntagszeitung sozusagen in feinerem Gewand daherkommt, besonders proper und mit Liebe herausgeputzt, als wollte sich der Journalismus von seiner besten Seite zeigen.
Die beiden Sonntagszeitungen, die mir schon aus meiner Jugend bekannt sind, kamen für mich aus politischer Abneigung nicht in Frage: die Bild am Sonntag und die Welt am Sonntag, beide aus dem Hause Springer. Erst als die Frankfurter Allgemeine im September 2001 landesweit eine eigene Sonntagsausgabe herausbrachte, ließ ich mich zu einem Abonnement verführen, für zuletzt 14,50 € monatlich, das sind 174 € im Jahr oder rund 3,30 € pro Ausgabe – also 40 Cent mehr als am Kiosk oder beim Bäcker. Da stutzt man schon, denn sonst ist doch in aller Regel ein Abo billiger: wegen der langfristigen Verpflichtung, die man da eingeht, auch wegen der Regelmäßigkeit des Bezugs. Zudem zahlt man mindestens für ein Vierteljahr im Voraus. Aber gut, der Zusteller muss ja auch von etwas leben. Und ob die FAS ihren Preis für mich wert ist, das will ich nicht von solchen Kleinigkeiten, gar Kleinlichkeiten abhängig machen.
Sondern ausschließlich vom Inhalt – und vom Nutzen, den mir dieser Inhalt bringt. Und was das betrifft, muss ich zunächst einmal bekennen, dass von dem Dutzend „Heften“, aus denen die Sonntagszeitung besteht, mich zwei Drittel rein gar nichts angehen: Sport, Wirtschaft, Geld & Mehr, Reise, Technik & Motor, Immobilien, Beruf und Chance sowie zwei „Hefte“ Inserate fliegen unbesehen in die Altpapierkiste. Allein dem politischen „Mantel“, dem Feuilleton und den Teilen Wissen und Gesellschaft widme ich ein Viertelstündchen lang meine Aufmerksamkeit, auf der Suche nach Artikeln, die ich am Abend dann eingehender studieren will.
Heute waren es genau fünf: auf S. 24 ein Bericht (von Julia Encke) über den Auftritt von sechs Autoren der Gruppe Oulipo beim Literaturfestival in Berlin; auf S. 27 die deutsche Übersetzung einer Geschichte des Ungarn Péter Zilahy, mit der er einen Erzählwettbewerb im Symphony Space am New Yorker Broadway gewonnen hat; auf S. 29 die stets höchst ärgerliche Rubrik Fragen Sie Reich-Ranicki, die ich mir nie entgehen lasse, weil ich mich über ganz bestimmte Angelegenheiten gern ärgere; auf S. 65 die Rubrik Gehen Sie ins Netz? von Jochen Reinecke; und auf S. 68 ein ganzseitiger Artikel über Das Universalgenie von der Odermündung, den Stettiner Studienrat Hermann Graßmann, der ja ein Kandidat für meine Eccentrics sein könnte. Ob auch nur ein einziger dieser Texte hält, was ich mir von ihm verspreche, das weiß ich noch nicht. Aber schon jetzt kann ich sagen, dass diese Ausbeute viel zu dürftig ist, um den regelmäßigen Pflichtbezug der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung weiter vor meinem Haushaltsplan, meiner Gefährtin und meinem Gewissen zu rechtfertigen. (Letzterem gegenüber kann ich unmöglich verantworten, dass ein gutes Pfund Papier bedruckt wird für diese lächerlichen sechs Artikel, die auf einen Bogen à 30 Gramm passen.)
Ich habe das Abo übrigens schon vor ein paar Tagen gekündigt, gerade noch rechtzeitig vor Beginn des vierten Quartals. Wie üblich war die Abbestellung längst nicht so bequem wie seinerzeit die Bestellung. Eine E-Mail-Adresse speziell zur Kündigung findet man im Impressum nicht. Also sandte ich meine Nachricht an sonntagszeitung@faz.de. Von dort erhielt ich umgehend meine E-Mail zurück, mit persönlichem Abesender, aber ohne jeden Kommentar. Ich fragte sicherheitshalber noch mal nach: „Sehr geehrte Frau Regine Henry, darf ich diese ,Nachricht‘ als Bestätigung der Wirksamkeit meiner Kündigung verstehen? Bitte, teilen Sie mir doch noch mit, ab wann die Kündigung wirksam wird.“ Frau Henry antwortete prompt: „E-Mails in Sachen Abo bitte immer an: vertrieb@faz.de. Ich habe Ihre E-Mail dahin weitergeleitet und bereits eine Eingangsbestätigung erhalten. Post von dort erhalten Sie extra.“ – Und tags drauf kam dann auch diese Extrapost: „Kündigungsbestätigung – Sehr geehrter Herr Hessling, schade, dass Sie sich zur Kündigung des Abonnements der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung entschlossen haben. Selbstverständlich respektieren wir die Gründe, die zu der Entscheidung geführt haben. Vielleicht geben Sie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die als fundierte Informationsquelle gedient hat, dennoch eine neue Chance? Zum Abschluss hier nun der aktuelle Status des Abonnements: Das Abonnement der Sonntagszeitung endet am 30.09.2009.“ Der Respekt, der hier meinen Gründen gezollt wird, ist nun in der Tat so selbstverständlich, dass ich mich frage, warum er dennoch ausdrücklich bekundet wird. Vielleicht, um mich daran zu erinnern, dass es heutzutage durchaus Vertragspartner gibt, die Kündigungen nicht so einfach akzeptieren bzw. vorsorglich Verträge schließen, die im Kleingedruckten Hürden verstecken, durch die eine vorzeitige Kündigung nahezu unmöglich oder doch mindestens äußerst beschwerlich und zeitaufwändig gemacht wird? – Was das angeht, ist die FAS immerhin ein fairer Geschäftspartner gewesen, über den ich mich insofern nicht beklagen kann.
[Teil 2 folgt morgen.]
Rundgang (X)
Saturday, 12. September 2009Die Kirche der evangelischen Gemeinde Rellinghausen ist uns schon auf einem früheren Rundgang begegnet. Seither habe ich sie aus ganz unterscheidlichen Perspektiven und von verschiedenen Standorten aus betrachtet. So zeigt das Titelbild sie von einem Waldweg aus, den ich bei meinen Spaziergängen mit Lola häufig passiere.
Inzwischen weiß ich, dass das „im Bauhausstil 1934-35 errichtete denkmalgeschützte Gebäude […] der dritte evangelische Kirchenbau Rellinghausens an dieser Stelle [ist]. Der letzte Neubau war notwendig geworden, als infolge des Bergbaus die Kirchengemeinde innerhalb von 40 Jahren von 800 auf 8.000 Mitglieder angewachsen war.“ (Holle, a. a. O., S. 6 f.) Die erste reformierte Kirche wurde 1663 eigeweiht, aber schon zehn Jahre später von durchziehenden französischen Truppen Ludwigs XVI. nahezu zerstört. Ein zweiter Kirchenbau, von dem es auch noch alte Fotos gibt, entstand in den Jahren 1772-75. (Vgl. Ludwig Potthoff: Rellinghausen im Wandel der Zeit. Essen: R. Bacht, 1953, S. 108-112.)
Der gegenwärtige Pfarrer, Andreas Volke-Peine, hat die Geschichte seiner Gemeinde und Kirche in Rellinghausen anlässlich des Jubiläums 1996 „aus evangelischer Sicht“ dargestellt. (Vgl. die Festschrift 1000 Jahre Rellinghausen. Essen: Bacht Verlag, 1995, S. 44-48.) Über die schwierige Zeit der Kirche im Nationalsozialismus und den Kampf zwischen den Deutschen Christen und der Bekennenden Kirche am Ort schreibt er: „Die Zeugnisse aus dieser Zeit lassen erkennen, daß auch in der Rellinghauser Gemeinde die Fahne mit dem Hakenkreuz Anhänger hatte und mancher evangelische Christ sich vom Führer verführen ließ. Aber es gab auch stets eine Fraktion, die fest zur Bekennenden Kirche stand und den Mut hatte, offen gegen das nationalsozialistische Gedankengut anzugehen.“ (Ebd., S. 48.)
Betreten habe ich die Kirche immer noch nicht. Ich nähere mich ihr bewusst, langsam, nichts übereilend. Und ich habe nun auch einen gebührenden Anlass gefunden:
Am 26. September, heute in zwei Wochen, gibt der Komponist Gerd Zacher aus Anlass seines 80. Geburtstags ab zwanzig Uhr ein Orgelkonzert in dieser Kirche. Auf dem Programm stehen zwei Ricercari von Johann Sebastian Bach aus dem Musikalischen Opfer und drei Werke von Zacher selbst: Szmaty (1968), Trapez (1993) und Vocalise (1971).
Time is Honey
Friday, 11. September 2009Mein neuer Telekommunikationsdienstleister, der eigentlich Handyhändler ist, aber solchen kommunikationstechnischen Anachronisten wie mir zuliebe im Nebenberuf auch noch Festnetzanbieter, wendet sich in seiner aktuellen Mobilfunkwerbung offenbar an Kunden, die dreißig Jahre jünger sind als ich und insofern noch viel mehr Zeit zu verschwenden haben. Trotzdem (oder gerade deshalb?) ist die Zeit eine zentrale Botschaft des Marketings dieses Global Players: „Lebe im Jetzt. Surf sofort. […] Es ist Deine Zeit.“ So heißt es in der plump-vertraulichen Duz-Form, an die man ja schon von Ikea her gewöhnt ist.
So ganz möchte man sich’s aber doch nicht mit mir verderben, denn auf der zweiten Seite werde ich dann wieder ganz förmlich gesiezt: „Holen Sie sich das Surf-Sofort-Paket […] und surfen Sie mit DSL-Speed ab der ersten Minute. […] Sofort telefonieren und surfen ohne Wartezeit […] Auspacke, anschließen und gleich lossurfen! Mit dem […] Surf-Sofort-Paket müssen Sie nicht lange warten. Surfen und telefonieren Sie sofort los! […] Konzentrieren Sie sich vom ersten Tag an auf das Wesentliche: Ihren Spaß.“ (Das Titelbild zeigt, wie genau man sich diese Art konzentrierten Spaßes eines solchen stolzen Telekommunikations-Kriegers vorzustellen hat.)
Ich muss da mal nachhaken. Ist denn die mittlerweile zu einem allgegenwärtigen Zeitvertreib gewordene Telefonitis tatsächlich ein Quell der Freude? Ist – Hand aufs Herz! – der Zwang zur telefonischen Erreichbarkeit rund um die Uhr und an jedem beliebigen Ort und Örtchen spaßig? Genau besehen tröstet uns diese Werbebotschaft nur mit dem Fitzelchen Zeit, das man spart, weil der Zutritt zum grenzen- und endlosen Palaver im Idealfall ruckzuck von statten geht. Ansonsten gilt: Wenn du hier eintrittst, lass alle Hoffnung fahren. Das Instrument, das du dir da nichtsahnend hast an die Backe nähen lassen, ist ein wahrer Zeitvampir.
Ich beobachte überdies gerade aus nächster Nähe, dass es ein extrem zeitraubendes Unternehmen ist, aus einem solchen ruckzuck geschlossenen Telefonvertrag wieder herauszukommen. Und übrigens gilt hier, wie sonst nur für den Junkie, das grausame Gesetz: Einmal Handy, immer Handy!
Eines muss der Neid den Werbefuzzis solcher Konzerne wirklich lassen: Es gelingt ihnen, ihren Zielgruppen, den juvenilen Kunden ihrer Auftraggeber, Scheiße für reinstes Gold anzudrehen. So lautet etwa eine ihrer unglaublichen Verheißungen: „Telefonieren Sie zum Beispiel günstig in andere Mobilfunknetze oder endlos in ausländische Festnetze.“ Wirklich endlos telefonieren? Ist es das, was sich der Warrior Nr. 10 erträumt? Dann wäre ihm ein Job in einem der zahlreichen Callcenter zu empfehlen. Da bekommt er sogar noch ein kleines Gehalt für seine Lieblingsbeschäftigung.
Verwechslung (I)
Thursday, 10. September 2009Im ICE nach Frankfurt am Main lauschte ich vor einigen Jahren dem Gespräch zweier Mitreisender, eines sehr ungleichen Paares. Eine offenbar nicht mehr nur leicht alkoholisierte Dame mittleren Alters berichtete ihrem Gegenüber, einem geschniegelten Bürschchen im Angelo-Litrico-Anzug und mit dem Odeur von Zino Davidoffs Cool Water, von ihrer schweren Kindheit ohne Vater. (Nennen wir der Einfachheit halber den Jungen künftig Andy und die Alte Bożena.)
Bożena behauptete, ihr trauriges Dasein dem Seitensprung eines berühmten polnischen Schriftstellers zu verdanken, der Deutschland anlässlich der Uraufführung eines seiner Stücke besucht habe. Erst auf dem Totenbett habe ihre Mutter, die in den späten 50er- und frühen 60er-Jahren als Souffleuse am Stadttheater gearbeitet hatte, ihr dies gestanden. Bożena schien den Tränen nahe, als sie von ihren vergeblichen Bemühungen berichtete, von ihrem leiblichen Vater, „dem Dichter, diesem Schwein“ als seine Tochter anerkannt zu werden. Ich saß unmittelbar hinter den beiden und hatte keine Chance, die detailreiche Schilderung dieser Familientragödie zu überhören. Ich hätte die Geschichte aber wohl schon am nächsten Tag wieder vergessen, wenn der Erzeuger der Erzählerin nicht ausgerechnet ein Schriftsteller hätte sein müssen. Dieses kleine Detail passte nicht zu ihr, zum Milieu ihrer Herkunft, zu den übrigen Umständen des in jeder Hinsicht bescheidenen Daseins. Wäre der angebliche oder tatsächliche Papa ein berühmter Musik- oder Filmstar gewesen und hätte er z. B. Elvis Presley oder Alain Delon geheißen: geschenkt. Aber ein polnischer Schriftsteller, dessen Name unserem Andy natürlich nichts sagte und den selbst ich nur vom Hörensagen kannte? Damit konnte man als geltungssüchtige Hochstaplerin kaum renommieren.
„Ja, ich weiß, den kennen nur gebildete Leute, aber für die ist er eine Berühmtheit. Vor ein paar Jahren ist seine Autobiographie erschienen und ich komme indirekt auch drin vor. Natürlich nicht mit Namen, so schlau ist der Suffkopp noch, dass er mir keine Beweise an die Hand gibt, ihn zur Verantwortung zu ziehen. Aber sonst stimmt alles bis ins kleinste Detail.“ So etwa sprach Bożena. Und mein täglich um tausende Zellen ärmer werdendes Gehirn reservierte ihr und ihrem Hallodri von Vater ein winziges Kämmerchen, wo die beiden ein kümmerliches Dasein am Rande der Vergessenheit fristeten.
Bis ich vor ein paar Tagen im Prospekt eines Ramschers blätterte und darin auf ein interessantes Angebot stieß: „Miłosz, Czesław: Mein ABC. Von Adam und Eva bis Zentrum der Peripherie. – Miłosz folgt in seinem Rückblick auf das 20. Jahrhundert nicht der Chronologie, sondern den ,unvorhersehbaren Assoziationen‘ seiner Erinnerung, die er auf die Willkürlogik des Alphabets bringt. In einer Vielzahl von Stimmen, Porträts und Begegnungen läßt Miłosz das Jahrhundert Revue passieren und verzichtet auf jede selbstglorifizierende Prätention. Ü: Doreen Damme. Gb., 180 S., DEA, (Hanser 2002), R, früher € 15,90, jetzt € 6,00 Nr. 13322.“ – Ach, dachte ich bei mir, ist das nicht der Schürzenjäger aus dem ICE? Bożenas Daddy? Und ist dieses ABC nicht vielleicht genau besagtes Buch, in dem ihre Mutter als dessen kurzzeitige Geliebte vorkommt, zwar mehr oder weniger gut getarnt, aber vielleicht für mich als unfreiwilligen Mitwisser durchaus erkennbar?
Um es kurz zu machen: Er ist es nicht. Ich habe schlichtweg zwei polnische Dichternamen verwechselt. Beide hatten für mich nur eins gemein, dass ich nie eine Zeile von ihnen gelesen hatte. Ich weiß mittlerweile, wer der Richtige gewesen wäre, aber der interessiert mich nun nicht mehr die Bohne. Denn dieser „Falsche“, Czesław Miłosz (1911-2004), ist wirklich und wahrhaftig eine große Entdeckung für mich! Und die gewundenen Wege, auf denen ich zu dieser Offenbarung gelangte, passen ihr wie ausgemessen und angegossen: Habent sua fata libelli. – Übrigens hätte mich bei dieser Verwechslung stutzig machen müssen, dass Miłosz im Unterschied zu dem wahren Verdächtigen Nobelpreisträger war – ein Detail, dass Bożena in ihrer Geschichte ganz sicher nicht unterschlagen hätte, hätte es doch vermutlich selbst den teilnahmslosen Andy mächtig beeindruckt.
[Fortsetzung: Verwechslung (II).]
Protected: Personality Show
Wednesday, 09. September 2009Protected: So kompliziert
Tuesday, 08. September 2009Rundgang (IX)
Monday, 07. September 2009Einen liebevoll gestalteten, handlichen Wanderführer der unmittelbaren Umgebung hat die Bürgerschaft Rellinghausen – Stadtwald e. V. herausgegeben. (Marlies Holle: Wandern auf kultur- und industriegeschichtlichen Pfaden in Rellinghausen/Stadtwald. Essen o. J. [2004].)
Die Wanderwege, von denen einer geradewegs vor dem Fenster meines Arbeitszimmers vorbeiführt, erstrecken sich von der Siedlung Altenhof im Westen bis zur Gaststätte „Zornige Ameise“ im Osten, von der Zeche Ludwig im Norden bis zur Zeche Gottfried-Wilhelm im Süden.
Tatsächlich sind die Spuren des Kohleabbaus, von dem das ganze Revier viele Jahrzehnte lebte und dem es seine rasante Entwicklung im 19. Jahrhundert verdankte, noch überall zu entdecken, wenn man nur aufmerksam ist und darauf achtet. So führt uns einer unser bevorzugten Spaziergänge durch den Schellenberger Wald regelmäßig an einem durch Gitter abgetrennten Areal vorbei, das auf Warntafeln als „Tagesbruch“ ausgewiesen ist.
Gestern las ich in dem genannten Wanderführer, dass sich im Wald bei Schloss Schellenberg, in der Nähe des Mattheywegs noch zahlreiche „Pingen“ entdecken lassen, Schürfstellen an der Erdoberfläche, die von den Anwohnern zur Versorgung ihres privaten Haushaltes ausgebeutet wurden. Und: „Noch immer tritt hier an manchen Stellen Kohle zu Tage.“ (Holle, a. a. O., S. 9.)
Also hielten wir gestern die Augen offen und entdeckten tatsächlich am Fuße eines Hügels, an dessen Gipfel sich ein alter Baum klammerte und unter dem das Erdreich durch Ausschwemmungen in Bewegung geraten war, einige Stückchen Kohle (s. Titelbild).
Romanendzeit
Sunday, 06. September 2009Gleich zwei Romane mit dem Anspruch, sich als „Jahrhundertromane“ behaupten zu können, werden in diesem Jahr in deutscher Übersetzung vorgelegt. Was für eine Anmaßung, möchte man einwenden, wo das 21. Jahrhundert gerade erst einmal acht Jahre und acht Monate alt ist. Aber die Verlage, die sie hierzulande herausbringen, bürgen durchaus für Seriosität. Auch weilen beide Autoren nicht mehr unter den Lebenden, womit eine wesentliche Voraussetzung für Unsterblichkeit erfüllt ist. Und schließlich sind die beiden Bücher, wie es sich für dergleichen gehört, dick wie Moby.
Da wäre also erstens Roberto Bolaño mit 2666. (A. d. Span. v. Christian Hansen. München: Carl Hanser Verlag, 2009. – 1096 S., Pb. m. Lesebändchen, Fadenheftung. – 29,90 €.)
Und da wäre zweitens David Foster Wallace mit Unendlicher Spaß. (A. d. Am. v. Ulrich Blumenbach. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2009. – 1547 S., Pb. m. zwei Lesebändchen, gelumbeckt. – 39,95 €.)
Weder der Chilene noch der Mann aus den USA waren dafür bekannt, fröhliche Menschen zu sein. Foster Wallace litt seit frühester Jugend an Depressionen und hängte sich schließlich Ende vorigen Jahres im Alter von nur 46 Jahren unter seine Schreibstubendecke. Und Bolaño war gerade einmal 50 Jahre alt, als sein jahrelanges Leberleiden ihn hinwegraffte, auch er ein Verzweifelter, dessen Gedanken zeitlebens um Krankheit und Tod kreisten. Können wir von solchen Leidenden erwarten, dass uns ihre Werke ermuntern? Wenn wir aber aus ihnen keine Kraft schöpfen wollen, was dann? Finden wir in solchen Büchern immerhin eine Einsicht, die uns mit unserer Zeit so weit aussöhnt, dass wir den morgigen Tag überstehen? Es sei zugestanden, dass Kunst niemals am Maße ihrer praktischen Nützlichkeit gemessen werden kann. Aber geradezu umbringen sollte uns ein Roman doch auch nicht, oder?
(Romane wie diese beiden gehen übrigens noch einen Schritt weiter, sie treten nicht bloß als Jahrhundert-, sondern gar als Endzeitromane auf. Sie wollen nicht allein das letzte Wort über die Epoche sprechen, der sie entstammen und für die sie stehen, sondern vielmehr das letzte Wort überhaupt – insofern sie unterstellen, dass dies eben die letzte Epoche sei.)
Google-Doodle
Saturday, 05. September 2009Aus besonderen Anlässen wird gelegentlich das bekannte Google-Symbol auf der Startseite der Suchmaschine – zwei blaue Gs, je ein rotes O und E, ein grünes L und ein gelbes O – grafisch mehr oder weniger stark verfremdet. Aus den beiden Os wird dann z. B. eine Harry-Potter-Brille; und wir User erfahren, ob wir’s nun wissen wollen oder nicht, dass just an diesem Tag der letzte Band dieses unsäglichen Fantasy-Zyklus ausgeliefert wird.
Oft sind die Bilder selbsterklärend, manchmal aber rätselt man, was sich denn nun wieder hinter diesem Google-Doodle – so der Name der Spielerei – verbergen mag. Dann reicht es, mit dem Mauszeiger auf das Logo zu fahren, und man liest in einem kleinen Textfeld, das sich automatisch öffnet, einen sogenannten „Tooltip“, auch „ALT-Tag“ genannt, der das Rätsel aufklärt. Da steht dann z. B. „Christopher-Street-Day“ oder „60 Jahre Currywurst“. Klickt man sodann auf das Google-Doodle, erhält man die Ergebnisse der Suchabfrage zu dem jeweiligen Begriff, wie sonst üblich.
Heute ist das zweite, sonst gelbe O in einer Art Glaskolben oder Kristallzylinder zu sehen, der sich nach oben hin verjüngt:
Auf dem Kolben ruht ein Hut mit breiter Krempe, den man aber auch als Halbkugel mit einer flachen Scheibe interpretieren könnte, oder als stilisierten Saturn mit seinen Mondringen, oder als unbekanntes Flugobjekt. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt – zumal uns diesmal kein Tooltip auf die Sprünge hilft.
Klickt man auf das Doodle, dann erhält man die Links zu den (zurzeit, nämlich um 10:00 Uhr MEZ) „ungefähr 49.000 Ergebnissen“ die sich mit der Frage befassen, was das ominöse Ding bedeuten soll, wobei diese Ausbeute nur die deutsche Google-Site betrifft. Auch in vielen anderen Ländern wird diskutiert und spekuliert, was es mit dem „rätselhaften Phänomen“, dem „Misteri inspiegabili ed insoluti“, dem „onverklaarbare verschijning“, dem „Fenómenos Inexplicáveis“ oder dem „Unexplained Phenomenon“ auf sich hat.
Hier die überraschende Lösung. Bei dem halbkugelförmigen Ding am Kopf des „Salzstreuers“ handelt es sich um ein stählernes Kunstobjekt, das sich auf dem Essener Ardeyplatz befindet, nur fünf Minuten von meiner neuen Wohnung entfernt (s. Titelbild). Schon immer haben die Bürger von Rellinghausen gerätselt, was sich wohl darunter befinden mag. Nun hat Google freundlicherweise dieses Rätsel gelüftet. Ein transparenter Kristall-Stalaktit reicht hier fünf Meter tief in den Boden. Eingeschlossen wie ein Insekt im Bernstein befindet sich darin ein O, das freilich auch als Null gelesen werden kann. Und wie hat kein anderer als Gottfried Wilhelm Leibniz die Null genannt? „… eine wunderbare Zuflucht des göttlichen Geistes – beinahe ein Zwitter zwischen Sein und Nicht-Sein.“ (Hier zit. nach Charles Seife: Zwilling der Unendlichkeit. Eine Biographie der Zahl Null. A. d. Am. v. Michael Zillgitt. Berlin: Berlin Verlag, 2000, S. 150.) – Das Rätsel ist also nicht mehr, was das auf dem Bild darstellt, sondern nur noch, warum Google es ausgerechnet heute doodelt.
Protected: Frischer Anschluss
Friday, 04. September 2009Rundgang (VIII)
Friday, 04. September 2009Mittlerweile haben wir unseren neuen Stadtteil wieder ein bisschen besser kennengelernt – nämlich statistisch. Am vergangenen Sonntag fanden ja in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt.
Das (nicht barrierefreie) Wahllokal für unseren Stimmbezirk, einen von vier in Rellinghausen, befand sich in der Albert-Einstein-Schule am Ardeyplatz (s. Titelbild). Dummerweise hatten wir unsere Wahlbenachrichtigungen nicht dabei und die Wahlhelfer hatten einige Mühe, uns Neubürger in ihrer langen Liste zu finden. Aber schließlich erhielten wir dann doch die drei Wahlzettel, einen für die Wahl des Oberbürgermeisters, einen zur Wahl des Stadtrates und einen zur Wahl der Bezirksvertretung.
Nachdem nun die Ergebnisse im Internet veröffentlicht sind, wissen wir, dass es zum Stichtag 3.060 Wahlberechtigte in unserem neuen Stadtteil gab, von denen sich rund 60 Prozent an diesen Wahlen beteiligt haben. Rellinghausen gehört zu jenen Stadtteilen, in denen der OB-Kandidat der CDU, Franz-Josef Britz, die Mehrheit der Stimmen für sich gewinnen konnte, allerdings relativ knapp gefolgt vom Kandidaten der SPD, Reinhard Paß, der stadtweit zum neuen Essener Oberbürgermeister gewählt wurde. Die Kandidatin der Grünen, Hiltrud Schmutzler-Jäger, erreichte in Rellinghausen nur knapp über fünf Prozent, sogar noch etwas weniger als Christian Stratmann von der FDP.
Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich auch aus den Zahlenverhältnissen der beiden anderen Wahlen. Rellinghausen ist ein politisch eher konservativ orientierter Stadtteil mit hohem Stimmanteil für die beiden großen Volksparteien: Zusammen bringen sie es auf gut drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen. Radikale Parteien wie die Republikaner, Die Linke oder die DKP sind weit abgeschlagen. Und die Freie Wählergemeinschaft des Essener Bürger-Bündnisses, die nach ihrer Gründung vor ein paar Jahren vom Zorn vieler Wähler auf den „roten Filz“ im Rathaus profitieren konnten, sinkt in unserem Stadtteil wie auch im übrigen Stadtgebiet zurück in die Bedeutungslosigkeit.
Interessant ist vielleicht noch folgende Berechnung. Die Einwohnerstatistik nach Stadtteilen (Stand: 30. September 2009) weist für Rellinghausen 3.628 Personen aus. Zieht man hiervon die 3.060 Wahlberechtigten ab, dann wohnen hier also 568 Menschen unter 16 Jahren. Dieser geringe Anteil von nur 15 Prozent entspricht aber dem Durchschnitt in Deutschland ziemlich genau.
Inspiration
Thursday, 03. September 2009Das zehnte Kapitel von Knut Hamsuns zweitem Roman, Mysterien, erzählt von einem Besuch des von aller Welt verspotteten und geschundenen Minute auf Nagels Zimmer, in dessen Verlauf sich der undurchschaubare Held dieses verwirrenden Buches, wie man so sagt: hoffnungslos betrinkt. (Knut Hamsun: Mysterien. A. d. Norw. v. J[ulius] Sandmeier. Nachw. v. Edzard Schaper. Zürich: Manesse Verlag, 1958, S. 200-230.)
Da der in jeder Hinsicht bescheidene Minute kaum einmal etwas sagt, besteht dieses starke Kapitel des Romans im Wesentlichen aus einem Monolog des Johan Nilsen Nagel, von dem der Leser an dieser Stelle immer noch nicht weiß, in welcher Angelegenheit er die kleine norwegische Küstenstadt besucht, ob er wirklich nur nach Entspannung sucht oder etwas Böses im Schilde führt, was er mit seinen vermeintlich „guten Taten“ bezweckt und so fort.
Anfangs sind die Ausführungen Nagels gegenüber seinem Schützling Minute noch halbwegs verständlich. Doch je mehr er dem Alkohol zugesprochen hat, desto fahriger wird seine Rede. Dieser schrittweise Zerfall der Stringenz seiner Rede, diese Zersetzung von Logik und Syntax, dieser allmähliche Übergang zu scheinbar völlig unzusammenhängenden Gedankenfragmenten gelingt Hamsun so gut, dass ich stellenweise den Verdacht hegte, er habe sich vorm Schreiben dieses Kapitels volllaufen lassen.
Es gibt ja durchaus dergleichen literarische Selbstversuche mit Rauschzuständen. So soll der Autor der Schatzinsel sich zu seiner vielleicht besten Novelle, der Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, durch exzessiven Koksgenuss anregen lassen haben: „Äußerst interessant ist eine Studie über Robert Louis Stevenson (1850-1894). Nach einer Analyse des amerikanischen Arztes Myron G. Schultz (1971) soll der weltberühmte englische Autor im Herbst 1885 Kokain als Medikament gegen seinen chronischen Katarrh erhalten haben. Die Droge wurde damals in der medizinischen Welt als Wundermittel gegen alle möglichen Krankheiten gefeiert und just zu jener Zeit erschien auch in der britischen Ärzteschrift The Lancet ein sehr positiver Artikel über die Wirkungen des Alkaloids. Schultz vermutet nun, daß Stevenson unter dem Einfluß dieser Droge sein bekanntestes Werk Dr. Jekyll and Mr. Hyde schrieb. Und zwar verfaßte er zwei Versionen des Buches innerhalb von sechs Tagen, eine unglaubliche Leistung, vor allem, nachdem er vorher lange Zeit äußerst unproduktiv gewesen war. Sowohl dieser physische und psychische Gewaltakt (der sehr für die Wirkung von Kokain spricht) als auch die Handlung des Romans sprechen für die aufgestellte Hypothese: Der Held der Erzählung verwandelt sich unter dem Einfluß eines Pulvers (!) über Nacht aus einem angenehmen, gütigen Zeitgenossen in einen bösartigen Unhold, der Menschen tötet. In dieser Verwandlung ist sehr plastisch der charakterzerstörende Effekt des Kokains bei anhaltendem Mißbrauch wiedergegeben.“ (Wolfgang Schmidbauer / Jürgen vom Scheidt: Handbuch der Rauschdrogen. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2004, S. 193 f.; vgl. Myron G. Schultz: The Strange Case of Robert Louis Stevenson; in: Journal of the American Medical Association 216, 1971, S. 90-94.)
Dass Knut Hamsun im Laufe seines langen Lebens häufig dem Alkohol zusprach und für einen langen Lebensabschnitt vermutlich gar als Alkoholiker bezeichnet werden darf, ist bekannt. Dass er den Alkoholrausch also nicht nur aus der unbeteiligten Betrachtung seiner besoffenen Zeitgenossen, sondern schon früh auch aus eigenem Erleben kannte, ist somit kaum bestreitbar. Und sein Biograph Ferguson teilt sogar mit, dass er sich bei der Niederschrift von Mysterien „Inspiration aus Sprit“ holte, wenn seine Arbeit ins Stocken geriet und sein Kopf sich anfühlte „wie ein abgehackter Fischkopf mit klaffendem Maul“, der einfach alle Denktätigkeit eingestellt hatte: „Wenn das eintrat, ließ er für gewöhnlich die Arbeit liegen und ging in die Stadt, setzte sich in ein Theater oder ging in eine obskure Bar etwas trinken.“ (Robert Ferguson: Knut Hamsun – Leben gegen den Strom. Biographie. A. d. Engl. v. Götz Burghardt. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992, S. 194.) – Vielleicht ist das zehnte Kapitel von Mysterien ja unmittelbar nach einem solchen Besuch in dieser obskuren Bar zustande gekommen, wer weiß?
Protected: Du tu dies, du das!
Wednesday, 02. September 2009Quasselknochen
Wednesday, 02. September 2009Endlich komme ich wieder dazu, alte Freundschaften zu erneuern, wenngleich vorläufig nur fernmündlich. Nachdem unsere Rufnummer infolge eines Wechsels des Anbieters geändert werden musste, liefen die Bemühungen einiger mir nahestehender Menschen, mit mir in Verbindung zu treten, wiederholt ins Leere, vorzugsweise natürlich jener, die den Austausch per E-Mail nicht zu ihren geläufigen Kommunikationstechniken zählen. Weil mir selbst dieser Informationsweg ganz selbstverständlich geworden ist, konnte es mir geschehen, dass ich diese „Anachronisten“ für ein Weilchen gar nicht mehr auf der Rechnung hatte. An alle Adressen in unserem Outlook-Sammelverteiler hatte ich eine knappe E-Mail mit unserer neuen Anschrift und Telefonnummer geschickt und irrigerweise angenommen, damit meine Pflicht getan zu haben. Daran sieht man, wie folgenreich es ist, wenn man an einer neuen Kommunikationstechnik, aus welchen Gründen auch immer, nicht teilnimmt. In letzter Konsequenz führt es wohl zur sozialen Isolation.
Ich selbst suche einen für mich maßgeschneiderten Mittelweg und entscheide nach gründlicher Prüfung von Fall zu Fall, welche „Werkzeuge“ ich für den Austausch von Informationen mit meinen Mitmenschen nutzen will und auf welche ich bewusst verzichte. Dabei bemühe ich mich, wo eben möglich auf zeitraubendes und nervtötendes Hightech-Spielzeug zu verzichten. Dass der Gebrauch der meisten dieser Gerätschaften stark suchtbildend ist – sonst wären sie ja nicht so erfolgreich –, das weiß ich zur Genüge und bin deshalb auf der Hut, bevor ich mich mit ihnen einlasse.
Sehr zum Erstaunen vieler besitze ich zum Beispiel noch immer kein Mobiltelefon. Während des Umzugs, als wir zeitweise weder in der „alten“ noch in der „neuen“ Wohnung einen Festnetzanschluss hatten und dauernd getrennt unterwegs waren, teils zwischen den beiden Wohnungen, teils auf dem Weg zu Baumärkten, Möbelgeschäften usw., da erwies es sich vorübergehend als ausgesprochen bequem und vor allem zeitsparend, dass mir meine Gefährtin ihr Zweithandy zur Verfügung gestellt hatte. Ich begann, mich an diesen vermeintlichen Luxus zu gewöhnen und erwog für eine kurze Zeit, mir selbst einen solchen Quasselknochen zuzulegen.
Dann machte ich mir aber doch rechtzeitig die Nachteile dieser Optionen bewusst: ständig auch unterwegs erreichbar zu sein und von überall her mit jedem Fernsprechteilnehmer in Verbindung treten zu können. Wollte ich das? Wenn ich entspannt und frohen Sinnes durch den Wald spazierte, dann riss mich urplötzlich dieses zunächst anonyme Klingeln aus meinem Wohlbehagen, das sich dann in einer Stimme personifizierte, die mich bat, einem meiner Söhne etwas auszurichten oder ein persönliches Treffen mit mir vereinbaren wollte oder mich fragte, ob ich vielleicht die Handynummer von diesem oder jener wüsste oder sich am Ende gar – tatsächlich? angeblich? – verwählt hatte. Selbst wenn das Telefonat selbst nur eine Minute gedauert hatte, brauchte ich anschließend eine Viertelstunde, bis ich diese Störung mental und emotional restlos verdaut und vergessen hatte.
Ich kenne den Einwand, dass man den Signalton eines Handys ja mit einem Tastendruck jederzeit abstellen kann. Aber tut man das? Es gelingt vielen Zeitgenossen ja nicht einmal, daran zu denken, wenn sie sich in ein Symphoniekonzert oder eine Kirche begeben. Schließlich läuft dieses „Auflautlosstellen“ des Apparates ja auch seinem Prinzip und seinem eigentlichen Anspruch ständiger Empfangsbereitschaft zuwider. Sicher, es gibt diese Momente, wo ich vorm Supermarktregal stehe und mich frage, ob ich meiner Gefährtin Johannisbeer- oder Brombeermarmelade mitbringen sollte. Jetzt wäre es doch so einfach, diese Frage mit einem kurzen Handytelefonat zu klären. Aber dagegen stehen etliche andere Momente, in denen ich unterwegs von Anrufern gestört würde. Und die Zeit, in der ich unterwegs bin, empfinde ich auch deshalb als eine angenehme, weil ich dabei eben gerade vor Störungen dieser Art sicher bin. Es reicht doch schon, wenn daheim jederzeit das Telefon klingeln kann, oder? – Immerhin, dort leiste ich mir schon seit Urzeiten einen schnurlosen Quasselknochen (s. Titelbild).
Anarchie!
Tuesday, 01. September 2009Ich war so um die sechzehn Jahre alt, als ich zum ersten Mal erkannte, wie Sprache manipuliert und zur Manipulation instrumentalisiert werden kann, wie durch Um- und Entwertung von Begriffen politische Gegner diskreditiert, marginalisiert oder gar kriminalisiert werden, wie durch penetrante Wiederholung von falsch verwendeten Wörtern deren Sinn schließlich völlig entstellt, ja geradezu ins Gegenteil verkehrt wird. Das so facetten- wie lehrreiche Beispiel, an dem sich all dies aufzeigen durchschauen ließ, was das Wort „Anarchismus“.
Die politischen Gewalttäter um Andreas Baader und Ulrike Meinhof, die sich in der Roten Armee-Fraktion (RAF) formiert hatten, um durch Banküberfälle, Sprengstoffattentate, Entführungen und zuletzt Mordanschläge die BRD unter Druck zu setzen, wurden erst lange Zeit in den bürgerlichen Medien allgemein als „Anarchisten“ bezeichnet, bevor sich schließlich der bis heute gültige Begriff „Terroristen“ durchsetzte, der dann freilich für gewalttätige Untergrundarmeen jeglicher Couleur Verwendung fand und findet.
Sehr bald fand ich heraus, dass die RAF mit den Zielen des klassischen Anarchismus wenig gemein hatte, vielmehr sowohl in ihren Vorstellungen von der „Zeit nach dem Sieg“ als auch im Verhalten untereinander während des bewaffneten Kampfes viel eher stalinistische Züge aufwies. Betrachtete man von der anderen Seite her den Anarchismus seit Michail Bakunin, dann fielen zwar einige terroristische Taten ins Auge, die die Zeitgenossen schockierten und die bis heute in den Geschichtsbüchern stehen. Doch kann kein unvoreingenommener Betrachter mit Blick auf das ganze Phänomen dieser politischen Geistesrichtung zu dem Ergebnis kommen, dass terroristische Gewalt einen bedeutenden Wesenszug des Anarchismus ausmacht oder gar mit diesem identisch ist.
Idee, Geschichte und Perspektiven des Anarchismus hat einer seiner besten Kenner der neueren Zeit, Horst Stowasser, vor zwei Jahren in einem Standardwerk zum Thema, zugleich seinem Lebens-Hauptwerk, auf 500 Seiten erschöpfend dargestellt. (Anarchie! Hamburg: Edition Nautilus / Verlag Lutz Schulenburg, 2007.) Wer in unseren langweilig perspektivlosen Zeiten, in denen selbst Träume nur noch gegen Eintrittsgeld zu haben sind, eine Ahnung von den Lüsten des politischen Utopismus gewinnen will, dem sei dieses Buch wärmstens ans Herz gelegt. Eine kleine Kritik kann ich mir nicht verkneifen: dass die Gewaltfrage, die doch auch den Anarchismus lange beschäftigt hat, bei Stowasser nahezu völlig ausgeklammert wird. Als ich im Zusammenhang mit meiner Pynchon-Lektüre über das Bombenattentat am Chicagoer Haymarket recherchierte, verwunderte mich, dass dieses Ereignis in Anarchie! überhaupt nicht vorkommt. Das Kapitel über den „Anarchismus und die Bombe“ (S. 315-326) ist leider das schwächste des sonst so leidenschaftlichen und gehaltvollen Buches.
Den Verdiensten des Autors um die theoretische und praktische Wiederbelebung des Anarchismus in unserer Zeit und in diesem Land tut das aber keinen Abbruch. Horst Stowasser ist heute im Alter von nur 58 Jahren in Neustadt an der Weinstraße gestorben.
Pushkids (V)
Tuesday, 01. September 2009Wenn ich aus der sicheren Distanz mehrerer Wochen und nach dem zwischenzeitlichen Hinaustragen von drei Müllbeuteln auf den Augenblick der Wahrheit zurückschaue, dann vermag ich die verschiedenen Faktoren, die zu meiner (oder unserer?) Entscheidung führten, vermutlich nicht mehr vollständig aufzuzählen, geschweige denn exakt zu gewichten.
Nicht unwesentlich war der optische, akustische, haptische Eindruck, den schließlich ein knallroter 22-Liter-Baseboy auf mich machte. Endlich einmal ein reales Exemplar jener unüberschaubar großen Produktfamilie aus dem Hause Wesco vor mir zu sehen, statt immer bloß Popup-Bildchen aus dem Internet, das war vielleicht kein sonderlich überzeugendes Kaufargument für gerade dieses Exemplar, vermittelte aber doch offenbar einen ausreichend starken Kaufimpuls, um 169 Euro locker zu machen – und dazu noch 3,50 Euro für zwanzig Original-Müllbeutel der Nobelmarke.
Zu diesem dann mich selbst überraschend schnellen Entschluss kam es wohl auch deshalb, weil mir das ergebnislose Hin und Her, das Abwägen von Für und Wider, das wenig zielführende Spekulieren über Eventulaitäten, Risiken, Vor- und Nachteile schließlich ganz furchtbar auf den Wecker ging. Verdammt noch mal, ich war die fliegenumwölkten Provisorien an der Türklinke leid!
Jetzt steht „the brave fireman“, wie ich unseren Wesco mittlerweile getauft habe, brav auf seinem Stammplatz zwischen der Schlachtbank und Lolas Näpfen, sagt kein Wort, klappt per Fußtritt mühelos auf, bedarf zum Zuklappen aber eines leichten Kläpschens mit der Hand, muss nur einmal pro Woche geleert werden und gibt sich auch mit No-Name-Müllbeuteln problemlos zufrieden.
Mit anderen Worten: Dafür, dass wir uns vor seiner Anschaffung so lange geziert haben, erweist sich „the brave fireman“ als ein überaus genügsamer und diensteifriger Mitbewohner.