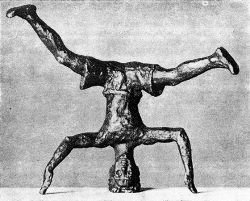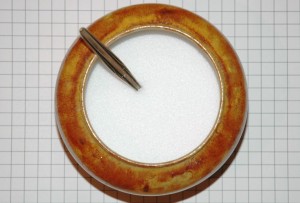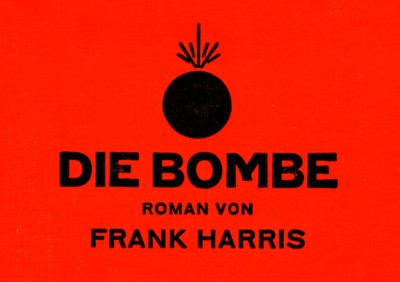Vom 11. bis zum 30. Oktober findet in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn der Kampf um die Schachweltmeisterschaft zwischen dem amtierenden Weltmeister, dem 38-jährigen Inder Viswanathan Anand (ELO 2783), und seinem Herausforderer, dem 33-jährigen Russen Wladimir Kramnik (ELO 2772), statt. Am gleichen Ort verlor Kramnik Ende 2006 in einem auf sechs Partien festgesetzten Wettkampf gegen das Schachprogramm Deep Fritz, nachdem ihm in der zweiten Partie der „Patzer des Jahrhunderts” (Susan Polgar) unterlaufen war: zum Wahnsinnigwerden.
Foster Wallace zitiert in seinem Buch über den Mathematiker Georg Cantor (1845-1918) den englischen Schriftsteller G. K. Chesterton: „Dichter werden nicht verrückt, Schachspieler schon. Mathematiker werden verrückt und Kassierer, schöpferische Künstler sehr selten. Ich wende mich nicht gegen die Logik: Ich sage nur, dass diese Gefahr [verrückt zu werden] in der Logik, nicht in der Vorstellungskraft liegt.” (David Foster Wallace: Georg Cantor. Der Jahrhundertmathematiker und die Entdeckung des Unendlichen. München: Piper Verlag, 2007, S. 12.)
Anand hat gerade der verbreiteten Auffassung widersprochen, dass professionelle Schachspieler unverhältnismäßig häufig im Wahnsinn enden: „Man braucht ein Leben abseits des Schachs, dann besteht keine Gefahr. Man muss sich andere Interessen bewahren. Wirklich krank wurden nicht so viele. Nur werden diese Fälle gleich einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Bestimmt gibt es ebenso viele verrückte Ärzte oder Busfahrer.” (Ansbert Kneip u. Maik Großekathöfer: „Schach ist Schauspielerei”. Interview mit Viswanathan Anand; zit nach: Spiegel online, 29. September 2008.)
Na, ich weiß nicht. Zumindest nach der Lektüre des Standardwerks zum Thema, von dem erstklassigen Schachspieler (ELO 2762) und Psychoanalytiker Reuben Fine (1914-1993), kommt man zu einem anderen Ergebnis. Abgesehen davon, dass etliche Großmeister des Schachspiels einen ausgeprägten Hang zum Größenwahn bis hin zu Allmachtsphantasien hatten, was man noch mit ihrem unvermeidlichen Weltruhm entschuldigen mag: Die Liste der verrückten Meister auf den 64 Feldern ist lang. Paul Morphy und Wilhelm Steinitz litten unter psychotischen Wahnvorstellungen. Auch Aaron Nimzowitsch und Akiba Rubinstein zeigten gelegentlich ein, gelinde gesagt, auffälliges Verhalten. Ersterer machte neben dem Schachbrett Kopfstandübungen, Rubinstein sprang aus dem Fenster, wenn er sich von einem Zuschauer bei einer Partie „verfolgt” fühlte. José Raúl Capablanca litt unter Donjuanismus, der paranoide Antisemit Alexander Aljechin war ein ausgesprochener Sadist und verfiel dem Alkohol, ebenso wie Joseph Henry Blackburne, genannt „the Black Death”. Und in neuerer Zeit hat Bobby Fischer mit seinen zahllosen Spleens am Schachbrett und mit seinen abstrusen politischen Ansichten diese Ahnenreihe der Schachverrückten würdig fortgesetzt. (Vgl. Reuben Fine: Die Psychologie des Schachspielers. A. d. Am. v. Reinhard Kaiser. Frankfurt am Main: Syndikat Autoren- und Verlagsgesellschaft, 1982.)
Zugegeben: Es gibt auch namhafte Gegenbeispiele, großartige Schachspieler, die zeitlebens bei völliger geistiger Gesundheit auf höchstem Niveau spielten, daneben ein ausgeglichenes Familienleben pflegten und sogar einem bürgerlichen Beruf nachgingen, wie etwa Adolf Anderssen, Max Euwe, Siegbert Tarrasch oder Emanuel Lasker. Ich schlage zwischen den beiden Standpunkten folgende argumentative Rochade vor: Man muss nicht verrückt sein, um Schachweltmeister zu werden; aber man läuft Gefahr, verrückt zu werden, wenn man das Schachspiel zu seinem einzigen Daseinsmittelpunkt macht.
[Titelbild: Joseph Henry Blackburne. Karikatur aus Vanity Fair.]