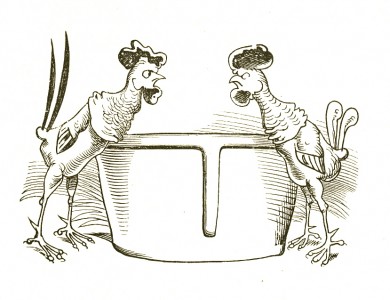Das Angebot von Schach-Periodika in deutscher Sprache hat sich im Zuge der Pressekonzentration deutlich reduziert. Heute gibt es vor allem noch Schach – Deutsche Schachzeitung aus dem Berliner ExzeLsior-Verlag, deren Anfänge bis 1947 zurückreichen; das Schach-Magazin 64 vom Schünemann-Verlag in Bremen; und Rochade Europa aus dem thüringischen Sömmerda. Während einstmals renommierte Blätter (wie Schach-Echo, Deutsche Schachblätter, Deutsche Schachzeitung, Der Schachspiegel und die Wiener Schachzeitung) auf der Strecke geblieben sind bzw. von den vorgenannten Schachorganen „geschluckt” wurden, gab es aber seither auch einige wenige Neugründungen, die abseits der üblichen Themen – Turnierberichterstattung, Meldungen aus dem Vereinsleben, Abdruck kommentierter Partien und von Schachkompositionen – inhaltlich nach neuen Wegen suchten.
Das Prunkstück unter diesen Newcomern ist zweifellos KARL – Das kulturelle Schachmagazin, das seit 2001 viermal jährlich in Frankfurt am Main erscheint. Jedes Heft, reich bebildert und auf Hochglanzpapier gedruckt, widmet sich einem Schwerpunktthema, das in mehreren ausführlichen Beiträgen von verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Mal werden reizvolle historische Gegenstände beleuchtet, wie das berühmte Café de la Régence als Mittelpunkt der Schachszene im Paris des 18. und 19. Jahrhunderts, oder die Geschichte des Blindschachs. Andere Hefte stellen einen der großen Meister der Vergangenheit in den Fokus, so Emanuel Lasker oder Aaron Nimzowitsch. Aber auch zentrale Themen der Schachtheorie, wie das Tempo, das Spiel aus der Defensive oder die Rolle des Zufalls im Schachspiel wurden schon eingehend gewürdigt.
Ich kann ein Abonnement dieses ebenso vielseitigen, anregenden wie kompetenten Schachmagazins nahezu ohne Einschränkung jedem Schachbegeisterten, ob Laie oder Vereinsspieler, nur wärmstens ans Herz legen, so er sich denn nicht bloß für die neuesten Erkenntnisse der Eröffnungstheorie interessiert und über den Rand des Brettes mit den 64 Feldern hinausblicken möchte. Eine kleine Mäkelei kann ich mir leider dennoch nicht verkneifen: KARL bedarf dringend eines gründlichen Korrektors. Die sprachlichen Schludrigkeiten unterbrechen den Lesegenuss auf nahezu jeder Seite. Ein Beispiel nur! In einer Bildunterschrift lese ich den Titel zu einer doch so schönen Tuschezeichnung von Helmut Toischer: „Schwarzer König kann Umwandlung des Bauers [!] nicht verhindern” (Heft 4/2006, S. 5). Es darf doch nicht sein, dass ein Schachmagazin, das sich sonst mit vollem Recht „kulturell” nennt, nicht weiß, wie man den Bauern dekliniert. Dieser Bauer war vergiftet – und „des Bauers” falscher Genitiv macht mich giftig.
Bevor ich durch den Wikipedia-Artikel über KARL eines Besseren belehrt wurde, fragte ich mich, woher dieses Magazin denn eigentlich seinen Namen hat. War er gedacht als Analogon zu Fritz, dem prominentesten Schach-Computerprogramm unserer Zeit? Diese Erklärung schien mir etwas dürftig, und so kam mir ein Gedankenblitz. Vielleicht ist KARL ein Akronym für die Instruktion: „König am rechten Läufer!”. Bekanntlich haben Anfänger ja beim Aufstellen der Figuren oft das Problem, auf welche Felder sie König und Dame stellen sollen. Dem Weißen könnte diese Eselsbrücke bei der Positionierung seiner beiden zentralen Figuren hilfreich sein – und der Schwarze müsste dann nur noch wissen, dass er seinen König und seine Dame vis-à-vis aufzustellen hat. Stattdessen teilt Herausgeber und Chefredakteur Harry Schaack mit, dass KARL vielmehr ein Akronym für „Kommunikation, Ansichten, Realitäten und Lorbeerkränze” sei – und zudem der Vorname eines Klubmitglieds der Schachfreunde Schöneck, aus deren Vereinszeitschrift dieses Magazin ursprünglich hervorging.
Ein Jahresabonnement von KARL, das es neuerdings auch in einer englischsprachigen Parallelausgabe gibt, kostet inkl. Porto 20,00 €, das Einzelheft am Kiosk 5,50 €. – Alle alten Hefte (bis auf drei) sind beim Verlag noch lieferbar.
[© Titelbild: Alltagsszene im Régence; aus: KARL 4/2006, S. 19.]