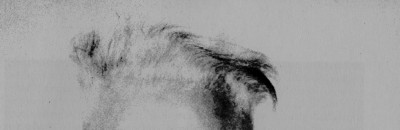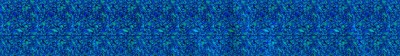Zum Abschied von diesem Jahr muss ich meine größte, wichtigste Entdeckung dieses Jahres noch einmal zum Ausdruck bringen: die immer und überall unterschätzte destruktive Macht im Menschen, die ihn entweder vernichtet oder zu schrecklichen Taten treibt, die ihn über seine Verhältnisse leben, die Natur und damit seine Lebensgrundlagen zerstören lässt und deren so harmlos, schlicht, fade klingender Name da lautet: Langeweile! Natürlich bin ich nicht der Entdecker dieser unterschätzten und noch längst nicht ans Ende, oder besser: zu allen ihren Enden hin ausgedachten Erkenntnis. Zur Feier des Tages zitiere ich hier als einen frühen Gewährsmann Pascal: „Langeweile. Nichts ist dem Menschen unerträglicher als völlige Untätigkeit, als ohne Leidenschaften, ohne Geschäfte, ohne Zerstreuungen, ohne Aufgabe zu sein. Dann spürt er seine Nichtigkeit, seine Verlassenheit, sein Ungenügen, seine Abhängigkeit, seine Unmacht, seine Leere. Allsogleich wird dem Grunde seiner Seele die Langeweile entsteigen und die Düsternis, die Trauer, der Kummer, der Verdruß, die Verzweiflung.“ (Über die Religion und über einige andere Gegenstände (Pensées). A. d. Frz. v. Ewald Wasmuth. Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1978, S. 75.) – Aber wer verstünde mich, wenn ich bekennen würde, dass ich das neue Jahr 2012 einer genaueren Untersuchung der Langeweile, ihrer Ursachen und Folgen widmen will?
Archive for December, 2011
Langeweile. Nichts …
Saturday, 31. December 2011Schwindende Verstörung
Friday, 30. December 2011Manchmal erweist es sich als Vorteilhaft, noch ein paar mehr Bücher griffbereit zu haben als den engsten Kreis der dringlichst benötigten, die Tausendschönsten. In den letzten Tagen war ich wieder mit der bibliographischen Erfassung von Serien für mein Antiquariats-Angebot befasst, genauer gesagt mit der Reihe der Suhrkamp-Taschenbücher, die seit 1971 erscheinen. Heute stieß ich dabei in einem Tagebuch von Peter Handke auf Notizen aus seinem Pariser Krankenhausaufenthalt vom März 1976. Obwohl mich Handkes manierierte Prosa noch nie recht begeistern konnte, las ich doch diese Seiten mit einigem Interesse, Stellenweise gar mit Anteilnahme. Die Erklärungen für diese unübliche Empathie sind schnell bei der Hand. Einmal stehe ich, gerade acht Wochen nach meiner Klinikentlassung, noch immer unter dem wenngleich verblassenden Eindruck dieses Erlebnisses und finde in Handkes Schilderungen manche Ähnlichkeit zu eigenen Beobachtungen und Empfindungen. Hinzu kommt, dass ein mir sehr nahestehender Mensch neuerdings von dem gleichen Leiden betroffen ist, das zu Handkes Klinikeinweisung geführt hat. Ja, es ist seltsam, wie fremd man empfindet, wenn man aus einer solchen Angst zurück in die dumpfe Sorglosigkeit gestoßen wird: „An diesem schönstmöglichen Tag der Welt gehe ich, aus dem Krankenhaus weggelassen, umher mit dem Gefühl(?), ich hätte nichts versäumt, wenn ich jetzt tot wäre.“ Mir fiel heute auf einem gewohnten Weg, den ich wenige Tage nach meiner Entlassung beim erstmaligen Beschreiten voller Entzücken neu sah, dieses nun uneinholbar verlorene Glück wieder ein. Ein solcher Verlust! Und ich erinnere mich – aber auch das ist vergangen – an dieses verschobene Verhältnis zu den fremden Mitmenschen in den Straßen, wie es Handke offenbar ähnlich (und doch ganz anders) empfand: „Seltsam: daß ich es unter den jungen, übermütigen, ausgelüfteten, luftigen, lebenslustigen Menschen am Boulevard nicht mehr aushielt – und daß ich mich hier, im Park, unter Älteren, Müderen, Frauen mit Pudeln, Sitzenden auf den verrosteten grünen Eisenstühlen, Kindern, so viel wohler fühle!“ (Das Gewicht der Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1979, S. 90 f.) Kann man denn von einer solchen Erschütterung nicht mehr bewahren als ein paar spröde Zeilen und ein blasser werdendes Erinnern?
Lebens Zenit
Thursday, 29. December 2011Ein anderer Mann, für den ich früh allerhöchste Verehrung empfand und der im Laufe der Jahre nur immer noch in meiner Achtung stieg, ist Bertrand Russell. In seiner Autobiographie beschreibt er, wie er im Alter von gerade einmal 28 Jahren seinen großen intellektuellen Durchbruch erlebte: „Meine Empfindungen ähnelten denen, die einen überkommen, wenn man im Nebel einen Berg erklettert, bei Erreichung des Gipfels den Nebel plötzlich weichen und das Land auf fünfzig Kilometer im Umkreis klar vor sich liegen sieht.“ Solche Gefühle hatte ich ebenfalls, aus vermutlich viel geringerem Anlass, in meiner Kindheit. Allerdings waren sie nicht Ergebnis einer geistigen Anstrengung, sondern überkamen mich eher impulsiv. Plötzlich begriff ich etwa, dass alle Dinge immer herabfielen, wenn ich sie losließ, und dass dies doch eigentlich nicht selbstverständlich war. Oder ich entdeckte, dass mein Spiegelbild das gleiche tat wie ich, und zwar exakt gleichzeitig. Aber natürlich meint Lord Russell hier einen viel erhabeneren Erkenntnisschritt, wenn er fortfährt: „Intellektuell war der September 1900 der Höhepunkt meines Lebens. Ich sagte mir dauernd selbst vor, jetzt endlich hätte ich etwas geleistet, was der Mühe wert war, und auf der Straße meinte ich, ich müsse jetzt ganz besonders aufpassen, nicht überfahren zu werden, ehe ich das zu Papier gebracht habe.“ Genau diese Sorge ist mir ebenfalls vertraut. Sie betraf gewisse Einsichten, die mich unter dem Einfluss psychotroper Substanzen beschlichen hatten. Allerdings genügte es mir, sie einigen vertrauten Mitmenschen mündlich mitzuteilen, was ich heute sehr bedaure. Der absolut nüchterne Bertrand Russell hingegen war so viel klüger und fleißiger als ich: „Anfangs Oktober machte ich mich daran, The Principles of Mathematics niederzuschreiben, wozu ich schon mehrfach erfolglose Versuche unternommen hatte. […] Während der Monate Oktober, November und Dezember schrieb ich jeden Tag meine zehn Seiten, so daß das Manuskript am letzten Tag des Jahrhunderts beendet war […].“ (Autobiographie I. 1872-1914. A. d. Engl. v. Harry Kahn. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1977, S. 223 f.) Nein, solch edlen Höhepunkt meines Lebens, noch dazu mit präzisem Timing zur Jahrhundertwende, vermag ich nicht vorzuweisen. Ich bin wohl eher ein Mensch der Ebene denn ein Gipfelstürmer. Mir reicht es schon, wenn ich alltäglich einen kleinen geistigen Hüpfer machen kann. Und wenn es mir dann noch gelingt, ihn leidlich auf die Zeile zu bringen, dann bin ich froh.
Common Little Man
Wednesday, 28. December 2011Kaum jemand dürfte in seinen Jugendjahren einen solch übermäßigen Verschleiß von Vorbildern, Idolen, Vaterfiguren gehabt haben wie ich. Zwischen meinem sechzehnten und meinem neunzehnten Lebensjahr wechselte ich meine Hausgötter wie die Socken, meist trug ich mehrere gleichzeitig nebeneinander oder übereinander, teils in beißender Kombination. Und so innig ich jeden von ihnen liebte und verehrte, wenn ich gerade in frischer Liebe entbrannt war, so abgeschmackt und peinlich fand ich ihn bald darauf, wenn ich seine Schwächen und Begrenzungen erkannt zu haben meinte. Die Halbwertzeiten dieser Idolatrien wurden immer kürzer, meine Ansprüche an die Exzentrik meiner Vordenker immer strenger. – Wenn ich heute an diese Zeit der Unreife zurückdenke, ist Scham das vorherrschende Gefühl. Aber ein paar Namen kann ich heute noch nennen, ohne rot zu werden. Einer von ihnen ist Wilhelm Reich, von dem ich mich so unmittelbar angesprochen und durchschaut fühlte wie von kaum einem seiner Konkurrenten: „Ich sage dir, kleiner Mann: Du hast den Sinn für das Beste in dir verloren. Du hast es erstickt, und du mordest es, wo immer du es in anderen entdeckst, in deinen Kindern, deiner Frau, deinem Mann, deinem Vater und deiner Mutter. Du bist klein und willst klein bleiben, kleiner Mann.“ (Rede an den kleinen Mann. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1984, S. 31.) Bei aller Bizarrerie seiner Wolkenkanonen und Orgonakkumulatoren scheint mir Reich noch heute geadelt durch den Hass und die Verfolgungen, dener er seitens seiner Gegner ausgesetzt war. Wozu diese Hartnäckigkeit, dieser Vernichtungszwang gegen einen harmlosen Irren? Und noch heute komme ich nicht darüber weg, wie klar er selbst seinen Untergang prophezeit hat, ohne darüber doch jede Hoffnung aufzugeben: „Was immer nun du mir angetan hast oder noch antun wirst, ob du mich als Genie verklärst oder als Wahnsinnigen einsperrst, ob du mich nun als deinen Retter anbetest oder als Spion hängst oder räderst, früher oder später wirst du aus Not begreifen, daß ich die Gesetze des Lebendigen entdeckte und dir das Handwerkszeug gab, dein Leben mit Willen und Ziel zu lenken, wie du bisher nur Maschinen lenken konntest.“ (Ebd., S. 124.)
Krieg verbindet
Tuesday, 27. December 2011Am 30. März 1974 schreibt Peter Weiss, unterwegs zu Recherchen in Spanien, in sein Notizbuch: „Es gibt immer viel mehr, was die Menschen verbindet, als was sie trennt. Warum dann Krieg? Immer viel mehr verständnisvolle Menschen als rohe. Warum dann diese Destruktion?“ (Notizbücher 1971-1980. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981, S. 298.) Ich stutze. Stimmt das? Wie soll ich den Wahrheitsgehalt dieser Sätze prüfen? Ich vergleiche ihren Gehalt mit meinen eigenen, ganz persönlichen Erfahrungen. Wenn ich fremde Menschen kennenlerne, dann empfinde ich sie vielmehr immer als haupsächlich anders. Nach Gemeinsamkeiten, die mich mit ihnen verbinden, muss ich lange suchen. Und wenn ich mich bemühe, mich ihnen verständlich zu machen, dann gelingt mir dies eher selten. – Aber vielleicht war Weiss ja ein ganz anderer Mensch als ich? Ich muss sogar gestehen, dass ich nahezu täglich, wenn ich mich unter die Menschen mische, beim Einkaufen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder einfach auf der Straße, eine Rohheit wahrnehme, die mich verschreckt und die mein Verständnis überfordert. Allerdings sehe ich auch, dass die Menschen durch viele Gemeinsamkeiten einander immer ähnlicher zu werden scheinen; mir jedoch werden sie so immer fremder und bedrohlicher. Kann es sein, dass der Schriftsteller in seinem schwedischen Exilidyll ganz weltfremd geworden war? Mögen immerhin seine subjektiven Empfindungen von den braven Mitmenschen wahrhaftig gewesen sein – aber wie kann ein Intellektueller, der vom dialektischen Materialismus geprägt war, die Wirklichkeit des Krieges aus der Perspektive subjektiver Empfindungen in Frage stellen? Sehr sonderbar.
[wird fortgesetzt]
Monday, 26. December 2011Seit einer gefühlten Ewigkeit wartete ich auf die Fortsetzung von Wolfgang Herrndorfs Blog Arbeit und Struktur. Der letzte Eintrag war vom 19. November und berichtete in vier Sätzen von einem Besuch des Films Cheyenne mit Kathrin Passig und einem anschließenden traurigen Gespräch über gemeinsame Urlaube. Das letzte Wort war „gescheitert“. Tag für Tag klappte ich in den vergangenen Wochen, gleich nachdem der Rechner hochgefahren war, Kapitel Einundzwanzig auf, immer wieder dieser letzte Absatz mit Cheyenne und „gescheitert“. Darunter die Ankündigung, Versprechung: „[wird fortgesetzt]“. Dabei fürchten wir treuen Besucher dieser Seite doch alle, dass irgendwann hier noch für eine solche gefühlte Ewigkeit „[wird fortgesetzt]“ stehen wird, obwohl der Blogger seinem Glioblastom erlegen ist. Ich ertappte mich dabei, sicherheitshalber immer mal wieder auf Wikipedia nachzuschauen. Nein, er lebt noch! Heute nun kamen gleich vier Tagesnotizen, vom 20. bis zum 25. November, für die eigens ein neues Kapitel Zweiundzwanzig aufgemacht wurde. Wichtigste, erfreuliche Neuigkeit: H. erfährt im Abschlussgespräch nach seiner letzten Bestrahlung vom Arzt, dass er noch zehn bis zwölf Monate Aufschub erwarten darf, bis zum nächsten Rezidiv. – Ich fragte mich eben, ob ich hier überhaupt schon von meiner zweiten, intensiveren Begegnung mit dem Werk des Wolfgang Herrndorf berichtet habe. Die Suche nach seinem Nachnamen ergab aber nur einen einzigen Beleg. Vor fast genau einem Jahr hörte ich im Rundfunk eine überaus positive Besprechung seines Bestsellererfolgs Tschick, der mir aber erst durch einen besonderen Zufall so merkwürdig wurde, dass ich ihn wenig später kaufte und dann auch las. Die beiden jugendlichen Ausreißer brechen dort in eine gelobte Fremde auf, für die sie mangels konkreter Vorstellungen den Namen Walachei einsetzen. Und eben diese Walachei tauchte auch in einer 200 Jahre alten Ausgabe der Berliner Abendblätter auf, die anlässlich des bevorstehenden Kleist-Jahres gerade Tag für Tag online publiziert wurde und die ich gleichzeitig las. Ich wollte die Stelle bei Tschick genau zitieren und kaufte darum später das Buch. Nun lese ich Herrndorfers neues Buch Sand, über das ich erst urteilen will, wenn ich damit durch bin. – Sein Weblog jedenfalls ist stellenweise großartig, voller Tragik und Humor!
Sammlers Bescheidenheit
Sunday, 25. December 2011In den letzten Jahren habe ich das Interview als eine vollwertige literarische Kunstform entdeckt; was natürlich keineswegs bedeutet, dass nun Interviews, wie sie mit den langweiligen Prominenzen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltungsindustrie geführt und alltäglich in den Zeitungen und Magazinen veröffentlicht werden, per se schon Kunstwerke sind, die die Beachtung einer gebildeten Leserschaft und die Beurteilung der professionellen Kritik verdienten. Aber es gibt doch in diesem ohrenbetäubenden Allerweltspalaver immer wieder einmal Kleinodien des Gesprächs, der Befragung, die es verdienen, in eine Textsammlung der literarischen Meisterwerke aller Gattungen und Sprachen aufgenommen zu werden. Einige Interviews des im April dieses Jahres gestorbenen André Müller sind darunter; manche in der New Yorker Literaturzeitschrift Paris Review erschienene Autorengespräche; und viele verstreut veröffentlichte Einzelstücke, die ich hier und dort im Laufe von Jahrzehnten zusammengetragen habe, eine Sammlung, die es dringend nötig hat, gesichtet und ausgedünnt zu werden. Unbedingt würde ich die Gespräche hinzurechnen, die Osvaldo Ferrari 1984 bis 1986 in Genf mit Jorge Luis Borges geführt hat. Leider gibt es bisher nur eine Auswahl in deutscher Übersetzung (von Gisbert Haefs). Natürlich müssten aber auch Interviews mit jenen Unbekannten vertreten sein, die weniger durch ihren erlauchten Geist, durch ihre Beiträge zu Kunst und Wissenschaft unser Interesse verdienen, sondern allein durch das wahrhaftige Bekenntnis zu ihrem einfachen Leben, mit einem Wort: durch ihre Authentizität. Hier denke ich an Hubert Fichtes Interviews aus dem Palais d‘Amour oder die langen Interviews per brieflicher Befragung, die Paul Moor mit Jürgen Bartsch im Gefängnis geführt hat, um nur zwei Beispiele zu nennen, die mich nachhaltig geprägt haben. Natürlich gehören auch Verhöre hinzu, die Befragungen von Tätern und Zeugen vor Gericht. Zuletzt würde vielleicht ein tausendstimmiges Oratorium aus Fragen und Antworten dabei herauskommen, zwischen Himmel und Hölle, ohne Anfang und Ende. Alles Gerede mündete dann in diesen einen polyphonen Gesang, wie Mallarmé erklärt hat: „Tout au monde existe pour aboutir à un livre“, was Borges 1951 zum Motto seines Essays Vom Bücherkult machte, woran ihn Ferrari in einem seiner Interviews erinnerte. (Vgl. Lesen ist denken mit fremdem Gehirn. Zürich: Arche Verlag, 1990, S. 89.) – Vielleicht hätte ich mich doch mit dem ehrbaren Handwerk des Anthologisten bescheiden sollen, statt mich dazu berufen zu fühlen, selbst zu schreiben?
Herr und Frau N.
Saturday, 24. December 2011Vielleicht ist ja die zukunftsträchtigste Ausbeute des zu Ende gehenden Jahres unsere gemeinsame Idee zu einem Figurentheater. Sie wurde erst vor wenigen Wochen auf einem Waldspaziergang geboren. Der Plan sieht vor, dass nur zwei Puppen, Herr N. und Frau N., auf der Bühne agieren; ein älteres Ehepaar, das uns beide verkörpert, aber natürlich ins Maskenhafte übertrieben. Wir entwickeln eine Vielzahl von kurzen Szenen, die nahezu beliebig zusammengestellt werden können. Vorstellbar ist, dass es Szenen für reines Kinderpublikum und solche für Erwachsene gibt, aber auch einige, die sich für eine gemischte Zuschauerschar eignen. Die Kulisse ist immer dieselbe: das Interieur einer guten Stube mit Koch- und Schlafgelegenheit. Ein Fenster öffnet den Blick zur Außenwelt. Die Puppen sollten vielleicht Marionetten sein, weil diese mehr Bewegungsmöglichkeiten bieten als Hand- oder Stabpuppen. Damit stehen wir allerdings rein technisch vor einer anspruchsvollen Aufgabe, denn auf diesem Feld sind wir absolute Neulinge. – Eben da ich dies schreibe fällt mir ein, dass wir unsere Szenen natürlich auch peu à peu bei YouTube online stellen könnten. Die Aufgabenverteilung entspricht unseren Kompetenzen. Ich entwickle die Dramaturgie, schreibe die Dialoge, meine Gefährtin ist für die Puppen, die Kulissen, das Interieur zuständig. Aber natürlich wird das gesamte Projekt in erster Linie ein Gemeinschaftswerk, bei dem wir uns gegenseitig anregen und voranbringen. Ach, welch zauberhafter Traum!
Zufall fleischgeworden
Friday, 23. December 2011In den letzten Wochen plagte mich erneut der Gedanke, nun vielleicht doch ein wenig Zeit darauf zu verwenden, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Aber warum? Weil ich zufällig wieder einmal in dem so sehr erheiternden Buch von Luke Rhinehart gelesen hatte, das ich vor 37 Jahren entdeckte und das meinen Lebensgang wenn nicht bestimmt, so doch in einem kleinen, aber feinen Moment beeinflusst hat. Und dort steht gleich im Vorwort der Satz: „Ich erzähle meine Lebensgeschichte aus jenem bescheidenen Grund, der bisher noch jeden Autobiographen zur Arbeit gedrängt hat: der Welt zu beweisen, daß ich ein großer Mann bin.“ (Der Würfler. A. d. Am. v. Franz Scharpfender. Wien, München, Zürich: Verlag Fritz Molden, 1972, S. 10.) Na, so bescheiden wie Rhinehart bin ich gerade nicht. Ich würde verlangen, dass ich mir durch das Aufschreiben meiner Lebensgeschichte selbst beweisen könnte, mein Leben nicht verfehlt zu haben. Und damit ich mir bei diesem Versuch nicht fortwährend etwas in die Tasche lügen könnte, würde ich mir einen unbefangenen und unbestechlichen Leser vorstellen, der schließlich über diese Frage zu entscheiden hätte. Keinen geringeren als dich.
Haufen Schlamm
Thursday, 22. December 2011Wie erscheint der Tod in Flauberts vielleicht größtem Roman, Bouvard et Pécuchet aus dem Jahr 1881? Ganz richtig, in Gestalt eines Hundes. Die berühmte Stelle hat es mir schon damals angetan, als ich das Buch zum ersten Male las, vor genau einem Vierteljahrhundert. Damals hatten wir noch keinen Hund. Mein Verhältnis zu Hunden war gestört, ich hatte Angst vor ihnen, wenn ich ihnen auf der Straße begegnete. Handelte es sich um besonders große Tiere, dann wechselte ich nicht selten den Bürgersteig, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Über Hundebesitzer, die ihr Tier nicht an der Leine führten, konnte ich mich sehr erregen. Einem toten und gar verwesenden Hund bin ich hingegen bisher noch nicht begegnet, wie es den Herren Pécuchet und Bouvard einst widerfuhr: „Kleine Schäfchenwolken standen am Himmel, die Glöckchen des Hafers wiegten sich im Wind, an einer Wiese murmelte ein Bach, als plötzlich ein furchtbarer Gestank sie stehenbleiben ließ, und sie sahen auf dem Kies zwischen Brombeergestrüpp den Kadaver eines Hundes liegen. Seine vier Glieder waren vertrocknet. Der weitgeöffnete Rachen entblößte unter bläulichen Lefzen elfenbeinweiße Fangzähne; an Stelle des Bauches war da ein erdfarbener Haufen Schlamm, der zu beben schien, so lebendig wimmelten darunter die Würmer. Sie kribbelten hin und her, von der Sonne beschienen, von Fliegen umsummt, in diesem unerträglichen Geruch, diesem wilden, gleichsam verzehrenden Geruch.“ (Gustave Flaubert: Bouvard und Pécuchet. A. d. Frz. v. Erich Marx. Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, 1959, S. 303.) Längst haben wir nun unseren Hund. Sie ist schon alt. Vielleicht sehr bald wird sie sterben. Aber den Würmern und Fliegen wollen wir sie nicht überlassen.
typographophobie tödlich
Wednesday, 21. December 2011„[…] ich sage die wahre geschichte von der anderen seite dem inneren entrissen mit vertauschten rollen ohne weiteren aufschub sie stießen mich in den schrank im zweiten stock ich spreche von uns in eine kiste schlugen mich grün und blau ansichtssache wie es hätte anfangen sollen in meinen kurzen hosen eines kleinen jungen ich spreche von mir schschsch es ist sommer wieder lügen wir müssen den jungen verstecken schschsch flüstert mutter unter tränen es tut weh ständig zu verlieren […]“ (Raymond Federman: Die Stimme im Schrank. A. d. Am. v. Peter Torwerk unter Mitarb. v. Silvia Morawetz. Hamburg: Kellner, 1989.) Dies ist immer der Ausgangspunkt auch für mich gewesen, das verwöhnte Jüngelchen aus den fetten Fünfzigern. Es hat aber von da an noch ein paar Jährchen gedauert, bis ich begriff, woher die Migräne kam. Bis ich aus der Kiste kriechen und den Schrecken hinterm schönen Schein von Geborgenheit erkennen konnte. Ja, es ist Ansichtssache, wie ich anfangen sollte. Ich suche noch immer das rechte Beginnen. Dieses Blog ist nur ein weiterer meiner vielen Umwege, eine erneute meiner zahllosen Ausreden. So sitze ich im Parterre und starre aus dem Fenster in den stillgelegten Haushaltswarenladen, während mich aus dem Hintergrund E2-E4 von Old Lazy Bones Manuel Göttsching am Leben hält.
Heinrich Funke: Das Testament (XXVI)
Tuesday, 20. December 2011Erste Frage: Wer oder was ist hier mit Eros gemeint? Wikipedia bietet uns drei Alternativen an. Gemeint sein könnte im Sinne der Mythologie der griechische Gott der Liebe, von dessen Namen das Wort ursprünglich herstammt; im Verständnis der Philosophie seit Platon der Drang nach Erkenntnis und schöpferischer geistiger Tätigkeit; und schließlich nach Sigmund Freud der Lebenstrieb, als einer der beiden Haupttriebe in seiner Psychoanalyse (der andere ist hiernach Thanatos, der Todestrieb). Das Bildmotiv, die Sexbombe Marilyn Monroe in der berühmten Szene über dem Lüftungsschacht, legt immerhin nahe, dass hier am ehesten noch der griechische Gott gemeint sein soll, zumal die Liebe, die er erweckt, laut Wikipedia im engeren Sinne eine „begehrliche“ ist. Nun könnten wir der Einfachheit halber statt von Liebe dann hier gleich von Begierde sprechen; oder, noch unverblümter, von Geilheit. Ob wir aber sicher sein können, dass die unschuldigen Griechen da ähnlich differenzierten wie wir, nach vielen Jahrhunderten Christentum? Man sagt, dass der Gott Eros mit kleinen Flügelchen dargestellt wurde, habe seinen Grund darin, dass die erotische Liebe schon immer als flüchtig empfunden wurde – etwa deshalb, weil die körperliche Attraktivität der Liebenden mit dem Alter schwindet; oder weil sich ein Überdruss einstellt, der zu Untreue verführt – nämlich auf dem Weg über die Empfänglichkeit für weitere Pfeile des Verführers. Hier kann ich mir aber die zweite Frage nicht verkneifen: Was verspricht denn eigentlich Eros? Das muss uns der Künstler verraten, denn meine Quellen (Hesiod und Ranke-Graves) geben dazu nichts her. Und wenn wir es dann wissen, können wir vielleicht auch verstehen, warum Eros sein angebliches Versprechen nicht halten kann. Das Versprechen von Marilyns schönen Beinen ist immerhin bekannt: eine lustvolle Begegnung im Bett. Dass sie dieses Versprechen mindestens zeitweise halten konnte, ist jedenfalls – soweit ich weiß – biographisch verbürgt.
Verklemmte Tür
Monday, 19. December 2011Auf seiner Polenreise im Herbst des Jahres 1924 kam Alfred Döblin auch nach Lublin. Dass er überhaupt eine solche Rundreise unternahm, darf verwundern, denn eigentlich hielt er, mir darin sehr ähnlich, vom Reisen gar nichts. Dass das Reisen bilde nannte er einen törichten Gemeinplatz, durch nichts belegt, weder durch eigene Erfahrung noch durch den Bildungsstand der Vielreisenden. Ich applaudiere! Dennoch lese ich seine Geschichten aus Polen teils mit großem Vergnügen, teils mit beträchtlichem Erstaunen, nahezu immer mit Gewinn. Was ihnen fehlt, das ist ein kleinster gemeinsamer Nenner des Themas, vielleicht auch ein stilistischer Bogen, der sich über allem wölbte, jedenfalls irgendetwas, das dem Buch die gewisse Geschlossenheit gäbe, die der Leser doch erwartet, wenngleich vielleicht nur aus alter Gewohnheit? Aber in Lublin, ja, da entdeckte ich nun etwas, das mich doch gegen das Buch einnahm. Döblin erzählt hier die Geschichte von seinem Aufenthalt in einem, „wie man sagt“, guten Hotel. „Zu den erstaunlichsten Dingen in diesem Hotel gehört meine Tür.“ Und nun erzählt er in Begriffen und Einzelheiten von der Besonderheit dieser Zimmertür, die sich verschließen lässt, aber nicht immer öffnen und beinahe nie ohne Mühen und Sorgen; erzählt dies umständlich und mit einer unterschwelligen Bedeutungslast versehen, dass man meint, dies müsse unbedingt von Franz Kafka stammen. Und so es denn nicht von diesem direkt gestohlen wurde, dann doch immerhin unverschämt nachgeäfft. Man bedenke, gerade in diesem Jahr war Kafka gestorben, im Wesentlichen unerkannt, aber doch immerhin einem Kreis von Kennern bekannt, wenn noch nicht durch seine Romane, so doch durch einen guten Teil seiner Erzählungen. Alfred Döblin wird diese Erzählungen gekannt haben. Ich will ihm auch nicht vorwerfen, dass er sich dem Einfluss dieses so viel Stärkeren nicht hat entziehen können, ihm willfahrte bis ins Imitat. Aber es ist schon ein starkes Stück, wenn man Stellen liest wie diese, über das Aufschließen der Zimmertür: „Das Schloß […] war völlig verstockt, von einer enormen Tiefe, durch die ganze massive Tür durch. Man durchbohrte mit dem Schlüssel die ganze Tür, stieß ihr mitten ins Herz und – kam innen heraus. Gerade das war falsch. Man mußte drin bleiben. Die Tür ließ dem Angreifer ruhig das Behagen, zuzustoßen, und schon saß er auf. Man mußte bei einer gewissen Tiefe haltmachen. Bei welcher: das war eben das Geheimnis. […] Ich betastete sorgfältig, zärtlich das Innere des Schlosses. Denn es hatte keinen Sinn, hier grob zu werden. Wie ein Tier ließ das Schloß alles mit sich machen. Ich suchte, gespannt, sehr höflich, scheinheilig. Endlich fand ich die fragliche Tiefe, drehte herum, einmal, zweimal, – manchmal [mein Herz erstarrte] dreimal, viermal, fünfmal. Es konnte immer so weiter gehen; ich würde nie ermitteln, wann ich aufzuhören hatte.“ (Alfred Döblin: Reise in Polen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1993, S. 163 f.) – Ins wirkliche Lublin musste der Autor nicht reisen, um dies schreiben zu können; aber vermutlich in Gedanken nach Prag. Reisen bildet nicht, sehr wohl aber Lesen.
Sonntag, 18. Dezember 2011
Sunday, 18. December 2011Vierter Advent. Ein furchtbar unfruchtbarer Tag, der über nutzlosem Streit, schlechter Laune, langer Weile und miesem Wetter verraucht und verstreicht; wie so viele Sonntage seit ich denken kann, denen dieser zum Verwechseln ähnlich sich anfühlt, aussieht und schmeckt; nämlich räudig, hässlich und bitter. Je älter ich aber werde und um so knapper die verbleibende Zeit, desto wütender werde ich. Und hilfloser. Wären alle Tage wie dieser, es gäbe kein Halten mehr.
Kullernde Kartoffeln
Saturday, 17. December 2011Manche Reiseberichte von Journalisten der „Siegermächte“ durchs demolierte Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden hierzulande in deutscher Übersetzung erst mit großem zeitlichen Abstand zum grausigen Geschehen veröffentlicht. Vor die Aufarbeitung haben die Götter die Verdrängung gesetzt! Der Schwede Stig Dagerman war mir zuerst 1977 durch sein Hörspiel Der Entdeckungsreisende aufgefallen. Ich las dann seine Erzählungssammlung Spiele der Nacht mit der atemberaubenden Miniatur Ein Kind töten. Deshalb musste ich zugreifen, als mir im Ramschkasten vor Baedeker auf der Kettwiger Straße Anfang der 1980er Jahre seine zwölf Reportagen aus dem verwüsteten Trizonesien vom Herbst 1946 in die Finger fielen. Als ich neulich wieder einmal in diesem leider etwas schlampig edierten Bändchen blätterte, stieß ich auf folgende Episode, die durch ihre filmreife Tragikomik beeindruckt. An einer stark frequentierten Brücke in Hamburg verkauft ein fliegender Händler ein Kartoffelschälmesser. Er findet wenig Zuspruch, denn Kartoffeln sind schließlich Mangelware. Vor diesem Hintergrund ereignet sich nun folgendes Missgeschick: „Eine kleine alte Tante mit einem großen Sack Kartoffeln hat es gerade in dem Augenblick geschafft, auf das Trittbrett der Bahn zu gelangen, als sich der Wagen in Bewegung setzt. Ihr Sack kippt um, die Schnur geht auf und die Alte schreit. Als der Wagen an uns vorbeirollt, beginnen die Kartoffeln gegen die Brückenführung zu trommeln. Im Gedränge um den Verkäufer entsteht plötzlich eine heftige Bewegung, und als die Straßenbahn die Brücke passiert hat, steht der Verkäufer beinahe allein am Geländer, während sich sein Publikum zwischen hupenden Armeefahrzeugen und kriegsbemalten Volkswagen um Kartoffeln schlägt. Schulbuben füllen ihre Ranzen, Arbeiter stopfen ihre Taschen voll, Hausfrauen öffnen ihre Handtaschen für Deutschlands meist gesuchte Frucht.“ (Stig Dagerman: Deutscher Herbst ’46. A. d. Schwed. v. Günter Barudio. Köln-Lövenich: „Hohenheim“-Verlag, 1981, S. 34.) – Zufällig zeigte ARTE nun den 2009 nach dieser Buchvorlage aus historischen Archivaufnahmen zusammengesetzten Dokumentarfilm 1946, Herbst in Deutschland von Michaël Gaumnitz. Und erstaunlicherweise gibt es darin eine Szene mit einem sehr ähnlichen Malheur, wenngleich dabei die Kartoffeln von einem Lkw herunterfallen. Könnte es etwa sein, dass Dagerman einige der von ihm beschriebenen Ereignisse gar nicht im wirklichen Leben, sondern bloß auf der Leinwand gesehen hat? Etwa in der Wochenschau Welt im Bild, die nach dem Zweiten Weltkrieg von der US-amerikanischen und britischen Besatzungsmacht in den intakten Münchner Bavaria-Studios produziert und vor den Filmaufführungen gezeigt wurde? – Und wenn! Würde es der Qualität und Authentizität von Dagermans „Augenzeugen“-Berichterstattung Abbruch tun?
Trockener Applaus
Friday, 16. December 2011Als Routineleser entwickelt man im Lauf der Jahrzehnte eine Dickfelligkeit, da muss schon Unerhörtes zwischen zwei Deckeln geschehen, damit man ein Buch nach ein paar Seiten aus der Hand legt und sagt: ,Puh! Das trifft mich ja ohne Unterlass ein ums andere Mal mitten ins Herz und mitten ins Hirn. Wie kann denn solch eine Übereinstimmung möglich sein?‘ Zuletzt widerfuhr mir das mit den Lektürenotizen von Gerhard Amanshauser, wo mir gleich zu Anfang mehrere meiner Hausgötter – Paul Scheerbart, Oskar Panizza, Fritz Mauthner – begegneten. Nun sind das ja nicht eben Allerweltsnamen, die einem alle Nasen lang in den Feuilletons begegnen. Aber um wie viel mehr musste mich entzücken, dass ich auch in den Antipathien Übereinstimmungen entdeckte, wie etwa gegen Thomas Bernhard, dem A. treffend einen „Manierismus des Schimpfens“ vorhält; oder gegen Peter Handke, dessen Künstler-Pose ich bereits in den 1970er Jahren affektiert fand, heute aber geradezu degoutant nennen muss. A. zitiert einen bekannten Ausspruch Handkes, der es „ein sicheres Zeichen“ nannte, dass einer „kein Künstler“ sei, wenn er das „Gerede von der ,Endzeit‘“ mitmache. Dieses Notat Handkes (aus Phantasien der Wiederholung von 1983) fand schon damals verschiedentlich Widerspruch, so des wackeren Wolfgang Hildesheimer, der es 1986 in einer Kritik in der Zeit schlicht „unverständlich“ nannte. Das wäre mir indes noch zu viel der Rücksichtnahme. Viel besser passt und so viel hellsichtiger ist A.s Verdikt von der „Tugendpest“, die sich in solchem Selbstverständnis des lobpreisenden Künstlers, des edlen, über alle schnöde Endlichkeit erhabenen Dichters kundtue. – Zu der hochgemuten Hymne des Novalis, zitiert nach den Paralipomena zu ,Die Lehrlinge zu Sais‘ vom Spätsommer 1798, die da lautet: „Der Mensch hat immer symbolische Philosophie seines Wesens – in seinen Werken und seinem Thun und Lassen ausgedrückt – Er verkündigt sich und sein Evangelium der Natur. Er ist der Messias der Natur“ … zu dieser Hymne auf das Wesen Mensch und des Menschen Wesen aus besseren Zeiten merkt A. bitter an: „Ein vermutlich mißlungenes Wesen, vor kurzer Zeit aus unglücklichen Zufällen entstanden und jüngst von einer seuchenartigen Vermehrung betroffen, die zu seinem baldigen Untergang führen muß, hält sich für den ,Messias der Natur‘. Allenfalls kann es noch den Titel ,Henker der Natur‘ für sich beanspruchen.“ – Ebenso schnöde wie wahr! (All dies gefunden und nachempfunden auf den ersten paar Seiten von Gerhard Amanshauser: Sondierungen und Resonanzen. Heidenreichstein: Verlag publication PN°1 Bibliothek der Provinz, o. J. [2007], S. 25-33.)
[Gewidmet Günter Landsberger, dessen Hinweis vom 20. August 2008 ich die Bekanntschaft mit A. und dem zitierten Buch verdanke.]
Wunder satt
Thursday, 15. December 2011Wenn man meint, als Leser viel Zeit sparen zu können, indem man sich mit dem Lesen von Aphorismen begnügt, der tägliche Kalenderspruch als Buchersatz für den eiligen Sinnsucher sozusagen, dann liegt man natürlich falsch, denn auf diesem Felde verliert man die scheinbar gewonnene Zeit bei der Sisyphusarbeit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Schlechte oder doch schwache Sprichwörter und Redewendungen, Zitate und Sentenzen sind leider die Regel, von der es bloß zwei seltene Ausnahmen gibt: Aphorismen, die nicht den geringsten Makel haben und unmittelbar erleuchten; und solche, die einen geringen Makel haben und dadurch mittelbar erhellen. Zur ersten Kategorie zähle ich eine Vielzahl der Sudelbuch-Notizen des unübertrefflichen Lichtenberg; zur zweiten beispielsweise ein paar Bemerkungen aus den Notizen von Ludwig Hohl, wie etwa diese: „Mir ist durchaus klar, daß es keinen Gott gibt. – Aber es gibt die Welt, das ist schon verwunderlich genug.“ (Die Notizen oder Von der unvoreiligen Versöhnung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981, S. 733.) Hieran ist mancherlei fragwürdig. Um die Nichtexistenz von etwas zu behaupten, muss man sich zunächst ja dessen „Wesen“ auf irgendeine Weise vorgestellt haben, seine Form und Beschaffenheit etwa, oder seine abstarkten Merkmale. Und dieser Vorstellungsinhalt muss auch meinem Gesprächspartner, Zuhörer, Leser vertraut sein, um meine Negation von dessen Existenz überhaupt verstehen, bejahen oder vielleicht auch ablehnen zu können. Ersetzte man das Wort Gott in Hohls Satz durch das Wort Xyll, so wüsste niemand, was gemeint ist, es sei denn, es gäbe ein solches Wort in einer fremden Sprache und der Angesprochene beherrschte zufällig dieses Idiom. Nun handelt es sich bei dem Wort Gott insofern um einen besonderen Typ von Substantiven, als ihm kein konkretes Ding in der sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit entspricht, von bildlichen Gottesdarstellungen aus der Zeit vor Erfindung der Fotografie und Berichten über Gotteserscheinungen einmal absehen. Insofern gibt es Gott durchaus, so wie es zum Beispiel auch das Einhorn gibt, allerdings nicht als reales Lebewesen auf unserer Erde, sondern als Fabeltier, das der Phantasie unserer Vorfahren entsprungen ist. Indirekt lassen sich aus Hohls Aphorismus zwei Fragen ableiten: Warum hatten unsere Ahnen es nötig, zu der doch wahrlich vor konkreten Wundern nur so strotzenden wirklichen Welt mancherlei Hirngespinste hinzuzuerfinden, mit denen sie ihre Sagen, Märchen und Mythen bevölkerten? Und zweitens: Warum tun sich auch heute noch viele Menschen, vermutlich sogar die große Mehrzahl der Zeitgenossen gegen alle Vernunft schwer damit, auf diese Selbsttäuschung zu verzichten? Insofern ist Ludwig Hohls Aphorismus nicht übel: Es ist ja nicht das schlechteste Ergebnis, wenn ein schiefer Satz aus seinem Dunkel zwei gerade Fragen ans Licht bringt.
Verspätete Grasmücken
Wednesday, 14. December 2011Gegen Klassiker gleich welcher Art hat man mir in der Schule eine Aversion antrainiert, gegen die ich bis heute nur schwer ankomme, obwohl ich längst begriffen habe, wie unvernünftig solche prinzipiellen Vorbehalte sind. Und doch mag ich meinen rebellischen Büchner lieber als den Geheimrat von Goethe, stelle den von Selbstzweifeln zerfressenen Robert Walser turmhoch über Thomas Mann, wie mir die Aberkennung der Mündigkeit eher ein Testat von Genialität zu sein scheint als die Verleihung des Nobelpreises. Wenn ich Goethe dankbar bin, dann zuallererst dafür, dass er einen Kauz wie Johann Peter Eckermann zum Protokollanten seiner alltäglichen mündlichen Belehrungen gemacht hat; allerdings nicht etwa, weil ich dieses nur zu oft neunmalkluge und selbstgefällige Geschwafle des greisen Dichters nicht entbehren könnte, sondern weil Eckermann selbst durch seine Protokolle der Vergessenheit entrissen wurde. So findet sich eine der schönsten Stellen in den Gesprächen mit Goethe für mich unterm Datum des 26. September 1827, an dem die beiden ungleichen Männer per Kutsche einen Ausflug zum Jagdschloss Ettersberg unternahmen: „Hinter Lützendorf, wo es stark bergan geht und wir nur Schritt fahren konnten, hatten wir zu allerlei Beobachtungen Gelegenheit. Goethe bemerkte rechts in den Hecken hinter dem Kammergut eine Menge Vögel und fragte mich, ob es Lerchen wären. – Du Großer und Lieber, dachte ich, der du die ganze Natur wie wenig andere durchforscht hast, in der Ornithologie scheinst du ein Kind zu sein!“ Und nun tauschen Goethe und sein „treuer Eckermann“ plötzlich die Rollen, letzterer ist mit einem Mal der Belehrende, während das große Genie sich in seiner ganzen naiven Kenntnislosigkeit offenbart; und was man immer behauptet: dass Goethe einer der letzten Generalisten gewesen sei, der das Wissen seiner Zeit noch in allen Bereichen überblicken konnte, es erweist sich hier als eine romantische Verklärung. „,Hm!‘ sagte Goethe, ,Sie scheinen in diesen Dingen nicht eben ein Neuling zu sein.‘“ Man beachte den peinlich späten Zeitpunkt dieser Erkenntnis! Seit gut vier Jahren kannte Goethe seinen Adlatus nun bereits, sah und sprach ihn zeitweise täglich – und hatte doch von dessen phänomenalen vogelkundlichen Kenntnissen bis zu diesem milden Herbsttag nicht das Mindeste gewusst. (Vgl. Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Hrsg. v. Adolf Bartels. Buchschmuck v. Walter Heßling. Jena: Eugen Diederichs, 1908, Bd. II, S. 331 ff.)
Bleibende Blüten
Tuesday, 13. December 2011Das Werk eines Lyrikers darf aber, ungeachtet dessen, was ich vorgestern zum Thema Anthologien gesagt habe, in besonderen Fällen durchaus auch in einer eigenständigen Buchausgabe zur Geltung kommen. Anders gesagt, es gibt Dichter, die mehr als die sprichwörtliche Handvoll großer Gedichte zu Papier gebracht haben, auf die Gottfried Benn grundsätzlich das bewahrenswerte Lebenswerk eines jeden Poeten beschränken wollte. Schließlich sollten wir doch wenigstens auf diesem über alle Regeln erhabenen Felde der Literatur von Prinzipien verschont bleiben! Und so habe ich auch nicht nötig zu begründen, warum Entsorgt von Nicolas Born auf der ewigen Hitliste jener Gedichte sehr weit oben steht, denen ich niemals untreu werden kann, die ich liebe, die mein Herz immer wieder verstören. Und allein um dieses Gedichtes willen ist es nötig, alle Gedichte von Born in einem dicken Band versammelt zu haben, bis zu dem allerletzten titellosen Vierzeiler aus dem Nachlass: „Als einmal der Zug in Fußgängertempo verfällt: | bleibende Blüten und Vogelstimmen: | wir sind zurückgekehrt | nur etwas verschlissen von Schnelligkeit.“ (Nicolas Born: Gedichte. Hrsg. v. Katharina Born. Göttingen: Wallstein Verlag, 2005, S. 235 f. und 401.)
Wesensschichten überwuchert
Monday, 12. December 2011Am 12. März 1922 erschien, mit dem Titel Die Wartenden überschrieben, in der Frankfurter Zeitung ein Essay von Siegfried Kracauer, der so beginnt: „Es gibt gegenwärtig eine große Anzahl von Menschen, die, ohne voneinander zu wissen, doch alle durch ein gemeinsames Los verbunden sind.“ Im Anschluss daran beschreibt der Autor moderne Großstädter mit Begriffen, bezeichnet ihre Stimmungen und Eigenschaften mit Ausdrücken, die mich selbst, nahezu neunzig Jahre später, zu der Annahme verführen, dass ich einer von diesen gewesen, so ich denn ihr Zeitgenosse hätte sein sollen. Kracauers Aufsatz mag aus heutiger Sicht vom Vorgefühl der bevorstehenden Katastrophe inspiriert erscheinen; das Erwartete, von dem er spricht, sich im Weltenbrand des Krieges und in der Shoah erfüllt haben. Warten ist in einer die Beschleunigung selbst perpetuierenden Gegenwart, die gar zu bald in jedem Augenblick schon Vergangenheit ist, keine zeitgemäße Haltung mehr. Aber was die vormals Wartenden zu Schicksalsgefährten machte, nämlich „das metaphysische Leiden an dem Mangel eines hohen Sinnes in der Welt, an ihrem Dasein im leeren Raum“, das dürfen wir auch jetzt noch als den blinden Fleck im bunten Panorama unserer Verstandeskonstruktionen erleiden, durch die wir unsere Tage leidlich ertragen. (Zit. nach Siegfried Kracauer: Das Ornament der Masse. Essays. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1963, S. 106.)
Metzelnde Mobile
Sunday, 11. December 2011Auch ein paar Anthologien sollen ihre Existenzberechtigung im meiner Sammlung behaupten, und zwar hauptsächlich, damit auch literarische Kurzformen wie Gedicht, Tagebuch-Aufzeichnung oder Brief zur angemessenen Geltung kommen. So erhalten Autoren Zutritt, die mir nie wichtig genug waren, um mir eines ihrer Werke anzuschaffen, aber immerhin durch diese Hintertür mit besonders geglückten Kostproben ihres Könnens einen der billigen Stehplätze beanspruchen mögen. Heute begrüße ich Léon Bloy, Vertreter eines anachronistischen katholischen Extremismus. Immerhin war der Mann intelligent genug, sich schon hundertundein Jahr vor der Jahrtausendwende nicht von dem Trubel mitreißen zu lassen, mit dem seine Zeitgenossen das Jahr Neunzehnhundert begrüßten, und lieferte im Oktober dieses Jahres in seinem Tagebuch dafür eine milchmädchenhaft einfache Begründung: „Viele Menschen wollten – und wollen noch heute – das Jahr 1900 zum ersten Jahre des 20. Jahrhunderts machen. Untrüglicher Beweis für das allerorts wahrzunehmende Absterben der menschlichen Vernunft. Als ob einer, der hundert Francs zu fordern hat, sich für bezahlt anzusehen hätte, wenn sein Schuldner ihm neunundneunzig auf den Tisch des Hauses hinzählt!“ (Zit. nach Gustav René Hocke: Europäische Tagebücher aus vier Jahrhunderten. Motive und Anthologie. Wiesbaden und München: Limes Verlag, 1986, S. 859.) Und im August des folgenden Jahres diagnostizierte er mit prophetischer Hellsicht eins der Grundübel des nun wirklich angebrochenen Jahrhunderts: „Auch Auto gibt’s. Teuflische, menschenmordende Besessenheit einer wildgewordenen Menschheit. Sicherheit auf den Straßen gab’s einmal. Heute morgen zeigte uns unser Kutscher eine dieser Maschinen, welche vor kurzem eine alte Frau überfahren und zu Tode gebracht hat und nun zu neuem Gemetzel gerüstet dasteht. Strafe natürlich gleich Null. Der ,Verkehrssünder‘, richtiger ,Amokläufer‘, mußte ein paar lumpige Taler auf den Tisch des Hauses zahlen und die Sache war abgetan.“ (Ebd., S. 863.)
Zurückweichende Merkmale
Saturday, 10. December 2011Manche Bücher behaupten ihren Platz in meiner nächsten Nähe allein als Muntermacher für getrübte Stimmungslagen. Aber ist das ein geringschätziges Urteil? Im Gegenteil. Nicht auszudenken, zu welchen nicht mehr gut zu machenden Kurzschlusshandlungen ich mich hätte hinreißen lassen, stünde nicht stets die entzückende Werkausgabe von Hector Hugh Munro in greifbarer Nähe. Überkommen mich wieder einmal Selbstvernichtungswünsche, dann reicht beispielsweise eine Personenbeschreibung aus seiner Feder wie diese, mich vom Rand des Abgrunds zurückzureißen: „Lucas war ein mehr als wohlgenährter Zeitgenosse, […] von einer Gesichtsfarbe, die bei Spargel als Zeichen höchster Kultur gelten mochte, in seinem Falle aber wohl nichts anderes war als das Ergebnis sorgfältig vermiedener körperlicher Ertüchtigung. Stirn und Haaransatz waren die einzig zurückweichenden Merkmale einer in jeder anderen Hinsicht aufdringlichen und anmaßenden Persönlichkeit.“ (Saki: Base Theresa; in: Biest und Überbiest. A. d. Engl. v. Claus Sprick. Zürich: Haffmans Verlag, S. 206.) Wenn der Tag mit dem Lachen über eine solche Charakterisierung beginnt, darf mir viel zustoßen, ohne mich zu erschüttern; endet er so, muss ich mindestens fünf weitere Saki-Geschichten lesen, bis ich einschlafen kann.
Hinterm Reiterhof
Friday, 09. December 2011Anfang der 1990er Jahre hatte ich die Marotte, Bücher per Stichprobe zu prüfen, indem ich genau eine Seite las. Es war keine willkürlich ausgewählt Seite, sondern prinzipiell die Seite 35. Wie ich gerade zu dieser Seitenzahl kam, das ist eine verwickelte Geschichte. Hier geht es mir um etwas anderes: „Die Krypta ist ein Kriminalroman, ein Kriminalroman in zwei Teilen, dessen zweiter Teil peinlichst genau alles das zerstört, was der erste sich aufzubauen bemüht hat […]“ – las ich Mitte Juni 1992 auf Seite 35 eines Romans, den mir Uschi Engelbrecht vom Hanser-Verlag „als ausgewiesenen [!] Oulipo-Fan“ zugeschickt hatte, verbunden „mit dem ausdrücklichen Wunsch, daß Sie aus dem Labyrinth des Buches, in dem man sich gerne verliert, wieder auftauchen.“ Zweimal Dankeschön für Uschi Engelbrecht: einmal für das Buch, das ich bis auf Seite 35 nicht gelesen habe; und zweitens für den Wunsch, der nicht in Erfüllung gegangen ist. Denn ich nahm den zitierten Satz über den wohl fiktiven Kriminalroman zum Anlass, selbst einen Kriminalroman zu schreiben, der nach dem besagten Strickmuster gebaut sein sollte. Dieses Unternehmen erwies sich allerdings recht bald als ein Labyrinth, aus dem ich streng genommen bis heute nicht wieder aufgetaucht bin. In zwei Punkten irrte freilich die freundliche Verlagsangestellte: Ich war und bin kein Oulipo-Fan, und schon erst recht kein „ausgewiesener“; und ich verliere mich nicht „gerne“, weder in Büchern noch in der Wirklichkeit. – Der zitierte Satz geht übrigens so weiter: „[…] das klassische Verfahren zahlreicher Rätsel-Romane, das hier auf einen fast karikaturistischen Höhepunkt getrieben wird.“ (Georges Perec: 53 Tage. A. d. Frz. v. Eugen Helmlé. München: Carl Hanser Verlag, 1992, S. 35.) Das mag für die Krypta stimmen, meine Furie hingegen verrennt sich in den uferlosen Ebenen der Langeweile.
Jacke wie Hose
Thursday, 08. December 2011Vor 350 Jahren berichtet Samuel Pepys vom Missgeschick eines Mr. Townsend, „daß er nämlich kürzlich mit beiden Beinen durch ein Hosenbein gestiegen und so den ganzen Tag herumgelaufen“ sei. (Tagebuch aus dem London des 17. Jahrhunderts. A. d. Engl. v. Helmut Winter. Stuttgart: Philipp Reclam, 1980, S. 69.) Wie soll man sich denn das vorstellen? Dann müsste Townsend Beine gehabt haben wie ein Storch; oder Hosen so weit wie Röcke? Übrigens bezeichnete das Wort Hose im Deutschen ja ursprünglich das einzelne Hosenbein, wie in dem berühmten Reklamespruch von Lichtenberg noch deutlich wird: „Wer zwei Paar Hosen hat, mache eins zu Geld und schaffe sich dieses Buch an.“ (Sudelbücher, Heft E, 79.) – Es hilft alles Deuten und Raten nichts, manche Stellen in alten Büchern muss man entweder für kryptisch oder für frech gelogen halten.
schlupp! zur Welt gebracht
Wednesday, 07. December 2011Was, würde ich mir wünschen, sollte ein ernst zu nehmender Kunstrichter hundert Jahre nach meinem Tod über mich und mein Geschreibsel urteilen? Schön wäre etwa: „Er ist die personifizierte Vollkommenheit; und man kann das eigentlich bloß konstatieren.“ So darf sich nur ein unterschätzter Kritiker über einen ebenso unterschätzten Poeten und Künstler äußern. Hier ist es Egon Friedell, den ich zitiere (Kulturgeschichte der Neuzeit. München: Verlag C. H. Beck, 1974, S. 1322) und dem ich unbedingt beipflichte, ist doch der so maßlos Verehrte kein geringerer als der allerfrüheste Urheber meines Kunstverstands, meiner Lachlust, meiner Melancholie. (Größenwahn ist in der Einsamkeit ein bezauberndes Gefühl.)
Grünspan fern der Heimat
Tuesday, 06. December 2011Was mich bei aller gefahrvollen Abenteuerlust früher Entdecker und Weltreisender stets am meisten beeindruckt hat, das ist ihr Wagemut, sich von allen üblichen Hilfs- und Rettungsmitteln der menschlichen Zivilisation so weit zu entfernen, dass in manchem Notfall einer Verletzung oder Erkrankung möglicherweise keinerlei Hoffnung auf Heilung mehr bestünde, die daheim noch zu kurieren gewesen wäre. Andererseits imponiert mir das praktische Wissen solcher Leute, wie sie sich in der Mannschaft des Kapitäns James Cook bei seiner zweiten Südseereise zusammengefunden hatten, die so leicht durch nichts zu erschüttern waren. – So berichtet etwa der neunzehnjährige Georg Forster ganz nebenbei, warum er sich am 23. April 1773 einem Landgang in der neuseeländischen Dusky-Bay nicht hatte anschließen können, den verschiedene Offiziere unternahmen. „Wir hätten sie gern begleitet; aber Durchlauf und Colik hielten uns am Bord zurück. Beydes kam von der Sorglosigkeit des Kochs her, der unser kupfernes Küchen-Geschirr ganz von Grünspan hatte anlaufen lassen.“ (Reise um die Welt. Hrsg. v. Gerhard Steiner. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1983, S. 177.) Wenn ich mir vorstelle, ich wüsste mich vor Leibkrämpfen, Durchfall und Erbrechen nicht zu halten, weit weg von jeder Ambulanz und jedem ärztlichen Rat; und dann zeigte mir so ein schmieriger Smutje seine grün angelaufenen Kupferpfannen und -töpfe … grauenhaft!
Leid entfesselt
Monday, 05. December 2011Ende der 1970er Jahre kursierte unter linken Antiquaren der Geheimtipp, dass Hugo Balls Die Flucht aus der Zeit von 1946 beim Verlag Josef Stocker in Luzern noch ganz regulär lieferbar sei; zwar keine Erstausgabe aus dem schmalen Werk des Dadaisten, denn ursprünglich waren diese Tagebuchnotizen 1927 bei Duncker & Humblot in München erschienen – aber immerhin! Auch ich orderte das Buch zum Listenpreis von 13,50 Schweizer Franken. Leider hat es einen braunen Fleck im Vorderschnitt. Ich lese: „Die Fehler, die man am andern entdeckt, sind oftmals nur die eigenen. Wer sich mit diesem Gedanken vertraut macht, hat großen Nutzen davon.“ (Eintrag vom 6. April 1920, S. 281.) Daran musste ich im Krankenhaus denken, als mir jeder meiner insgesamt fünf Zimmernachbarn seine halbe Lebens- und ganze Leidensgeschichte erzählte, ohne sich auch nur im Mindesten für mich und mein Ach und Weh zu interessieren. Aber ganz so war ich selbst ja bisher auch aufgetreten! Seither zügele ich mich immerhin gelegentlich, wenn meine Tiraden und Jammerarien mich wieder einmal mit sich reißen wollen und unaufmerksam zu machen drohen fürs nicht minder traurige Los meiner Zuhörer.
Schmerz vergangen
Sunday, 04. December 2011Früher hatte ich noch die schlechte Angewohnheit, meinen Namen und das Anschaffungsdatum in meine Bücher zu schreiben. Glücklicherweise muss mir sehr bald ein kundiger Kollege in der Buchhandlung, in der ich seit dem 16. Oktober 1978 arbeitete, den Tipp gegeben haben, meinen Besitzvermerk wenn schon dann jedenfalls nicht auf die Titelseite zu schreiben, die sei so etwas wie das Hymen des Buches und müsse unbedingt rein und unbeschädigt bleiben. Vielleicht das allererste Buch, das ich an meinem ersten Arbeitsplatz mit Kollegenrabatt erwarb, war eine gebundene Ausgabe der Tagebücher von Franz Kafka (Hrsg. v. Max Brod. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1967). Darin strich ich irgendwann eine Stelle aus dem März 1922 an, als der Autor gerade noch zwei Jahre zu leben hatte: „Früher, wenn ich einen Schmerz hatte und er verging, war ich glücklich, jetzt bin ich nur erleichtert, habe aber das bittere Gefühl: ,wieder nur gesund, nicht mehr‘.“ (S. 415.) – Diese Wandlung habe ich, wie es scheint, nun auch durchgemacht, wenngleich ich eher von einem flauen denn von einem bitteren Gefühl sprechen möchte.
Kopfschnitt entstaubt
Saturday, 03. December 2011Als ich in nur einer Woche meine gesamte Arbeitsbibliothek neu ordnete, blieben für jedes Buch im Mittel gerade mal ein paar Minuten Aufmerksamkeit. Damit diese Schnelldurchsicht – vom eigentlichen Zweck der Übung, der Neuordnung, einmal abgesehen – nicht ganz nutzlos sein sollte, blätterte ich die meisten Bücher wenigstens kurz an, las hier und da wahllos ein paar Zeilen, schaute ins Inhaltsverzeichnis oder ins Register. Und wenn ich dabei, was nicht eben selten geschah, eine Stelle erspähte, die mein Interesse weckte, dann legte ich dort zwischen die Seiten einen jener postkartengroßen, hauchdünnen, säurefreien Notizzettel, die ich schon seit vielen Jahren als Lesezeichen und Vorratsspeicher für Gedankenblitze nutze. Gelegentlich notierte ich auf diese Blättchen mit spitzem Bleistift ein paar Ideensplitter, eine Assoziation oder eine Frage, zu der mich die vom Zufall ausgewählte Textstelle angeregt hatte und die ich einer genaueren Betrachtung zu einem späteren Zeitpunkt für wert befand. Und vielleicht würde hieraus ja der eine oder andere Beitrag zu meinem Blog heranreifen?
Geist händisch
Friday, 02. December 2011Nach einer Lebenskrise habe ich immer das Verlangen, Ordnung zu schaffen. So war ich diesmal, nach der Rückkehr aus der Klinik, zunächst zu keiner anderen Handlung in der Lage, als etwas zu tun, das ich schon lange vor mir hergeschoben und zu dem ich mich dank vermeintlich wichtigerer Aufgaben doch nie hatte aufraffen können: meine Büchersammlung zu ordnen. Jeder, der aus einer großen in eine wesentlich kleinere Wohnung umziehen musste, kennt die Schwierigkeit, alles Hab und Gut in die neue, knappe Behausung so hineinzustopfen, dass man noch einigermaßen weiß, wo was zu finden ist. So lebte ich in meiner Bibliothek seit Sommer vorletzten Jahres im quälenden Dauerzustand einer Unübersichtlichkeit, die das glückliche Finden eines bestimmten Buches zum Zufall und das zufällige Entdecken eines längst nicht mehr vermissten Buches zur Regel werden ließ. Dies mag für eine Weile reizvoll sein. Und so bewog mich mein sanguinisches Temperament sehr bald, mir diese eigentlich unbefriedigende Arbeitsbedingung als eine weitere Exzentrizität meines kauzigen Wesens schönzureden. Wenn ich nach dem Wortlaut eines Satzes aus Wittgensteins Tractatus suchen wollte, aber leider das Buch nicht fand und mir stattdessen Hebbels Tagebücher in die Hände fielen, dann blätterte ich darin so lange, bis ich auf einen Ausspruch stieß, der mir noch ungleich besser in den Zusammenhang zu passen schien. Wenn es stimmt, dass Not erfinderisch macht, dann gilt nach meiner Erfahrung erst recht, dass Faulheit zu wahren Geniestreichen verleiten kann – gelegentlich jedenfalls. Da ich nun aber die neu gewonnene Lebensperspektive nutzen wollte, um manche träge Gewohnheit und insbesondere auch meine Arbeitsweise zu überdenken, begann ich gleich mit der übelsten Kärrnerarbeit und räumte die Bibliothek meines Arbeitszimmers vollständig aus den Regalen, sortierte sie und räumte sie anschließend wieder ein. Das klingt, so leicht dahingesagt, wie ein Handumdrehen, fühlt sich aber in der Wirklichkeit eher an wie das Zermahlen aller Knochen im Fleische. Was mich dennoch halbwegs bei Laune hielt, das waren die vielfältigen Wiedersehensfreuden, wenn mancher längst vergessene Schatz, seit gefühlten Ewigkeiten in der zweiten Reihe schmachtend, wohin die Willkür des chaotischen Einzugs ihn verbannt hatte, plötzlich wieder sein Präsenzrecht behaupten durfte. Jedenfalls reichten solche Glücksimpulse, um aus den finsteren Tälern grenzenloser Erschöpfung immer wieder heraufzufinden ans Licht. Nun umgibt mich die Handbibliothek in feinster Ordnung, ich weiß wieder, was sie birgt und wozu ich sie nutzen kann. Die wertvollste Erfahrung aber, die mir dieser körperliche Gewaltakt bescherte, soll diesen knappen Expeditionsbericht krönen. Mir wurde doch deutlich wie nie zuvor, welch unersetzlichen Wert eine solche Textsammlung in ihrer Konkretion als Fülle von mit Händen greifbaren Büchern hat. Besäße ich diese ungefähr tausend Werke stattdessen als Textdateien auf einer Festplatte, wäre die Aufgabe einer Neusortierung oder Umstrukturierung gewiss mit ein paar Anschlägen auf der Tastatur zu erledigen gewesen. Aber diese kinderleichte Arbeit in Minutenschnelle hätte auch keinerlei Spuren bei mir hinterlassen, von Glücksmomenten ganz zu schweigen. Es ist eben so viel mehr als nur verdrossene Treue zu einem antiquierten Medium, das uns Hirntiere zu Skeptikern angesichts der bevorstehenden E-Book-Revolution macht. Wenn man den Geist von seinen mit Händen greifbaren Werkzeugen nimmt und in einem virtuellen Raum isoliert, dann wird eine grauenhafte Verödung die Folge sein – für den Geist so sehr wie für die wirkliche Welt.
Kürzer treten
Thursday, 01. December 2011Die Entwürfe zu diesem ersten Posting nach der langen Krankheitspause hätten den Brennstoff liefern können zu einem völlig neuen Blog mit dem Titel Scheiterhaufen. So nannte ich einst im paranoiden Jahr 1984 mit vollem Recht einen ersten Romanversuch, dessen Überbleibsel noch irgendwo auf meiner Spur durch verschollene Keller und Speicher in schimmelnden Kisten gammeln mögen. Aber daran wollte ich nun doch nicht anknüpfen, denn schließlich war es alles nichts, was ich mir da so zusammenspann in den vergangenen endlosen Wochen – und nichts schien selbst mir ein wenig zu gering. Nun hatte ich mir aber frühzeitig für den Neubeginn ein Ultimatum gesetzt; nämlich heute. Ich bin ja, was die Inspiration betrifft, ein etwas kauziger Fall. Wenn eine erlösende Eingebung hartnäckig sich verweigert, dann führe ich sie per höchstrichterlichem Beschluss herbei. Hiernach lautet ab dato die formale Regel für alle künftigen Beiträge in diesem Blog, dass sie nurmehr einen Absatz haben sollen, statt wie bisher deren fünf. Das wird zweifellos auf den Stil, die Tendenz, die Frequenz und den Inhalt meiner Kurzprosa Auswirkungen haben, von denen ich mich aber ebenso überraschen lassen muss wie die geschätzte Leserin, der geneigte Leser.