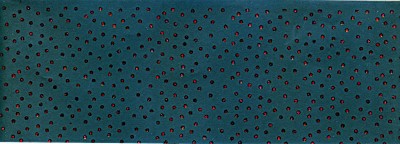Vielleicht war es auch der Geist von Raymond Federman, der mich Anfang des Monats aus dem Tritt gebracht hat.
Federman starb am 6. Oktober früh um 6:15 Uhr im Alter von 81 Jahren im kalifornischen San Diego an Krebs. Seine Tochter Simone, die ihn in der langen Zeit seiner Erkrankung begleitet hatte, war auch in der Stunde seines Todes bei ihm. Über fast alles, was das Menschenleben ausmacht, wenn das Nebensächliche von ihm abgestreift wird, zum Beispiel in einem Augenblick höchster Todesangst, hat Raymond Federman geschrieben, als Erzähler und als Dichter. Für den letzten Augenblick vor dem Ende hat er seinen Wunsch in ein Gedicht gekleidet, Am Ende, in meiner Übersetzung:
Manche sterben heroisch
auf dem Schlachtfeld
andere aufbegehrend
mit einem Sprung von der Klippe
viele jedoch sterben
unerwartet
im Schlaf
ohne es zu erleben
während eine Vielzahl
in Angst und Feigheit dahingeht
auf den Krankhausstationen
sehr wenige scheiden
schmalos dahin
ohne sich zu sträuben
Ich hingegen wünsche mir zu sterben
gerade so eben
ohne Begeisterung
Man muss wissen, dass Raymond Federman dem Tod vor sehr langer Zeit, Mitte Juli 1942 in Paris im allerletzten Augenblick von der Schippe gesprungen ist, als 14-jähriger Judenjunge, den seine beherzte Mutter vor den Nazischergen in einem Schrank versteckte.
Ich weiß, dass Raymond Federman über diese klaustrophobe Erfahrung ein Buch geschrieben hat, The Voice in the Closet – La voix dans le cabinet de débarras – Die Stimme im Schrank. Ein einziger Satz. Diesen 75 Seiten langen Satz las Simone ihrem Vater in der Nacht seines Todes noch einmal vor, in einem Atemzug. Sie kam bis Seite 61, dann