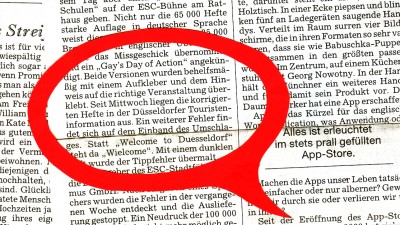Sollte sich trotz meines längeren Schweigens gelegentlich noch der eine oder andere Leser auf dieses Blog verirren, und sollte sich unter diesen paar Versprengten gar einer tummeln, der mit langem Atem mein treuer Gast ist, dann könnte ihm aufgefallen sein, dass unter anderen Rubriken auch diese, Sprechblasen genannte, sanft entschlummerte, vor ziemlich genau zwei Monaten. Mir schien es nämlich nach nur 13 Folgen nicht mehr der Mühe wert, mich auf die alltägliche „Schnitzerjagd“ zu begeben. Das war zu leicht, das wurde bald fad! Zudem verspürte ich bei meiner hämischen Kritikasterei stets ein leichtes Unbehagen, da ich doch hier ausgerechnet eine jener wenigen Tageszeitungen deutscher Sprache aufs Korn nahm, die bei allen angekreideten Fehlern immer noch den Anspruch zu haben scheint, richtig und gut zu schreiben.
So ließ ich ’s also bleiben. Und wenn ich jetzt einmal rückfällig werde, dann nur deshalb, weil der Süddeutschen in ihrer heutigen Ausgabe ein Patzer unterlaufen ist, der mir gleich in zweifacher Hinsicht bemerkenswert erscheint, handelt es sich hier doch um einen Fall von Steinewerfen im Glashaus und zugleich um einen Fall von kulturellem Banausentum.
Erstens geht es in dem fraglichen Artikel gerade um „peinliche Fehler“, nämlich im Begleitheft zum Finale des Eurovision Song Contest, das am 14. Mai 2011 in Düsseldorf ausgetragen wird. Das in einer Auflage von 65.000 Exemplaren gedruckte Heft kündigt einen gleichtags stattfindenden „Aktionstag der Schwulen“ an. Und in den 35.000 Exemplaren der Broschüre in englischer Sprache ist analog von einem „Gay’s Day of Action“ die Rede. Dumm nur, dass es sich um einen „Aktionstag der Schulen“ handelt. Das ist verständlicherweise ein Fall für die Panorama-Seite der SZ, denn dort will sich der gebildete Leser dieses Blattes schließlich für alles entschädigen, was ihm durch seinen BILD-Boykott entgeht.
Was aber dem Fass den Boden ausschlägt: dass nun just in diesem Oberlehrer-Artikel dem anonymen Autor ebenfalls ein Lapsus widerfährt, und zwar einer, der nicht bloß auf Flüchtigkeit beruht wie in den von ihm monierten Fällen, sondern noch ganz andere Defizite offenbart. Er schreibt: „Ein weiterer Fehler findet sich auf dem Einband des Umschlages.“ (SZ Nr. 97 v. 28. April 2011, S. 9.) So etwas gibt es nicht und kann es nicht geben! Vielleicht hat der Leser dieser Zeilen im Unterschied zu dem zitierten SZ-Redakteur einmal ein Buch in der Hand gehalten und erinnert sich von daher, dass das viele Papier im Inneren äußerlich von zwei meist etwas stabileren Deckeln eingefasst war, einer vorn und einer hinten. Dies nennt man „Einband“. Viele Bücher hüllen sich nun zusätzlich noch in eine Schutzschicht, damit die Einbanddeckel beim Lesen am Früstücks- oder Abendbrottisch nicht so leicht bekleckert werden können. Diese Schicht nennt man „Umschlag“.
So wird auch dem Buchunkundigen hoffentlich klar, dass man notfalls von einem „Umschlag des Einbandes“ sprechen kann, mitnichten jedoch, wie in dem Artikel geschehen, von einem „Einband des Umschlages“. (Der lässliche Flüchtigkeitsfehler auf dem Umschlag des Einbands sei immerhin noch nachgetragen: „Statt ,Welcome to Duesseldorf‘ steht da ‚Wielcome‘.“ Geschenkt!)