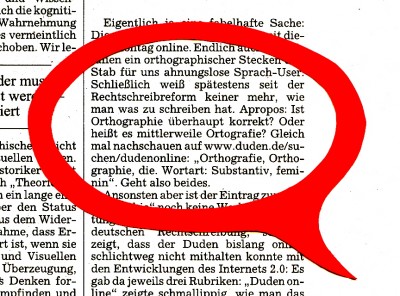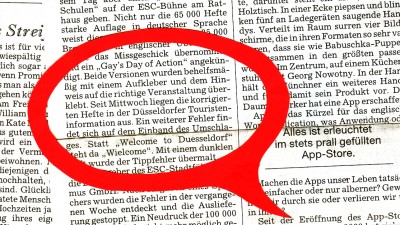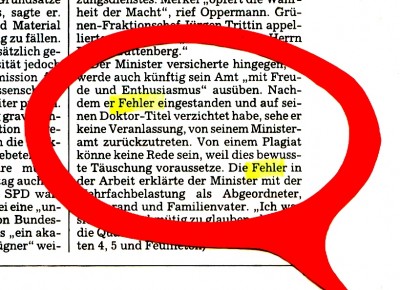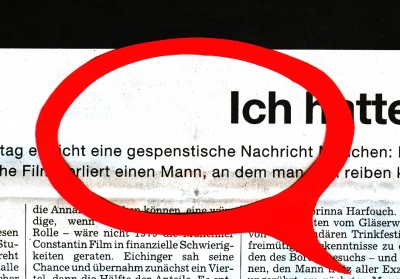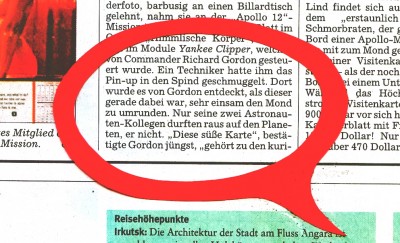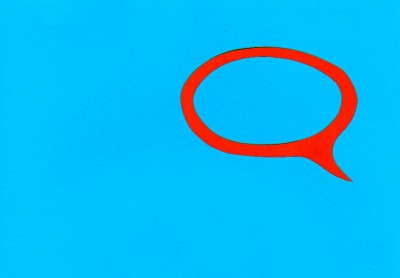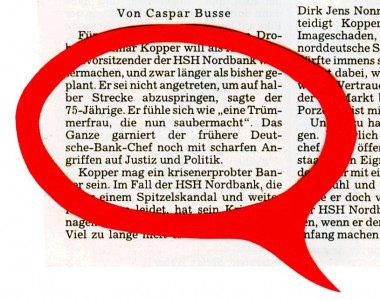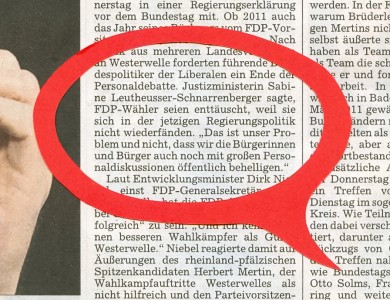Die Verführungskraft der Patzer in der Süddeutschen ist in letzter Zeit wieder besonders groß. Erneut gelingt es einem ihrer Redakteure, in einem Artikel zum Thema richtiges Deutsch einen bösen Fehler unterzubringen. Ja, es kommt sogar noch dicker. SZ-Mitarbeiter alex macht seinen Schnitzer ausgerechnet in einem Satz über die (nach der neuen Rechtschreibung) korrekte Schreibweise des (aus dem Altgriechischen hergeleiteten) Fachworts für Rechtschreibung: Orthographie; und zwar, peinlicher geht ‘s nimmer, in diesem Wort selbst!
Worum geht es in dem Feuilleton-Beitrag? Seit gestern ist die neue Website des Duden online: „Endlich auch in Digitalien ein orthographischer Stecken und Stab für ahnungslose Sprach-User.“ So locker-flockig, mit gleich zwei kreativen Neologismen, die man auch in der aktuellsten Print-Version des Duden vergeblich suchen würde, führt uns alex ans Thema heran, um dann fortzufahren: „Apropos: Ist Orthographie überhaupt korrekt? Oder heißt es mittlerweile Ortografie? Gleich mal nachschauen auf www.duden.de/suchen/dudenonline: ,Orthografie, Orthographie, die. Wortart: Substantiv, feminin‘. Geht also beides.“ (alex: Aus Sprechern sollen User werden; in: SZ Nr. 101, S. 11. – Nebenbei: Auch der Titel dieser Glosse ist völlig danebengeraten. Nachschlagewerke zur Rechtschreibung, gleich ob traditionell als Buch oder digitalisiert und online, wurden und werden in erster Linie nicht von Sprechern, sondern von Schreibern genutzt. Und zudem sollen auch diese nicht ihr Verhalten als Schreibende ändern, sondern ihr Verhalten beim Nachschlagen. Allenfalls könnte die Headline also lauten: Aus nachschlagenden Schreibern sollen tippende und klickende User werden. Das wäre wohl als Überschrift viel zu lang, aber vermutlich die kürzeste korrekte Formulierung für den gemeinten Sinn. Was dort nun stattdessen als Titel steht, ist jedenfalls kompletter Blödsinn!)
Es geht also beides? Offenbar kann der Verfasser nicht einmal bis drei zählen, denn so viele Varianten des Wortes hat er doch selbst soeben gebracht: [1] Orthographie; [2] Ortografie; [3] Orthografie. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann sollten wir auch die letzte nicht unterschlagen: [4] Ortographie. Um es vorwegzunehmen: [1] und [3] gehen, [2] und [4] nicht, aber nach [1] und [2] hatte alex gefragt, [1] und [3] gefunden – und geantwortet: „Geht also beides.“
Und sonst? Ansonsten verfehlt der flapsige Artikel sein Thema. Denn worum es bei der Kurzvorstellung eines neuen Online-Werkzeugs zuallererst gehen müsste, wäre doch dessen Funktionsweise. Was passiert, wenn ich ein Wort, dessen korrekte Schreibweise ich nicht kenne, ins Suchfeld eingebe? Dabei wäre besonders interessant zu erfahren, wie das Verzeichnis reagiert, wenn ich ein falsch geschriebenes Wort eingebe. Im konkreten Beispiel hätte alex vielleicht mal seine für möglich gehaltene Variante [2] Ortografie prüfen können. Ich habe genau das getan und erhielt unter der Überschrift Suchergebnisse folgende Antwort: „Die Suche nach ,ortografie‘ lieferte 0 Treffer | Oder meinten Sie: Kartografie, Fotografie, Areografie“.
Hier könnte nun ein Kritiker, der diesen Namen verdient, berechtigte Bedenken anmelden. Wenn ich als „User“ des neuen Duden-Onlinewörterbuchs den Begriff nur vom Hörensagen kenne, dann wüsste ich doch gern, wie das Wort sich richtig schreibt. Vielleicht würde ich in einem nächsten Versuch [4] Ortographie eingeben. Ich erhielte dann exakt das gleiche Ergebnis, wieder mit den kaum hilfreichen, geradezu unsinnigen Verweisen auf die Wörter Kartografie, Fotografie und Areografie. Außerdem würde mich gewiss interessieren, warum man den Wortteil „Ortho-“ nicht ohne „h“ schreiben darf, den Wortteil „-graphie“ hingegen sehr wohl mit „f“ statt „ph“. Richtige Schreibweisen von falschen zu unterscheiden fällt ja schließlich viel leichter, wenn man die Regeln kennt, die dem zugrunde liegen. Hier versagt Dudenonline völlig – und sein „Kritiker“ ebenfalls.