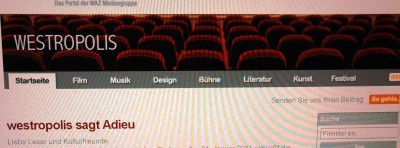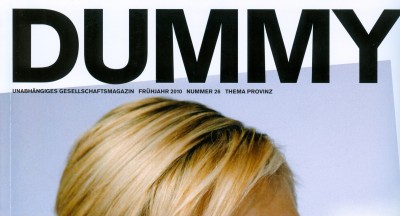Die Vision eines für anspruchsvolle Kulturfreunde im Revier nützlichen Weblogs habe ich in groben Zügen umrissen. Nun also die letzte Frage, mit deren Beantwortung alles steht und fällt: „Wer ist interessiert und in der Lage, ein solches Kulturblog zu realisieren, sowohl inhaltlich als auch materiell?“
Die erste Voraussetzung, die dessen Stammautoren vermutlich erfüllen müssten, wäre ihre materielle Unabhängigkeit mindestens in einer Startphase. (Es sei denn, man fände einen risikofreudigen, idealistischen Sponsor.) Dass man mit Weblogs nur schwer Geld verdienen kann und in den ersten ein, zwei Jahren vorsichtshalber von einem Nullsummenspiel ausgehen sollte, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben.
Sodann sollten sich die Autoren auf einen klar definierten, verbindlichen Standard verständigen können, was die Art der Themen, die Darstellungsweise und die stilistische und formale Qualität betrifft. Damit soll die Meinungsfreiheit und die Phantasie der Autoren keineswegs beschränkt werden. Aber ein Kulturblog für das Revier ist beispielsweise nicht die richtige Bühne für die Mitteilung persönlicher Befindlichkeiten, Exaltationen, Selbstdarstellungen selbstverliebter Schreibvirtuosen. (Als einen solchen kann man mich durchaus ansehen, aber diese Neigungen verwirkliche ich in meinem persönlichen Blog.) Auch ein Reisebericht von den Seychellen oder die Todesnachricht von Gary Moore gehört nicht hierher. Und das Unterscheidungsvermögen von das und dass ist die Mindestvoraussetzung für die Teilnahme an einem solchen Projekt, das sich an gebildete Leser wendet und sich von den auch orthografisch immer weiter degenerierenden Printmedien positiv abheben will. Ein besonders auffälliger Ton im Lokalkolorit der Ruhrstädte ist zweifellos der Fußball; doch bei allem Verständnis für Traditionen und gepflegten Infantilismus hat dieser vereinsmeiernde Ballspielwahn auf einer Kulturseite allenfalls ausnahmsweise etwas zu suchen.
Spätestens an dieser Stelle wird vielleicht deutlich, warum ich pessimistisch bin, was die Realisation dieses schönen Traums betrifft. Die einzigen Blogger im Revier, denen man den Anspruch unterstellen könnte, immerhin nebenbei auch Kultur im Revier und für das Revier zu vermitteln, die ruhrbarone, sortieren ihre Artikel in vier Schubladen: Alles über Pop bringt vorwiegend YouTube-Filmchen für junge Leute unter fünfzig; Auf dem Platz meint viel Fußball und sonst so allerlei, Lokalpolitik zum Beispiel und delikate Personalien aus der Region; Glaube, Sitte, Heimat ist ebenfalls ein Durcheinander ohne erkennbaren gemeinsamen Nenner, vielmehr rotieren regionale, nationale, internationale und interstellare Themen in der Schleuder, dass einem schwindlig wird; und schließlich hat die internationale Politik dann bei Rest der Welt noch ihren Exklusivauftritt.
Das ist jedenfalls kein Kulturblog, in dem man findet, was man sucht, sondern allenfalls über manches stolpert, von dem man nicht einmal träumte und das doch gelegentlich Spaß macht oder Interesse verdient. Wenn ich Langeweile habe, weil ich nicht weiß, was ich mit einem angebrochenen Abend anfangen soll, dann schnüffele ich vielleicht wie ein streunender Hund in meinen Lieblingsblogs, und dann vielleicht auch bei ruhrbarone herum, um für den Rest des Abends meine gute Stube nicht mehr zu verlassen. Wenn ich aber wissen will, was es an kulturellem Angebot für einen solchen Abend jenseits meines Monitors in der Region gibt, dann finde ich auf diesem Monitor zurzeit noch keine überzeugende Orientierungshilfe. – Mache ich einen Denkfehler, oder darf man dieses Defizit getrost als echte Marktlücke bezeichnen?