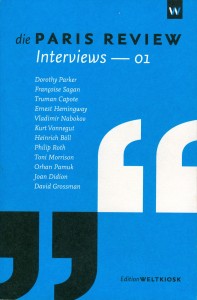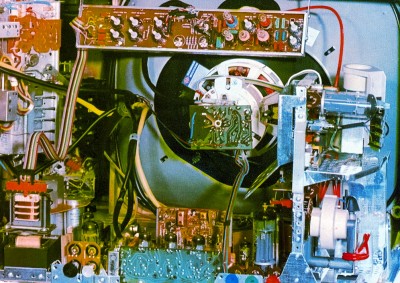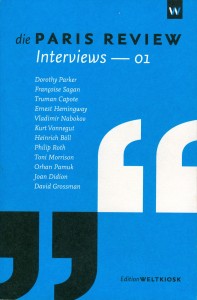
Die Interviews der New Yorker Literaturzeitschrift Paris Review können mit Fug und Recht als stilbildend für die ganze noch junge Gattung gelten. Dass man den Befragten nicht mit den üblichen Allerweltsfragen à la FAZ-Fragebogen abwärts kommen kann, mit denen die sonstige Prominenz aus Politik, Sport und Showbiz gelöchert wird, liegt auf der Hand. Schließlich sind Literaten Leute, die immerhin schreiben können. Hierunter verstehe ich selbstredend nicht jene Dauersekretion von Banalitäten als Tagesgeschäft, die schon immer 99,9 Prozent aller Papierwaren beschleimte. Schreiben im eigentlichen Sinn jedoch setzt Verstand voraus, Selbstbewusstsein, Weltkritik und ein gerüttelt Maß Verzweiflung. Menschen, die unter solchen schweren Handicaps leiden, darf man nicht mit Fragen nach ihrem Lieblingsbuch und ihrer schönsten Kindheitserinnerung in Lebensgefahr bringen. Das wissen die einfühlsamen Interviewer der Paris Review, und sie beherrschen ihr Mundwerk. In den vergangenen 57 Jahren seit Gründung der Vierteljahreszeitschrift sind dort fast 350 Interviews erschienen, von denen nun die Edition Weltkiosk im C. W. Leske Verlag ein Dutzend ausgewählt und in deutscher Übersetzung vorgelegt hat. (Ich muss das so unpersönlich formulieren, denn einen Herausgeber im eigentlichen Sinn scheint diese Sammlung nicht zu haben. Die Übersetzer heißen Henning Hoff, Judith und Alexandra Steffes; letztere hat auch ein knappes Vorwort geschrieben. Leider verrät sie dem Leser nicht, welche Kriterien gerade diese Auswahl bestimmten.)
Ohne Einschränkung darf ich zunächst den Vorsatz preisen, dem deutschen Leser diese Meisterwerke der Befragungskunst nahezubringen. Selbst von jenen Autorinnen und Autoren, die mir bisher fremd waren und auch durch ihre Antworten mein Interesse an ihrem Werk nicht so stark wecken konnten, dass ich in nächster Zeit eins ihrer Werke lesen müsste, habe ich nun doch immerhin eine recht deutliche Vorstellung. Köstlich amüsiert hat mich Dorothy Parker, zu deren Short Storys ich vor vielen Jahren trotz mehrfacher Versuche keinen rechten Zugang finden konnte, was möglicherweise damit zu erklären ist, dass ich seinerzeit eine Verehrerin ihrer Prosa kannte, die mir mit ihrem humorlosen Suffragetten-Appeal ganz schrecklich auf die Nerven ging. Von Françoise Sagan kannte ich außer den Titeln ihrer Bücher nur die Verfilmung ihres Debutromans Bonjour tristess, die ich mir in einer Periode heftigster Leidenschaft für Jean Seberg zugemutet habe und nahezu unerträglich fand. Als das Mädchen aus gutem Hause in meinem Geburtsjahr befragt wurde, zählte sie gerade einmal 21 Jahre und gab Antworten wie eine abgebrühte Existenzialistin. Insofern habe ich sie bisher wohl unterschätzt. Da ich nun weiß, dass sie keineswegs das naive Hühnchen war, für das ich sie hielt, weil ich sie vermutlich mit der Bardot und mit Mireille Mathieu in einen Topf warf, glaube ich stattdessen erkannt zu haben, dass sie ein viel zu früh gereiftes, altkluges Wesen war, größenwahnsinnig und ohne stabile Orientierung. Truman Capote erscheint mir im Interview ganz so, wie ich ihn bisher wahrgenommen habe. Er schwindelt auf eine Weise, dass er damit mehr über sich sagt, als wenn er streng bei der Wahrheit bliebe; und er übertreibt, doch wenn er es nicht täte, hätte man das Gefühl, er würde untertreiben. Eine wirkliche Überraschung in zweifacher Hinsicht bot mir das Interview mit Ernest Hemingway, das der Chefredakteur der Paris-Review, George Plimpton führte. Erstens sind die Auskünfte des bulligen Mannes über seine Schreibtechnik außergewöhnlich präzise, feinsinnig und gewissenhaft. Er erinnert mich darin an Joseph Roth, mit dem er eigentlich doch nur eines gemeinsam hatte: den exzessiven Alkoholismus. Und zweitens verzückt mich geradezu seine gnadenlose Aufrichtigkeit im Umgang mit schwachen Fragen. Ein Beispiel? Plimton fragt: „Was würden Sie als bestes intellektuelles Training für einen angehenden Schriftsteller ansehen?“ Und Hemingway antwortet: „Sagen wir, er sollte rausgehen und sich aufhängen, weil er feststellt, dass Schreiben, nun, unvorstellbar schwer ist. Dann sollte er ohne Gnade heruntergeschnitten werden und gezwungen, für sich alleine so gut zu schreiben, wie er es kann, bis zum Ende seines Lebens. Immerhin wird er mit der Geschichte des Erhängens anfangen können.“ (S. 65.) Während ich bei Hemingway ein negatives Vorurteil hatte, sah ich Vladimir Nabokovs Auskünften mit gelassener Vorfreude entgegen – und wurde bitter enttäuscht! Dabei hätte ich darauf gefasst sein können, denn in der Vorbemerkung erfahren wir, dass der große Meister sich die Fragen vorab nach Montreux schicken ließ und seine Antworten von A bis Zett vorformulierte, um sie dem Interviewer beim vereinbarten Gesprächstermin schwarz auf weiß auszuhändigen. Wie soll ich das denn finden? Welche kleinliche Angst steckt dahinter, auch nur ein falsches oder nur missverständliches Wort von sich zu geben? Dabei hätte Nabokov wie alle anderen Befragten auch ohnehin die Gelegenheit erhalten, seine Antworten vor der Drucklegung zu überarbeiten oder zu streichen. Ist es Zufall, dass diese Enttäuschung in eine Zeit fällt, da meine Begeisterung für das Werk Nabokovs sich spürbar abschwächt? Zu den drei nächsten Autoren – Kurt Vonnegut, Heinrich Böll und Philip Roth – kann ich summarisch bekennen, dass ich ihre Aufnahme in diese Sammlung bedaure, stehlen sie doch den Platz für solch ungleich interessantere Geister wie Julio Cortazar, Raymond Carver oder Primo Levi. Die letzten vier – Toni Morrison, Orhan Pamuk, Joan Didion und David Grossman – kannte ich bislang nur ganz oberflächlich. Jeden einzelnen von ihnen würde ich gern näher kennenlernen, wenn ich nicht zu viel Zeit mit meinem eigenen Schreiben verschwenden müsste. So reicht es nur für eine knappe Sympathiebekundung. Ich entdeckte bei ihnen einen Ernst, eine Weite und eine Leidenschaft, die sicher hervorragende Voraussetzungen sind, um große Werke zu schaffen. (Allerdings muss ich, was die Leidenschaft betrifft, bei Joan Didion gewisse Abstriche machen. Sie erschien mir – vielleicht insofern ein direktes Gegenstück zu Toni Morrisson – in vielen ihrer Antworten eher unterkühlt.)
Ich habe das 350 Seiten starke Buch auf einen Rutsch in drei Tagen gelesen, auf ,meiner‘ sonnigen Bank am Blücherturm und nachts in meinem blauen Ohrensessel vorm Zubettgehen. Es war eine streckenweise unterhaltsame und gelegentlich sogar lehrreiche Lektüre, besonders dann, wenn es um die ganz profanen technischen Fragen und Probleme des Schreibens ging. Mit großem Interesse habe ich auch die wenigen Passagen zur Kenntnis genommen, in denen einzelne Autoren auf ihr Verhältnis zu ihrem Lektor zu sprechen kommen – verständlich, da ich selbst in jüngster Zeit diese Tätigkeit als professionelle Nebenbeschäftigung betreibe. Toni Morrison schwärmt von ihrem Lektor Bob Gottlieb: „Was ihn so gut machte für mich waren mehrere Dinge – zu wissen, was man nicht anrührt; all die Fragen zu stellen, die man wahrscheinlich sich selbst gestellt hätte, hätte man die Zeit gehabt. Gute Lektoren sind wirklich das dritte Auge: sachlich, leidenschaftslos. Sie lieben nicht dich oder dein Werk; das ist für mich das Wertvolle – nicht Komplimente. Das ist für mich hilfreich. Manchmal ist es unheimlich. Der Lektor legt seinen Finger genau auf die Stelle, die schwach ist; der Autor weiß es, war aber zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage, sie besser hinzubekommen. Oder vielleicht dachte der Autor, es könnte funktionieren, war sich aber nicht sicher. Gute Lektoren identifizieren die Stelle und machen manchmal Vorschläge. Manche Vorschläge sind nicht hilfreich, da man einem Lektor nicht alles erklären kann, was man da zu tun versucht. Ich könnte unmöglich all diese Sachen einem Lektor erklären, da das, was ich mache, auf so vielen Ebenen zu funktionieren hat. Aber wenn in dieser Beziehung etwas Vertrauen steckt, etwas Wille zuzuhören, können außergewöhnliche Dinge passieren. Ich lese dauernd Bücher, von denen ich weiß, dass sie nicht von einem Korrekturleser profitiert hätten, sondern von jemandem, der das Buch schlicht durchgesprochen hätte.“ (S. 214.)
Da beneide ich Toni Morrison allerdings, denn ich lese vielmehr dauernd Texte aller Art, die zuallererst einmal eines gründlichen Korrekturlesers bedurft hätten. Und leider macht auch das hier zu würdigende Buch da keine Ausnahme, hätte es doch einen scharfsichtigen „letzten Leser“ vor der Drucklegung so sehr verdient! Immer wieder stolpert der Leser über kleine Fehlerchen, nicht weltbewegend, aber eben doch den Lesefluss störend, beispielsweise gehäuft fehlende Buchstaben am Ende eines Wortes. In einem Absatz stand gleich zweimal „and“ statt „und“. Das passiert einem Übersetzer aus dem Englischen eben; aber liest denn keiner noch mal drüber? Vermutlich gab es wie so oft ganz zum Ende des langen Produktionswegs zeitlichen Druck, der den letzten Schliff unmöglich machte. Das ist schade – und umso mehr, da ja heutzutage bei einer zweiten Auflage in aller Regel die Ausmerzung dieser Fehler nicht finanzierbar ist. (Auch ein Vorteil, nebenbei bemerkt, von Weblogs wie diesem. Ich korrigiere dauernd an meinen älteren Texten herum, bis sie endlich – hoffentlich! – perfekt sind.)
Eine letzte Bemerkung noch zum Verlag. Die Edition Weltkiosk im C. W. Leske Verlag mit Sitz in London ist ein Imprint des Düsseldorfer Lilienfeld-Verlags, dessen kleines und feines Programm ich seit seiner Gründung vor vier Jahren mit Wohlwollen und wachsender Neugier beobachtet und gelegentlich in meinen Blogs kommentiert habe. Zu dem neuen Engagement schreiben die Lilienfeld-Verleger Viola Eckelt und Axel von Ernst in ihrer Frühjahrsvorschau: „Durch die Übernahme des traditionsreichen C. W. Leske Verlages als Imprint werden wir im nächsten Jahr gleich 190 Jahre alt!“ Bald wollen die beiden unter diesem Namen ein Sachbuchprogramm starten. Nun ist das mit dem Reichtum der Traditionen ja manchmal eine vertrackte Sache. In diesem Fall ergibt die Recherche, dass der 1821 in Darmstadt gegründete C. W. Leske Verlag ursprünglich ein Sprachrohr des Vormärz war, im Laufe seiner langen Geschichte aber weit in die rechte, nationalistische Ecke hinüberwanderte. Bedeutende Sortimentsschwerpunkte waren über viele Jahre hinweg Kriegsgeschichte und Militärkunde. Was der Verlag in der Zeit des Nationalsozialismus getrieben hat, weiß ich nicht. Sehr interessant ist jedenfalls die rege Betriebsamkeit, die er in den 1950er-Jahren entfaltete, als er sich mit nationalkonservativen politischen Sachbüchern von Autoren wie Horst Mahnke aus der Deckung traute, jenes vormaligen SS-Hauptsturmführers, der es im Nachkriegsdeutschland der Adenauer-Ära bis zum Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger schaffte. Was wundert es, dass Mahnke sein gemeinsam mit dem ehemaligen SS-Hauptsturmführer Georg Wolff verfasstes Buch 1954 – Der Frieden hat eine Chance just bei C. W. Leske erscheinen ließ, war dessen Verlagsleiter seit 1953 doch kein geringerer als Franz-Alfred Six, SS-Brigadeführer und Amtsleiter im berüchtigten Reichssicherheitshauptamt von Reinhard Heydrich und Heinrich Himmler. (Letzterer kommt übrigens auch in Jonathan Littells Roman Les Bienveillantes vor, deutsch erschienen unter dem Titel Die Wohlgesinnten.) Dieser Clique gelang es in der Nachkriegszeit sogar, Augsteins Spiegel als Medium für antisemitische und den Faschismus exkulpierende Artikel zu nutzen, wie erst jüngst Peter-Ferdinand Koch in einer verdienstvollen Monographie noch einmal in allen für das Hamburger Magazin nicht eben schmeichelhaften Details nachgewiesen hat. Ich will damit nur sagen, dass die 190 Jahre adoptierte Verlagsgeschichte offenbar mehr hergeben als die nobel schimmernde Patina einer nicht weiter hinterfragten „Tradition“. Es stünde dem Lilienfeld-Verlag gut zu Gesicht, wenn er diesen Stier bei den Hörnern packte und einen investigativen Historiker beauftragte, die Geschichte des Darmstädter Verlags C. W. Leske einmal bis in die letzten finsteren Falten auszuleuchten. Vielleicht gelingt das ja bis zur 200-Jahr-Feier?
[die PARIS REVIEW Interviews – 01. A. d. Engl. v. Alexandra Steffes, Judith Steffes u. Henning Hoff. London / Berlin: Edition Weltkiosk im C. W. Leske Verlag, 2011. – ISBN 978-3-942377-01-0. – 19,90 €.]