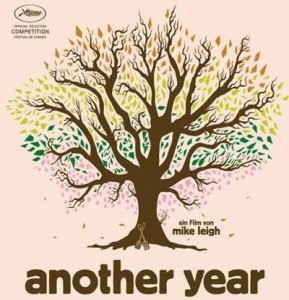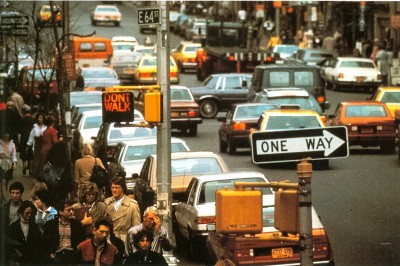Zu Besuch bei Freunden in Düsseldorf. Manche Räume versetzen mich in einen Zustand wohliger Perplexität. (Ich weiß, dass das eigentlich eine unmögliche Begriffskonstruktion ist.) Bin ich drin, fühlt es sich an, als steckte ich in einer besseren Haut. Verlasse ich sie wieder, ist das Gefühl folglich wie eine Häutung. Ich streife ihre Atmosphäre ab und bin wieder der traurige Alte. Ernüchterung! Fast könnte man sagen: Es ist, als würde mir das Fell über die Ohren gezogen und ich stünde nackt und frierend in der grauen Landschaft. Aber das schösse übers Ziel hinaus, denn nur im ersten Augenblick der Verstoßung aus der Zimmeridylle erscheint mir die übrige Welt so. Die geschwinde Rückkehr in die Üblichkeit hindert, dass sich Schwermut festbeißen könnte.
Archive for the ‘Flanerie’ Category
Wintergarten
Saturday, 11. February 2012Straßenbilder
Tuesday, 10. January 2012Schon seit einem guten Jahr trage ich mich mit dem Plan, eine Reihe von langen Straßen meiner Vaterstadt von einem Ende bis zum andern abzuschreiten und dabei zu fotografieren, mit dem Ziel, ein insofern lückenloses Bild der jeweiligen Straße entstehen zu lassen, als im Mittelpunkt jeder Fotografie der Standpunkt der auf sie folgenden zu sehen ist. Ich war auf diesen Gedanken nach unserem letzten Umzug gekommen, denn nun wohnen wir am Ende bzw. Anfang einer der längsten Straßen Essens, der Rellinghauser Straße; und gleichzeitig, wie schon bei unserem vorletzten Wohnort, am Rande einer weiteren sehr langen Straße, der Frankenstraße. Ein günstiger Zeitpunkt für die Realisation dieses Projekts wäre sicher der frühe Morgen rund um die Sommersonnenwende am 21. Juni, denn dann muss man auf Passanten kaum Rücksicht nehmen, deren Missfallen es vielleicht erregen könnte, in der Öffentlichkeit fotografiert zu werden. Ein weiteres Problem stellt sich mit den Autos, deren Nummerschilder ins Bild kommen könnten, was ebenfalls auf einen Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte hinausliefe. Notfalls müssten die Autonummern per Bildbearbeitung unkenntlich gemacht werden. Ich denke noch darüber nach, ob es vielleicht reizvoll wäre, jede dieser langen Straßen in beide Richtungen abzuschreiten, denn so ergäbe sich ja ein jeweils völlig anderer Eindruck. Die einzelnen Bilder würde ich hier im Blog veröffentlichen und meine Erinnerungen zu den verschiedenen Standorten zu „Bildunterschriften“ verarbeiten. Möglicherweise könnte ich die Aufnahme der Straßenbilder auch alle zehn Jahre wiederholen, um die Veränderungen zu registrieren.
[Das Titelbild zeigt das Ende der Rellinghauser Straße mit der Einmündung in die Frankenstraße am heutigen Tag um 12:00 Uhr.]
Schreibvoraussetzungen
Tuesday, 09. August 2011Ich bin seit Wochen gesundheitlich etwas angeschlagen. Das bekommt auch mein Blog zu spüren. Die schöne Regelmäßigkeit eines täglichen Postings, die ich in den Monaten Mai und Juni durchhalten konnte, ist zumindest vorläufig passè. Ich habe gegenwärtig, wie man sagt, ganz andere Sorgen. Bei dieser Gelegenheit wurde mir wieder einmal bewusst, wie viele Voraussetzungen doch erfüllt sein müssen, damit ich überhaupt erst mit dem Schreiben beginnen kann – von einem Gelingen mal ganz abgesehen!
Mein kleines Arbeitszimmer ist der einzige Ort, an dem ich schreiben kann, jedenfalls auf die nahezu definitiven Ergebnisse hin, die ich hier publiziere. Stichworte, Notizen, Skizzen kann ich handschriftlich überall zu Papier bringen, aber für die Niederschrift meiner Miniatur-Pentaloge muss ich auf diesem Stuhl sitzen, an diesem Tisch, mit Blick auf die kleine Straße. Ich brauche meinen Rechner samt Peripherie, die kleine Handbibliothek aus Notizbüchern und Nachschlagewerken, frische Luft und absolute Ruhe.
Mein Kopf muss frei sein von allen störenden Zwischengedanken. Ist noch Butter im Kühlschrank? Droht ein Telefonanruf? Steht gar ein Besuch vor der Tür? Pures Gift für meine kreative Abgeklärtheit ist ein Streit vor Arbeitsbeginn. Aber auch bevorstehende Ereignisse, wie ein seltenes Zusammentreffen mit einem lange nicht gesehenen Freund oder ein Termin bei einer Behörde, können mich gedanklich so sehr dominieren, dass ich mich nicht mit voller Kraft auf die aktuelle Niederschrift konzentrieren kann.
Zeitdruck ist kontraproduktiv, erhöht nach aller Erfahrung mindestens die Fehlerquote. Blasendruck mach mich nervös und führt mich in Versuchung, die zweitbeste Formulierung zu akzeptieren, weil ich mich erleichtern muss. Bevor ich wieder an der Tastatur sitze, ist mir meist nicht mehr präsent, dass das Provisorium noch auf Ablösung durch ein Optimum wartet. Generell sind falsche Druckverhältnisse abträglich, ob beim Blut- oder Luftdruck. Zu wenig Druck wirkt in aller Regel lähmend, zu hoher blockiert.
Vernichtend ist schließlich für mein Schreibvermögen Schmerz, in all seinen Facetten. Selbst ein leichtes Pochen im Backenzahn, sogar schon ein lästiges Jucken zwischen den Schulterblättern macht mich völlig unfähig, auch nur einen einzigen brauchbaren Satz abzusondern. Analgetika betäuben mit dem Störenfried zugleich auch die Inspiration und das Empfinden für Wohlklang und syntaktische Proportionen. Sorge und Angst verderben mir die gute Laune. Krankheit zwingt mich tief unter mein Niveau.
Ausflug zum Tetraeder
Sunday, 03. July 2011Vielleicht bin ich durch meine Hollandreise auf den Geschmack gekommen, vielleicht will ich aber auch zur Abwechslung mal nicht den Spielverderber geben, indem ich wie sonst alle Vorschläge zu Wochenendabenteuern vonseiten meiner nächsten Angehörigen empört von mir weise. Wie dem auch sei, ich willigte heute ein, meine Gefährtin samt Sohn, Schwiegertochter und Enkelkind bei einem kulturellen Sonntagsausflug im Revier zu begleiten. Ursprünglich war der Besuch der Ausstellung Krupp. Fotografien aus zwei Jahrhunderten geplant, die vor zwei Wochen in der Villa Hügel eröffnet wurde. Es stellte sich aber heraus, dass just an diesem Wochenende die Villa geschlossen bleibt. Den Grund erfährt man nicht. So disponierten wir kurzfristig um und beschlossen, unserer Schwiegertochter das Haldenereignis Emscherblick in Bottrop zu zeigen, kurz „Tetraeder“ genannt.
Wir fuhren mit der Straßenbahn Linie 105 bis zum Essener Hauptbahnhof und von dort mit S-Bahn Linie 9 bis nach Bottrop-Boy. Der Fußmarsch bis zur Halde an der Beckstraße, die mit 60 Metern Höhe einer der höchsten im gesamten Ruhrgebiet ist, erwies sich doch als weiter denn gedacht. Bald kam zwar der Tetraeder in Sicht und schien gar zum Greifen nah. Aber da der Weg hinauf in langgezogenen Serpentinen zu erklimmen ist, benötigten wir per pedes immer noch eine halbe Stunde, bis wir endlich auf dem Gipfel standen.
Ich war kurz nach der Eröffnung dieser Landmarke Mitte der 1990er Jahre schon einmal hier gewesen, erinnerte mich aber nicht mehr daran, dass man ja von hier oben aus tatsächlich einen Panoramablick weit hinaus ins Land hat. Seither hat die Natur die Industriebrache wieder in Besitz genommen. Ringsum ist alles grün, eine bunte Vielfalt von Bäumen und Buschwerk führt vor, dass die industriellen Verwüstungen glücklicherweise doch längst nicht immer so unumkehrbar sein müssen, wie man meinen sollte.
Ich habe mich schon bei der Errichtung des Bauwerks von Wolfgang Christ gefragt, warum ausgerechnet ein Tetraeder als Form für diesen „Aussichtsturm“ gewählt wurde. Ich dachte, dass es vielleicht einen Zusammenhang zur atomaren Struktur des Kohlenstoffs gäbe. Dass sich, wie es heißt, das „ebenmäßige Schüttungsprinzip der Halde“ in der Addition und Schichtung der Stahlrohrelemente zu Tetraedern wiederhole, scheint mir nicht unmittelbar einleuchtend. Immerhin habe ich heute gelernt, dass der innere Aufbau des Tetraeders aus dem Sierpinski-Dreieck abgeleitet ist – aber auch das hat wohl kaum einen inneren Bezug zur Region. Einen starken Eindruck machte bei meinem zweiten Besuch die linsenförmige Vertiefung aus künstlichem Berggestein, ohne dass ich mir so recht erklären konnte, was nun eigentlich in mir zum Klingen gebracht wurde, als ich diesen flachen Krater durchschritt.
Der Aufbruch vom Gipfel erfolgte dann etwas überstürzt, weil sich herausstellte, dass hier auch ein Elektrobus bis zum ZOB Bottrop verkehrt und wir diese Gelegenheit zu einer bequemen Rückfahrt nicht versäumen wollten. (Der nächste Bus wäre erst eine Stunde später abgefahren.) Auf dem Heimweg kreuz und quer durch Bottrop wurde uns wieder einmal bewusst, wie deprimierend manche Wohngegenden in unserer Heimatregion doch sind. Von Nahem sieht manches eben weit weniger erfreulich aus als aus der Distanz eines erhabenen Panoramablicks.
Memogramm der Hollandreise (Tag II)
Friday, 24. June 2011Erstmals gegen sechs Uhr im Dienstmädchenbett aufgewacht. Dann der verabredeten Frühstückszeit um acht Uhr entgegengeschlummert. Den Sohn hält es länger in den Federn. Die Kinder machen sich auf den Schulweg, gebeutelt von einer Prüfungswoche mit vielen Klassenarbeiten hintereinanderweg, offenbar eine Spezialität des niederländischen Schulsystems. Tom fährt zum Jachthaven in Stavoren, wo seine Leihboote liegen. Zum Wochenende kommen die Boote vom Meer zurück und müssen an neue Mieter übergeben werden.
Annette zeigt uns nun Workum. Der Sohn kennt das Städtchen schon aus Kindertagen, hat er doch hier mit seinen Geschwistern und der Mutter mehrere Ferienaufenthalte erlebt und nach glaubhaftem Bekunden in bester Erinnerung behalten. Ich hingegen betrete Neuland. (Schon damals war mir die seltene Ruhe daheim an meinem Arbeitsplatz wertvoller als der bei den meisten Mitmenschen so beliebte Tapetenwechsel.) Als uns durch eine schmale Gracht ein Segler mit dem Namen Tijdgeest entgegenkommt, verschlägt ’s mir fast die Sprache. Wie das Boot so ruhig dahingleitet, kommt es mir vor wie ein Gleichnis auf die mir oft so unbegreifliche Paniklosigkeit meiner Zeitgenossen.
Nun ist uns doch noch unser Museumsbesuch vergönnt, und was für einer! Das Werk des malenden Lumpensammlers Jopie Huisman beeindruckt durch seine planvolle Entwicklung. Offenbar ist der Mann sehr überlegt an seine selbstgestellte Aufgabe herangegangen und hat seit den frühen 1960ern zunächst maltechnisch allerlei ausprobiert, bevor er schließlich nach Jahren seine persönliche Handschrift und seinen Blick auf die Dinge fand. Diese Dinge waren vor allem die verachlässigten, abgenutzen Gegenstände, die seine Mitbürger fortwarfen und die auf seinem Karren landeten. Viel Fleiß und Sorgfalt steckt in seiner Malerei und Zeichenkunst. (Imposant auch Huismans Kollektion von Gewichtskästen und Waagen, mit der er die lange Geschichte des Betrugs zu dokumentieren trachtete, denn viele Gewichte sind durch unscheinbare „Abnutzungen“ offenbar leichter, als ihr Nennwert vorgibt.)
Anschließend besichtigen wir Toms Arbeitsplatz und seine Boote, deren Namen mit C beginnen und auf A enden, wie Carolina, Caba oder Camilla. So heißt das komfortabelste Schiff dieser Reihe zufällig wie meine Enkelin. Ungeschickt wie ich bin, reiße ich in einem anderen Boot, das wir uns von innen anschauen, die Klinke einer Schlafkojentür aus der Verankerung, was mir für eine unanständig lange Zeit die Stimmung verdirbt. Dabei ist der Schaden, den ich damit angerichtet zu haben fürchte, doch viel geringfügiger und leichter behebbar, als ich mir einrede und man mich im Scherz wohl auch glauben machen will. Ich ahne den Schabernack und mime nun so lange den arglos leidenden Übeltäter, bis Tom mich aus meinem Verdruss erlöst, indem er mir offenbart, wie geringfügig der Aufwand einer Reparatur doch eigentlich sei.
Mein Sohn und ich gönnen uns schließlich einen frischen Kabeljau aus der besten Bratküche von Stavoren. Einen so köstlichen Fisch habe ich lange nicht mehr gegessen. Mein Sohn hatte beschlossen, von hier aus per Fähre übers IJsselmeer nach Enkhuizen und von dort mit der Bahn zurück nach Amsterdam zu fahren. So nehmen wir am Steg Abschied von ihm und winken, bis das Schiff außer Sicht ist. Annette packt in Workum ihre sieben Sachen und wir fahren gemeinsam mit dem Automobil in unser beider Heimatstadt. Unterwegs nutzen wir die Gelegenheit zum Austausch über Themen, die nur uns beide interessieren. Die wenigen Gesprächspausen stopfen wir mit ein paar Liedern von Hindi Zhara. Um fünf Uhr nachmittags bin ich wieder daheim.
Memogramm der Hollandreise (Tag I)
Thursday, 23. June 2011Wecker 5:25 Uhr. Eine Tasse Kaffee, zwei Brote mit Kochschinken. Fußweg zum Rathaus Rellinghausen bei trockenem Wetter, angenehm kühl, klare Luft, Vogelgezwitscher. Mit dem Nachtexpress-Bus, den ich noch nie genutzt habe, zum Hauptbahnhof Essen, von dort mit einem weiteren Nachtexpress-Bus zum Oberhausener Hauptbahnhof. Von dort mit dem ICE über Duisburg, Arnhem, Utrecht nach Amsterdam. Ankunft pünktlich um halb zehn, wo der älteste Sohn und seine friesische Freundin Gerda mich gut gelaunt erwarten. Zum Harnabschlagen und auf einen Weckkaffee in ein rummeliges Restaurant mit überforderten Kellnern noch im Centraal-Bahnhof.
Per Straßenbahn dann in Gerdas Wohnung in der Marco Polostraat. Nach kurzem Aufenthalt zu dritt großer Spaziergang, unter andrem durch den schönen Vondelpark bis ins Museumsviertel. Nach Abwägung von Kosten und Nutzen werden aber Ausstellungsbesuche, ob im Van Gogh Museum oder im Rijksmuseum, einstimmig verworfen. Einkehr auf Bierbänken vor einer kleinen Gaststätte. (Kann man dann eigentlich von „Einkehr“ sprechen?) Aß eine sehr fruchtige Tomatensuppe mit bestem Appetit, aber glücklicherweise vor Inaugenscheinnahme der sanitären Anlagen, die mir diesen möglicherweise verdorben hätte.
Unterdessen stets angeregte Unterhaltung über disparate Gegenstände, wie sie uns die durchwanderten Stadtkulissen gerade zutrugen. Eindrücklich etwa Gerdas Schilderung vom wilden Leben und tragischen Tod des niederländischen Musikers, Küstlers und Enfant terribles Herman Brood, der sich vom Dach des Amsterdamer Hilton-Hotels herabstürzte, weil ihm seine Drogensucht übern Kopf wuchs. (Dass dieses traurige Ereignis sich zufällig an meinem bevorstehenden Geburtstag zum zehnten Mal jährt, erfahre ich gerade erst beim Nachlesen des Wikipedia-Artikels über Brood.) Auf dem Rückweg Einkauf bei Albert Heijn, einer Ladenkette, bei der die muslimischen Kassiererinnen allesamt schwarze Kopftücher trugen.
Rechtzeitig zurück in Gerdas Wohnung, um den für fünf Uhr nachmittags verabredeten Besuch Annette B.s aus Workum abzuwarten, die uns nach dorthin mit ihrem Automobil abholt. (Leider kann Gerda nicht mitkommen, weil sie am nächsten Tag beruflichen Verpflichtungen nachzukommen hat. Oder waren es Verpflichtungen im Zusammenhang mit der überaus problematischen Wohnungssuche? Es ist nahezu unmöglich, in dieser Stadt eine akzeptablie Mietwohnung zu finden, wenn man sich hierum nicht entweder schon vor vielen Jahren angemeldet hat oder doch mindestens das Einommen eines Chefarztes oder die Beziehungen eines Immobilienmaklers hat.) So gehen wir zu dritt ohne Gerda auf die Suche nach einer italienischen Gaststätte oder einer holländischen Pommesbude und finden kurz vorm Verhungern in der Jan van Galenstraat tatsächlich die kleine Pizzeria Martini mit originellem Ambiente und freundlicher Bedienung durch den Inhaber. Anschließend fahren wir über den fast dreißig Kilometer langen Afsluitdijk durchs IJsselmeer nach Workum.
Tom und die Kinder begrüßen uns. Hausbesichtigung und Tagesausklang. Zu Bett im „Dienstmädchen-Zimmer“. Fülle der Eindrücke hindert mich zunächst am Einschlafen. Lese darum noch in einem beliebig aus dem Bücherregal gegriffenen Suhrkamp-Bändchen aus dem Bestand von Annettes verstorbener Schwester Karin: Edmund Wilsons Auf dem Weg zum Finnischen Bahnhof. Bedrückende Schilderungen des Lebens der arbeitenden Bevölkerung im Manchester des XIX. Jahrhunderts. – Traum von einem gefluteten Keller, in dem quietschend die Ratten ertrinken.
Nistgewohnheiten von Stadtvögeln
Wednesday, 01. June 2011Die schmalen Streifen Restnatur, die sich in der Großstadt gegen die Totalherrschaft menschlicher Artefakte so gerade noch behaupten können, verbergen mitunter unerwartete Geheimnisse, Rätsel und Gefahren.
So beobachtete ich heute einen dunklen Vogel mittlerer Größe, der mit einem Sträußlein dünner Zweige im Schnabel in einem Buschwerk verschwand, das über einen Zaun am Rande eines Fußwegs herabquillt. Diesen Ort suche ich nahezu täglich auf, wenn ich mit unserer Hündin Gassi gehe.
Leider bin ich ornithologisch zu wenig bewandert, um mit Gewissheit sagen zu können, um welche Art Vogel es sich handelte. Er hatte etwa die Größe einer Schwarzdrossel, allerdings keinen gelben Schnabel, auch war sein Gefieder nicht tiefschwarz, sondern eher dunkelgraubraun. Und zudem schien er mir etwas schlanker, als Drosseln gewöhnlich sind. Immerhin begriff ich auf den ersten Blick, dass dieser Vogel mit seinem Nestbau beschäftigt war. Und da er aus dem Gebüsch nicht wieder auftauchte, folgerte ich, dass das Nest sich offenbar dort verbarg.
Mein nächster Gedanke war, dass dem zu erwartenden Nachwuchs des Vogels vielleicht Gefahr drohen könnte, wenn sich der Zaunbesitzer einfallen ließe, demnächst besagtes Gebüsch zu stutzen. Sollte ich den Mann, den ich vom Sehen kenne und der mich entfernt an Pettersson erinnert, warnen? Dann fragte ich mich, wie lange eigentlich ein solcher Vogel für den Bau seines Nestes benötigt, wie lange er brütet und wie lange es schließlich dauert, bis die Brut ihr Nest verlässt? Insgesamt drei Wochen? Oder eher drei Monate? Ich stellte wieder einmal fest, dass ich in solchen Dingen nicht die Spur einer Ahnung habe. Warum auch? Für mich hing ja tatsächlich in meinem bisherigen Leben nichts davon ab. Jetzt aber stand im schlimmsten Fall das Leben einiger gerade erst geborener Vögel auf dem Spiel!
Also sah ich bei Wikipedia nach, mangels zuverlässiger Klassifizierung unter Schwarzdrossel. (Dass dieser Vogel mit der Amsel identisch ist, war mir auch noch nicht klar.) Was ich dort über Neststandort und Nestbau dieser Vögel erfuhr, fand ich ausgesprochen interessant, so die Vorliebe für runde Buchstaben und die Abneigung gegen die Farbe Rot. Jetzt weiß ich, dass das Weibchen zwei bis fünf Tage für den Nestbau benötigt, ein bis drei Tage vergehen bis zur Eiablage. Die einzelnen Eier, vier bis fünf an der Zahl, werden im Abstand von 24 Stunden gelegt. Die Brutdauer liegt zwischen 10 und 19 Tagen, im Mittel bei 13 Tagen. Die Nestlinge sind etwa 13 bis 15 Tage nach dem Schlüpfen in der Lage, das Nest zu verlassen. Angenommen, „mein“ Vogel hätte gerade heute erst mit dem Nestbau begonnen, dann müsste ich sicherheitshalber dafür Sorgen, dass diese hängende Hecke sieben Wochen lang nicht beschnitten wird, also frühestens am 20. Juli. Ich werde mit Pettersson reden müssen.
Außerfahrplanmäßig
Monday, 23. May 2011Ich führerscheinloser Fußkranker bin infolgedessen gewohnheitsmäßiger Vielnutzer von öffentlichen Omnibussen und Straßenbahnen. Wie jede andere Fortbewegungsweise, und wie vielleicht überhaupt alle Handlungsoptionen im Leben hat auch diese ihre Vorzüge und Nachteile. Heute widerfuhr mir ein Ereignis, das mich noch nach Stunden schwanken lässt, ob ich es als Ärgernis oder Glücksmoment werten soll.
Als gebürtigen Rüttenscheider mit Wohnsitz in Rellinghausen zieht es mich zum Einkaufen alle paar Tage an meinen Herkunftsort, den ich wahlweise „untenrum“ mit der Straßenbahnlinie 105 über den Moltkeplatz oder „obenrum“ mit der Buslinie 142 über die Martinstraße erreichen kann. Letztere Variante bevorzuge ich, weil sie zeitsparender ist und durchs Grüne führt. Zudem fährt der Bus fast vor unserer Haustür ab, während ich zur Tramhaltestelle fünf Minuten laufen muss. Heute hatte ich meine paar Einkäufe auf der Rü schnell erledigt und stand frühzeitig an der Bushaltestelle Martinstraße, von der außer dem 142er auch der 160er in Richtung Stoppenberg abfährt. Hier wurde vor einem knappen Jahr versuchsweise eine digitale Anzeigetafel montiert, auf der die aktuellen Abfahrtzeiten der jeweils nächsten Busse abzulesen sind. Diese Zeiten kann der Fahrgast zwar auch den an allen Haltestellen aushängenden Plänen entnehmen, aber vermutlich soll diese elektronische Anzeige es ermöglichen, auch über gelegentliche Verspätungen zu informieren. Heute wurde ich nun Zeuge, wie zwei Elektriker unter der Anzeigetafel eine Leiter aufklappten, hinaufstiegen, einen Kasten öffneten und sich an den labyrinthischen Verdrahtungen mit Schraubendrehern zu schaffen machten. Ihren großen Werkstattwagen hatten sie auf der Bushaltespur geparkt, sodass diese nicht mehr in voller länge frei war. Nun näherte sich „mein“ 142er und hielt in einigem Abstand hinter dem Werkstattwagen, was mir sofort plausibel war, denn um an der Kreuzing plangemäß rechts abbiegen zu können, musste der 142er sich noch einigen Spielraum zum Manövrieren lassen. Ich stieg ein und setzte mich gleich auf den ersten Platz rechts neben dem Fahrer, da der von mir sonst bevorzugte Platz links, direkt hinter dem Fahrer, von einer Dame mittleren Alters besetzt war. Nachdem offenbar alle wartenden Fahrgäste eingestiegen waren, lenkte der Fahrer sein Gefährt an dem parkenden Werkstattwagen links vorbei auf die rechte der beiden „normalen“ Fahrspuren. Die Ampel stand noch auf Rot, musste aber gleich auf Grün schalten. – Nun ereignete sich etwas Ungewöhnliches.
Von hinten aus dem Bus machte sich lautstark ein junger Mann bemerkbar, der den Busfahrer aufforderte, gefälligst noch zu warten. Hinter uns nähere sich der 160er, vielleicht wollten ja Fahrgäste aus diesem Bus in „unseren“ 142er umsteigen? Und außerdem sei der Fahrer sowieso wieder mal anderthalb Minuten zu früh abgefahren. – Ganz abgesehen davon, dass es jetzt definitiv zu spät war, um die Forderungen des Mannes im Hintergrund zu erfüllen, selbst wenn sie berechtigt gewesen wären, machte nun der Busfahrer seinerseits mit vollem Recht darauf aufmerksam, dass es wegen des außerplanmäßig parkenden Werkstattwagens für den 160er gar nicht möglich gewesen wäre, in die Bushaltespur einzufahren, solange sie noch von unserem 142er besetzt war. Und übrigens sei er auch nicht 90 Sekunden zu früh, sondern bloß 30 Sekunden zu früh abgefahren. Der Fahrgast möge sich also mäßigen und im übrigen das Busfahren ihm, dem Busfahrer überlassen. Seine Argumente trug der Fahrer in wohltuendem Unterschied zu dem Beschwerdeführer sehr sachlich vor. Dieser musste nun allerdings erst recht auf seinem Standpunkt beharren und stimmte ein langes Lamento darüber an, wie ärgerlich es doch immer wieder sei, dass Busse und Bahnen sich nicht an die Fahrpläne hielten, die Fahrer offenbar gar nicht schnell genug nach Hause kommen könnten, es insofern ja kein Wunder wäre, dass die öffentlichen Verkehrsmittel einen so schlechten Ruf hätten – und überhaupt gehe die Uhr des Fahrers wohl eine Minute vor! Dem Gemurmel, das sich seitens einiger älterer Leute rings um diesen Querulanten erhob, war eine verhaltene Zustimmung zu entnehmen, aber von der feigen Sorte, die sich nicht wirklich Farbe zu bekennen traut, sondern ganz schnell wieder verstummt, wenn eine gegenteilige Meinung sich noch lauter und respektgebietender vernehmen lässt. Der Fahrer hatte übrigens offenbar beschlossen, dem Krakeeler kein Paroli mehr zu bieten und sich auf den Verkehr zu konzentrieren, was von großer Besonnenheit zeugte und mich vollends auf seine Seite brachte. – Da geschah die zweite Überraschung!
Völlig unvermittelt, aus dem sprichwörtlichen heiteren Himmel erhob die Dame mittleren Alters links neben mir ihre Stimme und trug nun mit flammender Leidenschaft ihr Anliegen und ihre Sicht der Dinge vor: „Jetzt reicht es! Bevor sie hier den Fahrer weiter belästigen, sollten Sie sich vielleicht zunächst einmal die Beförderungsbedingungen durchlesen. Dort heißt es nämlich, dass Fahrgäste zwei Minuten vor dem fahrplanmäßigen Abfahrttermin an den Haltestellen eintreffen sollen, da es nicht in allen Verkehrssituationen gewährleistet werden kann, dass die Fahrzeuge bis zur letzten Sekunde mit der Abfahrt warten. Ich bin selbst seit 18 Jahren mit einem Busfahrer verheiratet, der nach mancher Schicht nach Hause kommt und mit den Nerven völlig am Ende ist, wegen solch unverschämter Fahrgäste wie Sie einer sind! Ich bin mir sicher, dass ein einziger Tag hinter dem Steuer eines Busses oder einer Straßenbahn ausreichen würde, um Sie nie wieder auf den Gedanken kommen zu lassen, solch ein unbegründetes Urteil über die Tauglichkeit und Redlichkeit dieser Fahrer zu fällen, wie Sie es hier getan haben.“ Punktum.
Der Querulant murmelte noch bis zur nächsten Haltestelle vor sich hin, es sei ja klar, dass die Frau von solch einem Fahrer keine objektive Meinung haben könne, befangen wie sie sei. Er bleibe bei seinem Standpunkt. Dann stieg er aus. Die opportunistischen Claqueure aber hatten sich schon vorher geräuschlos in Luft aufgelöst.
Am Herzen von Köln
Saturday, 07. May 2011Umstände, die hier nicht hergehören, brachten es mit sich, dass ich in relativ kurzer Zeit gleich dreifach meinem Vorsatz untreu wurde, meine Heimatstadt nicht zu verlassen. Nun ist die Reise nach Köln ja keine Ochsentour. Und mein Ökologischer Fußabdruck wird durch die ein oder andere Exkursion dorthin auch nicht wesentlich größer, zumal ich heute mit der S-Bahn reiste. Dennoch spüre ich, wie sehr mich diese rapiden Ortswechsel aus der Balance bringen. Prompt vergaß ich gestern vorm Schlafengehen, meinen Betablocker zu schlucken, und heute früh in der Hektik des Aufbruchs den ACE-Hemmer noch dazu! Bei der Rückfahrt traf ich im Zug Kölner Fans von Bayer Leverkusen auf dem Weg zum Spiel gegen den HSV. Es wurde eng und laut und heiß!
Am rettenden Ufer, in meiner Arbeitsklause zeigte mein Blutdruckmessgerät 154 zu 101, bei einem Puls von 99. Zieht man den Panikeffekt ab, den eine solche Messung beim typischen Hypochonder auslöst, bleibt immer noch ein Ergebnis, das der Hypertoniker nicht alle Tage riskieren sollte. Doch diesmal war die Erfahrung es immerhin wert, dass ich mein Leben aufs Spiel setzte.
Ich war in der Kölner Philharmonie verabredet. Wenn ich mich richtig erinnere, bin ich in den vergangenen dreißig Jahren mindestens fünfmal per Bahn nach Köln gefahren. Jeder andere würde sich an meiner statt vermutlich schämen, dies zuzugeben: Ich wusste trotzdem bis heute nicht, wie nah der Dom am Bahnhof und wie nah beides am Rhein liegt. Ich versuche, mich zu erinnern. Ein Grund könnte sein, dass ich als Atheist und kaltblütiger Verächter aller religiösen Symbolik, erst recht wenn sie mir in Gestalt solch eines steinernen Riesen in den Weg trat, den Blick vor dergleichen ,Einschüchterungs-Architektur‘ reflexhaft niederschlug. Zudem war wohl der kurze Weg vom Dom zum Rhein, den ich heute beschritt, früher durch einen Busbahnhof geradezu verbarrikadiert und wurde erst durch den Neubau von Philharmonie und Museum Ludwig eröffnet.
Beim Aufstieg über eine wundervolle Treppe hinauf zu diesem imposanten Ensemble, mit Dani Karavans geradezu magisch wirkendem Ma’alot als stillem Mittelpunkt, passierten wir eine Gruppe Touristen, die sich auf den Stufen zum Gruppenfoto drapierte – ganz ähnlich wie es täglich tausendmal auf der berühmten Scalinata di Trinità dei Monti geschieht, die wir Deutschen die Spanische Treppe nennen. „Sie waren doch sicher einmal in Rom?“ Nein, da muss ich meinen Begleiter enttäuschen. Im Vorbeigehen schnappen wir noch eine andere Gedankenverbindung auf, von einem der posierenden Sehenswürdigkeiten-Sammler: „Das ist ja hier wie beim Hermannsdenkmal!“
Die Treppe und ihre Stufen – das war das beherrschende Thema des heutigen Köln-Besuchs. Nun bedaure ich, dass ich die Lange Nacht des Deutschlandfunks gelöscht habe, in der es ausschließlich um dieses Thema ging. Mir fiel der Name der zuständigen Wissenschaft leider nicht mehr ein. Sie heißt Scalalogie. (Und die deutsche Koryphäe auf diesem Gebiet ist Friedrich Mielke.)
Filmkritik (III)
Friday, 11. March 2011Wenn ich schon mal ins Kino gehe, dann bemühe ich mich, dies mit ,gehobenem Bewusstsein‘ zu tun. Ich will versuchen zu erklären, was ich damit meine, und das heutige Beispiel eignet sich besonders gut dazu. – Der neueste Film der Coen-Brüder, True Grit, stand zunächst nicht auf meiner Wunschliste, so sehr ich das Regie-Duo seit Blood Simple schätze. Aber grundsätzlich sind Western, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht gerade meine große Leidenschaft, und die meiner Gefährtin erst recht nicht. Doch ohne diese wählerische Begleitperson gehe ich prinzipiell nicht ins Kino. Zudem werde ich immer skeptisch, wenn ein Film sich zum Blockbuster mausert, und erst recht, wenn er die Oscar-Nominierungen einsammelt wie Konfetti auf der Sombrerokrempe. Dass wir uns den jüngsten Film von Joel und Ethan Coen trotz dieser Bedenken am Karnevalsdienstag anschauten, hatte zwei gute Gründe.
Erstens machte mich ein Interview neugierig, das Tobias Kniebe mit den Regisseuren geführt hat („Hat die Inspiration schon jemals zugeschlagen?“; in: SZ v. 9. Februar 2011.) Auf die skeptische Frage, wie sie an diesen alten Stoff herangegangen seien, aus dem vor über vierzig Jahren John Hathaway einen überaus geradlinigen Western gemacht habe, antwortet Ethan: „Wenn man die Story genau betrachtet, ist es ein ziemlich gradliniger Western über Vergeltung. Unser Idee dazu war sehr simpel: Wir wollten dem Roman, der allem zugrunde liegt, möglichst treu bleiben. Wir lieben dieses Buch.“ Ein solches Bekenntnis lässt mich immer aufhorchen. Die Herren Regisseure lieben ein Buch! Und sie gehen zurück zu den Wurzeln, wenn sie ein Remake zu einem alten, seinerzeit erfolgreichen Film wagen!
Dann sahen wir uns zunächst Der Marshal an, jenen Westernklassiker, der am 21. August 1969 Deutschland-Premiere hatte. (Zufällig ein Datum, das für mich tragische Bedeutung hat, aber das ist irrationaler Schnickschnack.) Bei allen Vorbehalten gegen die fragwürdigen Fortschritte der Unterhaltungstechnik ist hier doch einmal zu loben, wie bewuem es heute ist, beinahe jeden älteren Film von einiger Bedeutung auf DVD zu beschaffen und am heimischen PC anzuschauen. John Wayne als Rooster Cogburn, mit Augenklappe und Schnapsflasche, gibt in der Rolle des Titelhelden noch einmal sein Bestes und wurde dafür mit seinem zweiten Oscar als bester männlicher Hauptdarsteller belohnt. Die rachedürstende Mattie Ross wird von der bei Drehbeginn bereits 21-jährigen Kim Darby dargestellt, die den 14-jährigen Trotzkopf dennoch glaubwürdig hinbekommt. Der Film ist unterhaltsam von der ersten bis zur letzten Minute. Auch kleinere Nebenrollen sind trefflich besetzt. So hat mir Cogburns chinesischer Hauswirt Chen Lee (Hom Wing Gim) gut gefallen. Der Darsteller des tödlich angeschossenen Gangsters Moon macht ebenfalls seine Sache sehr gut. Dass es sich bei ihm um keinen Geringeren als Dennis Hopper handelte, kurz vor seinem großen Durchbruch mit Easy Rider im gleichen Jahr, das wurde mir erst beim Studieren der Cast-Liste klar. Der einzige Totalausfall in Der Marshal ist fraglos Glen Campbell als Texas-Ranger La Boeuf. Zu dieser anspruchsvollen Filmrolle, seiner ersten und letzten, ist er gewiss nur gekommen, weil er als berühmter Country-Sänger gut für die Kinokasse war. Er singt den Titelsong und eroberte mit dieser Schnulze vermutlich das Herz der weiblichen Kinofans: “One day, little girl, the sadness will leave your face | As soon as you’ve won the fight to get justice done | Someday little girl you’ll wonder what life’s about | But other’s have known few battles are won alone | So, you’ll look around to find | Someone who’s kind, someone who is fearless like you | The pain of it will ease a bit | When you find a man with true grit || One day you will rise and you won’t believe your eyes | You’ll wake up and see a world that is fine and free | Though summer seems far away | You will find the sun one day.” Nachdem wir das hinter uns gebracht hatten, waren wir nun doch sehr gespannt, wie die Coen-Brüder jene Szenen bringen würden, die uns in ihrem Vorgängerfilm beeindruckt hatten: Mattie am offenen Sarg ihres Vaters, das Henken der drei Ganoven in Fort Smith, die Zeugenvernehmung von Cogburn vorm dortigen Gericht, Matties Ritt durch den Fluss und wie ihr La Boeuf den Hintern versohlt, Moons Verrat und Tod und schließlich Matties Sturz in die Schlangengrube und wunderbare Errettung.
Wir hatten das Glück, die Neuverfilmung in der Essener Lichtburg sehen zu dürfen. Nun könnte ich ellenlang über die Übereinstimmungen und Unterschiede beider Filme referieren, aber damit wäre nichts gewonnen und der Genuss, den ich beim Vergleich der Versionen hatte, ist dadurch ohnehin nicht zu vermitteln. So viel nur: Ich habe beschlossen, mir noch eine dritte ,Verfilmung‘ des Stoffs zu gönnen, nämlich jene, die beim Lesen der Romanvorlage in meinem Kopf entsteht. Sie stammt von Charles Portis und erschien zuerst 1969 unter dem Titel Die mutige Mattie bei Rowohlt in deutscher Übersetzung. (Anlässlich der Coen-Verfilmung ist soeben eine überarbeitete Neuauflage im Taschenbuch erschienen.)
Es geht übrigens, im Buch und in den Filmen, um Rache. Voraussetzung für Rachlust ist vermutlich Hass. Kann aber eine 14-Jährige hassen? Und kann man diesen Hass plausibel machen, wenn man seinen Ursprung, die Liebe zum ermordeten Vater, mit diesem selbst ausblendet? Bei Hathaway hat der lebende Frank Ross wenigstens noch einen kleinen Auftritt zu Beginn des Films. Die Coens zeigen ihn nurmehr als erstarrte Kontur einer Leiche im Schneegestöber. Welche Rolle spielt Matties Vater bei Portis?
Filmkritik (II)
Monday, 31. January 2011Gestern seit langer Zeit mal wieder mit meiner Gefährtin im Kino gewesen, natürlich in einem der Lichtspielhäuser von Marianne Menze und Hanns-Peter Hüster, dem Astra-Theater in der Teichstraße ganz nah beim Hauptbahnhof. Sonst gibt es in Essen ja nur noch das CinamaxX am Limbecker Platz, aber dort hat man das Gefühl, dass der Zutritt von über 40 Jahre alten Personen nur so gerade noch geduldet wird. Außerdem zerstört die Anonymität dieser Massenabfertigungsfirma noch den schönsten Filmgenuss.
Was das Alter der Besucher betrifft, gehörten wir diesmal allerdings zu den jüngsten. Gezeigt wurde der neue Film von Mike Leigh, Another Year. Die Entscheidung für diese Londoner Tragikomödie fiel erst nach einigem Hin und Her. Ich kannte den Regisseur nur vom Hörensagen, hatte seine Komödie Happy-Go-Lucky rühmen hören und ihn dann wieder aus dem Blick verloren. Ein erster Hinweis auf den neuen Film klang nach gehobenem Klamauk, nach einem Trommelfeuer krasser Pointen. Aber als ich den Trailer anschaute, entsprach er dieser Erwartung so gar nicht, da war kein einziger Schenkelklopfer zu verbuchen. Doch dann hörte ich am Donnerstag im Deutschlandradio eine Kritik von Rüdiger Suchsland, die mich belehrte, dass die Qualitäten des Films wohl ganz woanders zu suchen seien als bei unbeschwerter Lustigkeit. Diese Ankündigung sollte sich als nur zu treffend erweisen. Glücklicherweise befinde ich mich gegenwärtig nicht in einem Stimmungstief, sonst hätte ich Another Year vermutlich nicht so sehr genießen können. Menschen mit einer vorzeitigen Frühjahrsdepression rate ich vom Besuch ab!
Worum geht es? Um ein erstaunlich glückliches Ehepaar Anfang 60, den Geologen Tom (Jim Broadbent) und seine Frau, die Psychologin Gerri (Ruth Sheen), deren gemütliches Heim zur Zufluchtstätte für eine Reihe sehr verschiedener, aber durchweg weniger glücklicher Mitmenschen geworden ist – von ihrem einzigen Kind, dem Rechtsanwalt Joe (Oliver Maltman), der mit 30 noch immer nicht unter der Haube ist; über Toms Jugendfreund Ken (Peter Weight), der an Fresssucht und Alkoholismus leidet und zunehmend vereinsamt; bis hin zu Gerris Arbeitskollegin Mary (grandios: Lesley Manville), die erst in der Schlusseinstellung ins katastrophische Epizentrum dieses erstaunlichen Films gesetzt wird. Mehr will ich nicht verraten, nur ein paar der außergewöhnlichen Qualitäten von Another Year aufzählen.
Die Kameraführung von Dick Pope, mit dem Leigh nun schon seit zwanzig Jahren zusammenarbeitet, ist meisterlich. Einem jungen Kinoneuling würde ich neben fünf, sechs anderen diesen Film zeigen, um ihm die Bedeutung der Kameraarbeit für das Gesamtergebnis zu demonstrieren. Schon die Eingangssequenz in Gerris Sprechzimmer verschlägt einem die Sprache, wenn wir das rastlose, süchtige, zerquälte Antlitz einer Patientin in schmerzhafter Unmittelbarkeit ertragen müssen. Solche Bilder werden uns im Amüsierkino von heute nicht mehr oft zugemutet. Und auch der Schnitt von Tom Gregory fällt postiv auf, wenn bei einigen Einstellungen der Blick auf den Punkt genau jenen Momente länger auf einem Bild ruht, der uns aufmerken lässt. Ob die Dreharbeiten genau ein Jahr gedauert haben? Es scheint fast so, denn die vier Teile des Films, mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter untertitelt, zeigen uns den Schrebergarten des Ehepaares im jeweils zur Jahreszeit passenden Erscheinungsbild. Ich kann nicht glauben, dass Leigh solche Naturbilder von einem Outdoor-Kulissenschieber nachbauen lässt. Das würde schlecht passen zu einem Regisseur, der ohne Drehbuch auskommt und so eine Authentizität erzeugt, die uns vergessen lässt, auf eine Leinwand zu schauen und nicht ins wirkliche Leben.
Vielleicht vierzig Zuschauer genossen mit uns diesen herrlich kompromisslosen Film in dem mit seinen 432 Plätzen größten Filmkunst-Theater Deutschlands; mehr nicht. Gut, es war die Nachmittagsvorführung, aber immerhin an einem kalten und trüben Sonntagnachmittag, an dem einem unternehmungslustigen Städter viel mehr nicht einfällt, als ins Kino zu gehen. Solche Beobachtungen lassen mich immer wieder erschrecken. Wie lange wird es Kino von solcher Qualität in unseren Großstädten noch geben?
Wieso ich?
Tuesday, 14. December 2010Immer mal wieder erreichen mich über meine Adresse info[at]revierflaneur[dot]de E-Mail-Angebote einer vermeintlich lukrativen Zusammenarbeit. Meist sind mir diese Offerten nicht einmal eine Antwort wert. Heute aber konnte ich es nicht lassen, wenigstens öffentlich zu replizieren. – Hier zunächst der Anlass meiner Irritation, das Angebot der Unister GmbH in Leipzig:
„Hallo Herr H., auf der Suche nach relevanten Partnern zum Thema Reisen, Urlaub o. ä. bin ich auf Ihre interessante und optisch sehr ansprechende Webseite revierflaneur.de gestoßen. – Unser Unternehmen betreibt das Portal ab-in-den-urlaub.de und wir entwickeln derzeit das Affiliate-Partnerprogramm Content4Partners. Über dieses Programm (WordPress-Plugin) haben Sie die Möglichkeit, Beschreibungen zu Städten und Hotels in von Ihnen gewählten Regionen, beispielsweise Hotels Afrika oder Hotels Ghana auf Ihrer Seite einzubinden. Das Layout der generierten Seiten wird automatisch an das Aussehen Ihrer Website angepasst. – Das Plugin liefert Ihnen suchmaschinenfreundliche Inhalte und dadurch erhöhte Zugriffszahlen. Des Weiteren ermöglicht es Ihnen, Provisionszahlungen für Reisebuchungen über Ihre Website zu generieren und ist somit eine sehr gute monetäre Ergänzung zu den bisherigen Inhalten auf Ihrer Website. – Die Einbindung des Plugins (Programm) erfolgt über eine einfache One-Klick-Installation. – Momentan befindet sich Content4Partners in der späten Beta-Phase. Dafür suchen wir nach interessierten Partnern, die Content4Partners testen würden. – Aus diesem Grund möchten wir Sie herzlich dazu einladen, sich kostenlos und unverbindlich für die Beta-Phase von Content4Partners anzumelden. – Wenn Sie sich das Plugin innerhalb der nächsten 2 Wochen auf Ihrem WordPress Blog installieren, aktivieren und mindestens einen Monat testen, dann bekommen Sie eine einmalige Aufwandsentschädigung von 40 € brutto. – Für weitere Informationen hänge ich Ihnen eine Präsentation an und stehe Ihnen natürlich sehr gern für Rückfragen zur Verfügung. – Wir freuen uns auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit! – Freundliche Grüße, Frank Z. Projektmanager“
Reflexartig frage ich mich bei solchen Gelegenheiten immer: Wie, um alles in der Welt, kommen die bloß ausgerechnet auf mich? Diesmal lag die Antwort realtiv nahe, denn offenbar ist Herr Z. oder einer seiner Zuarbeiter beim Googeln nach den Top-Destinationen dieses Online-Reisebüros auf dem Weg über das Suchwort Ghana Hals über Kopf in mein Weblog hineingestolpert. Das Kompliment gleich eingangs – „Ihre interessante und optisch sehr ansprechende Webseite“ – verfehlte leider seinen Zweck, ist es doch völlig unglaubwürdig. Denn um mein Blog interessant zu finden, muss man erstens schon reichlich schräg drauf sein; und wer dessen Gestaltung ansprechend findet, hat vermutlich zweitens noch das falsche Kräutlein geraucht! Aber Scherz beiseite: Wenn eines gewiss ist, dann dass der Projektmanager und seine Leute maximal fünf Minuten auf die Absendung dieser Akquise-Mail an mich verwendet haben, davon allenfalls 90 Sekunden aufs Anschauen meines Weblogs.
Gelesen haben sie jedenfalls nicht darin. Nicht einmal den einzigen der mittlerweile über 700 Beiträge, der sie vielleicht hätte interessieren können, haben sie zur Kenntnis genommen: das Impressum. Denn sonst hätten sie dort gleich eingangs gelesen: „Die Website revierflaneur.de ist ein rein privates Weblog zur Information, Meinungsbildung und Unterhaltung seiner Leser. Kommerzielle Zwecke werden mit diesem kostenlosen Angebot nicht verfolgt. Werbung wird nicht geschaltet.“
Wirklich absurd ist dieses Anerbieten aber insofern, weil der Revierflaneur ein strikter Gegner des Massentourismus ist, schon seit vielen Jahren keine Erholungs- oder Vergnügungsreisen mehr unternimmt, erst recht das Verreisen per Flugzeug als einen völlig inakzeptablen Anschlag auf die Überlebenschancen künftiger Generationen ablehnt und sich deshalb niemals und für kein Geld der Welt dazu hergeben würde, diesen selbstmörderischen Luxus zu bewerben oder solche Werbung zu unterstützen.
Filmkritik-Kritik (I)
Tuesday, 13. April 2010Vorgestern habe ich mir an der Seite meiner Gefährtin in der Essener Lichtburg den ersten Film des Modedesigners Tom Ford angeschaut. Es waren auffallend viele attraktive junge Männer in Begleitung älterer Herren im Kino. Das ist erfreulich, denn heute kann kein Produzent mehr auf seine Kosten kommen, wenn er ausschließlich ein cineastisch motiviertes Publikum anspricht. Die mimische Leistung des Hauptdarstellers, Colin Firth als George Falconer, hat A Single Man eine Oscar-Nominierung eingebracht. Das internationale Echo auf den Film, nach dem gleichnamigen Roman von Christopher Isherwood von 1964, war durchweg positiv, und auch hierzulande war das Urteil nahezu einhellig. Einen „traumwandlerisch schönen, traurigen Film“ nennt ihn Rainer Ganserma in der SZ. Ein „bravouröses Regiedebüt“ hat Peter Zander von der WELT gesehen und bescheinigt dem Regisseur, Drehbuchautor und Produzenten Ford eine verblüffende Stilsicherheit. Harald Peters von der gleichen Zeitung spricht von einem „eigenwilligen, wundervollen Werk“. Für die Kritikerin der ZEIT, Anke Leweke, ist A Single Man nicht nur ein Film, der „schön anzusehen ist“, „sondern auch ein schöner Film“. Michael Althen schließlich stellt Fords Debüt in der FAZ gar in die Tradition eines Klassikers wie Le feu follet von Louis Malle. Selbst im linken Freitag, von dem man am ehesten angenommen hätte, dass er sich mit dem Sujet und insbesondere mit dem auf Hochglanz polierten Milieu dieses Streifens schwertun würde, findet Matthias Dell nur lobende Worte und die überraschende Einsicht, der Film sei „auf subtile Weise […] politisch.“
Wenn sich alle Welt in einem Urteil dermaßen einig ist, dann kann die Versuchung für einen kämpferischen Geist unwiderstehlich werden, trotzig das gerade Gegenteil zu behaupten. So gab’s auch ein paar Zuschauer, genauer: ein Zuschauerpaar in der Lichtburg, das ein Viertelstündchen vor Schluss des Films das Kino verließ. Während ich mich noch fragte, welche Erwartungen hier enttäuscht worden waren, hatte die Frau an meiner Seite schon eine Erklärung parat: „Die konnten es bestimmt nicht länger aushalten und mussten dringend heim ins Bett!“
Da sind die Gründe, warum Ekkehard Knörer vom Perlentaucher den Filmgenuss wohl auch gern vorzeitig abgebrochen hätte, offenbar ganz anders gelagert. Gleich im ersten Absatz seiner Besprechung nennt er A Single Man unverblümt ein „Machwerk“. Was seinen Kolleginnen und Kollegen gerade als der besondere Vorzug des Films erschien, die Perfektion des Designs bis ins kleinste Detail, das nennt Knörer mit Bezug auf dessen Optik „fortgesetzte platte Redundanzproduktion“, während seine feinen Ohren „von der maximal minimal [sic] pathetisierenden Musik“ gepeinigt wurden, dass er sich fühlte „wie mit nassem Handtuch geprügelt“. Die ästhetische Konzeption nennt er eine der „streng gescheitelten Trauerkloßhaftigkeit“; und unterm Strich muss er feststellen, „dass im Leben eines durch und durch falschen Films eine echte Regung ein Ding der Unmöglichkeit ist.“ Wer dächte da nicht an Adornos bekannte Sentenz: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“? Und wenn man deren Kontext kennt, nämlich den 18. Aphorismus unter dem Titel Asyl für Obdachlose in Minima Moralia (Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Berlin u. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1951, S. 55-59), dann trifft diese Assoziation ins Herz der Diskussion über diesen Film, denn hier wie dort geht es nach meinem Dafürhalten ums Wohnen der Unbehausten in einer keinen Schutz mehr bietenden Welt.
Wenn es in A Single Man eine Szene gibt, an die sich jeder erinnert, dann ist es jene Rückblende, in der Literaturprofessor George Falconer (Colin Firth) „am Telefon vom Tod seines Freundes erfährt und ihm beschieden wird, dass die Familie auf seine Anwesenheit bei der Beerdigung keinen Wert lege – wie er versucht, die Fassung zu wahren, wie er seine versagende Stimme zur Disziplin zwingt und wie ihn nach dem Ende des Gesprächs dann die bleierne Gewissheit in den Sessel drückt und seine Augen überlaufen lässt, während es draußen in Strömen regnet, ist so erschütternd, dass es quasi alles beglaubigt, was den Film sonst nur an der Oberfläche zu bewegen scheint.“ So hat es Michael Althen empfunden. Und nun halten wir dagegen, was Ekkehard Knörer gesehen hat und wie er es bewertet: „Die Szene, in der George Falconer am Telefon vom Tod des geliebten Mannes erfährt, wird als schauspielerische Glanzleistung gepriesen. Aber auch und gerade an ihr ist alles ausgestellt. Tom Ford setzt seinen Hauptdarsteller ins perfekt eingerichtete Bild und lässt ihn wie ein gelehriges Tier im Zoo echtes Gefühl performieren. Der tut das, ringt virtuos um Fassung, aber gelangt übers Klischee einer solchen Situation kein Jota hinaus.“ Und darauf folgt besagter Satz vom durch und durch falschen Film. Was hat Knörer denn eigentlich sehen wollen? Einen Dokumentarfilm?
Ich für mein Teil habe den Film genossen. Und jedem, der sich bei diesem Genuss selbst im Wege steht, darf ich mein aufrichtiges Beileid aussprechen.
Pedifest (II)
Sunday, 21. March 2010[6] Wenn ich die fünf Punkte meines Pedifests vom November 2008 heute wieder lese, so muss ich schmunzeln über mein damals offenbar nicht nur ironisch gemeintes Vorhaben, mich mit einem solchen Kredo des „Selbsttransporttechnikverweigerers“ an die Spitze einer neuen politischen Avantgarde zu stellen. Es fehlte zur Vereinsmeierei dann ja nur noch die Ausgabe von Mitgliedsausweisen und die Bestellung eines Kassenwarts.
[7] Und wenn ich mich gedanklich zurückversetze in den Urzustand einer frühesten Euphorie durchs Schreiben, vermutlich also in mein sechzehntes Lebensjahr, dann verdankte ich auch damals schon diese Hochstimmung an der Schreibmaschine dem Abfassen von grundstürzenden, blutrünstigen, weltverbessernden Pamphleten, Unglaubensbekenntnissen, Manifesten.
[8] Der feine Nervenkitzel bei der Niederschrift, die zur jedesmaligen Übertreibung noch immer abgefeimterer Unverschämtheiten inspirierende Nickligkeit, die trotzige Gegenfrage auf den doch so billigen Einwand, dass ich mich mit meiner über jedes vernünftige Ziel hinausschießenden Radikalität außerhalb jeder sozialen Verträglichkeit stelle („Na, und?“), ohne darauf je eine plausible Antwort zu erhalten – das waren die prägenden Erfahrungen meiner Jugendzeit.
[9] Die hätten mich für die praktischeren Lebensertüchtigungen eines reiferen Erwachsenendaseins gänzlich unbrauchbar gemacht, wäre meinem lebensmüden Versagenskonzept (ich schrieb damals an einem provisorisch Scheiterhaufen betitelten Abgesang) nicht die Treffsicherheit meiner Abermillionen Spermatozoen und die Empfängnisbereitschaft von fünf Oocyten in die Quere gekommen. Der Rest war peripatetische Abgeklärtheit.
[10] Und dann? Dann verlässt unsereiner eben (oder gern auch uneben) die abgezirkelten Wandelhallen, die sich einem experimentierfreudigen Gespinsthirn über kurz oder lang freilich als Labyrinthe weit eher denn als Schubladensysteme offenbaren, um hinauszuschreiten in eine yottabytebreite und -hohe und -tiefe Webspaceweite, die einen Anfang vor einer Adler nicht kennt, wohl aber ein Ende im Zufall.
Was’n das?
Thursday, 25. February 2010Ich bin noch ganz verdattert. Was ist passiert? Seit nahezu zwei Jahren blogge ich jetzt hier still und heimlich vor mich hin und habe mich längst daran gewöhnt, dass meine Anklagen, Stimmungsbilder, Strafpredigten, Jammerarien und Lobeshymnen kaum einmal Resonanz finden; und wenn, dann kommt sie von ein paar versprengten Sympathisanten, die mir noch aus der Zeit meiner Westropolis-Hospitanz verbunden sind und mich gelegentlich aufmuntern zu müssen meinen.
Und jetzt das! Auf eine eher beiläufig hererzählte Episode aus meinem destabilisierten Alltag hin geht unvermittelt ein warmer Regen durchweg freundlicher Kommentare nieder, von Hansi, Hoshi, amo, saba, Mata, Ole, Paco, ch, Horst, JanDob, Julian, Brandbarth, Gerd, Leo, jules nut, Bernd das Brot, Oliver, docmed, mailo, Brent und Andi – lauter Menschen, die sich hier bisher noch nie haben vernehmen lassen. (Oder doch höchstens ganz selten einmal.)
Was hat das kleine Geschichtchen bloß an sich, dass es plötzlich einen solchen Applaus auslöst und seine Leser gar – das Wort ist nicht von mir – zu einer gründlichen Exegese veranlasst? Zu Pfennigfuchsereien garadezu? Oder gibt es vielleicht in der Blogosphäre irgendwelche Multiplikations-Mechanismen, die eine Flüsterpropaganda nach dem Schneeballprinzip in Gang setzen? Der Vorgang ist mir jedenfalls einigermaßen unheimlich.
Schon ertappe ich mich bei dem offenbar von schierer Eitelkeit erkitzelten Einfall, hier künftig in schöner Regelmäßigkeit ähnliche Alltäglichkeiten unter die Lupe zu nehmen, wie etwa: Was mir unlängst vor den Altglascontainern widerfuhr; Traurige Beobachtungen am Rande des diesjährigen Karnevalszugs; Wie mich die Zeuginnen Jehovas zum allerletzten Mal besuchten; „Würden Sie vielleicht eine Obdachlosenzeitung erstehen, der Herr?“; Stammgäste bei Starbucks usw. Aus dem Stegreif würden mir wohl zwei Dutzend ähnlich ergiebige Geschichtchen einfallen.
Aber will ich das? Ich weiß nicht so recht. Erfolg war mir immer schon verdächtig. Komplimente korrumpieren ja leicht. Immerhin mag ein wenig Zuspruch alle paar Jahre vielleicht noch hingehen. Und wenn er überhandnimmt, ist es mir bekanntlich ein Leichtes, die Gäste schleunigst wieder aus dem Haus zu ekeln. Vielleicht darf ich das Experiment wagen. Die neue Kategorie soll also Alltäglichkeiten heißen.
Wer ist dran?
Tuesday, 23. February 2010Gestern Vormittag vorm Backwarenstand. Ich stehe links, in der Mitte eine ältere Dame, die sich gerade eine sehr spezielle Auswahl von Teilchen zusammenstellen lässt. Ich spüre, dass ich ungeduldig werde, nicht weil ich in Eile bin, sondern einfach vom Zuhören: „Und dann bitte noch zwei Quarktaschen. Oder nein, geben sie mir doch besser drei! Aber nicht die zerdrückte, lieber die links daneben. Nein, von mir aus gesehen links.“ Und so weiter in der Manier einer einsamen Frau, die für den Rest des jungen Tages keinen Gesprächspartner mehr findet. Dass die Backwaren seit heute vor dem Supermarkt verkauft werden, hat seinen Grund offensichtlich darin, dass der Verkaufsstand im Geschäft komplett neu aufgestellt wird. Handwerker tragen die Einzelteile des alten Standes hinaus und werfen sie krachend in einen Container. Im Hintergrund schrillt eine Säge. Zudem liegt ein feiner Nieselregen in der Luft. Jede dieser kleinen Unannehmlichkeiten ist, für sich genommen, gewiss keine Katastrophe, alle zusammen aber lassen es nicht unbedingt als wünschenswert erscheinen, vor diesem Backwarenstand Wurzeln zu schlagen. „Momentchen,“ höre ich die ältere Dame sagen, „das müsste ich passend haben.“ Dann lässt sie mit ungelenken Fingern neun Euro und 78 Cent auf den Zahlteller klappern, gestückelt in 19 einzelne Münzen. Ein Zwei-Cent-Stück fällt zu Boden, ich bin ganz Kavalier und klaube es aus dem Matsch. Misstrauisch nimmt sie es entgegen, als hätte sie befürchtet, ich könnte mich damit aus dem Staub machen. Gleichzeitig höre ich die Brotverkäuferin sagen: „Es sind aber Neuneuroneunundsiebzig! Hätten Sie vielleicht noch einen Cent für mich?“ Sofort greife ich nach meiner Geldbörse, damit dieses grausame Spiel endlich ein Ende hat. Aber ich muss feststellen, dass sich in meinem Münzfach nur ein einziges Zwei-Euro-Stück befindet. Auch die ältere Dame hat bei der Suche in ihrem Portemonnaie und in den Taschen ihres Mantels offenbar keinen Erfolg. Da kommt ihr ein älterer Herr zu Hilfe, den ich jetzt erst bemerke. Er hatte wohl zuvor auf der, von uns aus gesehen, rechten Seite des Backwarenstandes gewartet. „Sie erlauben, dass ich ihnen diesen Glückscent zum Geschenk mache?“
Die überschwängliche Begeisterung, mit der die ältere Dame dieses Präsent von ihrem Altersgefährten entgegennahm, gab mir einen kleinen Stich. Zugleich beschäftigte mich die Frage, ob dieser spendable Kavalier bereits um Backwaren angestanden hatte, als ich hinzukam; oder ob er erst nach mir an der Reihe war. Möglicherweise hatte die zwischen uns stehende Teilchenkäuferin mir den Blick auf ihn verstellt. Vor dieser provisorischen Verkaufsstelle hatte sich in der Kürze der Zeit noch keine Gewohnheitsregel etablieren können, ob sich die Warteschlange nun nach rechts oder links zu bilden hätte. Ich kam aus Richtung der Bushaltestelle und stand darum links. Dass der ältere Herr hingegen rechts stand, konnte vielleicht darauf hindeuten, dass er mit dem Auto unterwegs war, denn rechts vom Standort, eben von diesem soeben erst aufgebauten Backwarenstand, befindet sich der Parkplatz des Supermarkts, der ungefähr die gleiche Fläche in Anspruch nimmt wie der Supermarkt selbst.
Bevor ich diese Erwägungen zu einem für mich eindeutigen Ergebnis hätte führen können, hatte die Backwarenverkäuferin gegen mich entschieden, indem sie sich dem älteren Herrn zuwandte: „Und was darf’s denn für Sie sein?“
Bevor er antwortete, schaute er kurz zu mir herüber, wie mir schien aber nicht mit einem fragenden, sondern eher mit einem triumphierenden Blick. Es war einer dieser Augenblicke, in denen eine kleine Ewigkeit Platz findet und die sich uns einbrennen, als läge in ihnen eine Weisheit verborgen, die weit über die in Sekunden oder in Jahren messbare Zeit hinausreicht. Er sah mich nicht so an, als wollte er sich vergewissern, ob er wirklich vor mir an der Reihe sei; und noch nicht einmal so, als wollte er prüfen, ob ich mich mit diesem Verlauf der Ereignisse abfinden würde, obwohl ich vielleicht davon ausginge, dass die Reihe eigentlich an mir sei. Er schaute vielmehr drein, als wollte er sagen: ,Pass mal auf, Du Trottel. Ich weiß zwar besser als Du selbst, dass ich nach Dir gekommen bin. Aber Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich die Gunst des Augenblicks verstreichen lasse, in dem mich die Verkäuferin zuerst angesprochen hat.‘ Und ehe ich mich’s versah, hatte er schon das Wort ergriffen. „Ich hätte gern … ich wollte eigentlich … aber ich hörte ja gerade … dass ihre Brotschneide-Maschine ja leider … wegen dem Umbau, tja … sehr ärgerlich.“ An Stelle der drei Pünktchen muss man sich jeweils eine so lange Pause vorstellen, wie man in einer solchen Situation eben noch für möglich hält. Offenbar litt die Backwarenverkäuferin genauso wie ich, denn nachdem sie kurz „Jasoisses“ gesagt hatte und darauf seitens des älteren Herrn erst einmal gar nichts mehr kam, wandte sie sich sichtbar erleichtert mir zu: „Und bei Ihnen?“ Wie aus der Pistole geschossen stieß ich hervor: „Nur drei Brötchen. Ich hab’s auch passend.“ Und sie steckte meine drei Brötchen schon in die Tüte, als der ältere Herr, ich ahnte es ja, seiner Entrüstung Ausdruck verlieh: „Das glaube ich jetzt nicht! Wieso sind Sie denn jetzt dran. Ich war doch noch längst nicht fertig.“ – „Und deshalb sind ja auch schon wieder dran. Ich wusste, was ich wollte und hab’s auch schon.“ Hier schwenkte ich mit der Linken die Brötchentüte und legte mit der Rechten abgezählte 81 Cent auf den Teller. Und nach einem verständnisinnigen Blickwechsel mit der Verkäuferin fügte ich hinzu: „Ich dachte, wir nutzen die Zeit, bis sie mit Ihren Überlegungen zu Rande gekommen sind.“ – „Das ist ja wohl eine Unverschämtheit! Meinen Sie etwa, weil ich auf meine alten Tage nicht mehr ganz so schnell bin, können Sie sich hier alles erlauben? Entschuldigung, dass ich noch lebe!“ – „Aber keine Ursache. Das stört mich nur mäßig.“ Und weg war ich.
Bin ich nun hiermit zu weit gegangen? Hätte ich dem Motto folgen sollen, das da heißt: Der Klügere gibt nach? Hätte ich bis zum fernen Ende weiter mit Engelsgeduld die schikanöse Slowmotion-Darbietung dieses offenbar unter Langeweile leidenden Rentners auf der Suche nach Streit ertragen müssen? Nun weiß ich nicht, was Dr. Dr. Rainer Erlinger im SZ-Magazin auf diese Gewissensfrage antworten würde. Ich werde ihn allerdings auch nicht fragen. Ich bin nämlich nach diesem kleinen Zwischenfall völlig im Reinen mit meinem Gewissen. So einer bin ich!
Voll Kwango
Thursday, 18. February 2010Im Zoo von Münster lebt ein Gorilla namens N’Kwango (* 1996). So stark er ist, hat er doch ein weiches Herz. Wenn Fatima (* 1973) traurig ist, schmilzt N’Kwangos Herz hinter dem hammerharten Brustkasten und er versucht, sie zu trösten. Das sieht dann so aus. Warum Fatima traurig ist, wissen wir nicht, können da nur mutmaßen. Vielleicht, weil sie den Tod ihrer Schwester Gana (1998-2010) nicht verkraftet hat?
Wenn man in Essen ungewöhnliche Begegnungen mit Tieren haben will, geht man ins Folkwang-Museum. Die Zeiten, als es im Essener Grugapark noch einen Affenfelsen, ein Seehundbecken und ein imposantes Aquarium samt Terrarium gab, sind längst Geschichte. Noch nicht ganz so lange zurück liegt aber die Folkwang-Ausstellung Das fotografierte Tier. Und unvergessen ist mein Eindruck von der privaten Führung, die mein alter Freund Jürgen Lechtreck als Kurator dieses modernen „Bestariums im Rahmen und hinter Glas“ für mich und meinen ältesten Sohn im Dezember 2005 veranstaltet hat.
Heute habe ich mir den gerade eröffneten Neubau des Museum Folkwang [siehe hierzu die Kommentare] angeschaut. Ein großformatiges, zwanzigseitiges Heft Eröffnung des Neubaus wird am Empfang kostenlos ausgegeben. Darin und in allen anderen Verlautbarungen, die mir bisher zu Gesicht gekommen sind, ist die adjektivische Dopplung „hell und licht“ besonders beliebt zur Beschreibung der Qualitäten dieses Bauwerks von David Chipperfield. Und was sieht man an den teuren Wänden, in den edlen Hallen? Die Zusammenstellung von Werkgruppen und Installationen der Gegenwartskunst schien mir etwas willkürlich. Immerhin war ich froh, Gerhard Richters Wolkenbild Nr. 265 endlich einmal wiederzusehen. Es hängt jetzt in Augenhöhe des Betrachters, somit viel tiefer als früher, wo es in dem großen Saal mit dem Calder-Mobile unerreichbar entrückt schien – wie Wolken ja üblicherweise auch zu sein pflegen. Hier nun kommt es mir kleiner vor als in meiner Erinnerung. Soll das so bleiben? Bitte nicht!
Eine angenehme Überraschung boten hingegen die drei kleinen Ausstellungen Raumeroberungen (mit Plakaten von Günther Kieser, Holger Matthies und Gunter Rambow), Wünsche und Erwerbungen (mit zeitgenössischen Zeichnungen) und insbesondere die imponierende Zusammenstellung von Porträts unter dem Titel Fotografie und Individuum. Wieder einmal konnte man sich überzeugen, welch großartige Sammlung Ute Eskildsen hier in den vergangen drei Jahrzehnten zusammengetragen hat. Ich wäre sofort bereit gewesen, einen Katalog mit den Fotos dieser Teilausstellung zu erwerben, musste aber mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass es einen solchen nicht gibt. – Somit ist ein Besuch dieser Ausstellung (bis zum 4. April) nicht nur empfehlenswert, sondern dringend geboten: Go to Folkwang! (Eintritt 5 Euro.)
Auch heute entdeckte ich übrigens wieder ungewöhnliche Tierfotos, diesmal im Rahmen verschiedener Serien mit Schausteller-Porträts. Unvergleichlich schienen mir die Farbfotos mit nigerianischen Hyänenführern von Pieter Hugo [Titelbild aus seinem Bildband The Hyena & Other Men © Pestel Verlag]. Hatte ich nicht eine dieser Hyänen auch im Eröffnungsprospekt gesehen? Ich blätterte und suchte und kam zu dem Ergebnis, dass ich mich da wohl von ganz oberflächlichen Ähnlichkeiten hatte täuschen lassen. Übrigens sind Hyänen ja im Allgemeinen viel harmloser, als ihr schlechter Ruf uns glauben machen will.
Roth im Revier (II)
Sunday, 14. February 2010In der bahnbrechenden Roth-Biographie des Amerikaners David Bronsen heißt es über die erste Revier-Stippvisite von Joseph Roth: „Im Frühjahr 1926, auf der Rückreise von einer Redaktionskonferenz in Frankfurt, machte Roth einen Abstecher nach dem Ruhrgebiet, ehe er seine Reise nach Paris fortsetzte. Die Reportagen, die daraus entstanden, stehen in krassem Gegensatz zu denen über Südfrankreich, dessen heilsamer Einfluß ihn nicht losließ. […] Das Temperament des Berichterstatters nahm vieles mit Unwillen auf. ,Dunst, Rauch, Staub‘ stoßen ihn ab. Nachdem er den organisch gewachsenen französischen Midi gepriesen hat, klagt er über die ,Enge‘ und ,die Kälte‘ des Ruhrgebietes, die ihm zur Qual werden. Er reibt sich an der Grobheit des Arbeiterlebens und der primitiven Anspruchslosigkeit der sozialen und kulturellen Einrichtungen. […] In Frankreich feierte er den Sieg der Natur. Hier schildert er den trostlosen Sieg über die Natur.“ (David Bronsen: Joseph Roth. Eine Biographie. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1974, S. 277 f.) In der Frankfurter Zeitung, bei der Roth damals unter Vertrag stand, erscheinen die Artikel Tübsal einer Straßenbahn im Ruhrgebiet und Der Rauch verbindet Städte (am 9. und 18. März 1926; in: Werke 2, S. 544-549) sowie, mit etwas Verzögerung, weshalb man es in der streng chronologisch geordneten Werkausgabe leicht übersieht, ein so luzides wie zynisches Resümee seines Aufenthaltes an der Ruhr unter dem Titel Privatleben des Arbeiters (am 10. April 1926; ebd., S. 552-556). Diesem trostlosen Fazit hat die Zeitung eine „redaktionelle Bemerkung“ vorangestellt, die Bronsen zitiert: „Wir bringen diese Eindrücke von einer Reise durch das Ruhrgebiet, Eindrücke aus dem Alltag des Arbeiters, die uns um so wertvoller erscheinen, als sie unabhängig von jeder programmatischen Forderung entstanden sind. Es versteht sich von selber, daß mit den folgenden Betrachtungen prinzipielle Fragen nur aufgeworfen, aber nicht grundsätzlich beantwortet sein sollen. Es sind Impressionen, gesehen durch ein Temperament.“ (Bronsen, a. a. O., S. 278.)
Bei seinem Aufenthalt in Essen logierte Joseph Roth im Hotel Kaiserhof [Titelbild], wie wir dem Absendevermerk eines auf den 11. Februar 1926 datierten Briefes an Bernhard von Brentano entnehmen können. Darin klagt Roth: „Ich reise jetzt einige Wochen herum. Aber ohne Geld. Es ist furchtbar, so zu fahren, ich bin verzweifelt, kann meine kostspieligen Bedürfnisse nicht aufgeben und die Zeitung spart und spart erbärmlich. Es macht mir keine Freude mehr, man hat mir nicht einmal einen Vorschuß für März gegeben, ich habe keinen Vertrag, ich bin ganz trostlos.“ (Joseph Roth: Briefe 1911-1939. Hrsg. u. eingel. v. Hermann Kesten. Köln / Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1970, S. 78.) Das Verhältnis zu seinem langjährigen Auftraggeber, der Frankfurter Zeitung, ist schon seit einer Weile gespannt und wird es bleiben. Im Sommer 1930 löst Roth das Verhältnis und schließt einen Vertrag mit den Münchner Neuesten Nachrichten. Auch in anderen Zeitungen erscheinen nun vermehrt seine Feuilletons.
Ab Anfang Mai 1931 bringt die Kölnische Zeitung eine längere Folge von Reiseimpressionen, aus Magdeburg, Leipzig und schließlich erneut aus dem Ruhrgebiet, beginnend in Duisburg mit Der Hafen von Ruhrort, In andern Kneipen und Gustav (24. Mai und 7. Juni; in: Werke 3, S. 320-329). Darauf folgen die Ankunft in Essen, Abend in Essen, Die Bar erster und zweiter Klasse, Die andere Bar, Der Morgen aber, Ein Ingenieur mit Namen K. und Ein Arbeiter mit Namen M. (7., 14. u. 21. Juni 1926; ebd., S. 330-346).
Wilhelm von Sternburg hat in seiner jüngst erschienen Biographie Zweifel angemeldet, ob Joseph Roth in der ersten Jahreshälfte 1931 tatsächlich eine zweite Reise ins Ruhrgebiet gemacht hat: „Am 3. Mai 1931 erscheint in der Kölnischen Zeitung der erste von 15 Artikeln, in denen er von einer Reise berichtet, die ihn nach Magdeburg, Leipzig und in das Ruhrgebiet geführt haben soll, und in denen er feuilletonistisch über Gustav den Kneipenwirt oder einen Ausflug am Sonntag plaudert. Die Daten der überlieferten Briefe geben keinerlei Ansatzpunkte, dass Roth diese Reise gemacht hat. Vielleicht schrieb er sie alle im Pariser Hotelzimmer.“ (Wilhelm von Sternberg: Joseph Roth. Eine Biographie. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2009, S. 393.) Ich habe eine andere Vermutung. Am 7. April 1926 hatte der Feuilletonchef der Frankfurter Zeitung, Benno Reifenberg (1892-1970), an Joseph Roth in Paris geschrieben: „Ich habe Ihnen für vielerlei zu danken […], für Ihre weitere Arbeit aus dem Ruhrgebiet Persönliches Leben des Arbeiters [sic] und jetzt für Ihren Bericht von den Schlachtfeldern […].“ (Gemeint ist Roths Bericht St. Quentin, Perronne, die Maisonette, erschienen in der Frankfurter Zeitung v. 2. Mai 1926.) Nach diesen einleitenden Komplimenten kommt Reifenberg bald zum eigentlichen Anlass seines Briefes: „Lieber Herr Roth, ich muß wohl nicht sagen, daß Ihr Ausscheiden aus unserer Zeitung für mich den schwersten Schlag bedeutet, den ich in diesen Anfangsjahren erleben könnte. Ich habe einfach auf Sie gerechnet. Ich brauche die Mitarbeit von Menschen meiner Generation, mit denen ich mich ohne weiteres verstehe, mit denen ich Ideen teile, die uns ohne weiteres selbstverständlich sind. Es wäre nach meiner Überzeugung eine verlorene Schlacht, wenn Ihr Name plötzlich in Berliner Blättern auftauchen müßte. Ich habe das deutlich dem Verlag mitgeteilt und nun bitte ich mir zu glauben, daß der Verlag nicht sehr viel anders als ich denkt und daß ihm sehr darum zu tun ist, mit Ihnen ein gutes Einvernehmen zu pflegen.“ (Briefe 1911-1939, a. a. O., S. 83 f.) Dank dieser Intervention konnte ein vollkommener Bruch mit der Frankfurter Zeitung vorläufig noch verhindert werden. Es kann aber gut sein, dass durch diese vorübergehende Verstimmung die Veröffentlichung weiterer, bereits vorbereiteter oder gar ausformulierter Ruhrgebiets-Artikel ins Stocken geriet und dann ganz unterblieb. Schließlich hatte ja ihr Verfasser nicht einmal einen Vertrag, wie er im oben zitierten Brief aus dem Essener Kaiserhof beklagte. Fünf Jahre später kam der viel beschäftigte Journalist dann auf die Idee, diese liegengebliebenen Blätter der Kölnischen Zeitung als brandneu zu verkaufen. Tatsächlich enthalten alle zehn Artikel keinen einzigen Hinweis, der eine eindeutige Datierung zuließe. Klang nicht übrigens auch die oben zitierte „redaktionelle Vorbemerkung“ von 1926 eher nach der Ankündigung einer längeren Folge von Artikeln? Dass daraufhin nur drei Texte erschienen, musste die Erwartungen enttäuschen, die durch die Ankündigung geweckt worden waren.
Ich vermute, dass die insgesamt 13 Revier-Feuilletons von Joseph Roth zusammengehören, nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich. Sollten gründlichere Recherchen zu diesem Gegenstand und in diese Richtung meine Annahme bestätigen, dann wäre es vorstellbar und wünschenswert, diese Kleine Reise ins Revier von Joseph Roth aus dem Frühjahr 1926 als kommentierten Separatdruck neu herauszubringen.
Roth im Revier (I)
Thursday, 11. February 2010Gerade erweist sich wieder einmal, dass das Ruhrgebiet bei aller blühenden Pracht diverser bildender und darstellender Künste literarisch nahezu nichts zu bieten hat. Im über 200 Seiten starken Programmheft für das erste Halbjahr der Kulturhauptstadt Europas entfallen auf die Sparte „Sprache erfahren“ gerade einmal sechs, dazu noch mühsam gefüllte Seiten (vgl. Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010. Buch zwei. Essen: RUHR.2010 GmbH, 2010, S. 116-121). Dieses unfreiwillige Selbstbekenntnis zum sekundären Analphabetismus einer Fünfmillionen-Metropole werde ich vielleicht gelegentlich, wenn ich in soliderer Stimmung bin, genauer unter die Lupe nehmen.
Hätte man ehrlich sein wollen, dann wäre noch am ehesten ein Programmschwerpunkt mit jenen schreibenden Revierflüchtlingen zu bestreiten gewesen, die bis auf ihre Abstammung und damit immerhin ihre früheste Prägung kaum etwas mit der Region verbindet, also mit Nachkriegsautoren wie Helmut Salzinger, Nicolas Born, Brigitte Kronauer oder Ralf Rothmann. Aber mit welchen Inhalten hätte man eine solche Revue der Fortgegangenen füllen können? Mit der Ausnahme von Rothmanns Frühwerk hat diese Herkunft, mit der man nirgends Eindruck schinden kann, kaum einen Niederschlag bei ihnen gefunden. Und auch über die Gründe ihres Weggehens haben sie, soweit ich weiß, nichts Nennenswertes zu Papier gebracht, vermutlich einfach deshalb, weil es jedem Außenstehenden unmittelbar verständlich ist und keiner besonderen Erklärung bedarf, wenn man als kulturell interessierter, weltoffener, sensibler und erfahrungshungriger junger Schriftsteller aus dieser Gegend nur fliehen kann. Und den Zurückgebliebenen muss man es nicht erklären, weil die es gar nicht merken, nicht wissen wollen und nicht verstehen würden. Niemand hat ja die Fortgegangenen je vermisst.
Wenn man sich die wenigen Sammlungen literarischer Zeugnisse aus dem bzw. über das Ruhrgebiet anschaut, dann fällt auf, dass es sich ganz überwiegend um nüchterne Berichte von eilig Durchreisenden handelt, so etwa in einer Textsammlung über meine Heimatstadt, Essen in alten und neuen Reisebeschreibungen (ausgew. v. Klaus Rosing. Düsseldorf: Droste, 1989). Indirekt spiegelt sich dies auch im Titel der von Dirk Hallenberger liebevoll zusammengetragenen Reportagesammlung über das Ruhrgebiet wider: Heimspiele und Stippvisiten. Schaut man sich die Auswahl genauer an, dann bestätigt sich schnell die Vermutung, dass die „Stippvisiten“ deutlich in der Überzahl sind, während mit „Heimspiele“ wohl bloß der lokalen Affinität zum Fußball eine kleine Reverenz erwiesen werden soll. Gerade aus dieser Beobachtung hätte ja ein in Sachen Literatur etwas ambitionierteres Team im Kulturhauptstadt-Büro den ispirierenden Funken schlagen können. Schließlich sind die touristischen Heerscharen, die das Großevent Kulturhauptstadt an die Ruhr locken soll, ebenfalls nur auf Stippvisite.
Und was hatten sie so zu berichtet, die großen Durchreisenden der 1920er-Jahre? – Alfred Kerr: „Die Einwohner sind nicht von überflüssiger Heiterkeit. Machen Wege nicht zum Spaß – sondern anscheinend immer zu irgendeinem sachlichen Ziel. (So sieht es für den hereinschneienden Gast aus.)“ (Es sei wie es wolle, es war doch so schön! Berlin: S. Fischer, 1928; hier zit. nach Rosing, a. a. O., S. 126.) – Egon Erwin Kisch: „Bei Tag sieht man Menschen, die von der Macht des Gußstahls zertrümmert und vom Atem der Kohle vergiftet sind.“ (Der rasende Reporter. Berlin: E. Reiß, 1925; hier zit. nach Hallenberger, a. a. O., S. 21.) – Und deutlicher als alle anderen Joseph Roth: „Es ist […] nicht anzunehmen, daß schon viele Vergnügungsreisende den Essener Bahnhof verlassen haben, um ihre Laune zu heben oder ihre Ferien zu würzen.“ (Ankunft in Essen; in: Kölnische Zeitung v. 7. Juni 1931; hier zit. nach Werke 3: Das journalistische Werk 1929-1939. Hrsg. u. m. e. Nachw. v. Klaus Westermann. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1991, S. 330.)
Und damit komme ich zur Klimax meiner heutigen Reviermelancholie – und zum mich selbst überraschenden Umschlag aus der Tristesse in die Euphorie. So viele Jahre habe ich nach einem Epiker gesucht, der dieser nichtigen Landschaft, dieser ungestalten Stadtwüste, dieser profillosen Gemeinschaft und dieser unkultivierten Ödnis des Ruhrgebiets, wie es im vorigen Jahrhundert war, sprachlich gerecht geworden wäre. Noch vor ein paar Tagen hätte ich im Brustton der Überzeugung behauptet, dass es diesen Schreiber nicht gab. Jetzt bin ich eines Besseren belehrt. Joseph Roth hat, wenn ich es richtig übersehe, das Revier zweimal besucht, Anfang 1926 und fünf Jahre später, im Frühling 1931. Seine Eindrücke von den beiden „Stippvisiten“ hat er in zehn Feuilleton-Artikeln für die Frankfurter Zeitung bzw. die Kölnische Zeitung festgehalten (vgl. Joseph Roth: Werke 2, S. 544-549 u. Werke 3, S. 320-346). Und diese auf den ersten Blick unscheinbaren und weitgehend unbekannten „Reiseimpressionen“ – welch harmloses Wort! – sind nun wahrlich auf den zweiten das Kraftvollste und Ätzendste, das Bohrendste und Bitterste, das Hell- und Weitsichtigste, was ich je über meine Heimat gelesen habe. Von diesem freudigen Schreck muss ich mich erst einmal erholen. Ich hätte eine szenische Lesung aus diesen Texten arrangieren können, die an allen 365 Tagen des Kulturhauptstadtjahres an einem anderen Revierort zur Aufführung hätte kommen können. Das wäre was gewesen. Aber, ach! Zu spät …
20th Century Trends
Sunday, 07. February 2010Die Berlinale feiert 60. Geburtstag, wie übrigens auch der gerade nach Berlin umgezogene Suhrkamp-Verlag. Das Filmfestival hat Werner Herzog zum Präsidenten gemacht. Ist das eine Nachricht? Vielleicht lautet die Nachricht doch eher: Werner Herzog hat sich zum Jury-Präsidenten der Berlinale machen lassen. Aber ich muss noch grundsätzlicher werden. Für mich persönlich lautet die Nachricht zuallererst einmal: Werner Herzog lebt noch.
Mindestens scheint es so. Ein Mann dieses Namens hat aus Anlass seiner Bestallung längliche Interviews gegeben, so in der SZ (Jörg Häntzschel: Die Hornisse; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 28 v. 4. Februar 2010, S. 3) und in der ZEIT. Dort fragt ihn Katja Nicodemus nach seiner neuen Heimatstadt Los Angeles. Werner Herzog: „Los Angeles ist ja eine Stadt, in der man nicht zu Fuß gehen kann. Sie machen sich verdächtig. Die Polizei fährt langsam neben Ihnen her und fragt, was Sie da tun. Nur wenn Sie einen Hund ausführen oder joggen, dann fallen Sie nicht auf. Aber zu Fuß gehe ich eigentlich nur, wenn ein existenzieller Grund dahinter ist.“ (Herr der Schmerzen; in: DIE ZEIT Nr. 6 v. 4. Februar 2010, S. 45.) Das ist ziemlich genau die Situation, die Günther Anders Anno Domini 1941 in Kalifornien erlebt und 15 Jahre später mit nicht zu überbietendem Sarkasmus geschildert hat. (In: Die Antiquiertheit des Menschen. Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. München: C. H. Beck, 1956, S. 172-174; vgl. auch hier.)
Herzog nimmt aber längst keinen Anstoß mehr daran, dass an seinem Wohnort die natürliche Fortbewegung per pedes nurmehr in Tarnkleidung oder in Begleitung eines alibi animal möglich ist. Dabei sollte man ja gerade von ihm eine gesteigerte Empfindlichkeit gegen die Verkümmerung der natürlichen Körpermotorik erwarten, hat er doch vor vielen Jahren einmal bei seinem Marsch in 22 Tagen von München nach Paris vorgeführt, dass das Wissen des Menschen von den Füßen kommt und nicht von den Rädern. So fragt Katja Nicodemus auch ganz keck: „Früher sagten Sie, dass sich nur dem Fußgänger die Welt eröffne. Das ist hier wohl vorbei.“ Der schlecht versteckte Vorwurf gegen jemanden, der längst seine Jugendideale verraten hat, kommt bei Herzog nicht an. Los Angeles lässt es eben nicht zu.
Und trotzdem lebt der Regisseur gern dort: „Für mich ist Los Angeles die amerikanische Stadt mit der größten Substanz. Ich meine natürlich nicht die reine Oberfläche, den Glitz [!] und Glamour von Hollywood. Aber alle wichtigen Trends des vergangenen Jahrhunderts kommen aus Kalifornien […]“ – und dann zählt Werner Herzog auf, was er für die wichtigen Trends des vergangenen Jahrhunderts hält. Hier fasst er nun also den Wert der Jahre 1901 bis 2000 zusammen, über die er sich offenbar ein altersweises Urteil zutraut. Nebenbei bemerkt: Werner Herzog wurde erst im Jahre 1963 erwachsen. Aber man kann sich Geschichtskenntnisse ja auch auf dem ersten oder zweiten Bildungsweg aneignen. Der deutsche Filmemacher kommt also für besagte hundert Jahre auf genau acht wichtige Trends. Für deren sechs meint er den Ursprung in Kalifornien verorten zu können; und von diesen seien immerhin vier ernst zu nehmen.
Nun bitte ich meine Leser, vorsorglich die Schuhe selbst auszuziehen, es sich bequem zu machen, noch einmal tief durchzuatmen und sodann Werner Herzogs ultimative Trendshow des Zwanzigsten Jahrhunderts made in California zur Kenntnis zu nehmen. Es sind dies „[1] die kollektiven Träume im Kino weltweit. [2] Die Tatsache, dass Homosexuelle als integraler Bestandteil einer Gesellschaft anerkannt werden. [3] Die Computertechnologie. [4] Die großen Internetinnovationen. Und im Übrigen auch die Dummheiten wie [5] Hippie und [6] New Age. Es gibt nur zwei Ausnahmen. [7] Die grüne Bewegung kommt eher aus Skandinavien. Und der [8] islamische Fundamentalismus kommt auch nicht aus Kalifornien.“ Wow! Da bin ich tatsächlich sprachlos.
Protected: Müßiggang A-Z
Monday, 25. January 2010Unangeleint
Wednesday, 20. January 2010Vergangene Woche starb in Berlin kurz vor Vollendung ihres 69sten Lebensjahrs die linke Essayistin Katharina Rutschky, die einer größeren Öffentlichkeit Ende der 1970er-Jahre durch das von ihr herausgegebene Quellenbuch zur „Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung“ bekannt wurde. Dessen Titel, Schwarze Pädagogik, ging danach in den allgemeinen Wortschatz ein zur Bezeichnung eines durch Jahrhunderte geübten Erziehungsstils, der es sich nicht zur vornehmsten Aufgabe machte, die natürlichen Anlagen des Kindes durch liebevolle Zuwendung nach Möglichkeit zu fördern, sondern ihm stattdessen mit einem großen Arsenal physischer und psychischer Strafwerkzeuge Disziplin, Fleiß und Gehorsam anzudressieren. (Rutschky selbst war übrigens kinderlos, und ihre Tätigkeit als Lehrerin beschränkte sich auf junge Erwachsene im zweiten Bildungsweg. Ich überlasse es dem Leser, ob er dieses praktische Defizit bei der Parteinahme in pädagogischen Diskursen für einen Vor- oder Nachteil halten will.)
Mir war Katharina Rutschky in den 1980er-Jahren als gelegentliche Beiträgerin zu Wagenbachs Freibeuter aufgefallen. Aus traurigem Anlass habe ich in den vergangenen Tagen ihre kurzen, aber hoch konzentrierten Geschichtsbetrachtungen zur Pädagogik noch einmal durchgesehen und bin dabei auch auf einen Text gestoßen, der mich heute naturgemäß sehr interessiert: Die kleine und die große Pause. Eine Anleitung zum Nichtstun oder: Gibt es Grenzen der pädagogischen Vergesellschaftung? (in: Freibeuter. Vierteljahresschrift f. Kultur u. Politik. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 1987, Heft 33, S. 31-42.) Dass sie bei „Ausflügen in den real existierenden Feminismus“ bereits vor zehn Jahren mit Alice Schwarzers neuem Spießertum im gefälschten Gewand der Aufklärung abgerechnet hat, spricht sehr für die geistige Unabhängigkeit dieser Feministin der ersten Stunde, wenngleich ich skeptisch bin, ob sie bei den betroffenen Akteurinnen damit mehr erreicht hat als die Verurteilung als Ketzerin und Nestbeschmutzerin. (Emma und ihre Schwestern. München: Carl Hanser Verlag, 1999.)
Völlig übersehen hatte ich aber bisher, dass Katharina Rutschky auch Autorin eines ganz außergewöhnlichen Buchs über bellende Zweibeiner ist: Der Stadthund. (Von Menschen an der Leine. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 2001.) Ausnahmsweise zitiere ich hier mal den Klappentext: „Wohl wenige Themen sind so sehr geeignet, die Menschheit in zwei Parteien zu spalten, wie die Frage, ob man in der Großstadt einen Hund halten soll. Katharina Rutschky, streitbare Publizistin aus Berlin, ist bekennende Hundehalterin. Mit ihrem Cockerspaniel namens Kupfer flaniert [!] sie täglich durch die Straßen der Hauptstadt. – Eines der geistreichsten und unterhaltsamsten Tierbücher seit langem! Pflichtlektüre für Hundehasser und Hundeliebhaber!“ Naja, die Hundehasser wird man wohl kaum zur Lektüre verpflichten können, ebensowenig wie die Emma-Abonnentinnen zum Lesen des vorgenannten Buches. Andererseits muss man auch nicht wie ich selbst auf den Hund gekommen sein, um großen Gewinn aus diesen Reflexionen einer langjährigen Stadthundehalterin ziehen zu können, und zwar längst nicht nur über die doch sehr speziellen Fragen der Erziehung, Ernährung und Pflege solcher Vierbeiner.
Im Rahmen meines Flaneurblogs ist besonders das 8. Kapitel, „An einem Tag wie jeder andere“, von Interesse. Hier beschreibt Rutschky, wie sie sich in Begleitung von Kupfer – dessen Vorgänger Nickel heiß – durch die Stadtlandschaft bewegt, welche Begegnungen mit Hunden, Fahrrädern, Hundehaltern und Hundelosen dabei vorkommen, welche Verbote dabei zu befolgen sind – oder auch bewusst übertreten werden können, und was dann passiert. Wer dergleichen nie erlebt hat, bekommt einen guten Eindruck davon, wie das Spazierengehen in Gesellschaft des Tieres nicht nur einen völlig anderen Charakter bekommt, andere Prioritäten gesetzt werden und die Wahrnehmung der Wege sich schärft, wohingegen die Fixierung des Ziels gelegentlich in Vergessenheit gerät. Der Leser bekommt auch eine Ahnung davon, wie sich das Zeitempfinden verändert: „Allmählich wird meine Zeit knapp; wenn man als privilegierter Heimarbeiter nämlich nicht über ein hoch entwickeltes Pflichtgefühl verfügt, kann einen jeder Hund mit seiner unerschöpflichen Lust am Streunen und Herumziehen zum Vertrödeln vieler kostbarer Arbeitszeit animieren. Die vorhin erwähnte Regel […], die besagt, dass der Hund unter allen Umständen einen täglichen Anspruch auf sechzig Minuten Ausgang hat, Erde und Wasser inklusive, dient also auch dem Schutz des Menschen vor Verführung. Ich habe mir angewöhnt, nie ohne Armbanduhr mit Kupfer loszuziehen.“ (Ebd., S. 143 f.) Erde und Wasser inklusive? Das heißt, dieser Cockerspaniel will nicht nur auf Pflaster laufen; und Kupfer liebt es, im Wasser zu tollen.
Die wichtigste Erkenntnis lautet darum: Wenn man seinem Hund Gutes tut, tut man in aller Regel auch sich selbst etwas Gutes! Tierhaltung bringt die Rückkehr zu einem „animalischen Egoismus“ mit sich. Vor unseren beiden letzten Umzügen war zum Beispiel die artgerechte Wohnlage für unsere Lola durchaus ein wesentliches Kriterium bei der Wohnungssuche. Dass wir dennoch bis vor einem halben Jahr keinen Wald in fußläufig erreichbarer Nähe hatten und uns mit einem mickrigen Park begnügen mussten, war ein echtes Manko für unseren Hund, aber auch für uns selbst. Indem wir nun die Interessen unserer Hündin in unsere Erwägungen einbezogen, schlossen wir gewisse Objekte von vornherein aus und fanden so schließlich ein neues Heim, das nicht nur hundgerecht, sondern auch uns Menschentieren überaus gemäß ist.
Ruhrmuseum
Monday, 11. January 2010Am Samstag war das Wetter tatsächlich so ruppig, dass wir die Fahrt mit Bus und Bahn zur Zeche Zollverein nicht riskierten. Im Radio war zu hören, dass zahlreiche Schaulustige am frühen Nachmittag noch gar nicht aufs Gelände kamen. Höchste Sicherheitsstufe für die prominenten Gäste des Open-Air-Festaktes! Während das Schneetreiben kein Ende nehmen wollte, verging uns die Vorfreude auf eine Expedition nach Katernberg mehr und mehr. Hin würde man ja noch irgendwie gelangen, aber dann dort mit der Angst im Nacken rumzulaufen, dass wir spät in der Nacht nicht mehr heimkämen, das schien uns doch auf unsere alten Tage etwas zu strapaziös.
Mit desto besserer Laune machten wir uns dann heute auf den Weg. Es hatte endlich aufgehört zu schneien, und auch der scharfe Wind hatte sich gelegt. An der U-Bahn-Haltestelle Martinstraße warteten wir eine Viertelstunde, bis die Kulturlinie 107 schließlich kam, die ja laut Ankündigung im 7,5-Minuten-Takt verkehren sollte. Wir konnten uns so gerade noch reinquetschen und hatten bis Zollverein dann warme Stehplätze. Festzuhalten brauchte man sich nicht, denn zum Umfallen fehlte es entschieden am nötigen Raum. Aber es ist ja erfreulich, dass die Kulturhauptstadt RUHR.2010 gleich auf Anhieb solchen Zuspruch findet! Die frustrierten Gesichter der Zusteigewilligen an den diversen Haltestellen auf der Fahrt in den Essener Norden waren bilderbuchreif, die Türen blieben zu. Gern hätte ich ein paar Fotos gemacht, aber ich traute mich nicht, in dem Gedränge meine Kamera aus der Tasche zu holen. Die Mäkeleien mancher Fahrgäste, die dieses Chaos nun wieder typisch für den Essener ÖPNV fanden, ließen wir nahezu unkommentiert. Als aber eine besonders zickige Dame wissen wollte, warum man denn nicht einfach mal doppelt so viele Straßenbahnen eingesetzt habe, konnte ich meinen frechen Schnabel nicht mehr halten: „Ganz einfach: Weil die dafür nötigen Straßenbahnfahrer noch in der Ausbildung sind.“
Am Eingang zum Zollverein-Gelände wurden wir dann mit den bei der Vorbereitung so sehr entbehrten Programm-Foldern zum Kulturfest „Glück Auf 2010!“ geradezu überschüttet. Mittlerweile hatten wir aber längst eingesehen, dass wir selbst beim besten Willen keinen auch nur halbwegs vollständiges Bild von diesem gigantischen Programm würden gewinnen können. So beschränkten wir uns darauf, wenigstens eine große Attraktion, das heute neu eröffnete Ruhrmuseum, genauer in Augenschein zu nehmen und uns anschließend nur noch vom Zufall treiben zu lassen. Wir reihten uns in eine lange Schlange ein, und als wir den Eingang erreicht hatten, hieß es, wir müssten im Vorraum unsere Garderobe abgeben und würden dann eine Plakette mit einer Nummer erhalten. Wir taten wie befohlen, meine Plakette hatte die Nummer 4647. Nun betraten wir das große gläserne Zelt, eher eine Art Gewächshaus, das eigens für die Eröffnung des Ruhrmuseums vor der Kohlenwäsche aufgebaut worden war. Dort musizierte auf einer kreisrunden Bühne ein Jazztrio und man konnte an langen Tischen Platz nehmen und Kuchen essen oder an Stehtischen Bier trinken. Eine weitere Schlange lud uns dazu ein, ihr vorläufiges Ende zu bilden, aber wir stellten verwundert fest, dass wir zu einer kleinen Minderheit gehörten, die sich brav ihrer Garderobe entledigt hatten. Die überwiegende Mehrheit der Besucher standen dort in Mänteln, Jacken und Mützen. Da wir jetzt schon mit den Zähnen klapperten, gingen wir zurück in den Vorraum und erbaten unsere Garderobe, die wir von der wirklich sehr verständnisvollen Gardrobiere nun auch anstandslos zurückbekamen. Sie wisse auch nicht, was das solle. Nachdem wir diese kleinen Hemmnisse überwunden hatten, gelangten wir schließlich auf die berühmte lange Rolltreppe [s. Titelbild], die uns auf die Eingangsebene in 24 Meter Höhe beförderte. Die verschiedenen Etagen des Museums sind nämlich nicht wie sonst üblich durchnummeriert, sondern mit ihren Meter-Höhen bezeichnet. Die 17 m-Ebene trägt den Titel „Gegenwart“, die 12 m-Ebene heißt „Gedächtnis“ und die 6 m-Ebene „Geschichte“. Wir hatten sehr schnell erkannt, dass die Dimensionen dieser neuen Ausstellung viel zu riesenhaft sind, als dass man sie bei einem einzigen Tagesbesuch ausmessen könnte. Also begnügten wir uns damit, hier und da auf allen Ebenen ein paar Stippvisiten zu machen und einen allerersten Gesamteindruck zu gewinnen. Um es rundheraus zu bekennen: Wir waren auf Anhieb vollauf begeistert von dieser Präsentation! Erstens ist die Kulisse, die das Industriegebäude mit seinen unverändert belassenen „Innereien“ dieser Ausstellung bietet, schon für sich ein sinnliches Faszinosum erster Güte. Wie es nun aber zweitens den Ausstellungsmachern gelungen ist, die so vielgestaltigen und teils geradezu filigranen Exponate vor diesem grobschlächtigen Hintergrund zur Geltung zu bringen, das ist ein kleines Wunder.
Auf der 17 m-Ebene entdeckte ich auch bald meinen vorläufig Favoriten, den Ausstellungsteil „Zeitzeichen“: Quadratische Glasvitrinen in weißen Säulen beherbergen 30 Objekte der kollektiven Erinnerung und 30 Objekte der Naturzeit. In besonderer Erinnerung geblieben sind mir der selbstgebastelte Adventskalender aus Streichholzschachteln und die präparierte Staublunge eines Bergmanns. Ich bedauere sehr, dass nicht alle 60 Exponate dieses Bereichs im ansonsten reichhaltigen, prachtvollen und lesenswerten Katalog reproduziert und kommentiert werden. (Vgl. Ruhr Museum. Natur. Kultur. Geschichte. Hrsg. v. Ulrich Borsdorf u. Heinrich Theodor Grütter. Essen: Klartext Verlag, 2010, S. 158-169.) Gerade die Beliebigkeit der Auswahl führt zu wunderbaren Interferenzen der disparaten Gegenstände in der Phantasie des Betrachters. Ich könnte mir vorstellen, dass die Vitrinen in größerem zeitlichen Abstand mit anderen Inhalten befüllt werden, damit so diese wunderbare Museumsbühne immer wieder einmal neu bespielt wird und zu neuen Entdeckungen einlädt.
Vorläufiges Fazit: Das Ruhrmuseum – das sich übrigens leider, einem modischen Manierismus folgend, offiziell Ruhr Museum schreibt – lohnt sicher mehr als nur einen Besuch. Zur Eröffnung war der Eintritt frei, zukünftig hat der Erwachsene 6 Euro zu zahlen, für die ihm aber weitaus mehr geboten wird als in … nein, das sage ich jetzt nicht.
Schneegestöber
Friday, 08. January 2010Am bevorstehenden Wochenende steigt also die große Eröffnungsparty auf Zollverein – vorausgesetzt, das Wetter macht den Organisatoren keinen dicken Strich durch die Rechnung. Ich reagiere ja üblicherweise allergisch, wenn ich bei Kulturveranstaltungen, zum Beispiel bei Museumsbesuchen vor abstrakten Ödnissen à la Homage to the Square, benachbarte Kunstkenner das Modewort „spannend“ raunen höre. Aber in diesem Falle ist Höchstspannung wirklich der passende Ausdruck zur Bezeichnung unserer Stimmung, in Erwartung dieses Mega-Events. Schon jetzt wird deutlich, dass das Kulturhauptstadtjahr im Revier polemisch von zwei großen Chören in den Weblog-Kommentarspalten begleitet werden wird: dem Chor der Nörgler und dem der Schönredner.
Die Nörgler fragen sich, warum eine solche Veranstaltung ausgerechnet in der kalten Jahreszeit stattfinden muss, und dann noch größtenteils im Freien. Gibt es denn keine ausreichend großen Hallen? Offenbar nicht. Da sieht man mal wieder, was passiert, wenn man am falschen Ende spart und der Fußballverein Rot-Weiß Essen immer noch kein neues, überdachtes Stadion hat. Und offenbar hatten die Krawattenträger in den klimatisierten Planungsbüros nicht genug Phantasie, sich einen harschen Wintertag auszumalen, als sie die Weichen für diesen Wahnsinn stellten. Jetzt sollen sich doch die Herren und Damen Köhler und Barroso morgen den Po verkühlen, da waren die Kumpel im Pütt ganz andere Verhältnisse gewöhnt. Aber dass noch nicht mal genug Streusalz eingekauft wurde zum Kulturhauptstadtwinter, das ist mal wieder typisch! – So stänkern die Nörgler.
Die Schönredner geben zu bedenken, dass in unserer Hemisphäre schließlich jedes Jahr mit der kalten Jahreszeit beginnt und auch im Kulturhauptstadt-Jahr der Januar nicht in den Hochsommer fällt. In den vergangenen Jahren fielen die Winter allesamt außergewöhnlich mild aus. Dass jetzt ausgerechnet zum Eröffnungswochenende bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen sollen, ist zwar nicht nett vom Petrus. Aber vielleicht wird diese Massenveranstaltung ja gerade deshalb besonders gut gelingen, weil sich ein Teil jener Massen durch die Wetterprognosen abschrecken lässt und den wetterfesten Fans das Gedränge im befürchteten „Polackenflachrennen“ dadurch erspart bleibt. Außerdem gibt es doch genügend Gelegenheiten, sich ins Warme zu flüchten. Die Hallen 2, 5, 9 und 12, das SAANA-Haus, Salzlager und Mischanlage Kokerei, Oktogon, PACT Zollverein öffnen allesamt am späten Nachmittag ihre Pforten und werden gewiss nicht ganz ungeheizt sein. – So frohlocken die Schönredner.
Was mich betrifft, so weigere ich mich hartnäckig und konsequent, ungelegte Eier zu kommentieren. Die Veranstaltung findet morgen und übermorgen statt, bis dahin halte ich mich zurück. Anfang der Woche werde ich dann von meinen Erfahrungen und Erlebnissen berichten, so ich denn zum Zollverein-Gelände durchkomme und nicht unterwegs in einer Schneeverwehung steckenbleibe.
Eins muss ich aber doch schon vorab loswerden. Die Verteilung des Programmheftes zum Eröffnungsfest ließ doch sehr zu wünschen übrig! Meine erste Anlaufstelle war gestern die Touristikzentrale der Essen Marketing Gesellschaft (EMG) am Essener Handelshof. Dort las ich auf einem Zettel an der verschlossenen Tür sinngemäß: ,Die Touristikzentrale ist vom 21. Dezember 2009 bis zum 10. Januar 2010 wegen Umbau geschlossen. Im Foyer des Hotels Maritim nebenan gibt es in dieser Zeit einen Infotisch mit individueller Beratung.‘ Das Programm erhielt ich dort allerdings auch nicht, sondern nur den Tipp, es sei der WAZ beigelegt. Ausnahmsweise kaufte ich mir also zähneknirschend dieses Blatt, aber die 1,20 € hätte ich mir sparen können. Das volle Programm nennt sich vollmundig die äußerst dürftige Kurzübersicht, die dort auf einer einzigen Seite abgedruckt ist. Dabei gibt es doch im Internet ein 26-seitiges, farbenfrohes Programmheft als PDF zum Download, das keine Wünsche offen lässt. Sollte das tatsächlich nicht in gedruckter Form erhältlich sein? Da ich ohnehin noch einen Gang zur benachbarten Stadtbibliothek vor mir hatte, vertraute ich darauf, dass in dieser Kultureinrichtung wohl gewiss ein großer Tisch mit allen Prospekten und Broschüren zur Kulturhauptstadt RUHR.2010 auf mich warten würde. Wieder Fehlanzeige! „Eigentlich ein Armutszeugnis,“ bekannte ein freundlicher Bibliotheksmitarbeiter. Ob nun seitens der Bibliothek oder des Kulturhauptstadt-Büros, das ließen wir höflich offen. Ich bin gespannt, ob die Programmhefte morgen wenigstens vor Ort auf Zollverein ausliegen.
Kulturflanerie
Friday, 01. January 2010Kalendarisch beginnt heute also das Kulturhauptstadt-Jahr in der Stadt Essen und im Ruhrgebiet. Offiziell gibt es am Samstag, 9. und Sonntag, 10. Januar 2010 zum Auftakt ein erstes Mega-Event auf Zollverein. Neben dem offiziellen Eröffnungs-Festakt mit über tausend prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und der Einweihung des Ruhrmuseums findet für die 100.000 geschätzten “einfachen” Besucher an diesem Wochenende ein geradezu erdrückendes Veranstaltungsaprogramm in den Hallen und auf dem Außengelände statt.
Ich habe lange darüber nachgedacht, welche Beobachtungsposition ich gegenüber diesem Spektakel in meiner Heimatstadt und -region beziehen soll. Als ich vor zwei Jahren notgedrungen über eine berufliche Neuorientierung nachdenken musste, habe ich für ein Weilchen erwogen, das Angebot befristeter Stellen im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt abzugrasen. Mir wurde aber nur allzu bald klar, dass ich aus verschiedenen Gründen (nicht jung, nicht billig, nicht flexibel, nicht mobil) auf diesem Felde völlig chancenlos war. Auch mein kritisches Engagement als Blogger bei Westropolis 2007/08 zielte anfangs auf dieses Hauptthema, die Kommentierung der Vorbereitung und Durchführung des Kulturhauptstadt-Jahres 2010 im Ruhrgebiet. Aus dieser Zeit ist mir nicht viel mehr als mein Nickname ,Revierflaneur‘ geblieben. Schon in dieser frühen Phase der Projektmodellierung durch die RUHR.2010 GmbH und das Kulturhauptstadt-Büro unter Dr. h.c. Fritz Pleitgen und Prof. Dr. Oliver Scheytt wuchsen sich aber meine Störgefühle gegenüber der Seelenlosigkeit und Kommerzialität des ganzen Unternehmens zu so starken Vorbehalten aus, dass ich beschloss, mich vorläufig wieder in eine größtmögliche Distanz zu begeben, zumal ich auf meine Kritik hin immer wieder den Satz hörte: „Nun warte doch erst mal ab!“
Wie es mir in die Wiege gelegt ist, geradezu naturgemäß erwuchs meine Abneigung gegen das Unternehmen aus dem kakophonen Sprachgedöns, das es allenthalben umrankte, überwucherte, verstellte, ursprünglich wohl, um dessen Ärmlichkeiten und Widersprüche notdürftig zu verhüllen. Meine Erfahrungen in der Marketing- und Kommunikationsbranche haben mich zusätzlich skeptisch gemacht für die Ergebnisse jener obligatorischen Brainstormings in den Agenturen, die sich bei näherer Betrachtung oft genug bloß als Sturm im Wasserglas erweisen – und ihr Ergebnis bestenfalls als heiße, öfter noch als lauwarme Luft.
„Mythos Ruhr begreifen!“ – „Metropole gestalten!“ – „Bilder entdecken!“ – „Theater wagen!“ – „Musik leben!“ – „Sprache erfahren!“ – „Kreativwirtschaft stärken!“ – „Feste feiern!“ – „Europa bewegen!“ So lautet zum Beispiel eine dieser unsäglichen Schlagwortkaskaden, bei denen sich mir die Nackenhaare sträuben und ich den Stoßseufzer gen Himmel schicken möchte, dass er uns doch vor solchen Quatschköpfen beschützen möge. Sinn der Übung war wohl, Ordnung ins Chaos des unüberschaubaren Angebots zu bringen. Aber schon die Beliebigkeit, mit der diese Wortpaare zusammengestellt wurden, macht diese Absicht zunichte. „Mythos Ruhr erleben!“ – „Metropole entdecken!“ – „Bilder wagen!“ – „Theater leben!“ – „Musik gestalten!“ – „Kreativwirtschaft bewegen!“ –„Europa stärken!“ Das passt mindestens genauso gut, vielleicht besser. Einzig dass man Feste feiert, ist aus den Begriffen selbst heraus evident und passt deshalb nicht zu den übrigen, gewollt originell wirkenden Kombinationen. Und was bleibt? „Sprache begreifen!“ Damit hätten die schwächlichen Kreativwirtschaftler besser mal beginnen sollen.
Nun denn, jetzt geht der Rummel los, und die Zeit des Abwartens und der vornehmen Zurückhaltung hat damit für mich ihr Ende. Meine Beobachtungsposition ist die der größtmöglichen Unabhängigkeit. Ich bin mit den Verantwortlichen auf keine noch so indirekte Weise verbandelt und verbinde nicht das geringste wirtschaftliche Interesse mit meiner Anteilnahme an den Veranstaltungen, über die ich berichten und urteilen werde. Mit gutem Willen werde ich mich bemühen, meine hier vorab eingestandenen Vorurteile selbstkritisch unter Kontrolle zu halten und es dem Urteil des Lesers überlassen zu entscheiden, ob mir dies von Fall zu Fall gelungen ist. – Für die Beiträge zum Thema Kulturhauptstadt 2010 habe ich eine eigene Rubrik, eingerichtet: „Kulturflanerie 2010“.
[Das Titelbild zeigt den Titel des Ruhr-Museum-Folders zur Eröffnung. Gestaltung Uwe Loesch, Foto (Ausschnitt) Rainer Rothenberg.]
Pausenlos
Friday, 25. December 2009Das Los der Pause in unserer Zeit ist ihre Entwertung zur Störung. Wo das Ideal die optimale Verwertung der Zeit im Produktionsvorgang ist, muss die Pause als Zeitverlust erscheinen. Die Räder sollen sich ununterbrochen drehen, die starken Arme müssen für die unentwegte Zirkulation des Räderwerks sorgen, einem diesem ewigen Kreislauf entgegenstehender Wille muss von vornherein böswillige Absicht gegen den heiligen Zweck der ganzen Maschinerie unterstellt werden. Dennoch sind Pausen unvermeidlich, wenn etwa die Maschine geschmiert werden muss, wenn der Mensch Kraft schöpfen soll für ein mit neuem Schwung wiederaufgenommenes Schaffen. Diese Pausen sind aber sozusagen nicht ganz echt, sie sind in ihrem auf die Produktion bezogenen Regenerationszweck Teil derselben, auch sie müssen deshalb optimal genutzt werden.
Die echte Pause hingegen beginnt da, wo jede Zweckmäßigkeit ihren Sinn verliert. Sie ist vollkommen nutzlos. Zugleich hat die echte Pause kein inneres Maß und kein vorbestimmtes Ziel. Die abgesteckten, zu festgesetzter Stunde beginnenden, verordneten Pausen, wie die Schulpause zwischen den Stundenblöcken und die Brotzeit in der Fabrik, sind so gesehen bloß Attrappen der wahren Pause. (Die Schule trainiert somit, noch vor allem fachlichen Geschick und stofflichen Wissen, zuallererst den Rhythmus von Schaffen und Erschlaffen ein, der dem Produktionsfaktor Mensch dann lebenslang in Fleisch und Blut verwurzelt bleibt.)
[Pause.]
Eine echte Pause beginnt erst, wenn ihr Ende völlig offen ist. In einer solchen Pause lebe ich seit etlichen Monaten, was die zeitliche Bindung an eine gewerbsmäßige Produktion betrifft. Naiv ist, oder korrumpiert von den üblichen Bildern der Beschäftigung, wer diesen Zustand mit Untätigkeit verwechselt. Im Gegenteil bin ich, unterm Gesichtspunkt der Qualität meines Tuns, noch nie so folgenreich werktätig gewesen wie in jüngster Vergangenheit. Allerdings bemisst sich dieser Reichtum nicht in Euro verdienten Geldes, wie auch der hierfür eingesetzte Aufwand nicht in Stunden abzumessen ist.
„Und? Was machst Du jetzt so?“ Das fragten mich entfernte Bekannte, die von meiner neuen Lebenssituation vom Hörensagen wussten. „Ich habe jetzt erst mal eine Denkpause eingelegt.“ Das war für eine Zeit meine Lieblingsantwort. Mir gefiel daran, dass sie zwei Interpretationen zuließ: eine Pause zum Nachdenken – und eine Pause vom Denken. An die zweite Möglichkeit dachte zwar niemand außer mir. Und doch war es gerade diese Variante, die ich immer mitdenken wollte. Mein Nichtstun sollte tatsächlich ein absolutes sein. Wenn ich früher, in Zeiten meiner „Vollbeschäftigung“, in meinen wenigen Pausen doch immerhin noch gedacht, vor- und nachgedacht hatte, so suchte ich nun den Zustand absoluter Gedankenlosigkeit wie ein verlorenes Paradies.
[Der Pausenfüller ist ein Podcast von Claudia Wehrle und Oliver Glaap mit dem Titel Vom Verschwinden der Pause, zuerst gesendet im Hessischen Rundfunk am 18. Dezember 2009.]
Proust bei proust
Thursday, 10. December 2009Heldenhaft der Kampf der kleinen aber feinen Buchhandlungen gegen die banausischen, in vielerlei Hinsicht immer tiefer sinkenden Großflächen à la Thalia, Mayersche, Hugendubel, sie sind nicht genug zu loben. Manchmal weiß ich aber keine Antwort mehr auf die Frage, wie bei aller unterstellten, nahezu grenzenlosen Bereitschaft zur Selbstausbeutung der Inhaber solcher Schmuckkästchen, bei aller Professionalität und Investitionsbereitschaft nicht nur von Geld und Zeit, sondern auch von Hirn und vor allem Herz per Saldo noch was übrig bleibt zur Bestreitung bescheidener Lebenshaltungskosten.
Gestern war ich zu Gast bei einer Lesung in der Essener Buchhandlung proust. Michael Maar las aus seiner viel gelobten Essaysammlung Proust Pharao (Berlin: Berenberg Verlag, 2009). Zwanzig interessierte Zuhörer waren bereit, hierfür acht Euro Eintritt zu bezahlen, einige kauften anschließend das vorgestellte Buch zum Preis von 19 Euro. Maar, der von Berlin aus eigens mit dem Auto angereist war, las eine knappe Stunde. Anschließend erfüllte er Signierwünsche. Fragen aus dem Publikum wurden nur wenige gestellt. Ich erinnere mich blass an die Frage eines bekennenden „Nicht-Proustianers“, die sich mit der Quantität der Recherche befasste und einen leichten Trend ins Banausische hatte, wovon sich der Autor aber nicht zu einer Hochnäsigkeit hinreißen ließ. Die Buchhändler reichten zu allem Überfluss gar noch einen großen Teller Madeleines herum.
Die Frage drängt sich auf: Wie geht das? Fahrtkosten des Autors hin und zurück, und wenn Maar nicht um zehn Uhr abends noch die Heimreise antreten wollte, kam eine Hotelübernachtung hinzu. An Personalkosten fallen mindestens anderthalb Überstunden für zwei Buchhändler und eine Auszubildende an, für die gleiche Zeit Heizkosten und Beleuchtung im Geschäft. Dazu noch Autorenhonorar? Und was, wenn nun statt zwanzig nur zwei Zuhörer erschienen wären? Wie man es dreht und wendet, solche schönen Abende können für sich betrachtet nur ein Verlustgeschäft sein, sie rentieren sich hoffentlich indirekt über den fabelhaft guten Ruf, den sich dadurch eine Buchhandlung wie proust erwirbt, und zwar insbesondere bei der wertvollsten Kundschaft, den Viellesern. Die werden damit zu treuen Stammkunden und kaufen vielleicht sogar das eine oder andere Buch zusätzlich, damit das Schmuckkästchen nicht in wirtschaftliche Bedrängnis gerät.
Eine ganz ähnliche Entwicklung gibt es ja übrigens bei den Kinos. Auch dort verdanken die Cineasten es wenigen Idealisten, wenn es heute überhaupt in den Großstädten neben den öden MegamaxX-Alptraumfabriken noch Lichtspielhäuser gibt, die ihrem Namen Ehre machen: durch ein anregendes Programm, ein gediegenes Interieur und einen bewussten Umgang mit der Tradition. Um am Standort Essen zu bleiben: Hier eröffnet in wenigen Tagen nach acht Jahren Zwangspause das Filmstudio am Glückaufhaus wieder seine Tore. Hauptsächlich dem unermüdlichen Einsatz der leidenschaftlichen Kinobetreiber Marianne Menze und Hanns-Peter Hüster und der Spendenbereitschaft geschichtsbewusster Essener Filmfreunde ist es zu verdanken, dass das älteste Kino des Ruhrgebiets seinen Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. Herzlichen Glückwunsch!
Diesen wie jenen Einsatz sollte jeder belohnen, der dessen Ergebnis zu schätzen weiß: Buch- bzw. Filmgenuss vom Feinsten. Und das geschieht auf kürzestem und wirksamstem Weg durch Besuch und Kauf. Ich werbe hier sonst nie, für nichts und niemanden – diesmal mache ich die berühmte Ausnahme, die die Regel bestätigt: Bücherfreunde, kauft bei proust! Filmfreunde, besucht die Essener Filmkunsttheater Galerie Cinema, Lichtburg, Eulenspiegel, Astra und Filmstudio!
[Titelfoto: Proust-Leser Kamillus Dreimüller bei proust in Essen; Foto: Heinrich Funke.]
Wohnende (II)
Sunday, 03. May 2009Seit Erfindung der Treppe gibt es dreierlei Wohnweisen: unten, oben und dazwischen.
Der Mieter im Parterre gewinnt am schnellsten Land, wenn das Haus unsicher wird, eroberte also etwa in den Bombennächten des letzten Krieges regelmäßig die besten Plätze im Keller; aber auch im zivilen Brandfall hat er die besseren Karten, bleibt ihm doch der freie Fall ins Sprungtuch erspart; andererseits muss er aber vor Dieben besonders auf der Hut sein, die den Weg durchs Fenster notfalls per Räuberleiter bewältigen können. (Wohnsinn 8, 9, 10 und 11.)
Der Mieter unterm Dach thront über allen, genießt eine weite Aussicht und quält sich tagtäglich im Treppenhaus, in jungen Jahren nur auf-, in späteren dann auch abwärts. Er überlegt sich dreimal, ob er noch für ein Viertelstündchen vor die Tür gehen soll, zu einem kleinen Abendspaziergang durch die laue Frühlingsluft. Des Straßenlärms ist er leidlich enthoben, nicht aber der Flüche der Paketboten. (Wohnsinn 1, 3, 4, 5 und 6.)
Alles, was sich zwischen diesen beiden Hemisphären tummelt, also die überwiegende Mehrheit der Etagenhausbewohner, führt ein nicht so klar akzentuiertes Grauzonendasein, hat welche unter und welche über sich, fühlt sich vielleicht unbewusst eingequetscht, umso mehr, wenn sich außerdem ein Nachbar zur Rechten und ein Nachbar zur Linken bemerkbar machen und die Wände, wie üblich, noch dünner sind als die Decken und Böden. (Wohnsinn 2 und 7.)
Ich habe alle drei Wohnweisen intensiv erfahren und weiß, wovon ich rede, wenn ich sage: Allein schon diese Lokalisation ist die halbe Miete und entscheidet gegebenenfalls über Wohl und Wehe des Wohnenden.
Wohnende (I)
Sunday, 03. May 2009Nicht unwesentlich bestimmt sich der Flaneur als ein Umwegegeher. Er hat eingesehen, dass auf den geraden Strecken, den kürzesten Verbindungen zwischen zwei Punkten wenig zu finden ist und meist nur das Erwartbare, von Gewissheiten und Plänen Entwertete. Das Stöbern des Flanierenden hingegen geschieht planlos, wohl auf der Suche, aber ohne Wissen nach was. Müßig zu sagen, dass die Bewegung des Flanierens nicht auf Straßen und Wege beschränkt ist, sich vielmehr auch in ganz anderen Zielgebieten unternehmungslustiger Neugier bewähren kann.
Weit abseits von jenem weitläufigen Thema, das ich ab heute einzukreisen beginne, stieß ich auf folgende Einsicht des persischen Physikers und Heilkundigen Najib al-Din Abu Hamid Muhammad ibn Ali ibn Umar al-Samarqandi: „Die verschiedenen Gruppen der menschlichen Gesellschaft sind, angesichts der Realität, eigentlich ,Nationen‘ […]. Man könnte Kleriker, Ärzte, Literaten, Adelige und Bauern im Grunde als Nationen bezeichnen; denn jede Gruppe hat ihre eigenen Gebräuche und Denkschemata. Die Idee, sie seien genau wie man selbst, nur weil sie im selben Land leben oder dieselbe Sprache sprechen, ist eine Vorstellung, die des Überdenkens bedarf.”
Für alle, die es interessiert, hier der Routenplan für den Umweg. Ich fand diese Passage als Motto in Lisa Althers herzerfrischend unbefangenem Roman Hautkontakte (a. d. Am. v. Gisela Stege. Berlin – Frankfurt/M – Wien: Verlag Ullstein, 1977, S. 5), die sie wiederum der Sammlung alter sufistischer Geschichten von Idries Shah, Caravan Of Dreams, entnommen hat (London: The Octagon Press, 1968). Althers Buch habe ich mir erst neulich antiquarisch besorgt, weil ich eine kurze Episode daraus, Fesselnde Ehe, erneut mit Erfolg bei meiner Lesung in Oberhausen zum Besten gegeben hatte und gern einmal den Kontext kennenlernen wollte, in dem sie steht. Ich kannte diese groteske Geschichte um einen peinlich missglückten sexuellen Exzess, bei dem ein Paar Handschellen eine verhängnisvolle Rolle spielt, aus dem von Hermann Kinder herausgegebenen „Handbuch der literarischen Hocherotik”, Die klassische Sau (Zürich: Haffmans Verlag, 1986, S. 446-451), das ich 1986 von dem inzwischen verstorbenen Verlagsvertreter Jac Flessenkemper vor 23 Jahren zum Geburtstag geschenkt bekam. Jacs Widmung auf dem Vorsatz: „Trau keinem unter 30!”
Zurück zu al-Samarqandi. Der Gedanke, den er uns in aller Bescheidenheit ans Herz legt, ist ebenso schlicht wie berückend. Wenn man die Menschen nach ihrer Nationalität, nach ihrer Sprache oder ihrem Heimatland unterscheidet und hieraus Schlüsse auf ihre „Gebräuche und Denkschemata” ziehen zu können meint, dann ist es ebenso statthaft und sinnvoll, nach ihrer Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe zu fragen, denn diese ist mindestens ebenso prägend für ihr Verhalten und ihr Denken. Ich kann dieser Idee nur beipflichten, und dies sogar aus eigener Erfahrung, war ich doch unzweifelhaft in jenen 17 Jahren als Händler in einem offenen Ladengeschäft ein anderer Mensch als in den darauf folgenden zwölf Jahren, als ich einer Bürotätigkeit nachging.
Ich bin sogar davon überzeugt, dass es noch eine Reihe weiterer Gruppenzugehörigkeiten für jeden in der Zivilisation beheimateten Menschen gibt, von denen jede einzelne mehr Wirkung für seine „Gebräuche und Denkschemata” hat als seine Staatsangehörigkeit! Zum Beispiel sind Menschen ja nicht nur nebenbei Essende und Trinkende, weshalb Jean Anthèlme Brillat-Savarin im Aphorismus 4 zu seiner Physiologie des Geschmacks vielleicht etwas vollmundig erklärt hat: „Sage mir, was du ißt, und ich will dir sagen, was du bist!” (A. d. Frz. v. Emil Ludwig. Frankfurt am Main: Insel-Verlag, 1979, S. 15.) Aber auch darum soll es hier nicht gehen, sondern um uns Menschen als Wohnende. Und was den Leser unter dieser Überschrift künftig erwartet, sind ein paar Beobachtungen und Gedankensplitter zu einer noch zu schreibenden „Psychophysiologie des Wohnens”.
Schrittwechsel
Wednesday, 28. January 2009Hans Siemsen, der in seinem Reisebericht aus dem Sowjetstaat mit mildem Spott anmerkt, dass der Taylorismus und die Ford’sche Fließbandproduktion, nach dem allbeherrschenden Prinzip „Tempotempo!”, im Kommunismus keineswegs abgeschafft sind, sondern durch die gnadenlosen Vorgaben des ersten Fünf-Jahres-Planes eher noch eine Verschärfung erfahren haben, relativiert diese Diagnose an anderer Stelle durch seine Beobachtung, dass jeder russische Industriearbeiter in einer deutschen Fabrik unweigerlich auffallen würde: „Vor allem durch Langsamkeit.” (Rußland – ja und nein. Berlin: Ernst Rowohlt Verlag, 1931, S. 164.) Gegen das Phlegma der russischen Volksseele kehrt offenbar selbst Stalins „harter Besen” vergebens.
Und in den klimatisch milderen Regionen, am Asowschen und Schwarzen Meer, registriert er gar mit erkennbarem Wohlbehagen eine „Kultur der Langsamkeit”, die ihn fast an mediterrane Lässigkeit erinnert: „Vom Balkon des Hotels [in Rostow am Don] sehen wir hinunter auf die Straße. Es ist Ende September [1930]. Ein schöner, warmer Abend, wie in Berlin ein Sommerabend. In Moskau hatten wir schon gefroren. In Moskau habe ich nie einen Menschen ,spazieren gehen‘ sehen, alle waren immer so ernsthaft eilig. In Rostow ,flaniert‘ man. Liebespaare flirten langsam die Schaufenster entlang. Es gibt Läden mit Wein und Obst und schrecklichen Nippsachen. Die ganze Straße ist voll von Menschen, die, da es Abend ist, spazieren gehen. – Die ausländischen Journalisten auf dem Balkon sind ganz erstaunt. Sie kommen aus Moskau. Sie haben sowas noch gar nicht gesehen in Rußland. ,Das ist ja wie in Paris!‘, sagt einer zum andern. Der weiß es besser. ,Wie in Marseille!‘ sagt er. Und ein Dritter weiß es am besten: ,Ein Arbeiterviertel in Paris oder Marseille.‘ Aber alle sind sich darin einig, daß Rostow ganz was anderes ist als Moskau, hübscher, leichter, nicht so ernsthaft und streng. Verwegene sprechen von ,Eleganz‘. ,Sehen sie bloß! Da geht einer mit einem weißen Leinenanzug und einer knallbunten Krawatte.‘” (Ebd., S. 190.)
Müsste uns nicht längst schon die traurige Erkenntnis dämmern, dass die drei großen Ideale der Französischen Revolution – „Liberté, égalité, fraternité” – von vornherein zum Scheitern verurteilt waren, weil sie die naturgegebenen klimatischen Unterschiede zwischen den Weltregionen nicht in Rechnung stellten? Sind nicht alle hehren Versöhnungswünsche, von Christus bis zum jüngsten Shootingstar eines trotzigen Optimismus, Barack Obama, allein schon deshalb ins Leere gesprochen, weil es etwa in Sibirien unerträglich kalt und in weiten Teilen Afrikas unerträglich heiß ist? Die Staatsgrenzen, machen wir uns nichts vor, sind doch bei aller vorgeblichen Globalisierung vor allem Abwehrzäune der klimatisch bessergestellten Bevölkerungen, die ihr natürliches Privileg nicht mit den hungernden, frierenden und dürstenden Artgenossen teilen wollen.
Als komplizierende Faktoren kommen noch hinzu die ungleiche, gänzlich „ungerechte” Verteilung der Bodenschätze, die unabsehbaren Folgen des Klimawandels und das nach wie vor exponentielle Wachstum der Weltbevölkerung. Schlechte Aussichten für Homo sapiens.
Flanieren wir Happy Few doch ganz gelassen dem Untergang entgegen! Eile ist nicht geboten. Wir kommen schon noch früh genug ans Ziel.
Walkability
Monday, 22. December 2008Wohin die Autolosigkeit im Land der unbegrenzten Automobilität schlimmstenfalls bisher führen konnte, das hat uns wohl zuerst Günther Anders (1902-1992) in einer Tagebuchnotiz aus dem Jahr 1941 nahezubringen versucht, die er in den ersten Band seines Hauptwerks Die Antiquiertheit des Menschen aufnahm (München: C. H. Beck, 1956). Anders erzählt dort (S. 172 ff.), was ihm widerfuhr, als er weit außerhalb von Los Angeles einen Highway entlangwanderte und als verdächtiges Subjekt von einem motorisierten Cop gestoppt wurde. Dieser pflichtbewusste Polizist findet in seinem Weltbild nur zwei plausible Erklärungen für die befremdliche Tatsache, dass ein menschliches Wesen sich am Rande der Schnellstraße statt auf ihr und auf andere als die übliche Weise fortbewegt, nämlich vorsintflutlich per pedes. Entweder muss dieser „Sunnyboy”, wie der Polizist den Philosophen gönnerhaft nennt, sein Auto verkauft und noch kein neues erworben haben; oder das Auto dieses spät geborenen Peripatetikers muss sich in Reparatur befinden. Als Anders bekennt, er habe nie ein Auto besessen, fällt dem misstrauischen Gesetzeshüter die Kinnlade runter: „Sie haben nie?”
Gerade einmal 67 Jahre später haben wir nun den globalen Schlamassel namens „Finanzkrise” – und es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis die ewiggestrigen „Sunnyboys” sich zu Pionieren einer lange verschmähten Fortbewegungsart mausern werden. Zwar ist, verstehe es wer kann, das Benzin vorübergehend noch mal billig wie nie geworden, aber den Autobauern in Detroit, Stuttgart, Wolfsburg, Chūō (Tokio), Toyota und anderswo steht das Wasser bis zum Hals wie sonst nur noch den Banken.
Heute berichtet meine Tageszeitung, dass die Amerikaner neuerdings gern wieder zu Fuß gehen und sich aus den Suburbs zurück in die Zentren ihrer Städte sehnen. (Viola Schenz: Das Gute liegt so nah; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 297 v. 22. Dezember 2008, S. 9.) Dort kann man nachlesen, was man immer schon befürchtete: dass 41 Prozent aller Autofahrten in den USA unter zwei Meilen liegen und dass sich gerade einmal fünf bis zehn Prozent der amerikanischen Wohngebäude in einer städtischen Umgebung befinden, die sich „walkable” nennen kann: für ihre Bewohner in Nähe zu ihren Arbeitsplätzen, Einkaufszentren, Kulturstätten und Erholungsgebieten, die sie auf sicheren Verkehrswegen fußläufig erreichen können.
Der unvermeidlich bevorstehende Mangel, nicht die bessere Einsicht vor der Zeit, bringt schließlich den Fortschritt in Gang. So war es vermutlich schon immer. Es musste erst ganz schlimm mit uns kommen, damit es wieder besser werden konnte mit uns. Dabei war doch nur zu offenkundig, dass dieser Weg, so komfortabel er immer gewesen sein mochte, notwendig in eine Sackgasse münden musste. Oder?
Jetzt bleibt bloß noch zu hoffen, dass wir es nicht längst zu weit getrieben haben und der Autofriedhof des 20. Jahrhunderts uns im 21. nicht mit sich und unter sich begraben wird.
Pedifest (I)
Monday, 03. November 2008[1] In der Flanerie kehrt der Mensch, am Ausgang des inhumanen Zeitalters grenzenloser Beschleunigung, zu seiner ihm gemäßen Bewegungsform zurück. Der Flaneur, die Flaneuse von heute sind Pioniere bei der Erprobung jener natürlichen Fortbewegung, die nach dem unausweichlichen Zusammenbruch der automatisierten Mobilitätsgesellschaft allein noch übrig bleiben wird. Zugleich sind sie die ersten Wiederentdecker jener archaischen Erfahrungsmöglichkeiten vor Erfindung des Rades, als noch der Schritt und nicht die Umdrehungszahl den Rhythmus menschlichen Lebens und Erlebens bestimmte.
[2] Mit der Heimkehr zum Gehen und der Abkehr vom Fahren und Fliegen leisten Flaneur und Flaneuse bewussten Verzicht auf eine Bequemlichkeit, die von Anbeginn ihrer Entwicklung auf Kosten der natürlichen Umwelt ging. Neben dem Raubbau an der Natur nahmen die Passagiere der immer schneller werdenden Fahrzeuge aber auch eine schleichende Zerstörung ihrer Sinnlichkeit hin. Der vermeintliche Komfort des Ortswechsels stahl den durch die Landschaft katapultierten Körpern einen großen Teil ihres unmittelbaren Empfindens. Die Flanerie ist das Projekt der Rückeroberung dieser verlorenen Welt.
[3] Die Erfahrung der Langsamkeit ist die ursprünglichste Passion des Flanierenden, seine Leidenschaft und zugleich sein bewusst gelebtes Leiden. Unsere allein auf Schnelligkeit zugerichtete Umwelt erlebt er von außen, als Außenseiter und Anachronist, spürt unmittelbar ihre morbide Hässlichkeit, Schmutzigkeit, Verkommenheit. So gewinnt er eine unverstellte Einsicht in den Zustand dieser menschgemachten Wirklichkeit, die den vorbeirasenden Gefangenen in ihren Fahrgastzellen lebenslänglich fremd bleiben muss. Flanieren ist somit in einer hierfür nicht ausgelegten Realität das Beschreiten, Beschreiben eines Passionswegs.
[4] Flaneur und Flaneuse der urbanisierten Welt zu Beginn des dritten Jahrtausends sind keine Romantiker mehr wie ihre Vorgänger seit Charles Baudelaire. Zwar mag sich der gebildetere Teil von ihnen mit Sympathie auf die großen Vorbilder besinnen: auf die Spaziergänger Johann Gottfried Seume und Robert Walser, auf die großstädtischen Flaneure der 1920er-Jahre wie Walter Benjamin, Franz Hessel, Victor Auburtin, Siegfried Kracauer, Hans Siemsen und Walther Kiaulehn – oder gar auf einen nahezu völlig unbeachteten Tippelbruder im Geiste wie Hans Jürgen von der Wense. Doch die Zukunft des Flanierens sieht notgedrungen anders aus.
[5] Nebenbei hält auch eine philosophische Avantgarde den schützenden Schirm übers Haupt des modernen Flaneurs. Hierzu zählen nicht erst die französischen Situationisten um Guy Debord und Raoul Vaneigem, sondern viel früher schon die Peripatetiker der Antike und der Wandersmann Giordano Bruno. In neuester Zeit haben sich Denker wie Günther Anders, Paul Virilio, Joseph Weizenbaum und Neil Postman um die erkenntnistheoretische Durchleuchtung des „rasenden Stillstands” und der zunehmenden Virtualisierung unserer Lebenswelt verdient gemacht. Doch das Lesen ist nur eine Entspannungsübung nach der Arbeit: dem Flanieren.
[Fortsetzung: Pedifest (II).]