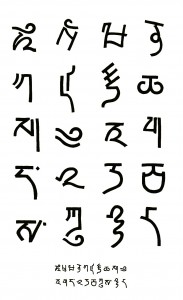Heute, am Monatsletzten, beende ich die Bettlektüre eines Buches, die ich am Neujahrstag begonnen habe: Uwe Tellkamps Der Turm (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2008). Der Roman bringt es auf knapp tausend Seiten und ist insofern eigentlich als literarisches Betthupferl aufgrund rein orthopädischer Bedenken eher ungeeignet. Dass ich dennoch vorm Einschlafen im Tagesdurchschnitt rund dreißig Seiten „geschafft” habe, obwohl mir gelegentlich ein bleiernes Gefühl in die Arme schlich, spricht immerhin für den Unterhaltungswert dieses, um die Verlagswerbung zu zitieren, „monumentalen Panoramas der untergehenden DDR”.
Die Kritik war sich einig, dass der Bachmann-Preisträger des Jahres 2004 damit wenn nicht sein Meisterwerk, so doch sein respektables Gesellenstück abgeliefert hat. Sie hat aber nach meinem Urteil nicht deutlich genug gemacht, dass Tellkamp mit diesem opulenten Buch den Versuch gewagt hat, die ehrwürdige Tradition des bürgerlichen Familienromans à la Buddenbrooks und die seit James Joyce florierende Erzähltechnik der Montage gänzlich disparater Stilmittel zum stimmigen Bild eines untergegangenen realsozialistischen Deutschen Reichs zu legieren. (Sabine Franke zählt in ihrer Rezension für die Frankfurter Rundschau „Briefe, Träume, Rückblenden, Fakten und konventionelle Erzählpassagen” auf; dabei sind es doch noch weitaus mehr.) Und diese vom vergleichsweise hohen Rang des Romans faszinierte Kritik vergisst leider zu erwähnen, dass der ebenso fleißige wie belesene Autor sich bei diesem Spagat letztlich die Beine ausreißt.
Dass Der Turm zudem noch als ein Schlüsselroman daherkommt, nimmt mich eher gegen ihn ein – denn neben meiner täglichen Pynchon-Lektüre möchte ich zu nachtschlafender Zeit eigentlich nicht mehr den Rechner anschmeißen, um dahinterzukommen, dass sich hinter Baron Arbogast kein Geringerer als Manfred von Ardenne verbirgt, Jochen und Philipp Londoner Vater und Sohn Kuczynski zum Vorbild haben und mit dem RA Sperber des Romans nur der mittlerweile verstorbene Manfred Vogel gemeint sein kann, der im Agentenschacher des Kalten Krieges eine unvergesslich-zwielichtige Rolle spielte.
Tellkamps mit langem Atem geschriebenes magnum opus ist, bei allen Einwänden gegen seine möglicherweise anbiedernde, effekthascherische Schreibe, nur selten langatmig. Ich bin immerhin gespannt, ob dieses bemerkenswerte Talent sich noch zu einem opus summum aufschwingen wird; hoffentlich ganz anders als Thomas Mann mit seiner Joseph-Tetralogie, die im bitteren Geschehen der fernen Völkerschlacht – meine Heimatstadt Essen wurde dem Erdboden gleichgemacht – keine andere Heimstatt finden konnte als in den Geborgenheiten schimmelnder Traditionen. Während dies geschah, löffelte der geistheilige Thomas Mann zitronensaftgewürzte Austern in seiner Villa in Pacific Palisades.
Auch wir intellektuellen Überflieger – wie Goebbels sagte: die „Intelligenzbestien” – müssen uns doch nicht bis zum Jüngsten Gericht gedulden, an dem wir das Scherbengericht zusammentragen. Da warten wir stattdessen lieber auf eine Erleuchtung, die sich von Traditionen gleich welcher Art freigemacht hat – noch im Diesseits.