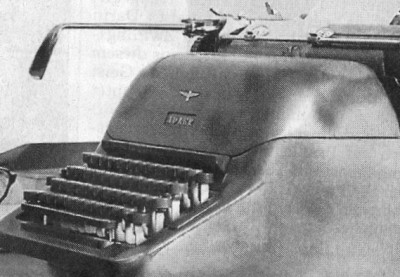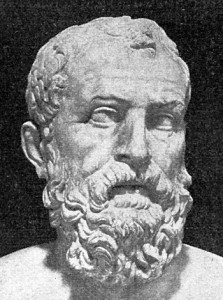Die erzwungene Besinnungspause führt zu ersten Einsichten. Weil ich mich mit kleinen Schritten begnügen wollte, meinte ich, diesem langsamen Fortschritt durch entsprechend viele Schritte auf die Sprünge helfen zu müssen. In den 1280 seit dem Startschuss für dieses Weblog vergangenen Tagen habe ich 886 Beiträge veröffentlicht. Anders gesagt durfte der Leser hier an zwei von drei Tagen einen neuen Artikel erwarten – wenn es denn überhaupt Leser gab, die hier alle paar Tage vorbeischauten.
Dieser Illusion gehe ich aber längst nicht mehr auf den Leim. Dazu ist mein Blog einerseits zu strapaziös, andererseits – “to tell the truth: its too much eccentric!” Nachdem ich hinlänglich unter Beweis gestellt habe, dass es mir an Fleiß und Kondition nicht mangelt, sollte ich mich vielleicht künftig darauf konzentrieren, noch deutlicher und noch genauer das zum Ausdruck zu bringen, was – frei nach Patti Smith – nur ich allein so zum Ausdruck bringen kann. Dafür benötige ich jedoch erfahrungsgemäß etwas mehr Zeit als anderthalb Tage.
Vor ein paar Tagen mehr wurden in unserem Haus fünf Betten angeliefert. Da die Straße sehr schmal ist, stand der Möbelwagen direkt vor unserem Küchenfenster. Dadurch ergab sich das irritierende Bild dort oben: “Big sister is watching you!” Plötzlich verschieben sich durch des Zufalls Komödiantenlaune die Proportionen. Ich wähne mich in den daumengroßen Bewohner eines Puppenhauses verwandelt, den von draußen die riesenhaft erscheinende Besitzerin dieser Liliputwelt amüsiert beobachtet. Gleich wird es ihr vielleicht gefallen, mich mit spitzen Fingern zu packen und auf den Dachfirst zu setzen!
Wo es aber durch ein wenig Kulissenschieberei möglich ist, einem mittelgroßen Mitteleuropäer momentweise das Selbstempfinden eines Zwergs zu suggerieren, da ließe ich mich doch vielleicht mittels eines entgegengesetzten Verzerrungstricks zu einem virtuellen Geistesriesen aufblasen – wenn nicht für immer, so doch bitte schön für jene fünf Minuten, die das Lesen und Verstehen meiner fünfteiligen Kurzprosa-Pröbchen beansprucht.
Dieser Trick wäre vielleicht durch die Lupe möglich, die der Leser zur Hand nehmen sollte, um zwischen meinen Zeilen auf die Suche nach versteckten Hinweisen zu gehen. Wo steckt der Schlüssel zum Hinterzimmer? Wer lauert dort auf den ungebetenen Besucher? Was führt er mit diesem im Schilde? Welche Ausflüchte könnte der Eindringling vorbringen? Was geschähe mit ihm, so sie nicht verfängen? Und was um alles in der Welt wäre sein Lohn, wenn ihm wider Erwarten schließlich doch noch mit knapper Nor die Flucht gelänge?