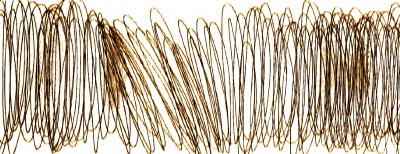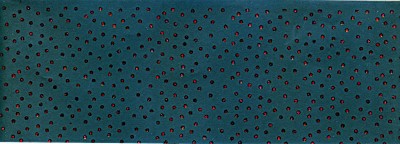Mein Ältester erzählt mir beiläufig von einem Dokumentarfilm über einen nie zu Ende gedrehten Spielfilm des französischen Regisseurs Henri-George Clouzot. Ich hätte ja immer nur von Lohn der Angst geschwärmt. Gern hätte ich widersprochen, denn ich erinnerte mich gut, dass es noch einen zweiten Film von Clouzot gab, den ich damals annehmbar fand. Aber wieder einmal macht mir, wie in den letzten Jahren immer öfter, mein schwächer werdendes Langzeitgedächtnis einen Strich durch die Rechnung. Ich komme nicht auf den Titel dieses Films. Aber eigentlich geht es ja auch nicht um diesen vergessenen Film, sondern um den Fragment gebliebenen Film, dessen Titel mein Sohn wohl auch genannt hat, aber kurz darauf habe ich auch diesen Titel vergessen. Wie kamen wir überhaupt auf Clouzot? Ach ja, das fällt mir wieder ein. Ich hatte die Geschichte von Romy Schneider und Harry Meyen erzählt, von der Nephrektomie rechtsseitig bei Romy und dem Suicid am Seidenschal nach langjährigem Optalidon-Abusus bei Harry, was mir gleichzeitig als unsägliches Kauderwelsch vorkam, Gefasele eines unter Beziehungswahn leidenden Irrgängers. Es entstand eine peinliche Pause, denn meine Geschichte führte ins Nichts. Daraus rette mich mein Sohn, indem er von Clouzots unvollendetem Meisterwerk sprach, worin Romy Schneider die weibliche Hauptrolle spielte. Das war die Brücke zu L’Enfer. Denn so hieß der Film, das habe ich jetzt nachgeschlagen. Falsch verstanden hatte ich, dass der Regisseur über den Dreharbeiten einem Herzinfarkt erlegen sei. So war es nicht. Allerdings mussten die Arbeiten wegen Clouzots Infarkt abgebrochen werden, doch überlebte der Meister und drehte anschließend noch zwei weitere, weniger bedeutende Filme. Mein Sohn wusste wohl davon, weil vor drei Jahren ein Dokumentarfilm L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot herauskam, der begeisterten Zuspruch fand. Einen kleinen Ausschnitt habe ich eben gesehen. Er zeigt Romys Gesicht, rauchend, verführerisch lächelnd, zeigt sie Wasser aus einer unerschöpflichen Flasche in ein Glas füllend – und schließlich mit einer Spirale spielend, die unmittelbar eine starke Erinnerung in mir wachrief. Genau eine solche Spirale hat mein bester Freund vor wohl 45 Jahren aus den Ferien mitgebracht. Er konnte sie Treppenstufen „hinunterlaufen“ lassen, ein wunderbarer Effekt, ein beneidenswertes Objekt! Im Film von 1964 kriecht die gleiche Spirale über Romy Schneiders in verführerische Dessous gehüllten, in blaues Licht getauchten Körper. (Und jetzt weiß ich auch wieder, wie der zweite Film von Clouzot hieß, den ich mochte. Das waren Die Teuflischen, nach dem Roman von Boileau-Narcejac, den ich ebenfalls gelesen habe.) – So vergeblich, so albern, so kränkend diese kleinen Scharmützel im Kampf gegen das Vergessen sein mögen, es käme einer Generalkapitulation gleich, wenn ich mich ihnen nicht mehr stellen wollte.
Archive for the ‘Rêverie’ Category
Spiraltraum
Wednesday, 11. January 2012Texttraum (I)
Friday, 12. February 2010Seit ich die produktive Zeit meiner Tage ganz überwiegend mit dem Verfassen von Texten verbringe, seit knapp drei Jahren also hat sich bei mir ein neuer Traumtyp eingestellt.
Diese Textträume, wie ich sie nennen will, suchen mich in unregelmäßigen Abständen heim, und zwar immer in den Morgenstunden an der Grenze zum Erwachen. Ich bin mir sogar bewusst, dass ich träume, beschließe aber, den Traum noch nicht durch vollständiges Hinüberwechseln in den Wachzustand zu beenden, weil ich gern wissen möchte, wie er ausgeht, wenn ich ihn sich selbst überlasse. Darin verbirgt sich allerdings ein Widerspruch, denn gleichzeitig bin ich mir dessen bewusst, dass ich selbst es bin, oder besser: dass es etwas in mir selbst ist, dass den Traum in allen Einzelheiten verfertigt.
Dies mag schon befremdlich genug klingen. Was mich aber wirklich immer wieder erstaunt und anfangs sogar beunruhigt hat, ist etwas anderes. In diesen Träumen spielt die Sprache – die ausformulierte Sprache in wörtlicher Rede, in gelesenen Texten, aus dem Radio oder in Büchern – die entscheidende Rolle. Und die sprachlichen Äußerungen, mit denen ich in diesen Textträumen konfrontiert bin, richtiger: mit denen ich mich selbst konfrontiere, ohne mir einer schöpferischen Leistung bewusst zu werden, sind so wohlgesetzt, teils syntaktisch erstaunlich kompliziert und doch fehlerfrei gebaut, dass ich den Zweifel nicht ganz abweisen kann, ob sie wirklich von mir allein stammen. Hinzu kommt, dass ich, ihr Träumer, von ihrem eigentlichen Inhalt oft genug selbst überrascht bin.
Der jüngste Texttraum liegt unmittelbar zurück und ich habe ihn noch in sehr frischer Erinnerung. Als gutes Beispiel will ich ihn hier möglichst genau wiedergeben. Ich befinde mich mit einem etwa 30jährigen, blonden, gut aussehenden Mann im Halbdunkel eines kleinen Häuschens, von dem ich annehme, dass es auf dem Lande gelegen ist. Ich erinnere mich, dass er irgendwann den geografischen Namen Västerbotten erwähnt, weshalb ich ihn für einen Skandinavier halte und vermute, dass wir uns in Schweden befinden. Es ist Winter, durch ein beschlagenes Fenster hinter dem Mann ist eine Schneelandschaft zu erahnen. Ich habe das Gefühl, dass noch weitere Personen sich mit uns in diesem schwach beleuchteten, aber gemütlichen Zimmer befinden, die eher zu mir gehören. Die Art, wie der Mann spricht, lässt darauf schließen, dass er uns auf eine Frage antwortet. Vielleicht sind wir Reporter, die ihn interviewen? Vielleicht sind wir aber auch neue Freunde, denen er bedeutsame Episoden aus seinem Leben erzählt, damit wir ihn besser kennenlernen. Der Mann spricht in kurzen, klaren Sätzen, nicht laut, nicht leise, nicht tonlos, aber auch nicht dramatisierend. Vielleicht könnte man seinen Tonfall am ehesten als beherrscht bezeichnen, und zwar durchaus in dem Sinne, dass er seine Stimme mit Macht beherrschen muss, weil sie sonst ausbrechen könnte. Von Anfang an habe ich, während ich ihm zuhöre, das Gefühl, dass das, was er uns erzählt, auf etwas Ungutes hinauslaufen wird. Und ich bin ganz sicher, dass ich ihn unter keinen Umständen unterbrechen darf. Dies erzeugt in mir ein deutliches, aber nicht unerträgliches Gefühl von Ausgeliefertsein. Vermutlich ist es die Neugier, die ich gleichzeitig empfinde, die mir die Lage des stummen Zuhörers dennoch halbwegs erträglich macht. Zugleich weiß ich ja, siehe oben, dass ich dies nur träume. „Nein,“ sagt der blonde Mann, „ich bin nicht gern in diesem Haus. Es ist nicht etwa deshalb, weil an dem Haus selbst etwas zu beanstanden wäre. Es ist günstig gelegen. Es hat für einen bescheidenen Menschen wie mich genug Komfort. Und dennoch kehre ich nur hierher zurück, wenn es nicht vermeidbar ist. Die Heizung hat ihre Mucken, gewiss. Auch das Regenrohr verstopft im Herbst, und das Wasser pläddert anschließend gegen die Fenster, was ganz schön an die Nerven gehen kann. Aber damit lässt sich ja schließlich leben. Es hat einen anderen Grund, warum ich dieses Haus meiner Kindheit meide. Es sind die Erinnerungen, die dann wach werden. Sie stecken in jedem Winkel, kriechen aus jeder Ritze. Jedes Astloch raunt mir diese alten Geschichten ins Ohr.“ (Ich muss hier kurz unterbrechen, um meine Begeisterung für dieses Sprachbild zum Ausdruck zu bringen. Darauf wäre ich im Wachzustand kaum gekommen. Übrigens fiel im Traum an dieser Stelle seiner Ausführungen mein Blick tatsächlich auf ein Astloch in der Tischplatte vor mir, zwischen uns, und es schien mir, dass es die Form und Färbung eines zum O geformten Mundes hatte.) „Meine Mutter arbeitete in der Stadt. Und im Winter waren mein Vater und mein Onkel daheim und hatten nichts zu tun. Deswegen ertrage ich es nur mit Mühe und nur für kurze Zeit, mich in diesem Haus aufzuhalten. Ich bereue jetzt wieder, mich auf den Vorschlag eingelassen zu haben, hierher zu kommen. Es ist ja so, dass mein Onkel mit mir hier Dinge getan hat, die mir nicht gefielen. Und es ist so, dass diese Dinge mir immer unerträglicher wurden. Ich ertrug es schließlich nicht mehr und bin, obwohl ich mich so sehr schämte, zu meinem Vater gegangen. Aber mein Vater hat mich nicht vor seinem älteren Bruder in Schutz genommen. Das ist der Grund. Das ist alles. – Gehen wir!“
Ich beschließe, dass der Texttraum damit beendet ist, knipse ihn geradezu aus wie einen Film im Fernsehen und bin augenblicklich hellwach. Ich erzähle ihn meiner Gefährtin, damit ich ihn besser im Kopf behalte. Zweierlei fiel mir zu diesem speziellen Fall spontan ein, was als Quelle oder Material gedient haben könnte. Einmal die Autobiographie von Per Olof Enquist, die ich im Juni vorigen Jahres gelesen habe. Enquist stammt aus Västerbotton und hat in Ein anderes Leben ausführlich über seine problematische Kindheit gesprochen und über das Verhältnis zu seinem früh verstorbenen Vater. (Dass mein sehr starker Eindruck von diesem Buch hier keinen Wiederhall gefunden hat, ist einzig mit meiner umzugsbedingten Zwangspause beim Bloggen zu erklären.) Zweitens der Film Das Fest des Dänen Thomas Vinterberg, den ich 2005 gesehen habe und in dem es um Kindesmissbrauch durch den Vater geht. – Ich verspüre ansonsten nicht das Bedürfnis, meine Textträume zu interpretieren, zu deuten. Das erschiene mir fast wie die Beschädigung von etwas sehr Zartem, Verletzlichem, als wollte man einer Blüte die einzelnen Blätter ausrupfen.
Blutregen
Thursday, 08. October 2009Gestern habe ich tatsächlich die allerletzten Bücherkisten ausgepackt und ihren Inhalt in die Lagerregale verfüllt. Ja, dieser Ausdruck, wie aus einer Großmolkerei mit Massentierhaltung, passt ganz gut zu der viehischen Plackerei, der ich mich in den vergangenen Tagen ausgesetzt sah.
Viele Male musste ich mir Gewalt antun, wenn ein Buch meine Aufmerksamkeit erheischte, das ich schon seit Jahren nicht mehr in Händen gehalten und gar schon nahzu vergessen hatte. Nur zu gern hätte ich der Zeit nachgesonnen, als ich es für meine Bibliothek erwählte, den Gründen auf der Spur, die es für mich eingenommen hatten; zu gern hätte ich mir die Frage gestellt, ob ich es gelesen und mit welchem Ergebnis aus der Hand gelegt haben mochte. Aber der unbarmherzige Scherge, den ich mir selbst in den Nacken gesetzt hatte, ließ keinen Müßiggang zu. Hier galt es einzig und allein zu prüfen, ob der Platz auf den Brettern für das in den Kisten reichen würde. Also rief er mir ein ums andere Mal sein Kommando ins Gewissen, wenn ich in Nachdenklichkeit zu versinken drohte: ,Weiter, weiter! Auspacken, einräumen! Zum Träumen ist später noch Zeit genug.‘
Wie Schneeflocken tanzten die Bücher vor mir im Neonlicht des Archivs. Die Masse, die ich zwar geahnt hatte, überwältigte mich dann doch. Das war zweifellos nicht mehr gesund. So viele Bücher! Wie hatte ich es nur so weit kommen lassen können? Als mein zweiter Sohn die letzte Sackkarrenladung abgesetzt hatte, meinte er in seiner unnachahmlich trockenen Art: „Nun habe ich aber fürs Erste wirklich genug von deinen Büchern, Vater.“ Dieser Überdruss war ihm und allen anderen, die mir in den letzten Wochen und Monaten wissentlich oder unfreiwillig geholfen hatten, meine Bibliothek erstmals seit vielen Jahren wieder an einem Orte zusammenzuführen, wahrlich nicht zu verdenken. Ich danke euch von Herzen …
In der vergangenen Nacht träumte ich, dass ich aus dem Fenster eines Sanatoriums in eine dunkle Winterlandschaft hinausspähte, weil ich jemanden erwartete, der mich hier besuchen wollte. Es schneite auch in diesem Traum, aber die Schneeflocken waren blutrot. Das wunderte mich zwar nicht weiter, aber ich machte mir Sorgen, mein Besucher könnte sich auf seiner Wanderschaft die Kleidung ruinieren.
(Übrigens vermisse ich jetzt, obwohl ich wirklich alle Kisten ausgepackt habe, immer noch einige Bücher, die ich bei dieser Herkulestat fest gehofft hatte endlich wiederzufinden.)
Not leidend
Wednesday, 21. January 2009Schon von Weitem sehe ich, dass mit meiner Bank etwas nicht stimmen kann. Vor dem monumentalen Gebäude im Palazzo-Stil erhebt sich ein Baugerüst. Arbeiter in blauen Overalls sind damit beschäftigt, die Fassadenverkleidung aus weißem Carrara-Marmor abzuschälen und auf einen Lastwagen zu verladen. Auf meine Frage, was das denn zu bedeuten habe, erwidert ein breit grinsender Türke mit einem $$-Tattoo auf dem rechten Handrücken: „Das wird jetzt zu Geld gemacht.”
Beim Betreten der Schalterhalle trifft mich fast der Schlag. Dort, wo noch gestern imposante Kristalllüster hingen und diese Kathedrale des Geldverkehrs in gleißendem Licht erstrahlen ließen, baumeln nun nur noch ein paar vereinzelte Energiesparleuchten von der Decke herab, in deren zwielichtigem Schein sich mir ein Bild des Jammers darbietet. Unwillkürlich muss ich an die Kirche in Soylent Green denken, wo Lincoln Kilpatrick als farbiger Priester den Mühseligen und Beladenen im New York des Jahres 2022 eine dürftige Bleibe geschaffen hat [s. Titelbild]. Überall verstellen Notbetten den Weg zu den Kassenschaltern, bedecken Luftmatratzen und Schlafsäcke das bis vorgestern noch stets spiegelblank polierte Parkett, auf dem jetzt stöhnende, sabbernde, wimmernde Elendsgestalten sich zur letzten Ruhe gebettet haben. Etliche dieser traurigen Kreaturen strecken ihre flehenden Hände nach mir aus, betteln mich um ein paar Cent an, während ich mir mühsam einen Weg zu jenem „Infopoint” erkämpfe, an dem ich in den letzten dreißig Jahren Terminabsprachen mit den Sachbearbeitern der oberen Etagen vereinbarte.
„Was ist denn hier los?” Meine Frage, die ich an „Miss Moneypenny” gerichtet habe – ich nenne die dienstälteste Beschäftigte des Kreditinstituts meiner Wahl insgeheim schon seit Urzeiten so, weil sie tatsächlich verblüffende Ähnlichkeit mit Lois Maxwell in den frühen James-Bond-Filmen hat -, meine entsetzte Frage trifft auf völliges Unverständnis. „Aber haben Sie es denn noch nicht mitbekommen, Herr H.? Wir sind durch die Finanzkrise völlig verarmt. Die komplette Belegschaft musste entlassen werden. Ich bin die Letzte, die hier noch die Stellung hält, um unsere treuen Kunden zu ver-, äh, zu trösten. Wir mussten auf Anordnung der Stadtverwaltung unsere Räumlichkeiten zum Notasyl für Obdachlose umrüsten.” Flüsternd fügt sie hinzu: „Einige meiner ehemaligen Kollegen liegen auch auf den Pritschen.” Und mit nahezu ersterbender Stimme: „Dort hinten, der alte Mann mit dem hässlichen Hungerödem neben der Nase, das ist der ehemalige Vorstandschef der Bank. Und dabei hatte er doch immer so einen guten Riecher!” Verschämt stecke ich Moneypenny einen Zehn-Euro-Schein zu, den sie augenblicklich im Ärmel ihrer nicht mehr ganz sauberen Bluse verschwinden lässt: „Ich schäme mich so! Das ist alles soo furchtbar – sooo erbärmlich!” – Dicke Tränen perlen auf dunkle Augenringe …
Nachdem ich eben aus diesem Albtraum an meinen bescheidenen Schreibtisch zurückgekehrt bin, lese ich mit Verwunderung, dass die Jury der Sprachkritischen Aktion Unwort des Jahres das Wort von den „Not leidenden Banken” zum „Unwort des Jahres 2008″ gekürt hat. Unworte, so hatte ich bisher angenommen, seien solche sprachlichen Neubildungen, die in einem krassen, geradezu zynischen Widerspruch zu den politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Tatsachen in Deutschland stehen. Der durch diese verfehlte Jury-Entscheidung inkriminierte Begriff beschreibt aber doch die aktuelle Situation sehr zutreffend, wovon ich mich durch persönliche Inaugenscheinnahme soeben überzeugen musste.
Geld ist ja eigentlich nicht meine Welt. Und so war mein Hauptmotiv, warum ich mich hier zu diesem für mich nahezu bedeutungslosen Thema zu Wort gemeldet habe, ein ganz anderes. Ist es denn etwa nicht erschreckend, dass mittlerweile selbst die publicityträchtige Bekanntgabe eines solchen „Unworts”, auf der breiten Front der offenbar Ahnungslosen, in der zwar nicht falschen, aber doch veralteten Schreibweise „notleidende Banken” erfolgt? Wo doch der aktuelle Duden (24. Auflage, S. 735) seit 2006 ausdrücklich „Not leidend”, in getrennter Schreibung, als bevorzugte Variante empfiehlt? – Meine Sorgen möchte ich haben.
Was nun?
Monday, 19. January 2009Die Arbeitswoche lässt sich nicht gut an. Nachdem ich gegen Mitternacht noch in Raymond Martins Ich bin gut gelesen habe und dabei feststellen musste, dass mein Eccentrics-Beitrag nicht nur vor sachlichen Fehlern strotzt, sondern vermutlich auch in seinem Fazit ungerecht ist, schlief ich mit dem unerträglichen Gefühl ein, mich als Verräter geriert zu haben.
In einem Albtraum, aus dem ich gegen drei Uhr nachts schweißgebadet erwachte, hatte ich an Händen und Füßen gefesselt und nackt auf einem Thron gesessen, an dem die lange Reihe meiner Feinde vorbeidefilierte, um mir durch einen Metalltrichter allerlei eklige, giftige und unverdauliche Scheußlichkeiten einzuflößen. (Vermutlich verdankte ich diese unerträgliche Reminiszenz dem Auburtin-Feuilleton Gold, das ich gestern zum zweiten Mal las und in dem es heißt: „Der zweite Grad war jener berühmte Schwedentrunk. Zwei Soldaten gossen dem Liegenden durch einen Schlauch die Mistjauche in den Mund und drückten dann auf den Magen, daß die ekle Brühe hoch herausspritzte. Dreimal taten sie es, und nach jedem Mal fragten sie nach seinem Gold […].”) Diese Foltermethode erinnerte mich selbst im Traum noch vermutlich an den Film Cartouche, der Bandit, mit Jean-Paul Belmondo und Claudia Cardinale in den Hauptrollen, den ich im Vormittagsprogramm des ZDF sah, zerlegt in einen Zwei- oder Dreiteiler, Anfang der 1970er Jahre bei einem Freund aus dem Süthers Garten, dessen Mutter sich erfreulicherweise alltäglich zum Mittagsschlaf zurückzog und uns die Herrschaft über die Traumfabrik aus der Flimmerkiste überließ. Auch in diesem Film von Philippe de Broca (1962) wurde einem gefesselten Kampfgefährten des französischen Schinderhannes-Pendants ein solcher Trunk eingeflößt, was meine masochistischen Pubertätsphantasien heftig stimulierte.
Kein ganz unpassender Eintritt in einen Tag, an dem man Edgar Allan Poe zu seinem runden Geburtstag gratulieren möchte. In „irgendeiner kleinen Pension in der Haskins[-] oder Hollis Street im südlichen Teil von Boston” (Frank T. Zumbach: E. A. Poe. Eine Biographie. München: Winkler Verlag, 1986, S. 22) erblickte, heute auf den Tag genau vor zweihundert Jahren, der Sohn eines nicht gerade überaus erfolgreichen Schauspieler-Ehepaares das Licht dieser immerzu untergehenden Menschenwelt – Grund genug, diesem Großmeister des schwarzen Humors erneut meine Reverenz zu erweisen, nachdem ich seiner unbezweifelbaren Genialität ja schon mit meiner XXVII. Literarischen Soiree am 1. August 1991 den nötigen Respekt gezollt habe.
Allein, ich konnte in meinem Bücherdurcheinander weder die Poe’sche Werkausgabe aus dem Walter-Verlag in Olten und Freiburg im Breisgau finden, übersetzt von Arno Schmidt und Hans Wollschläger, noch die Sammlung seiner Meistererzählungen im Manesse-Verlag. Ich konnte noch nicht einmal den Schlüssel zu meinen Bücherkatakomben finden, wo sich vielleicht diese beiden Preziosen versteckt halten. Erfolgloses Suchen – das hätte vielleicht auch noch ein traumatisches Thema für eine weitere „Short Story” des vermutlich im Delirium tremens verendeten Dichters abgeben können. Oder starb er, wie andere meinen, an einem tollwütigen Katzenbiss? Gar an der Cholera?
Ursprünglich wollte ich heute über Raymond Roussels geniales Patentrezept für das Matt mit Läufer und Springer berichten. Auch das ist ja eine Art Albtraum: wenn es im Endspiel nicht gelingt, innerhalb der vorgeschriebenen Höchstzahl von 50 Zügen mit zwei Leichtfiguren und dem König den Sieg zu erzwingen! Roussel wird warten müssen. Alles geht nun mal nicht, an einem solchen trüben Tag – und nach solch finsterer Nacht.
[Titelbild: Alfred Kubins Schlussvignette zu Poes Novelle Lebendig begraben, zuerst erschienen in der Sammlung König Pest und andere Novellen. A. d. Am. v. Gisela Etzel. München u. Leipzig: Verlag Georg Müller, 1911, S. 97.]
Totenträume
Tuesday, 30. December 2008Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurden ungezählte Deutsche, die sich leichtsinnigerweise Anfang August noch in Frankreich aufhielten, unter dem Vorwand der feindlichen Spionage verhaftet. Ich vermute, dass mit den Franzosen im Deutschen Reich nicht viel anders verfahren wurde. Krieg folgt ja im Großen und Ganzen, aber auch in allen Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten der alttestamentarischen Regel: „Auge um Auge, Zahn um Zahn” (Ex 21, 24) – und bedeutet somit den sündhaften Verstoß gegen die radikale Forderung des Mannes aus Nazareth (Mt 5, 39), stattdessen die andere Wange hinzuhalten.
Einer dieser harmlosen Zivilisten, die es zu Kriegsbeginn eiskalt erwischt, ist der begnadete Feuilletonist Victor Auburtin (1870-1928), der als Auslandskorrespondent des Berliner Tageblatts von September 1911 bis Ende Juli 1914 in Paris weilt. Dem genussfreudigen Bonvivant wird zum Verhängnis, dass er sich bei der Flucht in die Schweiz auf der Zwischenstation in Dijon von einer herrlichen Aalpastete, einem prachtvollen Rehrücken und zwei Flaschen moussierenden Burgunderweines zum Bleiben verführen lässt – „denn so unvernünftig die Welt auch geworden sein mag, bleibe ich doch besonnen genug, um mich zu erinnern, daß man in Dijon gut ißt.” (Zit. nach Victor Auburtin: Was ich in Frankreich erlebte und die Literarischen Korrespondenzen aus Paris 1911-1914. Werkausgabe, Bd. 3. Berlin: Verlag Das Arsenal, 1995, S. 369.)
Zwei Tage später sitzt der allzu optimistische Gourmet als politischer Häftling in Zelle 11 des Gefängnisses von Besançon, das er erst am 21. Januar 1915 wieder verlassen wird – aber nur, um für die kommenden zwei Jahre, sieben Monate und 18 Tage mit hunderten deutscher Leidensgefährten in einem Internierungslager auf Korsika „verwahrt” zu werden. Über die nutzlos verschwendeten Jahre seiner Gefangenschaft hat Auburtin in seinem bereits Anfang 1918 in Genf erschienenen Carnet d’un boche en France berichtet, das noch im gleichen Jahr in der deutschsprachigen Originalfassung unter dem Titel Was ich in Frankreich erlebte im Verlag Mosse in Berlin erschien und in der erwähnten Werkausgabe (S. 355-441) erfreulicherweise wieder – oder soll man schon sagen und warnen: „noch”? – greifbar ist.
Über die Traumwelt des Gefangenen schreibt der Traumtänzer Auburtin: „Ich bedenke die Träume, die man als Gefangener hat. Sie sind bedeutend und eindringlich und ganz anders als die Träume der Menschen in der Freiheit. Oft träume ich – und meine Mitgefangenen ebenso – von den toten Freunden und Verwandten, an die ich jahrelang nicht mehr gedacht habe; sie erscheinen mir freundlich, sehen mich gütig an, und ich wohne mit ihnen in engen, traulich erhellten Zimmern. Seitdem mein Vater während meiner Gefangenschaft gestorben ist, träume ich stets von ihm, und sein besorgter Geist kommt zu mir durch die öde Sturmnacht des entlegenen Meeres. Neben diesen düsteren Totenträumen sind Phantasmen von leuchtender Helligkeit: weiße Pferde, sattellose, galoppieren marmorgepflasterte Straßen entlang; ein unermeßlich breiter Strom fließt spiegelnd; ich sitze im strahlend hellen Theater in der Tiefe einer Loge und sehe ein Gewühl wunderbarer Frauen, die schwere Perlenketten um die Schultern tragen.” (S. 444 f.)
Wenn das wache Leben zum öden Albtraum wird, treibt die Traumwelt umso farbigere Blüten.
[Titelbild: Ausschnitt aus Le rêve von Henri Rousseau, 1910.]