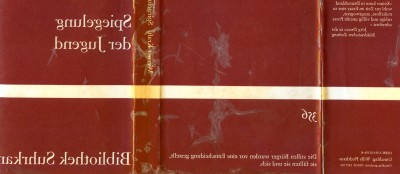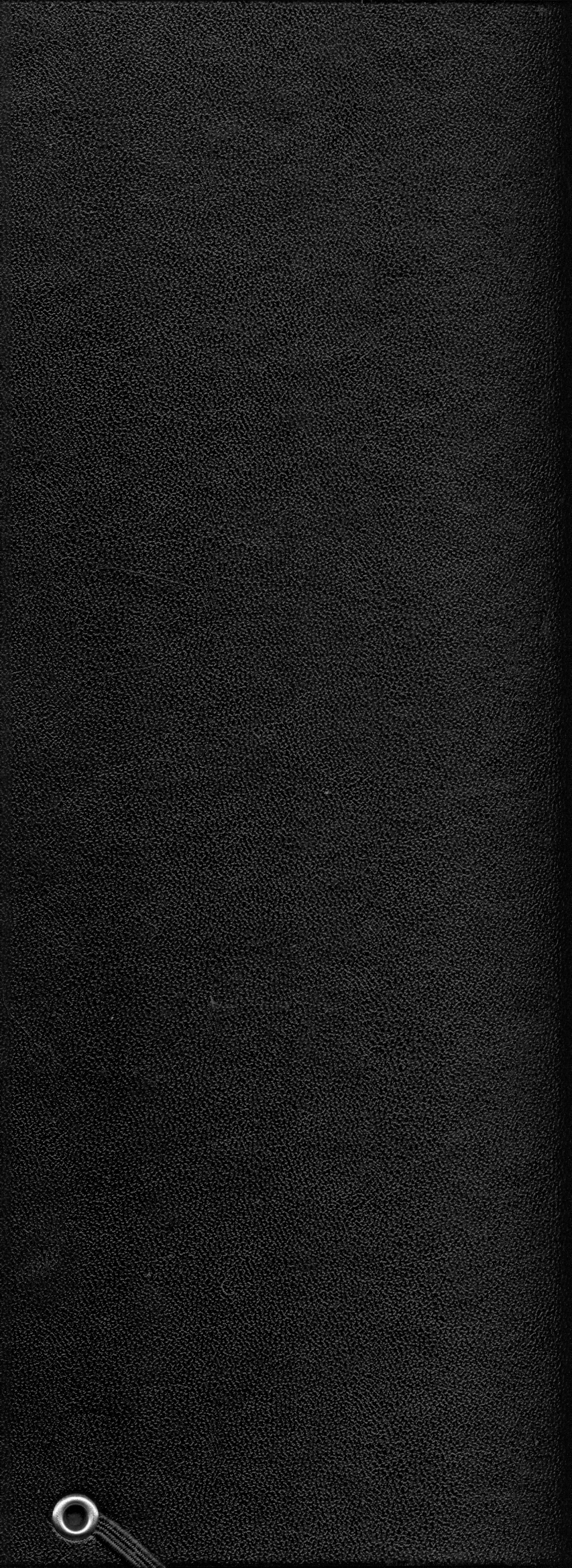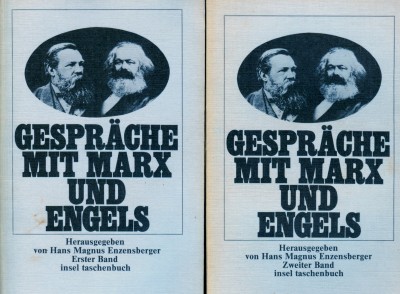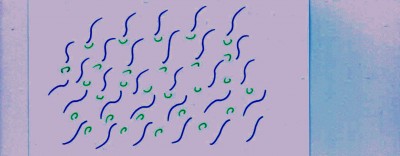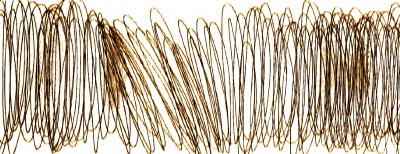Noch einmal aus meiner Kraft-Lektüre. In einer Kurzbiographie hatte ich gelesen, dass er als Soldat in jenem Weltkrieg, der noch keine Nummer trug, zu schwach für den Fronteinsatz war und darum in der Nähe seiner Heimatstadt Hannover in den Wahrendorffschen Anstalten als Sanitäter diente. Das war ein „Lazarett für Kriegshysteriker und Kriegsneurotiker“, wobei die staatstragenden Psychiater sich nach Kräften bemühten, erstere von letzteren diagnostisch zu unterscheiden, um die Hysteriker zurück an die Front schicken zu können. In diesem Zusammenhang stolperte ich in Krafts Jugenderinnerungen über folgenden Passus, der die Atmosphäre in der Anstalt beschreiben soll: „[…] die Luft war kaum zu atmen vor Sexualität, auch Homosexualität und Gemeinheit schlechthin, übrigens nicht nur bei den Kranken, sondern auch bei den Krankenwärtern und bei den Krankenschwestern. Das Bild war das einer kranken Gesellschaft im Zustand des Lebenshungers und der moralischen Verwilderung, die als Kriegsnatur eher erwünscht als verboten war.“ (A. a. O, S. 57.) – Das steht da schlicht und schlimm, in einem Atemzug „Homosexualität und Gemeinheit“! Man meint ja, die Schicksalsgemeinschaft von Juden, Homosexuellen, Kommunisten, Zigeunern unter der Herrschaft des Faschismus, wo sie alle miteinander in den gleichen KZs und Vernichtungslagern zusammengepfercht waren, hätte wenigstens die Vorurteile untereinander endlich beseitigen müssen. Aber weit gefehlt!
Archive for January, 2012
Gemeinheit schlechthin
Tuesday, 31. January 2012Schnupperwetter
Monday, 30. January 2012Ein verbreitetes Kennzeichen des Genies ist, nach vielen kleinen Anekdoten in den Biographien genialer Menschen zu urteilen, die hartnäckige Hinterfragung von scheinbaren Selbstverständlichkeiten des alltäglichen Lebens. Die normalsterblichen Durchschnittsdenker geben sich damit zufrieden, dass etwas so ist wie es ist, weil es ja schließlich immer schon so war und weil es ihnen übrigens auch ganz egal ist, denn nichts würde sich scheinbar für sie ändern, wenn es anders wäre. In einer kleinen Serie will ich solche Beobachtungen unerklärlicher Phänomene hier beschreiben – nicht etwa, weil ich mich für ein Genie hielte, sondern allenfalls in der Hoffnung, dass das eine oder andere Genie unter meinen zukünftigen Lesern hierdurch vielleicht einen Gedankenanstoß erhalten könnte für eine geniale Entdeckung oder Erfindung. Heute teile ich meine Beobachtung mit, dass Lola bei Neuschnee wesentlich intensiver am Boden rumschnüffelt als gewöhnlich [s. Titelbild]. Dies erstaunt mich insofern, als ich doch immer davon ausgegangen bin, dass Kälte die Gerüche eher dämpft, in der Hitze des Sommers hingegen vielerlei zu faulen und zu stinken beginnt. Zudem hätte ich gedacht, dass die Schneedecke selbst, die ja schließlich aus nahezu geruchsfreiem Wasser besteht, etwaige Geruchsquellen abschließt und insofern für eine Hundenase eher unattraktiv ist. Doch tatsächlich scheint das genaue Gegenteil der Fall zu sein. Man komme mir nun nicht mit der Idee, Lola stupse ihre Nase bloß ins kalte Weiß, weil sie die Abkühlung so sehr schätze. Ich bin ganz nahe rangegangen und konnte eindeutig hören, dass sie schnuppert! – Nun bin sehr gespannt, ob in den nächsten Jahrzehnten irgendein Genie eine plausible Erklärung hierfür hat.
Sonntag, 29. Januar 2012
Sunday, 29. January 2012Gift oder Gas?
Saturday, 28. January 2012Ausmusterung der Reihe Bibliothek Suhrkamp fürs Antiquariat. Die fadengehefteten Pappbände im farbigen Umschlag mit andersfarbigem Strich erschienen seit 1951, brachten es bis 1989 auf tausend Nummern und erscheinen noch heute und sind jetzt bei Nummer 1469 angekommen. Die Umschlaggestaltung lag seit 1959 bei Willy Fleckhaus. (Erst jetzt fällt mir auf, dass der vertikale Strich stets schwarz oder weiß ist, einzig wenn der Umschalg weiß ist, das der Strich farbig sein.) Von den rund hundert Bänden in meiner Sammlung werde ich drei Viertel abgeben – und selbst den kleineren Rest muss ich noch einmal gründlich durchsehen. Ein Buch, in dem ich seit gestern abends immer ein paar Seiten lese, ist Werner Krafts Spiegelung der Jugend, eine Erstausgabe von 1973. Diese Erinnerungen habe ich nach der Anschaffung des Buches vor dreißig Jahren schon einmal angelesen, allerdings wohl nur etwa bis Seite 68, denn da befindet sich die letzte meiner akkuraten Bleistiftunterstreichungen. Ein Passus, den ich nicht unterstrich, erscheint mir heute bemerkenswert. Kraft porträtiert eine Schwester seiner Großmutter, die in Celle wohnte und einmal besucht wurde. Was mag aus der jüdischen Frau geworden sein? „Sie hat 1933 noch gelebt, und ich hoffe, daß sie energisch genug war, dem schrecklicheren Tode als dem schrecklichen durch Gift zuvorzukommen.“ (Werner Kraft: Spiegelung der Jugend. Frankfurt am Main. Suhrkamp Verlag, 1973, S. 33.) Was ist das für eine Welt, in der der Hoffnung nurmehr die Wahl zwischen einem schrecklichen und einem schrecklicheren Geschick bleibt und eine liebe Großtante spurlos aus einem freundlichen Häuschen in Celle ins Nichts wechselt?
Geplante Obsoleszenz
Friday, 27. January 2012Bei Arte+7 ist seit Dienstag eine kritische Dokumentation über die Verschwendungssucht in den hochentwickelten Industrienationen abrufbar, Kaufen für die Müllhalde. Der französische Film von Cosima Dannoritzer (2010) erzählt, wie die „geplante Obsoleszenz“, also die künstlich in der Produktherstellung angelegte verkürzte Haltbarkeit Mitte der 1920er Jahren zuerst von einem weltweiten Kartell namens Phöbus bei den Glühbirnen durchgesetzt wurde, um den Absatz anzukurbeln, damit die Wirtschaft zu stärken und so bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Auch Helmut Höge hat einen kleinen Auftritt, der mysteriöse Macher des von mir einst so geschätzten Magazins Neues Lotes Folum. Er war (unter dem Pseudonym Helke Schwan) Verfasser des legendären Aufsatzes The Glühbirnen Fake, den ich aus Jörg Schröders Mammut-Antholgie kannte und der mir ein Licht aufsteckte. Und auch die älteste Glühbirne der Welt in Livermore kommt natürlich zu ihrem Recht. Ein weiteres Highlight ist die Geschichte von Markos, dessen Tintenstrahldrucker den Geist aufgibt und der sich nicht damit abfinden will, dass niemand das Gerät in Reparatur nehmen will, weil ein neues doch viel günstiger sei als die Wiederherstellung des alten. Er findet nach langen vergeblichen Irrwegen schließlich heraus, dass ein kleiner Chip im Drucker nach Erreichen einer bestimmten Anzahl von Druckvorgängen das Gerät automatisch blockiert, obwohl es sonst noch absolut funktionstüchtig ist. Ein russischer Hacker übermittelt ihm dann einen kleinen Code, mit dem er den Chip überlisten und die Druckfunktion wieder in Gang setzen kann. Die US-amerikanische Maschinenstürmerin Nicols Fox kommt zu Wort, die ihr Buch über die Ludditen noch auf einer mechanischen Schreibmaschine verfasst hat. Und auf der anderen Seite wird der Erfinder der geplanten Obsoleszenz, Bernard London, in Erinnerung gerufen, der 1933 im ersten Kapitel seines Buches The New Prosperity versprach: „Ending the Depression Through Planned Obsolescence“. Allerdings konnte er sich mit seinem Konzept einer staatlich verordneten Verfallsfrist für alle Handelsgüter nicht durchsetzen, obwohl die Produzenten etwa von Nylonstrümpfen, Küchengeräten und vielen anderen Dingen des täglichen Gebrauch sehr bald Ingenieure damit beauftragten, künstliche Verschleißfaktoren in die Produkte einzubauen. Dieser Effekt kommt zum Beispiel in Arthur Millers Theaterstück Death of a Salesman (1949) vor, aber auch in dem Film The Man in the White Suit (1951), in dem Alec Guinness einen Chemiker spielt, der einen schmutzabweisenden und reißfesten Anzugstoff erfunden hat und dafür keinen Ruhm erntet, sondern die Kleiderfabrikanten und selbst die Arbeiter in den Fabriken gegen sich hat. Die einen bangen um ihren Absatz, die anderen um ihren Job. Auch der vergessene Bestseller-Autor Vance Packard wird bemüht, der nach seinem legendären Buch über die Werbewirtschaft (The Hidden Persuaders) bereits 1961 mit The Waste Makers jene große Verschwendung anprangerte, die damals erst in ihren bescheidenen Anfängen steckte. Der Film endet in Ghana, auf der Müllhalde von Agbogbloshie, wo hustende Jungen das Kupfer aus den Comuterkabeln herausschmelzen. Er zeigt die riesigen Containerschiffe, die hier mit dem Elektromüll aus halb Europa anlanden. Der Import von Müll ist verboten, aber die Zollkontrollen werden ausgetrickst, indem die Container vorn mit halbwegs tauglichen Geräten beladen werden, während die 90 Prozent Schrott sich dahinter verbergen. Vorgestellt wird schließlich Mike Anane, der die Inventaraufkleber von den Monitoren, Tastaturen und PC-Gehäusen ablöst und einscannt, um die Herkunftsorte und -firmen namhaft zu machen, die sich ihres Mülls auf diese schändliche Weise entledigen. Aber leider – und hier muss ich den ansonsten sehr lehrreichen Film kritisieren – erfahren wir nicht, welche Erfolgsaussichten die Recherchen von Anane haben. Ich werde gelegentlich versuchen, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen.
Bitte nicht lachen
Thursday, 26. January 2012Gerade lese ich ein paar Absätze in Roland Barthes’ Die Lust am Text. An einer Stelle ergeht er sich, der Vielbelesene, wie er in einem von Stendhal vermittelten Text „ein winziges Detail Proust“ wiederentdeckt und sich daraufhin an eine ähnliche Passage bei Flaubert erinnert. Er spricht von „zirkularer Erinnerung“, insofern das große Werk von Marcel Proust sein zentraler Bezugspunkt ist, wie es die Briefe der Madame de Sévigné für seine Großmutter gewesen seien oder für Don Quijote die Ritterromane. Das klingt mir vertraut, es besteht kein Zweifel, hier spricht ein Hirntier und Bücherfresser vor dem Herrn glaubwürdig von den Assoziationskaskaden, die ihm jede lustvolle Lektüre verursacht. – Aber dann? Lässt Barthes unvermittelt seinen Gedanken in einer Generalisierung gipfeln, die mir völlig unsinnig erscheint: „Und eben das ist der Inter-Text: die Unmöglichkeit, außerhalb des unendlichen Textes zu leben – ob dieser Text nun Proust oder die Tageszeitung oder der Fernsehschirm ist: das Buch macht den Sinn, der Sinn macht das Leben.“ (Roland Barthes: Die Lust am Text. A. d. Frz. v. Traugott König. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974, S. 53 f.) Aber was ist das für eine plumpe Gleichmacherei? Es ist die Ignoranz des Intellektuellen vor den Quantensprüngen der technischen Entwicklung. Sein Unfalltod kommt mir insofern vor wie die gesuchte Pointe zu einem traurigen Witz.
Eichhörnchens Mühsal
Wednesday, 25. January 2012Im neuen Jahr kommt im Antiquariat Revierflaneur durchschnittlich eine Bestellung pro Tag herein. Somit ist das Bestellaufkommen wieder leicht gestiegen, seit ich mein Angebot um Taschenbücher erweitert habe. Gestern zum Beispiel habe ich eine Sammlung von rund 50 Insel-Taschenbüchern online gestellt – und schon heute am frühen Morgen ging eine Bestellung eines Titels aus diesem Konvolut ein. Ich machte ihn gleich nach dem Frühstück versandfertig und brachte die Büchersendung zum Postkasten am Anfang der Oberstraße. Kaum hatte ich den Luftpolsterumschlag durch den Schlitz geschoben, da rutschte mir das Herz in die Hose: Ich hatte vergessen, den Umschlag zu frankieren! Wie ägerlich. Die nächste (und einzige) Leerung würde laut Anzeige auf dem gelben Kasten um 15:45 Uhr stattfinden. Also blieb mir nichts andres übrig, als mich um diese Zeit auf die Lauer zu legen und abzuwarten, bis der Fahrer auf seiner Tour hier vorbeikam, um ihn zu bitten, den Umschlag nachfrankieren zu dürfen. Nun wollte ich unbedingt sichergehen, dass ich nicht zu spät kam, denn heutzutage muss man ja damit rechnen, dass die Leerung vorzeitig stattfindet, weil der vermutlich schlecht bezahlte Leiharbeiter so bald wie möglich wieder daheim sein will. Also war ich bereits um 15:15 Uhr zur Stelle. Eine geschlagene Stunde später, durchgefroren wie ich inzwischen war, wollte ich gerade aufgeben, als der Wagen endlich vorfuhr. Ein offenbar sehr unter Zeitdruck stehender Hüne mit grimmer Miene wartete gar nicht erst ab, bis ich mein Begehren vorgetragen hatte, sondern blaffte mich gleich an: „Ich darf nix rausgeben. Verboten!“ Ich blieb freundlich und erklärte ihm behutsam den Fall. Darauf der ungehaltene Mann: „Aber wie sollen wir denn Ihren Brief finden, auf die Schnelle? Ich hab keine Zeit!“ Längst hatte ich meinen Umschlag erspäht und griff danach: „Da ist er schon.“ Passende Marken hatte ich vorbereitet, eine selbstklebende 55er sowie je eine 10er und 20er zum Anlecken. Nun waren aber meine Finger dermaßen steif von der Kälte, dass ich mich ungeschickt anstellte und prompt die 55er-Marke zerriss. Ich klebte sie leidlich zusammengefügt auf den Umschlag, die beiden anderen Marken kreuz und quer daneben. Nun fürchte ich, dass die maschinelle Portoerkennung bei der Post diese seltsame Frankierung nicht durchgehen lässt und somit mein ganzer Aufwand vergeblich war. Und dies alles für einen Rechnungsbetrag von 13,35 Euro! Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen …
Durst
Tuesday, 24. January 2012Ich werde mich systematisch mit der Frage beschäftigen, was das Leben kostet. Gleich nach dem Atmen, das vorläufig noch kostenlos zu haben ist, drängt das Verlangen nach Flüssigkeit täglich danach, gestillt zu werden. Die billigste Variante wäre zweifellos ,Kraneberger‘, das kühle Nass aus der Wand. Man sagt ja, der Mensch solle täglich zwei Liter trinken. Demnach betrüge mein Jahresbedarf 730 Liter. Ein Kubikmeter Wasser kostet bei den Stadtwerken Essen aktuell 1,88 Euro. Somit müsste ich gerade einmal 1,38 Euro aufwenden, um meinen Flüssigkeitsbedarf für ein ganzes Jahr zu decken! Das hiesige Wasser stammt aus der Ruhr, einem der saubersten Flüsse Europas. Zudem wird es in Aufbereitungsanlagen gereinigt, geflockt und filtriert und abschließend noch auf biologisch wirksame Langsamsandfilter geleitet. Anschließend ist es jedenfalls gesundheitlich absolut verträglich. Ob es dem Verbraucher im Naturzustand mundet, steht freilich auf einem anderen Blatt. Viele Wassertrinker versorgen sich jedenfalls mit Mineralwasser in der Flasche. Auch ich trank bisher ein solches Wasser, das ich mir kastenweise bei einem fußläufig erreichbaren Getränkemarkt besorgte. Den über 20 Kilo schweren Kasten transportierte ich auf dem Fahrgestell unseres Handeinkaufswagens, denn bekanntlich verzichte ich auf ein motorisiertes Kraftfahrzeug. Dieser Einkauf dauert mit Hin- und Rückweg selten länger als zehn Minuten. Der Kasten à zwölf Flaschen der Marke meiner Wahl kostete bisher ohne Pfand 3,33 Euro, das entspricht knapp 0,40 Euro pro Liter. Mein Lieblingswasser kommt ganz aus der Nähe, was mir wichtig war, denn ich habe als umweltbewusster Konsument natürlich auch den Transportaufwand von der Quelle bis zur Mündung in meinen Mund im Blick. Wenn ich meinen empfohlenen Flüssigkeitsbedarf ausschließlich mit diesem Mineralwasser decken würde, müsste ich dafür somit 290 Euro pro Jahr aufbringen, das entspricht dem 210-fachen Preis des Kranwassers! Ich war schon halb auf dem Weg mir zu überlegen, ob ich mir nicht durch billige Geschmackszusätze das Leitungswasser appetitlicher machen könnte, da brachte mich eine weitere Verteuerung des Mineralwassers aus der Fassung. Der nahe gelegene Getränkemarkt hatte plötzlich geschlossen, wurde umgebaut und unter neuer Leitung neu eröffnet. Nun kostet der gleich Kasten statt 3,33 Euro stolze 3,69 Euro, das entspricht einer Preissteigerung um über zehn Prozent. Jetzt reicht’s! Ich muss Mittel und Wege finden, um aus dem konkurrenzlos billigen Leitungswasser mit geringstmöglichem Aufwand an Zeit und Geld ein Getränk herzustellen, das gesund ist und mir schmeckt.
Seine früheste Erinnerung
Monday, 23. January 2012Wenn er sich nicht täuscht, dann hatte er vor zwanzig oder dreißig Jahren noch ein paar deutliche Erinnerungen aus seiner allerfrühesten Kindheit bewahrt, also aus der Zeit, da er noch nicht einmal laufen und kaum sprechen konnte. Aber diese Bilder sind inzwischen wohl auf Nimmerwiedersehen versunken. Immerhin ein klares Bild ist ihm noch aus der Kinderwagenzeit verblieben, vielleicht nur deshalb, weil es ein Foto gibt, das eine sehr ähnliche Situation abbildet. Diese Schwarzweiß-Fotografie klebt in einem orangefarbenen, quadratischen Album, das seine Eltern liebevoll für ihren ersten und einzigen Sohn anlegten – schon bevor er überhaupt zur Welt gekommen war. Wann immer er in dem Album blätterte und jenes Foto betrachtete, rief es in ihm die Erinnerung wach, die übrigens eine durchaus unangenehme war und noch immer ist. Er sitzt angegurtet in diesem ,Sportwagen‘ im Stil der 1950er Jahre. Seine Mutter (rechts im Bild) hat gerade eine andere junge Mutter getroffen, die sie offenbar kennt. Die beiden Frauen plaudern miteinander, das Gespräch nimmt kein Ende. Er quengelt, will aus dem Wagen heraus: ,Wann gehen wir denn endlich heim?‘ Sein Kopf tut ihm weh, zudem ist ihm kalt, denn es ist wohl noch Winter. Mit dem anderen Kind kann oder will er nichts anfangen. Endlich erscheint sein Vater und befreit ihn aus seiner misslichen Lage. Im Hintergrund links ist der städtische Saalbau zu sehen, rechts am Horizont der Schornstein einer Brauerei. Das Jahr 1958 hat gerade begonnen.
Sonntag, 22. Januar 2012
Sunday, 22. January 2012In letzter Zeit kämpfe ich gegen die melancholische Idee, dass sich die private wie die öffentliche Aktualität zunehmend in Wiederholungen erschöpft. Die tragikomische Demontage des Bundespräsidenten Christian Wulff kommt mir vor wie ein fades Remake der zu Guttenberg’schen Plagiatsaffäre Anfang vorigen Jahres. Entsprechend angestaubt wirken die medialen Bemühungen, hieraus erneut einen Auflagen- und Einschaltquoten-Hype zu pressen. Dass es heuer nicht die traditionell der Aufklärung verpflichtete links-liberale Presse ist, die den Stein ins Rollen brachte, sondern ausgerechnet die BILD-Zeitung, passt ebenso zu diesem Eindruck wie manches Detail, das ich eher widerstrebend zur Kenntnis nehmen muss, keinesfalls mehr mit der lustvollen Schadenfreude vom Vorjahr, die ich mir beim Sturz des Verteidigungsministers nicht verkneifen konnte und wollte. So kam jüngst das neue Verb „wulffen“ in Umlauf, im Sinne von: „jmd. aus persönlichen Gründen mit (rechtlichen) Konsequenzen drohen“. Ich wette aber dagegen, dass es eine Chance hat, zum „Wort des Jahres“ gewählt zu werden. 2011 kam das Verb „guttenbergen“ immerhin auf Platz 7 der Vorschlagsliste, als Synonym für „abschreiben, abkupfern, plagiieren“, aber in den aktiven Wortschatz der Deutschen ist auch dieses Wort seither keineswegs aufgenommen worden, im Unterschied zu dem schließlich von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden prämierten „Stresstest“. Ach, dieser Wulff! Als er sich um das höchste Amt bewarb, sah ich seine Vita durch und stolperte über den Namen eines seiner väterlichen Förderer: Ulrich Parzany. Den habe ich als Vierzehnjähriger ein einziges Mal im Essener Weigle-Haus predigen gehört und gleich eine tiefe Abneigung entwickelt. Charisma wird dem Mann zugeschrieben. Wenn ich Parzany etwas verdanke, dann dass ich seit meiner Begegnung mit ihm gegen Charismatiker aller Art immun bin. Wenn das so weitergeht, wird 2012 ein Jahr ohne Charakter.
Nekro-Exhibitionismus
Saturday, 21. January 2012Die neuen Mittel der öffentlichen Selbstdarstellung via Weblog, YouTube, Twitter, XING, MySpace, Facebook usw. haben nicht zuletzt auch neue Möglichkeiten der unfreiwilligen Selbstbeschädigung herbeigeführt, Versuchungen zur unbedachten Autodestruktion bereitgestellt, Lockmittel ausgestreut zur leichtfertigen Präsentation nicht nur geheimer Gedanken und intimer Körperzonen, sondern auch zur Preisgabe privatester Erlebnisse, wie Geburt, Krankheit, Sterben und Tod. Eine deprimierende ärztliche Diagnose wie Krebs, Depression, Parkinson oder Aids überfordert oft nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch deren Angehörige und Freunde. Die Angst vor nötigen klinischen Untersuchungen und Eingriffen, vor dauerhaften körperlichen Beeinträchtigungen und Schmerzen belastet den Kranken umso mehr, als er erfahren muss, dass die Anteilnehme in seinem sozialen Umfeld bald ihre natürliche Grenze findet. Für die Gesunden geht das Leben mit seinem Ernst und seinem Spaß schließlich weiter bie bisher. Schon aus einem verständlichen Bedürfnis nach emotionaler Immunisierung gegen das dramatische Geschehen der schweren, möglicherweise todbringenden Krankheit meiden sie allzu intensive Begegnungen. Vom Kranken, gar Todgeweihten geht ein Sog in den Abgrund aus. Er „zieht runter“, wie man ganz unverblümt bekennt. In dieser Einsamkeit des Leidenden bieten sich die Social-Media-Plattformen im Internet an für ein offenherziges Bekenntnis zum eigenen Elend, für die Suche nach Gesprächspartnern, ob Leidensgefährten oder bloß Anteilnehmenden, ob im Schutze der Anonymität oder unter vollem Namen. Im Extremfall führt dies zu einer hochdramatischen Vorführung des eigenen Sterbens in Echtzeit und damit zu einem Exhibitionismus – bzw., je nach Perspektive, Voyeurismus – des Todes, wie er in dieser Direktheit noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre. An dieser Stelle will ich auf das neue Phänomen bloß aufmerksam machen, ohne noch darüber reflektiert zu haben, was aus ihm für den Umgang mit Krankheit und Tod in unserer Gesellschaft folgt. Ich halte dies insbesondere deshalb für ein relevantes Thema in meinem eigenen Blog, weil ich unlängst ebenfalls von einer bösen Überraschung heimgesucht wurde und weil ich zudem sehe, dass sich auch sehr besonnene und gebildete Autoren mit ihrem Leid in die Öffentlichkeit des Web begeben.
Sonderbehandlung
Friday, 20. January 2012Am 8. Januar 1942 sandte der Chef der Sicherheitspolizei und des SD Reinhard Heydrich aus Prag eine Einladung an seinen Parteigenossen, den Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt Martin Luther, und dreizehn weitere Herren eine Einladung zu einem Treffen in der Reichshauptstadt. Dort solle am 20. Januar, heute vor 70 Jahren, in einer Villa am Großen Wannsee eine „Besprechung mit anschließendem Frühstück“ stattfinden. Der Teilnehmer mit dem Namen des Reformators geriet später auf Abwege, als er sich an einem Putschversuch gegen seinen Vorgesetzten, den Reichsminister des Auswärtigen Joachim Rippentropp beteiligte und nach seiner Enttarnung als privilegierter Häftling im KZ Sachsenhausen landete. Nur diesem Umstand ist zu danken, dass das Besprechungsprotokoll der Wannsee-Konferenz, auf der die Ermordung aller 11.000.000 Juden in Europa beschlossen wurde, auf uns gekommen ist, da das Aktenmaterial aus Luthers Büro zur Vorbereitung des Hochverratsprozesses gegen ihn in Berlin-Lichterfelde ausgelagert worden war. Allerdings kommen selbst in diesem hochgeheimen Dokument eindeutige Begriffe wie „Tötung“, „Vernichtung“ oder „Auslöschung“ nicht vor. Die entscheidende Passage lautet so: „Unter entsprechender Leitung sollen nun im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen, unter Trennung der Geschlechter, werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist. (Siehe die Erfahrung der Geschichte.)“ (Besprechungsprotokoll der sog. Wannsee-Konferenz, S. 7/8; Hervorhebung von mir.) Autor dieses in seinen Folgen vielleicht schrecklichsten Textes der bisherigen Geschichte unserer Spezies war als Protokollführer übrigens der Bürokrat Adolf Eichmann. Wir kennen den Tonfall des seelenlosen Verwaltungsfachmanns und Logistikers aus seinen Verteidigungsreden, als ihm 18 Jahre später in Jerusalem der Prozess gemacht wurde. Die deutsche Sprache hat spätestens mit Sätzen wie diesen ihre Unschuld verloren. Einen weiteren muss ich noch zitieren: „Der Wunsch des Reichsmarschalls [Hermann Göring], ihm einen Entwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Belange im Hinblick auf die Endlösung der europäischen Judenfrage zu übersenden, erfordert die vorherige gemeinsame Behandlung aller an diesen Fragen unmittelbar beteiligten Zentralinstanzen im Hinblick auf die Parallelisierung der Linienführung.“ (Besprechungsprotokoll der sog. Wannsee-Konferenz, S. 2; Hervorhebung von mir.) Der tarnende Begriff des Behandelns bzw. der Behandlung wird also offenbar unterschiedslos auf den Todfeind und die höchsten Instanzen des Reiches angewandt, wenn es darum geht, den eigentlichen, für die Behandelten unangenehmen Charakter dieser „Behandlung“ zu verbrämen. Im ersten Falle besteht die „Behandlung“ darin, die Juden unter möglichst gefahrvollen und strapaziösen Bedingungen im Straßenbau einzusetzen, damit ein großer Teil von ihnen dabei vor Entkräftung oder durch Krankheiten stirbt, um dann die übriggebliebenen Menschen mit Vernichtungsmitteln (Zyklon B) zu ermorden; während „Behandlung“ im zweiten Fall bedeutet, die Vorgesetzten der zuständigen Parteidienststellen und Reichsbehörden und ihr Personal seelisch-moralisch auf diesen staatlich angeordneten Massenmord einzustimmen. – Was Karl Kraus schon lange zuvor in aller Schärfe erkannt hatte, wurde hier traurige Realität und droht für alle Zukunft, sich zu wiederholen: Die schrecklichsten Taten tarnen sich hinter floskelhaften Euphemismen; wenn jene erst leicht über die Lippen kommen, dann gehen diese umso leichter von der Hand.
Er beschließt
Thursday, 19. January 2012Als er auf seinem zuletzt immer beschwerlicher und unübersichtlicher werdenden Weg einen Punkt erreicht hatte, da ihm die Kräfte schwanden und er die Orientierung verlor, beschloss er, für eine Weile zu rasten und seine lange Reise bis hierher noch einmal von Anbeginn zu überdenken. Vielleicht würde er bei dieser Rückschau eine Stelle finden, an der er in die Irre gegangen war. Vielleicht würde er aber am Ende auch zu dem Ergebnis kommen, dass alles bis ganz zuletzt seine Richtigkeit hatte; dass nämlich auch die Verirrungen und sogar das schließliche Scheitern nichts anderes bedeuteten, als die Erfüllung seines ihm beschiedenen Schicksals. So machte er sich also ein zweites Mal auf den Weg und befragte seine Erinnerung nach dem Sinn seines scheinbar schlichten und in Wahrheit doch so rätselvollen Daseins.
Blackout against SOPA!
Wednesday, 18. January 2012Der Revierflaneur schließt sich heute den weltweiten Protesten gegen den US-amerikanischen Gesetzentwurf SOPA an. Urheberrechte müssen auch im Internet geschützt bleiben, keine Frage. Aber die neuesten Bestrebungen in den USA gehen hierüber hinaus und lassen befürchten, dass die freieste Kommunikationsplattform der Welt künftig zunehmend von Zesurmaßnahmen beschnitten werden kann. Dies darf nicht wahr werden!
Brevissimo!
Tuesday, 17. January 2012Was hat nun die Entscheidung, von fünf Absätzen auf einen runterzuschalten, für mein Blog gebracht, aus meinem Blogschreiben gemacht? Wenn ein Thema, ein Gegenstand, ein Vorwand eine gewisse Ausführlichkeit erheischt, dann taucht das Ende vom Lied in den Untergrund, liegt irgendwo weit unterhalb der südlichen Monitorbegrenzung, sozusagen unter der Tischplatte. Scroll-scroll! Na, und? Allen Ernstes meldete sich jüngst eine Leserin und klagte über die Strapaze, für ihre Augen keine Leerzeilen mehr zum Verweilen angeboten zu bekommen. Ich muss schon sehr bitten! Durch das Halten der Strg-Taste und mehrfache Betätigung des +-Zeichens im Nummernblock rechts kann sie doch den Text auf dem Schirm in so augenfreundlich bemessene und leicht verdauliche Einheiten portionieren, dass niemals die Gefahr besteht, in der Zeile zu verrutschen oder sonstwie ins Stolpern zu kommen. Überhaupt sind solche Leserwünsche eine Zumutung! Wer käme auf den Gedanken, von einem Maler zu fordern, er möge kleinere Bilder malen, oder doch wenigstens nicht so detailreiche, weil man diese Riesenschinken ja gar nicht auf einen Blick erfassen könne? Wobei ich andererseits durchaus um Konzentration bemüht bin. Ständig streiche und streiche ich meine Entwürfe zusammen. Mit meinen Hobelspänen würde mancher Schreiber dürre Anekdoten zu Romanen ausstopfen. Und das war’s auch schon wieder für heute.
Mohr und General
Monday, 16. January 2012Dieses Buch ist sogar im Wilpert-Gühring gelistet, dem Handbuch des Antiquars, das die Erstausgaben deutscher Dichtung verzeichnet und somit als Prüfstein dafür gilt, ob ein Buch wirklich als „EA“ angeboten werden kann und damit ein deutlich höherer Preis verlangt werden darf, als für alle späteren Auflagen des gleichen Titels. Allerdings haftet meinem Exemplar ein kleiner Fehler an, insofern es sich nur um die Taschenbuch-Ausgabe in zwei Bänden handelt, die zwar gleichzeitig mit der gebundenen Ausgabe herauskam, aber vermutlich für EA-Sammler nicht in Betracht kommt. Die Rede ist von der wundervollen Montage Gespräche mit Marx und Engels, die Hans Magnus Enzensberger 1973 für den Insel-Verlag zusammengestellt hat. Auf rund 700 Seiten versammelt das Werk Berichte von Augenzeugen, die den Theoretikern des wissenschaftlichen Sozialismus und Mitbegründern der „Internationale“ persönlich begegnet sind – und zwar in sehr unterschiedlicher Beziehung: als Freunde oder Feinde, Familienmitglieder oder Polizeispitzel, Genossen oder Abtrünnige. Dies Buch liest sich sehr lebendig und vermittelt gerade in seiner Widersprüchlichkeit einen ungleich glaubwürdigeren Eindruck von den Personen als die bekannten hagiographisch angelegten Lebensbeschreibungen. Im Anhang lässt Enzensberger dann noch Marx und Engels selbst zu Worte kommen, nämlich in einem „Injurien- und Elogenregister“, in dem er ein alphabetisches Namenverzeichnis der wichtigsten Gewährsleute seiner Montage mit den Äußerungen versieht, die Marx und Engels über diese von sich gaben. (Ich erinnere mich noch gut, dass der Schwall von Beschimpfungen, den die beiden über Bakunin ergießen, nicht wenig dazu beigetragen hat, mich fortan für den Anarchismus zu erwärmen.) – Im Wilpert-Gühring (2. Aufl.) findet man das Buch übrigens unterm Stichwort Enzensberger als Nr. 24.
Deutschland, hilf!
Sunday, 15. January 2012Man darf niemals aufgeben. „Ich habe soeben erstmals den Namen Ihrer Hilfsorganisation gelesen (auf einem Werbeplakat an einer Straßenbahnhaltestelle in Essen). Sehr stört mich daran, dass in Ihrem Namen ein Rechtschreibfehler unterlaufen ist. Das Wort ,helfen‘ ist ein Verb und muss darum kleingeschrieben werden, außer am Anfang des Satzes. Es heißt also richtig: ,Aktion Deutschland hilft‘. Wie erklären Sie diesen Fehler, durch den vor allem Kindern und Deutsch lernenden Ausländern ein schlechtes Vorbild gegeben wird, bei einer solch renommierten und wirkungsvollen Organisation? Ich bin gespannt auf Ihre Antwort und würde mich freuen, wenn Sie meine Anregung aufgreifen und den falsch geschriebenen Namen bald korrigieren würden.“ (Anfrage per Online-Formular abgeschickt am heutigen Tage um 19:00 Uhr.)
Rote Giftquallen
Saturday, 14. January 2012(Bild wegen ungeklärter Rechte entfernt)
Zum Babysitting bei der Tochter. Wir schauen nach langer, langer Zeit mal wieder „Glotze pur“, also nicht in konservierter Form ausgewählte Edelkulturstreifen bei ARTE+7, sondern einmal die Programme rauf und runter in Echtzeit. Unkulturschock! Völlige Desorientierung. Taste 1 ARD: Wir stolpern in eine Verfolgungsjagd mit wilden Schusswechseln, deren Ergebnis dank schneller Schnittwechsel jeweils ungewiss bleibt. Sind die Gliedmaßen der bösen Häscher nun zerfetzt worden, oder waren das bloß Streifschüsse? Der Held kommt mir von irgendwo bekannt vor und ich frage meine Gefährtin: „Ist das nicht James Bond?“ Nachträglich lese ich in der Programmankündigung der SZ: Es war James Bond, aber eine spätere Folge, mit Pierce Brosnan, um genau zu sein von 1999, also aus einer Zeit, als ich aus dem Alter längst raus war, dem Betrachten solcher Filme wenigstens noch einen ironischen Genuss abgewinnen zu können. Zielgruppe: kleine und große Jungs. – Taste 2 ZDF: Auch hier ein Film aus dem Genre Verbechensverfolgung, aber diesmal deutsche Hausmannskost. Da menschelt es gewaltig. Die altersweise Schwiegermutter, Typ Inge Meysel, nur intelligenter, übt sich am Küchentisch als Seelentrösterin für ein ungewollt schwanger gewordenes Nervenbündel, das dann das Kind verloren hat und nun auch noch den Beinahevater einzubüßen droht. Tränenreiche Bekenntnisse. Zielgruppe junge Mädchen und Omas. – Taste 3 RTL: Hier erinnere ich mich nur an eine unsägliche Alberei auf einer Bühne, aber der Eindruck war zu kurz, denn meine Gefährtin forderte unmissverständlich: „Mach das weg! Das ist ja schrecklich!“ Jetzt lese ich, dass es sich um „eine Auswahl der besten, aber auch schrägsten Auftritte“ aus der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ handelte. Ich wusste immer nicht, was das eigentlich ist. Jetzt ahne ich es immerhin. Zielgruppe: Peinlichkeitsliebhaber. – Taste 4 SAT 1: Ein Besuch im Krankenhaus. Das dickliche Opfer liegt mit Beatmungsschläuchen hilflos auf der Intensivstation, der böse Doktor am Fußende verweigert ihm die Behandlung mit dem rettenden Antidot gegen einen absolut tödlichen Virus, der in wenigen Stunden den keuchenden Dicken dahinraffen wird. Die Zeit läuft! „Mission Impossible II“. Zielgruppe: Masochisten und SciFi-Fans. – Taste 5 Pro Sieben: Hier haben wir mal Glück und stolpern nicht mitten hinein in den Schlamassel, sondern bekommen ihn von Anfang an mit. Es heißt „Shopping-Center King – Hier gilt mein Gesetz“ und läuft unter Komödie, soll uns also zum Lachen bringen. Nachdem ich mir zehn Minuten lang vorgestellt habe, welch Geistes Kind die Menschen sein müssen, die über diesen Klamauk von der allerbilligsten Sorte lachen können, war ich sehr traurig und hätte am liebsten das Experiment ganz abgebrochen. Zielgruppe: Naive, Debile und Betrunkene. – Taste 6 Vox: Nun sehen wir kämpfende Männer aus offenbar ferner Vergangenheit. Sie schleichen mit Pfeil und Bogen durch den dunklen Forst. Einer legt auf eine Hirschkuh an und ich beginne zu fürchten, dass für diesen Film ein unschuldiges Tier dran glauben musste, aber nach einem blitzschnellen Durcheinander bleibt gottlob nur einer der Recken auf der Strecke. Dann geht ’s hinaus aufs offene Feld, wo sich zwei ungleich bewaffnete Heere gegenüberstehen. Der Aufwand an Statisten, Pferden und Kostümen nötigt uns Bewunderung ab, die traurige Schlichtheit der Dialoge macht diesen Eindruck leider bald wieder zunichte. Wir sahen einen Ausschnitt aus „Braveheart“. Zielgruppe: historisch interessierte Melancholiker. – Taste 7 Arte: Womit wir also doch wieder bei „unserem“ Sender wären. Hier tauchen wir in die Tiefsee und erfahren in hektischer Schnittfolge tausenderlei über Eisbären, Wale, Eiszeiten, Warmzeiten, Bohrkerne, Expeditionen, Fischfang, Thunfisch, rote Giftquallen, globale Erwärmung usw. Vorgetragen wird dies von Bestseller-Autor Frank Schätzing (Der Schwarm), der mittels beeindruckender Trickanimation raketenartig durch die Lüfte fliegt. Fazit der dreiteiligen Lehrsendung „Universum der Ozeane – Geheimnisse der Tiefsee“: Der Mensch versündigt sich auf vielfache Weise an der Natur, aber auf ebenso vielfache Weise ersinnt er stets neue Möglichkeiten der Schadensbegrenzung. Und überhaupt muss man angesichts von Jahrmillionen Evolution in größeren Zeiträumen denken. Zielgruppe: Der beunruhigte Intellektuelle, der als Betthupferl ein buntes Trostpflästerchen benötigt. Unser Resümee dieses aufschlussreichen Fernsehabends: Uns entgeht hier nichts! Und insofern ist es eine Unverschämtheit, wenn wir ab 2013 gezwungen werden, die volle GEZ-Gebühr zu entrichten, obwohl wir nach wie vor auf das TV-Programm dankend verzichten wollen und uns auch fürderhin kein Bildfunkgerät zulegen werden.
Freitag der Dreizehnte
Friday, 13. January 2012Ob Glücks- oder Unglückstag – dieser Freitag hatte es in sich. Zum ersten Mal erreichte mein Antiquariat eine Bestellung aus dem ferneren fremdsprachigen Ausland. (Bislang kamen bloß Bestellungen aus Österreich und der Schweiz.) Ein Kunde aus New York orderte Martin Kippenbergers Frauen. Und welch ein Zufall, dass mein Ältester gerade noch in Essen weilt und mir erstens helfen konnte, per E-Mail die näheren Einzelheiten dieser Transaktion mit dem Kunden abzusprechen, because my English is not so good. Und zweitens nun das kleine Bändchen aus dem Merve-Verlag morgen auf seinen Flug nach New York mitnehmen kann. Der Kunde hat einen auf Künstlerbücher spezialisierten Laden in Greenwich Village und spart auf diese Weise 50 US-$ Transportkosten. Ich hoffe sehr, dass er meine erschöpfend ehrliche Beschreibung des Exemplares richtig verstanden hat und nicht enttäuscht ist. Es handelt sich um einen Fehldruck des Bandes 93 aus der Reihe Internationaler Merve Diskurs, bei dem eine Bogenseite nicht bedruckt wurde, weshalb acht Seiten leer sind. Auf zwei dieser Seiten habe ich seinerzeit Anfang der 1980er Jahre persönlich zwei mir „passend“ scheinende Schwarzweißfotos von Frauen eingeklebt. Zudem stattete ich das Büchlein mit einem zusätzlichen Umschlag aus, indem ich es mit einer Roth-Händle-Stangenverpackungsfolie beklebte [siehe Titelbild]. Leider ist es dadurch für jemanden, der es nicht kennt, kaum mehr zweifelsfrei zu identifizieren, da es drinnen keine Titelseite, kein Impressum usw. enthält. Das kann man ja übrigens auch in der Kippenberger-Biografie seiner Schwester Susanne nachlesen: „Zwischen all den komplizierten theorielastigen (post-)stukturalistischen Texten kam nun Martin mit einem Band, der nur aus Bildern bestand, in dem allein das drin war, was draußen draufstand, nicht mehr und nicht weniger: ,Frauen‘. Fremde Frauen, Freundinnen, Kolleginnen, unsere Mutter auch, lachend in seinem Arm. Die einzigen Worte haben auf dem Umschlag Platz: vorne Autor, Titel, Verlag, hinten das Impressum.“ (Susanne Kippenberger: Kippenberger. Der Künstler und seine Familie. Berlin: Berlin Verlag, 2007, S. 188.) Ich bin sehr gespannt, ob Mr B. D. bei der Übergabe keine Schwierigkeiten macht. Wie auch immer die Geschichte ausgeht, werde ich so auch nicht klüger, was die Frage betrifft, ob das heutige Datum nun ein glückliches oder unglückliches Omen bedeutet.
Wie wirkt yakoana?
Thursday, 12. January 2012Besichtigung der atemberaubenden Ausstellung über die Yanomami im Museum Folkwang. Der Beuys-Schüler Lothar Baumgarten hat diesen südamerikanischen Indianerstamm 1978/79 besucht und anderthalb Jahre mit den „Señores Naturales“ gelebt, hat an ihren Ritualen und an ihrem Alltag teilgenommen, ist mit ihnen auf die Jagd gegangen, hat sie fotografiert, ihre Gesänge und Gespräche aufgenommen und im Tausch ihre Pfeilspitzen, Schnupfrohre, Körbe und Hängematten erworben. Er hat sie auch animiert, mit Wasserfarbe und Pinsel auf Papier zu malen, eine Anregung, die sie offensichtlich mit großer Begeisterung und Ausdauer angenommen haben, wobei ihre Bilder nahezu ausnahmslos ungegenständlich geblieben sind. Unser Freund Jürgen Lechtreck, der die Ausstellung als Projektleiter kuratiert hat, führt uns durch die neun mit großer Liebe und Sorgfalt eingerichteten Räume im Untergeschoss des Museums und gewährt dabei interessante Einblicke in die Zusammenarbeit mit dem Künstler, erläutert die technischen Herausforderungen der Präsentation und vermittelt ein Gefühl für die nötige Rücksichtnahme auf den empfindlichen Zauber dieser uralten Kultur an der Grenze zum Verschwinden. Ein Gefühl der Trauer stellt sich bei mir ein, auch der Scheu, wie beim unbefugten Zutritt zu einem fremden Heiligtum. Wenn ich die in ihren Riten begeisterten Gesichter dieser so ganz ungezwungen wirkenden Menschen auf den Fotos betrachte, dann beneide ich sie einerseits, wie ich vielleicht Kinder beneide, die den „Ernst des Lebens“ noch nicht erfahren haben und sich ganz hemmungslos ihrem Spiel hingeben können. Andererseits schäme ich mich, mein Selbstverständnis zivilisierter Überlegenheit dabei nicht ablegen zu können, den mitleidigen Blick auf die Dürftigkeit und Grobheit der Verhältnisse. – Wenn ich irgend die Zeit und Kraft dazu finde, werde ich noch einmal allein wiederkommen, um diesen Gefühlen auf den Grund gehen zu können.
[Die Ausstellung im Museum Folkwang „Lothar Baumgarten: Abend der Zeit – Señores Naturales Yanomami“ ist noch bis zum 27. Mai 2012 geöffnet.]
Spiraltraum
Wednesday, 11. January 2012Mein Ältester erzählt mir beiläufig von einem Dokumentarfilm über einen nie zu Ende gedrehten Spielfilm des französischen Regisseurs Henri-George Clouzot. Ich hätte ja immer nur von Lohn der Angst geschwärmt. Gern hätte ich widersprochen, denn ich erinnerte mich gut, dass es noch einen zweiten Film von Clouzot gab, den ich damals annehmbar fand. Aber wieder einmal macht mir, wie in den letzten Jahren immer öfter, mein schwächer werdendes Langzeitgedächtnis einen Strich durch die Rechnung. Ich komme nicht auf den Titel dieses Films. Aber eigentlich geht es ja auch nicht um diesen vergessenen Film, sondern um den Fragment gebliebenen Film, dessen Titel mein Sohn wohl auch genannt hat, aber kurz darauf habe ich auch diesen Titel vergessen. Wie kamen wir überhaupt auf Clouzot? Ach ja, das fällt mir wieder ein. Ich hatte die Geschichte von Romy Schneider und Harry Meyen erzählt, von der Nephrektomie rechtsseitig bei Romy und dem Suicid am Seidenschal nach langjährigem Optalidon-Abusus bei Harry, was mir gleichzeitig als unsägliches Kauderwelsch vorkam, Gefasele eines unter Beziehungswahn leidenden Irrgängers. Es entstand eine peinliche Pause, denn meine Geschichte führte ins Nichts. Daraus rette mich mein Sohn, indem er von Clouzots unvollendetem Meisterwerk sprach, worin Romy Schneider die weibliche Hauptrolle spielte. Das war die Brücke zu L’Enfer. Denn so hieß der Film, das habe ich jetzt nachgeschlagen. Falsch verstanden hatte ich, dass der Regisseur über den Dreharbeiten einem Herzinfarkt erlegen sei. So war es nicht. Allerdings mussten die Arbeiten wegen Clouzots Infarkt abgebrochen werden, doch überlebte der Meister und drehte anschließend noch zwei weitere, weniger bedeutende Filme. Mein Sohn wusste wohl davon, weil vor drei Jahren ein Dokumentarfilm L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot herauskam, der begeisterten Zuspruch fand. Einen kleinen Ausschnitt habe ich eben gesehen. Er zeigt Romys Gesicht, rauchend, verführerisch lächelnd, zeigt sie Wasser aus einer unerschöpflichen Flasche in ein Glas füllend – und schließlich mit einer Spirale spielend, die unmittelbar eine starke Erinnerung in mir wachrief. Genau eine solche Spirale hat mein bester Freund vor wohl 45 Jahren aus den Ferien mitgebracht. Er konnte sie Treppenstufen „hinunterlaufen“ lassen, ein wunderbarer Effekt, ein beneidenswertes Objekt! Im Film von 1964 kriecht die gleiche Spirale über Romy Schneiders in verführerische Dessous gehüllten, in blaues Licht getauchten Körper. (Und jetzt weiß ich auch wieder, wie der zweite Film von Clouzot hieß, den ich mochte. Das waren Die Teuflischen, nach dem Roman von Boileau-Narcejac, den ich ebenfalls gelesen habe.) – So vergeblich, so albern, so kränkend diese kleinen Scharmützel im Kampf gegen das Vergessen sein mögen, es käme einer Generalkapitulation gleich, wenn ich mich ihnen nicht mehr stellen wollte.
Straßenbilder
Tuesday, 10. January 2012Schon seit einem guten Jahr trage ich mich mit dem Plan, eine Reihe von langen Straßen meiner Vaterstadt von einem Ende bis zum andern abzuschreiten und dabei zu fotografieren, mit dem Ziel, ein insofern lückenloses Bild der jeweiligen Straße entstehen zu lassen, als im Mittelpunkt jeder Fotografie der Standpunkt der auf sie folgenden zu sehen ist. Ich war auf diesen Gedanken nach unserem letzten Umzug gekommen, denn nun wohnen wir am Ende bzw. Anfang einer der längsten Straßen Essens, der Rellinghauser Straße; und gleichzeitig, wie schon bei unserem vorletzten Wohnort, am Rande einer weiteren sehr langen Straße, der Frankenstraße. Ein günstiger Zeitpunkt für die Realisation dieses Projekts wäre sicher der frühe Morgen rund um die Sommersonnenwende am 21. Juni, denn dann muss man auf Passanten kaum Rücksicht nehmen, deren Missfallen es vielleicht erregen könnte, in der Öffentlichkeit fotografiert zu werden. Ein weiteres Problem stellt sich mit den Autos, deren Nummerschilder ins Bild kommen könnten, was ebenfalls auf einen Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte hinausliefe. Notfalls müssten die Autonummern per Bildbearbeitung unkenntlich gemacht werden. Ich denke noch darüber nach, ob es vielleicht reizvoll wäre, jede dieser langen Straßen in beide Richtungen abzuschreiten, denn so ergäbe sich ja ein jeweils völlig anderer Eindruck. Die einzelnen Bilder würde ich hier im Blog veröffentlichen und meine Erinnerungen zu den verschiedenen Standorten zu „Bildunterschriften“ verarbeiten. Möglicherweise könnte ich die Aufnahme der Straßenbilder auch alle zehn Jahre wiederholen, um die Veränderungen zu registrieren.
[Das Titelbild zeigt das Ende der Rellinghauser Straße mit der Einmündung in die Frankenstraße am heutigen Tag um 12:00 Uhr.]
Heinrich Funke: Das Testament (XXVII)
Monday, 09. January 2012„Der Mensch der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein“? Eine Behauptung, und zwar eine gefahrlose, weil sie gleich zwei unscharfe Begriffe im Munde führt: ,Zukunft‘ und ,Mystiker‘. Mutig wäre eine etwas präzisere Aussage, wie etwa: ,Der Mensch des Jahres 2025 wird so und so beschaffen sein, oder er wird nicht mehr sein.‘ Dem könnte man widersprechen und schmunzelnd die Drohung anschließen: ,Na, dann wollen wir uns mal in dreizehn Jahren wiedersprechen!‘ Aber die Propheten unserer aufgeklärten Endzeit tun gut daran, sich nicht allzu präzis festzulegen, wie man neulich noch am traurigen Beispiel von Harold Camping gesehen hat. Übrigens fände eine noch allgemeinere Aussage durchaus meine Zustimmung: ,Auch die Menschheit hat einmal ein Ende.‘ Dies scheint mir evident, und zwar nicht etwa ontologisch, sondern aus ganz banalen astronomischen Gründen. Spannend wird die Frage nach dem genauen Zeitpunkt dieses Verendens von Homo sapiens auf Terra – aber leider für die meisten meiner Zeitgenossen nach meiner Beobachtung nur insofern, als dieser Zeitpunkt nicht in ihre Lebenszeit fallen möge. Ansonsten gilt das alte Motto der dickfelligen Egoisten: ,Nach mir die Sintflut!‘ Werfen wir einen Blick auf das Kompetenzprofil des Zukunftsmenschen, dem allein eine Einstellungs-Chance in die Welt von morgen eingeräumt wird. Er soll nicht etwa umfassend gebildet sein, belastbar und ausdauernd in der Verfolgung seiner Ziele. Auch von sozialen Qualitäten ist nicht die Rede, wie Kommunikationsbereitschaft, Empathie oder Teamfähigkeit. Vielmehr soll er ein ‚Mystiker‘ sein, nach gängigem Verständnis also jemand, dessen Sinnen und Trachten auf die Erfahrung einer absoluten Wirklichkeit gerichtet ist, auf Transzendenz, Jenseitigkeit, Gott und dergleichen Luxusgegenstände, die jedenfalls im allerobersten Stockwerk der Maslowschen Bedürfnispyramide angesiedelt sind. Hier tut unserer Zukunftsdeuterei vielleicht ganz gut, einen Blick auf die Vergangenheit zu werfen, der uns belehrt, dass die mystischen Gipfelstürme stets erst dann möglich wurden, wenn die Grundlagen hierfür in den unteren Etagen geschaffen waren; und dass selbst dann nur wenige privilegierte Außenseiter dafür geschaffen waren, im Verzicht auf weltliche Freuden einen höheren Genuss zu suchen und zu finden. Mit anderen Worten: Mystische Asketen kommen den Herausforderungen der Zukunft vielleicht insofern entgegen, als ihre Lebensweise eine günstige Umweltbilanz ausweist. Nichts spricht aber dafür, dass ihr Vorbild Schule machen und die übrigen 99 Prozent Hedonisten davon abbringen könnte, die Lebenswelt durch Verbrauch zu vernichten. Die Rettung des Menschen auf dem Weg über die Mystik ist gerade so aussichtsreich wie die Himmelsflucht über eine Leiter, die an einer Wolke angelehnt wird.
Sonntag, 8. Januar 2012
Sunday, 08. January 2012Vom leidenschaftlichen Cineasten, der ich seit meinem 16. Lebensjahr war, habe ich mich zuletzt in wenigen Jahren zum Filmverächter gewandelt. Noch immer kann ich es kaum fassen, dass mich offenbar tatsächlich kein Film mehr zu begeistern vermag. Immer wieder einmal mache ich einen Versuch, gebe dem Drängen von Freunden nach, probiere ich diese und jene eindringliche Empfehlung aus. Und stets aufs Neue bin ich enttäuscht, finde meine ärgsten Befürchtungen bestätigt. Dabei beschränkt sich meine Aversion durchaus nicht auf neue Filme. Selbst berühmte Klassiker, die wenigen, die ich noch nicht kannte, können mich nicht gewinnen. Und auch die einst mit solcher Inbrunst verehrten Lieblingsfilme, die in meiner Erinnerung herrlich strahlten, erweisen sich beim Wiedersehen nach so langer Zeit als merkwürdig verblasst, sind nicht mehr ernst zu nehmen. Besonders enervierend erscheint mir übrigens, eine Nebenbeobachtung, die Musik im Film. Diese abgeschmackte „Untermalung“ von Stimmungen, Spannungen, Gestik und Mimik habe ich früher wohl gar nicht bewusst wahrgenommen, so selbstverständlich schien sie mir. Nun löst die Tonspur sich aus dem Zusammenhang, das Getöse tritt mir isoliert entgegen, nahezu stets als alberne Effekthascherei, ganz und gar unerträglich! Mag sein, dass ich überkritisch bin, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr zu einer Toleranz überreden, aus der ich unwiderruflich herausgewachsen bin. Das ist bedauerlich, doch nicht zu ändern.
Zufall: Rumgetalpe
Saturday, 07. January 2012Durchsicht aller online verfügbaren Rezensionen von Wolfgang Herrndorfs Sand. Durchwegs urteilen die Kritiker wohlwollend bis überschwänglich, kein einziger Verriss tanzt aus der Reihe. Das ist insofern erstaunlich, als sie sich andererseits darin einig sind, aus dem Buch nicht recht schlau geworden zu sein. Sie geben zu, verwirrt zu sein, den Überblick verloren zu haben, sich getäuscht und hintergangen vorzukommen – aber sie nehmen das nicht etwa übel, sondern applaudieren dieser Vertracktheit und irritierenden Unübersichtlichkeit noch. Als langjähriger Zufallsforscher kann mich nicht überraschen, dass dieses vielfach missbrauchte Wörtchen auch hier dran glauben muss, um dem Chaos einen Dreh ins glücklich Gewollte und damit Gelungene zu geben. Den Anfang machte Friedmar Apel: „Da die Wahrheit so unwahrscheinlich klingt, erfindet er [der Protagonist des Romans, Carl genannt] wahrscheinlichere Aussagen, aber der Zufall will ihm nicht zu Hilfe kommen. Dabei könnte das Ganze als eine Verkettung von dummen Zufällen erscheinen. […] Die Ereignisse und Gewalttaten scheinen jeweils keinen oder einen falschen Grund zu haben. Das Leben ist auch ein Fehlerspiel von Zufällen, aber da nennt man es Schicksal.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 11. November 2011.) – Und so geht es munter weiter. Dirk Knipphals: „Jedenfalls spielt der Zufall, der in diesem sinnlosen Kosmos und dieser transzendentalen Obdachlosigkeit, in der wir nun einmal leben, herrscht, die alles überragende Rolle.“ (taz v. 15. November 2011.) – Andrea Hanna Hünniger: „Es ist, als wollte er [der Autor] sagen: Jede Handlung ist nur eine Folge von Missverständnissen. Jede Begegnung eine Folge von Zufällen. Und jedes Urteil eine Folge von inkompetenten Richtern. […] Alles, was er [Carl] vor seiner Gefangenschaft tut, geht schief, obwohl sich nicht genau sagen lässt, ob er selbst einen Fehler gemacht hat. Eher sind es die Zufälle, die alles kompliziert machen. Sie sind es, die dafür sorgen, dass ihm der Mikrofilm in die Hände fällt und im Moment des Fast-Erlöstseins wieder verloren geht.“ (ZEIT v. 22. November 2011.) – Luise Boege: „In Sand wird zunächst sehr viel durch Zufall hineingeraten und herumgetalpt […].“ (der Freitag v. 5. Dezember 2011.) Wie die Rezensenten habe ich das Buch mit großen Erwartungen zur Hand genommen. Wie sie empfand ich für den Autor nach Tschick und mehr noch nach intensiver Lektüre seines Blogs Arbeit und Struktur Sympathie und Achtung. Nachdem ich zwei Wochen Bettlektüre – Bücher lese ich ausschließlich vorm Einschlafen im Bett – mit Sand verbracht habe, komme ich noch zu keinem abschließenden Urteil. Die Besprechungen jedenfalls gehen nach meiner festen Überzeugung allesamt in die Irre. Indem sie das Buch so loben, tun sie ihm Unrecht. Zum Überfluss entdeckte ich noch diesen Mitschnitt einer Lesung des Autors aus Sand, bei der im Publikum dauernd gekichert wird. Offenbar sind die Zuhörer mit dem Vorurteil aus Tschick zu der Rezitation gegangen, einem Humoristen zu begegnen – und hören dann nicht richtig hin. Schmerzhaft!
Optalidon (I)
Friday, 06. January 2012„Das Einzige, das half.“ Nämlich gegen meine Kopfschmerzattacken, die mich seit frühester Kindheit zwar nicht regelmäßig, aber zuverlässig immer dann, wenn ich am wenigsten damit rechnete „aus der Bahn warfen“: grauenhafte Pein, Schwindel und blitzende Aureolen, schließlich gipfelnd in Kotzeruptionen „bis zur Galle“, dann totale Erschöpfung und Schlaf; zuletzt ein Erwachen „wie neugeboren“. Wenn ich mir diese Ochsentour ersparen wollte, griff ich zu einem jener rosafarbenen Zäpfchen aus dem Hause Sandoz. Wunderbar! Wenn man heute ,Optalidon‘ bei Wikipedia eingibt, findet man nur eine Erwähnung im Artikel über den Schauspieler Harry Meyen, der sich 1979 an einer Feuerleiter an der Rückfront seines Hauses in Hamburg erhängte, im Alter von nur 54 Jahren, mit einem Seidenschal. Und dort liest man: „Sein Leben lang litt Meyen unter starker Migräne und nahm daher viele Tabletten, unter anderem Optalidon und Staurodorm. Verbunden mit Alkohol führen diese Medikamente häufig zu Benommenheit, Müdigkeit, Lichtempfindlichkeit, Angst und Selbstmordgefährdung. Sein Rauschmittelkonsum steigerte sich im Laufe der Jahre.“ Meyen war als „jüdischer Mischling ersten Grades“ mit 18 Jahren ins KZ Neuengamme verschleppt worden. International bekannt wurde er als Ehemann von Romy Schneider. Einen Abschiedsbrief hat Harry Meyen nicht hinterlassen.
Amt, beschädigt
Thursday, 05. January 2012Ausnahmsweise werde ich mir doch einmal untreu und äußere mich zur Tagespolitik. Seit Guttenberg, mithin seit einem Dreivierteljahr, habe ich mich zurückgehalten und meinen Ärger, meinen Ekel und meine Belustigung über das alltägliche Hickhack unserer demokratisch gewählten, politischen Sachwalter und Repräsentanten und die nicht minder unappetitliche Ausplünderung dieses Spektakels in den kommerziellen Massenmedien hinuntergewürgt. Es gibt ja verdienstvolle Weblogs ohne Zahl, die auf diesem Feld vortreffliche Arbeit leisten, von netzpolitik.org und mediaclinique über Feynsinn, Schockwellenreiter und NachDenkSeiten bis hin zu den Sozialtheoristen und FeFes Blog. Setzt man nur diese Sieben Zwerge auf die Blogroll, dann ist einem alltäglich aus dem Herzen gesprochen und man kann sich allmorgendlich zwischen Frühstück und Tagwerk mit der schönen Illusion besänftigen, dass es noch genug kritischen Verstand in diesem Land gibt und wir uns um die Demokratie nicht sorgen müssen. – Jetzt aber muss ich doch einmal was sagen. Gestern hat Christian Wulff im Öffentlich-rechtlichen Fernsehen zur besten Sendezeit zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen Rede und Antwort gestanden. Da ich bekanntlich kein TV-Gerät beherberge und mir ohnehin solche wichtigen Einlassungen lieber schwarz auf weiß gedruckt zu Gemüt und Verstande führe, kenne ich das Ergebnis dieses knapp 18 minütigen Verhörs, dem der Bundespräsident seitens Bettina Schausten (ZDF) und Ulrich Deppendorf (ARD) unterzogen wurde, nur aus den jetzt als Abschrift im Internet verfügbaren Versionen. Hier also mein Urteil. Die Frage, ob sich Wulff etwas hat zuschulden kommen lassen, das seinen Rücktritt zwingend erforderlich macht, kann ich nicht beantworten. Ob seine Kreditgeschäfte oder sein Umgang mit der Presse gegen geltende Gesetze verstießen, müssen schlimmstenfalls die zuständigen Instanzen entscheiden. Was mich jedoch wirklich erschüttert, das ist das Bild, das dieser Mann in der erbarmungswürdigen Lage abgibt, in die er selbst sich durch sein doch wohl mindestens ungeschicktes Handeln und in die ihn die erbarmungslose Öffentlichkeit durch ihren unstillbaren Hunger auf Sensation getrieben haben. Es ist dies das Bild eines kleinen Jungen, der in der Ecke steht und um Straferlass bettelt. So ganz anders stand Wulffs Amtsvorgänger Horst Köhler bei seinem überraschenden Rücktritt im Mai 2010 vor der Medienmeute: trotzig, gar angriffslustig. Köhler hat sich unsere Sympathien, so wir denn überhaupt welche hatten, damals durch seine Uneinsichtigkeit verscherzt. Wulff hingegen ist nur zu bemitleiden. Die zynische Frage muss nun leider lauten: Welches Schauspiel fügt dem Amt des Bundespräsidenten den größeren Schaden zu?
Am Rande bedacht
Wednesday, 04. January 2012In meiner Jugend war ich davon überzeugt, verrückt zu sein, weil ich mich als so sehr anders empfand als meine Klassenkameraden. Ich interessierte mich für Psychiatrie und fand bald heraus, dass die Gesundheit, die sie im Irren wiederherstellen wollte, nichts anderes war als eine gesellschaftliche Norm, angepasst an die Erfordernisse eines produktiven Gemeinwesens. So entdeckte ich bald die Anti-Psychiatrie und las dort mit Zustimmung, dass die Geschäftigkeiten dieses Gemeinwesens im Gegenteil auf die totale Destruktion hinausliefen: „Mit Sicherheit werden wir uns selbst ausrotten, falls wir nicht unser Verhalten befriedigender als gegenwärtig regulieren.“ Unbefriedigt wie ich war erschien mir dies sehr plausibel, ebenso wie die Beschreibung unserer Defizite, die uns zum Opfer unserer eigenen Einrichtungen und Gewohnheiten machten: „Wir sind nicht einmal fähig, das Verhalten am Rande des Abgrunds adäquat zu bedenken. Doch wir bedenken weniger, als wir wissen; wir wissen weniger, als wir lieben; wir lieben sehr viel weniger, als es gibt. Und wir sind präzise so viel weniger, als wir sind.“ Daraus zog ich den Schluss, dass ich all meine Anstrengungen darauf richten müsste, so viel zu werden wie ich war; so viel wie möglich von dem zu lieben, was es gab; alles zu wissen, was ich liebte; und alles zu bedenken, was ich dann wüsste – um schließlich mein Verhalten am Rande des Abgrunds immerhin adäquat bedenken zu können. Als ich aber bereits an der ersten Hürde gescheitert war, glaubte ich erkannt zu haben, dass ich meine Hoffnung nicht mehr auf mich selbst setzen konnte. Doch stand mir nicht zu, alle Hoffnungen fahren zu lassen: „Wer sind wir, daß wir entscheiden könnten, es gebe keine Hoffnung mehr?“ Zumindest sei ja, wie der Prophet der Anti-Psychiatrie schrieb, jedes Kind „ein potentieller Prophet, gestürzt in die äußere Dunkelheit.“ (Alle Zitate aus Ronald D. Laing: Phänomenologie der Erfahrung. A. d. Engl. v. Klaus Figge u. Waltraud Stein. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1969, S. 24.) – Wenn ich Texte wie diesen heute wieder lese, wundere ich mich sehr, dass mir damals ihr Predigtton gar nicht auffiel und -stieß.
Kreuzungen, Knochen
Tuesday, 03. January 2012Lyrik (1). Immer wieder kehre ich zu den Versen zurück, die mich mit achtzehn, neunzehn Jahren umwarfen. Als könnte ich an ihnen prüfen, ob ich mir treu geblieben bin? So singt die polnische Dichterin Wisława Szymborska 1957: „Vertraut mit den großen Räumen | zwischen Himmel und Erde | verlieren wir uns im Raum | zwischen Erde und Kopf. | Der Weg vom Leid zur Träne | ist interplanetarisch. | Unterwegs vom Trug zum Sein | ergraut unser Kinderschopf.“ Ja, ich empfinde die gleiche Verlorenheit – und in diesem Gefühl eine solche Nähe, zu der polnischen Dichterin und zu dem Jungen, der ich war, als ich diese Nähe und diese Verlorenheit zum ersten Mal spürte. Unsterbliche Gedichte können Wegmarken in der Zeit sein, wie Saurierknochen an Kreuzungen aufgepflanzt. Aber auf meinem Weg gibt es nur sehr wenige Marken dieser Art. Ich weiß nicht, ob ich das bedauern soll. (Wisława Szymborska: Den Freunden; in: Salz. A. d. Poln. v. Karl Dedecius. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1973, S. 94.)
Prozess-Ungeheuer
Monday, 02. January 2012Pünktlich zum Dickens-Jahr habe ich mit der Lektüre von Bleakhaus begonnen, in der Übersetzung von Gustav Meyrink und in einer wunderschönen, hundert Jahre alten dreibändigen Ausgabe des Verlags von Albert Langen in München. Man denke: noch mit Kustoden! Der Roman um die juristische Erbschaftsfehde Jarndyce kontra Jarndyce ist der neunte aus der Feder des produktiven Briten, entstanden zu Beginn seines fünften Lebensjahrzehnts. Schon im ersten Kapitel beeindruckt mich der Einfallsreichtum des Autors, wenn er die kaum glaubhafte Verschleppung des Urteils in diesem Prozess anhand überaus komischer Vergleiche und Maßstäbe deutlich werden lässt: „Der kleine Kläger oder Beklagte, dem man ein neues Schaukelpferd versprochen, wenn ,Jarndyce kontra Jarndyce‘ geschlichtet sein würde, ist darüber groß geworden, hat sich ein lebendes Pferd gekauft und ist in die andere Welt getrabt.“ (Bd. I, S. 11.) Nach dem wenig amüsanten Roman von Herrndorf verschafft meinem angeschlagenen Gemüt vielleicht, hoffentlich dieses wohl bei allem Sarkasmus unschuldig erheiternde Meisterwerk über menschliche Schwächen und Dummheiten den nötigen Ausgleich.
Sonntag, 1. Januar 2012
Sunday, 01. January 2012So verschieden die Jahresrückblicke auf 2011 ausfallen mögen und so unterschiedlich die gesetzten Akzente je nach Format und Perspektive sind, so einig sind sich die journalistischen Chronisten doch in einem Punkt: dass das vergangene Jahr durch eine außergewöhnlich hohe Ereignisdichte aus der Reihe fällt. Heribert Prantl bringt es in der SZ so auf den Begriff: „Aus diesem Jahr hätte man drei Jahre machen können; oder vier, oder noch mehr. Das Jahr 2011 war ein Jahr, in dem im März schon so viel passiert war, wie sonst im Dezember noch nicht passiert ist. Es war ein Jahr, in dem die Ereignisse sich überschlugen.“ (Das atemlose Jahr; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 302 v. 31. Dez./1. Jan. 2011/12, S. V2/1.) Diese Betrachtungsweise unterstellt allerdings, dass hierbei vernünftige Maßstäbe zur Bewertung der Relevanz von Ereignissen angelegt werden, was offenkundig nicht der Fall ist. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Naturkatastrophe in Japan mit dem anschließenden Supergau im Atomkraftwerk von Fukushima werden geradezu in einem Atemzug genannt mit dem Rücktritt des deutschen Verteidigungsministers von allen seinen Ämtern. Während die radioaktive Verseuchung der Umwelt im ersten Falle womöglich noch in Jahrtausenden mess- und spürbar sein wird, ist der Name des peinlichen Plagiators vermutlich in zehn Jahren schon nahezu vergessen. Wichtig für die Berichterstattung ist in Wahrheit, was die Zeitung für geeignet hält, den Abonnenten bei der Stange zu halten. Und insofern war das Jahr 2011 vielleicht ein sehr ertragreiches Jahr für die Medien, als es für jeden etwas in petto hatte – und das nahezu pausenlos. Allerdings rührte diese Kontinuität und Lückenlosigkeit des Berichtenswerten wohl auch daher, dass sich etliche Geschehnisse außergewöhnlich lang hinzogen. Die arabischen Aufstände gegen hartnäckig widerstrebende Despoten oder der langwierige Kampf gegen die Kernschmelze in Japan waren (und sind teils noch) ebensolche Dauerbrenner wie die Bemühungen zur Rettung des Euro. In meinen Augen gab es 2011 eigentlich nur ein – dazu noch eher symbolisches – Ereignis von historischer Bedeutung: die Geburt des siebenmilliardsten Menschen. Bezeichnenderweise wurde aber über den Tod einzelner Menschen, wie von Kim Jong Il oder Johannes Heesters, ausführlicher berichtet als über die weiter exponentiell voranschreitende selbstzerstörerische Vermehrung unserer Art.