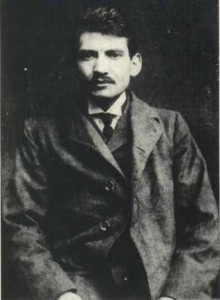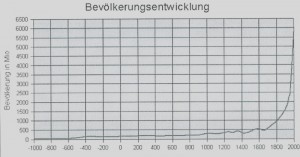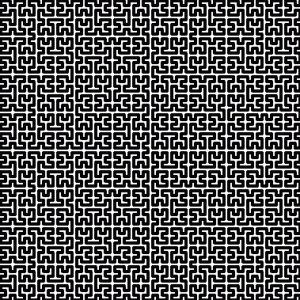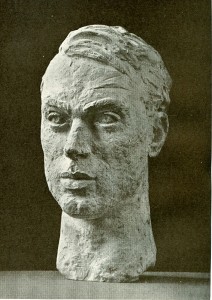Die meisten Quotenknüller des Fernsehens verdanken ihren Erfolg der Hoffnung des Zuschauers auf ein ungeplantes Missgeschick. Die erregtesten Gespräche nach Live-Übertragungen von der Formel I und der Tour de France gab es in der Betriebskantine meines früheren Arbeitgebers immer nach Unfällen, je schlimmer, desto doller. Peinliche Patzer von sonst so perfekten Nachrichtensprechern, der schweigende Boxer Norbert Grupe, Trapattoni und sein „Ich-habe-fertig!”-Wutausbruch, Zlatkos schlechte Manieren im „Big-Brother”-Container, Eva Hermans Nahezu-Rausschmiss bei Johannes B. Kerner, die gegenseitigen Beleidigungen von Marcel Reich-Ranicki und Sigrid Löffler im gesitteten „Literarischen Quartett”, Zinédine Zidanes Kopfstoß gegen die Brust von Marco Materazzi in den letzten Minuten des WM-Finales – das waren einige der vielen mittlerweile legendären Spontanereignisse der Fernsehgeschichte, auf die jeder Zuschauer insgeheim stets hofft, wenn er sich vor die Glotze hockt und nach spannender Entspannung giert.
Wem das wirkliche Leben keine Abwechslung bietet und schon gar keine Überraschungen, für den ist die Sehnsucht, zum Zeugen solcher ungeplanten Regelverstöße in aller Öffentlichkeit zu werden, ein starkes Motiv, sich den langweiligsten Quatsch aus alter Gewohnheit und in Ermangelung einer Alternative Abend für Abend, Stunde um Stunde, Jahr auf Jahr in unverbrüchlicher Treue reinzuziehen. Welch ein Elend! Welche Vergeudung von Lebenszeit, Kreativpotenzial und mentalem Volksvermögen!
Was für den im Live-TV übertragenen Sportevent der blutige Unfall oder das brutale Foul, das ist für die Talkshows, Quizsendungen oder Preisverleihungen der Eklat: ein kostenloser Quotenbringer allererster Güte. Seine Effizienz ist zu einem guten Teil von der Fallhöhe abhängig: der Differenz zwischen den Erwartungen des Publikums an die Akteure auf dem Bildschirm und deren skandalösem Verhalten. Wenn Dieter Bohlen bei DSDS einen vernehmlichen Furz ließe, wäre das für zarte Gemüter, die sich wild zappend in ein solches Format verirrt haben, vielleicht momentweise degoutant, für seine hartgesottenen Fans würde er damit aber bloß eine weitere stinkende Blase in jenem Schlammbad produzieren, in dem die Unappetitlichkeit längst vorherrschende Konvention des gewöhnlichen Umgangs miteinander geworden ist. Solche Entertainer haben’s schwer, es mit einem Ausraster noch mal auf die erste Seite der Bild-Zeitung zu schaffen. Wenn aber – ich phantasiere mal – ein vor Seriosität und Beherrschtheit sonst nur so strotzender Tagesschau-Sprecher beim Verlesen einer Unfallmeldung in Tränen ausbräche, weil seine eigene Tochter zu den Opfern zählte, dann wäre dies ein Ereignis, das „Fernsehgeschichte” schriebe und tausendfach wiederholt würde.
Marcel Reich-Ranicki war ein erfolgreicher Literaturkritiker in den „anspruchsvollen” Printmedien der 1960er- bis 1980er-Jahre (Zeit und FAZ), dem aber schon in dieser Tätigkeit die Zurschaustellung seiner hochrichterlichen Würde, Unabhängigkeit und Allmacht mehr bedeutete als die Wertbeständigkeit und Kommensurabilität seiner für den Tag geschriebenen Urteile. In einer Zeit, als das formale Experiment und die politische Provokation die dominierenden Kräfte der ehemals „Schönen Literatur” waren, stand sein Name für ein Beharren auf stockkonservativen Positionen, zu deren Begründung er nie viel mehr anzuführen wusste als die Rückbesinnung auf die Ideale der Klassik – und sein Lieblingsparadigma lautete allenthalben: „Literatur darf den Leser nicht langweilen.” (Mit der allerdings stets unterschlagenen Voraussetzung: „Der Leser bin ich.”) Im März 1988 schloss der nachmalige „Literaturpapst” dann einen Pakt mit dem Teufel und ging gegenüber seiner Würde, um seiner Eitelkeit willen, einen Kompromiss ein: Marcel Reich-Ranicki bereicherte das ZDF um ein „Format”, das zuvor niemand für möglich gehalten hätte, eine „anspruchsvolle Literatursendung”, in der es ausschließlich um Bücher ging und in der nicht mehr zu sehen und zu hören war als das Gespräch zwischen vier kontrovers argumentierenden Fachleuten.
Rückblickend betrachtet hat der mittlerweile 88-jährige Mann damit immerhin dem deutschen Buchhandel einen großen Dienst erwiesen und dafür gesorgt, dass Abermillionen Bücher, vorzugsweise die von ihm verrissenen, über den Ladentisch gingen. (Wie viele von ihnen tatsächlich von den braven Käufern gelesen wurden, das steht freilich auf einem anderen Blatt.) Ein solcher Pakt hat nun aber, wie der an der deutschen Klassik geschulte Großkritiker zweifellos wissen wird, immer seine zwei Seiten. Und so sind wir kritischen Zeitzeugen dieses traurigen Schauspiels nun dazu verdammt, einem unaufhaltsamen Niedergang zusehen zu müssen. Marcel Reich-Ranicki kann nach der Einstellung des Literarischen Quartetts Ende 2001 auf seine alten Tage nun doch nicht auf die öffentliche Aufmerksamkeit verzichten; er nutzt – welch ein Eklat! – die Verleihung des „Ehrenpreises der Stiftung des Deutschen Fernsehpreises” dazu, sich noch einmal ins Rampenlicht zu stellen, pünktlich zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse, indem er in die Hand beißt, die ihn viele Jahre gefüttert hat – und schafft es endlich wieder zu einer Bild-Schlagzeile. Wenn man sich allsonntäglich seine peinlichen Briefantworten in der FAS anschaut, dann hätte man allerdings gewarnt sein müssen. – Am kommenden Freitag von 22:30 bis 23:00 Uhr erhält der unsterbliche MRR die Gelegenheit, im Gespräch mit dem ebenfalls unsterblichen Thomas Gottschalk vor Millionen Fernsehzuschauern darzulegen, warum er so lange gebraucht hat, bis ihm die Erkenntnis dämmerte, dass das Fernsehen das bislang wirkungsvollste Instrument zur Kulturvernichtung in der Menschheitsgeschichte ist. Die Quoten dürften sich sehen lassen.