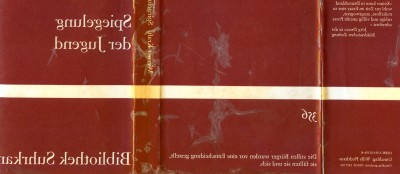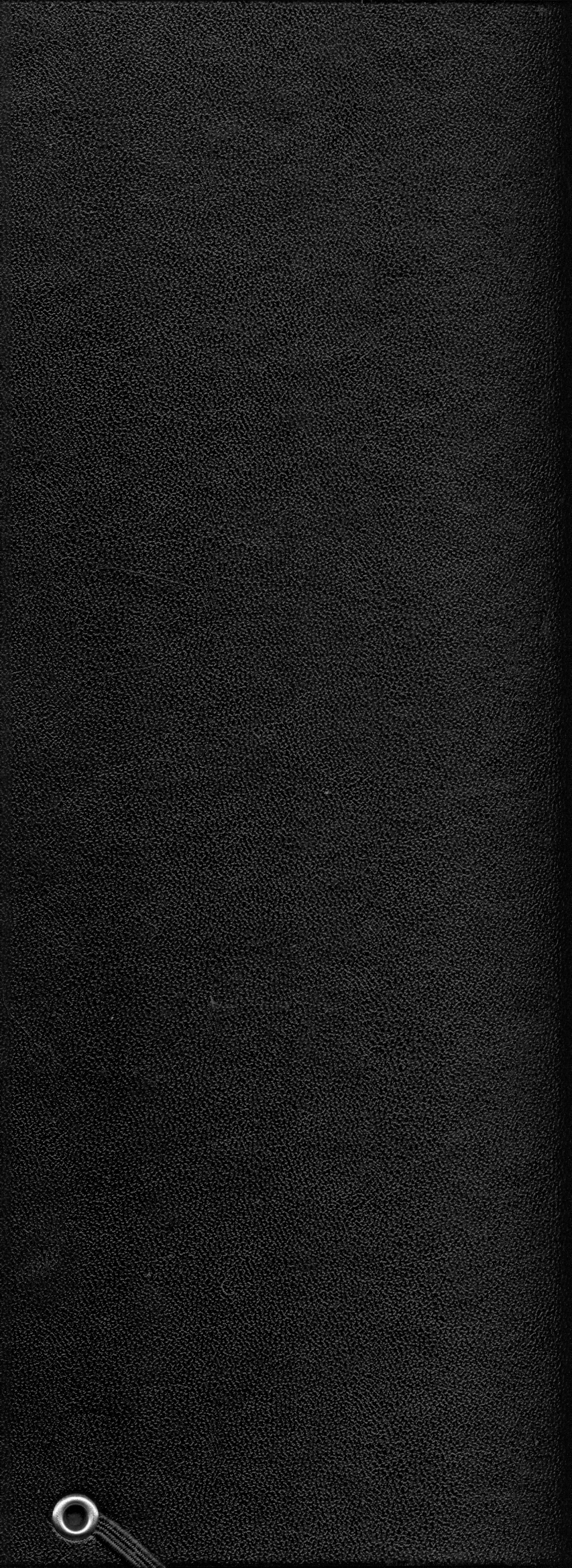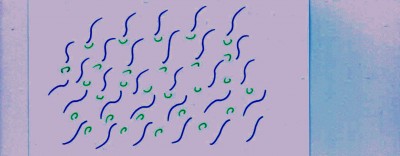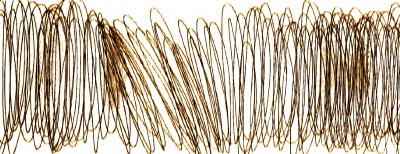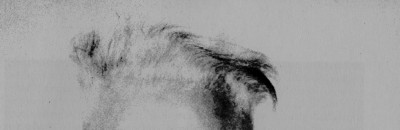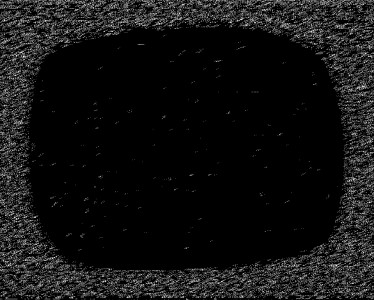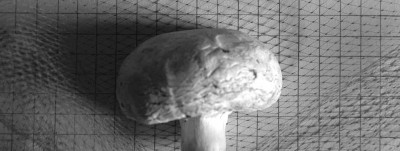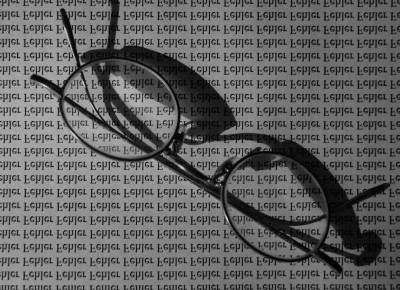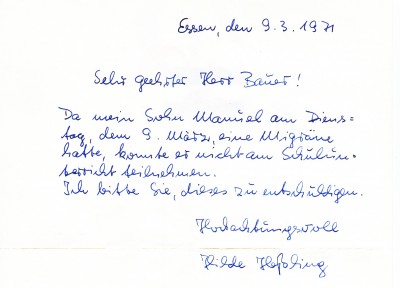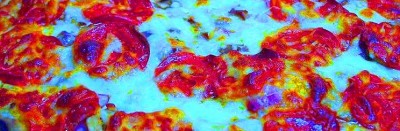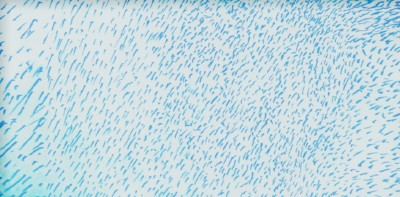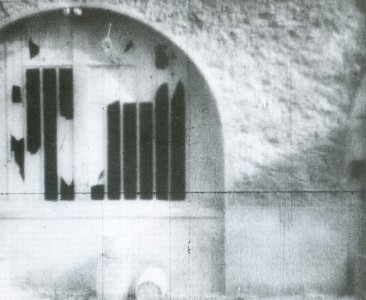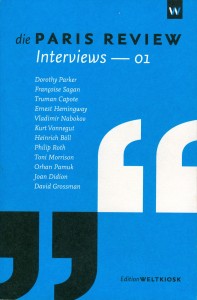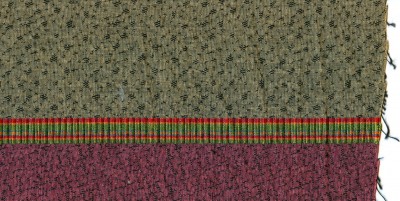Auch Herrndorfs work in progress zieht mich in letzter Zeit nur noch runter. Seine schubweisen Publikationen lassen nach meinem Gefühl immer länger auf sich warten und werden zugleich immer dünner, quantitativ und leider auch qualitativ. Ich hoffe, dass der Blogger H. das nicht liest. Sollte er sich dennoch hierher verirren, dann möchte ich ihm sagen, dass diese Anmerkung nicht als Kritik gemeint ist. Man kann nicht jemandes literarische Produktion unbefangen kritisieren, der in einer solchen Verfassung lebt. Dass es gegen Sand, diesen mindestens problematischen Roman, bisher keine ernst zu nehmenden Verrisse gab, ist schon verdächtig. Am Sonntag vor acht Tagen hörte ich nun eine geradezu hymnische Besprechung seines letzten Romans von Simone Hamm bei wdr3, die alle vorangegangenen an Lob weit übertrifft. Dass Hamm dabei, vielleicht als einzige unter ihren Kolleginnen und Kollegen, den gesundheitlichen Zustand des Autors nicht erwähnt, verstärkt bei mir noch den Eindruck, dass ihre Hymne zuvörderst mit Berechnung auf Wolfgang Herrndorf als Zuhörer geschrieben und gesprochen ist, erst in zweiter Linie für uns Radiohörer. Schlimm auch, dass er die Missverständnisse der Kritiker in einer Art ,Hitliste der Ignoranz‘ erfasst: „Michalzik entreißt Hünniger die Krone, Willmann nur noch unter ferner liefen.“ Als wollte er sich darüber beschweren, dass Leser nicht mit dem Notizblock neben dem Buch alle Namen, Orte und Ereignisse in Listen erfassen, um für alle losen Fäden die zugehörige Verknüpfung zu registrieren. Träumt der Autor etwa davon, dass ihm zu Ehren posthum ein Wolfgang-Herrndorf-Dechiffriersyndikat aus der Taufe gehoben wird? Das klingt makaber, ich weiß. Insofern müsste es Herrndorf ja eigentlich gefallen. Oder er legt mich in sein Säurebad Arbeit und Struktur. Was könnte ich dagegen sagen? Niemand kann ihm schließlich irgendwas ernsthaft verübeln. Das muss schrecklich sein, ein Schrecken mehr zu all den Schrecken.
Archive for the ‘Würfelwürfe’ Category
Alles gerät in Schieflage
Monday, 05. March 2012Lockere Sprüche
Monday, 05. March 2012,Zitat des Tages‘ neulich beim Perlentaucher ein Ausspruch des um flotte Sprüche bekanntlich nie verlegenen Oscar Wilde: „Jeder Erfolg, den man erzielt, schafft einen Feind. Man muss mittelmäßig sein, wenn man beliebt sein will.“ Danach kann sich jeder mittelmäßige Schnösel, der sich wie auch immer ein paar Feinde gemacht hat, in die Brust werfen und sich im Lichte seiner vermeintlichen Außergewöhnlichkeit sonnen. Ich will nicht in Abrede stellen, dass bei öffentlich wirksamen Personen der beschriebene Effekt eintreten kann, wenn beispielsweise ein politischer oder künstlerischer Erfolg dazu geeignet ist, Missgunst bei den Konkurrenten zu wecken. Das ist aber doch ein spezieller Fall, der mitnichten diesen generalisierenden Auftakt rechtfertigt („Jeder Erfolg, den man erzielt …“). Während Wilde sich lebenslänglich mit dem Thema sowohl theoretisch als auch praktisch beschäftigte und dabei noch allerlei weiteres aphoristisches Kleingeld unter die Leute brachte, ist der Große Meister der Gattung in seinen Sudelbüchern nur ein einziges Mal wortwörtlich auf den Erfolg zu sprechen gekommen, und da spricht er nicht einmal von dem Erfolg als öffentliche Anerkennung, sondern meint Erfolg als Gelingen (wissenschaftlicher Bemühungen): „Es gibt kein größeres Hindernis des Fortgangs in den Wissenschaften, als das Verlangen, den Erfolg davon zu früh verspüren zu wollen. Dieses ist munteren Charakteren sehr eigen; darum leisten sie auch selten viel; den sie lassen nach und werden niedergeschlagen, sobald sie merken, daß sie nicht fortrücken. Sie würden aber fortgerückt sein, wenn sie geringe Kraft mit vieler Zeit gebraucht hätten.“ (Aph. K 178; zit. nach Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und Briefe. Zweiter Band. München: Carl Hanser, 1971, S. 431.) – Es könnte eine dankbare Aufgabe für einen Possenschreiber sein, wollte er Lichtenberg und Wilde als Paar, wie es sich gegensätzlicher nicht denken lässt, auf die Bühne bringen. Nur diese beiden, aus einem Abstand von hundert Jahren in ein gemeinsames Jetzt geworfen! Sie träten jeweils durch zwei gegenüberliegende Türen auf, kämen aus ihren jeweiligen Welten von 1794 bzw. 1894, der geduldige Forscher Lichtenberg aus seinem Göttinger Gartenhaus an der Weender Chaussee, der muntere Charakter Wilde aus seiner Londoner Stadtwohnung, 16 Tite Street. (Was für Dialoge wären daraus zu entwickeln.)
Altersvorsorge
Saturday, 03. March 2012Swift, den viele als Autor seines Gulliver kennen und den ich verehre wegen seines Modest Proposal, jener Jonathan Swift hat lange Zeit vor dem Erscheinen der genannten Meisterwerke, im zarten Alter von 32 Jahren eine Liste von Verhaltensweisen aufgestellt, die er unbedingt vermeiden wollte, wenn er einmal alt würde. (Ich verdanke den Hinweis auf diese Liste Shaun Usher, der sie vorgestern in seinen Lists of Note veröffentlichte.) Swift erweist sich schon hier als großer Menschenbeobachter und -kenner, indem er diesmal die Schwächen des Greisenalters aufs Korn nimmt. Unbestechlich und mit erbarmungsloser Härte nennt er sie beim Namen, all die Verschrobenheiten, Nachlässigkeiten und Albernheiten, die den Menschen auf abschüssigem Weg daran hindern, seine wirkliche Lage anzuerkennen und sich damit auszusöhnen, dass er längst nicht mehr auf der Höhe ist. Der junge Swift gelobt sich also, dass er dereinst nicht lüstern sein und keine junge Frau heiraten will, um sich eigene Jugendlichkeit und Attraktivität vorzuspielen; dass er nicht griesgrämig oder mürrisch oder misstrauisch sein will; dass er nicht ein und dieselbe Geschichte den gleichen Leuten wieder und wieder auftischen will; dass er seine Nächsten nicht mit unerbetenen Ratschlägen belästigen und sich nicht abfällig über moderne Bräuche, Moden oder Ansichten äußern will; dass er jungen Leuten gegenüber tolerant sein und ihre Scherze und Schwächen ertragen will; und dass er sein Ohr vor dem Gewäsch tratschender Dienstboden ebenso verschließen will wie vor den Schmeichelein junger Frauen. Aber er geht noch einen Schritt weiter, denn offenbar hat er sich gefragt, warum denn all die Alten, die er beobachtet und bei denen er die aufgelisteten Mängel festgestellt hat, diesen Mängeln in so großer Zahl zum Opfer fallen. Offenbar sind sie blind geworden für ihre eigenen Verfehlungen. Also baut er noch eine Zusatzregel in seine Liste ein, die da lautet: “To desire some good Friends to inform me w[h]ich of these Resolutions I break, or neglect, and wherein; and reform accordingly.” Und Swift wäre nicht Swift, der große Ironiker und Humanist, würde er nicht seinen strengen Moralkatalog mit der letzten Regel wieder auf menschliches Maß zurückstutzen: “Not to sett up for observing all these Rules; for fear I should observe none.” – Ganz groß!
Lexikon der SciFi-Plots
Sunday, 26. February 2012Immer mal wieder fällt mir eine kleine Verzerrung der Wirklichkeit ein, aus deren konsequenter Weiterverfolgung sich eine wunderschöne Science-Fiction-Story entfalten ließe. Aber bevor ich noch ernsthaft darüber nachdenke, lähmt mich die Überzeugung, dass längst andere auf solch einen doch ganz naheliegenden Anlass für eine surreale Geschichte gekommen sein müssen und es sich insofern kaum lohnen dürfte, die Idee weiterzuverfolgen. Dagegen könnte man einwenden, dass es ja vielleicht auch auf die Umsetzung ankommt. Ein guter Plot im Kopf macht schließlich noch kein literarisches Meisterwerk auf dem Papier! Aber mich schreckt eben gleich von vornherein der Gedanke ab, dass ich viel Zeit in die Niederschrift einer solchen Story investieren könnte, um mir dann vom erstbesten Lektor in einem auf dieses Genre spezialisierten Verlag sagen lassen zu müssen, genau dieses Thema habe doch, beispielsweise, „der SciFi-Klassiker Theodore Sturgeon auf schwer erreichbare, sicher aber unübertreffliche Weise in einer großartigen Erzählung aus dem Jahr 1951 in allen Tonarten durchdekliniert [!]. Lesen Sie das mal – und dann melden Sie sich wieder, wenn möglich mit frischeren Motiven! Anbei Ihr Manuskript zu unserer Entlastung zurück.“ Nein, das muss ich mir nicht antun. Bei dieser Gelegenheit wird mir aber bewusst, wie hilfreich ein wirklich nach Vollständigkeit strebendes Verzeichnis der Stoffe und Motive der Science-Fiction-Literatur aller Zeiten und Sprachen wäre. (Die wertvolle Pionierarbeit von Elisabeth Frenzel als Verfasserin zweier Nachschlagewerk zu Stoffen und Motiven der Weltliteratur wurde leider durch ihre politische Vergangenheit im Nationalsozialismus diskreditiert, was vielleicht sogar die Stoff- und Motivforschung in Deutschland lange Zeit ausgebremst hat.) Es müsste darin nicht nur das jeweilige Hauptthema eines Werks erfasst sein, sondern durchaus auch die bloß marginale Behandlung von Themen. Beispielsweise müsste ich unterm Stichwort „Tunnelbau“ nicht nur auf den Roman von Bernhard Kellermann verwiesen werden, sondern auch auf Erzählungen, in denen der Bau eines Tunnels vielleicht nur am Rande vorkommt. Und man müsste ein Regelwerk zur Bildung von mehrteiligen Lemmata finden, um auch komplexere Themen, die nicht in einem einzigen Stichwort ausgedrückt werden können, auffindbar zu machen. – Beispielsweise dachte ich heute darüber nach, wie es einem Menschen ergehen mag, der eines Tages nach dem Aufwachen feststellt, dass er wie unter einem Zwang immer die Wahrheit sagen muss; oder, um den Einfall in eine andere Richtung zu biegen, der plötztlich beobachtet, dass alle anderen zwanghaft die Wahrheit sagen, nur er selbst kann lügen, dass sich die Balken biegen. Welchen Gefahren ist der Mann im ersten Beispiel ausgesetzt? Und welche Chancen ergeben sich für ihn im zweiten? Gibt es nicht längst schon Geschichten, die sich aus diesen Ideen entwickeln? Und wenn es ein solches Verzeichnis gäbe, wie ich es mir wünsche: Unter welchen Suchbegriffen würde man dann Geschichten des beschriebenen Typs finden?
Yuppie!
Saturday, 25. February 2012Am vergangenen Dienstag starb im gesegneten Alter von 89 Jahren Barney Rosset, Gründer der legendären Grove Press in New York, ein unermüdlicher Kämpfer für das freie Wort und gegen die Zensur, Förderer von so bahnbrechenden Autoren wie Henry Miller, Samuel Beckett, William S. Burroughs, Jack Kerouac und Allen Ginsberg. Meist ging es vor Gericht um vermeintliche Pornographie, gelegentlich auch um Politik, wie im Fall der Autobiographie von Malcolm X. In einem Interview mit der Paris Review (No. 145, Winter 1997) hat Rosset erzählt, wie er durch Nancy Kurshan, eine Mitarbeiterin bei seiner Evergreen Review, die Yuppies Jerry Rubin und Abbie Hoffman kennenlernte – und was er von ihnen hielt: “They were the cream, the froth at the top of the wave, but I really never trusted them.” Immerhin publizierte Rosset trotz aller Vorbehalte Hoffmans legendäres Buch Steal This Book, eine Anleitung zum zivilen Ungehorsam und zu einem Leben ohne Geld. Barney Rosset war damals so drauf, dass er solch ein radikales Pamplet gegen den American way of life auf den Buchmarkt brachte, ohne auch nur eine einzige Zeile von dem Zeugs gelesen zu haben. Um das Buch für seine Grove Press anzunehmen reichte ihm als Argument schon, dass Random House es abgelehnt hatte! Allerdings musste er bald feststellen, dass das Buch aus Sicht eines Verlegers einen kleinen Schönheitsfehler hatte. Die Leser nahmen seinen Titel nämlich wortwörtlich. (Das erinnerte mich sofort an das berühmt-berüchtigte Klau mich der Berliner Kommune I, mit Fritz Teufel und Rainer Langhans als Gallionsfiguren, dem ein ähnliches Schicksal beschieden war. Sollten die Berliner Haschrebellen die Idee zu ihrem originellen Titel bei den Gesinnungsgenossen in den USA geklaut haben? Aber in diesem Falle kann der Ideendiebstahl allenfalls in umgekehrter Richtung gelaufen sein, denn Klau mich erschien bereits 1968 in der Edition Voltaire, während Steal This Book bei Pirate Editions erst 1971 herauskam.) Diesen kleinen Nachruf setze ich hierher als Reverenz an einen wahrhaft großherzigen Verleger, aber auch als aktuellen Hinweis auf ein vergessenes Relikt der Frühgeschichte von Widerstandsformen, die heute mindestens in den Industrienationen zum Alltag jeder Subversion gehören.
Heikle Spur
Monday, 20. February 2012Ist eigentlich schon mal jemand auf den Gedanken gekommen, dass der Polizistenmord von Heilbronn vielleicht nicht ganz zufällig nur wenige Kilometer entfernt von Neckarsulm stattgefunden hat? Die Paulchen-Panther-Propagandafilme, die die Täter als Bekennervideos angefertigt haben, kokettieren ja mit beziehungsreichen Anspielungen auf die Taten, als wollten sie damit zeigen, wie sicher sie operieren konnten und wie wenig Sorgen sie sich machen zu müssen meinten, jemals gestellt zu werden. In diesem Zusammenhang könnte ich mir vorstellen, dass die Mörder aus dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) mit dem Tatort nahe dem namengebenden Standort der NSU Motorenwerke einen versteckten Hinweis geben wollten, sei es für ihre eingeweihten Gesinnungsgenossen, sei es für die Nachwelt, von der sie in ihrer Verblendung vermutlich hofften, einst in Mythen, Anekdoten und Schlachtenliedern gepriesen zu werden, wie einst der unselige Horst Wessel.
Noch ein paar Autotote
Monday, 20. February 2012Von der immer breiter werdenden Blutspur der Automobilisierung seit Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts habe ich hier immer wieder einmal die eine oder andere Probe aufgenommen, nicht ganz ohne Hintergedanken. Ich will in einer irgendwann zu komponierenden Zusammenschau solcher Zeugnisse nachvollziehbar machen, wie die Ungeheuerlichkeit dieses Mordens im Laufe der Zeit in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer Alltäglichkeit wird, die bloß noch im farblosen Spiegel der Statistik ihr Abbild findet. Gestern fand ich dieses erschütternde Beispiel in Kesslers Tagebuch: „Paris, 15. September 1927. Donnerstag – Die unglückliche Isadora Duncan ist gestern abend im Auto von ihrem eigenen Shawl, der sich in ein Hinterrad verwickelt hatte, erdrosselt worden. Ein tragisch-schicksalhafter Tod: der Shawl, der im Tanz ein so wesentlicher Teil ihrer Kunst war, hat ihr den Tod bereitet. Ihr Requisit und Sklave hat sich an ihr gerächt. Selten ist eine Künstlerin so tragisch umwittert gewesen und so aus ihrem eigensten Lebensschicksal heraus tragisch geendet: ihre beiden kleinen Kinder in einer Autokatastrophe umgekommen, ihr Mann, Jessenin, durch Selbstmord geendet, sie selbst jetzt in dieser Weise durch ihr eigenes Requisit, fast wie aus Rache, umgebracht.“ (Harry Graf Kessler: Tagebücher. 1918-1937. Hrsg. v. Wolfgang Pfeiffer-Belli. Frankfurt am Main: Insel-Verlag, 1961, S. 537.) Dieses Unglück trug sich in Nizza zu. Deirdre und Patrick, die beiden kleinen Kinder der Tänzerin, waren bereits 1913 durch eine Nachlässigkeit von Duncans Chauffeur ums Leben gekommen. Weil der Motor versagte, stieg er aus, um nach dem Rechten zu sehen, vergaß jedoch, die Handbremse anzuziehen. Das Automobil kam ins Rollen und stürzte in die Seine, die Kinder samt Kindermädchen ertranken.
Wintergarten
Saturday, 11. February 2012Zu Besuch bei Freunden in Düsseldorf. Manche Räume versetzen mich in einen Zustand wohliger Perplexität. (Ich weiß, dass das eigentlich eine unmögliche Begriffskonstruktion ist.) Bin ich drin, fühlt es sich an, als steckte ich in einer besseren Haut. Verlasse ich sie wieder, ist das Gefühl folglich wie eine Häutung. Ich streife ihre Atmosphäre ab und bin wieder der traurige Alte. Ernüchterung! Fast könnte man sagen: Es ist, als würde mir das Fell über die Ohren gezogen und ich stünde nackt und frierend in der grauen Landschaft. Aber das schösse übers Ziel hinaus, denn nur im ersten Augenblick der Verstoßung aus der Zimmeridylle erscheint mir die übrige Welt so. Die geschwinde Rückkehr in die Üblichkeit hindert, dass sich Schwermut festbeißen könnte.
Senkelverschleiß
Wednesday, 08. February 2012Eine kleine Fußnote zum Thema Geplante Obsoleszenz. Seit dem 13. Dezember vorigen Jahres laufe ich in neuen Schuhen herum, maßgeschneiderte schwarze orthopädische Lederschuhe mit hohem Schaft und fünf Paar mit schwarzen Metallösen verstärkten Schuhbandlöchern. Die schwarzen Schnürsenkel, die von meinem Schuhmacher mitgeliefert wurden, waren solche von Ringelspitz, schwarze Rundsenkel, 2,5 mm Durchmesser, 90 cm lang. Wie man im Bild oben sieht, verschleißen diese zu dünnen Bänder durch Abrieb in den obersten Ösen schnell. Schon nach knapp zwei Monaten täglicher Abnutzung ist der aus dem linken Schuh kurz vorm Zerreißen. Ich hatte für meine vorigen Schuhe die idealen Schuhbänder vom gleichen Hersteller nach langer Suche endlich gefunden. Es waren gewachste Rundsenkel von 4 mm Stärke. Die hielten ohne Probleme ein halbes Jahr und länger. Nun stellt sich leider heraus, dass die Ösen in den neuen Schuhen offenbar etwas kleiner sind, sodass die dickeren Bänder nur so gerade hindurchpassen. Zudem sind die beiden Ösenreihen wohl etwas weiter voneinander entfernt. Ideal wären deshalb Schuhbänder von einem Meter Länge. Nun hoffe ich, dass ich solche im Handel finde.
Gerade und ungerade
Tuesday, 07. February 2012In diesen Tagen brandet eine große Empörungswelle gegen das Urgestein des deutschen Qualitätsjournalismus, Wolf Schneider (86). Der hat die Frechheit besessen, auf seine alten Tage in sein Handbuch ein Kapitel über Online-Journaismus aufgenommen zu haben, das gelinde gesagt nicht die Zustimmung der Blogger findet. Mit einem ekligen Modewort ausgedrückt steht der graumelierte Grandseigneur seither in einem wahren shitstorm von Anwürfen und Beleidigungen, den er in der Würde seiner späten Tage selbst dann nicht verdient hätte, wenn sie allesamt berechtigt wären. – In diesem Zusammenhang stieß ich auf eine interessante Einlassung Schneiders zu der Frage, was denn im Wesentlichen Print- und Online-Journalismus unterscheide. Er sagte in einem Interview des Onlinebranchendienstes Meedia: „Solange wir nur vom Journalismus reden, sind die Unterschiede nicht groß. Womit ich gerade konfrontiert worden bin, ist ja gerade das Gegenteil von Journalismus: ,Mir fällt gerade was ein, und das finde ich unheimlich wichtig.‘ Das könnte eine Zeitung nicht bieten.“ – Und ich finde das gerade unheimlich zitierenswert, weil sich an dieser noblen Herablassung für mich mal wieder die grenzenlose Beschränktheit [!] von Leuten erweist, die zugleich Spezialisten, Profis und erfolgsverwöhnt sind. Damit meine ich den älteren Herrn Schneider ebensosehr wie seine kaum frischeren Kritiker. Wäre es unter vielen unwahrscheinlichen Umständen vielleicht doch möglich, dass es hier und da auf der Welt Leser gibt, die nicht nur an den gut recherchierten, leicht verständlich formulierten Darstellungen der alleraktuellsten Weltereignisse interessiert sind, hektisch vibrierend zwischen Marmeladenbrötchen und Kaffeetasse am Frühstückstisch, entziffernd, begreifend und vergessend im Sekundentakt? Schließlich ist doch der einzig erhabene, nämlich den ja tatsächlich unbezwinglichen Möglichkeiten des Web angemessene Nutzen der Bloggerei die Verbreitung von Blitz und Donnergrollen: in Form von Lyrik, Aphorismen, Bildern und kurzen Essays.
Hohe Decken
Monday, 06. February 2012Wenn ich mir meine verschiedenen Wohnsitze in Erinnerung rufe und dabei mein jeweiliges Körpergefühl nachzuempfinden versuche, dann fällt mir auf, dass insbesondere die Deckenhöhe einen ganz entscheidenden Einfluss auf mein Wohlbefinden, meine Stimmung und mein Selbstbewusstsein hatte. Das meine ich, auch wenn es anders klingen mag, durchaus wertfrei. In den niedrigen Behausungen fühlte ich mich wohl eher wie ein kuschelndes Nagetier oder ein lauerndes Reptil, während ich in den lichten und weiten Räumen dickwandiger Altbauten einherschritt wie ein stolzer Panther oder Pfau. Dieser oder jener Verkörperung den Vorzug zu geben wäre verfehlt, denn jedes Tier hat bekanntlich seine Stärken und Schwächen. Eben sehe ich im Briefwechsel von Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1978) Bilder der beiden Korrespondenten an ihren Schreibtischen. Schon Hofmannsthals mit Wandschmuck und Möbeln überladener grüner Salon in seinem Rodauner Schlössl wirkt zugleich imposant und bedrückend, der Dichter unterm hochdroben an der Stuckdecke baumelnden Kronleuchter (s. Titelbild), an einem großen runden Tisch sitzend und lesend, wirkt auf den ersten Blick eher wie ein leicht eingeschüchterten Pennäler, keinesfalls jedoch wie der dichtende Großbürger, als der er sich selbst gern darstellte und empfand. Erst recht macht die kathedralenartige Gewölbedecke im Arbeitsraum des Hôtel Biron in Paris aus dem traurig und verloren auf einem hohen Lehnstuhl hockenden Rilke ein armes Würstchen. Ich weiß nicht, wie mein hier trotzig hingeworfener Kleinkram aussähe, wenn ich unter solch hohen Decken schreiben müsste. So bin ich froh, zuletzt in einer handtuchschmalen Klause gestrandet zu sein!
Außer Manuel
Saturday, 04. February 2012Etliche Jahre hindurch habe ich unregelmäßig immer mal wieder Reime geschmiedet, häufig zu festlichen Anlässen, aber auch für Widmungen in verschenkten Büchern, zur Belustigung meiner Kinder und sogar zur humorvollen Bereicherung von Reden meiner Arbeitgeber. Immer geschah dies unter einem Pseudonym, womit es eine besondere Bewandtnis hat, welche ich aber vorläufig nicht preisgeben möchte: Conrad Döbling. Neulich las ich in der FAZ (Nr. 240 v. 15. Oktober 2011, S. 36) die freundliche Besprechung eines Kinderbuchs voller schadenfroher Reime nach einem Muster, das auch Döbling zu eigenen Versuchen angeregt hätte. (Martin Schmitz-Kuhl u. Anke Kuhl: Alle Kinder. Leipzig 2011.) Die lustig-makabren Zweizeiler lauten etwa so:
Alle Kinder laufen ins Haus. Außer Fritz –
den trifft der Blitz.
Alle Kinder freuen sich des Lebens. Außer Torben –
der ist gestorben
Alle Kinder stehen am Abgrund. Außer Peter –
der geht noch ’n Meter.
Lang, lang ist es her, dass wir als Kinder diese beißenden Zweizeiler tauschten. Und besonders groß war der Spaß, wenn wir einen leibhaftigen Fritz oder Peter mit „seinem“ Spruch necken konnten. Ich erinnere mich nicht, dass meine Spielgefährten auch auf meinen ja damals eher seltenen Vornamen einen „Alle-Kinder“-Spruch parat gehabt hätten. Aber den kann ja Conrad Döbling jetzt nachtragen:
Alle Kinder fliehen vor dem Löwen. Außer Manuel –
der ist halt nicht so schnell.
Motortode
Thursday, 02. February 2012Kann es sein, dass kreative Menschen häufiger durch Verkehrsunfälle zu Tode kommen als andere? Gerade in der letzten Zeit häufen sich in meiner Wahrnehmung wieder solche Fälle. Vielleicht ist es aber bloß so, dass generell der Tod auf der Straße oder hinterm Steuer öfter vorkommt, als man meint. Bei der Aufnahme meiner zum Verkauf bestimmten Bibliothek-Suhrkamp-Bändchen kommt mir Das Pesthaus unter die Finger, jener schwermütige Roman über Sterben und Tod in einem Sanatorium bei Palermo aus dem Jahr 1981. Am 14. Juni 1996 kam sein Autor, Gesualdo Bufalino, in der Nähe seines Heimatorts Comiso bei einem Autounfall ums Leben. (Es ist übrigens typisch, dass es mir jetzt nicht ohne Umstände gelingen will, die spezielle Art dieses Todes in Erfahrung zu bringen? Wurde Bufalino als Fußgänger zum Opfer eines Automobils – oder saß er selbst am Steuer und hat somit seinen Tod immerhin mitverschuldet? Das ist doch schließlich nicht vollkommen gleichgültig. Denn für mich ist das Automobil immer auch eine tödliche Waffe; und wer es bedient, wird damit jedenfalls leichter zum Mörder oder mindestens zum Totschläger, als jemand, der sich harmlos auf seinen eigenen zwei Beinen durch die Landschaft bewegt.) – Heute sah ich trotz der früher erwähnten Vorbehalte doch einmal wieder einen Spielfilm, Die Ewigkeit und ein Tag von Theodoros Angelopoulos. Er zeigt uns in heute unüblich gewordener Langsamkeit den letzten Tag des an Krebs erkrankten Schriftstellers Alexandros, dargestellt von Bruno Ganz. Es ist der Tag eines großen Abschieds, denn morgen soll Alexandros sich zum Sterben in eine Klinik begeben. Nachdem er bei seiner Tochter und deren unsäglich gefühllosem Mann keinen Schutz gefunden hat, klammert er sich an einen kleinen albanischen Jungen, den er vor Menschenhändlern in Sicherheit bringt, um ihm die Rückkehr in seine Heimat zu ermöglichen. Meist aber zeigt der Film Erinnerungsbilder des Sterbenden an die Menschen, die in seinem Leben wichtig für ihn waren und ihn doch irgendwann im Stich gelassen haben: seine Frau, seine Mutter, seine Freunde. Auch ein großer Hund spielt eine Rolle, als das einzige Lebewesen neben dem Jungen und einer treuen Haushälterin, für das es sich scheinbar gelohnt hat, zu lieben und zu sorgen. Sein letztes Werk, die Übersetzung eines großen Gedichtes, muss unvollendet bleiben. [Nachtrag: Zwei Tage später erfahre ich den Anlass, warum dieser Film von 1998 ins Programm genommen wurde. Am 24. Januar starb Angelopoulos in einem Krankenhaus in Neo Faliro bei Piräus an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Er hatte sich dort bei Dreharbeiten zu seinem Filmprojekt Das andere Meer befunden, als ihn ein Motorradfahrer erfasste.]
Sensibler Blogger
Wednesday, 01. February 2012Mir wird in letzter Zeit klarer als mir vielleicht lieb ist, dass ich bei dieser Art halböffentlichen Schreibens den Gedanken an konkrete Leser als Adressaten meiner Texte niemals ganz ausblenden kann. So entsteht beim Schreiben in meinem Bewusstsein oft ein verwirrendes Gespinst unberechenbarer Wechselwirkungen zwischen vermeintlichen Erwartungen und klammheimlichen Befürchtungen. Im persönlichen Dialog unter vier Augen kann ich meinen Diskurs ja auf mein individuelles Gegenüber abstellen und mich immerhin bemühen, Interessen, Ansichten und Empfindlichkeiten, Intelligenz und Bildung des Gesprächspartners bei allem was ich sage zu berücksichtigen. Im Web hingegen versetzt mich mein Bewusstsein vom freien Zutritt Vertrauter wie Fremder zu meinen tagesaktuellen Lebensäußerungen in eine irritierende Ambivalenz. So treffe ich im ,wirklichen Leben‘ gelegentlich engste Freunde, die sich persönlich zu einzelnen Blogbeiträgen äußern. Manchmal verblüffen sie mich mit Einzelheiten aus meinem realen Leben, von denen ich ihnen noch gar nicht berichtet hatte. Mir war schlicht entfallen, dass ich ja hier im Blog davon erzählt habe! Dann wieder lese ich ältere Artikel und stelle mir vor, wie diese oder jene neuere Bekanntschaft davon beeinflusst werden könnte, wie ich einmal war oder wie ich immerhin einmal zu sein meinte, als ich mich so darstellte. Ist es mir eigentlich recht, dass ich möglicherweise mit einer alten Larve meiner selbst identifiziert werde? Und schließlich stutze ich, wenn völlig fremde Leser unvermittelt ein Posting kommentieren, bei dessen Abfassung ich nur an eine sehr kleine, vertraute Zielgruppe dachte. Vermutlich stehen meine Skrupel, Irritationen und Überempfindlichkeiten in einem lächerlichen Widerspruch zu der conditio sine qua non beim Bloggen, sich preiszugeben. Somit gehöre ich vielleicht zur seltenen Spezies des sensiblen Bloggers, zur paradoxen Gattung eines „gschamigen Exhibitionisten“ im Cyberspace.
Gemeinheit schlechthin
Tuesday, 31. January 2012Noch einmal aus meiner Kraft-Lektüre. In einer Kurzbiographie hatte ich gelesen, dass er als Soldat in jenem Weltkrieg, der noch keine Nummer trug, zu schwach für den Fronteinsatz war und darum in der Nähe seiner Heimatstadt Hannover in den Wahrendorffschen Anstalten als Sanitäter diente. Das war ein „Lazarett für Kriegshysteriker und Kriegsneurotiker“, wobei die staatstragenden Psychiater sich nach Kräften bemühten, erstere von letzteren diagnostisch zu unterscheiden, um die Hysteriker zurück an die Front schicken zu können. In diesem Zusammenhang stolperte ich in Krafts Jugenderinnerungen über folgenden Passus, der die Atmosphäre in der Anstalt beschreiben soll: „[…] die Luft war kaum zu atmen vor Sexualität, auch Homosexualität und Gemeinheit schlechthin, übrigens nicht nur bei den Kranken, sondern auch bei den Krankenwärtern und bei den Krankenschwestern. Das Bild war das einer kranken Gesellschaft im Zustand des Lebenshungers und der moralischen Verwilderung, die als Kriegsnatur eher erwünscht als verboten war.“ (A. a. O, S. 57.) – Das steht da schlicht und schlimm, in einem Atemzug „Homosexualität und Gemeinheit“! Man meint ja, die Schicksalsgemeinschaft von Juden, Homosexuellen, Kommunisten, Zigeunern unter der Herrschaft des Faschismus, wo sie alle miteinander in den gleichen KZs und Vernichtungslagern zusammengepfercht waren, hätte wenigstens die Vorurteile untereinander endlich beseitigen müssen. Aber weit gefehlt!
Schnupperwetter
Monday, 30. January 2012Ein verbreitetes Kennzeichen des Genies ist, nach vielen kleinen Anekdoten in den Biographien genialer Menschen zu urteilen, die hartnäckige Hinterfragung von scheinbaren Selbstverständlichkeiten des alltäglichen Lebens. Die normalsterblichen Durchschnittsdenker geben sich damit zufrieden, dass etwas so ist wie es ist, weil es ja schließlich immer schon so war und weil es ihnen übrigens auch ganz egal ist, denn nichts würde sich scheinbar für sie ändern, wenn es anders wäre. In einer kleinen Serie will ich solche Beobachtungen unerklärlicher Phänomene hier beschreiben – nicht etwa, weil ich mich für ein Genie hielte, sondern allenfalls in der Hoffnung, dass das eine oder andere Genie unter meinen zukünftigen Lesern hierdurch vielleicht einen Gedankenanstoß erhalten könnte für eine geniale Entdeckung oder Erfindung. Heute teile ich meine Beobachtung mit, dass Lola bei Neuschnee wesentlich intensiver am Boden rumschnüffelt als gewöhnlich [s. Titelbild]. Dies erstaunt mich insofern, als ich doch immer davon ausgegangen bin, dass Kälte die Gerüche eher dämpft, in der Hitze des Sommers hingegen vielerlei zu faulen und zu stinken beginnt. Zudem hätte ich gedacht, dass die Schneedecke selbst, die ja schließlich aus nahezu geruchsfreiem Wasser besteht, etwaige Geruchsquellen abschließt und insofern für eine Hundenase eher unattraktiv ist. Doch tatsächlich scheint das genaue Gegenteil der Fall zu sein. Man komme mir nun nicht mit der Idee, Lola stupse ihre Nase bloß ins kalte Weiß, weil sie die Abkühlung so sehr schätze. Ich bin ganz nahe rangegangen und konnte eindeutig hören, dass sie schnuppert! – Nun bin sehr gespannt, ob in den nächsten Jahrzehnten irgendein Genie eine plausible Erklärung hierfür hat.
Gift oder Gas?
Saturday, 28. January 2012Ausmusterung der Reihe Bibliothek Suhrkamp fürs Antiquariat. Die fadengehefteten Pappbände im farbigen Umschlag mit andersfarbigem Strich erschienen seit 1951, brachten es bis 1989 auf tausend Nummern und erscheinen noch heute und sind jetzt bei Nummer 1469 angekommen. Die Umschlaggestaltung lag seit 1959 bei Willy Fleckhaus. (Erst jetzt fällt mir auf, dass der vertikale Strich stets schwarz oder weiß ist, einzig wenn der Umschalg weiß ist, das der Strich farbig sein.) Von den rund hundert Bänden in meiner Sammlung werde ich drei Viertel abgeben – und selbst den kleineren Rest muss ich noch einmal gründlich durchsehen. Ein Buch, in dem ich seit gestern abends immer ein paar Seiten lese, ist Werner Krafts Spiegelung der Jugend, eine Erstausgabe von 1973. Diese Erinnerungen habe ich nach der Anschaffung des Buches vor dreißig Jahren schon einmal angelesen, allerdings wohl nur etwa bis Seite 68, denn da befindet sich die letzte meiner akkuraten Bleistiftunterstreichungen. Ein Passus, den ich nicht unterstrich, erscheint mir heute bemerkenswert. Kraft porträtiert eine Schwester seiner Großmutter, die in Celle wohnte und einmal besucht wurde. Was mag aus der jüdischen Frau geworden sein? „Sie hat 1933 noch gelebt, und ich hoffe, daß sie energisch genug war, dem schrecklicheren Tode als dem schrecklichen durch Gift zuvorzukommen.“ (Werner Kraft: Spiegelung der Jugend. Frankfurt am Main. Suhrkamp Verlag, 1973, S. 33.) Was ist das für eine Welt, in der der Hoffnung nurmehr die Wahl zwischen einem schrecklichen und einem schrecklicheren Geschick bleibt und eine liebe Großtante spurlos aus einem freundlichen Häuschen in Celle ins Nichts wechselt?
Geplante Obsoleszenz
Friday, 27. January 2012Bei Arte+7 ist seit Dienstag eine kritische Dokumentation über die Verschwendungssucht in den hochentwickelten Industrienationen abrufbar, Kaufen für die Müllhalde. Der französische Film von Cosima Dannoritzer (2010) erzählt, wie die „geplante Obsoleszenz“, also die künstlich in der Produktherstellung angelegte verkürzte Haltbarkeit Mitte der 1920er Jahren zuerst von einem weltweiten Kartell namens Phöbus bei den Glühbirnen durchgesetzt wurde, um den Absatz anzukurbeln, damit die Wirtschaft zu stärken und so bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Auch Helmut Höge hat einen kleinen Auftritt, der mysteriöse Macher des von mir einst so geschätzten Magazins Neues Lotes Folum. Er war (unter dem Pseudonym Helke Schwan) Verfasser des legendären Aufsatzes The Glühbirnen Fake, den ich aus Jörg Schröders Mammut-Antholgie kannte und der mir ein Licht aufsteckte. Und auch die älteste Glühbirne der Welt in Livermore kommt natürlich zu ihrem Recht. Ein weiteres Highlight ist die Geschichte von Markos, dessen Tintenstrahldrucker den Geist aufgibt und der sich nicht damit abfinden will, dass niemand das Gerät in Reparatur nehmen will, weil ein neues doch viel günstiger sei als die Wiederherstellung des alten. Er findet nach langen vergeblichen Irrwegen schließlich heraus, dass ein kleiner Chip im Drucker nach Erreichen einer bestimmten Anzahl von Druckvorgängen das Gerät automatisch blockiert, obwohl es sonst noch absolut funktionstüchtig ist. Ein russischer Hacker übermittelt ihm dann einen kleinen Code, mit dem er den Chip überlisten und die Druckfunktion wieder in Gang setzen kann. Die US-amerikanische Maschinenstürmerin Nicols Fox kommt zu Wort, die ihr Buch über die Ludditen noch auf einer mechanischen Schreibmaschine verfasst hat. Und auf der anderen Seite wird der Erfinder der geplanten Obsoleszenz, Bernard London, in Erinnerung gerufen, der 1933 im ersten Kapitel seines Buches The New Prosperity versprach: „Ending the Depression Through Planned Obsolescence“. Allerdings konnte er sich mit seinem Konzept einer staatlich verordneten Verfallsfrist für alle Handelsgüter nicht durchsetzen, obwohl die Produzenten etwa von Nylonstrümpfen, Küchengeräten und vielen anderen Dingen des täglichen Gebrauch sehr bald Ingenieure damit beauftragten, künstliche Verschleißfaktoren in die Produkte einzubauen. Dieser Effekt kommt zum Beispiel in Arthur Millers Theaterstück Death of a Salesman (1949) vor, aber auch in dem Film The Man in the White Suit (1951), in dem Alec Guinness einen Chemiker spielt, der einen schmutzabweisenden und reißfesten Anzugstoff erfunden hat und dafür keinen Ruhm erntet, sondern die Kleiderfabrikanten und selbst die Arbeiter in den Fabriken gegen sich hat. Die einen bangen um ihren Absatz, die anderen um ihren Job. Auch der vergessene Bestseller-Autor Vance Packard wird bemüht, der nach seinem legendären Buch über die Werbewirtschaft (The Hidden Persuaders) bereits 1961 mit The Waste Makers jene große Verschwendung anprangerte, die damals erst in ihren bescheidenen Anfängen steckte. Der Film endet in Ghana, auf der Müllhalde von Agbogbloshie, wo hustende Jungen das Kupfer aus den Comuterkabeln herausschmelzen. Er zeigt die riesigen Containerschiffe, die hier mit dem Elektromüll aus halb Europa anlanden. Der Import von Müll ist verboten, aber die Zollkontrollen werden ausgetrickst, indem die Container vorn mit halbwegs tauglichen Geräten beladen werden, während die 90 Prozent Schrott sich dahinter verbergen. Vorgestellt wird schließlich Mike Anane, der die Inventaraufkleber von den Monitoren, Tastaturen und PC-Gehäusen ablöst und einscannt, um die Herkunftsorte und -firmen namhaft zu machen, die sich ihres Mülls auf diese schändliche Weise entledigen. Aber leider – und hier muss ich den ansonsten sehr lehrreichen Film kritisieren – erfahren wir nicht, welche Erfolgsaussichten die Recherchen von Anane haben. Ich werde gelegentlich versuchen, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen.
Bitte nicht lachen
Thursday, 26. January 2012Gerade lese ich ein paar Absätze in Roland Barthes’ Die Lust am Text. An einer Stelle ergeht er sich, der Vielbelesene, wie er in einem von Stendhal vermittelten Text „ein winziges Detail Proust“ wiederentdeckt und sich daraufhin an eine ähnliche Passage bei Flaubert erinnert. Er spricht von „zirkularer Erinnerung“, insofern das große Werk von Marcel Proust sein zentraler Bezugspunkt ist, wie es die Briefe der Madame de Sévigné für seine Großmutter gewesen seien oder für Don Quijote die Ritterromane. Das klingt mir vertraut, es besteht kein Zweifel, hier spricht ein Hirntier und Bücherfresser vor dem Herrn glaubwürdig von den Assoziationskaskaden, die ihm jede lustvolle Lektüre verursacht. – Aber dann? Lässt Barthes unvermittelt seinen Gedanken in einer Generalisierung gipfeln, die mir völlig unsinnig erscheint: „Und eben das ist der Inter-Text: die Unmöglichkeit, außerhalb des unendlichen Textes zu leben – ob dieser Text nun Proust oder die Tageszeitung oder der Fernsehschirm ist: das Buch macht den Sinn, der Sinn macht das Leben.“ (Roland Barthes: Die Lust am Text. A. d. Frz. v. Traugott König. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974, S. 53 f.) Aber was ist das für eine plumpe Gleichmacherei? Es ist die Ignoranz des Intellektuellen vor den Quantensprüngen der technischen Entwicklung. Sein Unfalltod kommt mir insofern vor wie die gesuchte Pointe zu einem traurigen Witz.
Durst
Tuesday, 24. January 2012Ich werde mich systematisch mit der Frage beschäftigen, was das Leben kostet. Gleich nach dem Atmen, das vorläufig noch kostenlos zu haben ist, drängt das Verlangen nach Flüssigkeit täglich danach, gestillt zu werden. Die billigste Variante wäre zweifellos ,Kraneberger‘, das kühle Nass aus der Wand. Man sagt ja, der Mensch solle täglich zwei Liter trinken. Demnach betrüge mein Jahresbedarf 730 Liter. Ein Kubikmeter Wasser kostet bei den Stadtwerken Essen aktuell 1,88 Euro. Somit müsste ich gerade einmal 1,38 Euro aufwenden, um meinen Flüssigkeitsbedarf für ein ganzes Jahr zu decken! Das hiesige Wasser stammt aus der Ruhr, einem der saubersten Flüsse Europas. Zudem wird es in Aufbereitungsanlagen gereinigt, geflockt und filtriert und abschließend noch auf biologisch wirksame Langsamsandfilter geleitet. Anschließend ist es jedenfalls gesundheitlich absolut verträglich. Ob es dem Verbraucher im Naturzustand mundet, steht freilich auf einem anderen Blatt. Viele Wassertrinker versorgen sich jedenfalls mit Mineralwasser in der Flasche. Auch ich trank bisher ein solches Wasser, das ich mir kastenweise bei einem fußläufig erreichbaren Getränkemarkt besorgte. Den über 20 Kilo schweren Kasten transportierte ich auf dem Fahrgestell unseres Handeinkaufswagens, denn bekanntlich verzichte ich auf ein motorisiertes Kraftfahrzeug. Dieser Einkauf dauert mit Hin- und Rückweg selten länger als zehn Minuten. Der Kasten à zwölf Flaschen der Marke meiner Wahl kostete bisher ohne Pfand 3,33 Euro, das entspricht knapp 0,40 Euro pro Liter. Mein Lieblingswasser kommt ganz aus der Nähe, was mir wichtig war, denn ich habe als umweltbewusster Konsument natürlich auch den Transportaufwand von der Quelle bis zur Mündung in meinen Mund im Blick. Wenn ich meinen empfohlenen Flüssigkeitsbedarf ausschließlich mit diesem Mineralwasser decken würde, müsste ich dafür somit 290 Euro pro Jahr aufbringen, das entspricht dem 210-fachen Preis des Kranwassers! Ich war schon halb auf dem Weg mir zu überlegen, ob ich mir nicht durch billige Geschmackszusätze das Leitungswasser appetitlicher machen könnte, da brachte mich eine weitere Verteuerung des Mineralwassers aus der Fassung. Der nahe gelegene Getränkemarkt hatte plötzlich geschlossen, wurde umgebaut und unter neuer Leitung neu eröffnet. Nun kostet der gleich Kasten statt 3,33 Euro stolze 3,69 Euro, das entspricht einer Preissteigerung um über zehn Prozent. Jetzt reicht’s! Ich muss Mittel und Wege finden, um aus dem konkurrenzlos billigen Leitungswasser mit geringstmöglichem Aufwand an Zeit und Geld ein Getränk herzustellen, das gesund ist und mir schmeckt.
Nekro-Exhibitionismus
Saturday, 21. January 2012Die neuen Mittel der öffentlichen Selbstdarstellung via Weblog, YouTube, Twitter, XING, MySpace, Facebook usw. haben nicht zuletzt auch neue Möglichkeiten der unfreiwilligen Selbstbeschädigung herbeigeführt, Versuchungen zur unbedachten Autodestruktion bereitgestellt, Lockmittel ausgestreut zur leichtfertigen Präsentation nicht nur geheimer Gedanken und intimer Körperzonen, sondern auch zur Preisgabe privatester Erlebnisse, wie Geburt, Krankheit, Sterben und Tod. Eine deprimierende ärztliche Diagnose wie Krebs, Depression, Parkinson oder Aids überfordert oft nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch deren Angehörige und Freunde. Die Angst vor nötigen klinischen Untersuchungen und Eingriffen, vor dauerhaften körperlichen Beeinträchtigungen und Schmerzen belastet den Kranken umso mehr, als er erfahren muss, dass die Anteilnehme in seinem sozialen Umfeld bald ihre natürliche Grenze findet. Für die Gesunden geht das Leben mit seinem Ernst und seinem Spaß schließlich weiter bie bisher. Schon aus einem verständlichen Bedürfnis nach emotionaler Immunisierung gegen das dramatische Geschehen der schweren, möglicherweise todbringenden Krankheit meiden sie allzu intensive Begegnungen. Vom Kranken, gar Todgeweihten geht ein Sog in den Abgrund aus. Er „zieht runter“, wie man ganz unverblümt bekennt. In dieser Einsamkeit des Leidenden bieten sich die Social-Media-Plattformen im Internet an für ein offenherziges Bekenntnis zum eigenen Elend, für die Suche nach Gesprächspartnern, ob Leidensgefährten oder bloß Anteilnehmenden, ob im Schutze der Anonymität oder unter vollem Namen. Im Extremfall führt dies zu einer hochdramatischen Vorführung des eigenen Sterbens in Echtzeit und damit zu einem Exhibitionismus – bzw., je nach Perspektive, Voyeurismus – des Todes, wie er in dieser Direktheit noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre. An dieser Stelle will ich auf das neue Phänomen bloß aufmerksam machen, ohne noch darüber reflektiert zu haben, was aus ihm für den Umgang mit Krankheit und Tod in unserer Gesellschaft folgt. Ich halte dies insbesondere deshalb für ein relevantes Thema in meinem eigenen Blog, weil ich unlängst ebenfalls von einer bösen Überraschung heimgesucht wurde und weil ich zudem sehe, dass sich auch sehr besonnene und gebildete Autoren mit ihrem Leid in die Öffentlichkeit des Web begeben.
Sonderbehandlung
Friday, 20. January 2012Am 8. Januar 1942 sandte der Chef der Sicherheitspolizei und des SD Reinhard Heydrich aus Prag eine Einladung an seinen Parteigenossen, den Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt Martin Luther, und dreizehn weitere Herren eine Einladung zu einem Treffen in der Reichshauptstadt. Dort solle am 20. Januar, heute vor 70 Jahren, in einer Villa am Großen Wannsee eine „Besprechung mit anschließendem Frühstück“ stattfinden. Der Teilnehmer mit dem Namen des Reformators geriet später auf Abwege, als er sich an einem Putschversuch gegen seinen Vorgesetzten, den Reichsminister des Auswärtigen Joachim Rippentropp beteiligte und nach seiner Enttarnung als privilegierter Häftling im KZ Sachsenhausen landete. Nur diesem Umstand ist zu danken, dass das Besprechungsprotokoll der Wannsee-Konferenz, auf der die Ermordung aller 11.000.000 Juden in Europa beschlossen wurde, auf uns gekommen ist, da das Aktenmaterial aus Luthers Büro zur Vorbereitung des Hochverratsprozesses gegen ihn in Berlin-Lichterfelde ausgelagert worden war. Allerdings kommen selbst in diesem hochgeheimen Dokument eindeutige Begriffe wie „Tötung“, „Vernichtung“ oder „Auslöschung“ nicht vor. Die entscheidende Passage lautet so: „Unter entsprechender Leitung sollen nun im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen, unter Trennung der Geschlechter, werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist. (Siehe die Erfahrung der Geschichte.)“ (Besprechungsprotokoll der sog. Wannsee-Konferenz, S. 7/8; Hervorhebung von mir.) Autor dieses in seinen Folgen vielleicht schrecklichsten Textes der bisherigen Geschichte unserer Spezies war als Protokollführer übrigens der Bürokrat Adolf Eichmann. Wir kennen den Tonfall des seelenlosen Verwaltungsfachmanns und Logistikers aus seinen Verteidigungsreden, als ihm 18 Jahre später in Jerusalem der Prozess gemacht wurde. Die deutsche Sprache hat spätestens mit Sätzen wie diesen ihre Unschuld verloren. Einen weiteren muss ich noch zitieren: „Der Wunsch des Reichsmarschalls [Hermann Göring], ihm einen Entwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Belange im Hinblick auf die Endlösung der europäischen Judenfrage zu übersenden, erfordert die vorherige gemeinsame Behandlung aller an diesen Fragen unmittelbar beteiligten Zentralinstanzen im Hinblick auf die Parallelisierung der Linienführung.“ (Besprechungsprotokoll der sog. Wannsee-Konferenz, S. 2; Hervorhebung von mir.) Der tarnende Begriff des Behandelns bzw. der Behandlung wird also offenbar unterschiedslos auf den Todfeind und die höchsten Instanzen des Reiches angewandt, wenn es darum geht, den eigentlichen, für die Behandelten unangenehmen Charakter dieser „Behandlung“ zu verbrämen. Im ersten Falle besteht die „Behandlung“ darin, die Juden unter möglichst gefahrvollen und strapaziösen Bedingungen im Straßenbau einzusetzen, damit ein großer Teil von ihnen dabei vor Entkräftung oder durch Krankheiten stirbt, um dann die übriggebliebenen Menschen mit Vernichtungsmitteln (Zyklon B) zu ermorden; während „Behandlung“ im zweiten Fall bedeutet, die Vorgesetzten der zuständigen Parteidienststellen und Reichsbehörden und ihr Personal seelisch-moralisch auf diesen staatlich angeordneten Massenmord einzustimmen. – Was Karl Kraus schon lange zuvor in aller Schärfe erkannt hatte, wurde hier traurige Realität und droht für alle Zukunft, sich zu wiederholen: Die schrecklichsten Taten tarnen sich hinter floskelhaften Euphemismen; wenn jene erst leicht über die Lippen kommen, dann gehen diese umso leichter von der Hand.
Blackout against SOPA!
Wednesday, 18. January 2012Der Revierflaneur schließt sich heute den weltweiten Protesten gegen den US-amerikanischen Gesetzentwurf SOPA an. Urheberrechte müssen auch im Internet geschützt bleiben, keine Frage. Aber die neuesten Bestrebungen in den USA gehen hierüber hinaus und lassen befürchten, dass die freieste Kommunikationsplattform der Welt künftig zunehmend von Zesurmaßnahmen beschnitten werden kann. Dies darf nicht wahr werden!
Deutschland, hilf!
Sunday, 15. January 2012Man darf niemals aufgeben. „Ich habe soeben erstmals den Namen Ihrer Hilfsorganisation gelesen (auf einem Werbeplakat an einer Straßenbahnhaltestelle in Essen). Sehr stört mich daran, dass in Ihrem Namen ein Rechtschreibfehler unterlaufen ist. Das Wort ,helfen‘ ist ein Verb und muss darum kleingeschrieben werden, außer am Anfang des Satzes. Es heißt also richtig: ,Aktion Deutschland hilft‘. Wie erklären Sie diesen Fehler, durch den vor allem Kindern und Deutsch lernenden Ausländern ein schlechtes Vorbild gegeben wird, bei einer solch renommierten und wirkungsvollen Organisation? Ich bin gespannt auf Ihre Antwort und würde mich freuen, wenn Sie meine Anregung aufgreifen und den falsch geschriebenen Namen bald korrigieren würden.“ (Anfrage per Online-Formular abgeschickt am heutigen Tage um 19:00 Uhr.)
Rote Giftquallen
Saturday, 14. January 2012(Bild wegen ungeklärter Rechte entfernt)
Zum Babysitting bei der Tochter. Wir schauen nach langer, langer Zeit mal wieder „Glotze pur“, also nicht in konservierter Form ausgewählte Edelkulturstreifen bei ARTE+7, sondern einmal die Programme rauf und runter in Echtzeit. Unkulturschock! Völlige Desorientierung. Taste 1 ARD: Wir stolpern in eine Verfolgungsjagd mit wilden Schusswechseln, deren Ergebnis dank schneller Schnittwechsel jeweils ungewiss bleibt. Sind die Gliedmaßen der bösen Häscher nun zerfetzt worden, oder waren das bloß Streifschüsse? Der Held kommt mir von irgendwo bekannt vor und ich frage meine Gefährtin: „Ist das nicht James Bond?“ Nachträglich lese ich in der Programmankündigung der SZ: Es war James Bond, aber eine spätere Folge, mit Pierce Brosnan, um genau zu sein von 1999, also aus einer Zeit, als ich aus dem Alter längst raus war, dem Betrachten solcher Filme wenigstens noch einen ironischen Genuss abgewinnen zu können. Zielgruppe: kleine und große Jungs. – Taste 2 ZDF: Auch hier ein Film aus dem Genre Verbechensverfolgung, aber diesmal deutsche Hausmannskost. Da menschelt es gewaltig. Die altersweise Schwiegermutter, Typ Inge Meysel, nur intelligenter, übt sich am Küchentisch als Seelentrösterin für ein ungewollt schwanger gewordenes Nervenbündel, das dann das Kind verloren hat und nun auch noch den Beinahevater einzubüßen droht. Tränenreiche Bekenntnisse. Zielgruppe junge Mädchen und Omas. – Taste 3 RTL: Hier erinnere ich mich nur an eine unsägliche Alberei auf einer Bühne, aber der Eindruck war zu kurz, denn meine Gefährtin forderte unmissverständlich: „Mach das weg! Das ist ja schrecklich!“ Jetzt lese ich, dass es sich um „eine Auswahl der besten, aber auch schrägsten Auftritte“ aus der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ handelte. Ich wusste immer nicht, was das eigentlich ist. Jetzt ahne ich es immerhin. Zielgruppe: Peinlichkeitsliebhaber. – Taste 4 SAT 1: Ein Besuch im Krankenhaus. Das dickliche Opfer liegt mit Beatmungsschläuchen hilflos auf der Intensivstation, der böse Doktor am Fußende verweigert ihm die Behandlung mit dem rettenden Antidot gegen einen absolut tödlichen Virus, der in wenigen Stunden den keuchenden Dicken dahinraffen wird. Die Zeit läuft! „Mission Impossible II“. Zielgruppe: Masochisten und SciFi-Fans. – Taste 5 Pro Sieben: Hier haben wir mal Glück und stolpern nicht mitten hinein in den Schlamassel, sondern bekommen ihn von Anfang an mit. Es heißt „Shopping-Center King – Hier gilt mein Gesetz“ und läuft unter Komödie, soll uns also zum Lachen bringen. Nachdem ich mir zehn Minuten lang vorgestellt habe, welch Geistes Kind die Menschen sein müssen, die über diesen Klamauk von der allerbilligsten Sorte lachen können, war ich sehr traurig und hätte am liebsten das Experiment ganz abgebrochen. Zielgruppe: Naive, Debile und Betrunkene. – Taste 6 Vox: Nun sehen wir kämpfende Männer aus offenbar ferner Vergangenheit. Sie schleichen mit Pfeil und Bogen durch den dunklen Forst. Einer legt auf eine Hirschkuh an und ich beginne zu fürchten, dass für diesen Film ein unschuldiges Tier dran glauben musste, aber nach einem blitzschnellen Durcheinander bleibt gottlob nur einer der Recken auf der Strecke. Dann geht ’s hinaus aufs offene Feld, wo sich zwei ungleich bewaffnete Heere gegenüberstehen. Der Aufwand an Statisten, Pferden und Kostümen nötigt uns Bewunderung ab, die traurige Schlichtheit der Dialoge macht diesen Eindruck leider bald wieder zunichte. Wir sahen einen Ausschnitt aus „Braveheart“. Zielgruppe: historisch interessierte Melancholiker. – Taste 7 Arte: Womit wir also doch wieder bei „unserem“ Sender wären. Hier tauchen wir in die Tiefsee und erfahren in hektischer Schnittfolge tausenderlei über Eisbären, Wale, Eiszeiten, Warmzeiten, Bohrkerne, Expeditionen, Fischfang, Thunfisch, rote Giftquallen, globale Erwärmung usw. Vorgetragen wird dies von Bestseller-Autor Frank Schätzing (Der Schwarm), der mittels beeindruckender Trickanimation raketenartig durch die Lüfte fliegt. Fazit der dreiteiligen Lehrsendung „Universum der Ozeane – Geheimnisse der Tiefsee“: Der Mensch versündigt sich auf vielfache Weise an der Natur, aber auf ebenso vielfache Weise ersinnt er stets neue Möglichkeiten der Schadensbegrenzung. Und überhaupt muss man angesichts von Jahrmillionen Evolution in größeren Zeiträumen denken. Zielgruppe: Der beunruhigte Intellektuelle, der als Betthupferl ein buntes Trostpflästerchen benötigt. Unser Resümee dieses aufschlussreichen Fernsehabends: Uns entgeht hier nichts! Und insofern ist es eine Unverschämtheit, wenn wir ab 2013 gezwungen werden, die volle GEZ-Gebühr zu entrichten, obwohl wir nach wie vor auf das TV-Programm dankend verzichten wollen und uns auch fürderhin kein Bildfunkgerät zulegen werden.
Wie wirkt yakoana?
Thursday, 12. January 2012Besichtigung der atemberaubenden Ausstellung über die Yanomami im Museum Folkwang. Der Beuys-Schüler Lothar Baumgarten hat diesen südamerikanischen Indianerstamm 1978/79 besucht und anderthalb Jahre mit den „Señores Naturales“ gelebt, hat an ihren Ritualen und an ihrem Alltag teilgenommen, ist mit ihnen auf die Jagd gegangen, hat sie fotografiert, ihre Gesänge und Gespräche aufgenommen und im Tausch ihre Pfeilspitzen, Schnupfrohre, Körbe und Hängematten erworben. Er hat sie auch animiert, mit Wasserfarbe und Pinsel auf Papier zu malen, eine Anregung, die sie offensichtlich mit großer Begeisterung und Ausdauer angenommen haben, wobei ihre Bilder nahezu ausnahmslos ungegenständlich geblieben sind. Unser Freund Jürgen Lechtreck, der die Ausstellung als Projektleiter kuratiert hat, führt uns durch die neun mit großer Liebe und Sorgfalt eingerichteten Räume im Untergeschoss des Museums und gewährt dabei interessante Einblicke in die Zusammenarbeit mit dem Künstler, erläutert die technischen Herausforderungen der Präsentation und vermittelt ein Gefühl für die nötige Rücksichtnahme auf den empfindlichen Zauber dieser uralten Kultur an der Grenze zum Verschwinden. Ein Gefühl der Trauer stellt sich bei mir ein, auch der Scheu, wie beim unbefugten Zutritt zu einem fremden Heiligtum. Wenn ich die in ihren Riten begeisterten Gesichter dieser so ganz ungezwungen wirkenden Menschen auf den Fotos betrachte, dann beneide ich sie einerseits, wie ich vielleicht Kinder beneide, die den „Ernst des Lebens“ noch nicht erfahren haben und sich ganz hemmungslos ihrem Spiel hingeben können. Andererseits schäme ich mich, mein Selbstverständnis zivilisierter Überlegenheit dabei nicht ablegen zu können, den mitleidigen Blick auf die Dürftigkeit und Grobheit der Verhältnisse. – Wenn ich irgend die Zeit und Kraft dazu finde, werde ich noch einmal allein wiederkommen, um diesen Gefühlen auf den Grund gehen zu können.
[Die Ausstellung im Museum Folkwang „Lothar Baumgarten: Abend der Zeit – Señores Naturales Yanomami“ ist noch bis zum 27. Mai 2012 geöffnet.]
Spiraltraum
Wednesday, 11. January 2012Mein Ältester erzählt mir beiläufig von einem Dokumentarfilm über einen nie zu Ende gedrehten Spielfilm des französischen Regisseurs Henri-George Clouzot. Ich hätte ja immer nur von Lohn der Angst geschwärmt. Gern hätte ich widersprochen, denn ich erinnerte mich gut, dass es noch einen zweiten Film von Clouzot gab, den ich damals annehmbar fand. Aber wieder einmal macht mir, wie in den letzten Jahren immer öfter, mein schwächer werdendes Langzeitgedächtnis einen Strich durch die Rechnung. Ich komme nicht auf den Titel dieses Films. Aber eigentlich geht es ja auch nicht um diesen vergessenen Film, sondern um den Fragment gebliebenen Film, dessen Titel mein Sohn wohl auch genannt hat, aber kurz darauf habe ich auch diesen Titel vergessen. Wie kamen wir überhaupt auf Clouzot? Ach ja, das fällt mir wieder ein. Ich hatte die Geschichte von Romy Schneider und Harry Meyen erzählt, von der Nephrektomie rechtsseitig bei Romy und dem Suicid am Seidenschal nach langjährigem Optalidon-Abusus bei Harry, was mir gleichzeitig als unsägliches Kauderwelsch vorkam, Gefasele eines unter Beziehungswahn leidenden Irrgängers. Es entstand eine peinliche Pause, denn meine Geschichte führte ins Nichts. Daraus rette mich mein Sohn, indem er von Clouzots unvollendetem Meisterwerk sprach, worin Romy Schneider die weibliche Hauptrolle spielte. Das war die Brücke zu L’Enfer. Denn so hieß der Film, das habe ich jetzt nachgeschlagen. Falsch verstanden hatte ich, dass der Regisseur über den Dreharbeiten einem Herzinfarkt erlegen sei. So war es nicht. Allerdings mussten die Arbeiten wegen Clouzots Infarkt abgebrochen werden, doch überlebte der Meister und drehte anschließend noch zwei weitere, weniger bedeutende Filme. Mein Sohn wusste wohl davon, weil vor drei Jahren ein Dokumentarfilm L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot herauskam, der begeisterten Zuspruch fand. Einen kleinen Ausschnitt habe ich eben gesehen. Er zeigt Romys Gesicht, rauchend, verführerisch lächelnd, zeigt sie Wasser aus einer unerschöpflichen Flasche in ein Glas füllend – und schließlich mit einer Spirale spielend, die unmittelbar eine starke Erinnerung in mir wachrief. Genau eine solche Spirale hat mein bester Freund vor wohl 45 Jahren aus den Ferien mitgebracht. Er konnte sie Treppenstufen „hinunterlaufen“ lassen, ein wunderbarer Effekt, ein beneidenswertes Objekt! Im Film von 1964 kriecht die gleiche Spirale über Romy Schneiders in verführerische Dessous gehüllten, in blaues Licht getauchten Körper. (Und jetzt weiß ich auch wieder, wie der zweite Film von Clouzot hieß, den ich mochte. Das waren Die Teuflischen, nach dem Roman von Boileau-Narcejac, den ich ebenfalls gelesen habe.) – So vergeblich, so albern, so kränkend diese kleinen Scharmützel im Kampf gegen das Vergessen sein mögen, es käme einer Generalkapitulation gleich, wenn ich mich ihnen nicht mehr stellen wollte.
Straßenbilder
Tuesday, 10. January 2012Schon seit einem guten Jahr trage ich mich mit dem Plan, eine Reihe von langen Straßen meiner Vaterstadt von einem Ende bis zum andern abzuschreiten und dabei zu fotografieren, mit dem Ziel, ein insofern lückenloses Bild der jeweiligen Straße entstehen zu lassen, als im Mittelpunkt jeder Fotografie der Standpunkt der auf sie folgenden zu sehen ist. Ich war auf diesen Gedanken nach unserem letzten Umzug gekommen, denn nun wohnen wir am Ende bzw. Anfang einer der längsten Straßen Essens, der Rellinghauser Straße; und gleichzeitig, wie schon bei unserem vorletzten Wohnort, am Rande einer weiteren sehr langen Straße, der Frankenstraße. Ein günstiger Zeitpunkt für die Realisation dieses Projekts wäre sicher der frühe Morgen rund um die Sommersonnenwende am 21. Juni, denn dann muss man auf Passanten kaum Rücksicht nehmen, deren Missfallen es vielleicht erregen könnte, in der Öffentlichkeit fotografiert zu werden. Ein weiteres Problem stellt sich mit den Autos, deren Nummerschilder ins Bild kommen könnten, was ebenfalls auf einen Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte hinausliefe. Notfalls müssten die Autonummern per Bildbearbeitung unkenntlich gemacht werden. Ich denke noch darüber nach, ob es vielleicht reizvoll wäre, jede dieser langen Straßen in beide Richtungen abzuschreiten, denn so ergäbe sich ja ein jeweils völlig anderer Eindruck. Die einzelnen Bilder würde ich hier im Blog veröffentlichen und meine Erinnerungen zu den verschiedenen Standorten zu „Bildunterschriften“ verarbeiten. Möglicherweise könnte ich die Aufnahme der Straßenbilder auch alle zehn Jahre wiederholen, um die Veränderungen zu registrieren.
[Das Titelbild zeigt das Ende der Rellinghauser Straße mit der Einmündung in die Frankenstraße am heutigen Tag um 12:00 Uhr.]
Zufall: Rumgetalpe
Saturday, 07. January 2012Durchsicht aller online verfügbaren Rezensionen von Wolfgang Herrndorfs Sand. Durchwegs urteilen die Kritiker wohlwollend bis überschwänglich, kein einziger Verriss tanzt aus der Reihe. Das ist insofern erstaunlich, als sie sich andererseits darin einig sind, aus dem Buch nicht recht schlau geworden zu sein. Sie geben zu, verwirrt zu sein, den Überblick verloren zu haben, sich getäuscht und hintergangen vorzukommen – aber sie nehmen das nicht etwa übel, sondern applaudieren dieser Vertracktheit und irritierenden Unübersichtlichkeit noch. Als langjähriger Zufallsforscher kann mich nicht überraschen, dass dieses vielfach missbrauchte Wörtchen auch hier dran glauben muss, um dem Chaos einen Dreh ins glücklich Gewollte und damit Gelungene zu geben. Den Anfang machte Friedmar Apel: „Da die Wahrheit so unwahrscheinlich klingt, erfindet er [der Protagonist des Romans, Carl genannt] wahrscheinlichere Aussagen, aber der Zufall will ihm nicht zu Hilfe kommen. Dabei könnte das Ganze als eine Verkettung von dummen Zufällen erscheinen. […] Die Ereignisse und Gewalttaten scheinen jeweils keinen oder einen falschen Grund zu haben. Das Leben ist auch ein Fehlerspiel von Zufällen, aber da nennt man es Schicksal.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 11. November 2011.) – Und so geht es munter weiter. Dirk Knipphals: „Jedenfalls spielt der Zufall, der in diesem sinnlosen Kosmos und dieser transzendentalen Obdachlosigkeit, in der wir nun einmal leben, herrscht, die alles überragende Rolle.“ (taz v. 15. November 2011.) – Andrea Hanna Hünniger: „Es ist, als wollte er [der Autor] sagen: Jede Handlung ist nur eine Folge von Missverständnissen. Jede Begegnung eine Folge von Zufällen. Und jedes Urteil eine Folge von inkompetenten Richtern. […] Alles, was er [Carl] vor seiner Gefangenschaft tut, geht schief, obwohl sich nicht genau sagen lässt, ob er selbst einen Fehler gemacht hat. Eher sind es die Zufälle, die alles kompliziert machen. Sie sind es, die dafür sorgen, dass ihm der Mikrofilm in die Hände fällt und im Moment des Fast-Erlöstseins wieder verloren geht.“ (ZEIT v. 22. November 2011.) – Luise Boege: „In Sand wird zunächst sehr viel durch Zufall hineingeraten und herumgetalpt […].“ (der Freitag v. 5. Dezember 2011.) Wie die Rezensenten habe ich das Buch mit großen Erwartungen zur Hand genommen. Wie sie empfand ich für den Autor nach Tschick und mehr noch nach intensiver Lektüre seines Blogs Arbeit und Struktur Sympathie und Achtung. Nachdem ich zwei Wochen Bettlektüre – Bücher lese ich ausschließlich vorm Einschlafen im Bett – mit Sand verbracht habe, komme ich noch zu keinem abschließenden Urteil. Die Besprechungen jedenfalls gehen nach meiner festen Überzeugung allesamt in die Irre. Indem sie das Buch so loben, tun sie ihm Unrecht. Zum Überfluss entdeckte ich noch diesen Mitschnitt einer Lesung des Autors aus Sand, bei der im Publikum dauernd gekichert wird. Offenbar sind die Zuhörer mit dem Vorurteil aus Tschick zu der Rezitation gegangen, einem Humoristen zu begegnen – und hören dann nicht richtig hin. Schmerzhaft!
Optalidon (I)
Friday, 06. January 2012„Das Einzige, das half.“ Nämlich gegen meine Kopfschmerzattacken, die mich seit frühester Kindheit zwar nicht regelmäßig, aber zuverlässig immer dann, wenn ich am wenigsten damit rechnete „aus der Bahn warfen“: grauenhafte Pein, Schwindel und blitzende Aureolen, schließlich gipfelnd in Kotzeruptionen „bis zur Galle“, dann totale Erschöpfung und Schlaf; zuletzt ein Erwachen „wie neugeboren“. Wenn ich mir diese Ochsentour ersparen wollte, griff ich zu einem jener rosafarbenen Zäpfchen aus dem Hause Sandoz. Wunderbar! Wenn man heute ,Optalidon‘ bei Wikipedia eingibt, findet man nur eine Erwähnung im Artikel über den Schauspieler Harry Meyen, der sich 1979 an einer Feuerleiter an der Rückfront seines Hauses in Hamburg erhängte, im Alter von nur 54 Jahren, mit einem Seidenschal. Und dort liest man: „Sein Leben lang litt Meyen unter starker Migräne und nahm daher viele Tabletten, unter anderem Optalidon und Staurodorm. Verbunden mit Alkohol führen diese Medikamente häufig zu Benommenheit, Müdigkeit, Lichtempfindlichkeit, Angst und Selbstmordgefährdung. Sein Rauschmittelkonsum steigerte sich im Laufe der Jahre.“ Meyen war als „jüdischer Mischling ersten Grades“ mit 18 Jahren ins KZ Neuengamme verschleppt worden. International bekannt wurde er als Ehemann von Romy Schneider. Einen Abschiedsbrief hat Harry Meyen nicht hinterlassen.
Amt, beschädigt
Thursday, 05. January 2012Ausnahmsweise werde ich mir doch einmal untreu und äußere mich zur Tagespolitik. Seit Guttenberg, mithin seit einem Dreivierteljahr, habe ich mich zurückgehalten und meinen Ärger, meinen Ekel und meine Belustigung über das alltägliche Hickhack unserer demokratisch gewählten, politischen Sachwalter und Repräsentanten und die nicht minder unappetitliche Ausplünderung dieses Spektakels in den kommerziellen Massenmedien hinuntergewürgt. Es gibt ja verdienstvolle Weblogs ohne Zahl, die auf diesem Feld vortreffliche Arbeit leisten, von netzpolitik.org und mediaclinique über Feynsinn, Schockwellenreiter und NachDenkSeiten bis hin zu den Sozialtheoristen und FeFes Blog. Setzt man nur diese Sieben Zwerge auf die Blogroll, dann ist einem alltäglich aus dem Herzen gesprochen und man kann sich allmorgendlich zwischen Frühstück und Tagwerk mit der schönen Illusion besänftigen, dass es noch genug kritischen Verstand in diesem Land gibt und wir uns um die Demokratie nicht sorgen müssen. – Jetzt aber muss ich doch einmal was sagen. Gestern hat Christian Wulff im Öffentlich-rechtlichen Fernsehen zur besten Sendezeit zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen Rede und Antwort gestanden. Da ich bekanntlich kein TV-Gerät beherberge und mir ohnehin solche wichtigen Einlassungen lieber schwarz auf weiß gedruckt zu Gemüt und Verstande führe, kenne ich das Ergebnis dieses knapp 18 minütigen Verhörs, dem der Bundespräsident seitens Bettina Schausten (ZDF) und Ulrich Deppendorf (ARD) unterzogen wurde, nur aus den jetzt als Abschrift im Internet verfügbaren Versionen. Hier also mein Urteil. Die Frage, ob sich Wulff etwas hat zuschulden kommen lassen, das seinen Rücktritt zwingend erforderlich macht, kann ich nicht beantworten. Ob seine Kreditgeschäfte oder sein Umgang mit der Presse gegen geltende Gesetze verstießen, müssen schlimmstenfalls die zuständigen Instanzen entscheiden. Was mich jedoch wirklich erschüttert, das ist das Bild, das dieser Mann in der erbarmungswürdigen Lage abgibt, in die er selbst sich durch sein doch wohl mindestens ungeschicktes Handeln und in die ihn die erbarmungslose Öffentlichkeit durch ihren unstillbaren Hunger auf Sensation getrieben haben. Es ist dies das Bild eines kleinen Jungen, der in der Ecke steht und um Straferlass bettelt. So ganz anders stand Wulffs Amtsvorgänger Horst Köhler bei seinem überraschenden Rücktritt im Mai 2010 vor der Medienmeute: trotzig, gar angriffslustig. Köhler hat sich unsere Sympathien, so wir denn überhaupt welche hatten, damals durch seine Uneinsichtigkeit verscherzt. Wulff hingegen ist nur zu bemitleiden. Die zynische Frage muss nun leider lauten: Welches Schauspiel fügt dem Amt des Bundespräsidenten den größeren Schaden zu?
Langeweile. Nichts …
Saturday, 31. December 2011Zum Abschied von diesem Jahr muss ich meine größte, wichtigste Entdeckung dieses Jahres noch einmal zum Ausdruck bringen: die immer und überall unterschätzte destruktive Macht im Menschen, die ihn entweder vernichtet oder zu schrecklichen Taten treibt, die ihn über seine Verhältnisse leben, die Natur und damit seine Lebensgrundlagen zerstören lässt und deren so harmlos, schlicht, fade klingender Name da lautet: Langeweile! Natürlich bin ich nicht der Entdecker dieser unterschätzten und noch längst nicht ans Ende, oder besser: zu allen ihren Enden hin ausgedachten Erkenntnis. Zur Feier des Tages zitiere ich hier als einen frühen Gewährsmann Pascal: „Langeweile. Nichts ist dem Menschen unerträglicher als völlige Untätigkeit, als ohne Leidenschaften, ohne Geschäfte, ohne Zerstreuungen, ohne Aufgabe zu sein. Dann spürt er seine Nichtigkeit, seine Verlassenheit, sein Ungenügen, seine Abhängigkeit, seine Unmacht, seine Leere. Allsogleich wird dem Grunde seiner Seele die Langeweile entsteigen und die Düsternis, die Trauer, der Kummer, der Verdruß, die Verzweiflung.“ (Über die Religion und über einige andere Gegenstände (Pensées). A. d. Frz. v. Ewald Wasmuth. Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1978, S. 75.) – Aber wer verstünde mich, wenn ich bekennen würde, dass ich das neue Jahr 2012 einer genaueren Untersuchung der Langeweile, ihrer Ursachen und Folgen widmen will?
Lebens Zenit
Thursday, 29. December 2011Ein anderer Mann, für den ich früh allerhöchste Verehrung empfand und der im Laufe der Jahre nur immer noch in meiner Achtung stieg, ist Bertrand Russell. In seiner Autobiographie beschreibt er, wie er im Alter von gerade einmal 28 Jahren seinen großen intellektuellen Durchbruch erlebte: „Meine Empfindungen ähnelten denen, die einen überkommen, wenn man im Nebel einen Berg erklettert, bei Erreichung des Gipfels den Nebel plötzlich weichen und das Land auf fünfzig Kilometer im Umkreis klar vor sich liegen sieht.“ Solche Gefühle hatte ich ebenfalls, aus vermutlich viel geringerem Anlass, in meiner Kindheit. Allerdings waren sie nicht Ergebnis einer geistigen Anstrengung, sondern überkamen mich eher impulsiv. Plötzlich begriff ich etwa, dass alle Dinge immer herabfielen, wenn ich sie losließ, und dass dies doch eigentlich nicht selbstverständlich war. Oder ich entdeckte, dass mein Spiegelbild das gleiche tat wie ich, und zwar exakt gleichzeitig. Aber natürlich meint Lord Russell hier einen viel erhabeneren Erkenntnisschritt, wenn er fortfährt: „Intellektuell war der September 1900 der Höhepunkt meines Lebens. Ich sagte mir dauernd selbst vor, jetzt endlich hätte ich etwas geleistet, was der Mühe wert war, und auf der Straße meinte ich, ich müsse jetzt ganz besonders aufpassen, nicht überfahren zu werden, ehe ich das zu Papier gebracht habe.“ Genau diese Sorge ist mir ebenfalls vertraut. Sie betraf gewisse Einsichten, die mich unter dem Einfluss psychotroper Substanzen beschlichen hatten. Allerdings genügte es mir, sie einigen vertrauten Mitmenschen mündlich mitzuteilen, was ich heute sehr bedaure. Der absolut nüchterne Bertrand Russell hingegen war so viel klüger und fleißiger als ich: „Anfangs Oktober machte ich mich daran, The Principles of Mathematics niederzuschreiben, wozu ich schon mehrfach erfolglose Versuche unternommen hatte. […] Während der Monate Oktober, November und Dezember schrieb ich jeden Tag meine zehn Seiten, so daß das Manuskript am letzten Tag des Jahrhunderts beendet war […].“ (Autobiographie I. 1872-1914. A. d. Engl. v. Harry Kahn. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1977, S. 223 f.) Nein, solch edlen Höhepunkt meines Lebens, noch dazu mit präzisem Timing zur Jahrhundertwende, vermag ich nicht vorzuweisen. Ich bin wohl eher ein Mensch der Ebene denn ein Gipfelstürmer. Mir reicht es schon, wenn ich alltäglich einen kleinen geistigen Hüpfer machen kann. Und wenn es mir dann noch gelingt, ihn leidlich auf die Zeile zu bringen, dann bin ich froh.
Common Little Man
Wednesday, 28. December 2011Kaum jemand dürfte in seinen Jugendjahren einen solch übermäßigen Verschleiß von Vorbildern, Idolen, Vaterfiguren gehabt haben wie ich. Zwischen meinem sechzehnten und meinem neunzehnten Lebensjahr wechselte ich meine Hausgötter wie die Socken, meist trug ich mehrere gleichzeitig nebeneinander oder übereinander, teils in beißender Kombination. Und so innig ich jeden von ihnen liebte und verehrte, wenn ich gerade in frischer Liebe entbrannt war, so abgeschmackt und peinlich fand ich ihn bald darauf, wenn ich seine Schwächen und Begrenzungen erkannt zu haben meinte. Die Halbwertzeiten dieser Idolatrien wurden immer kürzer, meine Ansprüche an die Exzentrik meiner Vordenker immer strenger. – Wenn ich heute an diese Zeit der Unreife zurückdenke, ist Scham das vorherrschende Gefühl. Aber ein paar Namen kann ich heute noch nennen, ohne rot zu werden. Einer von ihnen ist Wilhelm Reich, von dem ich mich so unmittelbar angesprochen und durchschaut fühlte wie von kaum einem seiner Konkurrenten: „Ich sage dir, kleiner Mann: Du hast den Sinn für das Beste in dir verloren. Du hast es erstickt, und du mordest es, wo immer du es in anderen entdeckst, in deinen Kindern, deiner Frau, deinem Mann, deinem Vater und deiner Mutter. Du bist klein und willst klein bleiben, kleiner Mann.“ (Rede an den kleinen Mann. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1984, S. 31.) Bei aller Bizarrerie seiner Wolkenkanonen und Orgonakkumulatoren scheint mir Reich noch heute geadelt durch den Hass und die Verfolgungen, dener er seitens seiner Gegner ausgesetzt war. Wozu diese Hartnäckigkeit, dieser Vernichtungszwang gegen einen harmlosen Irren? Und noch heute komme ich nicht darüber weg, wie klar er selbst seinen Untergang prophezeit hat, ohne darüber doch jede Hoffnung aufzugeben: „Was immer nun du mir angetan hast oder noch antun wirst, ob du mich als Genie verklärst oder als Wahnsinnigen einsperrst, ob du mich nun als deinen Retter anbetest oder als Spion hängst oder räderst, früher oder später wirst du aus Not begreifen, daß ich die Gesetze des Lebendigen entdeckte und dir das Handwerkszeug gab, dein Leben mit Willen und Ziel zu lenken, wie du bisher nur Maschinen lenken konntest.“ (Ebd., S. 124.)
[wird fortgesetzt]
Monday, 26. December 2011Seit einer gefühlten Ewigkeit wartete ich auf die Fortsetzung von Wolfgang Herrndorfs Blog Arbeit und Struktur. Der letzte Eintrag war vom 19. November und berichtete in vier Sätzen von einem Besuch des Films Cheyenne mit Kathrin Passig und einem anschließenden traurigen Gespräch über gemeinsame Urlaube. Das letzte Wort war „gescheitert“. Tag für Tag klappte ich in den vergangenen Wochen, gleich nachdem der Rechner hochgefahren war, Kapitel Einundzwanzig auf, immer wieder dieser letzte Absatz mit Cheyenne und „gescheitert“. Darunter die Ankündigung, Versprechung: „[wird fortgesetzt]“. Dabei fürchten wir treuen Besucher dieser Seite doch alle, dass irgendwann hier noch für eine solche gefühlte Ewigkeit „[wird fortgesetzt]“ stehen wird, obwohl der Blogger seinem Glioblastom erlegen ist. Ich ertappte mich dabei, sicherheitshalber immer mal wieder auf Wikipedia nachzuschauen. Nein, er lebt noch! Heute nun kamen gleich vier Tagesnotizen, vom 20. bis zum 25. November, für die eigens ein neues Kapitel Zweiundzwanzig aufgemacht wurde. Wichtigste, erfreuliche Neuigkeit: H. erfährt im Abschlussgespräch nach seiner letzten Bestrahlung vom Arzt, dass er noch zehn bis zwölf Monate Aufschub erwarten darf, bis zum nächsten Rezidiv. – Ich fragte mich eben, ob ich hier überhaupt schon von meiner zweiten, intensiveren Begegnung mit dem Werk des Wolfgang Herrndorf berichtet habe. Die Suche nach seinem Nachnamen ergab aber nur einen einzigen Beleg. Vor fast genau einem Jahr hörte ich im Rundfunk eine überaus positive Besprechung seines Bestsellererfolgs Tschick, der mir aber erst durch einen besonderen Zufall so merkwürdig wurde, dass ich ihn wenig später kaufte und dann auch las. Die beiden jugendlichen Ausreißer brechen dort in eine gelobte Fremde auf, für die sie mangels konkreter Vorstellungen den Namen Walachei einsetzen. Und eben diese Walachei tauchte auch in einer 200 Jahre alten Ausgabe der Berliner Abendblätter auf, die anlässlich des bevorstehenden Kleist-Jahres gerade Tag für Tag online publiziert wurde und die ich gleichzeitig las. Ich wollte die Stelle bei Tschick genau zitieren und kaufte darum später das Buch. Nun lese ich Herrndorfers neues Buch Sand, über das ich erst urteilen will, wenn ich damit durch bin. – Sein Weblog jedenfalls ist stellenweise großartig, voller Tragik und Humor!
Sammlers Bescheidenheit
Sunday, 25. December 2011In den letzten Jahren habe ich das Interview als eine vollwertige literarische Kunstform entdeckt; was natürlich keineswegs bedeutet, dass nun Interviews, wie sie mit den langweiligen Prominenzen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltungsindustrie geführt und alltäglich in den Zeitungen und Magazinen veröffentlicht werden, per se schon Kunstwerke sind, die die Beachtung einer gebildeten Leserschaft und die Beurteilung der professionellen Kritik verdienten. Aber es gibt doch in diesem ohrenbetäubenden Allerweltspalaver immer wieder einmal Kleinodien des Gesprächs, der Befragung, die es verdienen, in eine Textsammlung der literarischen Meisterwerke aller Gattungen und Sprachen aufgenommen zu werden. Einige Interviews des im April dieses Jahres gestorbenen André Müller sind darunter; manche in der New Yorker Literaturzeitschrift Paris Review erschienene Autorengespräche; und viele verstreut veröffentlichte Einzelstücke, die ich hier und dort im Laufe von Jahrzehnten zusammengetragen habe, eine Sammlung, die es dringend nötig hat, gesichtet und ausgedünnt zu werden. Unbedingt würde ich die Gespräche hinzurechnen, die Osvaldo Ferrari 1984 bis 1986 in Genf mit Jorge Luis Borges geführt hat. Leider gibt es bisher nur eine Auswahl in deutscher Übersetzung (von Gisbert Haefs). Natürlich müssten aber auch Interviews mit jenen Unbekannten vertreten sein, die weniger durch ihren erlauchten Geist, durch ihre Beiträge zu Kunst und Wissenschaft unser Interesse verdienen, sondern allein durch das wahrhaftige Bekenntnis zu ihrem einfachen Leben, mit einem Wort: durch ihre Authentizität. Hier denke ich an Hubert Fichtes Interviews aus dem Palais d‘Amour oder die langen Interviews per brieflicher Befragung, die Paul Moor mit Jürgen Bartsch im Gefängnis geführt hat, um nur zwei Beispiele zu nennen, die mich nachhaltig geprägt haben. Natürlich gehören auch Verhöre hinzu, die Befragungen von Tätern und Zeugen vor Gericht. Zuletzt würde vielleicht ein tausendstimmiges Oratorium aus Fragen und Antworten dabei herauskommen, zwischen Himmel und Hölle, ohne Anfang und Ende. Alles Gerede mündete dann in diesen einen polyphonen Gesang, wie Mallarmé erklärt hat: „Tout au monde existe pour aboutir à un livre“, was Borges 1951 zum Motto seines Essays Vom Bücherkult machte, woran ihn Ferrari in einem seiner Interviews erinnerte. (Vgl. Lesen ist denken mit fremdem Gehirn. Zürich: Arche Verlag, 1990, S. 89.) – Vielleicht hätte ich mich doch mit dem ehrbaren Handwerk des Anthologisten bescheiden sollen, statt mich dazu berufen zu fühlen, selbst zu schreiben?
Herr und Frau N.
Saturday, 24. December 2011Vielleicht ist ja die zukunftsträchtigste Ausbeute des zu Ende gehenden Jahres unsere gemeinsame Idee zu einem Figurentheater. Sie wurde erst vor wenigen Wochen auf einem Waldspaziergang geboren. Der Plan sieht vor, dass nur zwei Puppen, Herr N. und Frau N., auf der Bühne agieren; ein älteres Ehepaar, das uns beide verkörpert, aber natürlich ins Maskenhafte übertrieben. Wir entwickeln eine Vielzahl von kurzen Szenen, die nahezu beliebig zusammengestellt werden können. Vorstellbar ist, dass es Szenen für reines Kinderpublikum und solche für Erwachsene gibt, aber auch einige, die sich für eine gemischte Zuschauerschar eignen. Die Kulisse ist immer dieselbe: das Interieur einer guten Stube mit Koch- und Schlafgelegenheit. Ein Fenster öffnet den Blick zur Außenwelt. Die Puppen sollten vielleicht Marionetten sein, weil diese mehr Bewegungsmöglichkeiten bieten als Hand- oder Stabpuppen. Damit stehen wir allerdings rein technisch vor einer anspruchsvollen Aufgabe, denn auf diesem Feld sind wir absolute Neulinge. – Eben da ich dies schreibe fällt mir ein, dass wir unsere Szenen natürlich auch peu à peu bei YouTube online stellen könnten. Die Aufgabenverteilung entspricht unseren Kompetenzen. Ich entwickle die Dramaturgie, schreibe die Dialoge, meine Gefährtin ist für die Puppen, die Kulissen, das Interieur zuständig. Aber natürlich wird das gesamte Projekt in erster Linie ein Gemeinschaftswerk, bei dem wir uns gegenseitig anregen und voranbringen. Ach, welch zauberhafter Traum!
Zufall fleischgeworden
Friday, 23. December 2011In den letzten Wochen plagte mich erneut der Gedanke, nun vielleicht doch ein wenig Zeit darauf zu verwenden, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Aber warum? Weil ich zufällig wieder einmal in dem so sehr erheiternden Buch von Luke Rhinehart gelesen hatte, das ich vor 37 Jahren entdeckte und das meinen Lebensgang wenn nicht bestimmt, so doch in einem kleinen, aber feinen Moment beeinflusst hat. Und dort steht gleich im Vorwort der Satz: „Ich erzähle meine Lebensgeschichte aus jenem bescheidenen Grund, der bisher noch jeden Autobiographen zur Arbeit gedrängt hat: der Welt zu beweisen, daß ich ein großer Mann bin.“ (Der Würfler. A. d. Am. v. Franz Scharpfender. Wien, München, Zürich: Verlag Fritz Molden, 1972, S. 10.) Na, so bescheiden wie Rhinehart bin ich gerade nicht. Ich würde verlangen, dass ich mir durch das Aufschreiben meiner Lebensgeschichte selbst beweisen könnte, mein Leben nicht verfehlt zu haben. Und damit ich mir bei diesem Versuch nicht fortwährend etwas in die Tasche lügen könnte, würde ich mir einen unbefangenen und unbestechlichen Leser vorstellen, der schließlich über diese Frage zu entscheiden hätte. Keinen geringeren als dich.
Haufen Schlamm
Thursday, 22. December 2011Wie erscheint der Tod in Flauberts vielleicht größtem Roman, Bouvard et Pécuchet aus dem Jahr 1881? Ganz richtig, in Gestalt eines Hundes. Die berühmte Stelle hat es mir schon damals angetan, als ich das Buch zum ersten Male las, vor genau einem Vierteljahrhundert. Damals hatten wir noch keinen Hund. Mein Verhältnis zu Hunden war gestört, ich hatte Angst vor ihnen, wenn ich ihnen auf der Straße begegnete. Handelte es sich um besonders große Tiere, dann wechselte ich nicht selten den Bürgersteig, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Über Hundebesitzer, die ihr Tier nicht an der Leine führten, konnte ich mich sehr erregen. Einem toten und gar verwesenden Hund bin ich hingegen bisher noch nicht begegnet, wie es den Herren Pécuchet und Bouvard einst widerfuhr: „Kleine Schäfchenwolken standen am Himmel, die Glöckchen des Hafers wiegten sich im Wind, an einer Wiese murmelte ein Bach, als plötzlich ein furchtbarer Gestank sie stehenbleiben ließ, und sie sahen auf dem Kies zwischen Brombeergestrüpp den Kadaver eines Hundes liegen. Seine vier Glieder waren vertrocknet. Der weitgeöffnete Rachen entblößte unter bläulichen Lefzen elfenbeinweiße Fangzähne; an Stelle des Bauches war da ein erdfarbener Haufen Schlamm, der zu beben schien, so lebendig wimmelten darunter die Würmer. Sie kribbelten hin und her, von der Sonne beschienen, von Fliegen umsummt, in diesem unerträglichen Geruch, diesem wilden, gleichsam verzehrenden Geruch.“ (Gustave Flaubert: Bouvard und Pécuchet. A. d. Frz. v. Erich Marx. Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, 1959, S. 303.) Längst haben wir nun unseren Hund. Sie ist schon alt. Vielleicht sehr bald wird sie sterben. Aber den Würmern und Fliegen wollen wir sie nicht überlassen.
Entwischt
Friday, 04. November 2011Nun bin ich also noch einmal davongekommen.
Auf der Strecke blieben ein walnussgroßer Tumor, eine rechte Niere samt zugehörigem Harnleiter, knapp drei Wochen Arbeitszeit, sehr viel Kraft und ein paar Illusionen.
Gewonnen habe ich zwei beeindruckende Narben, etliche nicht immer schmeichelhafte Einblicke in meine seelische Konstitution, die Neubestimmung meiner Prioritäten und lehrreiche Eindrücke vom Alltag eines modernen Klinikbetriebs.
Aber diese Bilanz gibt natürlich nur einen blassen Schein davon wieder, was mir geschah.
Und welche Auswirkungen es auf mich und mein Blog haben wird, ist mir noch völlig unklar.
Fristsetzung als Formgeber
Friday, 30. September 2011Ich frage mich gerade, welchen Einfluss es auf mein Schreiben hätte, wenn meine verbleibende Lebenszeit genau begrenzt wäre. Wüsste ich zum Beispiel, dass ich nur noch ein halbes Jahr, zwei oder zehn Jahre zu leben hätte – würden dann meine Ergebnisse konziser? Hätte eine solche Limitierung Einfluss auf meine Themen? Oder verlöre ich gar, was ja auch vorstellbar wäre, gänzlich die Lust am Schreiben, um die verbleibende Zeit mit anderen Betätigungen hinzubringen?
Möglich wäre auch, oder doch immerhin vorstellbar, dass ich – angesichts der Aufgabe, nun einzig das Wesentliche in den Blick nehmen zu müssen – erstarrte und rein gar nichts mehr zu Papier brächte. Oder ich packte dies und jenes an, ließe es aber bald wieder fallen, weil mir etwas noch Wesentlicheres in den Sinn käme, wogegen das zuvor für wesentlich Gehaltene plötzlich trivial erschiene. Vielleicht verständigte ich mich in dieser Unrast schließlich doch gegen alle Unsicherheit auf einen festen Entschluss, an den ich mich nun klammerte, als stünde er für mein schwindendes Leben selbst, ohne freilich den nagenden Zweifel ganz zum Verstummen zu bringen, dass ich auf ein falsches Pferd gesetzt haben könnte.
Unwahrscheinlich, vielleicht unmöglich scheint mir hingegen, dass die Aussicht auf einen definierten Ultimo meines Lebens ganz folgenlos für mein restliches Tun und Lassen als Schreibender bliebe. Dabei stand ich schon immer – oder doch mindestens, soweit ich mich besinnen kann – unter dem inneren Druck, keine Arbeitszeit mit Marginalien zu Quisquilien zu verplempern. Es war ja schon schlimm genug, dass ich viele Jahre lang nur den kleineren Teil meines Tages aufs Schreiben verwenden durfte, während Familie, Brotberuf und Schlaf den großen Rest auffraßen.
Wieder eine andere Idee: Ich schreibe keine einzige neue Zeile mehr, sondern konzentriere all meine verbleibenden Kräfte darauf, das Vorhandene zu sichten, zu sortieren, auszumustern, zu vernichten und den guten Rest zu konservieren. Dieser Plan hat etwas Versöhnliches und überdies den Vorzug, dass er den vermutlich von Tag zu Tag nachlassenden Kräften am ehesten noch Rechnung trägt. Im günstigsten Fall kann er sogar Kraft spenden, wenn die Begegnung mit der Vergangenheit erfreuliche Erinnerungen ans Licht bringt.
(Ganz anders verhielte es sich freilich, wenn die Frist noch wesentlich kürzer wäre. Wenn sich der Erlebenskorridor auf die berühmten ,Letzten Worte‘ hin verengte. Was wäre da zu sagen? Dazu zu sagen?)
Schreibzwang
Sunday, 04. September 2011Manchmal stoße ich bei der Durchsicht älterer Postings auf Einfälle, die mir längst entfallen sind, dessen ungeachtet aber wert, aufgehoben und daraufhin geprüft zu werden, ob sich mit ihnen nicht noch etwas machen ließe. So begegnete mir heute in einem meiner allerersten Beiträge zu diesem Weblog das formale Konzept, alle fünf Absätze jeweils mit einem Temporaladverb anheben zu lassen.
Oft muss ich feststellen, dass die inhaltliche Substanz meiner Artikel zu wünschen übrig lässt; oder dass deren Anlässe zu zeitbezogen waren, um eine dauerhafte Aufbewahrung, gar öffentliche Zurschaustellung zu rechtfertigen. Vielfach sind Links verödet. Häufig verstehe ich selbst nicht mehr ganz, was ich eigentlich mit dieser oder jener Anspielung gemeint habe.
Selten bin ich wirklich begeistert von meinem eigenen Geschreibsel, aber dann kommt es mir regelmäßig so vor, als sei es nicht von mir.
Immer finde ich mindestens ein paar Kleinigkeiten, die ich polieren oder verfeinern, verdeutlichen oder entschärfen muss. Dabei fühle ich mich wie ein Betrüger und zudem wie ein Pedant. Warum fällt es mir so schwer, zu meinen Schwächen zu stehen? Und riskiere ich mit diesem Perfektionismus nicht, meinem persönlichen Stil die Seele auszutreiben?
Nie bezweifle ich hingegen, dass alternativlos ist, was ich hier mache: Ich kann nichts andres und ich kann ’s nicht anders.
Big Sister im Hinterzimmer
Friday, 26. August 2011Die erzwungene Besinnungspause führt zu ersten Einsichten. Weil ich mich mit kleinen Schritten begnügen wollte, meinte ich, diesem langsamen Fortschritt durch entsprechend viele Schritte auf die Sprünge helfen zu müssen. In den 1280 seit dem Startschuss für dieses Weblog vergangenen Tagen habe ich 886 Beiträge veröffentlicht. Anders gesagt durfte der Leser hier an zwei von drei Tagen einen neuen Artikel erwarten – wenn es denn überhaupt Leser gab, die hier alle paar Tage vorbeischauten.
Dieser Illusion gehe ich aber längst nicht mehr auf den Leim. Dazu ist mein Blog einerseits zu strapaziös, andererseits – “to tell the truth: its too much eccentric!” Nachdem ich hinlänglich unter Beweis gestellt habe, dass es mir an Fleiß und Kondition nicht mangelt, sollte ich mich vielleicht künftig darauf konzentrieren, noch deutlicher und noch genauer das zum Ausdruck zu bringen, was – frei nach Patti Smith – nur ich allein so zum Ausdruck bringen kann. Dafür benötige ich jedoch erfahrungsgemäß etwas mehr Zeit als anderthalb Tage.
Vor ein paar Tagen mehr wurden in unserem Haus fünf Betten angeliefert. Da die Straße sehr schmal ist, stand der Möbelwagen direkt vor unserem Küchenfenster. Dadurch ergab sich das irritierende Bild dort oben: “Big sister is watching you!” Plötzlich verschieben sich durch des Zufalls Komödiantenlaune die Proportionen. Ich wähne mich in den daumengroßen Bewohner eines Puppenhauses verwandelt, den von draußen die riesenhaft erscheinende Besitzerin dieser Liliputwelt amüsiert beobachtet. Gleich wird es ihr vielleicht gefallen, mich mit spitzen Fingern zu packen und auf den Dachfirst zu setzen!
Wo es aber durch ein wenig Kulissenschieberei möglich ist, einem mittelgroßen Mitteleuropäer momentweise das Selbstempfinden eines Zwergs zu suggerieren, da ließe ich mich doch vielleicht mittels eines entgegengesetzten Verzerrungstricks zu einem virtuellen Geistesriesen aufblasen – wenn nicht für immer, so doch bitte schön für jene fünf Minuten, die das Lesen und Verstehen meiner fünfteiligen Kurzprosa-Pröbchen beansprucht.
Dieser Trick wäre vielleicht durch die Lupe möglich, die der Leser zur Hand nehmen sollte, um zwischen meinen Zeilen auf die Suche nach versteckten Hinweisen zu gehen. Wo steckt der Schlüssel zum Hinterzimmer? Wer lauert dort auf den ungebetenen Besucher? Was führt er mit diesem im Schilde? Welche Ausflüchte könnte der Eindringling vorbringen? Was geschähe mit ihm, so sie nicht verfängen? Und was um alles in der Welt wäre sein Lohn, wenn ihm wider Erwarten schließlich doch noch mit knapper Nor die Flucht gelänge?
TV B Gone
Tuesday, 16. August 2011Dieser Tage machte mein Herz vor Begeisterung einen kleinen Hüpfer. (Zu richtigen Sprüngen kommt es ja in diesen Endzeitjahren nur noch sehr, sehr selten.) Ich las in einem Bericht über das Sommercamp des Chaos Computer Clubs auf dem ehemaligen sowjetischen Flugplatz Finowfurt im brandenburgischen Niemandsland, dass es jetzt einen elektronischen Zauberstab namens TV B Gone gebe, mit dem man sämtliche Fernseher im Umkreis von hundert Metern gleichzeitig ausschalten könne! (Vgl. Frederik Obermaier: Unter Nerds; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 186 v. 13./14./15. August 2011, S. 12.)
,Das musst du haben!‘, dachte ich gleich und recherchierte nach Bezugsquellen. Ich stieß auf zwei verschiedene Produkte. Erstens gibt es da einen schwarzen Schlüsselanhänger dieses Namens, der auf Knopfdruck nahezu jedes europäische Fernsehgerät ausschaltet, indem er in knapp einer Minute fast alle bekannten Ausschalt-Codes nacheinander per Infrarot sendet. Die Reichweite dieses „Ausschalt-Allrounders der 4. Generation“ beträgt allerdings lediglich drei bis fünf Meter. (Der Preis schwankt je nach Anbieter zwischen 9,90 € und 24,90 €.) Das zweite TV-B-Gone ist ein Bausatz aus 20 Teilen, zu dessen Montage etwas Zeit und Geschicklichkeit, ein Lötkolben, Lötzinn, ein Multimeter und eine Kneifzange erforderlich sind. Dieses Gerät ist viel stärker als die zuvor beschriebene Version, seine Reichweite beträgt mehr als 40 Meter, gelegentlich ist sogar von „bis zu 110 Meter“ die Rede. (Preis zwischen 16,95 € und 34,95 €.)
Nun stellte ich mir vor, allabendlich zur Hauptsendezeit mit meinem Handmade-TV-B-Gone einen Gang durch die Gemeinde zu machen und dabei alle hundert Meter den Glotzern ringsum eine überraschende kleine Sendepause zu verordnen. Schadenfreude? Ach, was! Bloß die Verzweiflungstat eines einsamen Bildfunkabstinenzlers, der wenigstens durch diese harmlose Harlekinade seine Verzweiflung über die Allmacht des medialen Tranquilizers zum Ausdruck bringen möchte. Ich bin ja überzeugt, dass binnen weniger Tage in allen Städten des Landes Barrikaden gebaut würden, wenn sämtliche Sender ihre Übertragung einstellten.
Leider brachte mich ein technisch versierter Bekannter schnell wieder auf den ernüchternden Boden der Tatsachen. Diese Allround-Ausschalt-Fernbedienung funktioniert nämlich wie jede andere auch nur dann, wenn sie punktgenau in die Richtung des auszuschaltenden Gerätes gehalten wird. Keineswegs kann man mit ihr blindlings in der Gegend rumballern und Glotzen im Dutzend auslöschen.
Schade!
Pulverfass
Sunday, 14. August 2011Die soeben im Artikel über Schreibvoraussetzungen aufgezählten inneren und äußeren Konditionen und Dispositionen sind zwar seit einigen Tagen durchaus gegeben – und doch kann ich mich nicht dazu aufraffen, einen neuen Beitrag für mein Blog zu verfassen. Es wäre der 884ste. Ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll. Alles, was mir einfällt, scheint mir nach kurzem Bedenken dann doch nicht der Mühe wert, schriftlich erzählt oder erörtert zu werden. Diese Skepsis gegenüber meinen Ideen befällt mich insbesondere an meinem Arbeitsplatz. Wenn ich gut gelaunt durch den feinen Nieselregen dem Wald zustrebe, durch das Fenster des 142er-Busses das Umschlagen der Ampel von Rot auf Grün erwarte oder im Bett kurz vorm Einschlafen an etwas Böses denke, dann überfällt mich aus dem Nichts ein erster Satz, ein hartnäckiger Widerspruch oder eine offene Frage, tauglich für mindestens ein Posting, wenn nicht gar für eine ganze Serie. Doch stolz wie ich bin verbiete ich mir, Notizen auf Merkzettel zu machen, weil ich mir sage: Wenn dieser Einfall nicht stark genug ist, dass ich ihn auch ohne Hilfsmittel im Kopf behalte, dann ist er wohl das Papier nicht wert, auf dem ich ihn skizzieren muss, um ihn nicht zu verlieren.
In dieser inspirativen Einöde lese ich obendrein noch das Interview, das Christian Wolf bei Basic Thinking vor ein paar Tagen mit dem Blogger Oliver Stör geführt hat. Stör hat innerhalb eines Jahres gleich drei Abmahnungen wegen vermeintlicher Rechtsverletzungen in seinem Weblog Stör-Signale erhalten und gibt nun nach neun Jahren fröhlicher Bloggerei entnervt auf. Was rät er Bloggern, die sich vor Angriffen der gefürchteten Abmahnanwälte schützen wollen? Da muss er leider mit den Achseln zucken. Ein Patentrezept gegen deren Machenschaften gebe es seines Wissens nämlich nicht. Immerhin könnte man seine Angreifbarkeit vermindern, indem man 1. keine Bilder aus dem Netz kopiert, 2. keine Zitate verwendet und 3. keine Links auf fremde Websites setzt. (Ich setze jetzt mal vorsichtshalber keinen Link auf das Interview.) Wenn ich mich nicht täusche, dann ist vermutlich der einzige Grund, weshalb dieser Kelch bisher an mir vorübergegangen ist, die totale Erfolglosigkeit meines Blogs. (Ich wusste ja schon immer, dass es ein großer Vorteil ist, nicht gelesen zu werden.)
Mit anderen Worten sitze ich hier auf einem Pulverfass. Sprachlos!
Ich überlege für ein Momentchen allen Ernstes, dieses Unternehmen mir nichts, dir nichts, sang- und klanglos aufzugeben. Was, wenn ich einfach den Stöpsel rauszöge? Es macht ein paar Mal gluck, gluck – und alles ist weg! Adieu, freie Meinungsäußerung vor der Weltöffentlichkeit. Andererseits bin ich heute auch wieder nicht in der Stimmung zu solch spontanen Vernichtungsaktionen. Meine cholerischen Anwandlungen gehören eben glücklicherweise längst der Vergangenheit an. Darum atme ich tief durch und erwäge ruhigen Blutes die verbleibenden Möglichkeiten, meine Arbeit an diesem Blog möglichst unbeeinflusst fortsetzen zu können, ohne Abzockern auch nur die kleinste Angriffsfläche zu bieten.
Vielleicht könnte ich mich rüsten, indem ich all jene älteren Postings, die auch nur von Ferne nach Verstößen gegen Urheber- oder Persönlichkeitsrechte duften, mit einem Passwortschutz versehe? Dabei sollte ich zweckmäßigerweise so vorgehen, dass ich zunächst ausnahmslos alle 883 Beiträge hinter Schloss und Riegel setze – um dann Schritt für Schritt die definitiv harmlosen Beiträge, gegen die auch der erfindungsreichste Rechtsverdreher nichts einzuwenden haben kann, wieder hervorzuholen. In einem zweiten Arbeitsgang könnten dann noch etliche Beiträge einer sorgfältigen Reinigung ad usum Delphini unterzogen werden, indem ich zum Beispiel ohnehin längst verödete Links entferne, wörtliche Zitate in indirekte umformuliere und so weiter. Bei meinen Neuveröffentlichungen werde ich fallweise entscheiden, welche ich der anonymen Öffentlichkeit zur Verfügung stellen darf und welche hinter die dicken Mauern eines Passwortschutzes gehören. Den Schlüssel zum intimeren Bereich meines Blogs erhalten dann nur meine engsten Freunde. (Je länger ich darüber nachdenke, desto reizvoller erscheint mir diese Lösung – und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht.)
Schreibvoraussetzungen
Tuesday, 09. August 2011Ich bin seit Wochen gesundheitlich etwas angeschlagen. Das bekommt auch mein Blog zu spüren. Die schöne Regelmäßigkeit eines täglichen Postings, die ich in den Monaten Mai und Juni durchhalten konnte, ist zumindest vorläufig passè. Ich habe gegenwärtig, wie man sagt, ganz andere Sorgen. Bei dieser Gelegenheit wurde mir wieder einmal bewusst, wie viele Voraussetzungen doch erfüllt sein müssen, damit ich überhaupt erst mit dem Schreiben beginnen kann – von einem Gelingen mal ganz abgesehen!
Mein kleines Arbeitszimmer ist der einzige Ort, an dem ich schreiben kann, jedenfalls auf die nahezu definitiven Ergebnisse hin, die ich hier publiziere. Stichworte, Notizen, Skizzen kann ich handschriftlich überall zu Papier bringen, aber für die Niederschrift meiner Miniatur-Pentaloge muss ich auf diesem Stuhl sitzen, an diesem Tisch, mit Blick auf die kleine Straße. Ich brauche meinen Rechner samt Peripherie, die kleine Handbibliothek aus Notizbüchern und Nachschlagewerken, frische Luft und absolute Ruhe.
Mein Kopf muss frei sein von allen störenden Zwischengedanken. Ist noch Butter im Kühlschrank? Droht ein Telefonanruf? Steht gar ein Besuch vor der Tür? Pures Gift für meine kreative Abgeklärtheit ist ein Streit vor Arbeitsbeginn. Aber auch bevorstehende Ereignisse, wie ein seltenes Zusammentreffen mit einem lange nicht gesehenen Freund oder ein Termin bei einer Behörde, können mich gedanklich so sehr dominieren, dass ich mich nicht mit voller Kraft auf die aktuelle Niederschrift konzentrieren kann.
Zeitdruck ist kontraproduktiv, erhöht nach aller Erfahrung mindestens die Fehlerquote. Blasendruck mach mich nervös und führt mich in Versuchung, die zweitbeste Formulierung zu akzeptieren, weil ich mich erleichtern muss. Bevor ich wieder an der Tastatur sitze, ist mir meist nicht mehr präsent, dass das Provisorium noch auf Ablösung durch ein Optimum wartet. Generell sind falsche Druckverhältnisse abträglich, ob beim Blut- oder Luftdruck. Zu wenig Druck wirkt in aller Regel lähmend, zu hoher blockiert.
Vernichtend ist schließlich für mein Schreibvermögen Schmerz, in all seinen Facetten. Selbst ein leichtes Pochen im Backenzahn, sogar schon ein lästiges Jucken zwischen den Schulterblättern macht mich völlig unfähig, auch nur einen einzigen brauchbaren Satz abzusondern. Analgetika betäuben mit dem Störenfried zugleich auch die Inspiration und das Empfinden für Wohlklang und syntaktische Proportionen. Sorge und Angst verderben mir die gute Laune. Krankheit zwingt mich tief unter mein Niveau.
Koinzidenz
Saturday, 06. August 2011Heute auf den Tag genau vor zwanzig Jahren wurde das Netz ausgeworfen, das mittlerweile anderthalb Milliarden Menschen per Personalcomputer miteinander verbindet. Ursprünglich sollte es nicht Netz (engl. web), sondern Geflecht oder Gitter heißen (engl. mesh), doch weil dieser Name leicht mit dem Wort für Unordnung (engl. mess) verwechselt werden kann, kam man davon wieder ab. Dabei ist es doch gar nicht so verkehrt, das World Wide Web mit Unordnung und Chaos in Verbindung zu bringen, wenn man die ungeheuren Datenvorräte als Ganzes betrachtet, die dort zur Verfügung gestellt werden.
Heute auf den Tag genau vor 66 Jahren ereignete sich eine menschgemachte Katastrophe, die mindestens ebenso folgenreich für unsere Zukunft war wie die Erfindung von Tim Berners-Lee, der mit seinem Hypertext-System das WWW ermöglichte. Auf die japanische Hafenstadt Hiroshima fiel die erste Atombombe. Sie tötete auf einen Schlag annähernd 80.000 Menschen; fast die gleiche Zahl starb, teils noch Jahrzehnte später, an den Folgen radioaktiver Verstrahlung. Der Einsatz von Little Boy, wie die Bombe euphemistisch genannt wurde, beendete den Zweiten Weltkrieg und eröffnete ein Jahrzehnte währendes Wettrüsten zwischen den Weltmächten USA und UdSSR.
Diese kalendarische Koinzidenz ist natürlich reiner Zufall. Naiv muss man jeden nennen, der daraus eine Bedeutung ableiten oder gar einen „geheimen Zusammenhang“ herstellen wollte!
Nun haben wir Menschen es uns seit Einführung des Kalenders zur Gewohnheit gemacht, Jahrestage zu begehen, an denen sich das Datum eines uns bedeutsam erscheinenden Ereignisses wiederholt, wie etwa unser Geburtstag oder die religiösen Festtage, der Jahreswechsel oder die Sommer- und Wintersonnenwende. Handelt es sich um ein erfreuliches Ereignis, wird ein solches Jubiläum üblicherweise mit einem Fest begangen. Haben wir hingegen einer finsteren Schandtat zu gedenken, wie an Karfreitag oder am heutigen Hiroshimatag, so scheinen uns innere Einkehr, Schweigen und der Verzicht auf Geschäftigkeit und Unterhaltung angemessene Formen der Erinnerung zu sein. An den Atombombenabwurf auf Hiroshima erinnerte die Süddeutsche heute nicht. Es ist ja heuer auch kein „runder“ Jahrestag zu betrauern. An die heimliche Großtat im Europäischen Forschungszentrum CERN erinnert sich dort Patrick Illinger, der als einer von rund achttausend Wissenschaftlern damals hautnah dabei war – und trotzdem wie alle anderen Zeitzeugen nicht bemerkte, welch folgenreicher Durchbruch dem damals 36-jährigen Physiker und Informatiker an diesem Tag gelungen war.
Ich profitiere, indem ich dies schreibe, ob ich will oder nicht, von beiden Innovationen. Die elektrische Energie, die es ermöglicht, kommt zu einem guten Teil aus Kernkraftwerken, deren Entwicklung ja erst als eine Art friedlicher Ableger der Atombombe möglich wurde. Und dass ich meinen Text veröffentlichen kann, erlaubt jenes weltweite Geflecht, dessen Struktur Tim Berners-Lee vor zwanzig Jahren seinen Kollegen zur Verfügung stellte. Die erste Erfindung begann mit einem großen Knall, die zweite geräuschlos und unauffällig. Von beiden ist noch nicht erwiesen, ob sie uns mehr Schaden oder Nutzen bringen. Nur eines steht fest: Wir werden sie nicht mehr los.
Neue Fehlertypen (I): Altlasten
Monday, 01. August 2011Wo ein Fortschritt ist, da lauern stets auch neue Gefahren. Wer geglaubt hat, dass durch Textverarbeitungsprogramme und die dort eingesetzten Prüfroutinen alle Schreibfehler bald der Vergangenheit angehören würden, der musste erfahren, dass davon längst noch keine Rede sein kann. Zwar spürt die automatische Fehlersuche falsch geschriebene Wörter auf, zum Beispiel bei einem „Bucshtabenderher“. Aber schon wenn man sich bei „versehen“ vertippt und „vergehen“ schreibt, entgeht dem Programm dieses Versehen, denn das Wort ist an sich kein falsches, sondern nur im Zusammenhang deplatziert.
Bei manchem Laienschreiber hat nun das grenzenlose Vertrauen ins Korrekturprogramm dazu geführt, dass er im Zweifelsfall nicht mehr nachschlägt, nicht einmal mehr nachdenkt, sondern die erstbeste Variante in die Tasten hackt, darauf vertrauend, dass sein nur vermeintlich allwissender Spürhund schon anschlagen wird, wenn sein Herrchen irgendwo falschlag. Schlimmer noch! Die gute alte Übung, grundsätzlich jeden fertigen Text erst einmal aufmerksam und gründlich durchzulesen, bevor man ihn aus der Hand gibt oder gar veröffentlicht, gilt den meisten Schreibern mittlerweile als unnötige Zeitverschwendung.
So hat die neue Technik in den vergangenen zwei Jahrzehnten zwar dafür gesorgt, dass mancherlei Fehlschreibungen in Texten rasend schnell und mühelos aufgespürt und berichtigt werden können. Gleichzeitig sind aber neue Fehlertypen entstanden, nämlich durch das Schreiben per PC. Einen sehr verbreiteten Typ stelle ich hier an einem schönen Beispiel vor. Ulrike Putz vom Spiegel berichtet heute über Morde an iranischen Atomphysikern: „Nach westlicher Einschätzung gehörte Mohammadi Teil zur Elite der iranischen Nuklearforscher.“ (Israels mörderische Sabotage-Strategie; in: SpOn v. 1. August 2011.)
Das Wort „Teil“ ist überflüssig. Wie kam es hierher? Offensichtlich sollte der Satz ursprünglich lauten: „Nach westlicher Einschätzung war Mohammadi Teil der Elite der iranischen Nuklearforscher.“ Vermutlich missfiel der Autorin das doppelte „der“ („… Teil der Elite der …“). Außerdem ist es selten passend, einen Menschen als Teil von etwas zu bezeichnen. (Mein Großonkel war als Akrobat mal Teil einer menschlichen Pyramide; das ginge allenfalls noch.) Also beschloss sie, den Satz umzuformulieren. Sie setzte ein neues Verb – „gehörte“ – an die Stelle von „war“, indem sie „war“ markierte und mit „gehörte“ überschrieb. Dann markierte sie „von“ und überschrieb es mit „zur“. Dabei übersah sie aber, dass auch „Teil“ hätte eliminiert werden müssen, und so entging diese Altlast der Entsorgung. Damit war ein Fehler entstanden, den nun keine gängige Rechtschreibprüfung mehr aufspüren kann.
Einerseits sind diese neuen Fehler, die mir gerade in Magazin- und Zeitungstexten dauernd begegnen, für uns Leser nervend, weil sie den Lesefluss unterbrechen und das inhaltliche Verständnis bremsen. Andererseits ergibt sich aus Fehlern wie diesem eine reizvolle Denksportaufgabe, wenn man den Ehrgeiz hat, ihre Entstehung zu rekonstruieren. So können selbst neuen Risiken des Fortschritts wieder einen Wert mit sich bringen – und sei ’s bloß der Unterhaltungswert.
[Nachbemerkung: Zur Ehrenrettung des Spiegel darf hier angemerkt werden, dass der Fehler bereits wenige Stunden nach der ersten Veröffentlichung des Beitrags bei SpOn berichtigt war: Das überzählige „Teil“ wurde entsorgt.]
Original und Fälschung
Friday, 29. July 2011Manche Menschen sind befremdet über die an Schamlosigkeit grenzende Bereitschaft vieler Blogger, ihr Privatestes öffentlich zu machen, ihr Innerstes nach außen zu kehren. Sie unterstellen ihnen Narzissmus, Starallüren oder mindestens eine egomanische Weltsicht. Gleichzeitig wundern sie sich über die Arglosigkeit, mit welcher diese eitlen Menschen sich vor aller Welt offenbaren, wo man doch heute vielmehr auf der Hut sein sollte, dass man nicht von Marktforschern, Staatsbeamten, Arbeitgebern oder dem Nachbarn um die Ecke virtuell ausspioniert wird; und zwar selbst dann, wenn man sich bemüht, die Schotten dicht zu halten und so wenig wie möglich von sich preiszugeben. Die an Exhibitionismus grenzende Selbstpreisgabe der Blogger scheint in einem schwer verständlichen Widerspruch zu stehen zu den Warnrufen der Datenschützer. (Hagen Rether hat vor Jahren schon diesen Widerspruch unterhaltsam auf die Bühne gebracht.)
Thomas Assheuer erinnerte jüngst in der ZEIT an eine Prophezeihung des Futurologen und Kommunikations-Theoretikers Marshall McLuhan, der genau diese Paradoxie prophezeit hat. Den Einfall der Medienöffentlichkeit ins Wohnzimmer, die sich in den 1950er-Jahren vollzog, würden die Menschen bald einmal damit beantworten, dass sie sich selbst veröffentlichten. Sie würden dann sein wie Reptilien, die sich auf links drehen, den Panzer nach innen wenden, während die seelischen Weichteile nach außen gekehrt würden. Assheuer erkennt in unserer heutigen Medienwirklichkeit das Eintreffen dieser Vorhersage, wenn „der Handybenutzer von heute […] einen voll besetzten Bus ungefragt über seinen Liebeskummer unterrichtet.“ (Thomas Assheuer: Der Magier; in: Die ZEIT Nr. 30 v. 21. Juli 2011.)
Oder wenn ich meine Nierensteine öffentlich mache, die heute früh von meinem Hausarzt diagnostiziert worden sind [s. Titelbild]. Welche Blöße gebe ich mir denn damit? Und wie kann eine solche Information schlimmstenfalls gegen mich verwandt werden?
Die Intimsphäre ist ein in mehrfacher Hinsicht zwielichtiger Raum. Wer Anspruch auf ihren Schutz erhebt, bekennt sich damit indirekt zu einem Verhalten, das das Licht der Öffentlichkeit scheuen muss; oder zu einem Zustand, der das Empfinden seiner Mitmenschen verletzt. Andererseits verliert bekanntlich manches Vergnügen seinen Reiz, wenn es aus dem Halbdunkel des Privaten ins gleißende Licht der Öffentlichkeit gezerrt wird. Und es war schon immer eine ureigenste Herausforderung der Kunst, genau diese Ambivalenz des Verbergens deutlich zu machen. (So könnte die abendländische Kunstgeschichte als ein immerwährender Schleiertanz interpretiert werden, bei dem ja der Reiz darin liegt, das Verhüllte zu entblößen und die Blößen zu verhüllen.)
Nichts anderes spielt sich in den Weblogs ab. Man erfährt hier Dinge, die man sich nicht hätte träumen lassen. Ob man sie wissen will, steht auf einem anderen Blatt. Und wieder eine Frage ist, ob sie wahr sind oder bloß gut erfunden. So kann die Ultraschallaufnahme von meiner Niere sehr gut auch eine plumpe Fälschung sein. Aber was ist im Zweifelsfall belastender? Dass ich gesundheitlich beeinträchtigt – oder dass ich ein Schwindler bin?
An Bauer, 9. März 1971
Wednesday, 27. July 2011Für ein Fernbleiben vom Unterricht mussten wir eine Entschuldigung der Eltern beibringen. Ich fehlte relativ häufig, aber fast immer nur für einen Tag und dann stets aus dem gleichen Grund: Migräne. Dieser Entschuldigungsgrund entsprach manchmal den Tatsachen, war aber häufig auch vorgeschoben, weil ich mich vor einer Klassenarbeit drücken wollte, für die ich nicht gelernt hatte; oder weil ich einen langweiligen Schultag lieber gegen einen viel unterhaltsameren im Bett tauschen wollte, lesend und phantasierend.
Nach dem frühen Tod meines Vaters im Sommer 1969 war es Aufgabe meiner Mutter, die Entschuldigungsbriefe zu verfassen. Wenn ich mich nicht täusche, hatten sie immer den gleichen Wortlaut – und den hatte sie buchstabengetreu von meinem Vater übernommen.
Ich erinnere mich, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Aber das starke Analgetikum, das ich vom Arzt verschrieben bekam und dessen euphorisierende Wirkung ich bald schätzen lernte, vertrieb nicht nur den Schmerz, sondern auch die Schuldgefühle, die mich heimsuchten, wenn ich den Unterricht schwänzte. Es rief wahre Allmachtsphantasien in meinem sehr kreativen Gefühlsleben hervor, lustvolle Illusionen einer Karriere jenseits der schnöden Schulbildung, die mir auf diesem kleinkarierten Gymnasium zuteilwurde.
Der Lehrer, an den diese Entschuldigung adressiert ist, war nach meiner Erinnerung ein freundlicher Naturwissenschaftler, keiner von den alten Säcken, die uns mit ihrer Griesgrämlichkeit und ihren wüsten Drohungen bis in unsere Albträume verfolgten.
Um den Schein zu wahren, musste ich meiner Mutter die Kopfschmerzen möglichst glaubwürdig vorspielen, damit sie mir die Entschuldigung ohne schlechtes Gewissen ausstellen konnte, und ohne sich mir gegenüber als Betrügerin zu erkennen geben zu müssen. Allerdings kam es mir manchmal so vor, als hätte sie mich längst durchschaut und gönnte es mir stillschweigend, wenn ich mir gelegentlich eine kleine Auszeit gönnte. Vielleicht genoss sie auch die Abhängigkeit, in die ich mich ihr gegenüber damit begab.
Protected: Against Political Correctness
Monday, 25. July 2011Protected: Schmerzhafte Genauigkeit
Sunday, 24. July 2011Jetzt mal langsam
Saturday, 23. July 2011Falsch- und Schlechtschreiber haben allerlei Scherznamen auf Lager, um jene lächerlich zu machen, die es genauer nehmen als sie: Pedanten, Kleinigkeitskrämer, Pingel, Erbsenzähler, Federfuchser, Haarspalter, Rechthaber, Schulmeister, Besserwisser, Neunmalkluge, Kritikaster, Silbenstecher und dergleichen mehr. Nun mag zwar Genauigkeit eine Frage des Ermessens sein, nicht hingegen Richtigkeit. Und meist suchen die Schlamperten mit ihren humorigen, augenzwinkernden Verweisen an die Adresse der Richtig- und Gutschreiber bloß ihre lückenhafte Kenntnis der Schreibregeln oder ihre Trägheit zu vertuschen.
Mit Aufkommen der Massenpresse wurden der Dilettantismus und die Flüchtigkeit der Schreiber alltägliche Normalität, an welcher nur noch ein Sonderling wie Karl Kraus dezidiert Anstoß nahm. Und mit der Schaffung einer jedem zugänglichen Publikationsfläche im World Wide Web, deren Geburtsstunde sich demnächst zum zwanzigsten Mal jährt, hat dieser Niedergang der Schreibkultur einen weiteren Schub erfahren. Einige Gründe hierfür sind banal und offensichtlich. So äußern sich hier plötzlich zahllose Menschen ausführlich schriftlich, die seit ihrer Schulzeit offenbar nur noch zum Stift gegriffen haben, um den Lottozettel auszufüllen: nämlich in den Kommentar-Foren der Zeitungen und Zeitschriften, beispielsweise bei Spiegel online. Da traut sich nun jeder, denn er sieht, dass die meisten anderen ja ebenfalls schreiben, wie ihnen die krumme Feder gewachsen ist. Diese gegenseitige Schreibenthemmung hat zu einem unbegrenzten Laissez-faire in allen Fragen der Orthografie, Grammatik, Semantik, Syntax und Interpunktion geführt, von Stil und Anstand ganz zu schweigen! Hinzu kommt, dass das menschliche Auge offenbar auf der Monitorfläche weniger genau sieht als auf dem Papier; und dass die blitzschnelle Publikation per Mausklick dazu verführt, notwendige Korrekturphasen zu überspringen.
Und wie sieht es bei den Blogs aus? Ich darf hier mal aus dem aktuellen Beitrag in einem der drei Dutzend von mir mehr oder weniger regelmäßig inspizierten Weblogs zitieren: „Ach, wenn man auf der Webseite einer Drehbuchautorin sieht, daß sie den Titel ihres eigenen Films nicht richtig schreibt. Gut, aber Webseiten, ich spreche aus Erfahrung, enden eh wie ein während einer Killervirenepidemie frisch untergepflügtes Kraut- und Rübenfeld. Man fängt irgendwie an, vielleicht mit einem Storyboard oder wenigstens einer kleinen Skizze, und am Ende hat man keine Zeit, haut man irgendwas da rein und schaut auch nie wieder drauf. Im Zeitalter des Flüchtigen sind statische Rechtschreibfehler von einst [abgebr.]“ (kid37: Merz/Bow #28; in: Das hermetische Café; Posting v. 21. Juli 2011.)
Da wäre sie also wieder, die ja keineswegs neue Schnelllebigkeit der Massenmedien als Generalabsolution für den Dauertiefstand journalistischer Sorgfalt! Da ja laut Volksmund nichts so alt ist wie die Zeitung von gestern, scheren ihre Macher nicht die Kommafehler in diesem durch die Zeitung von morgen bald überholten Blatt, das bereits übermorgen im Altpapier landet. – Aber wer etwas genauer hinschaut, dem müsste doch gerade hier der entscheidende Unterschied zwischen Printmedien und Onlinemedien auffallen. Zwar rutscht auch mein heutiges Posting Tag für Tag tiefer in den Keller meines Weblogs. Nach einer Woche ist es schon nicht mehr auf der Startseite präsent. Dann findet man es erst wieder, wenn man ganz nach unten scrollt und auf „Ältere Einträge“ klickt. Wer sich bei mir gut auskennt, der ahnt möglicherweise, dass der Artikel unter der Kategorie „Langsamkeit“ abgelegt sein könnte und findet ihn auf diesem systematischen Wege wieder. Ein anderer hat sich vielleicht gemerkt, dass Karl Kraus darin vorkommt, und gibt diesen Namen ins Suchfenster ein, um den Text zu finden. Aber das Versteck dieses wie jedes anderen Beitrags in meinem Blog mag noch so entlegen sein – sie alle sind immerhin noch da und landen nicht im Reißwolf! Sie bleiben auffindbar, abrufbar, lesbar, kopierbar, druckbar und versendbar. Und dies gar von jedem Online-Arbeitsplatz aus, überall auf der Welt!
Muss es da nicht mein Ziel sein, mit größtmöglicher Sorgfalt alle meine Texte so richtig und so gut herzustellen, wie es mir eben möglich ist? Und auch alle älteren Texte laufend zu verbessern, wenn ich nachträglich Fehler oder Schwächen in ihnen entdecke? (A work in infinite and slow progress.)
Deutschland umsonst (II)
Friday, 22. July 2011Nun habe ich Michael Holzachs letztes Buch ausgelesen. Es hielt zugleich weniger und mehr, als ich mir von ihm versprochen hatte. Ich will mit den Defiziten beginnen.
Für einen Fußmarsch von fast einem halben Jahr fällt die Ausbeute an Erlebnissen, Beobachtungen, Gedanken und Gefühlen eher mager aus, und dies erst recht, wenn man noch die reinen Phantasiebilder abzieht, die der Autor gelegentlich einstreut, und außerdem jene Passagen, in denen er Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend mitteilt, aufgerührt durch den Besuch von Ortschaften, in denen er früher einmal gelebt hat. Es entsteht der Eindruck, dass Holzach eigentlich verschiedene Bücher hat schreiben wollen. Der Versuch, gleich mehrere Konzepte zwischen nur zwei Deckel zu pressen, ist gründlich missraten. Die Verarbeitung einer teils als traumatisch erlebten Vergangenheit, die Erkundung sozialer Missstände in einem Wohlfahrtsstaat der 1980er-Jahre, das Abenteuer eines Gewaltmarsches unter Verzicht auf Geld und Beförderungsmittel, die Erkundung der eigenen psychischen und physischen Grenzen – daraus hätte man gut vier Bücher machen können; und vermutlich vier bessere Bücher als dieses, das von allem etwas bringt, aber von allem zu wenig.
Wenn dennoch mache Episoden haften bleiben, als Momentaufnahmen ohne Ansehen ihrer Bedeutung im Gesamtzusammenhang der Geschichte, dann spricht dies für die gelegentlich scharfe, fast mikroskopische Beobachtungsgabe und Darstellungssorgfalt des Autors. Als vielleicht besonders treffendes Beispiel für diese Qualität fällt mir die Einlösung einer „Durchreisebeihilfe“ in Form eines „Lebensmittelgutscheins“ ein, bei der es darum geht, die großzügig gewährten acht Mark („in Worten, acht, Spirituosen- und Tabakwaren ausgenommen“) möglichst auf den Pfennig genau auszuschöpfen. (Holzach, a.a.O., S. 88 f.) Auch sind die meisten der zahllosen knappen Porträts von Weggefährten, Obdach- und Arbeitgebern und Obrigkeitsvertretern markant, glaubwürdig und einprägsam. Dass der Autor Humor hat, zeigt sich am deutlichsten an diesen Karikaturen.
Ein lustiges Buch ist dies aber nicht. Dafür sorgt von der ersten bis zur letzten Seite ein melancholischer Grundton. Die Tristesse der Unbehaustheit ist stellenweise so bedrückend, dass man versucht ist, Deutschland umsonst vorzeitig aus der Hand zu legen. Alkoholismus wird vielfach als eine Hauptursache für Obdachlosigkeit angeführt. Wenn man dieses Buch gelesen hat, begreift man, dass andersrum auch ein Schuh draus wird: Obdachlosigkeit ist nämlich ohne Alkohol auf längere Sicht kaum zu ertragen.
Bleibt die Frage, um die es ja in dieser Serie über Trendbücher vordergründig geht: Was hat Michael Holzachs Reisebeschreibung durch ein Wohlstandsland für mehr als zwei Jahrzehnte zu einem solchen Dauerbrenner gemacht? Einmal steht das Buch in enger Verwandtschaft zum Werk von Günter Wallraff, der ja mit seinen „unerwünschten Reportagen“ seit 1969 vorgemacht hat, wie man durch das Ausprobieren von riskanten Lebensumständen zu aufschlussreichen Erfahrungen kommt und mit den abenteuerlichen Berichten darüber viele Leser findet. Zweitens macht der genial-knappe Titel neugierig auf eine Erfahrung, die niemand freiwillig machen möchte, die jeden mindetens theoretisch bedroht und auf die man sich darum gern einmal in der Phantasie einlässt – in der Erwartung schauriger Details, aber vielleicht auch in der Hoffnung auf praktische Ratschläge, die einem notfalls nützlich sein könnten: Man weiß ja nie! Und drittens hat vermutlich das tragische Ende des Autors dazu beigetragen, dass er nun von einer Aureole der Lauterkeit umgeben ist: Der Mensch, der sein Leben für einen Hund opferte. (Die Verfilmung als vierteilige TV-Serie unter dem Titel Zu Fuß und ohne Geld aus dem Jahre 1995 setzte vermutlich einen weiteren Kaufimpuls, indem viele vorherige Leser sie damit kommentierten, das Buch sei aber besser.)
Bücherdämmerung (IV)
Wednesday, 06. July 2011Der Perlentaucher eröffnet seinen täglichen Newsletter bekanntlich stets mit einem „Zitat des Tages“. Liegt es nun daran, dass seinen Machern, die ja schließlich ihre Brötchen zu einem guten Teil mit Buchrezensionen verdienen, der Arsch auf Grundeis geht angesichts der vielstimmigen Untergangschoräle auf das Buch, dem das E-Book den Garaus machen soll, wenn die Taucher dieser Tage gleich zwei aphoristische Elogen auf das ehrwürdige Buch vom Grunde heraufholen?
Gestern durfte Gerhart Hauptmann dran glauben, dass der Mensch ohne das Buch wohl ein Nichts oder mindestens doch ein nichtswürdiges Etwas sei, indem er verlauten ließ: „Die Kultur der Menschheit besitzt nichts Ehrwürdigeres als das Buch, nichts Wunderbareres und nichts, das wichtiger wäre.“
Kann man sich vorstellen, dass Steve Jobs bei einer seiner legendären Präsentations-Veranstaltungen behaupten würde, die Kultur der Menschheit besitze nichts Ehrwürdigeres als das iPad, nichts Wunderbareres und nichts, das wichtiger wäre? Wohl kaum, denn eine solche Aussage schiene ihm gar nicht wünschenswert, trägt doch jede Innovation von Apple in sich schon den Keim zu einer weiteren, die sie überflügeln wird. Diese permanente Selbstüberflügelung mag etwas Wunderbares an sich haben, aber ehrwürdig ist sie sicher nicht.
Heute ist beim Perlentaucher Cicero dran mit dem Ausspruch: „Einem Haus eine Bibliothek hinzuzufügen heißt, dem Haus eine Seele zu geben.“ Das mag wohl mal im alten Rom ein erstrebenswertes Einrichtungsideal gewesen sein. Wie das Haus der Zukunft aussehen wird, hat uns Bill Gates erstmals 1994 in einer kühnen Utopie ausgemalt. Es ähnelt einer Rundum-Maschine, die zuallererst unserer Bequemlichkeit dienen soll. Nun ist das Bücherlesen, wie neulich noch Ruth Klüger überzeugend dargelegt hat, alles andere als eine bequeme Angelegenheit. Vergleicht man es mit den Lieblingsbeschäftigungen der Generation Couch-Potatoe, dann kommt es nahezu einem Hochleistungssport gleich.
Und die gute Seele im Hause moderner Leute ist vorläufig noch eine steuerfrei beschäftigte Putzfrau aus Rumänien oder Thailand, der man zu ihren zahlreichen Reinigungsaufgaben nicht auch noch zumuten will, sinnlos herumstehende Bücherregale abzustauben. Zudem würde sie ein solcher Job am Ende noch dazu verführen, einen Blick zwischen Buchseiten zu tun, um dort solch aufrührerischen Unsinn zu lesen, wie dass die Würde des Menschen unantastbar sei und alle Menschen gleich geboren. Beim iPad gibt es gegen unbefugten Zugriff ein schlichtes Password. Allein schon deshalb muss es sich mittelfristig durchsetzen!
Interview mit einer Überlebenden
Tuesday, 05. July 2011Seit etwa einem Jahr denke ich gelegentlich immer mal wieder über ein SciFi-Buch nach, das in der Form eines Interviews einen Blick aus ferner Zukunft auf die Geschichte der Menschheit auf diesem Planeten wirft. Wie ich die Menschheit kenne und wie mich der Leser dieses Blogs inzwischen kennen müsste, wird diese Geschichte auf eine bitterböse Dystopie hinauslaufen. Seit ein paar Wochen mache ich mir erste Notizen zu diesem Buch. Hier teile ich zunächst den Grundgedanken mit. Ich gehe übrigens davon aus, dass es ähnliche Geschichten in der unüberschaubaren Vielfalt des SciFi-Genres längst schon gibt, was mich aber nicht daran hindern soll, dieses Sujet zu meiner ganz persönlichen Ausgestaltung der künftigen Apokalypse zu nutzen.
Mein Interviewer könnte ein intelligenter Besucher aus einer fernen Galaxie sein, eine Art rasender Reporter im interstellaren Raum. Er sammelt für seinen Heimatplaneten Erfolgs- und Misserfolgsgeschichten intelligenter Zivilisationen aus dem ganzen All, wobei er an letzteren besonders interessiert ist. Seine Auftraggeber daheim, die ihn auf diese lange Reise geschickt haben, erhoffen sich nämlich von Auskünften über die diversen Apokalypsen, die sich in den Weiten des Weltraum in den vergangenen Jahrmilliarden ereignet haben, wertvolle Aufschlüsse zur Bewahrung ihrer eigenen Spezies. Allerdings sind solche Katastrophenberichte sehr selten, da der Untergang der meisten Zivilisationen so gründlich vonstattenging, dass nichts und niemand mehr zu dessen Ursachen befragt werden kann.
So traurig auch das Schicksal der Späthominiden auf Terra gewesen sein mag, haben sich auf diesem blauen Planeten doch immerhin ein paar hunderttausend Exemplare bis ins 14. Jahrtausend nach der lokalen Zeitrechnung hinübergerettet. Größtenteils vegetieren sie noch immer von der „Resteverwertung“ der versunkenen Großreiche. Bei seiner ersten Begegnung mit Überlebenden zweifelte der Interviewer, ob überhaupt eine Verständigung mit ihnen möglich sein würde. Immerhin deutete die geschickte Verwendung verschiedener Jagdwerkzeuge darauf hin, dass wenigstens die klügsten unter ihnen vielleicht über eine ausreichend differenzierte Mitteilungsform verfügen mochten, um Auskünfte über die Vergangenheit ihres Stammes geben zu können. Allerdings beschränkten sich die akustischen Lebensäußerungen der meisten Exemplare auf starke Gefühlsregungen, wie Schreien, Weinen, Jammern, Zetern und Kichern.
Dann begegnete der Interviewer einem Exemplar, das sich sowohl durch seine kraftvolle körperliche Erscheinung als auch durch ein feines Lächeln wohltuend von seinen Stammesgenossen abhob. Dass die Wesen auf diesem Planeten in zwei Hauptgruppen in Erscheinung traten, war augenfällig, denn sie waren unbekleidet und ihre diesbezüglichen Unterscheidungsmerkmale leicht erkennbar. Später erfuhr der Interviewer, dass es sich bei seinem Gesprächspartner der folgenden Wochen um ein weibliches, d. h. gebärfähiges Exemplar handelte.
Doris, wie es sich nannte, erwies sich als ein ausgesprochener Glücksgriff für unseren Reporter. Sie war nämlich die letzte ihrer Art, die noch in der Lage war, die zahllosen Informationskonserven auf dem Planeten, die den Weltenbrand unversehrt überstanden hatten, zu dechiffrieren. Und so konnte sie ihrem Gesprächspartner eine Fülle unschätzbar wertvoller Auskünfte darüber geben, wie es in knapp zehntausend Jahren zum rasanten Aufstieg und schließlich zum abrupten Untergang der Zivilisation ihrer Ahnen gekommen war.
Deutschland umsonst (I)
Monday, 04. July 2011Dieses Buch werde ich wohl damals stapelweise verkauft haben, im Jahr 1982, als es erschien. Die gebundene Ausgabe im Verlag Hoffmann und Campe in Hamburg ging drei Jahre lang weg wie geschnitten Brot, zehn Auflagen und fast hunderttausend Exemplare wurden zum Stückpreis von 28 Mark abgesetzt, und dann noch einmal so viel als Ullstein-Taschenbuch für 7,80 Mark. Üblicherweise ist ein Bestseller dann vom Tisch. Aber bei Michael Holzachs Reisebericht Deutschland umsonst wagte HoCa 1993 gar noch einen weiteren Aufguss, diesmal als Paperback für 18 Mark; und auch der war immerhin noch so erfolgreich, dass er es bis 2006 auf solze 13 Auflagen brachte! Was ist bloß dran an diesem Buch? Ich wollte es wissen und lese es gerade.
Den Anstoß zu meiner Erinnerung an den Bericht eines jungen Mannes, der „zu Fuß und ohne Geld durch ein Wohlstandsland“ wandert – so die bündige Zusammenfassung des Themas im Untertitel –, gab mir indirekt dessen ehemaliger Weggefährte, der Essener Fotograf Timm Rautert, der regelmäßig bei proust ausstellt und auftritt. Als ich mich in der Wikipedia über Rautert informierte, las ich über ihn, er habe seit 1974 für das ZEITmagazin „in enger Kooperation mit dem Journalisten Michael Holzach überwiegend sozialkritische Themen“ fotografiert. Ein Klick auf Michael Holzach und es machte Klick! Ich erinnerte mich augenblicklich wieder an dessen Dauerbrenner von vor nahezu dreißig Jahren. Dass der Autor 1983 auf so tragische Weise ums Leben gekommen war, wusste ich nicht – oder hatte es jedenfalls längst vergessen.
Die Erstausgabe von Deutschland umsonst bekam ich antiquarisch über ZVAB zum Preis von 10,40 €, zwar leicht schiefgelesen und, dem Geruch nach zu urteilen, aus einem Raucherhaushalt, aber ansonsten sauber und mit tadellosem Schutzumschlag – an den ich mich prompt erinnerte, als ich das Buch in Händen hielt. Das Titelfoto stammt von Rautert und zeigt den Autor mit seinem Hund Feldmann, einem Boxermischling aus dem Hamburger Tierasyl, der ihn auf seiner Wanderschaft begleitete und schließlich Holzachs Tod verursachte.
Wie es dazu kam, dass Holzach sich 1980 für ein halbes Jahr ohne einen Pfennig Geld auf den Weg machte und die Bundesrepublik von Nord nach Süd und wieder zurück durchwanderte, das beschreibt er ziemlich genau in der Mitte seines Buches, unmittelbar bevor er sich mit Timm Rautert an der Kanalbrücke in Altenessen trifft. Er empfand damals sein Leben als „sozial engagierter Journalist“ auf die Dauer als pure Heuchelei. Die ging ihm schließlich so sehr an die Nieren, dass er seinen guten Job bei der ZEIT an den Nagel hängte. Für ein Jahr lebte er bei der deutschstämmigen Wiedertäufersekte der Hutterer in Kanada, die einen urchristlichen Kommunismus praktiziert. (Auch über dieses Abenteuer schrieb er ein Buch, Das vergessene Volk.) Und dann, so Holzach, „grub ich meinen alten Plan wieder aus, eine autobiographische Wanderung durch Deutschland zu machen“ – autobiographisch insofern, als er all jene Orte aufsuchte, die in seinem Leben irgendwann eine besondere Rolle gespielt hatten, wie Holzminden, Heppenheim oder Bergisch-Gladbach.
Was Holzach unterwegs erlebt, lässt sich keineswegs auf einen einfachen Nenner bringen, obwohl das Buch sich damals vielleicht mittels solcher Vereinfachungen vermarkten ließ: ,Mitten im Wohlstandsland BRD herrscht das bitterste Elend und hält jene grausam umklammert, die einmal schuldlos aus der bürgerlichen Ordnung gefallen sind.‘ Das ist aber keineswegs die Botschaft, die das Buch vermittelt. Eher geht es um die Selbsterfahrung des Autors, der wissen möchte, was mit ihm geschieht, wenn er sich ohne Geld durchschlagen muss. Aber erklärt die Neugier am Verlauf eines solchen Experiments allein schon den sensationellen Verkaufserfolg dieses Buches? Das kann ich nicht recht glauben.
[Fortsetzung folgt. – Titelbild © Timm Rautert & Verlag Hoffmann und Campe.]
Ausflug zum Tetraeder
Sunday, 03. July 2011Vielleicht bin ich durch meine Hollandreise auf den Geschmack gekommen, vielleicht will ich aber auch zur Abwechslung mal nicht den Spielverderber geben, indem ich wie sonst alle Vorschläge zu Wochenendabenteuern vonseiten meiner nächsten Angehörigen empört von mir weise. Wie dem auch sei, ich willigte heute ein, meine Gefährtin samt Sohn, Schwiegertochter und Enkelkind bei einem kulturellen Sonntagsausflug im Revier zu begleiten. Ursprünglich war der Besuch der Ausstellung Krupp. Fotografien aus zwei Jahrhunderten geplant, die vor zwei Wochen in der Villa Hügel eröffnet wurde. Es stellte sich aber heraus, dass just an diesem Wochenende die Villa geschlossen bleibt. Den Grund erfährt man nicht. So disponierten wir kurzfristig um und beschlossen, unserer Schwiegertochter das Haldenereignis Emscherblick in Bottrop zu zeigen, kurz „Tetraeder“ genannt.
Wir fuhren mit der Straßenbahn Linie 105 bis zum Essener Hauptbahnhof und von dort mit S-Bahn Linie 9 bis nach Bottrop-Boy. Der Fußmarsch bis zur Halde an der Beckstraße, die mit 60 Metern Höhe einer der höchsten im gesamten Ruhrgebiet ist, erwies sich doch als weiter denn gedacht. Bald kam zwar der Tetraeder in Sicht und schien gar zum Greifen nah. Aber da der Weg hinauf in langgezogenen Serpentinen zu erklimmen ist, benötigten wir per pedes immer noch eine halbe Stunde, bis wir endlich auf dem Gipfel standen.
Ich war kurz nach der Eröffnung dieser Landmarke Mitte der 1990er Jahre schon einmal hier gewesen, erinnerte mich aber nicht mehr daran, dass man ja von hier oben aus tatsächlich einen Panoramablick weit hinaus ins Land hat. Seither hat die Natur die Industriebrache wieder in Besitz genommen. Ringsum ist alles grün, eine bunte Vielfalt von Bäumen und Buschwerk führt vor, dass die industriellen Verwüstungen glücklicherweise doch längst nicht immer so unumkehrbar sein müssen, wie man meinen sollte.
Ich habe mich schon bei der Errichtung des Bauwerks von Wolfgang Christ gefragt, warum ausgerechnet ein Tetraeder als Form für diesen „Aussichtsturm“ gewählt wurde. Ich dachte, dass es vielleicht einen Zusammenhang zur atomaren Struktur des Kohlenstoffs gäbe. Dass sich, wie es heißt, das „ebenmäßige Schüttungsprinzip der Halde“ in der Addition und Schichtung der Stahlrohrelemente zu Tetraedern wiederhole, scheint mir nicht unmittelbar einleuchtend. Immerhin habe ich heute gelernt, dass der innere Aufbau des Tetraeders aus dem Sierpinski-Dreieck abgeleitet ist – aber auch das hat wohl kaum einen inneren Bezug zur Region. Einen starken Eindruck machte bei meinem zweiten Besuch die linsenförmige Vertiefung aus künstlichem Berggestein, ohne dass ich mir so recht erklären konnte, was nun eigentlich in mir zum Klingen gebracht wurde, als ich diesen flachen Krater durchschritt.
Der Aufbruch vom Gipfel erfolgte dann etwas überstürzt, weil sich herausstellte, dass hier auch ein Elektrobus bis zum ZOB Bottrop verkehrt und wir diese Gelegenheit zu einer bequemen Rückfahrt nicht versäumen wollten. (Der nächste Bus wäre erst eine Stunde später abgefahren.) Auf dem Heimweg kreuz und quer durch Bottrop wurde uns wieder einmal bewusst, wie deprimierend manche Wohngegenden in unserer Heimatregion doch sind. Von Nahem sieht manches eben weit weniger erfreulich aus als aus der Distanz eines erhabenen Panoramablicks.
Zeilenschindereiverweigerung
Saturday, 02. July 2011Der Antrieb zum Schreiben bleibt in der letzten Zeit immer häufiger weg. Dann sitze ich für eine unbestimmte Zeit an meinem Schreibtisch, schaue abwechselnd auf den weißen Monitor und knapp über ihn hinweg durchs Fenster auf die gegenüberliegende Hausfassade mit der Hausnummer 41, frage mich, ob ich nicht vielleicht mal wieder eine längere Schaffenspause einlegen sollte, wundere mich, dass ich mich gedanklich in eine solche Versuchung bringe, da ich doch weiß, wie leicht sich ein kleiner Schlendrian zu einer hartnäckigen Schreibhemmung auswachsen kann und zwinge mich zuletzt dazu, wenigstens über meine Schwierigkeiten zu schreiben, wenn ich sie schon nicht beheben, mir noch nicht einmal erklären kann.
Ernest Hemingway, der sich heute vor 50 Jahren den Gnadenschuss gab, musste dem Vernehmen nach bis zuletzt seine 700 Wörter täglich aufs Papier bringen, sonst konnte er nicht schlafen, ob mit oder ohne Alkohol. (Vgl. Willi Winkler: Das verriegelte Paradies; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 150 v. 2./3. Juli 2011, S. 17.) Das ist zufällig auch etwa mein Mittelmaß für meine täglichen Postings in diesem Blog. Möglicherweise bin ich Anfang Mai in eine Falle gegangen, als ich mir versprach, hier keinen Tag mehr auszulassen, koste es was es wolle. Möglicherweise habe ich damit meine Schreiberseele dem Teufel verkauft, der mich holt, wenn ich dieser Verabredung mit mir selbst auch nur ein einziges Mal untreu werde. Und wohin wird er mich dann verschleppen? In die Hölle der Sprachlosigkeit? Aber was ich früher nicht für möglich gehalten hätte, das beobachte ich seither doch mit einigem Erstaunen, dass nämlich sture Disziplin tatsächlich ein taugliches Mittel ist, der Kreativität Beine zu machen; und dass das Gerede von der unberechenbaren Inspiration, auf die man nur warten könne und die sich nicht erzwingen lasse, dummes Gewäsch ist von Leuten, die keine Ahnung haben oder bloß eine Ausrede für ihre Faulheit suchen.
Was freilich die Qualität des Geschreibsels betrifft, das auf diese erpresserische Weise zustande kommt, so mögen sie andere beurteilen, mir steht es nicht zu. Das hindert mich zwar nicht, eine Meinung davon zu haben, doch die ist sehr wechselhaft, was mir gelegentlich die Laune verdirbt. Ich glaube, ich wiederhole mich, indem ich bekenne, dass mir manche meiner älteren Beiträge in diesem Blog so sehr viel besser gefallen als die aktuellen. Gründe dafür weiß ich keine, tröste mich aber immerhin damit, dass es mir andersherum auch nicht gefiele, denn dann geriete ich vermutlich in die Versuchung, ältere Beiträge zu löschen.
Gelegentlich hadere ich mit den Grundgegebenheiten dieser Publikationsform „Weblog“: dass bloß die letzten sieben Artikel ohne Umstände sichtbar sind, und nur der allerneueste auf Anhieb. Und selbst den kann der Leser nur bis zu Ende lesen, wenn er abwärts scrollt, das heißt: die Bildschirmdarstellung gleitend verschiebt. Für die übrigen 860 Artikel muss er Schritt für Schritt auf „Ältere Einträge“ klicken. Ein mühsames Geschäft! Wer macht das schon? Zwar kann er sich thematisch verwandte Artikel durch einen Klick auf die passende Kategorie zusammenstellen. Aber ich bin da ganz der nüchterne Skeptiker: Das große, noch immer im Wachsen begriffene „Gesamtwerk“ meiner Blog-Artikel nimmt kein Mensch zur Kenntnis. Vielleicht gibt es eine winzig kleine Schar von treuen Lesern, die von Anfang an einigermaßen regelmäßig bzw. gelegentlich immer mal wieder hier vorbeischauen; aber dann wohl hauptsächlich, weil sie mich persönlich aus dem „realen Leben“ kennen. Von einer echten literarischen Wirkung über diesen engen Bekanntenkreis und über den Tag hinaus kann jedenfalls sicher keine Rede sein. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, dann ich habe nicht vor, meine Lieferungen auf die Kundenwünsche auszurichten, wie ich es in meiner Zeit bei Westropolis vorübergehend getan habe.
(Bis hierher waren es genau 600 Wörter. Doch es wäre ja wohl gelacht, wenn ich das letzte Siebtel zum vollen Hemingway-Pensum nicht auch noch hinbekäme! Dabei soll mein Kopf- und Handwerk aber keinesfalls zur plumpen Zeilenschinderei ausarten. Mein Ehrgeiz zwingt mich vielmehr dazu, die verbleibende Zeit meines Lesers so sinnvoll wie eben möglich zu nutzen. Er soll den Eindruck mitnehmen, es habe sich gelohnt, auch diesen letzten, fünften Absatz zu lesen; und das, obwohl er doch in Klammern steht und daher der Verdacht nahelag, dass er nicht ganz so wichtig wäre wie die vorangegangenen vier. – Jetzt fehlen mir die Worte!)
Protected: Christ-Birne (X)
Friday, 01. July 2011Plan einer Trendbuch-Analyse (1955-2005)
Wednesday, 29. June 2011Vor drei Jahren wurde ich von meiner Ansprechpartnerin bei Westropolis mal gebeten, einen „Beitrag über die Literatur der 1980er Jahre“ zu schreiben. Auf meine Nachfrage, was genau damit denn gemeint sei, stellte sich heraus, dass es um die in Deutschland damals erfolgreichsten Bücher gehen sollte, und unter diesen dann möglichst um solche, die den „Geist des Jahrzehnts“ besonders gut zum Ausdruck brächten. Das dürften Romane so gut wie Sachbücher sein! Die anderen freien Autoren des Kulturblogs der WAZ-Mediengruppe sollten parallel dazu die Musik, die Kunst, den Film und die Mode der 80er in Erinnerung bringen.
Wenn ich mich nicht sehr irre, war ich dann schließlich der einzige Gastautor, der den Auftrag ernst nahm und sein Soll erfüllte; kein Wunder, denn es stellte sich bald heraus, dass die Aufgabe mit einigem Aufwand verbunden war. Dabei hatte ich noch einen berufsbedingten Startvorteil, war ich doch im fraglichen Jahrzehnt ohne Unterbrechung als Buchhändler mit allen damals aktuellen literarischen Trends hautnah in Berührung gekommen. Und dennoch erswies sich ein erstes Brainstorming noch nicht als sehr ergiebig, zumal ich bei jedem zweiten Titel, der mir spontan einfiel, nicht hundertprozentig sicher war, ob er denn nun wirklich in diesem Jahrzehnt das Licht der Welt erblickt hatte. Ich hatte also einiges zu recherchieren und musste zudem die Spiegel-Bestsellerlisten der Jahre 1981 bis 1990 durchsehen, um meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen.
Was dabei herauskam, waren zwei Folgen Literatur der Achtziger, eine über Sachbücher und eine über die Belletristik dieses Dezenniums. In diesem Falle glaube ich nicht, dass es sich lohnt, meine alten Texte für Ostropolis zu überarbeiten. Sehr wohl aber scheint mir ihr Thema noch immer reizvoll, wenngleich nicht mit der willkürlichen Limitierung auf ein Jahrzehnt. Dass jedoch der Erfolg von Büchern etwas aussagt über das Denken und Empfinden der Menschen in der Zeit, in der diese Bücher – zur Freude ihrer Verleger und der Buchhändler – jene als Leser in großer Zahl für sich gewinnen, das erscheint mir immer noch evident und einer eingehenderen Betrachtung würdig.
Wenn von Erfolgsbüchern die Rede ist, dann meint man damit entweder Bestseller oder Kultbücher. Beide Begriffe möchte ich mit jeweils guten Gründen für mein Projekt vermeiden. Die reine Auflagen- bzw. Absatzzahl erscheint mir als Maßstab für die Wirkung eines Buches fragwürdig, sagt sie doch noch nichts darüber aus, ob der reißend verkaufte Schmöker auch gelesen wurde. Bestes Beispiel ist für mich hier immer Das Foucaultsche Pendel von Umberto Eco, das sich als Nachfolger seines populären Meisterwerks Der Name der Rose verkaufte wie geschnittenes Brot, aber die meisten Leser maßlos enttäuschte. (Ich persönlich kenne nur zwei Menschen, die von dem 750 Seiten starken Buch mehr gelesen haben als die ersten fünfzig.) Viele Erfolgsautoren sind da ja zugleich anspruchsloser und geschickter als Eco. Wenn sie einmal ein literarisches Erfolgsrezept gefunden haben, dann kochen sie daraus Jahr für Jahr ihr immergleiches Süppchen und haben ausgesorgt. Auch diese Art Serien-Bestseller von Leuten wie Johannes Mario Simmel, Heinz G. Konsalik, Donna Leon oder Georges Simenon sagen mindestens eins über ihre Leser aus: dass sie die Wiederholung des Immergleichen, längst Vertrauten lieben. Hohe Verkaufszahlen täuschen also starke Wirkung oft nur vor. Und das imposante Wort vom Kultbuch scheint mir ebenfalls für meine Absichten ungeeignet, da irreführend. So werden nach meiner Beobachtung nicht selten Bücher genannt, deren Titel jeder kennt, bei deren Nennung auch jeder ein mehr oder weniger deutliches Bild vor Augen hat – und die doch kaum jemand wirklich gelesen hat. Der Name sagt es ja schon deutlich: Kultobjekte werden aus der Distanz verehrt, vor allzu unmittelbarer Begegnung schützt sie ein stillschweigendes Berührungsverbot. Auch eilt ihnen meist der Ruf voraus, dass sie schwer zugänglich sind. Die Wirkungsgeschichte von Kultbüchern gibt indirekt zwar auch Auskunft über den Zeitgeist, doch soll dieser Aspekt hier nicht mein Thema sein.
Mir geht es vielmehr ganz banal um gesellschaftliche Trends, die sich im meist kurzlebigen Erfolg einzelner Bücher spiegeln. Die Frage, die sich mir in jedem einzelnen Fall stellen wird, lautet deshalb zunächst: Woher rührt das Interesse für gerade dieses spezielle Thema, das im vorliegenden Buch erstmals, oder doch erstmals auf diese Weise, abgehandelt wird? Und anschließend denke ich darüber nach, welchen der bekannten Grundrichtungen langfristiger sozialer Entwicklung dieses Interesse entspringt. Vielleicht komme ich aber auch zu dem Ergebnis, dass Bücher gerade deshalb erfolgreich sind, weil sie sich den vorherrschenden Trends verweigern und einen völlig neuen Ton anschlagen, der Neugier weckt. Insofern will ich das Ergebnis meiner Untersuchung offen halten. Ich beschränke mich bei meiner Studie auf die Zeit von 1955 bis 2005 und auf Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum.
Protected: Schlammschlacht um Kate Moss
Tuesday, 28. June 2011Einfallslosigkeit
Monday, 27. June 2011Es kommt vor, dass ich nicht weiß, was ich schreiben soll. Alle gewöhnlichen Mittel gegen diese Einfallslosigkeit versagen. Die Buchrücken schauen wie blöde Schafe auf mich herab, und ich schaue mutmaßlich ebenso blöd zurück. Ich denke darüber nach, was mir jüngst widerfahren ist, und gähne. Ich schaue aus dem Fenster auf die Schaufenster des seit Jahrzehnten geschlossenen Haushaltswarenladens gegenüber. Siebenschläfer. Es müsste leise nieseln, damit wenigstens das Wetter zur Leere in meinem Schädel passte. Aber höhnisch brät die Sonne die toten Fliegen auf meinem Fensterbrett gar.
Radiohören! Eben wird der 38-jährige Timm Klotzek zu seinem Wechsel von Neon und Nido zum SZ-Magazin befragt; ob ihm die Trennung schwer falle. Wörtlich sagt der Chefredakteur: „Ich glaube, der Wehmut wird erst später kommen.“ Habe ich richtig gehört? Ich habe richtig gehört. Vielleicht ist heute der Wermut zu früh gekommen. Na, das kann ja heiter werden. Aber einen eigenen Beitrag weiß ich aus diesem Lapsus nicht zu machen.
Ich könnte ja mit der Kamera vor die Tür treten und den nächstbesten Schnappschuss zum Anlass eines Textes machen, zur Kategorie Snapshot, oder Flanerie, oder Rêverie. Eine nicht gestellte Momentaufnahme, die mich vor die Aufgabe stellt herauszufinden, was der tiefere Sinn dieses Zufallsarrangements sein könnte. Die Welt ist doch so rätselhaft, so bizarr, so erklärungsbedürftig. Oder? Ich gähne schon wieder. Und außerdem kann ich gar nicht vor die Tür treten, denn ich warte auf einen Klempner, der im Keller ein leckes Rohr flicken soll.
Vielleicht sollte ich heute einfach mal wieder pausieren. Es ist doch keine Schande, wenn einem mal die Puste wegbleibt, oder? Was war das am 1. Mai – Tag der Arbeit! – bloß für ein dummer Einfall, mir beim Schreiben für mein Blog ab sofort keinen einzigen Tag Pause mehr zu gönnen? Dieser Ehrgeiz ist ja schon nahezu krankhaft!
Was sagt übrigens das Dienstpersonal zu meinen Nöten? „Gespräch meines Zimmerkellners mit dem Küchenmädchen über meine letzten Aphorismen. Er: ,Wenn man nur wüßte, wo der Mensch diese Einfälle alle hernimmt!?‘ Sie: ,Er hat doch den ganzen lieben Tag nix anderes zu tun!‘“ (aus Peter Altenberg: Fechsung; hier zit. nach Das Buch der Bücher von Peter Altenberg. Göttingen, Wallstein Verlag, 2009, Bd. 2, S. 475.) Und schon ist wieder ein Posting fertig. Etwas zerstreut ist es zugegebenermaßen geworden, aber doch drall und rund. Geh jetzt unter die Leut’; geh spielen!
Protected: Bücherdämmerung (III)
Saturday, 25. June 2011Memogramm der Hollandreise (Tag II)
Friday, 24. June 2011Erstmals gegen sechs Uhr im Dienstmädchenbett aufgewacht. Dann der verabredeten Frühstückszeit um acht Uhr entgegengeschlummert. Den Sohn hält es länger in den Federn. Die Kinder machen sich auf den Schulweg, gebeutelt von einer Prüfungswoche mit vielen Klassenarbeiten hintereinanderweg, offenbar eine Spezialität des niederländischen Schulsystems. Tom fährt zum Jachthaven in Stavoren, wo seine Leihboote liegen. Zum Wochenende kommen die Boote vom Meer zurück und müssen an neue Mieter übergeben werden.
Annette zeigt uns nun Workum. Der Sohn kennt das Städtchen schon aus Kindertagen, hat er doch hier mit seinen Geschwistern und der Mutter mehrere Ferienaufenthalte erlebt und nach glaubhaftem Bekunden in bester Erinnerung behalten. Ich hingegen betrete Neuland. (Schon damals war mir die seltene Ruhe daheim an meinem Arbeitsplatz wertvoller als der bei den meisten Mitmenschen so beliebte Tapetenwechsel.) Als uns durch eine schmale Gracht ein Segler mit dem Namen Tijdgeest entgegenkommt, verschlägt ’s mir fast die Sprache. Wie das Boot so ruhig dahingleitet, kommt es mir vor wie ein Gleichnis auf die mir oft so unbegreifliche Paniklosigkeit meiner Zeitgenossen.
Nun ist uns doch noch unser Museumsbesuch vergönnt, und was für einer! Das Werk des malenden Lumpensammlers Jopie Huisman beeindruckt durch seine planvolle Entwicklung. Offenbar ist der Mann sehr überlegt an seine selbstgestellte Aufgabe herangegangen und hat seit den frühen 1960ern zunächst maltechnisch allerlei ausprobiert, bevor er schließlich nach Jahren seine persönliche Handschrift und seinen Blick auf die Dinge fand. Diese Dinge waren vor allem die verachlässigten, abgenutzen Gegenstände, die seine Mitbürger fortwarfen und die auf seinem Karren landeten. Viel Fleiß und Sorgfalt steckt in seiner Malerei und Zeichenkunst. (Imposant auch Huismans Kollektion von Gewichtskästen und Waagen, mit der er die lange Geschichte des Betrugs zu dokumentieren trachtete, denn viele Gewichte sind durch unscheinbare „Abnutzungen“ offenbar leichter, als ihr Nennwert vorgibt.)
Anschließend besichtigen wir Toms Arbeitsplatz und seine Boote, deren Namen mit C beginnen und auf A enden, wie Carolina, Caba oder Camilla. So heißt das komfortabelste Schiff dieser Reihe zufällig wie meine Enkelin. Ungeschickt wie ich bin, reiße ich in einem anderen Boot, das wir uns von innen anschauen, die Klinke einer Schlafkojentür aus der Verankerung, was mir für eine unanständig lange Zeit die Stimmung verdirbt. Dabei ist der Schaden, den ich damit angerichtet zu haben fürchte, doch viel geringfügiger und leichter behebbar, als ich mir einrede und man mich im Scherz wohl auch glauben machen will. Ich ahne den Schabernack und mime nun so lange den arglos leidenden Übeltäter, bis Tom mich aus meinem Verdruss erlöst, indem er mir offenbart, wie geringfügig der Aufwand einer Reparatur doch eigentlich sei.
Mein Sohn und ich gönnen uns schließlich einen frischen Kabeljau aus der besten Bratküche von Stavoren. Einen so köstlichen Fisch habe ich lange nicht mehr gegessen. Mein Sohn hatte beschlossen, von hier aus per Fähre übers IJsselmeer nach Enkhuizen und von dort mit der Bahn zurück nach Amsterdam zu fahren. So nehmen wir am Steg Abschied von ihm und winken, bis das Schiff außer Sicht ist. Annette packt in Workum ihre sieben Sachen und wir fahren gemeinsam mit dem Automobil in unser beider Heimatstadt. Unterwegs nutzen wir die Gelegenheit zum Austausch über Themen, die nur uns beide interessieren. Die wenigen Gesprächspausen stopfen wir mit ein paar Liedern von Hindi Zhara. Um fünf Uhr nachmittags bin ich wieder daheim.
Memogramm der Hollandreise (Tag I)
Thursday, 23. June 2011Wecker 5:25 Uhr. Eine Tasse Kaffee, zwei Brote mit Kochschinken. Fußweg zum Rathaus Rellinghausen bei trockenem Wetter, angenehm kühl, klare Luft, Vogelgezwitscher. Mit dem Nachtexpress-Bus, den ich noch nie genutzt habe, zum Hauptbahnhof Essen, von dort mit einem weiteren Nachtexpress-Bus zum Oberhausener Hauptbahnhof. Von dort mit dem ICE über Duisburg, Arnhem, Utrecht nach Amsterdam. Ankunft pünktlich um halb zehn, wo der älteste Sohn und seine friesische Freundin Gerda mich gut gelaunt erwarten. Zum Harnabschlagen und auf einen Weckkaffee in ein rummeliges Restaurant mit überforderten Kellnern noch im Centraal-Bahnhof.
Per Straßenbahn dann in Gerdas Wohnung in der Marco Polostraat. Nach kurzem Aufenthalt zu dritt großer Spaziergang, unter andrem durch den schönen Vondelpark bis ins Museumsviertel. Nach Abwägung von Kosten und Nutzen werden aber Ausstellungsbesuche, ob im Van Gogh Museum oder im Rijksmuseum, einstimmig verworfen. Einkehr auf Bierbänken vor einer kleinen Gaststätte. (Kann man dann eigentlich von „Einkehr“ sprechen?) Aß eine sehr fruchtige Tomatensuppe mit bestem Appetit, aber glücklicherweise vor Inaugenscheinnahme der sanitären Anlagen, die mir diesen möglicherweise verdorben hätte.
Unterdessen stets angeregte Unterhaltung über disparate Gegenstände, wie sie uns die durchwanderten Stadtkulissen gerade zutrugen. Eindrücklich etwa Gerdas Schilderung vom wilden Leben und tragischen Tod des niederländischen Musikers, Küstlers und Enfant terribles Herman Brood, der sich vom Dach des Amsterdamer Hilton-Hotels herabstürzte, weil ihm seine Drogensucht übern Kopf wuchs. (Dass dieses traurige Ereignis sich zufällig an meinem bevorstehenden Geburtstag zum zehnten Mal jährt, erfahre ich gerade erst beim Nachlesen des Wikipedia-Artikels über Brood.) Auf dem Rückweg Einkauf bei Albert Heijn, einer Ladenkette, bei der die muslimischen Kassiererinnen allesamt schwarze Kopftücher trugen.
Rechtzeitig zurück in Gerdas Wohnung, um den für fünf Uhr nachmittags verabredeten Besuch Annette B.s aus Workum abzuwarten, die uns nach dorthin mit ihrem Automobil abholt. (Leider kann Gerda nicht mitkommen, weil sie am nächsten Tag beruflichen Verpflichtungen nachzukommen hat. Oder waren es Verpflichtungen im Zusammenhang mit der überaus problematischen Wohnungssuche? Es ist nahezu unmöglich, in dieser Stadt eine akzeptablie Mietwohnung zu finden, wenn man sich hierum nicht entweder schon vor vielen Jahren angemeldet hat oder doch mindestens das Einommen eines Chefarztes oder die Beziehungen eines Immobilienmaklers hat.) So gehen wir zu dritt ohne Gerda auf die Suche nach einer italienischen Gaststätte oder einer holländischen Pommesbude und finden kurz vorm Verhungern in der Jan van Galenstraat tatsächlich die kleine Pizzeria Martini mit originellem Ambiente und freundlicher Bedienung durch den Inhaber. Anschließend fahren wir über den fast dreißig Kilometer langen Afsluitdijk durchs IJsselmeer nach Workum.
Tom und die Kinder begrüßen uns. Hausbesichtigung und Tagesausklang. Zu Bett im „Dienstmädchen-Zimmer“. Fülle der Eindrücke hindert mich zunächst am Einschlafen. Lese darum noch in einem beliebig aus dem Bücherregal gegriffenen Suhrkamp-Bändchen aus dem Bestand von Annettes verstorbener Schwester Karin: Edmund Wilsons Auf dem Weg zum Finnischen Bahnhof. Bedrückende Schilderungen des Lebens der arbeitenden Bevölkerung im Manchester des XIX. Jahrhunderts. – Traum von einem gefluteten Keller, in dem quietschend die Ratten ertrinken.
Star-Dreck
Tuesday, 21. June 2011Was sind die beiden beherrschenden Themen in den dominierenden (d. h. bestverkäuflichen) Massenmedien (Boulevardpresse und Privatfernsehen)? Ganz einfach: „stars and strokes“, Prominente und Katastrophen. Das ist natürlich nicht etwa so, weil die Medienmacher keine anderen Einfälle hätten, sondern weil ihre Kunden keine anderen Bedürfnisse haben als eben diese beiden: Identifikationslust und Sensationsgier. Welcher Mann möchte nicht so cool wie Humphrey Bogart, so stark wie Arnold Schwarzenegger und so smart wie Tom Cruise sein? (Da darf man schon mal darüber hinwegsehen, dass Bogie ein schwächlicher Kettenraucher war, Arni ein Befürworter der Todesstrafe ist und Tommy sich als Aushängeschild für eine obskure Sekte hergibt.) Und welche Frau möchte nicht sexy wie Marilyn Monroe sein, klug wie Jodie Foster und erfolgreich wie Angela Merkel? (Macht ja nichts, dass Norma Jeane Baker an ihrer Anziehungskraft auf Männer schließlich elend zu Grunde ging, Jodie den Reagan-Attentäter Hinckley zu seinen sechs Schüssen auf den Präsidenten inspirierte und Angie, man mag es drehen und wenden wie man will, in ihrem öffentlichen Erscheinungsbild doch eine sehr fade und langweilige Person bleibt.)
Entscheidend fürs Image der Promis sind stets rein quantitativ messbare Werte: die Höhe der Gage, die Zahl der Fans, Einschaltquoten in der Glotze und Besucherzahlen in den Kinos, ausverkaufte Stadien und beeindruckend viele Klicks auf ihre „persönlichen“ Websites, möglichst hohe Positionen in Rankings („5 Oscars“, „über 90 Zentimeter Brustumfang“) und undurchdringliche Trauben von Fotografen vor den Entrees sündhaft teurer Hotels, Torschussstatistiken und ununterbrochene Serien von K.-o.-Siegen. Das Guinness-Buch der Rekorde ist zu einem guten Teil auch ein Almanach des Starkults unserer Tage. Eine immer ärmer werdende Menschenwelt lechzt zunehmend nach dem Weltrekord, bis in die letzten vernetzten Winkel von Hintertupfingen und der mongolischen Wüste. Und der armselige Star – verfolgt von Stalkern, Paparazzi und seinen eigenen Süchten – ist Täter und Opfer zugleich. Er zieht einen Schweif von Fans hinter sich her, der seiner Eitelkeit schmeichelt; und ist doch zugleich nur ein „Mensch wie jeder andere“: zwei Arme, zwei Beine und ein von diesem Spektakel überfordertes Hirn.
So, knapp charakterisiert, funktioniert die Maschinerie der Identifikationslust, die 99 Hundertstel von uns in ihren Bann zieht. Suche nach einem Menschen, der nicht weiß, wer Diana oder Elvis waren – dann kannst du vielleicht noch ein ursprüngliches Gespräch mit ihm führen. Wir sind alle verseucht von diesem Kult profaner Götter. Der vergängliche Ruhm dieser Götzen hat längst schon unser freies Denken paralysiert. Und nun tritt uns noch unsere unausrottbare Sensationslust in die Kniekehlen und besorgt den Rest, dass wir, täppische Affen, kaum noch eine Chance haben dürften, unseren Fortbestand aus diesem Jahrhundert ins nächste zu retten.
Was zwingt denn Millionen Fernsehzuschauer bei den alljährlichen Formel-I-Rennen vor den Bildschirm? Ich behaupte keck und frech: die Hoffnung auf einen katastrophalen Unfall. Wenn Michael Schumacher auf dem Nürburgring aus der Bahn getragen worden wäre, trotz aller Sicherungsmaßnahmen, und am Rande der Strecke zu einem Häuflein Asche verkohlt – dann, ja genau dann wären endlich die heimlichen Hoffnungen der sensationslüsternen Zuschauer erfüllt worden. Und in den folgenden Tagen wären die Einschaltquoten so hoch gewesen wie nie zuvor. Und da es doch letztlich immer ums Geld geht, wäre dieses traurige Ereignis das Optimum gewesen für den wirtschaftlichen Erfolg seiner Vermarkter. Insofern ist auch der Doping-Skandal bei der Tour de France ein Erfolg für die medialen Ausbeuter dieses Großevents. Die sportliche Konkurrenz als sauberer Vergleich ehrlicher Athleten passt doch längst nicht mehr in unsere nach persönlichen Tragödien und steilen Abstürzen gierende Welt des Starkults. Je maßloser wir unsere Stars in den Himmel der Unerreichbarkeit heben, desto tiefer wollen wir sie fallen sehen. Das ist nun einmal Gesetz in diesem schmutzigen Geschäft, in dem nur jene Vergötterung des Menschlich-Allzumenschlichen Bestand für die Ewigkeit haben kann, die noch zu Lebzeiten in den Abgrund völligen Versagens stürzt. Allein dieses Spektakel macht uns unser eigenes, schmalspuriges, blasses Alltagsleben noch einigermaßen erträglich. Und wenn dann beides gar zusammenfindet: die Gier nach der katastrophalen Sensation und die Lust an der Identifikation. Dann kocht das Star-System über und der Rubel rollt. Wie schön wäre es doch für den Moloch, wenn er solche Meldungen wie diese in die mediale Schein-Welt hinausschleudern dürfte: Kate Moss (aktueller Body-Mass-Index 16,9) erschießt ihren Ex-Geliebten Pete Doherty in der Empfangshalle des Berliner Hotels Adlon; Königin Elisabeth II. von England gibt zu, den Mord an ihrer Ex-Schwiegertochter Diana in Auftrag gegeben zu haben, weil sie diese beim inzestuösen Geschlechtsverkehr mit Enkel William im Buckingham-Palast ertappt hatte; die Pariser Zeitschrift Paris Match veröffentlicht das Faksimile eines Vertrags von Zinédine Zidane mit dem italienischen Fußball-Dachverband Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), aus dem hervorgeht, dass sein legendärer Kopfstoß gegen Marco Materazzi kurz vor Schluss des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Berlin verabredet und mit sieben Millionen Euro honoriert wurde.
Das wollt ihr doch hören, oder? Auf Sensationsnachrichten dieses Formats müsst ihr lüstern-lechzenden Fans wohl noch ein Weilchen warten. Aber sie werden kommen – so oder so ähnlich. Wartet ’s nur ab! Und dann? Was habt ihr davon? Ich würde euch so gern verstehen. Aber ich bin wohl zu dumm dazu.
[Dieses Posting erschien zuerst am 30. August 2008 bei Westropolis unter gleichem Titel. Es erscheint hier ungekürzt und wurde für die Neuaufnahme in mein Revierflaneur-Blog nur geringfügig überarbeitet. Das Titelfoto stammt vom Revierflaneur.]
Zwiegespräche mit Schriftwerkern
Friday, 17. June 2011Als ich vor drei Wochen mit großem Vergnügen die Schriftsteller-Interviews aus der Paris Review in der soeben erschienenen deutschen Übersetzung las, da fragte ich mich, warum es in Deutschland kein ähnlich ambitioniertes Unternehmen gab und gibt: Autoren nicht nur en passant zu befragen, wie es regelmäßig in unseren Zeitungs-Feuilletons geschieht, meist anlässlich des Erscheinens eines neuen Buches; sondern grundsätzlicher, zu ihrer Arbeitsweise, ihren Schreibtechniken, ihren innersten Anliegen, ihren Vorbildern und so weiter. Als einziges ungefähr dem amerikanischen Vorbild angenähertes deutsches Beispiel fielen mir spontan die Werkstattgespräche mit Schriftstellern ein, die Horst Bienek Anfang der 1960er-Jahre mit 15 zeitgenössischen deutschsprachigen Schriftstellern geführt hat (München: Carl Hanser Verlag, 1962).
Dieses Buch war für mich eine wichtige Orienierungshilfe, als ich mir als lesehungriger 15-Jähriger einen Überblick über die damals modernen Autoren verschaffen wollte. Das Wörtchen „modern“ bezeichnete für mich die conditio sine qua non bei der Auswahl meines Lesestoffs in der Stadtbibliothek. Aus einem naiven Vorurteil heraus lehnte ich alle ältere Literatur ab. Ich war überzeugt, dass mir nur lebende Autoren etwas über die gegenwärtige Welt würden sagen können, am besten noch junge lebende Autoren. Warum sollte für Bücher nicht gelten, was doch auch für alle anderen Industrieprodukte galt? (Dass nämlich nur das jeweils Neueste, Modernste für den Zeitgenossen das Beste und Brauchbarste sein konnte.)
Es überforderte mich allerdings, Romane von allen 15 Autoren zu lesen, die Bienek interviewt hatte. Darum nahm ich einige in die engere Wahl, die mir den Gesprächen nach zu urteilen am meisten zusagten. Wenn ich mich recht erinnere, gefielen mir Alfred Andersch und Martin Walser besonders gut, während mir Robert Neumann, Hermann Kesten und Friedrich Sieburg vorkamen, als gehörten sie eigentlich schon nicht mehr in die Gegenwart. Zu unmodern! Ich kann nicht einmal verhehlen, dass ich mich auch von den Porträtfotos beeinflussen ließ, die dem Band beigegeben sind. In diesem Alter ist es wohl verzeihlich, dass man noch sehr auf Äußerlichkeiten achtet. Von Walser lieh ich ein Buch aus – um es schon nach ein paar Seiten wieder aus der Hand zu legen. Was war das denn? Als ich auch im zweiten Anlauf überhaupt nicht mit diesem sonderbaren Büchlein zurechtkam, entdeckte ich, dass ich irrtümlich Prosatexte eines Robert Walser gegriffen hatte, der ja schon längst tot war! Angewidert brachte ich das Bändchen aus der Bibliothek Suhrkamp zurück und entlieh stattdessen Ehen in Philippsburg vom „richtigen“ Walser, ohne indes damit wesentlich mehr anfangen zu können.
Heute nahm ich Bieneks Buch, das ich mir vor ein paar Jahren antiquarisch beschafft hatte, wieder einmal zur Hand. Und was erfahren wir gleich zu Beginn des Vorworts über den „Anlaß“, der den Herausgeber zu seinem Vorhaben angeregt hatte? „Vor Jahren las ich in der amerikanischen Zeitschrift Paris Review ein Interview mit William Faulkner; ein junger Autor, Jean Stein, hatte den amerikanischen Romancier besucht und mit ihm über ,Werkstattprobleme‘ eines Schriftstellers gesprochen. Die Antworten Faulkners haben mir ein tieferes Verstehen seiner Yoknapatawpha-Welt ermöglicht, sie waren für mich ein Schlüssel, eine Art authentischen Kommentars zur Struktur seiner Romane: Ich erfuhr mehr daraus als aus allen Essays über ihn.“ (Bienek, a. a. O., S. 7.)
Ich habe das Faulkner-Interview soeben gelesen. Es hat mich in meinem Vorurteil bestärkt, dass Faulkner kein Autor ist, der mich interessieren könnte. Schon die Unverrückbarkeit seiner Standpunkte stößt mich ab, seine maskuline Selbstsicherheit. Dazu passt, dass er voreilig schlussfolgert und sich zu Gegenständen äußert, von denen er offenbar nicht die geringste Ahnung hat. Jean Stein bittet ihn, sich zur Zukunft des Romans zu äußern. “I imagine as long as people will continue to read novels, people will continue to write them, or vice versa; unless of course the pictorial magazines and comic strips finally atrophy man’s capacity to read, and literature really is on its way back to the picture writing in the Neanderthal cave.” (Paris Review No. 12 / Spring 1956.) – Wo ein Bedarf ist, finden sich Leute, die sich dafür bezahlen lassen, ihn zu decken? Das geht noch hin. Aber dass sich, „vice versa“, auch immer Leute finden, die ein Produkt abnehmen, bloß weil es in die Welt gesetzt wird, ist schlicht Blödsinn! Und mit seiner kulturpessimistischen Unkerei, dass die zeitgenössische Menschheit zum Neanderthaler regrediert, wenn sie ihre Kinder Comics lesen lässt, kommt mir Mr. Faulkner vor wie ein bornierter Spießer aus den miefigen 1950er-Jahren.
Immerhin
Wednesday, 15. June 2011Der Blick ins genau zehn Jahre alte Flourit-Kapitel des Zufall förderte keine neuen Erkenntnisse, sondern bloß ein paar Erinnerungen zutage. Man schreibt das erste Jahr des noch unschuldigen neuen Jahrtausends. Ich erscheine mir im Rückblick wie eine gefangene Motte, die zwischen verschiedenen gefährlichen Flammen hin- und herflattert. Es war noch nicht lange her, dass ich mein Souterrain zugunsten meines Ältesten aufgegeben hatte und in die obere Wohnung gezogen war. Dort schlief und schrieb ich eine Zeit lang im hinteren, zur Terrasse gelegenen Zimmer. Meine Brotarbeit empfand ich fast nur noch als lästige Routine, bei der die einzige Herausforderung darin bestand, eine möglichst heitere Miene zum faden Spiel zu machen. Und über diesem Szenario, das vielleicht tatsächlich bei allem Wohlstand eine Hölle war, lag Tag für Tag der dichte Nebel einer schweren Betäubung. Ich war wohl eine jener bemitleidenswerten Existenzen, von denen man spöttisch sagt, es gehe ihnen zu gut.
Immerhin hatte ich meine Freude an Wortspielen, Witzen und Rätseln noch nicht ganz eingebüßt. Und mein makaberer Humor lag immer auf der Lauer nach einem Bonmot, mit dem ich schlichtere Gemüter aus der Fassung bringen konnte. Um nicht zu versauern redete ich mir ein, dass ich nebenher meine hochtrabenden Projekte vorantrieb. Was war es doch gleich damals noch für eines? Richtig! Vor zehn Jahren wollte ich meine ganz persönliche Bibliothek der Weltliteratur zusammenstellen, bestehend aus tausend Bänden aller Zeiten und Länder, Dichtung so gut wie Philosophie und Wissenschaften umfassend. Und jedes dieser Werke wollte ich überaus gründlich lesen, um im Anschluss einen brillianten Essay zu schreiben, in dem seine Vorzüge, seine Einzigartigkeit und sein Wert für die Zukunft ausgemessen würden.
Vor zehn Jahren hatte ich gerade Theodor W. Adornos Gedankenbuch Minima Moralia aus der Hand gelegt und begann mit der Lektüre von Joseph Roths Roman Radetzkymarsch. Und was wurde daraus? Natürlich nichts Gescheites! Warum sollte auch gerade ich der Mann sein, dem zu jedem der großen Bücher der Weltliteratur etwas einfiele, worauf noch kein anderer gekommen war? Wenn ich mir die zahllosen Projekte vor Augen führe, die ich im Laufe von Jahrzehnten entworfen, eine Weile verfolgt und dann wieder verworfen habe, dann erscheine ich mir wie jemand, der sich selbst unablässig den großen Weltenrichter vorgespielt hat und dabei doch nur ein alberner Hanswurst war, Opfer einer größenwahnsinnigen Selbsttäuschung. Andererseits war ich immerhin nie ganz untätig. Die Pläneschmiederei hielt mich auf Trab. Ich schrieb unentwegt, ich las ein Buch nach dem anderen. Geschadet hat mir das kaum.
Zum Schluss dieses 166. Kapitels schrieb ich, wieder einmal voller Hoffnung auf eine Besserung meines Zustands: „Immerhin habe ich meinen blauen Ohrensessel nun so gestellt, dass ich den Blick frei habe in den Garten; daneben den Schachtisch, den ich allerdings bei nächster Gelegenheit einmal gründlich restaurieren muss. Zu sorgen ist nun vor allem noch für eine optimale Beleuchtung (von oben, von der Konstruktion des Hochbetts herab). Neben den Bleistiften und Karteikärtchen zum Exzerpieren von Zitaten und Gedanken sollen ein Stövchen mit Teekanne, eine Teetasse und eine große Kerze auf dem Schachtischchen Platz finden. – So gerüstet müsste ich das Lesen zu einem Hochgenuss kultivieren können, zum ersehnten Zielpunkt meines Alltags, zur eigentlichen Freude meines Daseins […].“ (Zufall, S. 2656.)
Diese eingeschränkte, trotzige kleine Hoffnung, die ich mit dem Adverb immerhin zum Ausdruck bringe, muss mir wohl reichen: für die Bewertung meiner Vergangenheit ebenso wie für die Einschätzung meiner Zukunftsaussichten. Immerhin lebe ich noch.
Inhaltsverzeichnis zum Zufall
Tuesday, 14. June 2011Träfe mich der Schlag und mir wäre, den Blick gen Himmel gerichtet, noch ein letzter heller Gedanke vergönnt, so dürfte er die Genugtuung zum Gegenstand haben, auf ein überreiches, geglücktes Leben zurückschauen zu können. Denn das war’s schon längst – und so erlebe ich heute jeden Tag als unverdiente Dreingabe.
Den sprichwörtlichen Baum hab ich bereits als Vorschulkind gepflanzt: eine Birke. Der Wunsch ein Haus zu bauen, dieser Selbstbetrug ewig beständiger Sesshaftigkeit, beschlich mich nie. Kinder sind da, für jeden Finger der Linken eins; und Werke für meine Rechte schon erst recht. Mein Hauptwerk, der Zufall, überraschte mich mit dem unerwarteten Geschenk, sich von mir vollenden zu lassen. Nun schwebt es als blauer Strich dicht unter der Decke meines Arbeitszimmers und wartet auf den neugierigen Nachlassverwalter, der das Monstrum nichtsahnend herab auf den Boden der Tatsachen holt [s. Titelbild]. Seit mir dieser Stein vom Herzen gefallen ist, fabriziere und fabuliere ich munter weiter drauf los.
Gelegentlich juckte es mir in den Fingern, einen Blick in eine dieser 32 blauen Schachteln mit ihren jeweils 160 einseitig beschriebenen Blättern zu werfen. Aber bei einem solchen Eindringen völlig willkürlich vorzugehen, das schien mir doch so, als wollte ich den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Ich vermisste das Inhaltsverzeichnis, denn dann hätte ich mir planvoll Zutritt verschaffen können.
Nun fiel mir dieses Verzeichnis jüngst beim Aufräumen unverhofft in die Hände. Es verzeichnet für jedes der 16-seitigen Kapitel den Titel, die Zahl seiner Absätze, die Nummern der Abbildungen und Fußnoten und schließlich – sehr wichtig! – das Datum des Beginns und das der Beendigung seiner Niederschrift. (Der Zufall entstand vom 23. März 1994 bis zum 18. Dezember 2005.)
Nun könnte ich also einen Rückblick exakt aus der Distanz eines Dezenniums wagen, wenn ich denn wollte. Am 15. Juni 2001 begann ich mit der Niederschrift des 166. Kapitels, Fluorit (S. 2641-2656). Es enthält die Absätze 4470 bis 4503, eine Abbildung und eine Fußnote. Beendet habe ich es am 30. Juni. Ob ich mich auf dieses Abenteuer einlasse, werde ich erst morgen entscheiden. Möglicherweise bin ich entsetzt? Vielleicht habe ich mich seit Jahren über die Qualität dieses vermeintlichen Haupt- und Meisterwerks getäuscht?
Meine kleinen Idiosynkrasien (II)
Monday, 13. June 2011[6] Hunde, die wie die Karikaturen ihrer Halter aussehen, sich wie diese bewegen, benehmen und sogar ganz ähnlich bellen wie die jeweiligen Frauchen bzw. Herrchen sprechen. (Dies kommt sehr häufig vor, ist vielleicht sogar die Regel, was man bemerken wird, sobald man sich erst mal angewöhnt hat, darauf zu achten. Dann aber wird man diesen Vergleichszwang nach meiner Erfahrung nicht mehr los.)
[7] Unentschiedene Witterungen, sowohl in klimatischen als auch in sozialen Zusammenhängen. Eine Gewitterneigung, die ums Verrecken nicht zum Donnerwetter führen will; ein Konflikt, der in der Luft liegt, aber nicht zur Sprache kommt.
[8] Die Frage „Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen?“ (Besonders nervend als Einleitung zu einer Frage, die sich als völlig banal und jedenfalls harmlos entpuppt, schlimmstenfalls noch mit dem Zusatz: „Aber Sie nehmen es mir auch ganz bestimmt nicht übel?“)
[9] Hundegebell. Je länger anhaltend, desto.
[10] Eklige Postwurfsendungen zu Reklamezwecken. (In letzter Zeit beonders unerträglich knatschbunte Werbung von Vorbeibringpizzerias mit schlechten Fotos von Pizza con Cozze [s. Titelbild].)
Meine kleinen Idiosynkrasien (I)
Sunday, 12. June 2011[1] Etwas unterm Schuh, das noch zu leben scheint. Quietscht es nicht gar? Ich trete fest auf, nun quietscht es noch lauter. (Allerlei Bilder von schwer verletzten Küken drängen sich mir auf.)
[2] Kirchenglocken in der Großstadt, die glaubwürdig so klingen, als würden sie noch von Hand geläutet. Von schwieligen, schrundigen Händen.
[3] Handgemachte Kitschartikel mit okzidentaler Symbolik (Nikoläuslein, Osterhäschen u. dgl.), gefertigt in Fernost mit maschineller Gefühllosigkeit.
[4] Touristische Hobbyfotografien von schneebedeckten Bergen, azurblauen Seen; von äsenden Rehkitzlein auf sonnenbeschienenen Lichtungen, imposanten Konzernzentralen und pittoresken Elendsvierteln; von einander zuprostenden Reisebekanntschaften, urigen Straßenmusikanten und anderem fröhlichen Gesindel – kurz: Beweisfotos der fatalen Gemütsverzerrungen ihrer Hersteller.
[5] Blüten-, Schmetterlings- u. ä. Naturmuster auf Klopapier [s. Titelbild].
Zu fünf Aphorismen von Karl Kraus
Saturday, 11. June 2011„Ich höre Geräusche, die andere nicht hören, die mir die Musik der Sphären stören, die andere auch nicht hören.“ (A 1250) – So oder ähnlich empfinde auch ich meine einsame Extravaganz. Gehe ich in Gesellschaft wo andere lachen, graust es mich. Wenn ich dort von meinen Ängsten erzähle, ernte ich Gelächter. Ich fliehe in den Wald, wo mir alle paar Meter austauschbare Menschen begegnen, die sich per Handy mit ihren fernen Nächsten austauschen. Noch wenn ich einsam in meiner Stube grüble, bebrüte ich die Erinnerung an diese Karikaturen der Geselligkeit und Naturverbundenheit. Wo diese alles zu sein bemüht sind, sind sie nichts; während ich nichts hermachen möchte, kommt mich alles an.
„Wenn ich mir die Haare schneiden lasse, so bin ich besorgt, daß der Friseur mir einen Gedanken durchschneide.“ (A 1975) – Es sind aber nicht bloß die Friseure, die durch ihr Geklapper und Geschnatter Zusammenhänge vernichten, verzweigte Gedankengebäude zu Kleingedrucktem zerlegen und Tabula rasa mit Denksystemen machen, als wären sie bloß Wasserdampf überm Herd. Die Alltäglichkeit der Alltäglichen tötet alles Erhabene wirksamer denn jeder Bildersturm.
„Die deutsche Bildung sollte nicht geleugnet werden. Nur muß man auch wissen, daß die kein Inhalt ist, sondern ein Schmückedeinheim.“ (A 500) – Das war einmal. Auch heute schmückt der Mann von Welt sein Heim, aber nicht mehr mit hohler Bildung, sondern mit prallen Abzeichen seiner Zeitgemäßheit, zu Deutsch: Design.
„Sexuelle Aufklärung ist jenes Verfahren, wodurch es der Jugend aus hygienischen Gründen versagt wird, ihre Neugierde selbst zu befriedigen.“ (A 1730) – Neugierde gilt immer noch als staatsgefährdend, aber die totale Aufklärung hat mittlerweile alle reizvollen Geheimnisse so vollständig eliminiert, dass die jugendlichen Abenteurer nicht den geringsten Anlass mehr finden, sich in Gefahr zu bringen.
„In keiner Sprache kann man sich so schwer verständigen wie in der Sprache.“ (A 1390) – Das verstünde ich wohl nur, wenn es in einer anderen Sprache gesagt worden wäre.
[Karl Kraus zu Ehren, dessen Todestag sich morgen zum 75sten Mal jährt.]
Die vergebliche Flucht
Friday, 10. June 2011Über Auschwitz habe ich viel gelesen; vermutlich mehr, als einem Menschen verträglich ist, wenn er sich einen unbefangenen Blick auf seine Mitmenschen erhalten will. Was in der Vergangenheit geschah, ist ja niemals vorbei. Und was Menschen einander einmal angetan haben, das kann sich jederzeit wiederholen, ganz gleich, mit welchen Nie-wieder-Mantras wir uns unterdessen in den Schlaf wiegen mögen. Die einmal ausgemessenen Dimensionen des Schrecklichen kann keine Macht der Welt wieder zurechtstutzen auf ein erträglicheres Maß. „Bewältigen“ kann man das Geschehene nicht, ebensowenig den Tätern verzeihen; schon gar nicht, wenn man zu den Opfern gehörte wie Rudolf Vrba, dessen zuerst 1963 in englischer Sprache erschienene Erinnerungen I Cannot Forgive der Verlag Schöffling & Co. im vorigen Jahr in einer kommentierten Neuübersetzung herausgegeben hat.
Dieses Buch gesellt sich zu den Berichten beredter Augenzeugen wie Imre Kertész (15 Jahre alt bei der Ankunft in Auschwitz), Primo Levi (24), Wieslaw Kielar, Tadeusz Borowski oder Shlomo Venezia (alle 20), die jeder auf eigene Weise versucht haben, das Grauen dieses Un-Ortes in veröffentlichten Erinnerungen begreifbar zu machen. Der gebürtige Slowake Rudolf Vrba (eig. Walter Rosenberg) kam als 17-Jähriger über das Vernichtungslager Maidanek nach Auschwitz und überlebte dort in verschiedenen Teilen des Lagers und in unterschiedlichen Positionen nahezu zwei Jahre, bevor ihm als einem der ganz wenigen Menschen überhaupt am 10. April 1944 mit seinem Mithäftling Alfréd Wetzler die Flucht gelang.
Die meisten konkreten Details seiner Erzählung waren mir aus den vielen Berichten und Beschreibungen des größten Menschenvernichtungslagers der Geschichte bekannt. Dennoch hat mich die Lektüre dieses Buches noch einmal auf eine Weise berührt und verstört, wie ich es nicht erwartet hätte und auch nicht leicht erklären kann. Gewiss trägt hierzu bei, dass Vrba seine Leidens- und Kampfgeschichte so lebendig und in allen grauenhaften Einzelheiten so nachfühlbar erzählt, dass man ihm nur atemlos folgen kann. Obwohl man weiß, dass es für ihn gut ausgehen wird, zittert man doch mit ihm bei den Vorbereitungen seines Ausbruchs und fühlt intensiv die ständige Bedrohung, der er sich damit aussetzt. Aber dies allein kann es nicht gewesen sein, was das Buch für mich von ähnlichen Zeugnissen unterscheidet. Es klingt vielleicht makaber, wenn ich es so sage, aber ich weiß keinen passenderen Ausdruck. Der Liebe zum Detail ist es vermutlich zu verdanken, wenn ich als Leser meine Zuflucht nicht in einem panoramatischen Blick aufs Ganze dieses Höllenschlunds nehmen konnte. Die Sinnlichkeit, mit der Vrba konkrete Dinge Gestalt annehmen lässt, macht es uns unmöglich, Distanz zu den Ereignissen zu beziehen, die sich dort zutrugen. [Das Titelbild zeigt eine Armbinde für Oberkapos in den Lagern. Auch ein solch konkreter Gegenstand vermag mich ähnlich zu berühren, wenn ich mir vorstelle, wie weibliche Häftlinge eingesetzt wurden, diese Binden in der Näherei anzufertigen. Vermutlich hing ihr Leben davon ab, dass dies mit tadelloser Sorgfalt geschah.]
Ein Rätsel, das das Buch aufgibt, ist das absolut außergewöhnliche, nahezu unmögliche Schicksal seines Autors. Auschwitz zu überleben war schon eine schier unlösbare Aufgabe. Eine gelungene Flucht hingegen war so selten, dass die Frage sich aufdrängt, wodurch der Glückliche, dem sie gelang, hierzu prädestiniert war. Rudolf Vrba stellt sich selbst diese Frage immer wieder – und findet darauf mehrere Antworten. Alles andere wäre vermutlich auch unseriös, denn eine einzelne Erklärung reicht nicht aus, um so viel Glück glaubhaft zu machen. Der junge Mann hatte tatsächlich unglaublich viel Dusel, indem er etwa zahllose lebensgefährliche Situationen mit knapper Not hinter sich brachte, oder indem er immer wieder zufällig an die richtigen Leute geriet, die ihm weiterhelfen konnten und wollten, statt ihn zu verraten. Zugleich hatte er aber auch einen unbeugsamen Optimismus und Überlebenswillen. Er ließ sich von Rückschlägen nicht entmutigen und verfolgte sein Ziel mit größter Beharrlichkeit. Für sein Alter war er erstaunlich besonnen, ein hervorragender Beobachter und guter Menschenkenner. Zudem sprach er mehrere Sprachen und konnte sich damit bei Mitgefangenen nützlich machen, die ihm so Dank schuldeten und ihn im Gegenzug unterstützten. Vielleicht war aber der entscheidende Kraftspender zur Verwirklichung seines Vorhabens Vrbas Motiv. Es ging ihm nämlich nicht darum, durch die Flucht sein eigenes Leben zu retten. Wenn ihm daran gelegen gewesen wäre, dann hätte er sich besser darauf verlegt, ein weiteres Jahr im Schutz der Unauffälligkeit, die er sich antrainiert hatte, im Lager zu überdauern. Die realistische Hoffnung, dass Hitler den Krieg verlieren könnte und die Konzentrationslager von seinen Gegnern irgendwann befreit würden, teilte er mit den politisch organisierten Häftlingen, die besser über das Kriegsgeschehen draußen informiert waren, als ihren allmählich nervös werdenden Bewachern recht sein konnten. Der Fluchtversuch hingegen war ein hochriskantes Vabanquespiel! Darauf ließen sich Vrba und Wetzler nur deshalb ein, weil sie die Weltöffentlichkeit über Auschwitz informieren wollten und hofften, zugleich hunderttausende ungarischer Juden, deren Vernichtung als nächstes auf Himmlers und Eichmanns Programm stand, zum Aufstand gegen ihre bevorstehende Deportation anzustacheln. Dass dies nicht gelang und insofern die Flucht der beiden gemessen an ihrer Absicht vergeblich war, ist die bittere Pointe des Buches. So wie Vrba nicht von Vergebung sprechen kann, ist es vielleicht auch nicht angebracht, es einen Trost zu nennen, dass wir seiner Flucht immerhin dieses außergewöhnliche Buch verdanken. Dankbar sein dürfen wir dem Schicksal hierfür aber immerhin.
Und auch dem Verlag gebührt Dank, dass er dem Buch viel editorische Sorgfalt hat angedeihen lassen. Augenzeugenberichte aus Konzentrationslagern werden ja nicht nur von Holocaust-Leugnern einer besonders kritischen Prüfung unterzogen, was ihre Faktentreue und Objektivität angeht. Auch politisch neutrale Historiker müssen Zeugenberichte von Opfern auf ihre Glaubwürdigkeit hin gründlich prüfen, denn seelische Traumatisierung kann das Gedächtnis auch ohne bewusste Absicht in die Irre führen. So korrigieren Fußnoten der Herausgeber manche Zahlenangaben oder Daten des Autors, ohne dass daraus gegen ihn der Vorwurf ableitbar wäre, er hätte bewusst übertrieben oder Ereignisse verfälscht. Auch die Abbildungen bereichern den Band. Besonders hat mich gefreut, Rudolf Vrba auf Fotos der 1960er-Jahre und danach als einen fröhlichen, selbstbewussten Ehemann und Familienvater zu sehen, dem selbst die Hölle von Auschwitz nicht den Lebensmut hat rauben können.
[Rudolf Vrba: Ich kann nicht vergeben. Meine Flucht aus Auschwitz. A. d. Engl. v. Sigrid Ruschmeier u. Brigitte Walitzek. M. e. Vorw. v. Beate Klarsfeld. Hrsg. u. m. e. Nachw. v. Dagi Knellessen u. Werner Renz. Mit zahlr. Abb. Frankfurt am Main: Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung, 2000. – ISBN 978-3-89561-416-3 – 28,00 €.]
Zukünftige Aureole im Rückblick
Wednesday, 08. June 2011Heute geht es mir dreckig. Krampfartige Schmerzen im Unterbauch, vorwiegend rechts. Blinddarm? Ein heißes Bad bringt vorübergehend Linderung. Der Schmerz kehrt aber bald zurück, und mit doppelter Wucht.
Ich werde in die Notfallambulanz des nächsten Krankenhauses fahren müssen. Dort wird mich ein Dr. (RUS) mit den Worten empfangen, da käme ich ja gerade noch rechtzeitig. Er habe nämlich schon so gut wie Feierabend. Hingelegt, Bein gestreckt, hier gedrückt, da gezogen: „Der Blinddarm ist es nicht!“
Er wird mir dann Novaminsulfon gegen die Schmerzen und weitere Tropfen gegen Motilitäts-Störungen im Magen-Darm-Bereich aufschreiben. Beim Gehen werde ich nach meiner scharzen Tasche greifen, die ich in aller Eile mit dem Nötigsten vollgestopft hatte. Irritiert und amüsiert wird er mich fragen, was ich denn da mit seiner Tasche wolle. Und es wird sich herausstellen, dass wir tatsächlich ganz gleiche Taschen besitzen, von Gardini. Ob ich die vielleicht in der Türkei gekauft habe, will er wissen.
Liegt es nun an der schmerzverschärften Wahrnehmung? Oder begegnen mir in solch inwendig außergewöhnlichen Verfassungen immer die extremsten Abstrusitäten? Die Apotheke mit Nachtdienst, zu der wir den Taxifahrer dirigieren werden, wird jedenfalls eher an eine Zwingburg als an eine Versorgungseinrichtung erinnern. Die Apothekerin wird eine halbe Ewigkeit benötigen, bis sie endlich mit den beiden Medikamenten anrückt. Und sie wird anschließend große Mühe haben, die Tüte mit den Packungen durch die engen Sprossen des Gitters zu quetschen, das sie vorm AIDS-Biss zähnefletschender Rauschgiftsüchtiger bewahren soll.
Tags drauf, also übermorgen, wird es mir nicht wesentlich besser gehen. Immerhin werde ich mich in mein Bücherlager schleppen, um eine Bestellung – Jules Vernes Geheimnisvolle Insel in der Übersetzung von Lothar Baier – ausliefern zu können. Wieder zurück in meinem Arbeitszimmer werde ich feststellen müssen, dass sich in der Mitte meines Gesichtsfelds dauerhaft eine hell leuchtende kreisförmige Erscheinung festgesetzt hat, die bei geschlossenen Augen so aussieht wie im Titelbild skizziert. Ich werde in Panik geraten und mit meinem Hausarzt tefelfonieren, der mir raten wird, einen Augenarzt aufzusuchen. Noch während des Gesprächs wird die Furcht einflößende Aureole sich verflüchtigen. Besonders bemerkenswert werde ich im Nachhinein finden, dass sie, wie in meiner Skizze angedeutet, nicht ganz regelmäßig gewesen sein wird.
Jugendfreundschaft
Tuesday, 07. June 2011Schon die üblichen Klassentreffen zu runden Abi-Jubiläen habe ich immer gemieden, weil ich die Mehrzahl der Knaben, mit denen ich die Schulbank drückte, nicht wiedersehen möchte. Also bestand für mich auch nie Veranlassung dazu, auf Internet-Plattformen wie StayFriends & Co. nach gründlich vergessenen Jahrgangsgefährten vom Essener Helmholtz-Gymnasium zu fahnden.
Anders verhält es sich mit den wenigen Freunden, die mich in meiner unglücklichen Schulzeit positiv beeindruckt und mich – was noch seltener der Fall war – ein wenig verstanden haben. Einer von ihnen war Dieter Schnack, drei Klassen über mir, Gründer und Chefredakteur der Schülerzeitung Holtzwurm. Bis dahin hatte es an diesem Jungengymnasium nur eine „Schulzeitung“ gegeben, in der kritische Beiträge zum Schulalltag keinen Platz hatten. Nun ließ Direktor Hugo Vollmerhaus gleich die erste Ausgabe des großformatigen Heftes – es erschien 1970 oder 1971 – beschlagnahmen. Der Grund? Eine Karikatur, die die Frage aufwarf, ob wohl ein Mitglied des Kollegiums neuerdings ein Halbperücke trüge. Die Bildunterschrift lautete: “Toupet or not toupet, that’s the question?” Die Antwort war zwar ohnehin längst allgemein bekannt, nachdem der Englisch- und Sportlehrer mit dem Haarersatz beim Kopfsprung vom Zehnmeterbrett einmal seine Bedeckung eingebüßt hatte. Aber zum Thema machen durften es die Schüler nicht, das erfüllte eindeutig den Tatbestand der Beleidigung und Untergrabung der Autorität. Mein bester Freund und ich waren die jüngsten Redaktionsmitglieder der ersten Stunde. Ich steuerte einen Beitrag zum Thema „mens sana in corpere sano“ bei, bestehend aus einer langen Liste von Genies, die alles andere als gesund gewesen waren, weder körperlich noch geistig – und etliche Rauschgiftsüchtige waren auch darunter. (Ich bediente mich dafür großzügig aus einem Essay von Gottfried Benn über Genie und Wahnsinn, aber das merkte einer.) Von Dieters Beiträgen erinnere ich mich noch an einen, indem er sein Befremden zum Ausdruck brachte, dass seine Altersgenossen in der Tanzschule zu dem Anti-Vietnamkriegs-Song Purple Haze von Jimi-Hendrix „ausgelassen herumhopsten“. Diese Ernsthaftigkeit imponierte mir damals sehr.
Nachdem ich die Schule vorzeitig verlassen hatte, verlor ich Dieter Schnack für viele Jahre aus den Augen. Er machte Abitur, studierte Pädagogik bis zum Diplom, schrieb zusammen mit Rainer Neutzling das erfolgreiche Buch Kleine Helden in Not (1990). Ich war unterdessen Buchhändler geworden und leitete die Rüttenscheider Filiale von G. D. Baedeker in Essen. 1993 wurde mir vom Rowohlt-Verlagsvertreter eine Autorenlesung mit Schnack und Neutzling aus ihrem neuen Buch Die Prinzenrolle angeboten. So kam es am 22. Oktober jenes Jahres zu einem Wiedersehen nach gut zwei Jahrzehnten. Wie es so geht, wenn man einen älteren Freund in der Erinnerung idealisiert, konnte dieses Treffen nur enttäuschen. Dieter hatte kaum noch eine Erinnerung an mich, und meine Erinnerungen an ihn schienen ihm nicht zu gefallen. Er glaubte gar, ich müsste ihn mit jemandem verwechseln, denn meine Erzählungen passten so gar nicht auf ihn. In sein Buch schrieb er mir die belanglose Widmung: „Mit den besten Wünschen für Dich und die Deinen!“
Nachdem nun weitere 18 Jahre ins Land gegangen sind, fiel mir unlängst ein drittes Buch in die Hände, dass er wieder gemeinsam mit Rainer Neutzling verfasst hatte: „Der Alte kann mich mal gern haben!“ Es erschien 1997 als rororo-Taschenbuch. Ich wollte wissen, ob inzwischen die Liste seiner Veröffntlichungen noch länger geworden sei, und gab seinen Namen in den Online-Katalog der Deutschen Nationalbibliothek ein. Dort findet man neben den bibliographischen Angaben auch einen knappen „Steckbrief“ zu jedem Autor: „Schnack, Dieter | auch Schnack-Jürgens, Dieter | Diplom-Pädagoge und Journalist | 1953-2000.“ Dass Schnack verheiratet war, wusste ich. Aber dass er nicht mehr lebt, weiß ich erst seit eben. Gerade mal 47 Jahre alt ist er also geworden. Sein Ko-Autor erwähnt in irgendeinem Vortrag, den man auch im Internet findet, dass Dieter Schnack nach langem Kampf an Krebs gestorben ist.
Die Prinzenrolle ist ein außergewöhnlich offenes und ehrliches Buch über die männliche Sexualität, gerade auch des männlichen Kindes. Natürlich beschränkt es sich lokal auf die mitteleuropäische Zivilisationssphäre und temporär auf die Lebenszeit meiner Generation, wobei die Generation unserer Eltern und die unserer Kinder natürlich mit in den Blick genommen wird. Im Rückblick auf die eigene Erziehung suchen die Autoren nach Erklärung, im Hinblick auf die Erziehung unserer Kinder nach Möglichkeiten der Befreiung. Insofern ist Die Prinzenrolle eine späte und reife Frucht jener sexuellen Revolution, die mit Volkmar Sigusch, Gunther Schmidt, Ernest Bornemann und dem jüngst tragisch verunglückten Günther Amendt mit den 68ern ihren Anfang nahm. Es bleibt im Bestand meiner via „Antiquariat Revierflaneur“ ständig schrumpfenden Bibliothek.
[Titelbild: Dieter Schnack, Rainer Neutzling und der Revierflaneur (v. l.) am 22. Oktober 1993 in der Stadtbibliothek Essen.]
Und heute: das Wetter!
Sunday, 05. June 2011Fast in jedem 23sten meiner bisherigen Artikel dieses Weblogs kommt das Wetter vor. Und das sind bloß die Präsenzen expressis verbis. Wenn ich noch die Postings zählen wollte, bei denen meine Stimmung indirekt durch das Wetter eingetrübt wurde, dann käme ich vielleicht gar auf fünfzig Prozent!
Nicht, dass man mich falsch versteht: Ich bin keineswegs wetterfühlig. Zwar habe ich gelegentlich vor aufziehenden Gewittern gegen Migräneattacken zu kämpfen, aber die können ebensogut durch den Geruch von faulen Kartoffeln, Schlagermusik, Karnevalsjecken, erzwungenes Beisammensein mit langweiligen Menschen und noch tausenderlei andere Umstände mehr verursacht werden.
Was mich je nach Tagesform belustigt oder in Rage versetzt, das ist keineswegs das unschuldige Wetter selbst. Das arme Wetter kann ja schließlich nichts dafür, dass es so ist wie es gerade nun mal ist. Vielmehr ist ’s das öffentliche Gerede meiner Mitmenschen über das Wetter, dass mich zuverlässig jedesmal aus dem Gleichgewicht bringt, wenn ich zum unfreiwilligen Ohrenzeuge dieser Jammerarien werde. Insofern ahne ich schon, was in den kommenden Tagen auf mich zukommt.
Ende Mai waren die Warnungen der Meterologen nicht mehr zu überhören: Deutschland sei nach einem relativ harten Winter und einem außergewöhnlich trockenen Frühjahr einer echten Dürregefahr ausgesetzt, die nicht nur der Landwirtschaft schwerste Schäden zufügen, sondern sogar das Wasser zum Kühlen der Kernkraftwerke knapp werden lassen könnte.
Nun könnten wir seit ein paar Tagen eigentlich aufatmen, denn für die kommende Woche werden für weite Teile Deutschlands Gewitter mit ergiebigen Niederschlägen vorausgesagt, die hoffentlich für die ausgedörrten Böden mehr bringen werden als den sprichwörtlichen Tropfen auf den heißen Stein. Ich weiß aber jetzt schon, dass gleichzeitig mit den ersten Regentropfen, die vom Himmel fallen, das große Lamentieren unter den Schirmen wieder anheben wird, was das den für ein Sommer sei? Dieses Wetter könne einen ja geradezu schwermütig werden lassen. Jetzt sei es mal ein paar Tage sonnig gewesen – und nun das! Was sich der Petrus wohl dabei wieder gedacht habe? (Diese Ignoranz gilt mir als weitere Bestätigung für meine alte Überzeugung, dass die tagesaktuelle Informationsflut aus Medien wie Radio oder Fernsehen keineswegs geeignet ist, bei den Empfängern eine halbwegs vernünftige, reflektierte Einstellung zu den schlichtesten Zusammenhängen ihres alltäglichen Lebens zu fördern. Durch die tägliche Dauerflutung des Bewusstseins mit Fakten, Fakten, Fakten geht jedes Denken in Zusammmenhängen und über den Tag hinaus den Bach runter.)
[Regenzeichnung: Revierflaneur.]
Bilddeutung (II)
Saturday, 04. June 2011Das könnte tatsächlich die Rückseite des Tores aus dem vorigen Bild sein; die Innenseite des geheimnisvollen Gebäudes. Leider wird mir kein Blick hinein in den Raum oder eher Saal gewährt, sondern ein Blick in die Gegenrichtung, auf den Eingang, durch dessen glaslose Fensterschlitze das grelle Tageslicht hineindringt und mich beinahe blendet.
Ein großer schlanker junger Mann hat die Tür in der Mitte einen Spalt weit geöffnet. Noch hält er wohl die Klinke in der Hand. Er steht auf der Schwelle und späht hinein.
Auch hier sind wieder Fässer zu sehen, verschiedener Größe, nebeneinander und aufeinandergestapelt. Links lehnt ein großes Brett oder eine schmale Kiste an der Wand, wenn es dort eine Wand gibt. Woran lehnt das Ding aber sonst? Das bleibt ein Rätsel, aber ein vermutlich unbedeutendes, an dessen Auflösung niemandem gelegen sein kann. Auf einigen Fässern stehen Flaschen unterschiedlicher Größe und Form. Sie mögen leer sein oder verschiedene Flüssigkeiten enthalten, das geht uns nichts an. Immerhin mag das kleinste Fläschchen ein konzentriertes Gift enthalten. Na, und? Niemand zwingt den Mann, davon zu trinken. Dumm ist er nicht, er würde daran schnuppern, bevor er einen Schluck nähme. Dann käme ihm der stechende Geruch, den es doch wohl ausströmte, gewiss verdächtig vor, und er würde es beiseitestellen oder gar an die rückwärtige Wand schleudern, knapp über meinen Kopf hinweg, wo es zerschellte. Aber mich schert das Fläschchen erst recht nicht, ob es nun Gift enthält oder nicht, ob es an seinen Platz zurückgestellt wird oder in meine Richtung geschleudert. Ja, nicht einmal das kann mich erschrecken. Es ist ja nur ein Bild, oder?
Der Mann trägt einen dunklen Anzug. An seinem erschreckend schlanken Hals zeichnet sich ein feiner weißer Hemdkragen ab. Ich möchte sagen: ,Aber kommen Sie doch herein, Herr Baron! Nur keine Scheu! Treten Sie näher!‘ Ich höre geradezu meine leicht meckernde, leicht drohende Stimme.
Der Herr zögert. Er scheint etwas zu fürchten. Vielleicht ist es nur, dass er nicht sicher ist, ob er mit seinem Eindringen eine Indiskretion begehen würde. Vielleicht ist es seine Vornehmheit, die ihm eigentlich verbietet, fremde Räume uneingeladen zu betreten. Aber warum hat er dann die Tür überhaupt geöffnet? Vielleicht war es Neugier. Neugier gilt ja längst nicht immer als lauteres Motiv für eine Handlung. Wer ungebeten ein fremdes Geheimnis lüftet, muss damit rechnen, dass sich ihm etwas offenbart, wovon er lieber keine Kenntnis erhalten hätte. Leider können wir den Gesichtsausdruck des Mannes nicht entschlüsseln. Das Bild ist zu unscharf, zudem liegt sein Antlitz im Halbschatten.
Bilddeutung (I)
Friday, 03. June 2011Vielleicht hat mich die Interpretation von Heinrichs Testament auf den Geschmack gebracht? Neuerdings kann ich jedenfalls oft der Versuchung nicht widerstehen, mir einen vielleicht spinnerten, vielleicht bezwingenden Reim auf Bilder zu machen, die mir hier und da zu Gesicht kommen. Es handelt sich dabei um ganz unterschiedliche Bilder, Fotos so gut wie Gemaltes, Kunstwerke neben Trivialem. Ich sage mittlerweile schon zu mir selbst: ,Das ist wieder eins!‘ (Nämlich ein Bild, das sich wünscht, von mir gedeutet zu werden.) Also fange ich heute einfach mal damit an.
Dieses Tor hat offenbar seine besten Zeiten schon gesehen. Die zum größeren Teil zerdepperten Scheiben lassen vermuten, dass der Raum dahinter nicht mehr zur Lagerung von Dingen genutzt wird, die keine Feuchtigkeit vertragen. Um welche Art Raum mag es sich handeln? Vielleicht um eine Scheune? Eine Lagerhalle? Vielleicht um einen Stall?
Am rechten Bildrand erkennt man gerade noch, dass es dort wohl ein genau gleich großes Tor gibt. Bilde ich es mir nur ein, dass wir uns hier einem landwirtschaftlich genutzten Gebäude gegenübersehen? Schließlich könnte es ja auch eine industrielle Lager- oder Produktionshalle sein. Oder doch immerhin um eine handwerkliche Arbeitsstätte, etwa eine Schmiede oder Küferei? Vor dem rechten Torflügel liegt immerhin etwas, das aussieht wie ein Fass. Was es enthält, kann ich nicht einmal erraten, denn ich weiß nicht, welche Art Fass das ist. Und links daneben scheint ein weiteres Fass zu stehen, auf dem ich noch ein weiteres Fässchen gewahre. Das könnte aber auch ein Eimer sein. Jedenfalls ist das Gemäuer alt. Heute würde man Eingangstore kaum mehr mit einem solchen Rundbogen bauen. Ich bin kein Fachmann für Architekturgeschichte, aber doch ziemlich sicher, dass dieses Bauwerk mindestens hundert Jahre alt ist.
Waagerecht läuft ein schwarzer Strich durchs Bild. Da er sich über das Mauerwerk ebenso erstreckt wie über das Holz des Tores, handelt es sich vermutlich um einen Strich auf dem Foto, nicht in der Wirklichkeit. Oder doch? Vielleicht ist ja dort in einigem Abstand zum Hintergrund ein schwarzes Seil gespannt. Aber warum? Außerdem gibt es zahlreiche, feinere vertikale Striche, in unregelmäßigen Abständen und von verschiedener Länge und Stärke. Es könnte sich also um ein Foto aus einem Film handeln. Das wäre doch was! Kintopp auf dem Bauernhof.
Den Anblick des Gemäuers mit dem ramponierte Zugang zu einem ungewissen Innenraum empfinde ich als unangenehm. Ich wüsste gern und doch wieder nicht, was sich hinter diesem Tor verbirgt. Ich weiß nicht, ob ich das Tor öffen würde, wenn es mir im wirklichen Leben und nicht bloß auf einem Bild begegnete. Vielleicht würde ich sogar der Versuchung widerstehen, wenigstens einmal einen kurzen Blick durch einen der zerborstenen Fensterschlitze zu werfen. Offenbar möchte ich mir nicht vorstellen, welcher Anblick sich mir hinter diesem Tor böte.
Nistgewohnheiten von Stadtvögeln
Wednesday, 01. June 2011Die schmalen Streifen Restnatur, die sich in der Großstadt gegen die Totalherrschaft menschlicher Artefakte so gerade noch behaupten können, verbergen mitunter unerwartete Geheimnisse, Rätsel und Gefahren.
So beobachtete ich heute einen dunklen Vogel mittlerer Größe, der mit einem Sträußlein dünner Zweige im Schnabel in einem Buschwerk verschwand, das über einen Zaun am Rande eines Fußwegs herabquillt. Diesen Ort suche ich nahezu täglich auf, wenn ich mit unserer Hündin Gassi gehe.
Leider bin ich ornithologisch zu wenig bewandert, um mit Gewissheit sagen zu können, um welche Art Vogel es sich handelte. Er hatte etwa die Größe einer Schwarzdrossel, allerdings keinen gelben Schnabel, auch war sein Gefieder nicht tiefschwarz, sondern eher dunkelgraubraun. Und zudem schien er mir etwas schlanker, als Drosseln gewöhnlich sind. Immerhin begriff ich auf den ersten Blick, dass dieser Vogel mit seinem Nestbau beschäftigt war. Und da er aus dem Gebüsch nicht wieder auftauchte, folgerte ich, dass das Nest sich offenbar dort verbarg.
Mein nächster Gedanke war, dass dem zu erwartenden Nachwuchs des Vogels vielleicht Gefahr drohen könnte, wenn sich der Zaunbesitzer einfallen ließe, demnächst besagtes Gebüsch zu stutzen. Sollte ich den Mann, den ich vom Sehen kenne und der mich entfernt an Pettersson erinnert, warnen? Dann fragte ich mich, wie lange eigentlich ein solcher Vogel für den Bau seines Nestes benötigt, wie lange er brütet und wie lange es schließlich dauert, bis die Brut ihr Nest verlässt? Insgesamt drei Wochen? Oder eher drei Monate? Ich stellte wieder einmal fest, dass ich in solchen Dingen nicht die Spur einer Ahnung habe. Warum auch? Für mich hing ja tatsächlich in meinem bisherigen Leben nichts davon ab. Jetzt aber stand im schlimmsten Fall das Leben einiger gerade erst geborener Vögel auf dem Spiel!
Also sah ich bei Wikipedia nach, mangels zuverlässiger Klassifizierung unter Schwarzdrossel. (Dass dieser Vogel mit der Amsel identisch ist, war mir auch noch nicht klar.) Was ich dort über Neststandort und Nestbau dieser Vögel erfuhr, fand ich ausgesprochen interessant, so die Vorliebe für runde Buchstaben und die Abneigung gegen die Farbe Rot. Jetzt weiß ich, dass das Weibchen zwei bis fünf Tage für den Nestbau benötigt, ein bis drei Tage vergehen bis zur Eiablage. Die einzelnen Eier, vier bis fünf an der Zahl, werden im Abstand von 24 Stunden gelegt. Die Brutdauer liegt zwischen 10 und 19 Tagen, im Mittel bei 13 Tagen. Die Nestlinge sind etwa 13 bis 15 Tage nach dem Schlüpfen in der Lage, das Nest zu verlassen. Angenommen, „mein“ Vogel hätte gerade heute erst mit dem Nestbau begonnen, dann müsste ich sicherheitshalber dafür Sorgen, dass diese hängende Hecke sieben Wochen lang nicht beschnitten wird, also frühestens am 20. Juli. Ich werde mit Pettersson reden müssen.
Paris-Review-Interviews
Tuesday, 31. May 2011Die Interviews der New Yorker Literaturzeitschrift Paris Review können mit Fug und Recht als stilbildend für die ganze noch junge Gattung gelten. Dass man den Befragten nicht mit den üblichen Allerweltsfragen à la FAZ-Fragebogen abwärts kommen kann, mit denen die sonstige Prominenz aus Politik, Sport und Showbiz gelöchert wird, liegt auf der Hand. Schließlich sind Literaten Leute, die immerhin schreiben können. Hierunter verstehe ich selbstredend nicht jene Dauersekretion von Banalitäten als Tagesgeschäft, die schon immer 99,9 Prozent aller Papierwaren beschleimte. Schreiben im eigentlichen Sinn jedoch setzt Verstand voraus, Selbstbewusstsein, Weltkritik und ein gerüttelt Maß Verzweiflung. Menschen, die unter solchen schweren Handicaps leiden, darf man nicht mit Fragen nach ihrem Lieblingsbuch und ihrer schönsten Kindheitserinnerung in Lebensgefahr bringen. Das wissen die einfühlsamen Interviewer der Paris Review, und sie beherrschen ihr Mundwerk. In den vergangenen 57 Jahren seit Gründung der Vierteljahreszeitschrift sind dort fast 350 Interviews erschienen, von denen nun die Edition Weltkiosk im C. W. Leske Verlag ein Dutzend ausgewählt und in deutscher Übersetzung vorgelegt hat. (Ich muss das so unpersönlich formulieren, denn einen Herausgeber im eigentlichen Sinn scheint diese Sammlung nicht zu haben. Die Übersetzer heißen Henning Hoff, Judith und Alexandra Steffes; letztere hat auch ein knappes Vorwort geschrieben. Leider verrät sie dem Leser nicht, welche Kriterien gerade diese Auswahl bestimmten.)
Ohne Einschränkung darf ich zunächst den Vorsatz preisen, dem deutschen Leser diese Meisterwerke der Befragungskunst nahezubringen. Selbst von jenen Autorinnen und Autoren, die mir bisher fremd waren und auch durch ihre Antworten mein Interesse an ihrem Werk nicht so stark wecken konnten, dass ich in nächster Zeit eins ihrer Werke lesen müsste, habe ich nun doch immerhin eine recht deutliche Vorstellung. Köstlich amüsiert hat mich Dorothy Parker, zu deren Short Storys ich vor vielen Jahren trotz mehrfacher Versuche keinen rechten Zugang finden konnte, was möglicherweise damit zu erklären ist, dass ich seinerzeit eine Verehrerin ihrer Prosa kannte, die mir mit ihrem humorlosen Suffragetten-Appeal ganz schrecklich auf die Nerven ging. Von Françoise Sagan kannte ich außer den Titeln ihrer Bücher nur die Verfilmung ihres Debutromans Bonjour tristess, die ich mir in einer Periode heftigster Leidenschaft für Jean Seberg zugemutet habe und nahezu unerträglich fand. Als das Mädchen aus gutem Hause in meinem Geburtsjahr befragt wurde, zählte sie gerade einmal 21 Jahre und gab Antworten wie eine abgebrühte Existenzialistin. Insofern habe ich sie bisher wohl unterschätzt. Da ich nun weiß, dass sie keineswegs das naive Hühnchen war, für das ich sie hielt, weil ich sie vermutlich mit der Bardot und mit Mireille Mathieu in einen Topf warf, glaube ich stattdessen erkannt zu haben, dass sie ein viel zu früh gereiftes, altkluges Wesen war, größenwahnsinnig und ohne stabile Orientierung. Truman Capote erscheint mir im Interview ganz so, wie ich ihn bisher wahrgenommen habe. Er schwindelt auf eine Weise, dass er damit mehr über sich sagt, als wenn er streng bei der Wahrheit bliebe; und er übertreibt, doch wenn er es nicht täte, hätte man das Gefühl, er würde untertreiben. Eine wirkliche Überraschung in zweifacher Hinsicht bot mir das Interview mit Ernest Hemingway, das der Chefredakteur der Paris-Review, George Plimpton führte. Erstens sind die Auskünfte des bulligen Mannes über seine Schreibtechnik außergewöhnlich präzise, feinsinnig und gewissenhaft. Er erinnert mich darin an Joseph Roth, mit dem er eigentlich doch nur eines gemeinsam hatte: den exzessiven Alkoholismus. Und zweitens verzückt mich geradezu seine gnadenlose Aufrichtigkeit im Umgang mit schwachen Fragen. Ein Beispiel? Plimton fragt: „Was würden Sie als bestes intellektuelles Training für einen angehenden Schriftsteller ansehen?“ Und Hemingway antwortet: „Sagen wir, er sollte rausgehen und sich aufhängen, weil er feststellt, dass Schreiben, nun, unvorstellbar schwer ist. Dann sollte er ohne Gnade heruntergeschnitten werden und gezwungen, für sich alleine so gut zu schreiben, wie er es kann, bis zum Ende seines Lebens. Immerhin wird er mit der Geschichte des Erhängens anfangen können.“ (S. 65.) Während ich bei Hemingway ein negatives Vorurteil hatte, sah ich Vladimir Nabokovs Auskünften mit gelassener Vorfreude entgegen – und wurde bitter enttäuscht! Dabei hätte ich darauf gefasst sein können, denn in der Vorbemerkung erfahren wir, dass der große Meister sich die Fragen vorab nach Montreux schicken ließ und seine Antworten von A bis Zett vorformulierte, um sie dem Interviewer beim vereinbarten Gesprächstermin schwarz auf weiß auszuhändigen. Wie soll ich das denn finden? Welche kleinliche Angst steckt dahinter, auch nur ein falsches oder nur missverständliches Wort von sich zu geben? Dabei hätte Nabokov wie alle anderen Befragten auch ohnehin die Gelegenheit erhalten, seine Antworten vor der Drucklegung zu überarbeiten oder zu streichen. Ist es Zufall, dass diese Enttäuschung in eine Zeit fällt, da meine Begeisterung für das Werk Nabokovs sich spürbar abschwächt? Zu den drei nächsten Autoren – Kurt Vonnegut, Heinrich Böll und Philip Roth – kann ich summarisch bekennen, dass ich ihre Aufnahme in diese Sammlung bedaure, stehlen sie doch den Platz für solch ungleich interessantere Geister wie Julio Cortazar, Raymond Carver oder Primo Levi. Die letzten vier – Toni Morrison, Orhan Pamuk, Joan Didion und David Grossman – kannte ich bislang nur ganz oberflächlich. Jeden einzelnen von ihnen würde ich gern näher kennenlernen, wenn ich nicht zu viel Zeit mit meinem eigenen Schreiben verschwenden müsste. So reicht es nur für eine knappe Sympathiebekundung. Ich entdeckte bei ihnen einen Ernst, eine Weite und eine Leidenschaft, die sicher hervorragende Voraussetzungen sind, um große Werke zu schaffen. (Allerdings muss ich, was die Leidenschaft betrifft, bei Joan Didion gewisse Abstriche machen. Sie erschien mir – vielleicht insofern ein direktes Gegenstück zu Toni Morrisson – in vielen ihrer Antworten eher unterkühlt.)
Ich habe das 350 Seiten starke Buch auf einen Rutsch in drei Tagen gelesen, auf ,meiner‘ sonnigen Bank am Blücherturm und nachts in meinem blauen Ohrensessel vorm Zubettgehen. Es war eine streckenweise unterhaltsame und gelegentlich sogar lehrreiche Lektüre, besonders dann, wenn es um die ganz profanen technischen Fragen und Probleme des Schreibens ging. Mit großem Interesse habe ich auch die wenigen Passagen zur Kenntnis genommen, in denen einzelne Autoren auf ihr Verhältnis zu ihrem Lektor zu sprechen kommen – verständlich, da ich selbst in jüngster Zeit diese Tätigkeit als professionelle Nebenbeschäftigung betreibe. Toni Morrison schwärmt von ihrem Lektor Bob Gottlieb: „Was ihn so gut machte für mich waren mehrere Dinge – zu wissen, was man nicht anrührt; all die Fragen zu stellen, die man wahrscheinlich sich selbst gestellt hätte, hätte man die Zeit gehabt. Gute Lektoren sind wirklich das dritte Auge: sachlich, leidenschaftslos. Sie lieben nicht dich oder dein Werk; das ist für mich das Wertvolle – nicht Komplimente. Das ist für mich hilfreich. Manchmal ist es unheimlich. Der Lektor legt seinen Finger genau auf die Stelle, die schwach ist; der Autor weiß es, war aber zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage, sie besser hinzubekommen. Oder vielleicht dachte der Autor, es könnte funktionieren, war sich aber nicht sicher. Gute Lektoren identifizieren die Stelle und machen manchmal Vorschläge. Manche Vorschläge sind nicht hilfreich, da man einem Lektor nicht alles erklären kann, was man da zu tun versucht. Ich könnte unmöglich all diese Sachen einem Lektor erklären, da das, was ich mache, auf so vielen Ebenen zu funktionieren hat. Aber wenn in dieser Beziehung etwas Vertrauen steckt, etwas Wille zuzuhören, können außergewöhnliche Dinge passieren. Ich lese dauernd Bücher, von denen ich weiß, dass sie nicht von einem Korrekturleser profitiert hätten, sondern von jemandem, der das Buch schlicht durchgesprochen hätte.“ (S. 214.)
Da beneide ich Toni Morrison allerdings, denn ich lese vielmehr dauernd Texte aller Art, die zuallererst einmal eines gründlichen Korrekturlesers bedurft hätten. Und leider macht auch das hier zu würdigende Buch da keine Ausnahme, hätte es doch einen scharfsichtigen „letzten Leser“ vor der Drucklegung so sehr verdient! Immer wieder stolpert der Leser über kleine Fehlerchen, nicht weltbewegend, aber eben doch den Lesefluss störend, beispielsweise gehäuft fehlende Buchstaben am Ende eines Wortes. In einem Absatz stand gleich zweimal „and“ statt „und“. Das passiert einem Übersetzer aus dem Englischen eben; aber liest denn keiner noch mal drüber? Vermutlich gab es wie so oft ganz zum Ende des langen Produktionswegs zeitlichen Druck, der den letzten Schliff unmöglich machte. Das ist schade – und umso mehr, da ja heutzutage bei einer zweiten Auflage in aller Regel die Ausmerzung dieser Fehler nicht finanzierbar ist. (Auch ein Vorteil, nebenbei bemerkt, von Weblogs wie diesem. Ich korrigiere dauernd an meinen älteren Texten herum, bis sie endlich – hoffentlich! – perfekt sind.)
Eine letzte Bemerkung noch zum Verlag. Die Edition Weltkiosk im C. W. Leske Verlag mit Sitz in London ist ein Imprint des Düsseldorfer Lilienfeld-Verlags, dessen kleines und feines Programm ich seit seiner Gründung vor vier Jahren mit Wohlwollen und wachsender Neugier beobachtet und gelegentlich in meinen Blogs kommentiert habe. Zu dem neuen Engagement schreiben die Lilienfeld-Verleger Viola Eckelt und Axel von Ernst in ihrer Frühjahrsvorschau: „Durch die Übernahme des traditionsreichen C. W. Leske Verlages als Imprint werden wir im nächsten Jahr gleich 190 Jahre alt!“ Bald wollen die beiden unter diesem Namen ein Sachbuchprogramm starten. Nun ist das mit dem Reichtum der Traditionen ja manchmal eine vertrackte Sache. In diesem Fall ergibt die Recherche, dass der 1821 in Darmstadt gegründete C. W. Leske Verlag ursprünglich ein Sprachrohr des Vormärz war, im Laufe seiner langen Geschichte aber weit in die rechte, nationalistische Ecke hinüberwanderte. Bedeutende Sortimentsschwerpunkte waren über viele Jahre hinweg Kriegsgeschichte und Militärkunde. Was der Verlag in der Zeit des Nationalsozialismus getrieben hat, weiß ich nicht. Sehr interessant ist jedenfalls die rege Betriebsamkeit, die er in den 1950er-Jahren entfaltete, als er sich mit nationalkonservativen politischen Sachbüchern von Autoren wie Horst Mahnke aus der Deckung traute, jenes vormaligen SS-Hauptsturmführers, der es im Nachkriegsdeutschland der Adenauer-Ära bis zum Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger schaffte. Was wundert es, dass Mahnke sein gemeinsam mit dem ehemaligen SS-Hauptsturmführer Georg Wolff verfasstes Buch 1954 – Der Frieden hat eine Chance just bei C. W. Leske erscheinen ließ, war dessen Verlagsleiter seit 1953 doch kein geringerer als Franz-Alfred Six, SS-Brigadeführer und Amtsleiter im berüchtigten Reichssicherheitshauptamt von Reinhard Heydrich und Heinrich Himmler. (Letzterer kommt übrigens auch in Jonathan Littells Roman Les Bienveillantes vor, deutsch erschienen unter dem Titel Die Wohlgesinnten.) Dieser Clique gelang es in der Nachkriegszeit sogar, Augsteins Spiegel als Medium für antisemitische und den Faschismus exkulpierende Artikel zu nutzen, wie erst jüngst Peter-Ferdinand Koch in einer verdienstvollen Monographie noch einmal in allen für das Hamburger Magazin nicht eben schmeichelhaften Details nachgewiesen hat. Ich will damit nur sagen, dass die 190 Jahre adoptierte Verlagsgeschichte offenbar mehr hergeben als die nobel schimmernde Patina einer nicht weiter hinterfragten „Tradition“. Es stünde dem Lilienfeld-Verlag gut zu Gesicht, wenn er diesen Stier bei den Hörnern packte und einen investigativen Historiker beauftragte, die Geschichte des Darmstädter Verlags C. W. Leske einmal bis in die letzten finsteren Falten auszuleuchten. Vielleicht gelingt das ja bis zur 200-Jahr-Feier?
[die PARIS REVIEW Interviews – 01. A. d. Engl. v. Alexandra Steffes, Judith Steffes u. Henning Hoff. London / Berlin: Edition Weltkiosk im C. W. Leske Verlag, 2011. – ISBN 978-3-942377-01-0. – 19,90 €.]
Warum ich? Warum nicht du?
Monday, 30. May 2011Und warum gerade heute? Warum stehen in Online-Tagebüchern (Weblogs) oben auf der ersten Seite die jüngsten, in Print-Tagebüchern dort hingegen die ältesten Einträge? Warum werden Einträge in Weblogs, die älter als eine Woche sind, so gut wie niemals mehr gelesen und dennoch für alle Zeiten aufbewahrt?
Warum gibt es eine Vergangenheit? Warum hat der Mensch ein Gedächtnis? Warum bewahrt man Dinge auf, die man nicht ständig im Gebrauch hat? Warum hängt man sich für viele Jahre Bilder an die Stubenwand, die man nach wenigen Tagen nicht mehr ansieht? Warum erzählt man neuen Freunden irgendwann einmal die Lebensgeschichte? Warum manchen alten Freunden nie? Warum kann man allerlei unangenehme Erinnerungen nicht einfach bzw. einfach nicht auslöschen?
Warum fragt er? Warum fragt sie nicht? Warum fragt er sich manchmal, warum er ihr diese oder jene Frage nicht gestellt hat? Warum meint sie mindestens einmal im Leben, dass sie ihm in einem bestimmten Augenblick bloß die eine entscheidende Frage hätte stellen müssen, und ihr restliches Leben wäre völlig anders verlaufen? Warum kommst du nicht darüber hinweg, dass du vor ewigen Zeiten auf eine einfache Frage keine Antwort von mir erhalten hast? Warum weiß ich jetzt die Antwort nicht mehr?
Warum setzen wir uns nicht einfach hin und schreiben unser ganzes bisheriges Leben auf, alles was wichtig war, wichtig schien oder wichtig hätte sein können? Warum lassen wir uns immer wieder von diesem Plan abbringen, sei es durch Zweifel an der Bedeutung unseres Lebens, sei es durch Skrupel gegenüber unseren Weggefährten, wenn sie sich in unserer Erinnerung nicht wiedererkennen oder gar wiedererkennen, sei ’s aus Angst, unser Leben als eine einzige Verfehlung zu enttarnen? Warum erkennen wir nicht, dass es keinen Sinn hat, auf ein zweites Leben zu warten, das die Beschreibung eher wert wäre?
Warum finde ich nicht die Quadratur des Kreises, eine neue Struktur im Rahmen des Weblogs, die es möglich macht, die Leserin zu verführen, mich gleichzeitig als den Gewordenen des heutigen Tages und den Werdenden der vergangenen fünf Jahrzehnte zu erleben?
Ich, der Omega-Blogger
Sunday, 29. May 2011Als ich noch bei Westropolis bloggte, ließ ich mich vorübergehend von der unmittelbaren Resonanz auf meine Postings mitreißen. Ich schielte zu den Kollegen hinüber und freute mich, wenn ich mehr Kommentare einsammeln konnte als sie. Angeblich waren die Zugriffszahlen zu den einzelnen Beiträgen oder der Trafficanteil pro Autor nicht ermittelbar, weshalb man sich nur an der Zahl der Kommentare orientieren konnte, wenn man wissen wollte, wie man ankam. Ich ertappte mich dabei, meine Inhalte so zu modulieren und meine Thesen so zuzuspitzen, dass ich stärkere Resonanz erwarten durfte. Außerdem griff ich selbst gezielt in die Diskussion ein, indem ich auf einzelne Kommetare mit Zuspruch oder Widerspruch entgegnete. Das machte eine Weile sehr viel Spaß, schmeichelte meiner Eitelkeit und führte mich in Versuchung, nicht mehr um eine Sache, sondern nur noch um Aufmerksamkeit zu kämpfen. Der Spaß ließ nach, als sich einige Trolle und dumpfe Nervensägen auf mich fixierten. Zudem stellte ich fest, dass sich mein vermeintlich großes Publikum bei genauerer Betrachtung auf vielleicht zehn, zwölf Stammleser und -kommentierer reduzieren ließ, zuzüglich regelmäßig auf- und wieder abtauchender Eintagsfliegen. Diese Einsicht war anfangs schmerzvoll, erleichterte aber wenig später den Ausstieg aus diesem Kasperlthater mit Suchtgefahr.
Seither bin ich immun gegen die Versuchung, mein Selbstwertgefühl als Blogger aus den Zugriffzahlen oder der Resonanz in den Kommentaren herzuleiten. Ich habe meine festen Qualitätsstandards für meine Texte und Bilder. Ich strebe an, täglich einen meiner Fünfabsätzer zu veröffentlichen. Ich bemühe mich nach Kräften, den großen runden Rahmen des Gesamtvorhabens Kleine Schritte weg von der Mitte nicht aus den Augen zu verlieren, wenngleich das selbst regelmäßige Leser vorläufig kaum werden nachvollziehen können. Und ansonsten kümmere ich mich nicht darum, die Zahl meiner Leser, die Qualität meiner Leser oder die Beteiligung meiner Leser zu maximieren. Hätte ich statt 25 regelmäßigen Besuchern 2.500 Dauergäste zu verzeichnen, dann fiele es mir vermutlich leichter, bei Verlagen Rezensionsexemplare zu erbetteln. Das wäre aber auch der einzige Vorteil, den mir diese Popularität brächte. Die Vorstellung scheint mir wenig verlockend, dass auf jeden meiner Beiträge 25 Kommentare eingehen: ein Drittel unangebrachte Komplimente, ein Drittel unbegründete Widersprüche, ein Drittel vermeidbare Missverständnisse – und nur der verbleibende Rest von gerade mal einem Kommentar wäre eine sinnvolle Reaktion auf meinen Text. Und ich müsste mich tagtäglich mit dieser Dampfplauderei herumschlagen. Da ziehe ich die himmlische Ruhe unbedingt vor, die hier herrscht.
Peter Zschunke, Chef-Korrespondent für Online-Themen bei der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, hat „Expertentipps“ zu der offenbar meine Kollegen bedrängenden Frage gesammelt: Wie werden Sie zum Alpha-Blogger (vgl. SPON v. 28. Mai 2011). Blog-Experte Oliver Gassner aus Steißlingen nennt folgende Grundvoraussetzungen fürs Bloggen: „Man sollte zu seiner Meinung stehen, etwas zu sagen haben und der Ansicht sein, dass man die Kommentierung von Politik und Alltag, Kultur und Leben nicht zwingend den Medien überlassen muss.“ Das ist eine ziemlich genaue Beschreibung des deutschen Stammtisch-Polemikers, dem es zur Verbreitung seiner Ansichten über den Dunstkreis seiner Stammkneipe hinaus bloß an den nötigen technischen Kenntnissen gebricht. (Passenderweise liefert Zschunke in den Absätzen 4 bis 8 seines Artikels für diese Klientel einen Schnellkurs zum Einrichten eines Weblogs.) Schockwellenreiter Jörg Kantel bietet alternativ diese fünf Befähigungsnachweise des erfolgreichen Bloggers an: „Spaß am Schreiben, Spaß an der Recherche, eine Message, ein dickes Fell und einen unstillbaren Veröffentlichkeitsdrang.“ Besser könnte man mir nicht erklären, warum ich ein dermaßen erfolgloser Blogger bin. Das Schreiben bereitet mir unsägliche Mühen, von den Recherchen ganz zu schweigen; mit einer Message kann ich nicht dienen, allenfalls mit der eindringlichen Warnung vor frohen Botschaften aller Art; meine Dünnhäutigkeit habe ich bisher immer als besonderes Qualifikationsmerkmal für meine Tätigkeit angesehen; und einen Veröffentlichungsdrang um seiner selbst willen würde ich mir als schieren Exhibitionsimus ankreiden und als Motiv für diese Tätigkeit nicht durchgehen lassen.
Gehe ich der Reihe nach die Liste der 25 beliebtesten Blog-Themen durch – Internet, Musik, Politik, Blog, Web 2.0, News, Fotografie, Medien, Design, Technik, Webdesign, Sport, Leben, Gesellschaft, SEO, Marketing, Computer, WordPress, Lifestyle, Kultur, Apple, Kunst, Software, Berlin, iPhone – dann finde ich bestätigt, was ich ohnehin schon wusste: Ich bin ein extraordinary eccentric. Meine bevorzugten Themen wie Literatur, Philosophie, Alltag, Psychologie, Geschichte, Gesellschaft, Kritik, Selbstanalyse, Sprache oder Zufall kommen überhaupt nicht vor.
Was muss ich tun, um der wundervollen Einsamkeit auf meinem Robinsonblog ein Ende zu bereiten und endlich lukrativen Massentraffic zu generieren? Christiane Schulzki-Haddouti von KoopTech weiß Rat: „Das Blog sollte eine klare inhaltliche Ausrichtung haben und für die gedachte Zielgruppe relevante Themen zuverlässig aufgreifen.“ Meine Zielgruppe sind alle Menschen. Mein Thema ist die Zukunft der Menschheit. Ich zweifle allerdings mittlerweile daran, ob dieses Thema für meine stark an Lifestyle oder Suchmaschinenoptimierung interessierte Zielgruppe relevant ist. Zudem sei es gut, über Twitter oder Facebook immer wieder auf die eigenen Beiträge hinzuweisen und sich dort an Diskussionen zu beteiligen. Die berühmten „sozialen Netzwerke“ also, denen ich mich konsequent verweigere. Wenn ich schon „Netzwerk“ höre! Ich bin doch kein Fisch! Und ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt noch etwas anderes werden will, als ich nun mal bin – ein Alpha-Blogger jedenfalls nicht!
Meine Migräne und ich
Saturday, 28. May 2011Welch große Bereicherung für mein Schreiben bedeutet es doch, dass hier in meinem Blog ohne mein Zutun immer ein tagesaktuelles Gesamtregister aller meiner Hinterlassenschaften erstellt wird! Ich gebe das Stichwort meines heutigen Beitrags ins Suchfester ein, und schon weiß ich, dass ich bisher an vier Stellen über Migräne geschrieben habe. Im Juni 2008 notierte ich, wie sehr mich die hässliche Tristesse der städtischen Umwelt doch bisweilen peinige, und dass mein armer Kopf dann gelegentlich keinen anderen Ausweg finde als die Flucht in einen Migräneanfall. Im Dezember 2008 bekannte ich mich zu den beiden körperlichen Beeinträchtigungen, die mich seit frühester Kindheit bis heute begleiten: ein zu Migräneattacken neigender Kopf und zwei deformierte Füße. Damals frohlockte ich, das erste dieser Leiden habe mir nach den maskulinen Wechseljahren offenbar endgültig Lebewohl gesagt. Zu früh gefreut! Mittlerweile habe ich eine neue Serie von Anfällen hinter mich gebracht. Im März 2010 nannte ich als einen von tausend Fällen, in denen mich meine Migräne daran hinderte, Pläne in die Tat umzusetzen, den verpassten Besuch einer Diskussionsveranstaltung mit Timm Ulrichs im Essener Folkwangmuseum. Und schließlich nannte ich den heftigsten Migräneschmerz, den ich je ertragen musste, neben einem Ohrenschmerz der Kindheit und dem Knochenschmerz nach der Operation meines rechten Fußes, in meiner Antwort auf eine der letzten Fragen von Max Frisch im Juli 2010 als Beispiel für einen Schmerz, den auszuhalten ich immerhin dem Tod vorgezogen hatte.
Welch große Bereicherung war doch für mich, und ist noch immer für mich die regelmäßige Erfahrung des Schmerzes, in seiner zivilisierten, domestizierten Form, als Migräne! Ja, ich weiß, das bedarf einer Erklärung.
Wer wünscht sich schon, von Schmerzen heimgesucht zu werden? Wann immer sich ein neuer Anfall bei mir angekündigt hat, im Übergang von einem zunächst noch kaum wahrgenommenen Kribbeln irgendwo zwischen Stirn und Hinterhaupt und der Gewissheit, dass ich nun wieder einmal das Steuer über mein Selbstempfinden werde abgeben müssen an eine fremde Macht namens Schmerz, stellte sich ein Gefühlschaos aus Wut, Enttäuschung, Hilflosigkeit und Angst bei mir ein. Einerseits weiß ich zwar, was kommt; andererseits ist das Ereignis durch diese Vertrautheit kein wenig erträglicher. Wenn ich das Glück habe, mich jeglicher Verantwortung gegenüber der Außenwelt für die Dauer des Anfalls entziehen zu können, konkret: wenn ich mich in ein stilles, kühles, abgedunkeltes Zimmer zurückziehen kann und Störungen jeder Art nicht einmal mit geringer Wahrscheinlichkeit befürchten muss, dann kann ich mich immerhin dem Schmerz stellen, ihm meine ganze Aufmerksamkeit schenken, ihn in Schach halten. Das mildert ihn zwar nicht, aber ich wahre ihm gegenüber immerhin noch einen Rest von Würde. Wenn ich aber, um das andere Extrem auszumalen, mit einer verantwortungsvollen Verpflichtung mitten unter Menschen geworfen bin, mir nichts anmerken lassen darf, kein Ende dieser Höllenveranstaltung abzusehen ist, dazu noch ein Gewitter in der Luft liegt, schwüle Luft und schlechte Gerüche, schrille Klänge und primitives Gelächter, wenn von verachtenswerten Individuen dumme Fragen an mich gerichtet werden – dann erzeugt das ohnehin schon unerträgliche Ereignis in meinem migränekranken Kopf ein Schmerzinferno, das mit Worten nicht zu beschreiben ist.
Und genau diese Unbeschreiblichkeit ist die Erfahrung, die mein Inderweltsein um eine unentbehrliche Dimension erweitert hat. Erst durch sie erkannte ich, dass das Beschreibenkönnen mein Dispositiv für alle Fälle ist. Und wo dieses Können seine Grenze findet, bin ich ein anderer, das Nicht-Ich, zum Tier entmachtet.
Gehupft wie gesprungen sind diese Zustände zueinander. Das man diesen schmerzvolle Krankheit nennt und jenen gesundes Wohlbefinden, ist eine verständliche Wertung. Wer hat schon gern Schmerzen. Und doch gibt es eine absolute Gleichwertigkeit zwischen Migräne und Migränefreiheit, was den Blick von hier nach dort und den von dort nach hier betrifft. Wenn ich Migräne habe, kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie es ohne diesen Schmerz ist, denn ich bin überzeugt, dass die Vorstellung von der Schmerzfreiheit diese sogleich herbeiführen müsste, was meiner Imagination hingegen niemals gelingt. Aber warum nicht? Schließlich spielt sich doch beides, der Schmerz und die Vorstellung von Schmerzfreiheit, am gleichen Ort ab: in meinem Kopf. – Und wenn ich frei von Migräneschmerzen bin, verstehe ich nicht, wie ich dort überhaupt jemals hineingeraten konnte. Und noch weniger verstehe ich, dass ich diesen Schmerz im Kopf nicht mit größerer Gelassenheit ertragen kann, da ich doch tausende Male erlebt habe, dass der Schmerz von allein weicht, nachdem er mich kaum jemals länger als einen Tag behelligt hat. Für die Grenzen zwischen wachem Normalbewusstsein und Zuständen wie Traum, Wahn oder Rausch führte der amerikanische Psychologe Roland Fischer den Terminus state boundaries ein. Ich finde sein Schema eines halbkreisförmigen Wahrnehmungs-Halluzinations- bzw. Wahrnehmungs-Meditations-Kontinuums sehr plausibel. Allerdings störte mich immer schon, dass die doch so existenzielle menschliche Erfahrung von Schmerz in diesem Modell keinen Platz fand. (Vielleicht sollte Fischers Modell um eine dritte Dimension ergänzt, also zur Halbkugel erweitert werden?)
Schröder erzählt: Funkloch
Friday, 27. May 2011Heute war ’s endlich mal wieder so weit. Die neue Folge der Schwarzen Serie von Schröder erzählt lag vor der Tür. Wenn das passiert, lasse ich augenblicklich alles stehen und liegen, suche mir ein ruhiges Plätzchen und versinke für eine gute Stunde in den Untiefen dieser endlosen Erzählung von Neid und Stolz, Armen und Reichen, Politik und Business, Verrat und Liebesglück, Heimtücke und Heimathass, Dumpfbackigkeit und Grandezza, Geilheit und Spießertum, Neurosen und Almosen, Protzerei und Pfennigfuchserei, verkannten Genies und verbrannten Talenten, Drogensucht und Hodenkrebs – obwohl, ich weiß nicht, ob ein solches Unterkörperkarzinom überhaupt vorkommt. Mir ist aber so. Ein Sachregister gibt es ja bisher noch nicht, bloß eine Synopsis samt Personenregister der ersten 40 Hefte, erschienen vor nun auch schon wieder einem Dezennium als Treuegabe für unverdrossene Abonnenten wie mich zum Abschluss der Weißen Serie.
Jörg Schröder und Barbara Kalender sind als kreatives Paar, das kann man wohl sagen, eine seltene Ausnahmeerscheinung in der Literaturgeschichte. Es gibt ja durchaus etliche schreibende Paare, die sich gegenseitig angeregt haben mögen, oder durch Konkrrenz angespornt. Jane und Paul Bowles fallen mir ein, Elsa Triolet und Louis Aragon, Ernst Weiss und Rahel Sanzara, Emmy Hennings und Hugo Ball, aus neuerer Zeit Siri Hustvedt und Paul Auster. Aber in allen diesen Fällen bleibt das Schreiben dennoch ein monologisches Medium, führt jede Hälfte des Paares ihren eigenen Stift. Beim Tandem Schröder / Kalender ist das anders.
Ich hatte das Glück, vor vielen Jahren einmal Zeuge einer solchen Erzähl-Session zu werden. Damals setzten mir Jörg Schröder und Barbara Kalender in ihrem Haus in Herbstein-Schlechtenwege am Vogelsberg haarklein auseinander, wie es zu jener einstweiligen Verfügung des Verlags der Autoren als Sachwalter der Rechte am Werk von Rainer Werner Faßbinder gegen den März-Verlag gekommen war, weil Schröder sich erdreistete, bei einer Neuauflage des Romans von Gerhard Zwerenz, Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond, im Anhang erstmals das gleichnamige Drehbuch zu veröffentlichen, das der Autor gemeinsam mit Faßbinder geschrieben hatte. Jörg Schröder umging die EV, indem er kurzerhand einen April-April-Verlag gründete und das fertig gedruckte Buch dort mit neuem Impressum als „Einmalige Notausgabe“ erscheinen ließ. Ich hatte beide Kontrahenten, Schröder für März und Karlheinz Braun für den Verlag der Autoren, zu einer Podiumsdiskussion ins Essener Grillo-Theater eingeladen, dazu noch Gerhard Zwerenz als Moderator und zugleich Hauptbetroffenen – schließlich war es sein Buch, dem der Zugang zum Markt verwehrt worden war. Im letzten Augenblick sagte Braun ab. Ich war sehr enttäuscht – und erhielt zum Trost die Einladung nach Herbstein.
Ich weiß nicht, ob das Tape von dieser Session noch exisitiert. Bisher wurde der ziemlich interessante und in mehrfacher Hinsicht für die politische Kultur in den 1980er-Jahren aufschlussreiche Fall in Schröder erzählt noch nicht aufgearbeitet. Die Arbeitsweise, die ich bei dieser Gelegenheit kennenlernte, war aber mindestens schon eine reife Vorstufe jener dialogischen Technik, die Barbara Kalender und Jörg Schröder seither zur Vollendung gebracht haben. Auf dem niedrigen Couchtisch lagen ausgebreitet wie die Karten einer Patience Zettel mit stichwortgebenden Notizen. Sie gaben eine Grundstruktur des Erzählgangs vor, ließen aber dabei noch genug Spielraum für Abschweifungen, Umwege, spontane Kurswechsel. Ich durfte Fragen stellen, wenn ich etwas nicht verstand. Und Barbara Kalender korrigierte oder ergänzte laufend, wenn sie Ereignisse anders in Erinnerung hatte oder ihre Bedeutung anders interpretierte. (Was ich naturgemäß nicht mitbekommen habe, sondern nur aus den Erzählungen der beiden kenne, ist der Vorgang der Verschriftlichung, bei dem Barbara Kalender einen sehr entscheidenden Anteil hat.)
Wenn ich heute die aktuelle Folge genieße, die Funkloch heißt, auf dem Titelblatt Friedrich den Großen mit seinem Rappen zeigt und rechts oben auf den Textseiten wie immer mit einer Vignette geschmückt ist, diesmal ein explodierendes Bömbchen im Warndreieck – dann genieße ich jede witzige Wortwahl und stelle mir dabei vor, wie das Paar den Text Satz für Satz durchgesprochen hat, immer unzufrieden, wenn er zu eingängig durch die Köpfe flutscht, nach überraschenden, hintersinnigen, doppeldeutigen Alternativen sucht und sie auch immer wieder findet. Was dabei herauskommt ist ein großes Werk der Inspiration, aber sicher ebensosehr hartnäckige Fleißarbeit. Ich lese mit Spannung, neugierig nicht nur auf die Auflösung von Preußenkönig und Funkloch, sondern auf jeden neuen Abschweif und darauf, wie sie schließlich diesmal die Kurve wieder kriegen. Manchmal stelle ich mir vor: Bekäme ich die tödliche ärztliche Prognose, noch ein halbes Jahr und dann ist Schluss, ich würde wohl das ganze Mammutwerk der (bislang) 56 Hefte noch einmal von Anfang bis Ende lesen. Aber da fällt mir gerade ein: Selbst diese Idee taucht ja irgendwo in Schröder erzählt schon auf. Ein reicher Abonnent gönnt sich auf seinem Sterbelager diesen Genuss, wenn ich mich richtig erinnere. Egal! Ich sterbe vermutlich ohnehin von jetzt auf gleich.
Suro Art 1972
Wednesday, 25. May 2011Vorgestern saßen wir mal wieder mit meinem ältesten Freund und seiner jüngsten Freundin beisammen, nebenbei bemerkt in einem Restaurant, für das ich ganz gegen meine Gewohnheit einmal Reklame machen möchte, denn es hat mir dort – im Kulturforum Steele in der Dreiringstraße – nun schon zum wiederholten Male ganz außergewöhnlich gut geschmeckt. (Zander.)
Dass ich immer wieder gern hier einkehre, hat seinen Grund auch in der außergewöhnlichen Atmosphäre des alten Ratssaals im ehemaligen Bürgermeisterhaus, denn dort wird man tatsächlich nicht mit Hintergrundmusik dauerbeschallt. Wo gibt es das noch? Dann stehen die hohen Wände kreativen Menschen zur Präsentation ihrer Bilder zur Verfügung, nicht unbedingt etablierte Künstler sind das, aber es berührt meist doch durch eine stille Leidenschaftlichkeit, was man dort zu sehen bekommt, und rührt gar manchmal durch einen verzweifelten Ehrgeiz. Und schließlich ist die Bedienung bezaubernd.
Dieses Raumklima fördert meine Lust am Gespräch zuverlässig ungemein. Und selbst das Zuhören, nicht unbedingt mein größtes Talent, fällt mir hier leichter als anderswo. Es ergab sich, dass ich nun schon zum wiederholten Male den Eindruck gewann, hier dem einzigen regelmäßigen Leser meines Blogs gegenüberzusitzen. Mein Freund, der nicht nur mein ältester, sondern auch mein bester ist, wie mir wieder einmal recht deutlich wurde, tippt bei solchen Gelegenheiten dies und jenes zart an, was ich in jeweils jüngster Zeit hier von mir gegeben habe. Dann zucke ich zusammen, denn ich weiß, wie mich selbst die blassesten Andeutungen einer Kritik aus der Fassung bringen und oft tagelang beschäftigen können. Blitzschnell überwinde ich meine Neugier und lenke dann ab, suche mit einem Überraschungscoup, einer kecken Frage oder einem provozierenden Witz das Thema zu wechseln. Diesmal jedoch kam ich zu spät – und schon war es passiert.
Das seien ja schon merkwürdige Typen, die ich da immer wieder kennen lernen würde. (Gemeint war damit offenbar Noxo.) Aber das mit den Fotos, mit der Anarchie, das habe er nicht verstanden.
Ich murmelte mir verschämt etwas in den Bart, er möge jetzt aber doch bitte nicht darauf bestehen, dass ich meine eigenen Texte, gar meine Ohne-Worte-Beiträge interpretiere. Aber das Kind war in den Brunnen gefallen und strampelt dort noch immer im faulen Schlick. Soll ich bekennen, dass es mir tatsächlich nicht bei allen Postings darum zu tun ist, verstanden zu werden? Noch schlimmer, dass ich manche meiner hier abgelegten Lebens- und Sterbensäußerungen selbst nicht begreife? Nein, das darf man nicht von mir verlangen. Und mein Freund am allerwenigsten. Das Foto oben zeigt ihn, wie er vor knapp 40 Jahren eine Reihe Zuckerwürfel im Abstand von exakt 10 Zentimetern quer über den Süthers Garten in Essen-Rüttenscheid legt. Sein Gesicht verbarg er dabei hinter einer Gasmaske. Für dieses Happening, das wir Suro Art Aktion No. 2 nannten, gab es auch keine vernünftige Erklärung. Es stimmte aber, in einem außerrationalen Sinn. Diesem Sinn bin ich treu geblieben. Und jetzt pssst!
Ghanas geheime Abenteuer
Tuesday, 24. May 2011Wieder mal ein wertvoller Hinweis von Nerdcore. Es fehlt nicht mehr viel und ich setze den Link auf meine Blogroll. (Aber zuerst muss ich mal den Link auf Glumm begründen.)
Im Chicago Cultural Center wird zurzeit eine extraordinäre Sammlung von handgemalten Filmplakaten aus Ghana gezeigt – im doppelten Sinn, denn nicht nur die Zahl der Exponate, sondern auch ihre Motivik sprengt alle Grenzen des Gewöhnlichen.
Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, angesichts der Überwältigung der althergebrachten Vorstellungswelten des Landes durch fremde Phantasmen aus aller Herren Ländern – und zugleich des trotzigen Festhaltens an offenbar sehr resistenten Lieblingsbildern aus eigenem Bestand, wie den aus menschlichen Körpern sich windenden, mit ihnen verbundenen oder in sie eindringenden Schlangen.
Mich persönlich irritieren besonders die fernöstlichen Ninjaposter in der Brechung afrikanischer Optik, wenn eine Exotik noch durch eine weitere potenziert wird und seltsamerweise hierdurch nicht weiter steigerbar ist, sondern eher neutalisiert wird.
Der Gesamteindruck überrascht hingegen nicht. Es war zu erwarten, dass in diesem Erdteil die „niederen Instinkte“ auch nicht nach anderen Genüssen und wohligen Schrecknissen auf der Leinwand lechzen als in Europa oder Nordamerika. Das kann nur jemanden enttäuschen, der hier eine überzivilisierte Dekadenz als Grund des vermeintlichen Übels annahm und den „unschuldigen Wilden“ idealisierte, der von sich aus auf solch „perverse Bilder“ gar nicht verfiele. Insofern wirkt der Anblick der Horrorplakate auf mich sehr beruhigend, geradezu versöhnlich. Liebliches Afrika!
Außerfahrplanmäßig
Monday, 23. May 2011Ich führerscheinloser Fußkranker bin infolgedessen gewohnheitsmäßiger Vielnutzer von öffentlichen Omnibussen und Straßenbahnen. Wie jede andere Fortbewegungsweise, und wie vielleicht überhaupt alle Handlungsoptionen im Leben hat auch diese ihre Vorzüge und Nachteile. Heute widerfuhr mir ein Ereignis, das mich noch nach Stunden schwanken lässt, ob ich es als Ärgernis oder Glücksmoment werten soll.
Als gebürtigen Rüttenscheider mit Wohnsitz in Rellinghausen zieht es mich zum Einkaufen alle paar Tage an meinen Herkunftsort, den ich wahlweise „untenrum“ mit der Straßenbahnlinie 105 über den Moltkeplatz oder „obenrum“ mit der Buslinie 142 über die Martinstraße erreichen kann. Letztere Variante bevorzuge ich, weil sie zeitsparender ist und durchs Grüne führt. Zudem fährt der Bus fast vor unserer Haustür ab, während ich zur Tramhaltestelle fünf Minuten laufen muss. Heute hatte ich meine paar Einkäufe auf der Rü schnell erledigt und stand frühzeitig an der Bushaltestelle Martinstraße, von der außer dem 142er auch der 160er in Richtung Stoppenberg abfährt. Hier wurde vor einem knappen Jahr versuchsweise eine digitale Anzeigetafel montiert, auf der die aktuellen Abfahrtzeiten der jeweils nächsten Busse abzulesen sind. Diese Zeiten kann der Fahrgast zwar auch den an allen Haltestellen aushängenden Plänen entnehmen, aber vermutlich soll diese elektronische Anzeige es ermöglichen, auch über gelegentliche Verspätungen zu informieren. Heute wurde ich nun Zeuge, wie zwei Elektriker unter der Anzeigetafel eine Leiter aufklappten, hinaufstiegen, einen Kasten öffneten und sich an den labyrinthischen Verdrahtungen mit Schraubendrehern zu schaffen machten. Ihren großen Werkstattwagen hatten sie auf der Bushaltespur geparkt, sodass diese nicht mehr in voller länge frei war. Nun näherte sich „mein“ 142er und hielt in einigem Abstand hinter dem Werkstattwagen, was mir sofort plausibel war, denn um an der Kreuzing plangemäß rechts abbiegen zu können, musste der 142er sich noch einigen Spielraum zum Manövrieren lassen. Ich stieg ein und setzte mich gleich auf den ersten Platz rechts neben dem Fahrer, da der von mir sonst bevorzugte Platz links, direkt hinter dem Fahrer, von einer Dame mittleren Alters besetzt war. Nachdem offenbar alle wartenden Fahrgäste eingestiegen waren, lenkte der Fahrer sein Gefährt an dem parkenden Werkstattwagen links vorbei auf die rechte der beiden „normalen“ Fahrspuren. Die Ampel stand noch auf Rot, musste aber gleich auf Grün schalten. – Nun ereignete sich etwas Ungewöhnliches.
Von hinten aus dem Bus machte sich lautstark ein junger Mann bemerkbar, der den Busfahrer aufforderte, gefälligst noch zu warten. Hinter uns nähere sich der 160er, vielleicht wollten ja Fahrgäste aus diesem Bus in „unseren“ 142er umsteigen? Und außerdem sei der Fahrer sowieso wieder mal anderthalb Minuten zu früh abgefahren. – Ganz abgesehen davon, dass es jetzt definitiv zu spät war, um die Forderungen des Mannes im Hintergrund zu erfüllen, selbst wenn sie berechtigt gewesen wären, machte nun der Busfahrer seinerseits mit vollem Recht darauf aufmerksam, dass es wegen des außerplanmäßig parkenden Werkstattwagens für den 160er gar nicht möglich gewesen wäre, in die Bushaltespur einzufahren, solange sie noch von unserem 142er besetzt war. Und übrigens sei er auch nicht 90 Sekunden zu früh, sondern bloß 30 Sekunden zu früh abgefahren. Der Fahrgast möge sich also mäßigen und im übrigen das Busfahren ihm, dem Busfahrer überlassen. Seine Argumente trug der Fahrer in wohltuendem Unterschied zu dem Beschwerdeführer sehr sachlich vor. Dieser musste nun allerdings erst recht auf seinem Standpunkt beharren und stimmte ein langes Lamento darüber an, wie ärgerlich es doch immer wieder sei, dass Busse und Bahnen sich nicht an die Fahrpläne hielten, die Fahrer offenbar gar nicht schnell genug nach Hause kommen könnten, es insofern ja kein Wunder wäre, dass die öffentlichen Verkehrsmittel einen so schlechten Ruf hätten – und überhaupt gehe die Uhr des Fahrers wohl eine Minute vor! Dem Gemurmel, das sich seitens einiger älterer Leute rings um diesen Querulanten erhob, war eine verhaltene Zustimmung zu entnehmen, aber von der feigen Sorte, die sich nicht wirklich Farbe zu bekennen traut, sondern ganz schnell wieder verstummt, wenn eine gegenteilige Meinung sich noch lauter und respektgebietender vernehmen lässt. Der Fahrer hatte übrigens offenbar beschlossen, dem Krakeeler kein Paroli mehr zu bieten und sich auf den Verkehr zu konzentrieren, was von großer Besonnenheit zeugte und mich vollends auf seine Seite brachte. – Da geschah die zweite Überraschung!
Völlig unvermittelt, aus dem sprichwörtlichen heiteren Himmel erhob die Dame mittleren Alters links neben mir ihre Stimme und trug nun mit flammender Leidenschaft ihr Anliegen und ihre Sicht der Dinge vor: „Jetzt reicht es! Bevor sie hier den Fahrer weiter belästigen, sollten Sie sich vielleicht zunächst einmal die Beförderungsbedingungen durchlesen. Dort heißt es nämlich, dass Fahrgäste zwei Minuten vor dem fahrplanmäßigen Abfahrttermin an den Haltestellen eintreffen sollen, da es nicht in allen Verkehrssituationen gewährleistet werden kann, dass die Fahrzeuge bis zur letzten Sekunde mit der Abfahrt warten. Ich bin selbst seit 18 Jahren mit einem Busfahrer verheiratet, der nach mancher Schicht nach Hause kommt und mit den Nerven völlig am Ende ist, wegen solch unverschämter Fahrgäste wie Sie einer sind! Ich bin mir sicher, dass ein einziger Tag hinter dem Steuer eines Busses oder einer Straßenbahn ausreichen würde, um Sie nie wieder auf den Gedanken kommen zu lassen, solch ein unbegründetes Urteil über die Tauglichkeit und Redlichkeit dieser Fahrer zu fällen, wie Sie es hier getan haben.“ Punktum.
Der Querulant murmelte noch bis zur nächsten Haltestelle vor sich hin, es sei ja klar, dass die Frau von solch einem Fahrer keine objektive Meinung haben könne, befangen wie sie sei. Er bleibe bei seinem Standpunkt. Dann stieg er aus. Die opportunistischen Claqueure aber hatten sich schon vorher geräuschlos in Luft aufgelöst.
Das Jüngste Gericht, gestern
Sunday, 22. May 2011Das Programm von Family Radio war am Tag Null der abgelaufenen Menschheitsgeschichte kopflos. Die sonore Stimme seines 89-jährigen Gründers, des evangelikalen Propheten Harold Camping, war verstummt. Vom Band lief stattdessen Kirchenmusik, unterbrochen von allerlei Lebensweisheiten und frommen Sprüchen. Die Uhr tickte und das Ende kam näher und näher.
Beginnen sollte es nach der festen Überzeugung von Camping in Asien, wo die Sonne ja wesentlich früher auf- und wieder untergeht als in der Neuen Welt. Als nun aber in Tokio und Peking der 21. Mai 2011 sich dem Ende näherte, ohne dass auch nur die geringste seismische Erschütterung spürbar gewesen wäre, schließlich Mitternacht vorbei war und ein ruhiger 22. Mai 2011 anbrach, da musste wohl der mindestens einige zehntausend Menschen zählenden Anhängerschaft des Apokalyptikers dämmern, dass sie einem Irrtum aufgesessen war. Was mag zum Beispiel Robert Fitzpatrick (60) gedacht haben, der mehr als 140.000 US$ gespendet hatte, damit auf Plakaten in der U-Bahn und an Bushaltestellen vor dem Weltuntergang gewarnt werden konnte?
Gabrielle Saveri von der Agentur Reuters berichtete, dass niemand an die Tür kam, als ein Reporter Campings Haus in Alameda (Kalifornien) aufsuchte, um ihn zu den Ereignissen zu befragen, oder richtiger: zum Ausbleiben der Ereignisse. Sheila Dorn (65), die seit vierzig Jahren im Nachbarhaus der Campings wohnt und nichts Schlechtes über das alte Ehepaar sagen kann, macht sich etwas Sorgen wegen der großen Aufmerksamkeit, die diese Prophezeihung in den vergangenen Wochen im ganzen Land gefunden hat. In dieser verrückten Welt könne man ja nie wissen, zu welchen Dummheiten sich jemand hinreißen lasse, der vielleicht zu sehr auf die Vorhersage vertraut habe und sich nun schadlos halten wolle bei dem falschen Propheten.
Großen Spaß hatten offenbar atheistische Gruppen, die bei Zusammenkünften im ganzen Land das Ausbleiben des Weltuntergangs feierten, so etwa bei einer Versammlung der Freimaurer-Loge von Oakland, wobei die Redner es sich nicht verkneifen konnten, scherzhaft Bezug auf den Judgement Day zu nehmen.
Stuart Bechman von den American Atheists erinnerte aber auch daran, dass es bei dergleichen obskuranten Verkündigungen doch auch einen sehr ernsten Aspekt gebe, den man nicht aus dem Blick verlieren sollte. Eine Vielzahl törichter und unbegründeter Überzeugungen würden von Leuten wie Camping in Umlauf gebracht, die bei leichtgläubigen Menschen durchaus auch großen Schaden anrichten könnten.
Apocalypse Now
Sunday, 22. May 2011Das Jüngste Gericht, morgen
Friday, 20. May 2011Wenn es nach Harold Camping geht, dem Chef des amerikanischen Radioprogramms Familiy Radio, dann ist dies hier leider schon mein letzter Blog-Beitrag, wenigstens in dieser Welt. Der 89-jährige US-Amerikaner hat nämlich den morgigen Samstag zum Judgement Day ausgerufen, also zum Tag des Jüngsten Gerichts. Seine evangelikale Anhängerschaft zieht seit Wochen mit Transparenten durch die Straßen des Landes und ruft zur inneren Einkehr auf, wo nötig auch zur Umkehr. Denn das Ende sei nah.
Camping hat nicht etwa zu tief ins Glas geschaut, sondern vielmehr ganz tief in The Holy Bible. Und dort hat er allerlei äußerst bemerkenswerte Zusammenhänge entdeckt, Zahlen mit magischer Bedeutung, den Schlüssel zu einer bezwingenden Verheißung eben. Heraus kam nach solchen ausgefuchsten numerologischen Kalkulationen just das morgige Datum, May 21, 2011. Also wieder einmal ein Weltuntergang, na schön. Ich bin drauf gefasst.
Merkwürdig finde ich aber doch, dass diese apokalyptischen Prophezeiungen immer unter dem vollmundigen Namen Welt-Untergang laufen. Als ginge mit der Menschheit gleich die Welt unter. Welche Anmaßung! Was nach einer kurzen Regentschaft von vielleicht gerade einmal 10.000 Jahren den Bach runter ginge, wäre doch gerade mal eine durchgeknallte und aus dem Ruder gelaufene Affenart, die sich für den Rest der Schöpfung hauptsächlich als epidemisch sich ausbreitender Schädling bemerkbar machte.
Und zweitens ist sonderbar, dass diese Vorhersagen einer neuen Sintflut sich immer und immer wieder auf einen einzigen Tag kaprizieren. Der Horizont dieser selbsternannten Hiobs und Kassandras ist offenbar nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit ausgesprochen beschränkt. Sie nehmen nicht wahr, dass der Untergang nicht der Welt, aber doch der Menschheit seit vielen Jahren längst, und zwar ununterbrochen stattfindet.
Harold Camping beglaubigt seinen festen Glauben an die Richtigkeit seiner Berechnungen damit, dass er für die Zeit nach morgen keine Termine mehr gemacht hat. Ach, der alte Herr aus Colorado tut mir richtig leid. Wie wird er sich fühlen, wenn ihm der liebe Gott den Gefallen nicht tut und der Welt noch einen kleinen Aufschub gewährt? Aber vermutlich gibt es dann für ihn doch noch einen spekulativen Ausweg: Er muss sich irgendwo verrechnet haben!
Chaos chétif
Wednesday, 18. May 2011Anarchie désolé
Tuesday, 17. May 2011Grau alle Theorie
Sunday, 15. May 2011(Ohne Worte.)
Alles gleich
Saturday, 14. May 2011Neulich brachte die FAZ ein langes Gespräch, das Frank Rieger vom Chaos Computer Club mit Daniel Suarez führte, einem US-amerikanischen Thriller-Autor, dessen Romane Daemon (2006) und Darknet (2010) die ebenso bedrückende wie gut begründete Vision einer menschlichen Gesellschaft entwerfen, die ihre Freiheit endgültig an ihre eigenen Apparate verliert.
An einer Stelle sagt Suarez: „Meine Sorge ist, dass Außenseiter am Ende möglicherweise als ,verdächtig‘ gelten, weil sie nicht ins Schema passen – statt dass es gerade umgekehrt wäre.“ (Frank Rieger: Wir werden mit System erobert: Ein Gespräch mit Daniel Suarez. A. d. Engl. v. Michael Bischoff; in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 100 v. 30. April 2011, S. 34 f.) – Der letzte Teilsatz klingt leider etwas hemdsärmelig oder schief geknöpft, was möglicherweise an einer unglücklichen Übersetzung liegt. Ich verstehe Suarez jedenfalls so, dass er eine Lanze für Außenseiter brechen will, deren Beitrag für die Entwicklung der Menschheit immer unverzichtbar war und deren Verschwinden einer Katastrophe für unser aller Zukunft bedeuten würde.
Zufällig las ich fast gleichzeitig anderswo folgenden Satz: „In Auschwitz, das wusste ich, starben die, die anders waren, während die Gesichtslosen, die Anonymen überlebten.“ Er stammt von Rudolf Vrba, einem der wenigen Überlebenden des Vernichtungslagers. (Rudolf Vrba: Ich kann nicht vergeben. Frankfurt am Main: Schöffling & Co., 2010, S. 248.) Die Ausmerzung des Abweichenden und die Anpassung der Verbleibenden an eine ideale Durchschnittlichkeit könnte das Rezept sein, nach dem sich diese Spezies endgültig eliminiert, denn schließlich ist Varietät das vitale Moment jeder Evolution.
Vielleicht komme ich aber nur zu diesem Ergebnis, weil ich mich selbst immer als einen Abweichling empfunden habe, als den Ausnahmefall für alle möglichen Regelmäßigkeiten, den aus der Rolle fallenden, aus der Reihe scherenden Störer. Und nichts ließ mich mehr leiden als die Langweiligkeit des Normalen. (Gleichzeitig war ich mir immer der Gefahren bewusst, denen ich mich damit aussetzte.)
Darum „weg von der Mitte“. (Und darum in „kleinen Schritten“.)
Lob des Missgeschicks
Friday, 13. May 2011Freitag, der 13. Mai 2011. Vor einem Datum wie heute zittern nicht nur strenge Irrationalisten, zumal dessen Ziffernfolge – 1 + 3 + 5 + 2 + 1 + 1 – als Quersumme diesmal auch noch 13 ergibt. Selbst mich beschlich gelegentlich ein leichtes Unwohlsein, wenn mir ausgerechnet an einem solchen Dreizehnten freitags ein unwahrscheinliches Missgeschick widerfuhr. Ausgerechnet hat jetzt ein Aachener Physikprofessor, dass tatsächlich mathematisch betrachtet an 13er-Freitagen mehr Unglücke geschehen als an jenen 13ten, die auf die sechs anderen Wochentage fallen. (Vgl. Christopher Schrader: Schicksalstag; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 110 v. 13. Mai 2011, S. 18.) Seine Grundannahme ist dabei natürlich, dass sich Unglücksfälle rein stochsatisch auf lange Sicht völlig gleichmäßig auf alle Tage des Jahres verteilen. Schaut man sich die Ereignisse an, die in den 366 Datums-Artikeln der Wikipedia gelistet sind, so sind die dort unter den zwölf 13ten aufgelisteten Katastrophen jedenfalls nicht zahlreicher als die unter den anderen Tagen genannten – wobei man nun noch prüfen müsste, welche von diesen insgesamt 42 Katastrophen-13ten auf einen Freitag fielen. Erst für den Fall, dass es signifikant mehr als der Durchschnitt von 3,5 waren, könnte man ins Grübeln kommen. (Ich werde das gelegentlich vielleicht einmal überprüfen.)
Aber all diese Berechnungen bewegen sich ohnehin auf schwankem Boden. Wer legt denn fest, welche Ereignisse als Katastrophe gewertet werden und Eingang in die Geschichtsbücher und Enzyklopädien finden? Überdies gibt zu denken, dass sich die Katastrophen scheinbar in letzter Zeit häufen. Glaubt man der Wikipedia, dann haben sich die meisten Katastrophen der dokumentierten Menschheitsgeschichte, also der vergangenen 4500 Jahre seit Aufkommen der ersten Hochkulturen, in den letzten 500 Jahren ereignet. Das könnte nun aber zu einem guten Teil auch daher rühren, dass in dieser Zeit die Kommunikations- und Dokumentations-Techniken große Fortschritte machten und weltweite Verbreitung fanden. Und überhaupt: Bezieht sich der Aberglaube um Freitag den Dreizehnten als Tag des Unglücks nicht ohnehin eher auf die Privatsphäre, auf die kleinen Missgeschicke des Alltags?
Hier kommt nun ein weiterer „Störfaktor“ ins Spiel, der die Betrachtung des Themas um einen zusätzlichen, reizvollen Aspekt erweitert. Ist es nicht eine Frage der inneren Einstellung, der zufälligen Tageslaune und der äußeren Umstände, ob man ein Missgeschick als Unglück empfinden muss – oder im Gegenteil in eine glückliche Wegweisung des Schicksals umzudeuten vermag?
Ich jedenfalls bin zu der Einsicht gelangt, dass das Missgeschick wesentlich besser ist als sein Ruf. Es kommt allein darauf an, wie man zu ihm steht und was man daraus macht. Wenn mir zum Beispiel wieder einmal der Bus vor der Nase wegfährt, dann vergeude ich meine Zeit nicht damit, den offenkundig entweder sehschwachen oder gehässigen Fahrer zu verfluchen, sondern ich nutze die unverhoffte Wartezeit für sinnvolle Beschäftigungen: Beobachtung der neben mir wartenden Mitmenschen, stille Teilnahme an ihren Gesprächen, Selbstversenkung, konzentrierte Verfolgung eines jüngst unterbrochenen Gedankengangs und dergleichen mehr. Oder ich mache mich auf den Weg zur nächsten, gar übernächsten Haltestelle, um mir etwas Bewegung zu verschaffen und mich überraschen zu lassen, was mir wohl unterwegs begegnen wird. Meist geschieht in dieser Zeit nichts Außergewöhnliches. Aber außergewöhnlich wären vermutlich auch nicht die anderswo verbrachten Minuten gewesen, die ich früher an meinem Zielort einträfe, wäre der Busfahrer gnädiger oder aufmerksamer gewesen. Hingegen kam es gelegentlich schon vor, dass mir in einer solchen aufgenötigten Wartezeit ein großes Glück beschieden war, dass ich mit dem rechtzeitigen Erreichen des Busses verpasst hätte.
Dies war bloß ein triviales Beispiel. Es reicht aber aus, um ein Lebensprinzip deutlich werden zu lassen, dass sich noch auf die dramatischsten Schicksalsschläge anwenden lässt. Man könnte auch von einer „Hans-im-Glück-Mentalität“ sprechen, die den von ihr beseelten unter einem undurchdringlichen Schutzschild durchs Leben führt. Allerdings muss ich gestehen, dass ich von einer solch fugendichten Gemütspanzerung noch sehr weit entfernt bin. (Nicht zu verwechseln ist diese übrigens mit einer Abstumpfung der Empfindsamkeit.) Immerhin habe ich gerade in jüngster Zeit offenbar einen Punkt erreicht, da ich Rückfällen in die Verzweiflung nach als ungerecht empfundenen Schicksalsschägen mit der Frage begegnen kann: Was will mir der Zufall damit sagen? Eine Frage aber führt immer weg vom Jammern und hin zum Denken. Das ist doch immerhin schon ein kleiner Fortschritt. – Fast wäre ich jetzt enttäuscht, wenn mir der heutige Freitag als Dreizehnter keine solche Frage stellte. Man soll das Unglück nicht beschwören? Ach was, ich bin doch schließlich strenger kritischer Rationalist Feyerabendscher Couleur und tanze unbekümmert auf dem Kraterrand. An allen Tagen des Jahres.
Magendarm (Forts.)
Thursday, 12. May 2011Magendarm
Wednesday, 11. May 2011Tante Äffi. Eine Groteske
Tuesday, 10. May 2011Meine Tante ist, wie sich nun herausgestellt hat, mit mir weder verwandt noch verschwägert. Der Schwager meiner Tante hat hierfür auf seine unnachahmlich ledige Weise den täuschend echten Kanadiernachweis erbracht. Da er sich vor ein paar Wochen auf dem Fischmarkt beim Segnen des Zeitlichen die Hakennase ausgekugelt hat, gilt aber sein Zeugnis vor höherer Instanz als inkohärent.
Sei’s drum. Immerhin ist meine Tante als Erbschnitte kein billiges Flittchen. Gerade vor vier Tagen hat sie mir ihren Kühlpark gezeigt, der es mit jeder besseren Gefrierschleuder im Handumdrehen aufnehmen könnte. Aber wer will das denn wissen? Ich jedenfalls bin voll und ganz zufrieden, wenn ich etwas von dem frischgemolkenen Käsekonfekt abstauben kann, den Äffi unter ihrem blaustichigen Busen birgt.
Äffi war der Hauptname meiner Tante, bevor sie diesen sturztrunkenen Philatelisten ehelichte, den sie auf der Schiffschaukel im Bunapark kennengelernt hatte. Seither schimpft sie sich Girondell und tut so, als wäre sie klar. Dabei strauchelt sie beim Kreuzworten nach wie vor, wenn nach einem Tranquilizer mit siebzehn Buchstaben gefragt wird. Ich aber tausche meinen Monaco-Vierer bei meinem Nennonkel gegen einen Wimpel für mein Dreirad.
Damit fahre ich die Bunaallee hinunter, dass der Auguststaub nur so gegen die Schaufensterscheiben der Heißmangeleien und Hautabziehereien wabert. Eine Freude ist das, weil mir so der scharfe Blick auf die drinnen stattfindenden Blutbäder und Hitzschläge erspart bleibt. Ich träume nämlich ungern unschön! „Nicht so presto, Idioto!“ Das schreit mir der Nennonkel nach und setzt sich augenblicklich wieder die Kodeinpulle an den Hals.
Wenn ich in die Schule komme, werde ich meine Tante verpetzen. Ich werde dem Fräulein erzählen, dass ich beobachtet hab, wie sie mit ihrer rechten Hand geradewegs über meiner linken Schulter usw. Auch die Geschichte mit dem kleinen Naduweißtschon kriegt das Fräulein von mir zu hören, als mir nichts andres übrig blieb, als kurzerhand, ähemm! Dann kommt der Schulpedell bestimmt in Tantchens Gelass und sorgt für Morgenrot. Oder?
[Aus den Märchenbüchern, Bd. IV. – Mai 1986.]
Kopfnote [2]
Monday, 09. May 2011Vor gut zwei Jahren schrieb ich hier und da mal über den armen US-amerikanischen Romancier Philip Roth, der wenig Glück mit den Frauen hat, unter Schreibzwang leidet, dem der Nobelpreis für Literatur verweigert wird und der zu allem Überfluss auch noch von Interviewern heimgesucht wird, die er bei all dem dann doch nicht verdient. – Dieser Tage musste ich leider feststellen, dass sich Roths traurige Lage in keiner Hinsicht gebessert hat.
Diesmal ist Willi Winkler von der SZ aufgebrochen, dem 78-Jährigen in seiner New Yorker Stadtwohnung auf den Pelz zu rücken. Womit? Mit Fragen? Schon im Untertitel zu Winklers Artikel lese ich, dass Philip Roth Interviews hasse. Warum gibt er sie dann? Müsste er verhungern, wenn er konsequent absagte, wie etwa zu Lebzeiten Salinger, oder heute noch Pynchon? Und warum bedrängt ihn der Journalist mit der Bitte um ein Interview, wenn der Gesprächspartner sich doch selbst alle Fragen längst schon gestellt und in seinen mehr als zwei Dutzend Büchern beantwortet hat. Winkler gesteht gleich eingangs, schon zweimal vergeblich versucht zu haben, Roth zum Interview zu treffen, 2002 und 2009. Aber er ließ nicht locker – und nun hat er ’s endlich geschafft. (Kann es sein, dass manche Zeitungsschreiber prominente Interview-Partner sammeln wie noch unbedarftere Leute Autogramme?)
Zwar können uns Lesern die Motive ja piepegal sein, aus denen ein solcher Interviewer um den halben Erdball fliegt, um einen berühmten Autor zu befragen, der nicht befragt zu werden wünscht – wenn, ja wenn dabei ein interessanter Artikel herauskommt, mit sonst nirgends zuvor veröffentlichten Einsichten in die Motive, Arbeitsmethoden oder Stimmungen der befragten Person. Das ist nun aber im hier zu beklagenden Hohltöner aus Winklers Feder mitnichten der Fall. Damit er diese Seite drei überhaupt voll bekommt, muss er langatmig und -weilig berichten, warum er sich verspätet hat zu diesem so lang ersehnten Gespräch. Dann gibt es eine lieblose Nacherzählung von Roths Ehetragödie mit Claire Bloom und ein paar knappe Bemerkungen zu einigen seiner bekannteren Romane. (Vielleicht sind es jene, die Winkler gelesen hat?) Zweimal klingelt das Telefon. Wieder erfahren wir etwas über die gesundheitlichen Probleme des Autors. Und die wenigen Auskünfte, die er über sein Leben, Denken und Schreiben gibt, sind dermaßen zusammenhanglos und beliebig hingetupft, dass man sich wirklich verarscht fühlen muss, ob man nun Roth-Fan ist oder nicht. (Willi Winkler: Lebenslänglich; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 94 v. 23./24./25. April 2011, S. 3.)
Ich habe Philip Roth zeitweise durchaus gern gelesen. Zur Entspannung war er in einer nun aber auch schon lange zurückliegenden Lebensphase für mich tauglich. Dass Willi Winkler uns nun aber nahelegen will, er sei der einzige für den Nobelpreis in Frage kommende Autor unserer Tage, das halte ich doch für einen schlechten Scherz. Nicht, dass Roth ihn nicht bekommen könnte. Das Stockholmer Komitee hat schließlich schon ganz andere Fehlentscheidungen getroffen. Aber was Winkler hier fabuliert, ist wegen seiner Albernheit einmal wörtlich zitierenswert. Roth, so Winkler, sei ein Schriftsteller, „der jedes Jahr, wenn der Sommer zu Ende geht und die Nobelpreisverleihung näher rückt, als bester, als idealer, als einzig möglicher Kandidat genannt wird. Aber weil das Nobelpreiskomitee hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen wohnt, wird es dann wieder nur Elfriede Jelinek. Oder Herta Müller. Oder, wirklich très chic: Le Clézio.“
Man mag dem Komitee ja manches vorwerfen, mag möglicherweise auch alle drei zuletzt genannten Personen der höchsten Literaturauszeichnung der Welt für unwürdig halten. Aber ein Vorwurf trifft die Mitglieder des Komitees nicht: dass sie in den vergangenen Jahrzehnten bei ihren Entscheidungen darauf geschielt hätten, was alle Welt den „den besten, idealen, gar einzig möglichen Kandidaten“ nennt. Wo, bitte schön, gibt es ein solches Votum? Und kann es einen solchen Kandidaten auf unserem globalisierten Globus auch nur theoretisch noch geben? Wer sind die Leute, die laut Winkler als einen solchen Kandidaten Jahr für Jahr den US-Amerikaner Philip Roth benennen? Und zwar übereinstimmend in China, Indien, den USA, Indonesien, Brasilien, Pakistan, Bangladesch, Nigeria, Russland und Japan gleichermaßen, um nur die zehn bevölkerungsreichsten Länder der Erde zu nennen? Quatsch! Und übrigens ist doch vermutlich das Warten auf den Preis das einzige Motiv, das den Autor Philip Roth noch bei der Stange hält und zum Schreiben motiviert. Warum sollte man ihm dann den Nobelpreis verleihen? Damit er anschließend verstummt, weil die Luft endgültig raus ist? Nein, es ist schon in Ordnung, diese Auszeichnung an Autoren zu geben, von denen man hoffen darf, dass Preis samt Preisgeld ihnen und ihrem Werk noch nützlich sein kann.