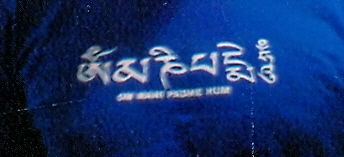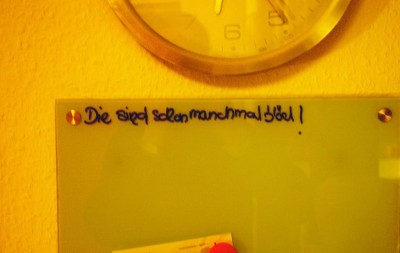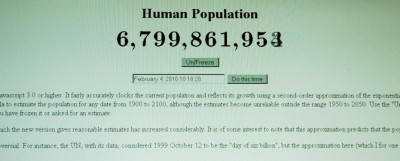Seit ich die produktive Zeit meiner Tage ganz überwiegend mit dem Verfassen von Texten verbringe, seit knapp drei Jahren also hat sich bei mir ein neuer Traumtyp eingestellt.
Diese Textträume, wie ich sie nennen will, suchen mich in unregelmäßigen Abständen heim, und zwar immer in den Morgenstunden an der Grenze zum Erwachen. Ich bin mir sogar bewusst, dass ich träume, beschließe aber, den Traum noch nicht durch vollständiges Hinüberwechseln in den Wachzustand zu beenden, weil ich gern wissen möchte, wie er ausgeht, wenn ich ihn sich selbst überlasse. Darin verbirgt sich allerdings ein Widerspruch, denn gleichzeitig bin ich mir dessen bewusst, dass ich selbst es bin, oder besser: dass es etwas in mir selbst ist, dass den Traum in allen Einzelheiten verfertigt.
Dies mag schon befremdlich genug klingen. Was mich aber wirklich immer wieder erstaunt und anfangs sogar beunruhigt hat, ist etwas anderes. In diesen Träumen spielt die Sprache – die ausformulierte Sprache in wörtlicher Rede, in gelesenen Texten, aus dem Radio oder in Büchern – die entscheidende Rolle. Und die sprachlichen Äußerungen, mit denen ich in diesen Textträumen konfrontiert bin, richtiger: mit denen ich mich selbst konfrontiere, ohne mir einer schöpferischen Leistung bewusst zu werden, sind so wohlgesetzt, teils syntaktisch erstaunlich kompliziert und doch fehlerfrei gebaut, dass ich den Zweifel nicht ganz abweisen kann, ob sie wirklich von mir allein stammen. Hinzu kommt, dass ich, ihr Träumer, von ihrem eigentlichen Inhalt oft genug selbst überrascht bin.
Der jüngste Texttraum liegt unmittelbar zurück und ich habe ihn noch in sehr frischer Erinnerung. Als gutes Beispiel will ich ihn hier möglichst genau wiedergeben. Ich befinde mich mit einem etwa 30jährigen, blonden, gut aussehenden Mann im Halbdunkel eines kleinen Häuschens, von dem ich annehme, dass es auf dem Lande gelegen ist. Ich erinnere mich, dass er irgendwann den geografischen Namen Västerbotten erwähnt, weshalb ich ihn für einen Skandinavier halte und vermute, dass wir uns in Schweden befinden. Es ist Winter, durch ein beschlagenes Fenster hinter dem Mann ist eine Schneelandschaft zu erahnen. Ich habe das Gefühl, dass noch weitere Personen sich mit uns in diesem schwach beleuchteten, aber gemütlichen Zimmer befinden, die eher zu mir gehören. Die Art, wie der Mann spricht, lässt darauf schließen, dass er uns auf eine Frage antwortet. Vielleicht sind wir Reporter, die ihn interviewen? Vielleicht sind wir aber auch neue Freunde, denen er bedeutsame Episoden aus seinem Leben erzählt, damit wir ihn besser kennenlernen. Der Mann spricht in kurzen, klaren Sätzen, nicht laut, nicht leise, nicht tonlos, aber auch nicht dramatisierend. Vielleicht könnte man seinen Tonfall am ehesten als beherrscht bezeichnen, und zwar durchaus in dem Sinne, dass er seine Stimme mit Macht beherrschen muss, weil sie sonst ausbrechen könnte. Von Anfang an habe ich, während ich ihm zuhöre, das Gefühl, dass das, was er uns erzählt, auf etwas Ungutes hinauslaufen wird. Und ich bin ganz sicher, dass ich ihn unter keinen Umständen unterbrechen darf. Dies erzeugt in mir ein deutliches, aber nicht unerträgliches Gefühl von Ausgeliefertsein. Vermutlich ist es die Neugier, die ich gleichzeitig empfinde, die mir die Lage des stummen Zuhörers dennoch halbwegs erträglich macht. Zugleich weiß ich ja, siehe oben, dass ich dies nur träume. „Nein,“ sagt der blonde Mann, „ich bin nicht gern in diesem Haus. Es ist nicht etwa deshalb, weil an dem Haus selbst etwas zu beanstanden wäre. Es ist günstig gelegen. Es hat für einen bescheidenen Menschen wie mich genug Komfort. Und dennoch kehre ich nur hierher zurück, wenn es nicht vermeidbar ist. Die Heizung hat ihre Mucken, gewiss. Auch das Regenrohr verstopft im Herbst, und das Wasser pläddert anschließend gegen die Fenster, was ganz schön an die Nerven gehen kann. Aber damit lässt sich ja schließlich leben. Es hat einen anderen Grund, warum ich dieses Haus meiner Kindheit meide. Es sind die Erinnerungen, die dann wach werden. Sie stecken in jedem Winkel, kriechen aus jeder Ritze. Jedes Astloch raunt mir diese alten Geschichten ins Ohr.“ (Ich muss hier kurz unterbrechen, um meine Begeisterung für dieses Sprachbild zum Ausdruck zu bringen. Darauf wäre ich im Wachzustand kaum gekommen. Übrigens fiel im Traum an dieser Stelle seiner Ausführungen mein Blick tatsächlich auf ein Astloch in der Tischplatte vor mir, zwischen uns, und es schien mir, dass es die Form und Färbung eines zum O geformten Mundes hatte.) „Meine Mutter arbeitete in der Stadt. Und im Winter waren mein Vater und mein Onkel daheim und hatten nichts zu tun. Deswegen ertrage ich es nur mit Mühe und nur für kurze Zeit, mich in diesem Haus aufzuhalten. Ich bereue jetzt wieder, mich auf den Vorschlag eingelassen zu haben, hierher zu kommen. Es ist ja so, dass mein Onkel mit mir hier Dinge getan hat, die mir nicht gefielen. Und es ist so, dass diese Dinge mir immer unerträglicher wurden. Ich ertrug es schließlich nicht mehr und bin, obwohl ich mich so sehr schämte, zu meinem Vater gegangen. Aber mein Vater hat mich nicht vor seinem älteren Bruder in Schutz genommen. Das ist der Grund. Das ist alles. – Gehen wir!“
Ich beschließe, dass der Texttraum damit beendet ist, knipse ihn geradezu aus wie einen Film im Fernsehen und bin augenblicklich hellwach. Ich erzähle ihn meiner Gefährtin, damit ich ihn besser im Kopf behalte. Zweierlei fiel mir zu diesem speziellen Fall spontan ein, was als Quelle oder Material gedient haben könnte. Einmal die Autobiographie von Per Olof Enquist, die ich im Juni vorigen Jahres gelesen habe. Enquist stammt aus Västerbotton und hat in Ein anderes Leben ausführlich über seine problematische Kindheit gesprochen und über das Verhältnis zu seinem früh verstorbenen Vater. (Dass mein sehr starker Eindruck von diesem Buch hier keinen Wiederhall gefunden hat, ist einzig mit meiner umzugsbedingten Zwangspause beim Bloggen zu erklären.) Zweitens der Film Das Fest des Dänen Thomas Vinterberg, den ich 2005 gesehen habe und in dem es um Kindesmissbrauch durch den Vater geht. – Ich verspüre ansonsten nicht das Bedürfnis, meine Textträume zu interpretieren, zu deuten. Das erschiene mir fast wie die Beschädigung von etwas sehr Zartem, Verletzlichem, als wollte man einer Blüte die einzelnen Blätter ausrupfen.