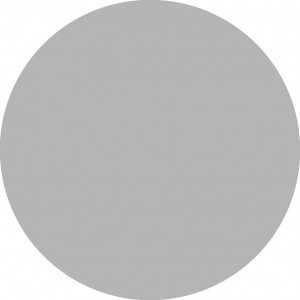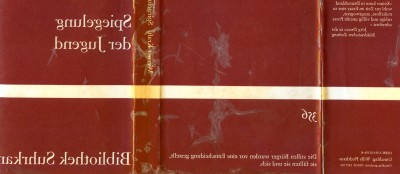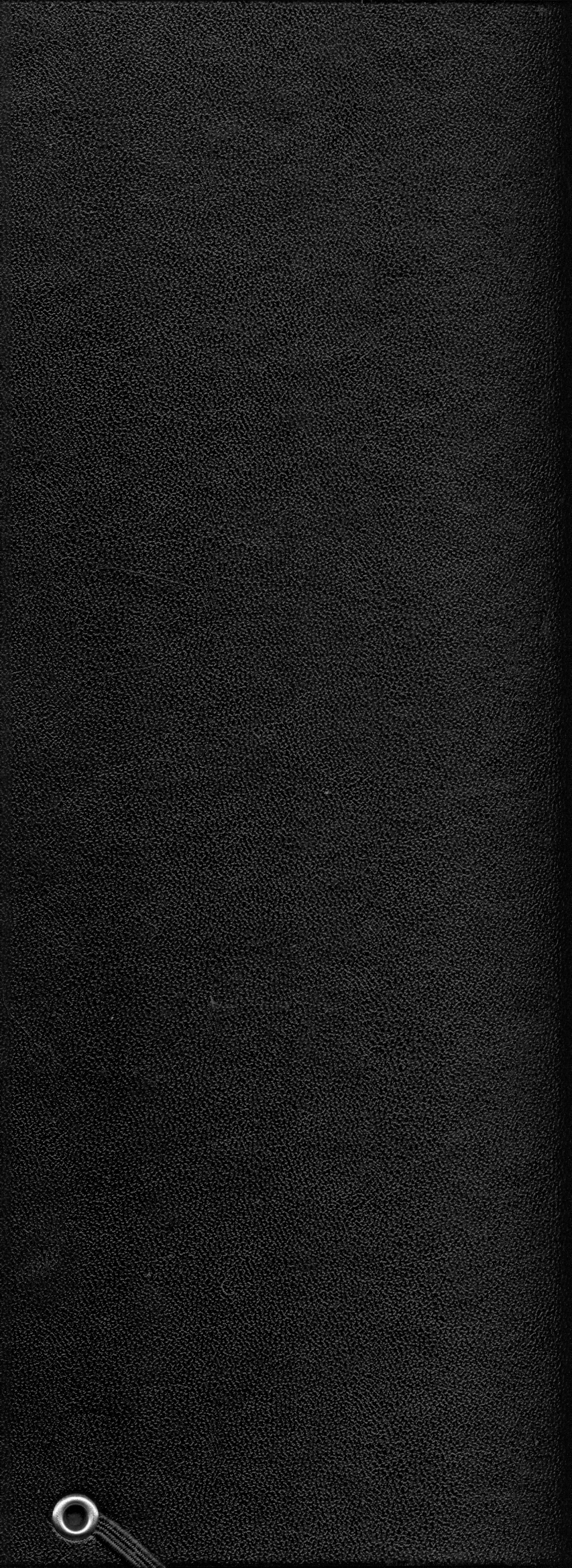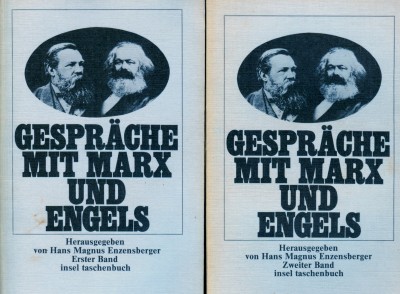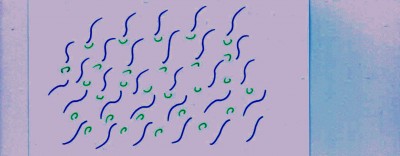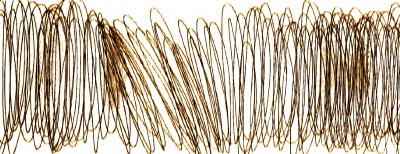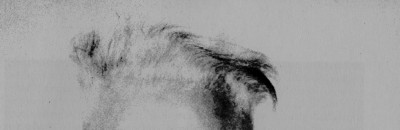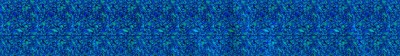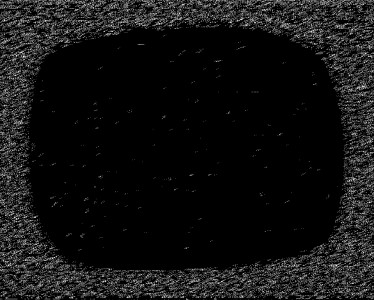* 11. Juli 1956 in Essen; † 8. April 2012 in Essen. Ohne ihn sind Ursula, Jacinta, Vincent, Valentin, Tristan, Daphnis, Lola, Christoph, Milan, Veronica, Carla, Gerda, Jacqueline, Liana.
Manuel ist nicht mehr
Wednesday, 11. April 2012Alles gerät in Schieflage
Monday, 05. March 2012Auch Herrndorfs work in progress zieht mich in letzter Zeit nur noch runter. Seine schubweisen Publikationen lassen nach meinem Gefühl immer länger auf sich warten und werden zugleich immer dünner, quantitativ und leider auch qualitativ. Ich hoffe, dass der Blogger H. das nicht liest. Sollte er sich dennoch hierher verirren, dann möchte ich ihm sagen, dass diese Anmerkung nicht als Kritik gemeint ist. Man kann nicht jemandes literarische Produktion unbefangen kritisieren, der in einer solchen Verfassung lebt. Dass es gegen Sand, diesen mindestens problematischen Roman, bisher keine ernst zu nehmenden Verrisse gab, ist schon verdächtig. Am Sonntag vor acht Tagen hörte ich nun eine geradezu hymnische Besprechung seines letzten Romans von Simone Hamm bei wdr3, die alle vorangegangenen an Lob weit übertrifft. Dass Hamm dabei, vielleicht als einzige unter ihren Kolleginnen und Kollegen, den gesundheitlichen Zustand des Autors nicht erwähnt, verstärkt bei mir noch den Eindruck, dass ihre Hymne zuvörderst mit Berechnung auf Wolfgang Herrndorf als Zuhörer geschrieben und gesprochen ist, erst in zweiter Linie für uns Radiohörer. Schlimm auch, dass er die Missverständnisse der Kritiker in einer Art ,Hitliste der Ignoranz‘ erfasst: „Michalzik entreißt Hünniger die Krone, Willmann nur noch unter ferner liefen.“ Als wollte er sich darüber beschweren, dass Leser nicht mit dem Notizblock neben dem Buch alle Namen, Orte und Ereignisse in Listen erfassen, um für alle losen Fäden die zugehörige Verknüpfung zu registrieren. Träumt der Autor etwa davon, dass ihm zu Ehren posthum ein Wolfgang-Herrndorf-Dechiffriersyndikat aus der Taufe gehoben wird? Das klingt makaber, ich weiß. Insofern müsste es Herrndorf ja eigentlich gefallen. Oder er legt mich in sein Säurebad Arbeit und Struktur. Was könnte ich dagegen sagen? Niemand kann ihm schließlich irgendwas ernsthaft verübeln. Das muss schrecklich sein, ein Schrecken mehr zu all den Schrecken.
Lockere Sprüche
Monday, 05. March 2012,Zitat des Tages‘ neulich beim Perlentaucher ein Ausspruch des um flotte Sprüche bekanntlich nie verlegenen Oscar Wilde: „Jeder Erfolg, den man erzielt, schafft einen Feind. Man muss mittelmäßig sein, wenn man beliebt sein will.“ Danach kann sich jeder mittelmäßige Schnösel, der sich wie auch immer ein paar Feinde gemacht hat, in die Brust werfen und sich im Lichte seiner vermeintlichen Außergewöhnlichkeit sonnen. Ich will nicht in Abrede stellen, dass bei öffentlich wirksamen Personen der beschriebene Effekt eintreten kann, wenn beispielsweise ein politischer oder künstlerischer Erfolg dazu geeignet ist, Missgunst bei den Konkurrenten zu wecken. Das ist aber doch ein spezieller Fall, der mitnichten diesen generalisierenden Auftakt rechtfertigt („Jeder Erfolg, den man erzielt …“). Während Wilde sich lebenslänglich mit dem Thema sowohl theoretisch als auch praktisch beschäftigte und dabei noch allerlei weiteres aphoristisches Kleingeld unter die Leute brachte, ist der Große Meister der Gattung in seinen Sudelbüchern nur ein einziges Mal wortwörtlich auf den Erfolg zu sprechen gekommen, und da spricht er nicht einmal von dem Erfolg als öffentliche Anerkennung, sondern meint Erfolg als Gelingen (wissenschaftlicher Bemühungen): „Es gibt kein größeres Hindernis des Fortgangs in den Wissenschaften, als das Verlangen, den Erfolg davon zu früh verspüren zu wollen. Dieses ist munteren Charakteren sehr eigen; darum leisten sie auch selten viel; den sie lassen nach und werden niedergeschlagen, sobald sie merken, daß sie nicht fortrücken. Sie würden aber fortgerückt sein, wenn sie geringe Kraft mit vieler Zeit gebraucht hätten.“ (Aph. K 178; zit. nach Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und Briefe. Zweiter Band. München: Carl Hanser, 1971, S. 431.) – Es könnte eine dankbare Aufgabe für einen Possenschreiber sein, wollte er Lichtenberg und Wilde als Paar, wie es sich gegensätzlicher nicht denken lässt, auf die Bühne bringen. Nur diese beiden, aus einem Abstand von hundert Jahren in ein gemeinsames Jetzt geworfen! Sie träten jeweils durch zwei gegenüberliegende Türen auf, kämen aus ihren jeweiligen Welten von 1794 bzw. 1894, der geduldige Forscher Lichtenberg aus seinem Göttinger Gartenhaus an der Weender Chaussee, der muntere Charakter Wilde aus seiner Londoner Stadtwohnung, 16 Tite Street. (Was für Dialoge wären daraus zu entwickeln.)
Altersvorsorge
Saturday, 03. March 2012Swift, den viele als Autor seines Gulliver kennen und den ich verehre wegen seines Modest Proposal, jener Jonathan Swift hat lange Zeit vor dem Erscheinen der genannten Meisterwerke, im zarten Alter von 32 Jahren eine Liste von Verhaltensweisen aufgestellt, die er unbedingt vermeiden wollte, wenn er einmal alt würde. (Ich verdanke den Hinweis auf diese Liste Shaun Usher, der sie vorgestern in seinen Lists of Note veröffentlichte.) Swift erweist sich schon hier als großer Menschenbeobachter und -kenner, indem er diesmal die Schwächen des Greisenalters aufs Korn nimmt. Unbestechlich und mit erbarmungsloser Härte nennt er sie beim Namen, all die Verschrobenheiten, Nachlässigkeiten und Albernheiten, die den Menschen auf abschüssigem Weg daran hindern, seine wirkliche Lage anzuerkennen und sich damit auszusöhnen, dass er längst nicht mehr auf der Höhe ist. Der junge Swift gelobt sich also, dass er dereinst nicht lüstern sein und keine junge Frau heiraten will, um sich eigene Jugendlichkeit und Attraktivität vorzuspielen; dass er nicht griesgrämig oder mürrisch oder misstrauisch sein will; dass er nicht ein und dieselbe Geschichte den gleichen Leuten wieder und wieder auftischen will; dass er seine Nächsten nicht mit unerbetenen Ratschlägen belästigen und sich nicht abfällig über moderne Bräuche, Moden oder Ansichten äußern will; dass er jungen Leuten gegenüber tolerant sein und ihre Scherze und Schwächen ertragen will; und dass er sein Ohr vor dem Gewäsch tratschender Dienstboden ebenso verschließen will wie vor den Schmeichelein junger Frauen. Aber er geht noch einen Schritt weiter, denn offenbar hat er sich gefragt, warum denn all die Alten, die er beobachtet und bei denen er die aufgelisteten Mängel festgestellt hat, diesen Mängeln in so großer Zahl zum Opfer fallen. Offenbar sind sie blind geworden für ihre eigenen Verfehlungen. Also baut er noch eine Zusatzregel in seine Liste ein, die da lautet: “To desire some good Friends to inform me w[h]ich of these Resolutions I break, or neglect, and wherein; and reform accordingly.” Und Swift wäre nicht Swift, der große Ironiker und Humanist, würde er nicht seinen strengen Moralkatalog mit der letzten Regel wieder auf menschliches Maß zurückstutzen: “Not to sett up for observing all these Rules; for fear I should observe none.” – Ganz groß!
Lexikon der SciFi-Plots
Sunday, 26. February 2012Immer mal wieder fällt mir eine kleine Verzerrung der Wirklichkeit ein, aus deren konsequenter Weiterverfolgung sich eine wunderschöne Science-Fiction-Story entfalten ließe. Aber bevor ich noch ernsthaft darüber nachdenke, lähmt mich die Überzeugung, dass längst andere auf solch einen doch ganz naheliegenden Anlass für eine surreale Geschichte gekommen sein müssen und es sich insofern kaum lohnen dürfte, die Idee weiterzuverfolgen. Dagegen könnte man einwenden, dass es ja vielleicht auch auf die Umsetzung ankommt. Ein guter Plot im Kopf macht schließlich noch kein literarisches Meisterwerk auf dem Papier! Aber mich schreckt eben gleich von vornherein der Gedanke ab, dass ich viel Zeit in die Niederschrift einer solchen Story investieren könnte, um mir dann vom erstbesten Lektor in einem auf dieses Genre spezialisierten Verlag sagen lassen zu müssen, genau dieses Thema habe doch, beispielsweise, „der SciFi-Klassiker Theodore Sturgeon auf schwer erreichbare, sicher aber unübertreffliche Weise in einer großartigen Erzählung aus dem Jahr 1951 in allen Tonarten durchdekliniert [!]. Lesen Sie das mal – und dann melden Sie sich wieder, wenn möglich mit frischeren Motiven! Anbei Ihr Manuskript zu unserer Entlastung zurück.“ Nein, das muss ich mir nicht antun. Bei dieser Gelegenheit wird mir aber bewusst, wie hilfreich ein wirklich nach Vollständigkeit strebendes Verzeichnis der Stoffe und Motive der Science-Fiction-Literatur aller Zeiten und Sprachen wäre. (Die wertvolle Pionierarbeit von Elisabeth Frenzel als Verfasserin zweier Nachschlagewerk zu Stoffen und Motiven der Weltliteratur wurde leider durch ihre politische Vergangenheit im Nationalsozialismus diskreditiert, was vielleicht sogar die Stoff- und Motivforschung in Deutschland lange Zeit ausgebremst hat.) Es müsste darin nicht nur das jeweilige Hauptthema eines Werks erfasst sein, sondern durchaus auch die bloß marginale Behandlung von Themen. Beispielsweise müsste ich unterm Stichwort „Tunnelbau“ nicht nur auf den Roman von Bernhard Kellermann verwiesen werden, sondern auch auf Erzählungen, in denen der Bau eines Tunnels vielleicht nur am Rande vorkommt. Und man müsste ein Regelwerk zur Bildung von mehrteiligen Lemmata finden, um auch komplexere Themen, die nicht in einem einzigen Stichwort ausgedrückt werden können, auffindbar zu machen. – Beispielsweise dachte ich heute darüber nach, wie es einem Menschen ergehen mag, der eines Tages nach dem Aufwachen feststellt, dass er wie unter einem Zwang immer die Wahrheit sagen muss; oder, um den Einfall in eine andere Richtung zu biegen, der plötztlich beobachtet, dass alle anderen zwanghaft die Wahrheit sagen, nur er selbst kann lügen, dass sich die Balken biegen. Welchen Gefahren ist der Mann im ersten Beispiel ausgesetzt? Und welche Chancen ergeben sich für ihn im zweiten? Gibt es nicht längst schon Geschichten, die sich aus diesen Ideen entwickeln? Und wenn es ein solches Verzeichnis gäbe, wie ich es mir wünsche: Unter welchen Suchbegriffen würde man dann Geschichten des beschriebenen Typs finden?
Yuppie!
Saturday, 25. February 2012Am vergangenen Dienstag starb im gesegneten Alter von 89 Jahren Barney Rosset, Gründer der legendären Grove Press in New York, ein unermüdlicher Kämpfer für das freie Wort und gegen die Zensur, Förderer von so bahnbrechenden Autoren wie Henry Miller, Samuel Beckett, William S. Burroughs, Jack Kerouac und Allen Ginsberg. Meist ging es vor Gericht um vermeintliche Pornographie, gelegentlich auch um Politik, wie im Fall der Autobiographie von Malcolm X. In einem Interview mit der Paris Review (No. 145, Winter 1997) hat Rosset erzählt, wie er durch Nancy Kurshan, eine Mitarbeiterin bei seiner Evergreen Review, die Yuppies Jerry Rubin und Abbie Hoffman kennenlernte – und was er von ihnen hielt: “They were the cream, the froth at the top of the wave, but I really never trusted them.” Immerhin publizierte Rosset trotz aller Vorbehalte Hoffmans legendäres Buch Steal This Book, eine Anleitung zum zivilen Ungehorsam und zu einem Leben ohne Geld. Barney Rosset war damals so drauf, dass er solch ein radikales Pamplet gegen den American way of life auf den Buchmarkt brachte, ohne auch nur eine einzige Zeile von dem Zeugs gelesen zu haben. Um das Buch für seine Grove Press anzunehmen reichte ihm als Argument schon, dass Random House es abgelehnt hatte! Allerdings musste er bald feststellen, dass das Buch aus Sicht eines Verlegers einen kleinen Schönheitsfehler hatte. Die Leser nahmen seinen Titel nämlich wortwörtlich. (Das erinnerte mich sofort an das berühmt-berüchtigte Klau mich der Berliner Kommune I, mit Fritz Teufel und Rainer Langhans als Gallionsfiguren, dem ein ähnliches Schicksal beschieden war. Sollten die Berliner Haschrebellen die Idee zu ihrem originellen Titel bei den Gesinnungsgenossen in den USA geklaut haben? Aber in diesem Falle kann der Ideendiebstahl allenfalls in umgekehrter Richtung gelaufen sein, denn Klau mich erschien bereits 1968 in der Edition Voltaire, während Steal This Book bei Pirate Editions erst 1971 herauskam.) Diesen kleinen Nachruf setze ich hierher als Reverenz an einen wahrhaft großherzigen Verleger, aber auch als aktuellen Hinweis auf ein vergessenes Relikt der Frühgeschichte von Widerstandsformen, die heute mindestens in den Industrienationen zum Alltag jeder Subversion gehören.
Heinrich Funke: Das Testament (XXVIII)
Friday, 24. February 2012Wir erkennen ihn an der Perspektive, in der der Aufgebahrte vor uns hingestreckt daliegt, endgültig aber an den Löchern in Händen und Füßen. Es ist der tote Jesus Christus nach der Kreuzabnahme und vor der Auferstehung. Die Bildunterschrift legt uns nahe, dass er nicht mehr (lebendig) und damit zum Finder geworden sei, während er vorher, als Seiender (Lebender) ein Sucher war. Fast war ich versucht, ein „nur“ hinzuzusetzen und damit eine Entwicklung hineinzudeuten, die aber nicht eindeutig ausgesagt wird. Dass ein Finder höher steht als ein Sucher, mag auf den ersten Blick plausibel sein, denn dem Suchenden mangelt es ja (noch) an etwas, eben am Gesuchten, während der Finder es hat – nämlich gefunden. Aus einer weniger naiven Sicht kann man aber auch diese Bewertung schon angreifen, denn der Finder hat mit dem Fund zugleich etwas verloren, und sei es den Antrieb zum Suchen, der vielleicht sein wesentlichster Lebenszweck ist. Das Bild zeigt einen Menschen, der kürzlich sein Leben verloren hat. Er ist aus seinem irdischen Sein gefallen, das neben andrem immer auch ein Suchen sein mag. Behauptet wird nun, dass im Tod, im Nichtsein ein Finden erreicht sei. Das ist eine insofern müßige Aussage, weil Behauptungen über Zustände (des Menschen, abgesehen von seiner rein leiblichen Existenz) im Nichtsein, im Tod prinzipiell weder beweisbar noch wiederlegbar sind. – Wenn ich mich dem Bild und den Worten nicht analytisch, sondern aus dem Gefühl heraus annähere, dann verspüre ich keinen Widerspruch. Leben und Tod, Sein und Nichtsein, Suchen und Finden … alles verschieden und alles eins und dasselbe. Könnte von den Vorsokratikern stammen. (Übrigens leuchtet mir nicht ein, warum es in der Bildunterschrift nicht richtiger heißt: Sein ein Suchen, Nichtsein ein Finden.)
Wie unten bereits gesagt?
Thursday, 23. February 2012Manchmal erscheint es mir so, als würde ich mich in diesem Weblog dauernd wiederholen, als hätte ich alle wesentlichen Fragen längst an- und ausgesprochen und würde sie seither nur wieder und wieder in immer neuer Verkleidung vor der Leserin Revue passieren lassen. Gerade eben habe ich zum Beispiel über meine frühe Freundschaft zu Pia Sch. geschrieben und dazu das süße Foto von uns beiden veröffentlicht, das uns auf ihrem Dreirad zeigt, im Sommer 1958. Ich könnte aber schwören, dass ich das Bild aus meinem Fotoalbum bereits in einem anderen Zusammenhang schon einmal publiziert habe. Aber nach Bildern kann man bekanntlich nur dann suchen, wenn man weiß, unter welchem Titel man sie veröffentlicht hat, und was das betrifft, bin ich nie einem stringenten Prinzip gefolgt und habe mir keine einheitliche Benennungsweise zu eigen gemacht. Mehr und mehr wird dieses Blog so zu einem undurchdringlichen Wirrwarr von Fährten ohne Ziel, zu einem Irrgarten, der bei aller vorgeblichen Strukturiertheit den Besucher an jeder Ecke und Weggabelung narrt und verhöhnt. Dieser Zustand spiegelt aber vermutlich meine innere Verfassung sehr gut wieder. Insofern tröste ich mich über das peinliche Gefühl eines Ungenügens und Unvermögens hinweg, indem ich mir sage, dass ich immerhin aufrichtig bin und nicht den schönen Schein einer Ordnung vortäusche, da doch in Wahrheit das reinste Chaos herrscht. Und übrigens kann ich mich auch über die vermeintlichen oder tatsächlichen Wiederholungen hinwegtrösten, denn dass ich einen Gedanken oder eine Vorstellung in zeitlichem Abstand von Monaten oder Jahren zweimal auf die identisch gleiche Weise niedergelegt habe, das ist doch äußerst unwahrscheinlich. Wenn jedoch aus den Wiederholungen gewisse Abweichungen herauslesbar sind, dann könnte ja auch dies zu einem vollständigeren Gesamtbild wenn nicht meiner Vollendung, so doch meiner Widersprüchlichkeit beitragen.
Jungen, Mädchen. Paar.
Thursday, 23. February 2012Bald fand er heraus, dass zwar auch Mädchen gemein sein konnten. Sie kreischten, kniffen und kratzten, wenn ihnen etwas nicht passte. Aber gegen die grobe Gewalt der Jungen war dies doch vergleichsweise leicht zu ertragen. Auch fiel ihm auf, dass Spielgefährten meist zugänglicher und harmloser waren, wenn er mit ihnen allein zu tun hatte. Kaum kam jedoch ein dritter, vierter hinzu, wurde die Lage schnell unübersichtlich für ihn und ängstigte ihn so sehr, dass er Reißaus nahm und zu seinen Eltern flüchtete. Nach einer Reihe solcher beunruhigenden Erlebnisse kam er zu dem Schluss, dass die zusätzlichen Freuden, die die Geselligkeit mit anderen Kindern bieten mochte, doch nicht die Sorgen und Ängste lohnte, die mit solchen Zusammentreffen schon im Voraus verbunden waren, ganz abgesehen von den tatsächlichen Gemütsaufwallungen, die ihn für lange Zeit begleiteten und quälten, wenn ein solches Treffen mit Grobianen und Kratzbürsten wieder einmal im Unfrieden geendet hatte. So war es ein wahres Geschenk des Himmels, als er sich mit P. anfreunden konnte, einem ein Jahr älteren Mädchen, das mit seinen Eltern in der gleichen Straße wohnte.
Draußen. Wiese, Sand.
Thursday, 23. February 2012Drinnen war die Welt und draußen herrschte das Chaos, eine beunruhigende Unübersichtlichkeit von vielerlei unbestimmten Dingen und haltlos vorbeirasenden Ereignissen, die ihn zutiefst aufwühlte, ja verstörte. Wenn er sich später prüfte, welche Wesenseigenschaften ihm angeboren sein mochten und nicht erst durch Vorbild und Erziehung antrainiert, dann war es neben anderen ein starkes Verlangen nach äußerer Ordnung. Dennoch konnte er für die Ewigkeit von Augenblicken in dieser so unaufgeräumten Außenwelt auch seine kleine Heimat finden und selige Ruhe, wenn er etwa auf einer Wiese saß und Gänseblümchen pflückte oder mit dem Spielzeugschüppchen den Sand ausgrub, voll neugieriger Erwartung, ob unter dem Sand denn wohl irgendwann einmal etwas anderes erscheinen würde als immer nur wieder Sand und noch mehr Sand. Ewigkeiten später, aber vermutlich noch im selben Sommer begriff er die Grundregeln der Statik und lernte die Technik, aus dem feuchten Sand unterer Schichten, gestern hatte es wohl stark geregnet, kleine Bauwerke zu errichten, Trutzburgen gegen einen erahnten Feind. Unvergessen, eigentlich unverziehen auf immer blieb ihm aber der Schreck, als ein sehr realer Gegner in Gestalt eines missgünstigen Rabauken auf den Plan trat, der sein liebevoll angelegtes Kastell mit ein paar brutalen Fußtritten zertrümmerte, um anschließend hohnlachend davonzuziehen. Hier blieb der sonst genussvoll ausgekostete Trost der Eltern wirkungslos. Das Urvertrauen darein, dass dem nichts Böses geschehen könne, der selbst nichts Böses tut, war auf immer beim Teufel.
Heikle Spur
Monday, 20. February 2012Ist eigentlich schon mal jemand auf den Gedanken gekommen, dass der Polizistenmord von Heilbronn vielleicht nicht ganz zufällig nur wenige Kilometer entfernt von Neckarsulm stattgefunden hat? Die Paulchen-Panther-Propagandafilme, die die Täter als Bekennervideos angefertigt haben, kokettieren ja mit beziehungsreichen Anspielungen auf die Taten, als wollten sie damit zeigen, wie sicher sie operieren konnten und wie wenig Sorgen sie sich machen zu müssen meinten, jemals gestellt zu werden. In diesem Zusammenhang könnte ich mir vorstellen, dass die Mörder aus dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) mit dem Tatort nahe dem namengebenden Standort der NSU Motorenwerke einen versteckten Hinweis geben wollten, sei es für ihre eingeweihten Gesinnungsgenossen, sei es für die Nachwelt, von der sie in ihrer Verblendung vermutlich hofften, einst in Mythen, Anekdoten und Schlachtenliedern gepriesen zu werden, wie einst der unselige Horst Wessel.
Leseliste für Entführungsopfer
Monday, 20. February 2012Am 25. März 1996 wurde der Arno-Schmidt-Förderer Jan Philipp Reemtsma, Erbe eines guten Anteils der nicht nur traditions-reichen Reemtsma Cigarettenfabrik, von dem Berufsverbrecher Thomas Drach uns seinen Gehilfen auf seinem Grundstück in Hamburg überwältigt und entführt. Erst nach zähen Verhandlungen und der Übergabe von 30 Millionen D-Mark Lösegeld kam Reemtsma nach 33 Tagen Gefangenschaft am 26. April 1996 wieder frei. Die Polizei war hierbei von der Familie des Entführten bewusst nicht einbezogen worden, auch die Medien wurden erst informiert, als alles vorbei war. So liefen die öffentlichen Fahnungsmaßnahmen nach den Tätern und dem Lösegeld erst Anfang Mai 1996 an. Dabei spielte auch eine Liste von Büchern eine Rolle, die die Kidnapper ihrem Opfer zur Ablenkung besorgt hatten. Im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel wurden die Sortimenter gebeten sich daran zu erinnern, ob sie die insgesamt 19 Titel, oder doch mindestens einige von ihnen, in der fraglichen Zeit an ein und denselben Kunden verkauft hätten. Im Anschluss an die Aufzählung der Bücher heißt es: „Am vielversprechendsten erscheint der Ermittlungsansatz bei Die Sammlungen des Prado, Hüben und Drüben und Peter Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft. Diese Bücher dürften nur in größeren Fachbuchhandlungen erhältlich sein.“ (Tipps erbeten: Reemtsmas Bücher; in: Börsenblatt Nr. 38 v. 10. Mai 1996, S. 4.) Wer hat sich wohl diesen vermeintlich erfolgsträchtigen Hinweis ausgedacht? Die Polizei wohl kaum! Polizeiliche Ermittler, die sich in ihrer Freizeit mit kulturphilosophischen Analysen beschäftigen, gibt es noch nicht einmal in schwedischen Kriminalromanen unserer Zeit. Es dürfte wohl der befreite Philologe und Sozialforscher Reemtsma selbst gewesen sein, der dies den Fahndern in die Feder diktierte. Dabei überschätzte er aber die Außergewöhnlichkeit seines Buchwunsches in diesem Fall vollkommen. Zum Zeitpunkt der Entführung war Sloterdijks Erfolgsbuch schon sein 13 Jahren auf dem Markt und erlebte gerade seine 13. Auflage. Es gehörte sich für jeden Möchtegern-Intellektuellen jener Zeit, es mindestens im Regal stehen zu haben. Selbst in Bahnhofsbuchhandlungen konnte man den beiden lilafarbenen Bänden aus der edition suhrkamp nicht entgehen. Ob solche Lektüre dem bedauernswerten Millionärssohn in seiner Haftzeit genützt hat? Vielleicht – und sei’s nur, weil er das Soldatensprichwort beherzigte, das dort auf S. 403 zitiert wird: „Lieber fünf Minuten feig als ein Leben lang tot.“ Über seine 33 traumatisierenden Tage in Drachs Gewalt hat Jan Philipp Reemtsma bekanntlich ein Buch geschrieben: Im Keller. Damit ist er sogar auf Lesereise gegangen. Allerdings hat er sich geweigert, es zu signieren. Man steckt nicht drin! [Den Hinweis auf den BöBla-Artikel und eine Kopie des Originaltextes verdanke ich meiner Freundin Annette Breithaupt.]
Noch ein paar Autotote
Monday, 20. February 2012Von der immer breiter werdenden Blutspur der Automobilisierung seit Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts habe ich hier immer wieder einmal die eine oder andere Probe aufgenommen, nicht ganz ohne Hintergedanken. Ich will in einer irgendwann zu komponierenden Zusammenschau solcher Zeugnisse nachvollziehbar machen, wie die Ungeheuerlichkeit dieses Mordens im Laufe der Zeit in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer Alltäglichkeit wird, die bloß noch im farblosen Spiegel der Statistik ihr Abbild findet. Gestern fand ich dieses erschütternde Beispiel in Kesslers Tagebuch: „Paris, 15. September 1927. Donnerstag – Die unglückliche Isadora Duncan ist gestern abend im Auto von ihrem eigenen Shawl, der sich in ein Hinterrad verwickelt hatte, erdrosselt worden. Ein tragisch-schicksalhafter Tod: der Shawl, der im Tanz ein so wesentlicher Teil ihrer Kunst war, hat ihr den Tod bereitet. Ihr Requisit und Sklave hat sich an ihr gerächt. Selten ist eine Künstlerin so tragisch umwittert gewesen und so aus ihrem eigensten Lebensschicksal heraus tragisch geendet: ihre beiden kleinen Kinder in einer Autokatastrophe umgekommen, ihr Mann, Jessenin, durch Selbstmord geendet, sie selbst jetzt in dieser Weise durch ihr eigenes Requisit, fast wie aus Rache, umgebracht.“ (Harry Graf Kessler: Tagebücher. 1918-1937. Hrsg. v. Wolfgang Pfeiffer-Belli. Frankfurt am Main: Insel-Verlag, 1961, S. 537.) Dieses Unglück trug sich in Nizza zu. Deirdre und Patrick, die beiden kleinen Kinder der Tänzerin, waren bereits 1913 durch eine Nachlässigkeit von Duncans Chauffeur ums Leben gekommen. Weil der Motor versagte, stieg er aus, um nach dem Rechten zu sehen, vergaß jedoch, die Handbremse anzuziehen. Das Automobil kam ins Rollen und stürzte in die Seine, die Kinder samt Kindermädchen ertranken.
Kurz vor Ladenschluss
Friday, 17. February 2012Der regelmäßige, gründliche Leser dieses Blogs wird sich in den letzten Tagen gewundert haben, warum ich von meiner Gewohnheit der vergangenen Monate abgewichen bin, alltäglich ohne Ausnahme einen kleinen Artikel zu veröffentlichen. Dieser Leser, so es ihn denn überhaupt noch gibt, hat sich vielleicht besorgt gefragt, ob etwa meine gesundheitliche Verfassung erneut einen Einbruch erlitten hat. Dem ist nicht so, wie ich zu seiner Beruhigung sagen kann, indem ich mich gleichzeitig für seine freundliche Anteilnahme bedanke. Diesmal liegen die Gründe für die Störung meiner Schaffenskraft eher auf dem Felde der wirtschaftlichen Grundversorgung. Mittlerweile wird es immer fragwürdiger, ob ich auf längere Sicht noch die Zeit und die Mittel für dieses einsame Abenteuer aufbringen kann – von der Kraft, die die Sorge um das Allernötigste verzehrt, ganz zu schweigen. Noch stelle ich nicht ab. Aber wenn sich nicht irgendwann ein Mäzen findet oder sonst eine günstige Wende eintritt, sind die Tage des Revierflaneurs im Internet wohl gezählt. (Bis zum 24. März 2012, an dem mein Weblog vier Jahre alt wird, halte ich aber mindestens noch durch, wenngleich voraussichtlich nur noch mit sporadischen Veröffentlichungen.)
Sonntag, 12. Februar 2012
Sunday, 12. February 2012Mit ziemlich besten Freunden in der Lichtburg, Deutschlands größtem Kinopalast, wie es in der Werbung wohl zutreffend heißt. Vorm Eingang zwei frierende Obdachlose, ein Mann und eine Frau um die Vierzig. Er sagt munter sein Sprüchlein auf: „Guten Abend! Hätten Sie wohl auch etwas übrig für uns Wohnungslose, bei der schrecklichen Kälte?“ Seit ich bei jedem Lebensmitteleinkauf die Ziffern hinterm Komma vergleichen muss, bin ich noch unwilliger als schon zuvor, mich auf diese Weise um mein Kleingeld erleichtern zu lassen, bloß damit ein armer Teufel für ein paar Stündchen seinen Alkoholpegel nachjustieren kann. Eine vorgestanzte Ausrede habe ich aber auch nicht parat, das überlasse ich meiner Tagesstimmung. Diesmal sage ich etwas wie „Och nö! Ich hab selbst kein Geld, fünf Kinder, tut mir leid.“ Gleichzeitig läuft vor der Kinokasse die Diskussion, ob wir uns Balkon leisten sollen oder mit Parkett Vorlieb nehmen. Unterdessen spricht mich nun die Frau mit einem ähnlichen Sprüchlein an, worauf ich nun etwas ungehalten reagiere, „Wie ich schon sagte …“ Dabei beginnt sich nun ganz gegen meinen Vorsatz in meinem Innersten ein kleines Schuldgefühl einzunisten, das aber ausgerechnet von dem Mann ohne Wohnung im Keim erstickt wird, indem er seine Bettelpartnerin anfährt: „Wie oft hab ich dir schon gesagt, du sollst die Leute nicht anquatschen, die ich schon gefragt hab! Pass doch gefälligst mal besser auf.“ Unser Film ist Ziemlich beste Freunde von Olivier Nakache und Eric Toledano, eine französische Komödie nahezu ohne den befürchteten Klamauk, mit einem pechschwarzen Omar Sy als charmantes Großmaul Driss und François Cluzet als Millionär im Rollstuhl. Ich amüsiere mich prächtig bis zu der Stelle, wo Driss eine kalte Nacht mit ein paar kiffenden Pennern im Freien zubringen muss. Der Vergleich zwischen Film und Realität stößt mich doch wieder auf meinen Generalvorbehalt: Selbst die wenigen mir erträglichen Filme, die es heute gerade noch in die großen Kinos schaffen, zeigen eine glasierte Scheinwelt, in der selbst die Penner gestylt wirken. Hätten wir im Parkett gesessen und wären die beiden lebensechten Wegelagerer nicht längst vor der Kälte geflohen, ich hätte die gesparten zwei Euro vielleicht doch noch gespendet.
Wintergarten
Saturday, 11. February 2012Zu Besuch bei Freunden in Düsseldorf. Manche Räume versetzen mich in einen Zustand wohliger Perplexität. (Ich weiß, dass das eigentlich eine unmögliche Begriffskonstruktion ist.) Bin ich drin, fühlt es sich an, als steckte ich in einer besseren Haut. Verlasse ich sie wieder, ist das Gefühl folglich wie eine Häutung. Ich streife ihre Atmosphäre ab und bin wieder der traurige Alte. Ernüchterung! Fast könnte man sagen: Es ist, als würde mir das Fell über die Ohren gezogen und ich stünde nackt und frierend in der grauen Landschaft. Aber das schösse übers Ziel hinaus, denn nur im ersten Augenblick der Verstoßung aus der Zimmeridylle erscheint mir die übrige Welt so. Die geschwinde Rückkehr in die Üblichkeit hindert, dass sich Schwermut festbeißen könnte.
Eulenbücher
Friday, 10. February 2012Marcus Jauer befasste sich neulich auf einer ganzen FAZ-Seite mit jenen belletristischen Büchern, die zwar millionenfach verkauft, aber von den Feuilletons üblicherweise keines Blickes gewürdigt werden. Dazu zählen heute Autorinnen wie Sabine Ebert aus Freiberg bei Dresden, die mit ihrer fünfbändigen Hebammen-Saga aus dem Hochmittelalter mittlerweile die Zwei-Millionen-Grenze überschritten hat – wohlgemerkt nicht beim Umsatz in Euro, sondern mit der Stückzahl abverkaufter Exemplare! Oder ein merkwürdiger Mensch namens Sebastian Fitzek, der mit extrem grausamen Krimis besonders bei Frauen einen eigentlich nicht glaubhaften Erfolg feiert. Da diese Art von Bestsellern sich den gängigen Kriterien der Literaturkritik entziehen, finden sie bei den seriösen Fachleuten keinerlei Resonanz. Daher hat sich neben jener äußerst produktiven literarischen Subkultur auch eine nicht minder fleißige Diskussionsgemeinde etabliert, natürlich im Internet. Im größten privaten Literaturforum deutscher Sprache, der Büchereule, tauschen Leser emsig ihre Meinungen aus. Ein Sonderfall in diesem trivialen Unfeld ist wohl die Autorin Bärbel Schmidt, die im Hauptberuf und unter ihrem bürgerlichen Namen als Verlagsvertreterin für DTV und Klett-Cotta unterwegs ist. Unter ihrem Pseudonym Dora Heldt erklimmt auch sie mit ihren Schmökern vordere Plätze in den Bestsellerlisten. Über Heldts bürgerliche Vergangenheit heißt es in dem FAZ-Artikel: „Bärbel Schmidt hat Anfang der achtziger Jahre Buchhändlerin gelernt, damals stand unter ,Frauenbuch‘ die feministische Literatur im Regal. Sie erinnert sich, wie sie sich gewehrt hat gegen Romane von Eva Heller, die sie heimlich gelesen hat, oder an die Scham, bei manchen Kundinnen schon am Eingang zu wissen, dass sie Nicht ohne meine Tochter von Betty Mahmoody kaufen würden.“ – Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen! Auch diese beiden Autorinnen gehören unbedingt in meine Trendbücher-Liste. Aber wann soll ich die Zeit finden, so etwas zu lesen? „Damals,“ so heißt es zum Schluss über Bärbel Schmidt, „hätte sie die Bücher, die sie jetzt schreibt, nicht ins Sortiment genommen. Aber das ist lange her.“ (Marcus Jauer: Die Bestseller; in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 240 v. 15. Oktober 2011, S. 44.)
Weicher Widerstand
Thursday, 09. February 2012Seine unschuldigen Spiele blieben ihm merkwürdigerweise immer dann in Erinnerung, wenn sie ein plötzliches Ende durch ein unverständliches Verbot der Großen fanden. Und immer war dieser Abbruch ebenso schmerzhaft, wie der Genuss des nun Verweigerten lustvoll gewesen war. So hatte er durch einen Zufall entdeckt, dass die Brüste seiner Mutter unter der Kleidung eine merkwürdige Art von Nachgiebigkeit zeigten, vergleichbar dem Gummiball seiner Kinderhupe. Wenn Mama ihn auf den Arm nahm, dann drückte er gegen einen Busen, der sich ein wenig eindellen ließ. Und wenn er sein Fäustchen zurückzog, dann stülpte sich die Delle sofort wieder aus. Dazu rief er laut, voll freudiger Begeisterung: „Tuut-tuut!“ Seine Eltern amüsierten sich hierüber zunächst über alle Maßen, und er selbst war auch überaus vergnügt bei diesem ausgelassenen Spiel. Schon sehr bald aber wurde Mama dessen überdrüssig und verweigerte ihm seinen Spaß, noch dazu ohne jede Begründung! Schmollend verkroch er sich hinter einem Sessel im Wohnzimmer und wollte nicht getröstet werden. Nie wieder machte er danach „Tuut-tuut!“ Dieser Spaß war ihm verleidet. Und noch mehr als darunter litt er an dem Geheimnis, das seine Eltern daraus machten, warum sie ihm etwas verbieten mussten, dass sie doch selbst bisher offenkundig genossen hatten. – Erst ganz viel später begriff er: dass es die Schaumgummieinlagen in den BHs jener Jahre waren, die den komischen Effekt bewirkten; und dass seine Eltern wohl befürchteten, prüde Erwachsene könnten als zufällige Zeugen dieses Spielchens dem naiven Jux des Kindes ein sexuelles Motiv unterstellen, das es in einem Knaben dieses Alters doch unbedingt zu unterbinden gälte. Peinliche Szenen und einer womöglich noch viel größeren Irritation ihres Söhnchens wollten sie vermutlich vorbeugen, indem sie dem Treiben selbst einen Riegel vorschoben.
Senkelverschleiß
Wednesday, 08. February 2012Eine kleine Fußnote zum Thema Geplante Obsoleszenz. Seit dem 13. Dezember vorigen Jahres laufe ich in neuen Schuhen herum, maßgeschneiderte schwarze orthopädische Lederschuhe mit hohem Schaft und fünf Paar mit schwarzen Metallösen verstärkten Schuhbandlöchern. Die schwarzen Schnürsenkel, die von meinem Schuhmacher mitgeliefert wurden, waren solche von Ringelspitz, schwarze Rundsenkel, 2,5 mm Durchmesser, 90 cm lang. Wie man im Bild oben sieht, verschleißen diese zu dünnen Bänder durch Abrieb in den obersten Ösen schnell. Schon nach knapp zwei Monaten täglicher Abnutzung ist der aus dem linken Schuh kurz vorm Zerreißen. Ich hatte für meine vorigen Schuhe die idealen Schuhbänder vom gleichen Hersteller nach langer Suche endlich gefunden. Es waren gewachste Rundsenkel von 4 mm Stärke. Die hielten ohne Probleme ein halbes Jahr und länger. Nun stellt sich leider heraus, dass die Ösen in den neuen Schuhen offenbar etwas kleiner sind, sodass die dickeren Bänder nur so gerade hindurchpassen. Zudem sind die beiden Ösenreihen wohl etwas weiter voneinander entfernt. Ideal wären deshalb Schuhbänder von einem Meter Länge. Nun hoffe ich, dass ich solche im Handel finde.
Gerade und ungerade
Tuesday, 07. February 2012In diesen Tagen brandet eine große Empörungswelle gegen das Urgestein des deutschen Qualitätsjournalismus, Wolf Schneider (86). Der hat die Frechheit besessen, auf seine alten Tage in sein Handbuch ein Kapitel über Online-Journaismus aufgenommen zu haben, das gelinde gesagt nicht die Zustimmung der Blogger findet. Mit einem ekligen Modewort ausgedrückt steht der graumelierte Grandseigneur seither in einem wahren shitstorm von Anwürfen und Beleidigungen, den er in der Würde seiner späten Tage selbst dann nicht verdient hätte, wenn sie allesamt berechtigt wären. – In diesem Zusammenhang stieß ich auf eine interessante Einlassung Schneiders zu der Frage, was denn im Wesentlichen Print- und Online-Journalismus unterscheide. Er sagte in einem Interview des Onlinebranchendienstes Meedia: „Solange wir nur vom Journalismus reden, sind die Unterschiede nicht groß. Womit ich gerade konfrontiert worden bin, ist ja gerade das Gegenteil von Journalismus: ,Mir fällt gerade was ein, und das finde ich unheimlich wichtig.‘ Das könnte eine Zeitung nicht bieten.“ – Und ich finde das gerade unheimlich zitierenswert, weil sich an dieser noblen Herablassung für mich mal wieder die grenzenlose Beschränktheit [!] von Leuten erweist, die zugleich Spezialisten, Profis und erfolgsverwöhnt sind. Damit meine ich den älteren Herrn Schneider ebensosehr wie seine kaum frischeren Kritiker. Wäre es unter vielen unwahrscheinlichen Umständen vielleicht doch möglich, dass es hier und da auf der Welt Leser gibt, die nicht nur an den gut recherchierten, leicht verständlich formulierten Darstellungen der alleraktuellsten Weltereignisse interessiert sind, hektisch vibrierend zwischen Marmeladenbrötchen und Kaffeetasse am Frühstückstisch, entziffernd, begreifend und vergessend im Sekundentakt? Schließlich ist doch der einzig erhabene, nämlich den ja tatsächlich unbezwinglichen Möglichkeiten des Web angemessene Nutzen der Bloggerei die Verbreitung von Blitz und Donnergrollen: in Form von Lyrik, Aphorismen, Bildern und kurzen Essays.
Hohe Decken
Monday, 06. February 2012Wenn ich mir meine verschiedenen Wohnsitze in Erinnerung rufe und dabei mein jeweiliges Körpergefühl nachzuempfinden versuche, dann fällt mir auf, dass insbesondere die Deckenhöhe einen ganz entscheidenden Einfluss auf mein Wohlbefinden, meine Stimmung und mein Selbstbewusstsein hatte. Das meine ich, auch wenn es anders klingen mag, durchaus wertfrei. In den niedrigen Behausungen fühlte ich mich wohl eher wie ein kuschelndes Nagetier oder ein lauerndes Reptil, während ich in den lichten und weiten Räumen dickwandiger Altbauten einherschritt wie ein stolzer Panther oder Pfau. Dieser oder jener Verkörperung den Vorzug zu geben wäre verfehlt, denn jedes Tier hat bekanntlich seine Stärken und Schwächen. Eben sehe ich im Briefwechsel von Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1978) Bilder der beiden Korrespondenten an ihren Schreibtischen. Schon Hofmannsthals mit Wandschmuck und Möbeln überladener grüner Salon in seinem Rodauner Schlössl wirkt zugleich imposant und bedrückend, der Dichter unterm hochdroben an der Stuckdecke baumelnden Kronleuchter (s. Titelbild), an einem großen runden Tisch sitzend und lesend, wirkt auf den ersten Blick eher wie ein leicht eingeschüchterten Pennäler, keinesfalls jedoch wie der dichtende Großbürger, als der er sich selbst gern darstellte und empfand. Erst recht macht die kathedralenartige Gewölbedecke im Arbeitsraum des Hôtel Biron in Paris aus dem traurig und verloren auf einem hohen Lehnstuhl hockenden Rilke ein armes Würstchen. Ich weiß nicht, wie mein hier trotzig hingeworfener Kleinkram aussähe, wenn ich unter solch hohen Decken schreiben müsste. So bin ich froh, zuletzt in einer handtuchschmalen Klause gestrandet zu sein!
Sonntag, 5. Februar 2012
Sunday, 05. February 2012Vielleicht ist das tauglichste Mittel gegen Melancholie, wenn einem zu ihrer Bekämpfung eine überragende Intelligenz ebensowenig zu Gebote steht wie ein fettes Girokonto oder ein unverwelkliches Erscheinungsbild à la Alain Delon in seinen besten Jahren; vielleicht ist das probateste Mittel gegen diese Gemütslage tatsächlich der lakonische Tonfall der Welt gegenüber, aber ebenso angesichts des eigenen Spiegelbilds; jener Tonfall, wie ihn uns Gertrude Stein so unnachahmlich vorgesprochen hat, etwa in Büchern wie The Autobiography of Alice B. Toklas (1933) und Everybody’s Autobiography (1937). Heute habe ich mit dem Lesen des letzteren begonnen und dabei abwechselnd einen trockenen Mund und feuchte Füße bekommen. Wie Frau Stein beginnt uns etwas zu erzählen um uns gerade in dem Moment da unser Interesse uns hinzureißen droht auf einen späteren Zeitpunkt zu vertrösten, und das in einer nicht eben vertrauenerweckenden Manier, das hat schon seine Art! Und wenn Andy Warhol meinte, er wäre ein Prophet, als er ankündigte, in Zukunft könne „jeder Mensch für 15 Minuten Berühmtheit erlangen“, dann hätte er mit dieser Vorhersagte um Jahrzehnte hinter Frau Stein hergehinkt, selbst wenn der Satz von Andy Warhol selbst gestammt hätte und nicht von Marshall McLuhan. Allerdings glaube ich, dass die freundliche Frau Stein und erst recht ihre nur äußerlich etwas bärbeißige Intima Frau Toklas es gar nicht so ungern sahen, wenn junge Burschen vom Schlage eines Andy Warhol hinter ihnen herhinkten. Und da ich wenn überhaupt auf etwas dann aufs Hinken spezialisiert bin, nämlich sowohl was meine körperliche als auch was meine geistige Fortbewegungsweise betrifft, stiefele ich nun also wie der Leibhaftige durch diese neue Lektüre und verspreche, den einen oder anderen riechenswerten Höllenfurz zu melden, der mir dabei vonseiten der beiden alten Schachteln unter die Nase schleicht. Vorausgesetzt, ich falle unterdessen nicht vom Stuhl.
Außer Manuel
Saturday, 04. February 2012Etliche Jahre hindurch habe ich unregelmäßig immer mal wieder Reime geschmiedet, häufig zu festlichen Anlässen, aber auch für Widmungen in verschenkten Büchern, zur Belustigung meiner Kinder und sogar zur humorvollen Bereicherung von Reden meiner Arbeitgeber. Immer geschah dies unter einem Pseudonym, womit es eine besondere Bewandtnis hat, welche ich aber vorläufig nicht preisgeben möchte: Conrad Döbling. Neulich las ich in der FAZ (Nr. 240 v. 15. Oktober 2011, S. 36) die freundliche Besprechung eines Kinderbuchs voller schadenfroher Reime nach einem Muster, das auch Döbling zu eigenen Versuchen angeregt hätte. (Martin Schmitz-Kuhl u. Anke Kuhl: Alle Kinder. Leipzig 2011.) Die lustig-makabren Zweizeiler lauten etwa so:
Alle Kinder laufen ins Haus. Außer Fritz –
den trifft der Blitz.
Alle Kinder freuen sich des Lebens. Außer Torben –
der ist gestorben
Alle Kinder stehen am Abgrund. Außer Peter –
der geht noch ’n Meter.
Lang, lang ist es her, dass wir als Kinder diese beißenden Zweizeiler tauschten. Und besonders groß war der Spaß, wenn wir einen leibhaftigen Fritz oder Peter mit „seinem“ Spruch necken konnten. Ich erinnere mich nicht, dass meine Spielgefährten auch auf meinen ja damals eher seltenen Vornamen einen „Alle-Kinder“-Spruch parat gehabt hätten. Aber den kann ja Conrad Döbling jetzt nachtragen:
Alle Kinder fliehen vor dem Löwen. Außer Manuel –
der ist halt nicht so schnell.
Sein erster Gesprächspartner
Friday, 03. February 2012Weil er in den ersten sieben Jahren seines Lebens ohne Geschwister war und besonders die Zeit vor dem Einschlafen, allein in seinem Bettchen in dem kleinen Kinderzimmer, ihm sein Alleinsein unangenehm werden ließ, begann er irgendwann mit sich selbst zu sprechen: zunächst nur still in seinem Kopf, dann auch leise vor sich hin flüsternd. Dieser Gewohnheit kam sehr entgegen, dass ihm gerade in dieser Zeit seine Großmutter von Vaters Seite eine kleine Puppe schenkte, die sie selbst aus einer großen hölzernen Garnrolle als Leib, etwas bunter Wolle als Kleid und Haarpracht und Watte als Füllstoff für den Kopf und die fünf biegsamen Extremitäten gebastelt hatte. Dieser lustige grüne Kerl war von Stund an allabendlich sein zutraulicher, treuer und verständnisvoller Gesprächspartner. Er führte lange Zwiesprache mit ihm, fragte seinen Troll – so der Name, den man ihm gegeben hatte – nach seiner Meinung, stritt gar mit ihm und vertrug sich wieder mit ihm. Später dachte er oft, wann immer ihm das urige Püppchen zufällig in die Hände fiel, dass mit ihm alles begonnen hatte, in vollkommener Einsamkeit mit sich selbst und in munterer Gesellschaft mit einer verkleideten Garnrolle: seine Freiheit, seine Phantasie, seine Sprechlust; und selbst seine kritische Urteilskraft – insofern nämlich der Troll ungehemmt seine Selbstzweifel zur Sprache brachte.
Motortode
Thursday, 02. February 2012Kann es sein, dass kreative Menschen häufiger durch Verkehrsunfälle zu Tode kommen als andere? Gerade in der letzten Zeit häufen sich in meiner Wahrnehmung wieder solche Fälle. Vielleicht ist es aber bloß so, dass generell der Tod auf der Straße oder hinterm Steuer öfter vorkommt, als man meint. Bei der Aufnahme meiner zum Verkauf bestimmten Bibliothek-Suhrkamp-Bändchen kommt mir Das Pesthaus unter die Finger, jener schwermütige Roman über Sterben und Tod in einem Sanatorium bei Palermo aus dem Jahr 1981. Am 14. Juni 1996 kam sein Autor, Gesualdo Bufalino, in der Nähe seines Heimatorts Comiso bei einem Autounfall ums Leben. (Es ist übrigens typisch, dass es mir jetzt nicht ohne Umstände gelingen will, die spezielle Art dieses Todes in Erfahrung zu bringen? Wurde Bufalino als Fußgänger zum Opfer eines Automobils – oder saß er selbst am Steuer und hat somit seinen Tod immerhin mitverschuldet? Das ist doch schließlich nicht vollkommen gleichgültig. Denn für mich ist das Automobil immer auch eine tödliche Waffe; und wer es bedient, wird damit jedenfalls leichter zum Mörder oder mindestens zum Totschläger, als jemand, der sich harmlos auf seinen eigenen zwei Beinen durch die Landschaft bewegt.) – Heute sah ich trotz der früher erwähnten Vorbehalte doch einmal wieder einen Spielfilm, Die Ewigkeit und ein Tag von Theodoros Angelopoulos. Er zeigt uns in heute unüblich gewordener Langsamkeit den letzten Tag des an Krebs erkrankten Schriftstellers Alexandros, dargestellt von Bruno Ganz. Es ist der Tag eines großen Abschieds, denn morgen soll Alexandros sich zum Sterben in eine Klinik begeben. Nachdem er bei seiner Tochter und deren unsäglich gefühllosem Mann keinen Schutz gefunden hat, klammert er sich an einen kleinen albanischen Jungen, den er vor Menschenhändlern in Sicherheit bringt, um ihm die Rückkehr in seine Heimat zu ermöglichen. Meist aber zeigt der Film Erinnerungsbilder des Sterbenden an die Menschen, die in seinem Leben wichtig für ihn waren und ihn doch irgendwann im Stich gelassen haben: seine Frau, seine Mutter, seine Freunde. Auch ein großer Hund spielt eine Rolle, als das einzige Lebewesen neben dem Jungen und einer treuen Haushälterin, für das es sich scheinbar gelohnt hat, zu lieben und zu sorgen. Sein letztes Werk, die Übersetzung eines großen Gedichtes, muss unvollendet bleiben. [Nachtrag: Zwei Tage später erfahre ich den Anlass, warum dieser Film von 1998 ins Programm genommen wurde. Am 24. Januar starb Angelopoulos in einem Krankenhaus in Neo Faliro bei Piräus an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Er hatte sich dort bei Dreharbeiten zu seinem Filmprojekt Das andere Meer befunden, als ihn ein Motorradfahrer erfasste.]
Sensibler Blogger
Wednesday, 01. February 2012Mir wird in letzter Zeit klarer als mir vielleicht lieb ist, dass ich bei dieser Art halböffentlichen Schreibens den Gedanken an konkrete Leser als Adressaten meiner Texte niemals ganz ausblenden kann. So entsteht beim Schreiben in meinem Bewusstsein oft ein verwirrendes Gespinst unberechenbarer Wechselwirkungen zwischen vermeintlichen Erwartungen und klammheimlichen Befürchtungen. Im persönlichen Dialog unter vier Augen kann ich meinen Diskurs ja auf mein individuelles Gegenüber abstellen und mich immerhin bemühen, Interessen, Ansichten und Empfindlichkeiten, Intelligenz und Bildung des Gesprächspartners bei allem was ich sage zu berücksichtigen. Im Web hingegen versetzt mich mein Bewusstsein vom freien Zutritt Vertrauter wie Fremder zu meinen tagesaktuellen Lebensäußerungen in eine irritierende Ambivalenz. So treffe ich im ,wirklichen Leben‘ gelegentlich engste Freunde, die sich persönlich zu einzelnen Blogbeiträgen äußern. Manchmal verblüffen sie mich mit Einzelheiten aus meinem realen Leben, von denen ich ihnen noch gar nicht berichtet hatte. Mir war schlicht entfallen, dass ich ja hier im Blog davon erzählt habe! Dann wieder lese ich ältere Artikel und stelle mir vor, wie diese oder jene neuere Bekanntschaft davon beeinflusst werden könnte, wie ich einmal war oder wie ich immerhin einmal zu sein meinte, als ich mich so darstellte. Ist es mir eigentlich recht, dass ich möglicherweise mit einer alten Larve meiner selbst identifiziert werde? Und schließlich stutze ich, wenn völlig fremde Leser unvermittelt ein Posting kommentieren, bei dessen Abfassung ich nur an eine sehr kleine, vertraute Zielgruppe dachte. Vermutlich stehen meine Skrupel, Irritationen und Überempfindlichkeiten in einem lächerlichen Widerspruch zu der conditio sine qua non beim Bloggen, sich preiszugeben. Somit gehöre ich vielleicht zur seltenen Spezies des sensiblen Bloggers, zur paradoxen Gattung eines „gschamigen Exhibitionisten“ im Cyberspace.
Gemeinheit schlechthin
Tuesday, 31. January 2012Noch einmal aus meiner Kraft-Lektüre. In einer Kurzbiographie hatte ich gelesen, dass er als Soldat in jenem Weltkrieg, der noch keine Nummer trug, zu schwach für den Fronteinsatz war und darum in der Nähe seiner Heimatstadt Hannover in den Wahrendorffschen Anstalten als Sanitäter diente. Das war ein „Lazarett für Kriegshysteriker und Kriegsneurotiker“, wobei die staatstragenden Psychiater sich nach Kräften bemühten, erstere von letzteren diagnostisch zu unterscheiden, um die Hysteriker zurück an die Front schicken zu können. In diesem Zusammenhang stolperte ich in Krafts Jugenderinnerungen über folgenden Passus, der die Atmosphäre in der Anstalt beschreiben soll: „[…] die Luft war kaum zu atmen vor Sexualität, auch Homosexualität und Gemeinheit schlechthin, übrigens nicht nur bei den Kranken, sondern auch bei den Krankenwärtern und bei den Krankenschwestern. Das Bild war das einer kranken Gesellschaft im Zustand des Lebenshungers und der moralischen Verwilderung, die als Kriegsnatur eher erwünscht als verboten war.“ (A. a. O, S. 57.) – Das steht da schlicht und schlimm, in einem Atemzug „Homosexualität und Gemeinheit“! Man meint ja, die Schicksalsgemeinschaft von Juden, Homosexuellen, Kommunisten, Zigeunern unter der Herrschaft des Faschismus, wo sie alle miteinander in den gleichen KZs und Vernichtungslagern zusammengepfercht waren, hätte wenigstens die Vorurteile untereinander endlich beseitigen müssen. Aber weit gefehlt!
Schnupperwetter
Monday, 30. January 2012Ein verbreitetes Kennzeichen des Genies ist, nach vielen kleinen Anekdoten in den Biographien genialer Menschen zu urteilen, die hartnäckige Hinterfragung von scheinbaren Selbstverständlichkeiten des alltäglichen Lebens. Die normalsterblichen Durchschnittsdenker geben sich damit zufrieden, dass etwas so ist wie es ist, weil es ja schließlich immer schon so war und weil es ihnen übrigens auch ganz egal ist, denn nichts würde sich scheinbar für sie ändern, wenn es anders wäre. In einer kleinen Serie will ich solche Beobachtungen unerklärlicher Phänomene hier beschreiben – nicht etwa, weil ich mich für ein Genie hielte, sondern allenfalls in der Hoffnung, dass das eine oder andere Genie unter meinen zukünftigen Lesern hierdurch vielleicht einen Gedankenanstoß erhalten könnte für eine geniale Entdeckung oder Erfindung. Heute teile ich meine Beobachtung mit, dass Lola bei Neuschnee wesentlich intensiver am Boden rumschnüffelt als gewöhnlich [s. Titelbild]. Dies erstaunt mich insofern, als ich doch immer davon ausgegangen bin, dass Kälte die Gerüche eher dämpft, in der Hitze des Sommers hingegen vielerlei zu faulen und zu stinken beginnt. Zudem hätte ich gedacht, dass die Schneedecke selbst, die ja schließlich aus nahezu geruchsfreiem Wasser besteht, etwaige Geruchsquellen abschließt und insofern für eine Hundenase eher unattraktiv ist. Doch tatsächlich scheint das genaue Gegenteil der Fall zu sein. Man komme mir nun nicht mit der Idee, Lola stupse ihre Nase bloß ins kalte Weiß, weil sie die Abkühlung so sehr schätze. Ich bin ganz nahe rangegangen und konnte eindeutig hören, dass sie schnuppert! – Nun bin sehr gespannt, ob in den nächsten Jahrzehnten irgendein Genie eine plausible Erklärung hierfür hat.
Sonntag, 29. Januar 2012
Sunday, 29. January 2012Gift oder Gas?
Saturday, 28. January 2012Ausmusterung der Reihe Bibliothek Suhrkamp fürs Antiquariat. Die fadengehefteten Pappbände im farbigen Umschlag mit andersfarbigem Strich erschienen seit 1951, brachten es bis 1989 auf tausend Nummern und erscheinen noch heute und sind jetzt bei Nummer 1469 angekommen. Die Umschlaggestaltung lag seit 1959 bei Willy Fleckhaus. (Erst jetzt fällt mir auf, dass der vertikale Strich stets schwarz oder weiß ist, einzig wenn der Umschalg weiß ist, das der Strich farbig sein.) Von den rund hundert Bänden in meiner Sammlung werde ich drei Viertel abgeben – und selbst den kleineren Rest muss ich noch einmal gründlich durchsehen. Ein Buch, in dem ich seit gestern abends immer ein paar Seiten lese, ist Werner Krafts Spiegelung der Jugend, eine Erstausgabe von 1973. Diese Erinnerungen habe ich nach der Anschaffung des Buches vor dreißig Jahren schon einmal angelesen, allerdings wohl nur etwa bis Seite 68, denn da befindet sich die letzte meiner akkuraten Bleistiftunterstreichungen. Ein Passus, den ich nicht unterstrich, erscheint mir heute bemerkenswert. Kraft porträtiert eine Schwester seiner Großmutter, die in Celle wohnte und einmal besucht wurde. Was mag aus der jüdischen Frau geworden sein? „Sie hat 1933 noch gelebt, und ich hoffe, daß sie energisch genug war, dem schrecklicheren Tode als dem schrecklichen durch Gift zuvorzukommen.“ (Werner Kraft: Spiegelung der Jugend. Frankfurt am Main. Suhrkamp Verlag, 1973, S. 33.) Was ist das für eine Welt, in der der Hoffnung nurmehr die Wahl zwischen einem schrecklichen und einem schrecklicheren Geschick bleibt und eine liebe Großtante spurlos aus einem freundlichen Häuschen in Celle ins Nichts wechselt?
Geplante Obsoleszenz
Friday, 27. January 2012Bei Arte+7 ist seit Dienstag eine kritische Dokumentation über die Verschwendungssucht in den hochentwickelten Industrienationen abrufbar, Kaufen für die Müllhalde. Der französische Film von Cosima Dannoritzer (2010) erzählt, wie die „geplante Obsoleszenz“, also die künstlich in der Produktherstellung angelegte verkürzte Haltbarkeit Mitte der 1920er Jahren zuerst von einem weltweiten Kartell namens Phöbus bei den Glühbirnen durchgesetzt wurde, um den Absatz anzukurbeln, damit die Wirtschaft zu stärken und so bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Auch Helmut Höge hat einen kleinen Auftritt, der mysteriöse Macher des von mir einst so geschätzten Magazins Neues Lotes Folum. Er war (unter dem Pseudonym Helke Schwan) Verfasser des legendären Aufsatzes The Glühbirnen Fake, den ich aus Jörg Schröders Mammut-Antholgie kannte und der mir ein Licht aufsteckte. Und auch die älteste Glühbirne der Welt in Livermore kommt natürlich zu ihrem Recht. Ein weiteres Highlight ist die Geschichte von Markos, dessen Tintenstrahldrucker den Geist aufgibt und der sich nicht damit abfinden will, dass niemand das Gerät in Reparatur nehmen will, weil ein neues doch viel günstiger sei als die Wiederherstellung des alten. Er findet nach langen vergeblichen Irrwegen schließlich heraus, dass ein kleiner Chip im Drucker nach Erreichen einer bestimmten Anzahl von Druckvorgängen das Gerät automatisch blockiert, obwohl es sonst noch absolut funktionstüchtig ist. Ein russischer Hacker übermittelt ihm dann einen kleinen Code, mit dem er den Chip überlisten und die Druckfunktion wieder in Gang setzen kann. Die US-amerikanische Maschinenstürmerin Nicols Fox kommt zu Wort, die ihr Buch über die Ludditen noch auf einer mechanischen Schreibmaschine verfasst hat. Und auf der anderen Seite wird der Erfinder der geplanten Obsoleszenz, Bernard London, in Erinnerung gerufen, der 1933 im ersten Kapitel seines Buches The New Prosperity versprach: „Ending the Depression Through Planned Obsolescence“. Allerdings konnte er sich mit seinem Konzept einer staatlich verordneten Verfallsfrist für alle Handelsgüter nicht durchsetzen, obwohl die Produzenten etwa von Nylonstrümpfen, Küchengeräten und vielen anderen Dingen des täglichen Gebrauch sehr bald Ingenieure damit beauftragten, künstliche Verschleißfaktoren in die Produkte einzubauen. Dieser Effekt kommt zum Beispiel in Arthur Millers Theaterstück Death of a Salesman (1949) vor, aber auch in dem Film The Man in the White Suit (1951), in dem Alec Guinness einen Chemiker spielt, der einen schmutzabweisenden und reißfesten Anzugstoff erfunden hat und dafür keinen Ruhm erntet, sondern die Kleiderfabrikanten und selbst die Arbeiter in den Fabriken gegen sich hat. Die einen bangen um ihren Absatz, die anderen um ihren Job. Auch der vergessene Bestseller-Autor Vance Packard wird bemüht, der nach seinem legendären Buch über die Werbewirtschaft (The Hidden Persuaders) bereits 1961 mit The Waste Makers jene große Verschwendung anprangerte, die damals erst in ihren bescheidenen Anfängen steckte. Der Film endet in Ghana, auf der Müllhalde von Agbogbloshie, wo hustende Jungen das Kupfer aus den Comuterkabeln herausschmelzen. Er zeigt die riesigen Containerschiffe, die hier mit dem Elektromüll aus halb Europa anlanden. Der Import von Müll ist verboten, aber die Zollkontrollen werden ausgetrickst, indem die Container vorn mit halbwegs tauglichen Geräten beladen werden, während die 90 Prozent Schrott sich dahinter verbergen. Vorgestellt wird schließlich Mike Anane, der die Inventaraufkleber von den Monitoren, Tastaturen und PC-Gehäusen ablöst und einscannt, um die Herkunftsorte und -firmen namhaft zu machen, die sich ihres Mülls auf diese schändliche Weise entledigen. Aber leider – und hier muss ich den ansonsten sehr lehrreichen Film kritisieren – erfahren wir nicht, welche Erfolgsaussichten die Recherchen von Anane haben. Ich werde gelegentlich versuchen, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen.
Bitte nicht lachen
Thursday, 26. January 2012Gerade lese ich ein paar Absätze in Roland Barthes’ Die Lust am Text. An einer Stelle ergeht er sich, der Vielbelesene, wie er in einem von Stendhal vermittelten Text „ein winziges Detail Proust“ wiederentdeckt und sich daraufhin an eine ähnliche Passage bei Flaubert erinnert. Er spricht von „zirkularer Erinnerung“, insofern das große Werk von Marcel Proust sein zentraler Bezugspunkt ist, wie es die Briefe der Madame de Sévigné für seine Großmutter gewesen seien oder für Don Quijote die Ritterromane. Das klingt mir vertraut, es besteht kein Zweifel, hier spricht ein Hirntier und Bücherfresser vor dem Herrn glaubwürdig von den Assoziationskaskaden, die ihm jede lustvolle Lektüre verursacht. – Aber dann? Lässt Barthes unvermittelt seinen Gedanken in einer Generalisierung gipfeln, die mir völlig unsinnig erscheint: „Und eben das ist der Inter-Text: die Unmöglichkeit, außerhalb des unendlichen Textes zu leben – ob dieser Text nun Proust oder die Tageszeitung oder der Fernsehschirm ist: das Buch macht den Sinn, der Sinn macht das Leben.“ (Roland Barthes: Die Lust am Text. A. d. Frz. v. Traugott König. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974, S. 53 f.) Aber was ist das für eine plumpe Gleichmacherei? Es ist die Ignoranz des Intellektuellen vor den Quantensprüngen der technischen Entwicklung. Sein Unfalltod kommt mir insofern vor wie die gesuchte Pointe zu einem traurigen Witz.
Eichhörnchens Mühsal
Wednesday, 25. January 2012Im neuen Jahr kommt im Antiquariat Revierflaneur durchschnittlich eine Bestellung pro Tag herein. Somit ist das Bestellaufkommen wieder leicht gestiegen, seit ich mein Angebot um Taschenbücher erweitert habe. Gestern zum Beispiel habe ich eine Sammlung von rund 50 Insel-Taschenbüchern online gestellt – und schon heute am frühen Morgen ging eine Bestellung eines Titels aus diesem Konvolut ein. Ich machte ihn gleich nach dem Frühstück versandfertig und brachte die Büchersendung zum Postkasten am Anfang der Oberstraße. Kaum hatte ich den Luftpolsterumschlag durch den Schlitz geschoben, da rutschte mir das Herz in die Hose: Ich hatte vergessen, den Umschlag zu frankieren! Wie ägerlich. Die nächste (und einzige) Leerung würde laut Anzeige auf dem gelben Kasten um 15:45 Uhr stattfinden. Also blieb mir nichts andres übrig, als mich um diese Zeit auf die Lauer zu legen und abzuwarten, bis der Fahrer auf seiner Tour hier vorbeikam, um ihn zu bitten, den Umschlag nachfrankieren zu dürfen. Nun wollte ich unbedingt sichergehen, dass ich nicht zu spät kam, denn heutzutage muss man ja damit rechnen, dass die Leerung vorzeitig stattfindet, weil der vermutlich schlecht bezahlte Leiharbeiter so bald wie möglich wieder daheim sein will. Also war ich bereits um 15:15 Uhr zur Stelle. Eine geschlagene Stunde später, durchgefroren wie ich inzwischen war, wollte ich gerade aufgeben, als der Wagen endlich vorfuhr. Ein offenbar sehr unter Zeitdruck stehender Hüne mit grimmer Miene wartete gar nicht erst ab, bis ich mein Begehren vorgetragen hatte, sondern blaffte mich gleich an: „Ich darf nix rausgeben. Verboten!“ Ich blieb freundlich und erklärte ihm behutsam den Fall. Darauf der ungehaltene Mann: „Aber wie sollen wir denn Ihren Brief finden, auf die Schnelle? Ich hab keine Zeit!“ Längst hatte ich meinen Umschlag erspäht und griff danach: „Da ist er schon.“ Passende Marken hatte ich vorbereitet, eine selbstklebende 55er sowie je eine 10er und 20er zum Anlecken. Nun waren aber meine Finger dermaßen steif von der Kälte, dass ich mich ungeschickt anstellte und prompt die 55er-Marke zerriss. Ich klebte sie leidlich zusammengefügt auf den Umschlag, die beiden anderen Marken kreuz und quer daneben. Nun fürchte ich, dass die maschinelle Portoerkennung bei der Post diese seltsame Frankierung nicht durchgehen lässt und somit mein ganzer Aufwand vergeblich war. Und dies alles für einen Rechnungsbetrag von 13,35 Euro! Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen …
Durst
Tuesday, 24. January 2012Ich werde mich systematisch mit der Frage beschäftigen, was das Leben kostet. Gleich nach dem Atmen, das vorläufig noch kostenlos zu haben ist, drängt das Verlangen nach Flüssigkeit täglich danach, gestillt zu werden. Die billigste Variante wäre zweifellos ,Kraneberger‘, das kühle Nass aus der Wand. Man sagt ja, der Mensch solle täglich zwei Liter trinken. Demnach betrüge mein Jahresbedarf 730 Liter. Ein Kubikmeter Wasser kostet bei den Stadtwerken Essen aktuell 1,88 Euro. Somit müsste ich gerade einmal 1,38 Euro aufwenden, um meinen Flüssigkeitsbedarf für ein ganzes Jahr zu decken! Das hiesige Wasser stammt aus der Ruhr, einem der saubersten Flüsse Europas. Zudem wird es in Aufbereitungsanlagen gereinigt, geflockt und filtriert und abschließend noch auf biologisch wirksame Langsamsandfilter geleitet. Anschließend ist es jedenfalls gesundheitlich absolut verträglich. Ob es dem Verbraucher im Naturzustand mundet, steht freilich auf einem anderen Blatt. Viele Wassertrinker versorgen sich jedenfalls mit Mineralwasser in der Flasche. Auch ich trank bisher ein solches Wasser, das ich mir kastenweise bei einem fußläufig erreichbaren Getränkemarkt besorgte. Den über 20 Kilo schweren Kasten transportierte ich auf dem Fahrgestell unseres Handeinkaufswagens, denn bekanntlich verzichte ich auf ein motorisiertes Kraftfahrzeug. Dieser Einkauf dauert mit Hin- und Rückweg selten länger als zehn Minuten. Der Kasten à zwölf Flaschen der Marke meiner Wahl kostete bisher ohne Pfand 3,33 Euro, das entspricht knapp 0,40 Euro pro Liter. Mein Lieblingswasser kommt ganz aus der Nähe, was mir wichtig war, denn ich habe als umweltbewusster Konsument natürlich auch den Transportaufwand von der Quelle bis zur Mündung in meinen Mund im Blick. Wenn ich meinen empfohlenen Flüssigkeitsbedarf ausschließlich mit diesem Mineralwasser decken würde, müsste ich dafür somit 290 Euro pro Jahr aufbringen, das entspricht dem 210-fachen Preis des Kranwassers! Ich war schon halb auf dem Weg mir zu überlegen, ob ich mir nicht durch billige Geschmackszusätze das Leitungswasser appetitlicher machen könnte, da brachte mich eine weitere Verteuerung des Mineralwassers aus der Fassung. Der nahe gelegene Getränkemarkt hatte plötzlich geschlossen, wurde umgebaut und unter neuer Leitung neu eröffnet. Nun kostet der gleich Kasten statt 3,33 Euro stolze 3,69 Euro, das entspricht einer Preissteigerung um über zehn Prozent. Jetzt reicht’s! Ich muss Mittel und Wege finden, um aus dem konkurrenzlos billigen Leitungswasser mit geringstmöglichem Aufwand an Zeit und Geld ein Getränk herzustellen, das gesund ist und mir schmeckt.
Seine früheste Erinnerung
Monday, 23. January 2012Wenn er sich nicht täuscht, dann hatte er vor zwanzig oder dreißig Jahren noch ein paar deutliche Erinnerungen aus seiner allerfrühesten Kindheit bewahrt, also aus der Zeit, da er noch nicht einmal laufen und kaum sprechen konnte. Aber diese Bilder sind inzwischen wohl auf Nimmerwiedersehen versunken. Immerhin ein klares Bild ist ihm noch aus der Kinderwagenzeit verblieben, vielleicht nur deshalb, weil es ein Foto gibt, das eine sehr ähnliche Situation abbildet. Diese Schwarzweiß-Fotografie klebt in einem orangefarbenen, quadratischen Album, das seine Eltern liebevoll für ihren ersten und einzigen Sohn anlegten – schon bevor er überhaupt zur Welt gekommen war. Wann immer er in dem Album blätterte und jenes Foto betrachtete, rief es in ihm die Erinnerung wach, die übrigens eine durchaus unangenehme war und noch immer ist. Er sitzt angegurtet in diesem ,Sportwagen‘ im Stil der 1950er Jahre. Seine Mutter (rechts im Bild) hat gerade eine andere junge Mutter getroffen, die sie offenbar kennt. Die beiden Frauen plaudern miteinander, das Gespräch nimmt kein Ende. Er quengelt, will aus dem Wagen heraus: ,Wann gehen wir denn endlich heim?‘ Sein Kopf tut ihm weh, zudem ist ihm kalt, denn es ist wohl noch Winter. Mit dem anderen Kind kann oder will er nichts anfangen. Endlich erscheint sein Vater und befreit ihn aus seiner misslichen Lage. Im Hintergrund links ist der städtische Saalbau zu sehen, rechts am Horizont der Schornstein einer Brauerei. Das Jahr 1958 hat gerade begonnen.
Sonntag, 22. Januar 2012
Sunday, 22. January 2012In letzter Zeit kämpfe ich gegen die melancholische Idee, dass sich die private wie die öffentliche Aktualität zunehmend in Wiederholungen erschöpft. Die tragikomische Demontage des Bundespräsidenten Christian Wulff kommt mir vor wie ein fades Remake der zu Guttenberg’schen Plagiatsaffäre Anfang vorigen Jahres. Entsprechend angestaubt wirken die medialen Bemühungen, hieraus erneut einen Auflagen- und Einschaltquoten-Hype zu pressen. Dass es heuer nicht die traditionell der Aufklärung verpflichtete links-liberale Presse ist, die den Stein ins Rollen brachte, sondern ausgerechnet die BILD-Zeitung, passt ebenso zu diesem Eindruck wie manches Detail, das ich eher widerstrebend zur Kenntnis nehmen muss, keinesfalls mehr mit der lustvollen Schadenfreude vom Vorjahr, die ich mir beim Sturz des Verteidigungsministers nicht verkneifen konnte und wollte. So kam jüngst das neue Verb „wulffen“ in Umlauf, im Sinne von: „jmd. aus persönlichen Gründen mit (rechtlichen) Konsequenzen drohen“. Ich wette aber dagegen, dass es eine Chance hat, zum „Wort des Jahres“ gewählt zu werden. 2011 kam das Verb „guttenbergen“ immerhin auf Platz 7 der Vorschlagsliste, als Synonym für „abschreiben, abkupfern, plagiieren“, aber in den aktiven Wortschatz der Deutschen ist auch dieses Wort seither keineswegs aufgenommen worden, im Unterschied zu dem schließlich von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden prämierten „Stresstest“. Ach, dieser Wulff! Als er sich um das höchste Amt bewarb, sah ich seine Vita durch und stolperte über den Namen eines seiner väterlichen Förderer: Ulrich Parzany. Den habe ich als Vierzehnjähriger ein einziges Mal im Essener Weigle-Haus predigen gehört und gleich eine tiefe Abneigung entwickelt. Charisma wird dem Mann zugeschrieben. Wenn ich Parzany etwas verdanke, dann dass ich seit meiner Begegnung mit ihm gegen Charismatiker aller Art immun bin. Wenn das so weitergeht, wird 2012 ein Jahr ohne Charakter.
Nekro-Exhibitionismus
Saturday, 21. January 2012Die neuen Mittel der öffentlichen Selbstdarstellung via Weblog, YouTube, Twitter, XING, MySpace, Facebook usw. haben nicht zuletzt auch neue Möglichkeiten der unfreiwilligen Selbstbeschädigung herbeigeführt, Versuchungen zur unbedachten Autodestruktion bereitgestellt, Lockmittel ausgestreut zur leichtfertigen Präsentation nicht nur geheimer Gedanken und intimer Körperzonen, sondern auch zur Preisgabe privatester Erlebnisse, wie Geburt, Krankheit, Sterben und Tod. Eine deprimierende ärztliche Diagnose wie Krebs, Depression, Parkinson oder Aids überfordert oft nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch deren Angehörige und Freunde. Die Angst vor nötigen klinischen Untersuchungen und Eingriffen, vor dauerhaften körperlichen Beeinträchtigungen und Schmerzen belastet den Kranken umso mehr, als er erfahren muss, dass die Anteilnehme in seinem sozialen Umfeld bald ihre natürliche Grenze findet. Für die Gesunden geht das Leben mit seinem Ernst und seinem Spaß schließlich weiter bie bisher. Schon aus einem verständlichen Bedürfnis nach emotionaler Immunisierung gegen das dramatische Geschehen der schweren, möglicherweise todbringenden Krankheit meiden sie allzu intensive Begegnungen. Vom Kranken, gar Todgeweihten geht ein Sog in den Abgrund aus. Er „zieht runter“, wie man ganz unverblümt bekennt. In dieser Einsamkeit des Leidenden bieten sich die Social-Media-Plattformen im Internet an für ein offenherziges Bekenntnis zum eigenen Elend, für die Suche nach Gesprächspartnern, ob Leidensgefährten oder bloß Anteilnehmenden, ob im Schutze der Anonymität oder unter vollem Namen. Im Extremfall führt dies zu einer hochdramatischen Vorführung des eigenen Sterbens in Echtzeit und damit zu einem Exhibitionismus – bzw., je nach Perspektive, Voyeurismus – des Todes, wie er in dieser Direktheit noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre. An dieser Stelle will ich auf das neue Phänomen bloß aufmerksam machen, ohne noch darüber reflektiert zu haben, was aus ihm für den Umgang mit Krankheit und Tod in unserer Gesellschaft folgt. Ich halte dies insbesondere deshalb für ein relevantes Thema in meinem eigenen Blog, weil ich unlängst ebenfalls von einer bösen Überraschung heimgesucht wurde und weil ich zudem sehe, dass sich auch sehr besonnene und gebildete Autoren mit ihrem Leid in die Öffentlichkeit des Web begeben.
Sonderbehandlung
Friday, 20. January 2012Am 8. Januar 1942 sandte der Chef der Sicherheitspolizei und des SD Reinhard Heydrich aus Prag eine Einladung an seinen Parteigenossen, den Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt Martin Luther, und dreizehn weitere Herren eine Einladung zu einem Treffen in der Reichshauptstadt. Dort solle am 20. Januar, heute vor 70 Jahren, in einer Villa am Großen Wannsee eine „Besprechung mit anschließendem Frühstück“ stattfinden. Der Teilnehmer mit dem Namen des Reformators geriet später auf Abwege, als er sich an einem Putschversuch gegen seinen Vorgesetzten, den Reichsminister des Auswärtigen Joachim Rippentropp beteiligte und nach seiner Enttarnung als privilegierter Häftling im KZ Sachsenhausen landete. Nur diesem Umstand ist zu danken, dass das Besprechungsprotokoll der Wannsee-Konferenz, auf der die Ermordung aller 11.000.000 Juden in Europa beschlossen wurde, auf uns gekommen ist, da das Aktenmaterial aus Luthers Büro zur Vorbereitung des Hochverratsprozesses gegen ihn in Berlin-Lichterfelde ausgelagert worden war. Allerdings kommen selbst in diesem hochgeheimen Dokument eindeutige Begriffe wie „Tötung“, „Vernichtung“ oder „Auslöschung“ nicht vor. Die entscheidende Passage lautet so: „Unter entsprechender Leitung sollen nun im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen, unter Trennung der Geschlechter, werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist. (Siehe die Erfahrung der Geschichte.)“ (Besprechungsprotokoll der sog. Wannsee-Konferenz, S. 7/8; Hervorhebung von mir.) Autor dieses in seinen Folgen vielleicht schrecklichsten Textes der bisherigen Geschichte unserer Spezies war als Protokollführer übrigens der Bürokrat Adolf Eichmann. Wir kennen den Tonfall des seelenlosen Verwaltungsfachmanns und Logistikers aus seinen Verteidigungsreden, als ihm 18 Jahre später in Jerusalem der Prozess gemacht wurde. Die deutsche Sprache hat spätestens mit Sätzen wie diesen ihre Unschuld verloren. Einen weiteren muss ich noch zitieren: „Der Wunsch des Reichsmarschalls [Hermann Göring], ihm einen Entwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Belange im Hinblick auf die Endlösung der europäischen Judenfrage zu übersenden, erfordert die vorherige gemeinsame Behandlung aller an diesen Fragen unmittelbar beteiligten Zentralinstanzen im Hinblick auf die Parallelisierung der Linienführung.“ (Besprechungsprotokoll der sog. Wannsee-Konferenz, S. 2; Hervorhebung von mir.) Der tarnende Begriff des Behandelns bzw. der Behandlung wird also offenbar unterschiedslos auf den Todfeind und die höchsten Instanzen des Reiches angewandt, wenn es darum geht, den eigentlichen, für die Behandelten unangenehmen Charakter dieser „Behandlung“ zu verbrämen. Im ersten Falle besteht die „Behandlung“ darin, die Juden unter möglichst gefahrvollen und strapaziösen Bedingungen im Straßenbau einzusetzen, damit ein großer Teil von ihnen dabei vor Entkräftung oder durch Krankheiten stirbt, um dann die übriggebliebenen Menschen mit Vernichtungsmitteln (Zyklon B) zu ermorden; während „Behandlung“ im zweiten Fall bedeutet, die Vorgesetzten der zuständigen Parteidienststellen und Reichsbehörden und ihr Personal seelisch-moralisch auf diesen staatlich angeordneten Massenmord einzustimmen. – Was Karl Kraus schon lange zuvor in aller Schärfe erkannt hatte, wurde hier traurige Realität und droht für alle Zukunft, sich zu wiederholen: Die schrecklichsten Taten tarnen sich hinter floskelhaften Euphemismen; wenn jene erst leicht über die Lippen kommen, dann gehen diese umso leichter von der Hand.
Er beschließt
Thursday, 19. January 2012Als er auf seinem zuletzt immer beschwerlicher und unübersichtlicher werdenden Weg einen Punkt erreicht hatte, da ihm die Kräfte schwanden und er die Orientierung verlor, beschloss er, für eine Weile zu rasten und seine lange Reise bis hierher noch einmal von Anbeginn zu überdenken. Vielleicht würde er bei dieser Rückschau eine Stelle finden, an der er in die Irre gegangen war. Vielleicht würde er aber am Ende auch zu dem Ergebnis kommen, dass alles bis ganz zuletzt seine Richtigkeit hatte; dass nämlich auch die Verirrungen und sogar das schließliche Scheitern nichts anderes bedeuteten, als die Erfüllung seines ihm beschiedenen Schicksals. So machte er sich also ein zweites Mal auf den Weg und befragte seine Erinnerung nach dem Sinn seines scheinbar schlichten und in Wahrheit doch so rätselvollen Daseins.
Blackout against SOPA!
Wednesday, 18. January 2012Der Revierflaneur schließt sich heute den weltweiten Protesten gegen den US-amerikanischen Gesetzentwurf SOPA an. Urheberrechte müssen auch im Internet geschützt bleiben, keine Frage. Aber die neuesten Bestrebungen in den USA gehen hierüber hinaus und lassen befürchten, dass die freieste Kommunikationsplattform der Welt künftig zunehmend von Zesurmaßnahmen beschnitten werden kann. Dies darf nicht wahr werden!
Brevissimo!
Tuesday, 17. January 2012Was hat nun die Entscheidung, von fünf Absätzen auf einen runterzuschalten, für mein Blog gebracht, aus meinem Blogschreiben gemacht? Wenn ein Thema, ein Gegenstand, ein Vorwand eine gewisse Ausführlichkeit erheischt, dann taucht das Ende vom Lied in den Untergrund, liegt irgendwo weit unterhalb der südlichen Monitorbegrenzung, sozusagen unter der Tischplatte. Scroll-scroll! Na, und? Allen Ernstes meldete sich jüngst eine Leserin und klagte über die Strapaze, für ihre Augen keine Leerzeilen mehr zum Verweilen angeboten zu bekommen. Ich muss schon sehr bitten! Durch das Halten der Strg-Taste und mehrfache Betätigung des +-Zeichens im Nummernblock rechts kann sie doch den Text auf dem Schirm in so augenfreundlich bemessene und leicht verdauliche Einheiten portionieren, dass niemals die Gefahr besteht, in der Zeile zu verrutschen oder sonstwie ins Stolpern zu kommen. Überhaupt sind solche Leserwünsche eine Zumutung! Wer käme auf den Gedanken, von einem Maler zu fordern, er möge kleinere Bilder malen, oder doch wenigstens nicht so detailreiche, weil man diese Riesenschinken ja gar nicht auf einen Blick erfassen könne? Wobei ich andererseits durchaus um Konzentration bemüht bin. Ständig streiche und streiche ich meine Entwürfe zusammen. Mit meinen Hobelspänen würde mancher Schreiber dürre Anekdoten zu Romanen ausstopfen. Und das war’s auch schon wieder für heute.
Mohr und General
Monday, 16. January 2012Dieses Buch ist sogar im Wilpert-Gühring gelistet, dem Handbuch des Antiquars, das die Erstausgaben deutscher Dichtung verzeichnet und somit als Prüfstein dafür gilt, ob ein Buch wirklich als „EA“ angeboten werden kann und damit ein deutlich höherer Preis verlangt werden darf, als für alle späteren Auflagen des gleichen Titels. Allerdings haftet meinem Exemplar ein kleiner Fehler an, insofern es sich nur um die Taschenbuch-Ausgabe in zwei Bänden handelt, die zwar gleichzeitig mit der gebundenen Ausgabe herauskam, aber vermutlich für EA-Sammler nicht in Betracht kommt. Die Rede ist von der wundervollen Montage Gespräche mit Marx und Engels, die Hans Magnus Enzensberger 1973 für den Insel-Verlag zusammengestellt hat. Auf rund 700 Seiten versammelt das Werk Berichte von Augenzeugen, die den Theoretikern des wissenschaftlichen Sozialismus und Mitbegründern der „Internationale“ persönlich begegnet sind – und zwar in sehr unterschiedlicher Beziehung: als Freunde oder Feinde, Familienmitglieder oder Polizeispitzel, Genossen oder Abtrünnige. Dies Buch liest sich sehr lebendig und vermittelt gerade in seiner Widersprüchlichkeit einen ungleich glaubwürdigeren Eindruck von den Personen als die bekannten hagiographisch angelegten Lebensbeschreibungen. Im Anhang lässt Enzensberger dann noch Marx und Engels selbst zu Worte kommen, nämlich in einem „Injurien- und Elogenregister“, in dem er ein alphabetisches Namenverzeichnis der wichtigsten Gewährsleute seiner Montage mit den Äußerungen versieht, die Marx und Engels über diese von sich gaben. (Ich erinnere mich noch gut, dass der Schwall von Beschimpfungen, den die beiden über Bakunin ergießen, nicht wenig dazu beigetragen hat, mich fortan für den Anarchismus zu erwärmen.) – Im Wilpert-Gühring (2. Aufl.) findet man das Buch übrigens unterm Stichwort Enzensberger als Nr. 24.
Deutschland, hilf!
Sunday, 15. January 2012Man darf niemals aufgeben. „Ich habe soeben erstmals den Namen Ihrer Hilfsorganisation gelesen (auf einem Werbeplakat an einer Straßenbahnhaltestelle in Essen). Sehr stört mich daran, dass in Ihrem Namen ein Rechtschreibfehler unterlaufen ist. Das Wort ,helfen‘ ist ein Verb und muss darum kleingeschrieben werden, außer am Anfang des Satzes. Es heißt also richtig: ,Aktion Deutschland hilft‘. Wie erklären Sie diesen Fehler, durch den vor allem Kindern und Deutsch lernenden Ausländern ein schlechtes Vorbild gegeben wird, bei einer solch renommierten und wirkungsvollen Organisation? Ich bin gespannt auf Ihre Antwort und würde mich freuen, wenn Sie meine Anregung aufgreifen und den falsch geschriebenen Namen bald korrigieren würden.“ (Anfrage per Online-Formular abgeschickt am heutigen Tage um 19:00 Uhr.)
Rote Giftquallen
Saturday, 14. January 2012(Bild wegen ungeklärter Rechte entfernt)
Zum Babysitting bei der Tochter. Wir schauen nach langer, langer Zeit mal wieder „Glotze pur“, also nicht in konservierter Form ausgewählte Edelkulturstreifen bei ARTE+7, sondern einmal die Programme rauf und runter in Echtzeit. Unkulturschock! Völlige Desorientierung. Taste 1 ARD: Wir stolpern in eine Verfolgungsjagd mit wilden Schusswechseln, deren Ergebnis dank schneller Schnittwechsel jeweils ungewiss bleibt. Sind die Gliedmaßen der bösen Häscher nun zerfetzt worden, oder waren das bloß Streifschüsse? Der Held kommt mir von irgendwo bekannt vor und ich frage meine Gefährtin: „Ist das nicht James Bond?“ Nachträglich lese ich in der Programmankündigung der SZ: Es war James Bond, aber eine spätere Folge, mit Pierce Brosnan, um genau zu sein von 1999, also aus einer Zeit, als ich aus dem Alter längst raus war, dem Betrachten solcher Filme wenigstens noch einen ironischen Genuss abgewinnen zu können. Zielgruppe: kleine und große Jungs. – Taste 2 ZDF: Auch hier ein Film aus dem Genre Verbechensverfolgung, aber diesmal deutsche Hausmannskost. Da menschelt es gewaltig. Die altersweise Schwiegermutter, Typ Inge Meysel, nur intelligenter, übt sich am Küchentisch als Seelentrösterin für ein ungewollt schwanger gewordenes Nervenbündel, das dann das Kind verloren hat und nun auch noch den Beinahevater einzubüßen droht. Tränenreiche Bekenntnisse. Zielgruppe junge Mädchen und Omas. – Taste 3 RTL: Hier erinnere ich mich nur an eine unsägliche Alberei auf einer Bühne, aber der Eindruck war zu kurz, denn meine Gefährtin forderte unmissverständlich: „Mach das weg! Das ist ja schrecklich!“ Jetzt lese ich, dass es sich um „eine Auswahl der besten, aber auch schrägsten Auftritte“ aus der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ handelte. Ich wusste immer nicht, was das eigentlich ist. Jetzt ahne ich es immerhin. Zielgruppe: Peinlichkeitsliebhaber. – Taste 4 SAT 1: Ein Besuch im Krankenhaus. Das dickliche Opfer liegt mit Beatmungsschläuchen hilflos auf der Intensivstation, der böse Doktor am Fußende verweigert ihm die Behandlung mit dem rettenden Antidot gegen einen absolut tödlichen Virus, der in wenigen Stunden den keuchenden Dicken dahinraffen wird. Die Zeit läuft! „Mission Impossible II“. Zielgruppe: Masochisten und SciFi-Fans. – Taste 5 Pro Sieben: Hier haben wir mal Glück und stolpern nicht mitten hinein in den Schlamassel, sondern bekommen ihn von Anfang an mit. Es heißt „Shopping-Center King – Hier gilt mein Gesetz“ und läuft unter Komödie, soll uns also zum Lachen bringen. Nachdem ich mir zehn Minuten lang vorgestellt habe, welch Geistes Kind die Menschen sein müssen, die über diesen Klamauk von der allerbilligsten Sorte lachen können, war ich sehr traurig und hätte am liebsten das Experiment ganz abgebrochen. Zielgruppe: Naive, Debile und Betrunkene. – Taste 6 Vox: Nun sehen wir kämpfende Männer aus offenbar ferner Vergangenheit. Sie schleichen mit Pfeil und Bogen durch den dunklen Forst. Einer legt auf eine Hirschkuh an und ich beginne zu fürchten, dass für diesen Film ein unschuldiges Tier dran glauben musste, aber nach einem blitzschnellen Durcheinander bleibt gottlob nur einer der Recken auf der Strecke. Dann geht ’s hinaus aufs offene Feld, wo sich zwei ungleich bewaffnete Heere gegenüberstehen. Der Aufwand an Statisten, Pferden und Kostümen nötigt uns Bewunderung ab, die traurige Schlichtheit der Dialoge macht diesen Eindruck leider bald wieder zunichte. Wir sahen einen Ausschnitt aus „Braveheart“. Zielgruppe: historisch interessierte Melancholiker. – Taste 7 Arte: Womit wir also doch wieder bei „unserem“ Sender wären. Hier tauchen wir in die Tiefsee und erfahren in hektischer Schnittfolge tausenderlei über Eisbären, Wale, Eiszeiten, Warmzeiten, Bohrkerne, Expeditionen, Fischfang, Thunfisch, rote Giftquallen, globale Erwärmung usw. Vorgetragen wird dies von Bestseller-Autor Frank Schätzing (Der Schwarm), der mittels beeindruckender Trickanimation raketenartig durch die Lüfte fliegt. Fazit der dreiteiligen Lehrsendung „Universum der Ozeane – Geheimnisse der Tiefsee“: Der Mensch versündigt sich auf vielfache Weise an der Natur, aber auf ebenso vielfache Weise ersinnt er stets neue Möglichkeiten der Schadensbegrenzung. Und überhaupt muss man angesichts von Jahrmillionen Evolution in größeren Zeiträumen denken. Zielgruppe: Der beunruhigte Intellektuelle, der als Betthupferl ein buntes Trostpflästerchen benötigt. Unser Resümee dieses aufschlussreichen Fernsehabends: Uns entgeht hier nichts! Und insofern ist es eine Unverschämtheit, wenn wir ab 2013 gezwungen werden, die volle GEZ-Gebühr zu entrichten, obwohl wir nach wie vor auf das TV-Programm dankend verzichten wollen und uns auch fürderhin kein Bildfunkgerät zulegen werden.
Freitag der Dreizehnte
Friday, 13. January 2012Ob Glücks- oder Unglückstag – dieser Freitag hatte es in sich. Zum ersten Mal erreichte mein Antiquariat eine Bestellung aus dem ferneren fremdsprachigen Ausland. (Bislang kamen bloß Bestellungen aus Österreich und der Schweiz.) Ein Kunde aus New York orderte Martin Kippenbergers Frauen. Und welch ein Zufall, dass mein Ältester gerade noch in Essen weilt und mir erstens helfen konnte, per E-Mail die näheren Einzelheiten dieser Transaktion mit dem Kunden abzusprechen, because my English is not so good. Und zweitens nun das kleine Bändchen aus dem Merve-Verlag morgen auf seinen Flug nach New York mitnehmen kann. Der Kunde hat einen auf Künstlerbücher spezialisierten Laden in Greenwich Village und spart auf diese Weise 50 US-$ Transportkosten. Ich hoffe sehr, dass er meine erschöpfend ehrliche Beschreibung des Exemplares richtig verstanden hat und nicht enttäuscht ist. Es handelt sich um einen Fehldruck des Bandes 93 aus der Reihe Internationaler Merve Diskurs, bei dem eine Bogenseite nicht bedruckt wurde, weshalb acht Seiten leer sind. Auf zwei dieser Seiten habe ich seinerzeit Anfang der 1980er Jahre persönlich zwei mir „passend“ scheinende Schwarzweißfotos von Frauen eingeklebt. Zudem stattete ich das Büchlein mit einem zusätzlichen Umschlag aus, indem ich es mit einer Roth-Händle-Stangenverpackungsfolie beklebte [siehe Titelbild]. Leider ist es dadurch für jemanden, der es nicht kennt, kaum mehr zweifelsfrei zu identifizieren, da es drinnen keine Titelseite, kein Impressum usw. enthält. Das kann man ja übrigens auch in der Kippenberger-Biografie seiner Schwester Susanne nachlesen: „Zwischen all den komplizierten theorielastigen (post-)stukturalistischen Texten kam nun Martin mit einem Band, der nur aus Bildern bestand, in dem allein das drin war, was draußen draufstand, nicht mehr und nicht weniger: ,Frauen‘. Fremde Frauen, Freundinnen, Kolleginnen, unsere Mutter auch, lachend in seinem Arm. Die einzigen Worte haben auf dem Umschlag Platz: vorne Autor, Titel, Verlag, hinten das Impressum.“ (Susanne Kippenberger: Kippenberger. Der Künstler und seine Familie. Berlin: Berlin Verlag, 2007, S. 188.) Ich bin sehr gespannt, ob Mr B. D. bei der Übergabe keine Schwierigkeiten macht. Wie auch immer die Geschichte ausgeht, werde ich so auch nicht klüger, was die Frage betrifft, ob das heutige Datum nun ein glückliches oder unglückliches Omen bedeutet.
Wie wirkt yakoana?
Thursday, 12. January 2012Besichtigung der atemberaubenden Ausstellung über die Yanomami im Museum Folkwang. Der Beuys-Schüler Lothar Baumgarten hat diesen südamerikanischen Indianerstamm 1978/79 besucht und anderthalb Jahre mit den „Señores Naturales“ gelebt, hat an ihren Ritualen und an ihrem Alltag teilgenommen, ist mit ihnen auf die Jagd gegangen, hat sie fotografiert, ihre Gesänge und Gespräche aufgenommen und im Tausch ihre Pfeilspitzen, Schnupfrohre, Körbe und Hängematten erworben. Er hat sie auch animiert, mit Wasserfarbe und Pinsel auf Papier zu malen, eine Anregung, die sie offensichtlich mit großer Begeisterung und Ausdauer angenommen haben, wobei ihre Bilder nahezu ausnahmslos ungegenständlich geblieben sind. Unser Freund Jürgen Lechtreck, der die Ausstellung als Projektleiter kuratiert hat, führt uns durch die neun mit großer Liebe und Sorgfalt eingerichteten Räume im Untergeschoss des Museums und gewährt dabei interessante Einblicke in die Zusammenarbeit mit dem Künstler, erläutert die technischen Herausforderungen der Präsentation und vermittelt ein Gefühl für die nötige Rücksichtnahme auf den empfindlichen Zauber dieser uralten Kultur an der Grenze zum Verschwinden. Ein Gefühl der Trauer stellt sich bei mir ein, auch der Scheu, wie beim unbefugten Zutritt zu einem fremden Heiligtum. Wenn ich die in ihren Riten begeisterten Gesichter dieser so ganz ungezwungen wirkenden Menschen auf den Fotos betrachte, dann beneide ich sie einerseits, wie ich vielleicht Kinder beneide, die den „Ernst des Lebens“ noch nicht erfahren haben und sich ganz hemmungslos ihrem Spiel hingeben können. Andererseits schäme ich mich, mein Selbstverständnis zivilisierter Überlegenheit dabei nicht ablegen zu können, den mitleidigen Blick auf die Dürftigkeit und Grobheit der Verhältnisse. – Wenn ich irgend die Zeit und Kraft dazu finde, werde ich noch einmal allein wiederkommen, um diesen Gefühlen auf den Grund gehen zu können.
[Die Ausstellung im Museum Folkwang „Lothar Baumgarten: Abend der Zeit – Señores Naturales Yanomami“ ist noch bis zum 27. Mai 2012 geöffnet.]
Spiraltraum
Wednesday, 11. January 2012Mein Ältester erzählt mir beiläufig von einem Dokumentarfilm über einen nie zu Ende gedrehten Spielfilm des französischen Regisseurs Henri-George Clouzot. Ich hätte ja immer nur von Lohn der Angst geschwärmt. Gern hätte ich widersprochen, denn ich erinnerte mich gut, dass es noch einen zweiten Film von Clouzot gab, den ich damals annehmbar fand. Aber wieder einmal macht mir, wie in den letzten Jahren immer öfter, mein schwächer werdendes Langzeitgedächtnis einen Strich durch die Rechnung. Ich komme nicht auf den Titel dieses Films. Aber eigentlich geht es ja auch nicht um diesen vergessenen Film, sondern um den Fragment gebliebenen Film, dessen Titel mein Sohn wohl auch genannt hat, aber kurz darauf habe ich auch diesen Titel vergessen. Wie kamen wir überhaupt auf Clouzot? Ach ja, das fällt mir wieder ein. Ich hatte die Geschichte von Romy Schneider und Harry Meyen erzählt, von der Nephrektomie rechtsseitig bei Romy und dem Suicid am Seidenschal nach langjährigem Optalidon-Abusus bei Harry, was mir gleichzeitig als unsägliches Kauderwelsch vorkam, Gefasele eines unter Beziehungswahn leidenden Irrgängers. Es entstand eine peinliche Pause, denn meine Geschichte führte ins Nichts. Daraus rette mich mein Sohn, indem er von Clouzots unvollendetem Meisterwerk sprach, worin Romy Schneider die weibliche Hauptrolle spielte. Das war die Brücke zu L’Enfer. Denn so hieß der Film, das habe ich jetzt nachgeschlagen. Falsch verstanden hatte ich, dass der Regisseur über den Dreharbeiten einem Herzinfarkt erlegen sei. So war es nicht. Allerdings mussten die Arbeiten wegen Clouzots Infarkt abgebrochen werden, doch überlebte der Meister und drehte anschließend noch zwei weitere, weniger bedeutende Filme. Mein Sohn wusste wohl davon, weil vor drei Jahren ein Dokumentarfilm L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot herauskam, der begeisterten Zuspruch fand. Einen kleinen Ausschnitt habe ich eben gesehen. Er zeigt Romys Gesicht, rauchend, verführerisch lächelnd, zeigt sie Wasser aus einer unerschöpflichen Flasche in ein Glas füllend – und schließlich mit einer Spirale spielend, die unmittelbar eine starke Erinnerung in mir wachrief. Genau eine solche Spirale hat mein bester Freund vor wohl 45 Jahren aus den Ferien mitgebracht. Er konnte sie Treppenstufen „hinunterlaufen“ lassen, ein wunderbarer Effekt, ein beneidenswertes Objekt! Im Film von 1964 kriecht die gleiche Spirale über Romy Schneiders in verführerische Dessous gehüllten, in blaues Licht getauchten Körper. (Und jetzt weiß ich auch wieder, wie der zweite Film von Clouzot hieß, den ich mochte. Das waren Die Teuflischen, nach dem Roman von Boileau-Narcejac, den ich ebenfalls gelesen habe.) – So vergeblich, so albern, so kränkend diese kleinen Scharmützel im Kampf gegen das Vergessen sein mögen, es käme einer Generalkapitulation gleich, wenn ich mich ihnen nicht mehr stellen wollte.
Straßenbilder
Tuesday, 10. January 2012Schon seit einem guten Jahr trage ich mich mit dem Plan, eine Reihe von langen Straßen meiner Vaterstadt von einem Ende bis zum andern abzuschreiten und dabei zu fotografieren, mit dem Ziel, ein insofern lückenloses Bild der jeweiligen Straße entstehen zu lassen, als im Mittelpunkt jeder Fotografie der Standpunkt der auf sie folgenden zu sehen ist. Ich war auf diesen Gedanken nach unserem letzten Umzug gekommen, denn nun wohnen wir am Ende bzw. Anfang einer der längsten Straßen Essens, der Rellinghauser Straße; und gleichzeitig, wie schon bei unserem vorletzten Wohnort, am Rande einer weiteren sehr langen Straße, der Frankenstraße. Ein günstiger Zeitpunkt für die Realisation dieses Projekts wäre sicher der frühe Morgen rund um die Sommersonnenwende am 21. Juni, denn dann muss man auf Passanten kaum Rücksicht nehmen, deren Missfallen es vielleicht erregen könnte, in der Öffentlichkeit fotografiert zu werden. Ein weiteres Problem stellt sich mit den Autos, deren Nummerschilder ins Bild kommen könnten, was ebenfalls auf einen Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte hinausliefe. Notfalls müssten die Autonummern per Bildbearbeitung unkenntlich gemacht werden. Ich denke noch darüber nach, ob es vielleicht reizvoll wäre, jede dieser langen Straßen in beide Richtungen abzuschreiten, denn so ergäbe sich ja ein jeweils völlig anderer Eindruck. Die einzelnen Bilder würde ich hier im Blog veröffentlichen und meine Erinnerungen zu den verschiedenen Standorten zu „Bildunterschriften“ verarbeiten. Möglicherweise könnte ich die Aufnahme der Straßenbilder auch alle zehn Jahre wiederholen, um die Veränderungen zu registrieren.
[Das Titelbild zeigt das Ende der Rellinghauser Straße mit der Einmündung in die Frankenstraße am heutigen Tag um 12:00 Uhr.]
Heinrich Funke: Das Testament (XXVII)
Monday, 09. January 2012„Der Mensch der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein“? Eine Behauptung, und zwar eine gefahrlose, weil sie gleich zwei unscharfe Begriffe im Munde führt: ,Zukunft‘ und ,Mystiker‘. Mutig wäre eine etwas präzisere Aussage, wie etwa: ,Der Mensch des Jahres 2025 wird so und so beschaffen sein, oder er wird nicht mehr sein.‘ Dem könnte man widersprechen und schmunzelnd die Drohung anschließen: ,Na, dann wollen wir uns mal in dreizehn Jahren wiedersprechen!‘ Aber die Propheten unserer aufgeklärten Endzeit tun gut daran, sich nicht allzu präzis festzulegen, wie man neulich noch am traurigen Beispiel von Harold Camping gesehen hat. Übrigens fände eine noch allgemeinere Aussage durchaus meine Zustimmung: ,Auch die Menschheit hat einmal ein Ende.‘ Dies scheint mir evident, und zwar nicht etwa ontologisch, sondern aus ganz banalen astronomischen Gründen. Spannend wird die Frage nach dem genauen Zeitpunkt dieses Verendens von Homo sapiens auf Terra – aber leider für die meisten meiner Zeitgenossen nach meiner Beobachtung nur insofern, als dieser Zeitpunkt nicht in ihre Lebenszeit fallen möge. Ansonsten gilt das alte Motto der dickfelligen Egoisten: ,Nach mir die Sintflut!‘ Werfen wir einen Blick auf das Kompetenzprofil des Zukunftsmenschen, dem allein eine Einstellungs-Chance in die Welt von morgen eingeräumt wird. Er soll nicht etwa umfassend gebildet sein, belastbar und ausdauernd in der Verfolgung seiner Ziele. Auch von sozialen Qualitäten ist nicht die Rede, wie Kommunikationsbereitschaft, Empathie oder Teamfähigkeit. Vielmehr soll er ein ‚Mystiker‘ sein, nach gängigem Verständnis also jemand, dessen Sinnen und Trachten auf die Erfahrung einer absoluten Wirklichkeit gerichtet ist, auf Transzendenz, Jenseitigkeit, Gott und dergleichen Luxusgegenstände, die jedenfalls im allerobersten Stockwerk der Maslowschen Bedürfnispyramide angesiedelt sind. Hier tut unserer Zukunftsdeuterei vielleicht ganz gut, einen Blick auf die Vergangenheit zu werfen, der uns belehrt, dass die mystischen Gipfelstürme stets erst dann möglich wurden, wenn die Grundlagen hierfür in den unteren Etagen geschaffen waren; und dass selbst dann nur wenige privilegierte Außenseiter dafür geschaffen waren, im Verzicht auf weltliche Freuden einen höheren Genuss zu suchen und zu finden. Mit anderen Worten: Mystische Asketen kommen den Herausforderungen der Zukunft vielleicht insofern entgegen, als ihre Lebensweise eine günstige Umweltbilanz ausweist. Nichts spricht aber dafür, dass ihr Vorbild Schule machen und die übrigen 99 Prozent Hedonisten davon abbringen könnte, die Lebenswelt durch Verbrauch zu vernichten. Die Rettung des Menschen auf dem Weg über die Mystik ist gerade so aussichtsreich wie die Himmelsflucht über eine Leiter, die an einer Wolke angelehnt wird.
Sonntag, 8. Januar 2012
Sunday, 08. January 2012Vom leidenschaftlichen Cineasten, der ich seit meinem 16. Lebensjahr war, habe ich mich zuletzt in wenigen Jahren zum Filmverächter gewandelt. Noch immer kann ich es kaum fassen, dass mich offenbar tatsächlich kein Film mehr zu begeistern vermag. Immer wieder einmal mache ich einen Versuch, gebe dem Drängen von Freunden nach, probiere ich diese und jene eindringliche Empfehlung aus. Und stets aufs Neue bin ich enttäuscht, finde meine ärgsten Befürchtungen bestätigt. Dabei beschränkt sich meine Aversion durchaus nicht auf neue Filme. Selbst berühmte Klassiker, die wenigen, die ich noch nicht kannte, können mich nicht gewinnen. Und auch die einst mit solcher Inbrunst verehrten Lieblingsfilme, die in meiner Erinnerung herrlich strahlten, erweisen sich beim Wiedersehen nach so langer Zeit als merkwürdig verblasst, sind nicht mehr ernst zu nehmen. Besonders enervierend erscheint mir übrigens, eine Nebenbeobachtung, die Musik im Film. Diese abgeschmackte „Untermalung“ von Stimmungen, Spannungen, Gestik und Mimik habe ich früher wohl gar nicht bewusst wahrgenommen, so selbstverständlich schien sie mir. Nun löst die Tonspur sich aus dem Zusammenhang, das Getöse tritt mir isoliert entgegen, nahezu stets als alberne Effekthascherei, ganz und gar unerträglich! Mag sein, dass ich überkritisch bin, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr zu einer Toleranz überreden, aus der ich unwiderruflich herausgewachsen bin. Das ist bedauerlich, doch nicht zu ändern.
Zufall: Rumgetalpe
Saturday, 07. January 2012Durchsicht aller online verfügbaren Rezensionen von Wolfgang Herrndorfs Sand. Durchwegs urteilen die Kritiker wohlwollend bis überschwänglich, kein einziger Verriss tanzt aus der Reihe. Das ist insofern erstaunlich, als sie sich andererseits darin einig sind, aus dem Buch nicht recht schlau geworden zu sein. Sie geben zu, verwirrt zu sein, den Überblick verloren zu haben, sich getäuscht und hintergangen vorzukommen – aber sie nehmen das nicht etwa übel, sondern applaudieren dieser Vertracktheit und irritierenden Unübersichtlichkeit noch. Als langjähriger Zufallsforscher kann mich nicht überraschen, dass dieses vielfach missbrauchte Wörtchen auch hier dran glauben muss, um dem Chaos einen Dreh ins glücklich Gewollte und damit Gelungene zu geben. Den Anfang machte Friedmar Apel: „Da die Wahrheit so unwahrscheinlich klingt, erfindet er [der Protagonist des Romans, Carl genannt] wahrscheinlichere Aussagen, aber der Zufall will ihm nicht zu Hilfe kommen. Dabei könnte das Ganze als eine Verkettung von dummen Zufällen erscheinen. […] Die Ereignisse und Gewalttaten scheinen jeweils keinen oder einen falschen Grund zu haben. Das Leben ist auch ein Fehlerspiel von Zufällen, aber da nennt man es Schicksal.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 11. November 2011.) – Und so geht es munter weiter. Dirk Knipphals: „Jedenfalls spielt der Zufall, der in diesem sinnlosen Kosmos und dieser transzendentalen Obdachlosigkeit, in der wir nun einmal leben, herrscht, die alles überragende Rolle.“ (taz v. 15. November 2011.) – Andrea Hanna Hünniger: „Es ist, als wollte er [der Autor] sagen: Jede Handlung ist nur eine Folge von Missverständnissen. Jede Begegnung eine Folge von Zufällen. Und jedes Urteil eine Folge von inkompetenten Richtern. […] Alles, was er [Carl] vor seiner Gefangenschaft tut, geht schief, obwohl sich nicht genau sagen lässt, ob er selbst einen Fehler gemacht hat. Eher sind es die Zufälle, die alles kompliziert machen. Sie sind es, die dafür sorgen, dass ihm der Mikrofilm in die Hände fällt und im Moment des Fast-Erlöstseins wieder verloren geht.“ (ZEIT v. 22. November 2011.) – Luise Boege: „In Sand wird zunächst sehr viel durch Zufall hineingeraten und herumgetalpt […].“ (der Freitag v. 5. Dezember 2011.) Wie die Rezensenten habe ich das Buch mit großen Erwartungen zur Hand genommen. Wie sie empfand ich für den Autor nach Tschick und mehr noch nach intensiver Lektüre seines Blogs Arbeit und Struktur Sympathie und Achtung. Nachdem ich zwei Wochen Bettlektüre – Bücher lese ich ausschließlich vorm Einschlafen im Bett – mit Sand verbracht habe, komme ich noch zu keinem abschließenden Urteil. Die Besprechungen jedenfalls gehen nach meiner festen Überzeugung allesamt in die Irre. Indem sie das Buch so loben, tun sie ihm Unrecht. Zum Überfluss entdeckte ich noch diesen Mitschnitt einer Lesung des Autors aus Sand, bei der im Publikum dauernd gekichert wird. Offenbar sind die Zuhörer mit dem Vorurteil aus Tschick zu der Rezitation gegangen, einem Humoristen zu begegnen – und hören dann nicht richtig hin. Schmerzhaft!
Optalidon (I)
Friday, 06. January 2012„Das Einzige, das half.“ Nämlich gegen meine Kopfschmerzattacken, die mich seit frühester Kindheit zwar nicht regelmäßig, aber zuverlässig immer dann, wenn ich am wenigsten damit rechnete „aus der Bahn warfen“: grauenhafte Pein, Schwindel und blitzende Aureolen, schließlich gipfelnd in Kotzeruptionen „bis zur Galle“, dann totale Erschöpfung und Schlaf; zuletzt ein Erwachen „wie neugeboren“. Wenn ich mir diese Ochsentour ersparen wollte, griff ich zu einem jener rosafarbenen Zäpfchen aus dem Hause Sandoz. Wunderbar! Wenn man heute ,Optalidon‘ bei Wikipedia eingibt, findet man nur eine Erwähnung im Artikel über den Schauspieler Harry Meyen, der sich 1979 an einer Feuerleiter an der Rückfront seines Hauses in Hamburg erhängte, im Alter von nur 54 Jahren, mit einem Seidenschal. Und dort liest man: „Sein Leben lang litt Meyen unter starker Migräne und nahm daher viele Tabletten, unter anderem Optalidon und Staurodorm. Verbunden mit Alkohol führen diese Medikamente häufig zu Benommenheit, Müdigkeit, Lichtempfindlichkeit, Angst und Selbstmordgefährdung. Sein Rauschmittelkonsum steigerte sich im Laufe der Jahre.“ Meyen war als „jüdischer Mischling ersten Grades“ mit 18 Jahren ins KZ Neuengamme verschleppt worden. International bekannt wurde er als Ehemann von Romy Schneider. Einen Abschiedsbrief hat Harry Meyen nicht hinterlassen.
Amt, beschädigt
Thursday, 05. January 2012Ausnahmsweise werde ich mir doch einmal untreu und äußere mich zur Tagespolitik. Seit Guttenberg, mithin seit einem Dreivierteljahr, habe ich mich zurückgehalten und meinen Ärger, meinen Ekel und meine Belustigung über das alltägliche Hickhack unserer demokratisch gewählten, politischen Sachwalter und Repräsentanten und die nicht minder unappetitliche Ausplünderung dieses Spektakels in den kommerziellen Massenmedien hinuntergewürgt. Es gibt ja verdienstvolle Weblogs ohne Zahl, die auf diesem Feld vortreffliche Arbeit leisten, von netzpolitik.org und mediaclinique über Feynsinn, Schockwellenreiter und NachDenkSeiten bis hin zu den Sozialtheoristen und FeFes Blog. Setzt man nur diese Sieben Zwerge auf die Blogroll, dann ist einem alltäglich aus dem Herzen gesprochen und man kann sich allmorgendlich zwischen Frühstück und Tagwerk mit der schönen Illusion besänftigen, dass es noch genug kritischen Verstand in diesem Land gibt und wir uns um die Demokratie nicht sorgen müssen. – Jetzt aber muss ich doch einmal was sagen. Gestern hat Christian Wulff im Öffentlich-rechtlichen Fernsehen zur besten Sendezeit zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen Rede und Antwort gestanden. Da ich bekanntlich kein TV-Gerät beherberge und mir ohnehin solche wichtigen Einlassungen lieber schwarz auf weiß gedruckt zu Gemüt und Verstande führe, kenne ich das Ergebnis dieses knapp 18 minütigen Verhörs, dem der Bundespräsident seitens Bettina Schausten (ZDF) und Ulrich Deppendorf (ARD) unterzogen wurde, nur aus den jetzt als Abschrift im Internet verfügbaren Versionen. Hier also mein Urteil. Die Frage, ob sich Wulff etwas hat zuschulden kommen lassen, das seinen Rücktritt zwingend erforderlich macht, kann ich nicht beantworten. Ob seine Kreditgeschäfte oder sein Umgang mit der Presse gegen geltende Gesetze verstießen, müssen schlimmstenfalls die zuständigen Instanzen entscheiden. Was mich jedoch wirklich erschüttert, das ist das Bild, das dieser Mann in der erbarmungswürdigen Lage abgibt, in die er selbst sich durch sein doch wohl mindestens ungeschicktes Handeln und in die ihn die erbarmungslose Öffentlichkeit durch ihren unstillbaren Hunger auf Sensation getrieben haben. Es ist dies das Bild eines kleinen Jungen, der in der Ecke steht und um Straferlass bettelt. So ganz anders stand Wulffs Amtsvorgänger Horst Köhler bei seinem überraschenden Rücktritt im Mai 2010 vor der Medienmeute: trotzig, gar angriffslustig. Köhler hat sich unsere Sympathien, so wir denn überhaupt welche hatten, damals durch seine Uneinsichtigkeit verscherzt. Wulff hingegen ist nur zu bemitleiden. Die zynische Frage muss nun leider lauten: Welches Schauspiel fügt dem Amt des Bundespräsidenten den größeren Schaden zu?
Am Rande bedacht
Wednesday, 04. January 2012In meiner Jugend war ich davon überzeugt, verrückt zu sein, weil ich mich als so sehr anders empfand als meine Klassenkameraden. Ich interessierte mich für Psychiatrie und fand bald heraus, dass die Gesundheit, die sie im Irren wiederherstellen wollte, nichts anderes war als eine gesellschaftliche Norm, angepasst an die Erfordernisse eines produktiven Gemeinwesens. So entdeckte ich bald die Anti-Psychiatrie und las dort mit Zustimmung, dass die Geschäftigkeiten dieses Gemeinwesens im Gegenteil auf die totale Destruktion hinausliefen: „Mit Sicherheit werden wir uns selbst ausrotten, falls wir nicht unser Verhalten befriedigender als gegenwärtig regulieren.“ Unbefriedigt wie ich war erschien mir dies sehr plausibel, ebenso wie die Beschreibung unserer Defizite, die uns zum Opfer unserer eigenen Einrichtungen und Gewohnheiten machten: „Wir sind nicht einmal fähig, das Verhalten am Rande des Abgrunds adäquat zu bedenken. Doch wir bedenken weniger, als wir wissen; wir wissen weniger, als wir lieben; wir lieben sehr viel weniger, als es gibt. Und wir sind präzise so viel weniger, als wir sind.“ Daraus zog ich den Schluss, dass ich all meine Anstrengungen darauf richten müsste, so viel zu werden wie ich war; so viel wie möglich von dem zu lieben, was es gab; alles zu wissen, was ich liebte; und alles zu bedenken, was ich dann wüsste – um schließlich mein Verhalten am Rande des Abgrunds immerhin adäquat bedenken zu können. Als ich aber bereits an der ersten Hürde gescheitert war, glaubte ich erkannt zu haben, dass ich meine Hoffnung nicht mehr auf mich selbst setzen konnte. Doch stand mir nicht zu, alle Hoffnungen fahren zu lassen: „Wer sind wir, daß wir entscheiden könnten, es gebe keine Hoffnung mehr?“ Zumindest sei ja, wie der Prophet der Anti-Psychiatrie schrieb, jedes Kind „ein potentieller Prophet, gestürzt in die äußere Dunkelheit.“ (Alle Zitate aus Ronald D. Laing: Phänomenologie der Erfahrung. A. d. Engl. v. Klaus Figge u. Waltraud Stein. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1969, S. 24.) – Wenn ich Texte wie diesen heute wieder lese, wundere ich mich sehr, dass mir damals ihr Predigtton gar nicht auffiel und -stieß.
Kreuzungen, Knochen
Tuesday, 03. January 2012Lyrik (1). Immer wieder kehre ich zu den Versen zurück, die mich mit achtzehn, neunzehn Jahren umwarfen. Als könnte ich an ihnen prüfen, ob ich mir treu geblieben bin? So singt die polnische Dichterin Wisława Szymborska 1957: „Vertraut mit den großen Räumen | zwischen Himmel und Erde | verlieren wir uns im Raum | zwischen Erde und Kopf. | Der Weg vom Leid zur Träne | ist interplanetarisch. | Unterwegs vom Trug zum Sein | ergraut unser Kinderschopf.“ Ja, ich empfinde die gleiche Verlorenheit – und in diesem Gefühl eine solche Nähe, zu der polnischen Dichterin und zu dem Jungen, der ich war, als ich diese Nähe und diese Verlorenheit zum ersten Mal spürte. Unsterbliche Gedichte können Wegmarken in der Zeit sein, wie Saurierknochen an Kreuzungen aufgepflanzt. Aber auf meinem Weg gibt es nur sehr wenige Marken dieser Art. Ich weiß nicht, ob ich das bedauern soll. (Wisława Szymborska: Den Freunden; in: Salz. A. d. Poln. v. Karl Dedecius. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1973, S. 94.)
Prozess-Ungeheuer
Monday, 02. January 2012Pünktlich zum Dickens-Jahr habe ich mit der Lektüre von Bleakhaus begonnen, in der Übersetzung von Gustav Meyrink und in einer wunderschönen, hundert Jahre alten dreibändigen Ausgabe des Verlags von Albert Langen in München. Man denke: noch mit Kustoden! Der Roman um die juristische Erbschaftsfehde Jarndyce kontra Jarndyce ist der neunte aus der Feder des produktiven Briten, entstanden zu Beginn seines fünften Lebensjahrzehnts. Schon im ersten Kapitel beeindruckt mich der Einfallsreichtum des Autors, wenn er die kaum glaubhafte Verschleppung des Urteils in diesem Prozess anhand überaus komischer Vergleiche und Maßstäbe deutlich werden lässt: „Der kleine Kläger oder Beklagte, dem man ein neues Schaukelpferd versprochen, wenn ,Jarndyce kontra Jarndyce‘ geschlichtet sein würde, ist darüber groß geworden, hat sich ein lebendes Pferd gekauft und ist in die andere Welt getrabt.“ (Bd. I, S. 11.) Nach dem wenig amüsanten Roman von Herrndorf verschafft meinem angeschlagenen Gemüt vielleicht, hoffentlich dieses wohl bei allem Sarkasmus unschuldig erheiternde Meisterwerk über menschliche Schwächen und Dummheiten den nötigen Ausgleich.
Sonntag, 1. Januar 2012
Sunday, 01. January 2012So verschieden die Jahresrückblicke auf 2011 ausfallen mögen und so unterschiedlich die gesetzten Akzente je nach Format und Perspektive sind, so einig sind sich die journalistischen Chronisten doch in einem Punkt: dass das vergangene Jahr durch eine außergewöhnlich hohe Ereignisdichte aus der Reihe fällt. Heribert Prantl bringt es in der SZ so auf den Begriff: „Aus diesem Jahr hätte man drei Jahre machen können; oder vier, oder noch mehr. Das Jahr 2011 war ein Jahr, in dem im März schon so viel passiert war, wie sonst im Dezember noch nicht passiert ist. Es war ein Jahr, in dem die Ereignisse sich überschlugen.“ (Das atemlose Jahr; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 302 v. 31. Dez./1. Jan. 2011/12, S. V2/1.) Diese Betrachtungsweise unterstellt allerdings, dass hierbei vernünftige Maßstäbe zur Bewertung der Relevanz von Ereignissen angelegt werden, was offenkundig nicht der Fall ist. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Naturkatastrophe in Japan mit dem anschließenden Supergau im Atomkraftwerk von Fukushima werden geradezu in einem Atemzug genannt mit dem Rücktritt des deutschen Verteidigungsministers von allen seinen Ämtern. Während die radioaktive Verseuchung der Umwelt im ersten Falle womöglich noch in Jahrtausenden mess- und spürbar sein wird, ist der Name des peinlichen Plagiators vermutlich in zehn Jahren schon nahezu vergessen. Wichtig für die Berichterstattung ist in Wahrheit, was die Zeitung für geeignet hält, den Abonnenten bei der Stange zu halten. Und insofern war das Jahr 2011 vielleicht ein sehr ertragreiches Jahr für die Medien, als es für jeden etwas in petto hatte – und das nahezu pausenlos. Allerdings rührte diese Kontinuität und Lückenlosigkeit des Berichtenswerten wohl auch daher, dass sich etliche Geschehnisse außergewöhnlich lang hinzogen. Die arabischen Aufstände gegen hartnäckig widerstrebende Despoten oder der langwierige Kampf gegen die Kernschmelze in Japan waren (und sind teils noch) ebensolche Dauerbrenner wie die Bemühungen zur Rettung des Euro. In meinen Augen gab es 2011 eigentlich nur ein – dazu noch eher symbolisches – Ereignis von historischer Bedeutung: die Geburt des siebenmilliardsten Menschen. Bezeichnenderweise wurde aber über den Tod einzelner Menschen, wie von Kim Jong Il oder Johannes Heesters, ausführlicher berichtet als über die weiter exponentiell voranschreitende selbstzerstörerische Vermehrung unserer Art.
Langeweile. Nichts …
Saturday, 31. December 2011Zum Abschied von diesem Jahr muss ich meine größte, wichtigste Entdeckung dieses Jahres noch einmal zum Ausdruck bringen: die immer und überall unterschätzte destruktive Macht im Menschen, die ihn entweder vernichtet oder zu schrecklichen Taten treibt, die ihn über seine Verhältnisse leben, die Natur und damit seine Lebensgrundlagen zerstören lässt und deren so harmlos, schlicht, fade klingender Name da lautet: Langeweile! Natürlich bin ich nicht der Entdecker dieser unterschätzten und noch längst nicht ans Ende, oder besser: zu allen ihren Enden hin ausgedachten Erkenntnis. Zur Feier des Tages zitiere ich hier als einen frühen Gewährsmann Pascal: „Langeweile. Nichts ist dem Menschen unerträglicher als völlige Untätigkeit, als ohne Leidenschaften, ohne Geschäfte, ohne Zerstreuungen, ohne Aufgabe zu sein. Dann spürt er seine Nichtigkeit, seine Verlassenheit, sein Ungenügen, seine Abhängigkeit, seine Unmacht, seine Leere. Allsogleich wird dem Grunde seiner Seele die Langeweile entsteigen und die Düsternis, die Trauer, der Kummer, der Verdruß, die Verzweiflung.“ (Über die Religion und über einige andere Gegenstände (Pensées). A. d. Frz. v. Ewald Wasmuth. Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1978, S. 75.) – Aber wer verstünde mich, wenn ich bekennen würde, dass ich das neue Jahr 2012 einer genaueren Untersuchung der Langeweile, ihrer Ursachen und Folgen widmen will?
Schwindende Verstörung
Friday, 30. December 2011Manchmal erweist es sich als Vorteilhaft, noch ein paar mehr Bücher griffbereit zu haben als den engsten Kreis der dringlichst benötigten, die Tausendschönsten. In den letzten Tagen war ich wieder mit der bibliographischen Erfassung von Serien für mein Antiquariats-Angebot befasst, genauer gesagt mit der Reihe der Suhrkamp-Taschenbücher, die seit 1971 erscheinen. Heute stieß ich dabei in einem Tagebuch von Peter Handke auf Notizen aus seinem Pariser Krankenhausaufenthalt vom März 1976. Obwohl mich Handkes manierierte Prosa noch nie recht begeistern konnte, las ich doch diese Seiten mit einigem Interesse, Stellenweise gar mit Anteilnahme. Die Erklärungen für diese unübliche Empathie sind schnell bei der Hand. Einmal stehe ich, gerade acht Wochen nach meiner Klinikentlassung, noch immer unter dem wenngleich verblassenden Eindruck dieses Erlebnisses und finde in Handkes Schilderungen manche Ähnlichkeit zu eigenen Beobachtungen und Empfindungen. Hinzu kommt, dass ein mir sehr nahestehender Mensch neuerdings von dem gleichen Leiden betroffen ist, das zu Handkes Klinikeinweisung geführt hat. Ja, es ist seltsam, wie fremd man empfindet, wenn man aus einer solchen Angst zurück in die dumpfe Sorglosigkeit gestoßen wird: „An diesem schönstmöglichen Tag der Welt gehe ich, aus dem Krankenhaus weggelassen, umher mit dem Gefühl(?), ich hätte nichts versäumt, wenn ich jetzt tot wäre.“ Mir fiel heute auf einem gewohnten Weg, den ich wenige Tage nach meiner Entlassung beim erstmaligen Beschreiten voller Entzücken neu sah, dieses nun uneinholbar verlorene Glück wieder ein. Ein solcher Verlust! Und ich erinnere mich – aber auch das ist vergangen – an dieses verschobene Verhältnis zu den fremden Mitmenschen in den Straßen, wie es Handke offenbar ähnlich (und doch ganz anders) empfand: „Seltsam: daß ich es unter den jungen, übermütigen, ausgelüfteten, luftigen, lebenslustigen Menschen am Boulevard nicht mehr aushielt – und daß ich mich hier, im Park, unter Älteren, Müderen, Frauen mit Pudeln, Sitzenden auf den verrosteten grünen Eisenstühlen, Kindern, so viel wohler fühle!“ (Das Gewicht der Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1979, S. 90 f.) Kann man denn von einer solchen Erschütterung nicht mehr bewahren als ein paar spröde Zeilen und ein blasser werdendes Erinnern?
Lebens Zenit
Thursday, 29. December 2011Ein anderer Mann, für den ich früh allerhöchste Verehrung empfand und der im Laufe der Jahre nur immer noch in meiner Achtung stieg, ist Bertrand Russell. In seiner Autobiographie beschreibt er, wie er im Alter von gerade einmal 28 Jahren seinen großen intellektuellen Durchbruch erlebte: „Meine Empfindungen ähnelten denen, die einen überkommen, wenn man im Nebel einen Berg erklettert, bei Erreichung des Gipfels den Nebel plötzlich weichen und das Land auf fünfzig Kilometer im Umkreis klar vor sich liegen sieht.“ Solche Gefühle hatte ich ebenfalls, aus vermutlich viel geringerem Anlass, in meiner Kindheit. Allerdings waren sie nicht Ergebnis einer geistigen Anstrengung, sondern überkamen mich eher impulsiv. Plötzlich begriff ich etwa, dass alle Dinge immer herabfielen, wenn ich sie losließ, und dass dies doch eigentlich nicht selbstverständlich war. Oder ich entdeckte, dass mein Spiegelbild das gleiche tat wie ich, und zwar exakt gleichzeitig. Aber natürlich meint Lord Russell hier einen viel erhabeneren Erkenntnisschritt, wenn er fortfährt: „Intellektuell war der September 1900 der Höhepunkt meines Lebens. Ich sagte mir dauernd selbst vor, jetzt endlich hätte ich etwas geleistet, was der Mühe wert war, und auf der Straße meinte ich, ich müsse jetzt ganz besonders aufpassen, nicht überfahren zu werden, ehe ich das zu Papier gebracht habe.“ Genau diese Sorge ist mir ebenfalls vertraut. Sie betraf gewisse Einsichten, die mich unter dem Einfluss psychotroper Substanzen beschlichen hatten. Allerdings genügte es mir, sie einigen vertrauten Mitmenschen mündlich mitzuteilen, was ich heute sehr bedaure. Der absolut nüchterne Bertrand Russell hingegen war so viel klüger und fleißiger als ich: „Anfangs Oktober machte ich mich daran, The Principles of Mathematics niederzuschreiben, wozu ich schon mehrfach erfolglose Versuche unternommen hatte. […] Während der Monate Oktober, November und Dezember schrieb ich jeden Tag meine zehn Seiten, so daß das Manuskript am letzten Tag des Jahrhunderts beendet war […].“ (Autobiographie I. 1872-1914. A. d. Engl. v. Harry Kahn. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1977, S. 223 f.) Nein, solch edlen Höhepunkt meines Lebens, noch dazu mit präzisem Timing zur Jahrhundertwende, vermag ich nicht vorzuweisen. Ich bin wohl eher ein Mensch der Ebene denn ein Gipfelstürmer. Mir reicht es schon, wenn ich alltäglich einen kleinen geistigen Hüpfer machen kann. Und wenn es mir dann noch gelingt, ihn leidlich auf die Zeile zu bringen, dann bin ich froh.
Common Little Man
Wednesday, 28. December 2011Kaum jemand dürfte in seinen Jugendjahren einen solch übermäßigen Verschleiß von Vorbildern, Idolen, Vaterfiguren gehabt haben wie ich. Zwischen meinem sechzehnten und meinem neunzehnten Lebensjahr wechselte ich meine Hausgötter wie die Socken, meist trug ich mehrere gleichzeitig nebeneinander oder übereinander, teils in beißender Kombination. Und so innig ich jeden von ihnen liebte und verehrte, wenn ich gerade in frischer Liebe entbrannt war, so abgeschmackt und peinlich fand ich ihn bald darauf, wenn ich seine Schwächen und Begrenzungen erkannt zu haben meinte. Die Halbwertzeiten dieser Idolatrien wurden immer kürzer, meine Ansprüche an die Exzentrik meiner Vordenker immer strenger. – Wenn ich heute an diese Zeit der Unreife zurückdenke, ist Scham das vorherrschende Gefühl. Aber ein paar Namen kann ich heute noch nennen, ohne rot zu werden. Einer von ihnen ist Wilhelm Reich, von dem ich mich so unmittelbar angesprochen und durchschaut fühlte wie von kaum einem seiner Konkurrenten: „Ich sage dir, kleiner Mann: Du hast den Sinn für das Beste in dir verloren. Du hast es erstickt, und du mordest es, wo immer du es in anderen entdeckst, in deinen Kindern, deiner Frau, deinem Mann, deinem Vater und deiner Mutter. Du bist klein und willst klein bleiben, kleiner Mann.“ (Rede an den kleinen Mann. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1984, S. 31.) Bei aller Bizarrerie seiner Wolkenkanonen und Orgonakkumulatoren scheint mir Reich noch heute geadelt durch den Hass und die Verfolgungen, dener er seitens seiner Gegner ausgesetzt war. Wozu diese Hartnäckigkeit, dieser Vernichtungszwang gegen einen harmlosen Irren? Und noch heute komme ich nicht darüber weg, wie klar er selbst seinen Untergang prophezeit hat, ohne darüber doch jede Hoffnung aufzugeben: „Was immer nun du mir angetan hast oder noch antun wirst, ob du mich als Genie verklärst oder als Wahnsinnigen einsperrst, ob du mich nun als deinen Retter anbetest oder als Spion hängst oder räderst, früher oder später wirst du aus Not begreifen, daß ich die Gesetze des Lebendigen entdeckte und dir das Handwerkszeug gab, dein Leben mit Willen und Ziel zu lenken, wie du bisher nur Maschinen lenken konntest.“ (Ebd., S. 124.)
Krieg verbindet
Tuesday, 27. December 2011Am 30. März 1974 schreibt Peter Weiss, unterwegs zu Recherchen in Spanien, in sein Notizbuch: „Es gibt immer viel mehr, was die Menschen verbindet, als was sie trennt. Warum dann Krieg? Immer viel mehr verständnisvolle Menschen als rohe. Warum dann diese Destruktion?“ (Notizbücher 1971-1980. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981, S. 298.) Ich stutze. Stimmt das? Wie soll ich den Wahrheitsgehalt dieser Sätze prüfen? Ich vergleiche ihren Gehalt mit meinen eigenen, ganz persönlichen Erfahrungen. Wenn ich fremde Menschen kennenlerne, dann empfinde ich sie vielmehr immer als haupsächlich anders. Nach Gemeinsamkeiten, die mich mit ihnen verbinden, muss ich lange suchen. Und wenn ich mich bemühe, mich ihnen verständlich zu machen, dann gelingt mir dies eher selten. – Aber vielleicht war Weiss ja ein ganz anderer Mensch als ich? Ich muss sogar gestehen, dass ich nahezu täglich, wenn ich mich unter die Menschen mische, beim Einkaufen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder einfach auf der Straße, eine Rohheit wahrnehme, die mich verschreckt und die mein Verständnis überfordert. Allerdings sehe ich auch, dass die Menschen durch viele Gemeinsamkeiten einander immer ähnlicher zu werden scheinen; mir jedoch werden sie so immer fremder und bedrohlicher. Kann es sein, dass der Schriftsteller in seinem schwedischen Exilidyll ganz weltfremd geworden war? Mögen immerhin seine subjektiven Empfindungen von den braven Mitmenschen wahrhaftig gewesen sein – aber wie kann ein Intellektueller, der vom dialektischen Materialismus geprägt war, die Wirklichkeit des Krieges aus der Perspektive subjektiver Empfindungen in Frage stellen? Sehr sonderbar.
[wird fortgesetzt]
Monday, 26. December 2011Seit einer gefühlten Ewigkeit wartete ich auf die Fortsetzung von Wolfgang Herrndorfs Blog Arbeit und Struktur. Der letzte Eintrag war vom 19. November und berichtete in vier Sätzen von einem Besuch des Films Cheyenne mit Kathrin Passig und einem anschließenden traurigen Gespräch über gemeinsame Urlaube. Das letzte Wort war „gescheitert“. Tag für Tag klappte ich in den vergangenen Wochen, gleich nachdem der Rechner hochgefahren war, Kapitel Einundzwanzig auf, immer wieder dieser letzte Absatz mit Cheyenne und „gescheitert“. Darunter die Ankündigung, Versprechung: „[wird fortgesetzt]“. Dabei fürchten wir treuen Besucher dieser Seite doch alle, dass irgendwann hier noch für eine solche gefühlte Ewigkeit „[wird fortgesetzt]“ stehen wird, obwohl der Blogger seinem Glioblastom erlegen ist. Ich ertappte mich dabei, sicherheitshalber immer mal wieder auf Wikipedia nachzuschauen. Nein, er lebt noch! Heute nun kamen gleich vier Tagesnotizen, vom 20. bis zum 25. November, für die eigens ein neues Kapitel Zweiundzwanzig aufgemacht wurde. Wichtigste, erfreuliche Neuigkeit: H. erfährt im Abschlussgespräch nach seiner letzten Bestrahlung vom Arzt, dass er noch zehn bis zwölf Monate Aufschub erwarten darf, bis zum nächsten Rezidiv. – Ich fragte mich eben, ob ich hier überhaupt schon von meiner zweiten, intensiveren Begegnung mit dem Werk des Wolfgang Herrndorf berichtet habe. Die Suche nach seinem Nachnamen ergab aber nur einen einzigen Beleg. Vor fast genau einem Jahr hörte ich im Rundfunk eine überaus positive Besprechung seines Bestsellererfolgs Tschick, der mir aber erst durch einen besonderen Zufall so merkwürdig wurde, dass ich ihn wenig später kaufte und dann auch las. Die beiden jugendlichen Ausreißer brechen dort in eine gelobte Fremde auf, für die sie mangels konkreter Vorstellungen den Namen Walachei einsetzen. Und eben diese Walachei tauchte auch in einer 200 Jahre alten Ausgabe der Berliner Abendblätter auf, die anlässlich des bevorstehenden Kleist-Jahres gerade Tag für Tag online publiziert wurde und die ich gleichzeitig las. Ich wollte die Stelle bei Tschick genau zitieren und kaufte darum später das Buch. Nun lese ich Herrndorfers neues Buch Sand, über das ich erst urteilen will, wenn ich damit durch bin. – Sein Weblog jedenfalls ist stellenweise großartig, voller Tragik und Humor!
Sammlers Bescheidenheit
Sunday, 25. December 2011In den letzten Jahren habe ich das Interview als eine vollwertige literarische Kunstform entdeckt; was natürlich keineswegs bedeutet, dass nun Interviews, wie sie mit den langweiligen Prominenzen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltungsindustrie geführt und alltäglich in den Zeitungen und Magazinen veröffentlicht werden, per se schon Kunstwerke sind, die die Beachtung einer gebildeten Leserschaft und die Beurteilung der professionellen Kritik verdienten. Aber es gibt doch in diesem ohrenbetäubenden Allerweltspalaver immer wieder einmal Kleinodien des Gesprächs, der Befragung, die es verdienen, in eine Textsammlung der literarischen Meisterwerke aller Gattungen und Sprachen aufgenommen zu werden. Einige Interviews des im April dieses Jahres gestorbenen André Müller sind darunter; manche in der New Yorker Literaturzeitschrift Paris Review erschienene Autorengespräche; und viele verstreut veröffentlichte Einzelstücke, die ich hier und dort im Laufe von Jahrzehnten zusammengetragen habe, eine Sammlung, die es dringend nötig hat, gesichtet und ausgedünnt zu werden. Unbedingt würde ich die Gespräche hinzurechnen, die Osvaldo Ferrari 1984 bis 1986 in Genf mit Jorge Luis Borges geführt hat. Leider gibt es bisher nur eine Auswahl in deutscher Übersetzung (von Gisbert Haefs). Natürlich müssten aber auch Interviews mit jenen Unbekannten vertreten sein, die weniger durch ihren erlauchten Geist, durch ihre Beiträge zu Kunst und Wissenschaft unser Interesse verdienen, sondern allein durch das wahrhaftige Bekenntnis zu ihrem einfachen Leben, mit einem Wort: durch ihre Authentizität. Hier denke ich an Hubert Fichtes Interviews aus dem Palais d‘Amour oder die langen Interviews per brieflicher Befragung, die Paul Moor mit Jürgen Bartsch im Gefängnis geführt hat, um nur zwei Beispiele zu nennen, die mich nachhaltig geprägt haben. Natürlich gehören auch Verhöre hinzu, die Befragungen von Tätern und Zeugen vor Gericht. Zuletzt würde vielleicht ein tausendstimmiges Oratorium aus Fragen und Antworten dabei herauskommen, zwischen Himmel und Hölle, ohne Anfang und Ende. Alles Gerede mündete dann in diesen einen polyphonen Gesang, wie Mallarmé erklärt hat: „Tout au monde existe pour aboutir à un livre“, was Borges 1951 zum Motto seines Essays Vom Bücherkult machte, woran ihn Ferrari in einem seiner Interviews erinnerte. (Vgl. Lesen ist denken mit fremdem Gehirn. Zürich: Arche Verlag, 1990, S. 89.) – Vielleicht hätte ich mich doch mit dem ehrbaren Handwerk des Anthologisten bescheiden sollen, statt mich dazu berufen zu fühlen, selbst zu schreiben?
Herr und Frau N.
Saturday, 24. December 2011Vielleicht ist ja die zukunftsträchtigste Ausbeute des zu Ende gehenden Jahres unsere gemeinsame Idee zu einem Figurentheater. Sie wurde erst vor wenigen Wochen auf einem Waldspaziergang geboren. Der Plan sieht vor, dass nur zwei Puppen, Herr N. und Frau N., auf der Bühne agieren; ein älteres Ehepaar, das uns beide verkörpert, aber natürlich ins Maskenhafte übertrieben. Wir entwickeln eine Vielzahl von kurzen Szenen, die nahezu beliebig zusammengestellt werden können. Vorstellbar ist, dass es Szenen für reines Kinderpublikum und solche für Erwachsene gibt, aber auch einige, die sich für eine gemischte Zuschauerschar eignen. Die Kulisse ist immer dieselbe: das Interieur einer guten Stube mit Koch- und Schlafgelegenheit. Ein Fenster öffnet den Blick zur Außenwelt. Die Puppen sollten vielleicht Marionetten sein, weil diese mehr Bewegungsmöglichkeiten bieten als Hand- oder Stabpuppen. Damit stehen wir allerdings rein technisch vor einer anspruchsvollen Aufgabe, denn auf diesem Feld sind wir absolute Neulinge. – Eben da ich dies schreibe fällt mir ein, dass wir unsere Szenen natürlich auch peu à peu bei YouTube online stellen könnten. Die Aufgabenverteilung entspricht unseren Kompetenzen. Ich entwickle die Dramaturgie, schreibe die Dialoge, meine Gefährtin ist für die Puppen, die Kulissen, das Interieur zuständig. Aber natürlich wird das gesamte Projekt in erster Linie ein Gemeinschaftswerk, bei dem wir uns gegenseitig anregen und voranbringen. Ach, welch zauberhafter Traum!
Zufall fleischgeworden
Friday, 23. December 2011In den letzten Wochen plagte mich erneut der Gedanke, nun vielleicht doch ein wenig Zeit darauf zu verwenden, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Aber warum? Weil ich zufällig wieder einmal in dem so sehr erheiternden Buch von Luke Rhinehart gelesen hatte, das ich vor 37 Jahren entdeckte und das meinen Lebensgang wenn nicht bestimmt, so doch in einem kleinen, aber feinen Moment beeinflusst hat. Und dort steht gleich im Vorwort der Satz: „Ich erzähle meine Lebensgeschichte aus jenem bescheidenen Grund, der bisher noch jeden Autobiographen zur Arbeit gedrängt hat: der Welt zu beweisen, daß ich ein großer Mann bin.“ (Der Würfler. A. d. Am. v. Franz Scharpfender. Wien, München, Zürich: Verlag Fritz Molden, 1972, S. 10.) Na, so bescheiden wie Rhinehart bin ich gerade nicht. Ich würde verlangen, dass ich mir durch das Aufschreiben meiner Lebensgeschichte selbst beweisen könnte, mein Leben nicht verfehlt zu haben. Und damit ich mir bei diesem Versuch nicht fortwährend etwas in die Tasche lügen könnte, würde ich mir einen unbefangenen und unbestechlichen Leser vorstellen, der schließlich über diese Frage zu entscheiden hätte. Keinen geringeren als dich.
Haufen Schlamm
Thursday, 22. December 2011Wie erscheint der Tod in Flauberts vielleicht größtem Roman, Bouvard et Pécuchet aus dem Jahr 1881? Ganz richtig, in Gestalt eines Hundes. Die berühmte Stelle hat es mir schon damals angetan, als ich das Buch zum ersten Male las, vor genau einem Vierteljahrhundert. Damals hatten wir noch keinen Hund. Mein Verhältnis zu Hunden war gestört, ich hatte Angst vor ihnen, wenn ich ihnen auf der Straße begegnete. Handelte es sich um besonders große Tiere, dann wechselte ich nicht selten den Bürgersteig, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Über Hundebesitzer, die ihr Tier nicht an der Leine führten, konnte ich mich sehr erregen. Einem toten und gar verwesenden Hund bin ich hingegen bisher noch nicht begegnet, wie es den Herren Pécuchet und Bouvard einst widerfuhr: „Kleine Schäfchenwolken standen am Himmel, die Glöckchen des Hafers wiegten sich im Wind, an einer Wiese murmelte ein Bach, als plötzlich ein furchtbarer Gestank sie stehenbleiben ließ, und sie sahen auf dem Kies zwischen Brombeergestrüpp den Kadaver eines Hundes liegen. Seine vier Glieder waren vertrocknet. Der weitgeöffnete Rachen entblößte unter bläulichen Lefzen elfenbeinweiße Fangzähne; an Stelle des Bauches war da ein erdfarbener Haufen Schlamm, der zu beben schien, so lebendig wimmelten darunter die Würmer. Sie kribbelten hin und her, von der Sonne beschienen, von Fliegen umsummt, in diesem unerträglichen Geruch, diesem wilden, gleichsam verzehrenden Geruch.“ (Gustave Flaubert: Bouvard und Pécuchet. A. d. Frz. v. Erich Marx. Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, 1959, S. 303.) Längst haben wir nun unseren Hund. Sie ist schon alt. Vielleicht sehr bald wird sie sterben. Aber den Würmern und Fliegen wollen wir sie nicht überlassen.
typographophobie tödlich
Wednesday, 21. December 2011„[…] ich sage die wahre geschichte von der anderen seite dem inneren entrissen mit vertauschten rollen ohne weiteren aufschub sie stießen mich in den schrank im zweiten stock ich spreche von uns in eine kiste schlugen mich grün und blau ansichtssache wie es hätte anfangen sollen in meinen kurzen hosen eines kleinen jungen ich spreche von mir schschsch es ist sommer wieder lügen wir müssen den jungen verstecken schschsch flüstert mutter unter tränen es tut weh ständig zu verlieren […]“ (Raymond Federman: Die Stimme im Schrank. A. d. Am. v. Peter Torwerk unter Mitarb. v. Silvia Morawetz. Hamburg: Kellner, 1989.) Dies ist immer der Ausgangspunkt auch für mich gewesen, das verwöhnte Jüngelchen aus den fetten Fünfzigern. Es hat aber von da an noch ein paar Jährchen gedauert, bis ich begriff, woher die Migräne kam. Bis ich aus der Kiste kriechen und den Schrecken hinterm schönen Schein von Geborgenheit erkennen konnte. Ja, es ist Ansichtssache, wie ich anfangen sollte. Ich suche noch immer das rechte Beginnen. Dieses Blog ist nur ein weiterer meiner vielen Umwege, eine erneute meiner zahllosen Ausreden. So sitze ich im Parterre und starre aus dem Fenster in den stillgelegten Haushaltswarenladen, während mich aus dem Hintergrund E2-E4 von Old Lazy Bones Manuel Göttsching am Leben hält.
Heinrich Funke: Das Testament (XXVI)
Tuesday, 20. December 2011Erste Frage: Wer oder was ist hier mit Eros gemeint? Wikipedia bietet uns drei Alternativen an. Gemeint sein könnte im Sinne der Mythologie der griechische Gott der Liebe, von dessen Namen das Wort ursprünglich herstammt; im Verständnis der Philosophie seit Platon der Drang nach Erkenntnis und schöpferischer geistiger Tätigkeit; und schließlich nach Sigmund Freud der Lebenstrieb, als einer der beiden Haupttriebe in seiner Psychoanalyse (der andere ist hiernach Thanatos, der Todestrieb). Das Bildmotiv, die Sexbombe Marilyn Monroe in der berühmten Szene über dem Lüftungsschacht, legt immerhin nahe, dass hier am ehesten noch der griechische Gott gemeint sein soll, zumal die Liebe, die er erweckt, laut Wikipedia im engeren Sinne eine „begehrliche“ ist. Nun könnten wir der Einfachheit halber statt von Liebe dann hier gleich von Begierde sprechen; oder, noch unverblümter, von Geilheit. Ob wir aber sicher sein können, dass die unschuldigen Griechen da ähnlich differenzierten wie wir, nach vielen Jahrhunderten Christentum? Man sagt, dass der Gott Eros mit kleinen Flügelchen dargestellt wurde, habe seinen Grund darin, dass die erotische Liebe schon immer als flüchtig empfunden wurde – etwa deshalb, weil die körperliche Attraktivität der Liebenden mit dem Alter schwindet; oder weil sich ein Überdruss einstellt, der zu Untreue verführt – nämlich auf dem Weg über die Empfänglichkeit für weitere Pfeile des Verführers. Hier kann ich mir aber die zweite Frage nicht verkneifen: Was verspricht denn eigentlich Eros? Das muss uns der Künstler verraten, denn meine Quellen (Hesiod und Ranke-Graves) geben dazu nichts her. Und wenn wir es dann wissen, können wir vielleicht auch verstehen, warum Eros sein angebliches Versprechen nicht halten kann. Das Versprechen von Marilyns schönen Beinen ist immerhin bekannt: eine lustvolle Begegnung im Bett. Dass sie dieses Versprechen mindestens zeitweise halten konnte, ist jedenfalls – soweit ich weiß – biographisch verbürgt.
Verklemmte Tür
Monday, 19. December 2011Auf seiner Polenreise im Herbst des Jahres 1924 kam Alfred Döblin auch nach Lublin. Dass er überhaupt eine solche Rundreise unternahm, darf verwundern, denn eigentlich hielt er, mir darin sehr ähnlich, vom Reisen gar nichts. Dass das Reisen bilde nannte er einen törichten Gemeinplatz, durch nichts belegt, weder durch eigene Erfahrung noch durch den Bildungsstand der Vielreisenden. Ich applaudiere! Dennoch lese ich seine Geschichten aus Polen teils mit großem Vergnügen, teils mit beträchtlichem Erstaunen, nahezu immer mit Gewinn. Was ihnen fehlt, das ist ein kleinster gemeinsamer Nenner des Themas, vielleicht auch ein stilistischer Bogen, der sich über allem wölbte, jedenfalls irgendetwas, das dem Buch die gewisse Geschlossenheit gäbe, die der Leser doch erwartet, wenngleich vielleicht nur aus alter Gewohnheit? Aber in Lublin, ja, da entdeckte ich nun etwas, das mich doch gegen das Buch einnahm. Döblin erzählt hier die Geschichte von seinem Aufenthalt in einem, „wie man sagt“, guten Hotel. „Zu den erstaunlichsten Dingen in diesem Hotel gehört meine Tür.“ Und nun erzählt er in Begriffen und Einzelheiten von der Besonderheit dieser Zimmertür, die sich verschließen lässt, aber nicht immer öffnen und beinahe nie ohne Mühen und Sorgen; erzählt dies umständlich und mit einer unterschwelligen Bedeutungslast versehen, dass man meint, dies müsse unbedingt von Franz Kafka stammen. Und so es denn nicht von diesem direkt gestohlen wurde, dann doch immerhin unverschämt nachgeäfft. Man bedenke, gerade in diesem Jahr war Kafka gestorben, im Wesentlichen unerkannt, aber doch immerhin einem Kreis von Kennern bekannt, wenn noch nicht durch seine Romane, so doch durch einen guten Teil seiner Erzählungen. Alfred Döblin wird diese Erzählungen gekannt haben. Ich will ihm auch nicht vorwerfen, dass er sich dem Einfluss dieses so viel Stärkeren nicht hat entziehen können, ihm willfahrte bis ins Imitat. Aber es ist schon ein starkes Stück, wenn man Stellen liest wie diese, über das Aufschließen der Zimmertür: „Das Schloß […] war völlig verstockt, von einer enormen Tiefe, durch die ganze massive Tür durch. Man durchbohrte mit dem Schlüssel die ganze Tür, stieß ihr mitten ins Herz und – kam innen heraus. Gerade das war falsch. Man mußte drin bleiben. Die Tür ließ dem Angreifer ruhig das Behagen, zuzustoßen, und schon saß er auf. Man mußte bei einer gewissen Tiefe haltmachen. Bei welcher: das war eben das Geheimnis. […] Ich betastete sorgfältig, zärtlich das Innere des Schlosses. Denn es hatte keinen Sinn, hier grob zu werden. Wie ein Tier ließ das Schloß alles mit sich machen. Ich suchte, gespannt, sehr höflich, scheinheilig. Endlich fand ich die fragliche Tiefe, drehte herum, einmal, zweimal, – manchmal [mein Herz erstarrte] dreimal, viermal, fünfmal. Es konnte immer so weiter gehen; ich würde nie ermitteln, wann ich aufzuhören hatte.“ (Alfred Döblin: Reise in Polen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1993, S. 163 f.) – Ins wirkliche Lublin musste der Autor nicht reisen, um dies schreiben zu können; aber vermutlich in Gedanken nach Prag. Reisen bildet nicht, sehr wohl aber Lesen.
Sonntag, 18. Dezember 2011
Sunday, 18. December 2011Vierter Advent. Ein furchtbar unfruchtbarer Tag, der über nutzlosem Streit, schlechter Laune, langer Weile und miesem Wetter verraucht und verstreicht; wie so viele Sonntage seit ich denken kann, denen dieser zum Verwechseln ähnlich sich anfühlt, aussieht und schmeckt; nämlich räudig, hässlich und bitter. Je älter ich aber werde und um so knapper die verbleibende Zeit, desto wütender werde ich. Und hilfloser. Wären alle Tage wie dieser, es gäbe kein Halten mehr.
Kullernde Kartoffeln
Saturday, 17. December 2011Manche Reiseberichte von Journalisten der „Siegermächte“ durchs demolierte Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden hierzulande in deutscher Übersetzung erst mit großem zeitlichen Abstand zum grausigen Geschehen veröffentlicht. Vor die Aufarbeitung haben die Götter die Verdrängung gesetzt! Der Schwede Stig Dagerman war mir zuerst 1977 durch sein Hörspiel Der Entdeckungsreisende aufgefallen. Ich las dann seine Erzählungssammlung Spiele der Nacht mit der atemberaubenden Miniatur Ein Kind töten. Deshalb musste ich zugreifen, als mir im Ramschkasten vor Baedeker auf der Kettwiger Straße Anfang der 1980er Jahre seine zwölf Reportagen aus dem verwüsteten Trizonesien vom Herbst 1946 in die Finger fielen. Als ich neulich wieder einmal in diesem leider etwas schlampig edierten Bändchen blätterte, stieß ich auf folgende Episode, die durch ihre filmreife Tragikomik beeindruckt. An einer stark frequentierten Brücke in Hamburg verkauft ein fliegender Händler ein Kartoffelschälmesser. Er findet wenig Zuspruch, denn Kartoffeln sind schließlich Mangelware. Vor diesem Hintergrund ereignet sich nun folgendes Missgeschick: „Eine kleine alte Tante mit einem großen Sack Kartoffeln hat es gerade in dem Augenblick geschafft, auf das Trittbrett der Bahn zu gelangen, als sich der Wagen in Bewegung setzt. Ihr Sack kippt um, die Schnur geht auf und die Alte schreit. Als der Wagen an uns vorbeirollt, beginnen die Kartoffeln gegen die Brückenführung zu trommeln. Im Gedränge um den Verkäufer entsteht plötzlich eine heftige Bewegung, und als die Straßenbahn die Brücke passiert hat, steht der Verkäufer beinahe allein am Geländer, während sich sein Publikum zwischen hupenden Armeefahrzeugen und kriegsbemalten Volkswagen um Kartoffeln schlägt. Schulbuben füllen ihre Ranzen, Arbeiter stopfen ihre Taschen voll, Hausfrauen öffnen ihre Handtaschen für Deutschlands meist gesuchte Frucht.“ (Stig Dagerman: Deutscher Herbst ’46. A. d. Schwed. v. Günter Barudio. Köln-Lövenich: „Hohenheim“-Verlag, 1981, S. 34.) – Zufällig zeigte ARTE nun den 2009 nach dieser Buchvorlage aus historischen Archivaufnahmen zusammengesetzten Dokumentarfilm 1946, Herbst in Deutschland von Michaël Gaumnitz. Und erstaunlicherweise gibt es darin eine Szene mit einem sehr ähnlichen Malheur, wenngleich dabei die Kartoffeln von einem Lkw herunterfallen. Könnte es etwa sein, dass Dagerman einige der von ihm beschriebenen Ereignisse gar nicht im wirklichen Leben, sondern bloß auf der Leinwand gesehen hat? Etwa in der Wochenschau Welt im Bild, die nach dem Zweiten Weltkrieg von der US-amerikanischen und britischen Besatzungsmacht in den intakten Münchner Bavaria-Studios produziert und vor den Filmaufführungen gezeigt wurde? – Und wenn! Würde es der Qualität und Authentizität von Dagermans „Augenzeugen“-Berichterstattung Abbruch tun?
Trockener Applaus
Friday, 16. December 2011Als Routineleser entwickelt man im Lauf der Jahrzehnte eine Dickfelligkeit, da muss schon Unerhörtes zwischen zwei Deckeln geschehen, damit man ein Buch nach ein paar Seiten aus der Hand legt und sagt: ,Puh! Das trifft mich ja ohne Unterlass ein ums andere Mal mitten ins Herz und mitten ins Hirn. Wie kann denn solch eine Übereinstimmung möglich sein?‘ Zuletzt widerfuhr mir das mit den Lektürenotizen von Gerhard Amanshauser, wo mir gleich zu Anfang mehrere meiner Hausgötter – Paul Scheerbart, Oskar Panizza, Fritz Mauthner – begegneten. Nun sind das ja nicht eben Allerweltsnamen, die einem alle Nasen lang in den Feuilletons begegnen. Aber um wie viel mehr musste mich entzücken, dass ich auch in den Antipathien Übereinstimmungen entdeckte, wie etwa gegen Thomas Bernhard, dem A. treffend einen „Manierismus des Schimpfens“ vorhält; oder gegen Peter Handke, dessen Künstler-Pose ich bereits in den 1970er Jahren affektiert fand, heute aber geradezu degoutant nennen muss. A. zitiert einen bekannten Ausspruch Handkes, der es „ein sicheres Zeichen“ nannte, dass einer „kein Künstler“ sei, wenn er das „Gerede von der ,Endzeit‘“ mitmache. Dieses Notat Handkes (aus Phantasien der Wiederholung von 1983) fand schon damals verschiedentlich Widerspruch, so des wackeren Wolfgang Hildesheimer, der es 1986 in einer Kritik in der Zeit schlicht „unverständlich“ nannte. Das wäre mir indes noch zu viel der Rücksichtnahme. Viel besser passt und so viel hellsichtiger ist A.s Verdikt von der „Tugendpest“, die sich in solchem Selbstverständnis des lobpreisenden Künstlers, des edlen, über alle schnöde Endlichkeit erhabenen Dichters kundtue. – Zu der hochgemuten Hymne des Novalis, zitiert nach den Paralipomena zu ,Die Lehrlinge zu Sais‘ vom Spätsommer 1798, die da lautet: „Der Mensch hat immer symbolische Philosophie seines Wesens – in seinen Werken und seinem Thun und Lassen ausgedrückt – Er verkündigt sich und sein Evangelium der Natur. Er ist der Messias der Natur“ … zu dieser Hymne auf das Wesen Mensch und des Menschen Wesen aus besseren Zeiten merkt A. bitter an: „Ein vermutlich mißlungenes Wesen, vor kurzer Zeit aus unglücklichen Zufällen entstanden und jüngst von einer seuchenartigen Vermehrung betroffen, die zu seinem baldigen Untergang führen muß, hält sich für den ,Messias der Natur‘. Allenfalls kann es noch den Titel ,Henker der Natur‘ für sich beanspruchen.“ – Ebenso schnöde wie wahr! (All dies gefunden und nachempfunden auf den ersten paar Seiten von Gerhard Amanshauser: Sondierungen und Resonanzen. Heidenreichstein: Verlag publication PN°1 Bibliothek der Provinz, o. J. [2007], S. 25-33.)
[Gewidmet Günter Landsberger, dessen Hinweis vom 20. August 2008 ich die Bekanntschaft mit A. und dem zitierten Buch verdanke.]
Wunder satt
Thursday, 15. December 2011Wenn man meint, als Leser viel Zeit sparen zu können, indem man sich mit dem Lesen von Aphorismen begnügt, der tägliche Kalenderspruch als Buchersatz für den eiligen Sinnsucher sozusagen, dann liegt man natürlich falsch, denn auf diesem Felde verliert man die scheinbar gewonnene Zeit bei der Sisyphusarbeit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Schlechte oder doch schwache Sprichwörter und Redewendungen, Zitate und Sentenzen sind leider die Regel, von der es bloß zwei seltene Ausnahmen gibt: Aphorismen, die nicht den geringsten Makel haben und unmittelbar erleuchten; und solche, die einen geringen Makel haben und dadurch mittelbar erhellen. Zur ersten Kategorie zähle ich eine Vielzahl der Sudelbuch-Notizen des unübertrefflichen Lichtenberg; zur zweiten beispielsweise ein paar Bemerkungen aus den Notizen von Ludwig Hohl, wie etwa diese: „Mir ist durchaus klar, daß es keinen Gott gibt. – Aber es gibt die Welt, das ist schon verwunderlich genug.“ (Die Notizen oder Von der unvoreiligen Versöhnung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981, S. 733.) Hieran ist mancherlei fragwürdig. Um die Nichtexistenz von etwas zu behaupten, muss man sich zunächst ja dessen „Wesen“ auf irgendeine Weise vorgestellt haben, seine Form und Beschaffenheit etwa, oder seine abstarkten Merkmale. Und dieser Vorstellungsinhalt muss auch meinem Gesprächspartner, Zuhörer, Leser vertraut sein, um meine Negation von dessen Existenz überhaupt verstehen, bejahen oder vielleicht auch ablehnen zu können. Ersetzte man das Wort Gott in Hohls Satz durch das Wort Xyll, so wüsste niemand, was gemeint ist, es sei denn, es gäbe ein solches Wort in einer fremden Sprache und der Angesprochene beherrschte zufällig dieses Idiom. Nun handelt es sich bei dem Wort Gott insofern um einen besonderen Typ von Substantiven, als ihm kein konkretes Ding in der sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit entspricht, von bildlichen Gottesdarstellungen aus der Zeit vor Erfindung der Fotografie und Berichten über Gotteserscheinungen einmal absehen. Insofern gibt es Gott durchaus, so wie es zum Beispiel auch das Einhorn gibt, allerdings nicht als reales Lebewesen auf unserer Erde, sondern als Fabeltier, das der Phantasie unserer Vorfahren entsprungen ist. Indirekt lassen sich aus Hohls Aphorismus zwei Fragen ableiten: Warum hatten unsere Ahnen es nötig, zu der doch wahrlich vor konkreten Wundern nur so strotzenden wirklichen Welt mancherlei Hirngespinste hinzuzuerfinden, mit denen sie ihre Sagen, Märchen und Mythen bevölkerten? Und zweitens: Warum tun sich auch heute noch viele Menschen, vermutlich sogar die große Mehrzahl der Zeitgenossen gegen alle Vernunft schwer damit, auf diese Selbsttäuschung zu verzichten? Insofern ist Ludwig Hohls Aphorismus nicht übel: Es ist ja nicht das schlechteste Ergebnis, wenn ein schiefer Satz aus seinem Dunkel zwei gerade Fragen ans Licht bringt.
Verspätete Grasmücken
Wednesday, 14. December 2011Gegen Klassiker gleich welcher Art hat man mir in der Schule eine Aversion antrainiert, gegen die ich bis heute nur schwer ankomme, obwohl ich längst begriffen habe, wie unvernünftig solche prinzipiellen Vorbehalte sind. Und doch mag ich meinen rebellischen Büchner lieber als den Geheimrat von Goethe, stelle den von Selbstzweifeln zerfressenen Robert Walser turmhoch über Thomas Mann, wie mir die Aberkennung der Mündigkeit eher ein Testat von Genialität zu sein scheint als die Verleihung des Nobelpreises. Wenn ich Goethe dankbar bin, dann zuallererst dafür, dass er einen Kauz wie Johann Peter Eckermann zum Protokollanten seiner alltäglichen mündlichen Belehrungen gemacht hat; allerdings nicht etwa, weil ich dieses nur zu oft neunmalkluge und selbstgefällige Geschwafle des greisen Dichters nicht entbehren könnte, sondern weil Eckermann selbst durch seine Protokolle der Vergessenheit entrissen wurde. So findet sich eine der schönsten Stellen in den Gesprächen mit Goethe für mich unterm Datum des 26. September 1827, an dem die beiden ungleichen Männer per Kutsche einen Ausflug zum Jagdschloss Ettersberg unternahmen: „Hinter Lützendorf, wo es stark bergan geht und wir nur Schritt fahren konnten, hatten wir zu allerlei Beobachtungen Gelegenheit. Goethe bemerkte rechts in den Hecken hinter dem Kammergut eine Menge Vögel und fragte mich, ob es Lerchen wären. – Du Großer und Lieber, dachte ich, der du die ganze Natur wie wenig andere durchforscht hast, in der Ornithologie scheinst du ein Kind zu sein!“ Und nun tauschen Goethe und sein „treuer Eckermann“ plötzlich die Rollen, letzterer ist mit einem Mal der Belehrende, während das große Genie sich in seiner ganzen naiven Kenntnislosigkeit offenbart; und was man immer behauptet: dass Goethe einer der letzten Generalisten gewesen sei, der das Wissen seiner Zeit noch in allen Bereichen überblicken konnte, es erweist sich hier als eine romantische Verklärung. „,Hm!‘ sagte Goethe, ,Sie scheinen in diesen Dingen nicht eben ein Neuling zu sein.‘“ Man beachte den peinlich späten Zeitpunkt dieser Erkenntnis! Seit gut vier Jahren kannte Goethe seinen Adlatus nun bereits, sah und sprach ihn zeitweise täglich – und hatte doch von dessen phänomenalen vogelkundlichen Kenntnissen bis zu diesem milden Herbsttag nicht das Mindeste gewusst. (Vgl. Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Hrsg. v. Adolf Bartels. Buchschmuck v. Walter Heßling. Jena: Eugen Diederichs, 1908, Bd. II, S. 331 ff.)
Bleibende Blüten
Tuesday, 13. December 2011Das Werk eines Lyrikers darf aber, ungeachtet dessen, was ich vorgestern zum Thema Anthologien gesagt habe, in besonderen Fällen durchaus auch in einer eigenständigen Buchausgabe zur Geltung kommen. Anders gesagt, es gibt Dichter, die mehr als die sprichwörtliche Handvoll großer Gedichte zu Papier gebracht haben, auf die Gottfried Benn grundsätzlich das bewahrenswerte Lebenswerk eines jeden Poeten beschränken wollte. Schließlich sollten wir doch wenigstens auf diesem über alle Regeln erhabenen Felde der Literatur von Prinzipien verschont bleiben! Und so habe ich auch nicht nötig zu begründen, warum Entsorgt von Nicolas Born auf der ewigen Hitliste jener Gedichte sehr weit oben steht, denen ich niemals untreu werden kann, die ich liebe, die mein Herz immer wieder verstören. Und allein um dieses Gedichtes willen ist es nötig, alle Gedichte von Born in einem dicken Band versammelt zu haben, bis zu dem allerletzten titellosen Vierzeiler aus dem Nachlass: „Als einmal der Zug in Fußgängertempo verfällt: | bleibende Blüten und Vogelstimmen: | wir sind zurückgekehrt | nur etwas verschlissen von Schnelligkeit.“ (Nicolas Born: Gedichte. Hrsg. v. Katharina Born. Göttingen: Wallstein Verlag, 2005, S. 235 f. und 401.)
Wesensschichten überwuchert
Monday, 12. December 2011Am 12. März 1922 erschien, mit dem Titel Die Wartenden überschrieben, in der Frankfurter Zeitung ein Essay von Siegfried Kracauer, der so beginnt: „Es gibt gegenwärtig eine große Anzahl von Menschen, die, ohne voneinander zu wissen, doch alle durch ein gemeinsames Los verbunden sind.“ Im Anschluss daran beschreibt der Autor moderne Großstädter mit Begriffen, bezeichnet ihre Stimmungen und Eigenschaften mit Ausdrücken, die mich selbst, nahezu neunzig Jahre später, zu der Annahme verführen, dass ich einer von diesen gewesen, so ich denn ihr Zeitgenosse hätte sein sollen. Kracauers Aufsatz mag aus heutiger Sicht vom Vorgefühl der bevorstehenden Katastrophe inspiriert erscheinen; das Erwartete, von dem er spricht, sich im Weltenbrand des Krieges und in der Shoah erfüllt haben. Warten ist in einer die Beschleunigung selbst perpetuierenden Gegenwart, die gar zu bald in jedem Augenblick schon Vergangenheit ist, keine zeitgemäße Haltung mehr. Aber was die vormals Wartenden zu Schicksalsgefährten machte, nämlich „das metaphysische Leiden an dem Mangel eines hohen Sinnes in der Welt, an ihrem Dasein im leeren Raum“, das dürfen wir auch jetzt noch als den blinden Fleck im bunten Panorama unserer Verstandeskonstruktionen erleiden, durch die wir unsere Tage leidlich ertragen. (Zit. nach Siegfried Kracauer: Das Ornament der Masse. Essays. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1963, S. 106.)
Metzelnde Mobile
Sunday, 11. December 2011Auch ein paar Anthologien sollen ihre Existenzberechtigung im meiner Sammlung behaupten, und zwar hauptsächlich, damit auch literarische Kurzformen wie Gedicht, Tagebuch-Aufzeichnung oder Brief zur angemessenen Geltung kommen. So erhalten Autoren Zutritt, die mir nie wichtig genug waren, um mir eines ihrer Werke anzuschaffen, aber immerhin durch diese Hintertür mit besonders geglückten Kostproben ihres Könnens einen der billigen Stehplätze beanspruchen mögen. Heute begrüße ich Léon Bloy, Vertreter eines anachronistischen katholischen Extremismus. Immerhin war der Mann intelligent genug, sich schon hundertundein Jahr vor der Jahrtausendwende nicht von dem Trubel mitreißen zu lassen, mit dem seine Zeitgenossen das Jahr Neunzehnhundert begrüßten, und lieferte im Oktober dieses Jahres in seinem Tagebuch dafür eine milchmädchenhaft einfache Begründung: „Viele Menschen wollten – und wollen noch heute – das Jahr 1900 zum ersten Jahre des 20. Jahrhunderts machen. Untrüglicher Beweis für das allerorts wahrzunehmende Absterben der menschlichen Vernunft. Als ob einer, der hundert Francs zu fordern hat, sich für bezahlt anzusehen hätte, wenn sein Schuldner ihm neunundneunzig auf den Tisch des Hauses hinzählt!“ (Zit. nach Gustav René Hocke: Europäische Tagebücher aus vier Jahrhunderten. Motive und Anthologie. Wiesbaden und München: Limes Verlag, 1986, S. 859.) Und im August des folgenden Jahres diagnostizierte er mit prophetischer Hellsicht eins der Grundübel des nun wirklich angebrochenen Jahrhunderts: „Auch Auto gibt’s. Teuflische, menschenmordende Besessenheit einer wildgewordenen Menschheit. Sicherheit auf den Straßen gab’s einmal. Heute morgen zeigte uns unser Kutscher eine dieser Maschinen, welche vor kurzem eine alte Frau überfahren und zu Tode gebracht hat und nun zu neuem Gemetzel gerüstet dasteht. Strafe natürlich gleich Null. Der ,Verkehrssünder‘, richtiger ,Amokläufer‘, mußte ein paar lumpige Taler auf den Tisch des Hauses zahlen und die Sache war abgetan.“ (Ebd., S. 863.)
Zurückweichende Merkmale
Saturday, 10. December 2011Manche Bücher behaupten ihren Platz in meiner nächsten Nähe allein als Muntermacher für getrübte Stimmungslagen. Aber ist das ein geringschätziges Urteil? Im Gegenteil. Nicht auszudenken, zu welchen nicht mehr gut zu machenden Kurzschlusshandlungen ich mich hätte hinreißen lassen, stünde nicht stets die entzückende Werkausgabe von Hector Hugh Munro in greifbarer Nähe. Überkommen mich wieder einmal Selbstvernichtungswünsche, dann reicht beispielsweise eine Personenbeschreibung aus seiner Feder wie diese, mich vom Rand des Abgrunds zurückzureißen: „Lucas war ein mehr als wohlgenährter Zeitgenosse, […] von einer Gesichtsfarbe, die bei Spargel als Zeichen höchster Kultur gelten mochte, in seinem Falle aber wohl nichts anderes war als das Ergebnis sorgfältig vermiedener körperlicher Ertüchtigung. Stirn und Haaransatz waren die einzig zurückweichenden Merkmale einer in jeder anderen Hinsicht aufdringlichen und anmaßenden Persönlichkeit.“ (Saki: Base Theresa; in: Biest und Überbiest. A. d. Engl. v. Claus Sprick. Zürich: Haffmans Verlag, S. 206.) Wenn der Tag mit dem Lachen über eine solche Charakterisierung beginnt, darf mir viel zustoßen, ohne mich zu erschüttern; endet er so, muss ich mindestens fünf weitere Saki-Geschichten lesen, bis ich einschlafen kann.
Hinterm Reiterhof
Friday, 09. December 2011Anfang der 1990er Jahre hatte ich die Marotte, Bücher per Stichprobe zu prüfen, indem ich genau eine Seite las. Es war keine willkürlich ausgewählt Seite, sondern prinzipiell die Seite 35. Wie ich gerade zu dieser Seitenzahl kam, das ist eine verwickelte Geschichte. Hier geht es mir um etwas anderes: „Die Krypta ist ein Kriminalroman, ein Kriminalroman in zwei Teilen, dessen zweiter Teil peinlichst genau alles das zerstört, was der erste sich aufzubauen bemüht hat […]“ – las ich Mitte Juni 1992 auf Seite 35 eines Romans, den mir Uschi Engelbrecht vom Hanser-Verlag „als ausgewiesenen [!] Oulipo-Fan“ zugeschickt hatte, verbunden „mit dem ausdrücklichen Wunsch, daß Sie aus dem Labyrinth des Buches, in dem man sich gerne verliert, wieder auftauchen.“ Zweimal Dankeschön für Uschi Engelbrecht: einmal für das Buch, das ich bis auf Seite 35 nicht gelesen habe; und zweitens für den Wunsch, der nicht in Erfüllung gegangen ist. Denn ich nahm den zitierten Satz über den wohl fiktiven Kriminalroman zum Anlass, selbst einen Kriminalroman zu schreiben, der nach dem besagten Strickmuster gebaut sein sollte. Dieses Unternehmen erwies sich allerdings recht bald als ein Labyrinth, aus dem ich streng genommen bis heute nicht wieder aufgetaucht bin. In zwei Punkten irrte freilich die freundliche Verlagsangestellte: Ich war und bin kein Oulipo-Fan, und schon erst recht kein „ausgewiesener“; und ich verliere mich nicht „gerne“, weder in Büchern noch in der Wirklichkeit. – Der zitierte Satz geht übrigens so weiter: „[…] das klassische Verfahren zahlreicher Rätsel-Romane, das hier auf einen fast karikaturistischen Höhepunkt getrieben wird.“ (Georges Perec: 53 Tage. A. d. Frz. v. Eugen Helmlé. München: Carl Hanser Verlag, 1992, S. 35.) Das mag für die Krypta stimmen, meine Furie hingegen verrennt sich in den uferlosen Ebenen der Langeweile.
Jacke wie Hose
Thursday, 08. December 2011Vor 350 Jahren berichtet Samuel Pepys vom Missgeschick eines Mr. Townsend, „daß er nämlich kürzlich mit beiden Beinen durch ein Hosenbein gestiegen und so den ganzen Tag herumgelaufen“ sei. (Tagebuch aus dem London des 17. Jahrhunderts. A. d. Engl. v. Helmut Winter. Stuttgart: Philipp Reclam, 1980, S. 69.) Wie soll man sich denn das vorstellen? Dann müsste Townsend Beine gehabt haben wie ein Storch; oder Hosen so weit wie Röcke? Übrigens bezeichnete das Wort Hose im Deutschen ja ursprünglich das einzelne Hosenbein, wie in dem berühmten Reklamespruch von Lichtenberg noch deutlich wird: „Wer zwei Paar Hosen hat, mache eins zu Geld und schaffe sich dieses Buch an.“ (Sudelbücher, Heft E, 79.) – Es hilft alles Deuten und Raten nichts, manche Stellen in alten Büchern muss man entweder für kryptisch oder für frech gelogen halten.
schlupp! zur Welt gebracht
Wednesday, 07. December 2011Was, würde ich mir wünschen, sollte ein ernst zu nehmender Kunstrichter hundert Jahre nach meinem Tod über mich und mein Geschreibsel urteilen? Schön wäre etwa: „Er ist die personifizierte Vollkommenheit; und man kann das eigentlich bloß konstatieren.“ So darf sich nur ein unterschätzter Kritiker über einen ebenso unterschätzten Poeten und Künstler äußern. Hier ist es Egon Friedell, den ich zitiere (Kulturgeschichte der Neuzeit. München: Verlag C. H. Beck, 1974, S. 1322) und dem ich unbedingt beipflichte, ist doch der so maßlos Verehrte kein geringerer als der allerfrüheste Urheber meines Kunstverstands, meiner Lachlust, meiner Melancholie. (Größenwahn ist in der Einsamkeit ein bezauberndes Gefühl.)
Grünspan fern der Heimat
Tuesday, 06. December 2011Was mich bei aller gefahrvollen Abenteuerlust früher Entdecker und Weltreisender stets am meisten beeindruckt hat, das ist ihr Wagemut, sich von allen üblichen Hilfs- und Rettungsmitteln der menschlichen Zivilisation so weit zu entfernen, dass in manchem Notfall einer Verletzung oder Erkrankung möglicherweise keinerlei Hoffnung auf Heilung mehr bestünde, die daheim noch zu kurieren gewesen wäre. Andererseits imponiert mir das praktische Wissen solcher Leute, wie sie sich in der Mannschaft des Kapitäns James Cook bei seiner zweiten Südseereise zusammengefunden hatten, die so leicht durch nichts zu erschüttern waren. – So berichtet etwa der neunzehnjährige Georg Forster ganz nebenbei, warum er sich am 23. April 1773 einem Landgang in der neuseeländischen Dusky-Bay nicht hatte anschließen können, den verschiedene Offiziere unternahmen. „Wir hätten sie gern begleitet; aber Durchlauf und Colik hielten uns am Bord zurück. Beydes kam von der Sorglosigkeit des Kochs her, der unser kupfernes Küchen-Geschirr ganz von Grünspan hatte anlaufen lassen.“ (Reise um die Welt. Hrsg. v. Gerhard Steiner. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1983, S. 177.) Wenn ich mir vorstelle, ich wüsste mich vor Leibkrämpfen, Durchfall und Erbrechen nicht zu halten, weit weg von jeder Ambulanz und jedem ärztlichen Rat; und dann zeigte mir so ein schmieriger Smutje seine grün angelaufenen Kupferpfannen und -töpfe … grauenhaft!
Leid entfesselt
Monday, 05. December 2011Ende der 1970er Jahre kursierte unter linken Antiquaren der Geheimtipp, dass Hugo Balls Die Flucht aus der Zeit von 1946 beim Verlag Josef Stocker in Luzern noch ganz regulär lieferbar sei; zwar keine Erstausgabe aus dem schmalen Werk des Dadaisten, denn ursprünglich waren diese Tagebuchnotizen 1927 bei Duncker & Humblot in München erschienen – aber immerhin! Auch ich orderte das Buch zum Listenpreis von 13,50 Schweizer Franken. Leider hat es einen braunen Fleck im Vorderschnitt. Ich lese: „Die Fehler, die man am andern entdeckt, sind oftmals nur die eigenen. Wer sich mit diesem Gedanken vertraut macht, hat großen Nutzen davon.“ (Eintrag vom 6. April 1920, S. 281.) Daran musste ich im Krankenhaus denken, als mir jeder meiner insgesamt fünf Zimmernachbarn seine halbe Lebens- und ganze Leidensgeschichte erzählte, ohne sich auch nur im Mindesten für mich und mein Ach und Weh zu interessieren. Aber ganz so war ich selbst ja bisher auch aufgetreten! Seither zügele ich mich immerhin gelegentlich, wenn meine Tiraden und Jammerarien mich wieder einmal mit sich reißen wollen und unaufmerksam zu machen drohen fürs nicht minder traurige Los meiner Zuhörer.
Schmerz vergangen
Sunday, 04. December 2011Früher hatte ich noch die schlechte Angewohnheit, meinen Namen und das Anschaffungsdatum in meine Bücher zu schreiben. Glücklicherweise muss mir sehr bald ein kundiger Kollege in der Buchhandlung, in der ich seit dem 16. Oktober 1978 arbeitete, den Tipp gegeben haben, meinen Besitzvermerk wenn schon dann jedenfalls nicht auf die Titelseite zu schreiben, die sei so etwas wie das Hymen des Buches und müsse unbedingt rein und unbeschädigt bleiben. Vielleicht das allererste Buch, das ich an meinem ersten Arbeitsplatz mit Kollegenrabatt erwarb, war eine gebundene Ausgabe der Tagebücher von Franz Kafka (Hrsg. v. Max Brod. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1967). Darin strich ich irgendwann eine Stelle aus dem März 1922 an, als der Autor gerade noch zwei Jahre zu leben hatte: „Früher, wenn ich einen Schmerz hatte und er verging, war ich glücklich, jetzt bin ich nur erleichtert, habe aber das bittere Gefühl: ,wieder nur gesund, nicht mehr‘.“ (S. 415.) – Diese Wandlung habe ich, wie es scheint, nun auch durchgemacht, wenngleich ich eher von einem flauen denn von einem bitteren Gefühl sprechen möchte.
Kopfschnitt entstaubt
Saturday, 03. December 2011Als ich in nur einer Woche meine gesamte Arbeitsbibliothek neu ordnete, blieben für jedes Buch im Mittel gerade mal ein paar Minuten Aufmerksamkeit. Damit diese Schnelldurchsicht – vom eigentlichen Zweck der Übung, der Neuordnung, einmal abgesehen – nicht ganz nutzlos sein sollte, blätterte ich die meisten Bücher wenigstens kurz an, las hier und da wahllos ein paar Zeilen, schaute ins Inhaltsverzeichnis oder ins Register. Und wenn ich dabei, was nicht eben selten geschah, eine Stelle erspähte, die mein Interesse weckte, dann legte ich dort zwischen die Seiten einen jener postkartengroßen, hauchdünnen, säurefreien Notizzettel, die ich schon seit vielen Jahren als Lesezeichen und Vorratsspeicher für Gedankenblitze nutze. Gelegentlich notierte ich auf diese Blättchen mit spitzem Bleistift ein paar Ideensplitter, eine Assoziation oder eine Frage, zu der mich die vom Zufall ausgewählte Textstelle angeregt hatte und die ich einer genaueren Betrachtung zu einem späteren Zeitpunkt für wert befand. Und vielleicht würde hieraus ja der eine oder andere Beitrag zu meinem Blog heranreifen?
Geist händisch
Friday, 02. December 2011Nach einer Lebenskrise habe ich immer das Verlangen, Ordnung zu schaffen. So war ich diesmal, nach der Rückkehr aus der Klinik, zunächst zu keiner anderen Handlung in der Lage, als etwas zu tun, das ich schon lange vor mir hergeschoben und zu dem ich mich dank vermeintlich wichtigerer Aufgaben doch nie hatte aufraffen können: meine Büchersammlung zu ordnen. Jeder, der aus einer großen in eine wesentlich kleinere Wohnung umziehen musste, kennt die Schwierigkeit, alles Hab und Gut in die neue, knappe Behausung so hineinzustopfen, dass man noch einigermaßen weiß, wo was zu finden ist. So lebte ich in meiner Bibliothek seit Sommer vorletzten Jahres im quälenden Dauerzustand einer Unübersichtlichkeit, die das glückliche Finden eines bestimmten Buches zum Zufall und das zufällige Entdecken eines längst nicht mehr vermissten Buches zur Regel werden ließ. Dies mag für eine Weile reizvoll sein. Und so bewog mich mein sanguinisches Temperament sehr bald, mir diese eigentlich unbefriedigende Arbeitsbedingung als eine weitere Exzentrizität meines kauzigen Wesens schönzureden. Wenn ich nach dem Wortlaut eines Satzes aus Wittgensteins Tractatus suchen wollte, aber leider das Buch nicht fand und mir stattdessen Hebbels Tagebücher in die Hände fielen, dann blätterte ich darin so lange, bis ich auf einen Ausspruch stieß, der mir noch ungleich besser in den Zusammenhang zu passen schien. Wenn es stimmt, dass Not erfinderisch macht, dann gilt nach meiner Erfahrung erst recht, dass Faulheit zu wahren Geniestreichen verleiten kann – gelegentlich jedenfalls. Da ich nun aber die neu gewonnene Lebensperspektive nutzen wollte, um manche träge Gewohnheit und insbesondere auch meine Arbeitsweise zu überdenken, begann ich gleich mit der übelsten Kärrnerarbeit und räumte die Bibliothek meines Arbeitszimmers vollständig aus den Regalen, sortierte sie und räumte sie anschließend wieder ein. Das klingt, so leicht dahingesagt, wie ein Handumdrehen, fühlt sich aber in der Wirklichkeit eher an wie das Zermahlen aller Knochen im Fleische. Was mich dennoch halbwegs bei Laune hielt, das waren die vielfältigen Wiedersehensfreuden, wenn mancher längst vergessene Schatz, seit gefühlten Ewigkeiten in der zweiten Reihe schmachtend, wohin die Willkür des chaotischen Einzugs ihn verbannt hatte, plötzlich wieder sein Präsenzrecht behaupten durfte. Jedenfalls reichten solche Glücksimpulse, um aus den finsteren Tälern grenzenloser Erschöpfung immer wieder heraufzufinden ans Licht. Nun umgibt mich die Handbibliothek in feinster Ordnung, ich weiß wieder, was sie birgt und wozu ich sie nutzen kann. Die wertvollste Erfahrung aber, die mir dieser körperliche Gewaltakt bescherte, soll diesen knappen Expeditionsbericht krönen. Mir wurde doch deutlich wie nie zuvor, welch unersetzlichen Wert eine solche Textsammlung in ihrer Konkretion als Fülle von mit Händen greifbaren Büchern hat. Besäße ich diese ungefähr tausend Werke stattdessen als Textdateien auf einer Festplatte, wäre die Aufgabe einer Neusortierung oder Umstrukturierung gewiss mit ein paar Anschlägen auf der Tastatur zu erledigen gewesen. Aber diese kinderleichte Arbeit in Minutenschnelle hätte auch keinerlei Spuren bei mir hinterlassen, von Glücksmomenten ganz zu schweigen. Es ist eben so viel mehr als nur verdrossene Treue zu einem antiquierten Medium, das uns Hirntiere zu Skeptikern angesichts der bevorstehenden E-Book-Revolution macht. Wenn man den Geist von seinen mit Händen greifbaren Werkzeugen nimmt und in einem virtuellen Raum isoliert, dann wird eine grauenhafte Verödung die Folge sein – für den Geist so sehr wie für die wirkliche Welt.
Kürzer treten
Thursday, 01. December 2011Die Entwürfe zu diesem ersten Posting nach der langen Krankheitspause hätten den Brennstoff liefern können zu einem völlig neuen Blog mit dem Titel Scheiterhaufen. So nannte ich einst im paranoiden Jahr 1984 mit vollem Recht einen ersten Romanversuch, dessen Überbleibsel noch irgendwo auf meiner Spur durch verschollene Keller und Speicher in schimmelnden Kisten gammeln mögen. Aber daran wollte ich nun doch nicht anknüpfen, denn schließlich war es alles nichts, was ich mir da so zusammenspann in den vergangenen endlosen Wochen – und nichts schien selbst mir ein wenig zu gering. Nun hatte ich mir aber frühzeitig für den Neubeginn ein Ultimatum gesetzt; nämlich heute. Ich bin ja, was die Inspiration betrifft, ein etwas kauziger Fall. Wenn eine erlösende Eingebung hartnäckig sich verweigert, dann führe ich sie per höchstrichterlichem Beschluss herbei. Hiernach lautet ab dato die formale Regel für alle künftigen Beiträge in diesem Blog, dass sie nurmehr einen Absatz haben sollen, statt wie bisher deren fünf. Das wird zweifellos auf den Stil, die Tendenz, die Frequenz und den Inhalt meiner Kurzprosa Auswirkungen haben, von denen ich mich aber ebenso überraschen lassen muss wie die geschätzte Leserin, der geneigte Leser.
Entwischt
Friday, 04. November 2011Nun bin ich also noch einmal davongekommen.
Auf der Strecke blieben ein walnussgroßer Tumor, eine rechte Niere samt zugehörigem Harnleiter, knapp drei Wochen Arbeitszeit, sehr viel Kraft und ein paar Illusionen.
Gewonnen habe ich zwei beeindruckende Narben, etliche nicht immer schmeichelhafte Einblicke in meine seelische Konstitution, die Neubestimmung meiner Prioritäten und lehrreiche Eindrücke vom Alltag eines modernen Klinikbetriebs.
Aber diese Bilanz gibt natürlich nur einen blassen Schein davon wieder, was mir geschah.
Und welche Auswirkungen es auf mich und mein Blog haben wird, ist mir noch völlig unklar.
Samstag, 15. Oktober 2011
Saturday, 15. October 2011Bevor ich auf unabsehbare Zeit, vielleicht für zwei Wochen, vielleicht auch für immer verstumme, muss ich hier mit der letzten Kraft doch eine Orientierungsfahne einpflanzen.
Sollte mir die Gelegenheit vergönnt sein, dann werde ich nach meiner Rückkehr an den Arbeitsplatz ein neues Projekt in diesem Blog starten. Ich will dann ganz unmittelbar aus dem Erlebnis des alltäglichen Tages heraus schreiben.
Und über den Tag hinaus jedenfalls nur insofern, als alles Augenblickliche Vergangenes in sich zu bergen imstande ist. Zukunft hingegen, das ist mir zuletzt ganz deutlich geworden, ist reine Einbildung; grundlose Hoffnung leider, aber glücklicherweise und zum Ausgleich auch grundlose Befürchtung.
Vielleicht wächst mein Schreiben nach den Erschütterungen, die ich jetzt durchlebe, doch noch ein Stückchen über mich selbst hinaus, wer weiß? In den vergangenen Wochen und Monaten litt ich im Gegenteil unter einem erbärmlichen Schrumpfen und Verkümmern.
Und andernfalls ist ja auch Schweigen nicht ganz ohne. Manchmal scheint mir jetzt, dass diese tumultante Menschenwelt unter Schwierigkeiten leidet wie manch junge Mutter: Stillprobleme.
Fristsetzung als Formgeber
Friday, 30. September 2011Ich frage mich gerade, welchen Einfluss es auf mein Schreiben hätte, wenn meine verbleibende Lebenszeit genau begrenzt wäre. Wüsste ich zum Beispiel, dass ich nur noch ein halbes Jahr, zwei oder zehn Jahre zu leben hätte – würden dann meine Ergebnisse konziser? Hätte eine solche Limitierung Einfluss auf meine Themen? Oder verlöre ich gar, was ja auch vorstellbar wäre, gänzlich die Lust am Schreiben, um die verbleibende Zeit mit anderen Betätigungen hinzubringen?
Möglich wäre auch, oder doch immerhin vorstellbar, dass ich – angesichts der Aufgabe, nun einzig das Wesentliche in den Blick nehmen zu müssen – erstarrte und rein gar nichts mehr zu Papier brächte. Oder ich packte dies und jenes an, ließe es aber bald wieder fallen, weil mir etwas noch Wesentlicheres in den Sinn käme, wogegen das zuvor für wesentlich Gehaltene plötzlich trivial erschiene. Vielleicht verständigte ich mich in dieser Unrast schließlich doch gegen alle Unsicherheit auf einen festen Entschluss, an den ich mich nun klammerte, als stünde er für mein schwindendes Leben selbst, ohne freilich den nagenden Zweifel ganz zum Verstummen zu bringen, dass ich auf ein falsches Pferd gesetzt haben könnte.
Unwahrscheinlich, vielleicht unmöglich scheint mir hingegen, dass die Aussicht auf einen definierten Ultimo meines Lebens ganz folgenlos für mein restliches Tun und Lassen als Schreibender bliebe. Dabei stand ich schon immer – oder doch mindestens, soweit ich mich besinnen kann – unter dem inneren Druck, keine Arbeitszeit mit Marginalien zu Quisquilien zu verplempern. Es war ja schon schlimm genug, dass ich viele Jahre lang nur den kleineren Teil meines Tages aufs Schreiben verwenden durfte, während Familie, Brotberuf und Schlaf den großen Rest auffraßen.
Wieder eine andere Idee: Ich schreibe keine einzige neue Zeile mehr, sondern konzentriere all meine verbleibenden Kräfte darauf, das Vorhandene zu sichten, zu sortieren, auszumustern, zu vernichten und den guten Rest zu konservieren. Dieser Plan hat etwas Versöhnliches und überdies den Vorzug, dass er den vermutlich von Tag zu Tag nachlassenden Kräften am ehesten noch Rechnung trägt. Im günstigsten Fall kann er sogar Kraft spenden, wenn die Begegnung mit der Vergangenheit erfreuliche Erinnerungen ans Licht bringt.
(Ganz anders verhielte es sich freilich, wenn die Frist noch wesentlich kürzer wäre. Wenn sich der Erlebenskorridor auf die berühmten ,Letzten Worte‘ hin verengte. Was wäre da zu sagen? Dazu zu sagen?)
Heinrich Funke: Das Testament (XXV)
Monday, 26. September 2011Der tanzende Elefant kommt uns bekannt vor, oder? Ganz richtig, erst auf dem vor-vorletzten Blatt ist er uns erstmals begegnet. Lediglich der Hintergrund hat sich seither von schmutzigblau zu rotviolett verfärbt. Der Elefant selbst hat seine Farbe behalten. Er ist grau, wie alle Elefanten, Esel und Theorien nun einmal sind. [Nachtrag: Der Künstler weist mich darauf hin, dass es noch einen auffälligeren Unterschied zwischen den beiden Bildern gibt: Die Horizontlinie ist im zweiten Bild von der oberen Bildhälfte in die untere gerutscht! Wie konnte mir das nur entgehen?]
Das Sprüchlein unterm ersten Elefanten lautete: „Wenn Religion zur Moral wird fängt sie an zu stinken“. Nun lesen wir: „Du hast mich verführt und ich habe mich verführen lassen“. Was fangen wir nun damit an?
Verführung bedeutet die Beeinflussung einer Person, um sie gegen ihre ursprünglichen Intentionen zu einer Denk- oder Handlungsweise zu bewegen. Dies kann in aller Regel nur dann gelingen, wenn die verführte Person in sich selbst Neigungen oder Bedürfnisse hat, die den besagten ursprünglichen Intentionen entgegenstehen und die sich der Verführer zunutze macht. Ein Beispiel. Ich habe vor Jahren beschlossen, das Rauchen aufzugeben, weil es meiner Gesundheit schadet, viel Geld verschlingt, meine Mitmenschen belästigt. Meine ursprüngliche Intention ist also, nie mehr zu rauchen. Nun bietet mir der Verführer eine Zigarette an: „Komm, sei kein Frosch! Nur eine!“ Er entfacht damit in mir einen inneren Kampf zwischen meinem Vorsatz und dem noch immer in mir lauernden Bedürfnis, diesen kleinen Schwindel im Kopf zu verspüren, der damals das Rauchen so angenehm machte. Wie ich mich nun entscheide, das hängt davon ab, welche der beiden Kräfte stärker ist. Wenn ich stark bleibe und das Angebot des Verführers ablehne, dann habe ich Schaden von mir ferngehalten und mir selbst meine Autonomie bewiesen. Gebe ich aber den Verlockungen und dem Drängen des Versuchers nach, dann bin ich schwach – und schwäche mich durch die Niederlage noch mehr.
Die Sentenz klingt nun wie eine Antwort auf die Frage, wen die Schuld trifft oder wem das Verdienst gebührt bei der geglückten Verführung. (Ganz recht, auch ein Verdienst kann dem Verführer zukommen, denn die Verführung muss ja nicht zum Schaden des Verführten gereichen. Wenn ich etwa jemanden dazu verführe, gegen seinen anfänglichen Widerwillen eine neue Speise zu kosten, die ihm dann ausgezeichnet mundet, dann hatte die Verführung ja einen Nutzen für ihn.) Mit dem Hinweis, dass auch der Verführte einen Anteil an der Verführung hat, indem er diese zuließ, bleibt die Frage nach Schuld bzw. Verdienst aber offen.
Der Satz des erfolgreichen Verführers klingt im ersten Teil wie ein Bekenntnis, im zweiten wie eine Apologie; und in seiner Dialektik banal. Es muss aber eins von beidem – der Widerstandswille des Verführten oder die Verführungskraft des Versuchers – um einen Tick stärker sein, damit die Entscheidung in diese oder jene Richtung fällt. Hier beginnt das Land der Freiheit, in der erst die Schuld gedeiht. Die Sentenz kommt mir insofern vor wie die windelweiche Relativierung eines Vorgangs, der ja eben nicht in die Ambivalenz mündete, sondern zu einem eindeutigen Ergebnis führte.
Melancholie unterm Regenbogen
Thursday, 15. September 2011In den vergangenen Tagen habe ich meine Sammlung von Taschenbüchern aus der edition suhrkamp für die Angebotsliste meines Versandantiquariats erfasst. Der Anschaffungszeitraum reicht von 1972 bis 1992. (Danach habe ich wohl auch noch das eine oder andere Bändchen dieser bunten Reihe erworben, doch stehen diese „jüngeren“ Bücher noch nicht zum Verkauf.)
Der geniale Einfall von Willy Fleckhaus, die Umschläge der ersten Taschenbücher im Suhrkamp-Verlag ohne Abbildungen zu gestalten, einfarbig und mit einer schlichten Linotype Garamond; und dass die Farben in der Zusammenschau aller Bände das gesamte Spektrum abbildeten – dieser Einfall hat sicher manchen Buchliebhaber dazu verführt, möglichst ausreichend viele dieser Bändchen zu erwerben, um daraus einen schönen Regenbogen ins Regal zaubern zu können. Nur die von Hannes Jähn gestalteten Taschenbücher der Sammlung Luchterhand kamen noch puristischer daher; und die erschienen erst sieben Jahre später. Alle anderen „pocket books“ in Deutschland, ob von Rowohlt, Fischer, Heyne, Ullstein oder Goldmann, imitierten ihre Vorbilder aus den angloamerikanischen Verlagen und gingen mit schreiend bunten Titelbildern auf Kundenfang.
Mit dem Erscheinen des ersten Bändchens in der edition suhrkamp, Bertolt Brechts Leben des Galilei, war das Taschenbuch 1964 endlich „stubenrein“ geworden. Anfangs wurden die Billigbücher mit solch reißerischen Reihennamen wie rororo von seriösen Buchhändlern ja noch boykottiert, wobei sich hinter dieser Hochnäsigkeit handfeste wirtschaftliche Bedenken verbargen. Die Sortimenter der 1950er-Jahre fürchteten nämlich, das wachsende Angebot billiger Taschenbücher würde bald die Preise für „richtige“ Bücher kaputt machen. Aber auch von den typischen Taschenbuchpreisen, die immer auf 80 Pfennig endeten, grenzte sich Suhrkamp bewusst mit runden D-Mark-Preisen ab. In der gleichen Zeit warb Reemtsma für seine Zigarettenmarke Atika mit dem Slogan: „Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.“ Ich müsste mich sehr irren, wenn diese Glimmstängel nicht auch einen glatten Preis gehabt hätten. (In den 1960er-Jahren kostete eine Schachtel mit 21 Zigaretten der Marke HB 1,90 DM.)
Was waren das also für besondere Geschmäcker, die diese Taschenbücher bevorzugten? Schüler der Frankfurter Schule, bewegte Studenten, Intellektuelle, Sozialkritiker, Fortschrittliche, Experimentierer, Alternative.
Indem ich nun jeden einzelnen dieser 115 Bände in die Hand genommen und mehr oder weniger gründlich inspiziert habe, musste ich feststellen, dass ich mich an die meisten kaum mehr erinnern konnte. Woraus hatte sich der Kaufimpuls genährt? Warum interessierte ich mich beispielsweise für Sozialistische Realismuskonzeptionen, nachvollziehbar gemacht durch „Dokumente zum 1. Allunionskongreß der Sowjetschriftsteller“? Das scheint auf den ersten Griff völlig unerfindlich. Schlage ich das Buch aber auf, entdecke ich eine hoffnungsvolle Rede von Ernst Toller, gehalten am 28. August 1934 in Moskau. Keine fünf Jahre später erhängte er sich in New York. Auch ein langer Bericht von Klaus Mann ist hier abgedruckt, voller Optimismus noch. Doch, es könnte lohnend sein, sich diese Dokumente einmal genauer anzuschauen. Jetzt stelle ich sie für 6,50 Euro beim ZVAB online; es ist ja kaum wahrscheinlich, dass sie einen Liebhaber finden.
Heinrich Funke: Das Testament (XXIV)
Wednesday, 14. September 2011Vor einem Vierteljahrhundert erschien im Kölner DuMont-Verlag ein Büchlein mit tausendachtzig Antworten auf die Frage: Was ist Kunst? Ob darunter eine Kunstdefinition zu finden ist, die dem heutigen Satz des Tages nahekommt, weiß ich nicht.
Beuys mit seinem erweiterten Kunstbegriff hat mir sehr gefallen, schon als angemessene Reaktion auf das Spießerlamento jener Zeit angesichts abstrakter oder sonstwie nicht ins vorgefasste Bild passender Kunst: „Das ist doch keine Kunst!“ – Nein, Kunst kommt nicht von können; wenn schon, dann von gönnen. (Also müsste sie richtiger Gunst heißen.)
„Kunst ist die Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffen von Gestalt“. Hier wird also Kunst als Tätigkeit aufgefasst – wahrnehmen, schaffen – und nicht als Objekt: als entstehendes oder fertiges Kunstwerk. (Nebenbei: Ob die Inkonsequenz der Begriffsbildung hier einer Absicht folgt? Man erwartet doch als „passende“ Begriffspaare entweder Wahrnehmung / Schöpfung oder Wahrnehmen / Schaffen. Aber so?)
Zu fragen wäre, ob es einen Unterschied zwischen Gestalt und Form gibt? Ob das Ungestalte sich der Kunstwerdung per definitionem verweigert? Und fragwürdig scheint mir zudem, ob man nicht gerade diesem freisinnigen Wörtchen Kunst das triste Definiertwerden einmal ersparen darf?
Offenbar nicht. In der zweiten Auflage des besagten DuMont-Büchleins waren weitere dreihundertachtzig Antworten auf die Frage Was ist Kunst? hinzugekommen.
Schreibzwang
Sunday, 04. September 2011Manchmal stoße ich bei der Durchsicht älterer Postings auf Einfälle, die mir längst entfallen sind, dessen ungeachtet aber wert, aufgehoben und daraufhin geprüft zu werden, ob sich mit ihnen nicht noch etwas machen ließe. So begegnete mir heute in einem meiner allerersten Beiträge zu diesem Weblog das formale Konzept, alle fünf Absätze jeweils mit einem Temporaladverb anheben zu lassen.
Oft muss ich feststellen, dass die inhaltliche Substanz meiner Artikel zu wünschen übrig lässt; oder dass deren Anlässe zu zeitbezogen waren, um eine dauerhafte Aufbewahrung, gar öffentliche Zurschaustellung zu rechtfertigen. Vielfach sind Links verödet. Häufig verstehe ich selbst nicht mehr ganz, was ich eigentlich mit dieser oder jener Anspielung gemeint habe.
Selten bin ich wirklich begeistert von meinem eigenen Geschreibsel, aber dann kommt es mir regelmäßig so vor, als sei es nicht von mir.
Immer finde ich mindestens ein paar Kleinigkeiten, die ich polieren oder verfeinern, verdeutlichen oder entschärfen muss. Dabei fühle ich mich wie ein Betrüger und zudem wie ein Pedant. Warum fällt es mir so schwer, zu meinen Schwächen zu stehen? Und riskiere ich mit diesem Perfektionismus nicht, meinem persönlichen Stil die Seele auszutreiben?
Nie bezweifle ich hingegen, dass alternativlos ist, was ich hier mache: Ich kann nichts andres und ich kann ’s nicht anders.
Big Sister im Hinterzimmer
Friday, 26. August 2011Die erzwungene Besinnungspause führt zu ersten Einsichten. Weil ich mich mit kleinen Schritten begnügen wollte, meinte ich, diesem langsamen Fortschritt durch entsprechend viele Schritte auf die Sprünge helfen zu müssen. In den 1280 seit dem Startschuss für dieses Weblog vergangenen Tagen habe ich 886 Beiträge veröffentlicht. Anders gesagt durfte der Leser hier an zwei von drei Tagen einen neuen Artikel erwarten – wenn es denn überhaupt Leser gab, die hier alle paar Tage vorbeischauten.
Dieser Illusion gehe ich aber längst nicht mehr auf den Leim. Dazu ist mein Blog einerseits zu strapaziös, andererseits – “to tell the truth: its too much eccentric!” Nachdem ich hinlänglich unter Beweis gestellt habe, dass es mir an Fleiß und Kondition nicht mangelt, sollte ich mich vielleicht künftig darauf konzentrieren, noch deutlicher und noch genauer das zum Ausdruck zu bringen, was – frei nach Patti Smith – nur ich allein so zum Ausdruck bringen kann. Dafür benötige ich jedoch erfahrungsgemäß etwas mehr Zeit als anderthalb Tage.
Vor ein paar Tagen mehr wurden in unserem Haus fünf Betten angeliefert. Da die Straße sehr schmal ist, stand der Möbelwagen direkt vor unserem Küchenfenster. Dadurch ergab sich das irritierende Bild dort oben: “Big sister is watching you!” Plötzlich verschieben sich durch des Zufalls Komödiantenlaune die Proportionen. Ich wähne mich in den daumengroßen Bewohner eines Puppenhauses verwandelt, den von draußen die riesenhaft erscheinende Besitzerin dieser Liliputwelt amüsiert beobachtet. Gleich wird es ihr vielleicht gefallen, mich mit spitzen Fingern zu packen und auf den Dachfirst zu setzen!
Wo es aber durch ein wenig Kulissenschieberei möglich ist, einem mittelgroßen Mitteleuropäer momentweise das Selbstempfinden eines Zwergs zu suggerieren, da ließe ich mich doch vielleicht mittels eines entgegengesetzten Verzerrungstricks zu einem virtuellen Geistesriesen aufblasen – wenn nicht für immer, so doch bitte schön für jene fünf Minuten, die das Lesen und Verstehen meiner fünfteiligen Kurzprosa-Pröbchen beansprucht.
Dieser Trick wäre vielleicht durch die Lupe möglich, die der Leser zur Hand nehmen sollte, um zwischen meinen Zeilen auf die Suche nach versteckten Hinweisen zu gehen. Wo steckt der Schlüssel zum Hinterzimmer? Wer lauert dort auf den ungebetenen Besucher? Was führt er mit diesem im Schilde? Welche Ausflüchte könnte der Eindringling vorbringen? Was geschähe mit ihm, so sie nicht verfängen? Und was um alles in der Welt wäre sein Lohn, wenn ihm wider Erwarten schließlich doch noch mit knapper Nor die Flucht gelänge?
Heinrich Funke: Das Testament (XXIII)
Friday, 19. August 2011Nach Schwein und Elefant nun also ein Rhinozeros. Diese Trias dickleibiger Säuger legt nahe, dass der Künstler eine gewisse Affinität zu schwergewichtigen Tieren hat. Zudem drängt sich die Vermutung auf, dass mit dem Bild des indischen Panzernashorns einem großen Vorbild die Reverenz erwiesen werden soll. Bekanntlich hat Albrecht Dürer 1515 einen Holzschnitt von jenem „Rhinocerus“ angefertigt, das der portugiesische Seefahrer Alfonso de Albuquerque von seiner Indienfahrt mit nach Europa gebracht hatte. (Allerdings vermuten Kunsthistoriker, dass Dürer dieses Tier persönlich gar nicht zu Gesicht bekommen hat.)
Das Wesen dieser einzelgängerischen Tiere wird aus Sicht menschlicher Beobachter je nach Lage der Dinge unterschiedlich beschrieben. Nähert man sich dem Nashorn in feindlicher Absicht, etwa um es zu erlegen und sein Horn zu Geld zu machen, dann kann es, was Wunder, sehr ungehalten werden. Seine Bisse sind lebensgefährlich; gerät man unter seine Hufe, überlebt man ebenfalls nur mit sehr viel Glück. Andererseits gilt es als anhänglich und handzahm, wenn es von einem fürsorglichen Halter gut verpflegt und liebevoll behandelt wird.
Ist ein Rhinozeros zur Sünde fähig? Hat es außer seinen animalischen Trieben noch andere Motive für sein Handeln? Kann es zwischen zwei Handlungsalternativen entscheiden? Wenn es so wäre, dann fiele ein wesentlicher Abstandhalter weg, mit dem wir uns moralisch über das Tier erheben. Unser Unterscheidungsvermögen von Gut und Böse stellt uns fortwährend vor die Aufgabe, unser Verhalten darauf auszurichten, Gutes zu tun und Böses zu vermeiden, vulgo: nicht zu sündigen. Wenn ein Mensch ohne dieses moralische Rüstzeug durchs Leben stampft, dann mag man ihn ein rechtes Rhinozeros schimpfen.
Die Zahl der Menschen auf der Erde ist längst schon zehnstellig, während die Zahl der Rhinozerosse wohl nurmehr fünfstellig sein dürfte. Der Schwund der Nashörner wird noch beschleunigt durch den unter Asiaten verbreiteten Aberglauben, dass sich aus deren Hörnern, zu Pulver zerrieben, ein wirksames Potenzmittel gewinnen ließe. Wären die betroffenen Tiere in der Lage zu erkennen, warum sie von Wilderern reihenweise übern Haufen geschossen werden, dann könnte vielleicht etwas wie Hass in ihnen aufflammen. Aber eine solche Spekulation ist müßig.
Ist der Nashornjäger ein Sünder, weil er zur irreversiblen Ausrottung einer Tierart beiträgt? Schließlich steht er im Dienste der Liebe, auch wenn die Lust aus dem zu Pulver zermahlenen Horn seines Opfers bloß auf Einbildung beruht. Und vermutlich geht er nicht aus blutrünstiger Infamie auf die Nashornpirsch, sondern weil er daheim fünf vor Hunger wimmernde Kinder weiß, die er zu ernähren hat. Wir müssen den Nashornjäger lieben, und sei es um seiner unschuldigen Arglosigkeit willen. Aber die Sünde hassen? Das können wir ebensowenig. Was wäre denn dieses große irdische Theater ohne Sünde, ohne die Einbildung von Schuldfähigkeit? Ein langweiliger Schmarrn!
TV B Gone
Tuesday, 16. August 2011Dieser Tage machte mein Herz vor Begeisterung einen kleinen Hüpfer. (Zu richtigen Sprüngen kommt es ja in diesen Endzeitjahren nur noch sehr, sehr selten.) Ich las in einem Bericht über das Sommercamp des Chaos Computer Clubs auf dem ehemaligen sowjetischen Flugplatz Finowfurt im brandenburgischen Niemandsland, dass es jetzt einen elektronischen Zauberstab namens TV B Gone gebe, mit dem man sämtliche Fernseher im Umkreis von hundert Metern gleichzeitig ausschalten könne! (Vgl. Frederik Obermaier: Unter Nerds; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 186 v. 13./14./15. August 2011, S. 12.)
,Das musst du haben!‘, dachte ich gleich und recherchierte nach Bezugsquellen. Ich stieß auf zwei verschiedene Produkte. Erstens gibt es da einen schwarzen Schlüsselanhänger dieses Namens, der auf Knopfdruck nahezu jedes europäische Fernsehgerät ausschaltet, indem er in knapp einer Minute fast alle bekannten Ausschalt-Codes nacheinander per Infrarot sendet. Die Reichweite dieses „Ausschalt-Allrounders der 4. Generation“ beträgt allerdings lediglich drei bis fünf Meter. (Der Preis schwankt je nach Anbieter zwischen 9,90 € und 24,90 €.) Das zweite TV-B-Gone ist ein Bausatz aus 20 Teilen, zu dessen Montage etwas Zeit und Geschicklichkeit, ein Lötkolben, Lötzinn, ein Multimeter und eine Kneifzange erforderlich sind. Dieses Gerät ist viel stärker als die zuvor beschriebene Version, seine Reichweite beträgt mehr als 40 Meter, gelegentlich ist sogar von „bis zu 110 Meter“ die Rede. (Preis zwischen 16,95 € und 34,95 €.)
Nun stellte ich mir vor, allabendlich zur Hauptsendezeit mit meinem Handmade-TV-B-Gone einen Gang durch die Gemeinde zu machen und dabei alle hundert Meter den Glotzern ringsum eine überraschende kleine Sendepause zu verordnen. Schadenfreude? Ach, was! Bloß die Verzweiflungstat eines einsamen Bildfunkabstinenzlers, der wenigstens durch diese harmlose Harlekinade seine Verzweiflung über die Allmacht des medialen Tranquilizers zum Ausdruck bringen möchte. Ich bin ja überzeugt, dass binnen weniger Tage in allen Städten des Landes Barrikaden gebaut würden, wenn sämtliche Sender ihre Übertragung einstellten.
Leider brachte mich ein technisch versierter Bekannter schnell wieder auf den ernüchternden Boden der Tatsachen. Diese Allround-Ausschalt-Fernbedienung funktioniert nämlich wie jede andere auch nur dann, wenn sie punktgenau in die Richtung des auszuschaltenden Gerätes gehalten wird. Keineswegs kann man mit ihr blindlings in der Gegend rumballern und Glotzen im Dutzend auslöschen.
Schade!
Pulverfass
Sunday, 14. August 2011Die soeben im Artikel über Schreibvoraussetzungen aufgezählten inneren und äußeren Konditionen und Dispositionen sind zwar seit einigen Tagen durchaus gegeben – und doch kann ich mich nicht dazu aufraffen, einen neuen Beitrag für mein Blog zu verfassen. Es wäre der 884ste. Ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll. Alles, was mir einfällt, scheint mir nach kurzem Bedenken dann doch nicht der Mühe wert, schriftlich erzählt oder erörtert zu werden. Diese Skepsis gegenüber meinen Ideen befällt mich insbesondere an meinem Arbeitsplatz. Wenn ich gut gelaunt durch den feinen Nieselregen dem Wald zustrebe, durch das Fenster des 142er-Busses das Umschlagen der Ampel von Rot auf Grün erwarte oder im Bett kurz vorm Einschlafen an etwas Böses denke, dann überfällt mich aus dem Nichts ein erster Satz, ein hartnäckiger Widerspruch oder eine offene Frage, tauglich für mindestens ein Posting, wenn nicht gar für eine ganze Serie. Doch stolz wie ich bin verbiete ich mir, Notizen auf Merkzettel zu machen, weil ich mir sage: Wenn dieser Einfall nicht stark genug ist, dass ich ihn auch ohne Hilfsmittel im Kopf behalte, dann ist er wohl das Papier nicht wert, auf dem ich ihn skizzieren muss, um ihn nicht zu verlieren.
In dieser inspirativen Einöde lese ich obendrein noch das Interview, das Christian Wolf bei Basic Thinking vor ein paar Tagen mit dem Blogger Oliver Stör geführt hat. Stör hat innerhalb eines Jahres gleich drei Abmahnungen wegen vermeintlicher Rechtsverletzungen in seinem Weblog Stör-Signale erhalten und gibt nun nach neun Jahren fröhlicher Bloggerei entnervt auf. Was rät er Bloggern, die sich vor Angriffen der gefürchteten Abmahnanwälte schützen wollen? Da muss er leider mit den Achseln zucken. Ein Patentrezept gegen deren Machenschaften gebe es seines Wissens nämlich nicht. Immerhin könnte man seine Angreifbarkeit vermindern, indem man 1. keine Bilder aus dem Netz kopiert, 2. keine Zitate verwendet und 3. keine Links auf fremde Websites setzt. (Ich setze jetzt mal vorsichtshalber keinen Link auf das Interview.) Wenn ich mich nicht täusche, dann ist vermutlich der einzige Grund, weshalb dieser Kelch bisher an mir vorübergegangen ist, die totale Erfolglosigkeit meines Blogs. (Ich wusste ja schon immer, dass es ein großer Vorteil ist, nicht gelesen zu werden.)
Mit anderen Worten sitze ich hier auf einem Pulverfass. Sprachlos!
Ich überlege für ein Momentchen allen Ernstes, dieses Unternehmen mir nichts, dir nichts, sang- und klanglos aufzugeben. Was, wenn ich einfach den Stöpsel rauszöge? Es macht ein paar Mal gluck, gluck – und alles ist weg! Adieu, freie Meinungsäußerung vor der Weltöffentlichkeit. Andererseits bin ich heute auch wieder nicht in der Stimmung zu solch spontanen Vernichtungsaktionen. Meine cholerischen Anwandlungen gehören eben glücklicherweise längst der Vergangenheit an. Darum atme ich tief durch und erwäge ruhigen Blutes die verbleibenden Möglichkeiten, meine Arbeit an diesem Blog möglichst unbeeinflusst fortsetzen zu können, ohne Abzockern auch nur die kleinste Angriffsfläche zu bieten.
Vielleicht könnte ich mich rüsten, indem ich all jene älteren Postings, die auch nur von Ferne nach Verstößen gegen Urheber- oder Persönlichkeitsrechte duften, mit einem Passwortschutz versehe? Dabei sollte ich zweckmäßigerweise so vorgehen, dass ich zunächst ausnahmslos alle 883 Beiträge hinter Schloss und Riegel setze – um dann Schritt für Schritt die definitiv harmlosen Beiträge, gegen die auch der erfindungsreichste Rechtsverdreher nichts einzuwenden haben kann, wieder hervorzuholen. In einem zweiten Arbeitsgang könnten dann noch etliche Beiträge einer sorgfältigen Reinigung ad usum Delphini unterzogen werden, indem ich zum Beispiel ohnehin längst verödete Links entferne, wörtliche Zitate in indirekte umformuliere und so weiter. Bei meinen Neuveröffentlichungen werde ich fallweise entscheiden, welche ich der anonymen Öffentlichkeit zur Verfügung stellen darf und welche hinter die dicken Mauern eines Passwortschutzes gehören. Den Schlüssel zum intimeren Bereich meines Blogs erhalten dann nur meine engsten Freunde. (Je länger ich darüber nachdenke, desto reizvoller erscheint mir diese Lösung – und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht.)
Schreibvoraussetzungen
Tuesday, 09. August 2011Ich bin seit Wochen gesundheitlich etwas angeschlagen. Das bekommt auch mein Blog zu spüren. Die schöne Regelmäßigkeit eines täglichen Postings, die ich in den Monaten Mai und Juni durchhalten konnte, ist zumindest vorläufig passè. Ich habe gegenwärtig, wie man sagt, ganz andere Sorgen. Bei dieser Gelegenheit wurde mir wieder einmal bewusst, wie viele Voraussetzungen doch erfüllt sein müssen, damit ich überhaupt erst mit dem Schreiben beginnen kann – von einem Gelingen mal ganz abgesehen!
Mein kleines Arbeitszimmer ist der einzige Ort, an dem ich schreiben kann, jedenfalls auf die nahezu definitiven Ergebnisse hin, die ich hier publiziere. Stichworte, Notizen, Skizzen kann ich handschriftlich überall zu Papier bringen, aber für die Niederschrift meiner Miniatur-Pentaloge muss ich auf diesem Stuhl sitzen, an diesem Tisch, mit Blick auf die kleine Straße. Ich brauche meinen Rechner samt Peripherie, die kleine Handbibliothek aus Notizbüchern und Nachschlagewerken, frische Luft und absolute Ruhe.
Mein Kopf muss frei sein von allen störenden Zwischengedanken. Ist noch Butter im Kühlschrank? Droht ein Telefonanruf? Steht gar ein Besuch vor der Tür? Pures Gift für meine kreative Abgeklärtheit ist ein Streit vor Arbeitsbeginn. Aber auch bevorstehende Ereignisse, wie ein seltenes Zusammentreffen mit einem lange nicht gesehenen Freund oder ein Termin bei einer Behörde, können mich gedanklich so sehr dominieren, dass ich mich nicht mit voller Kraft auf die aktuelle Niederschrift konzentrieren kann.
Zeitdruck ist kontraproduktiv, erhöht nach aller Erfahrung mindestens die Fehlerquote. Blasendruck mach mich nervös und führt mich in Versuchung, die zweitbeste Formulierung zu akzeptieren, weil ich mich erleichtern muss. Bevor ich wieder an der Tastatur sitze, ist mir meist nicht mehr präsent, dass das Provisorium noch auf Ablösung durch ein Optimum wartet. Generell sind falsche Druckverhältnisse abträglich, ob beim Blut- oder Luftdruck. Zu wenig Druck wirkt in aller Regel lähmend, zu hoher blockiert.
Vernichtend ist schließlich für mein Schreibvermögen Schmerz, in all seinen Facetten. Selbst ein leichtes Pochen im Backenzahn, sogar schon ein lästiges Jucken zwischen den Schulterblättern macht mich völlig unfähig, auch nur einen einzigen brauchbaren Satz abzusondern. Analgetika betäuben mit dem Störenfried zugleich auch die Inspiration und das Empfinden für Wohlklang und syntaktische Proportionen. Sorge und Angst verderben mir die gute Laune. Krankheit zwingt mich tief unter mein Niveau.