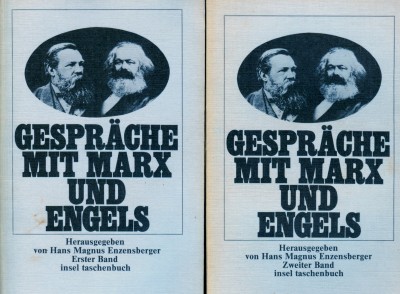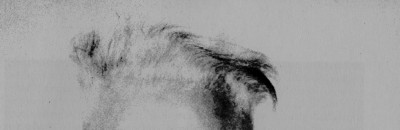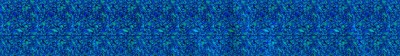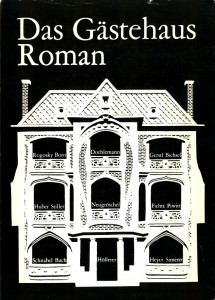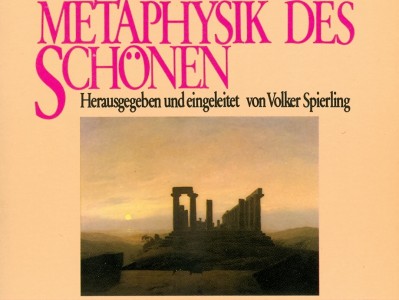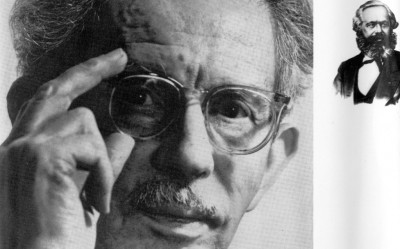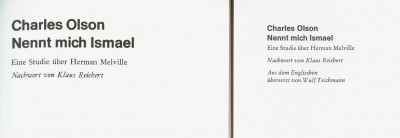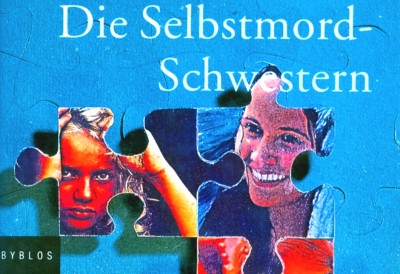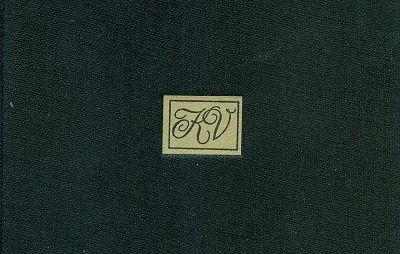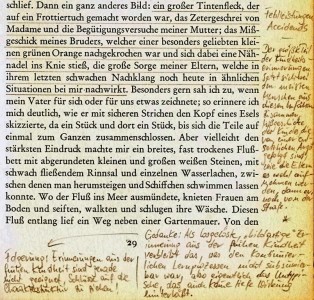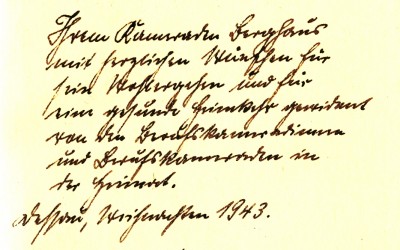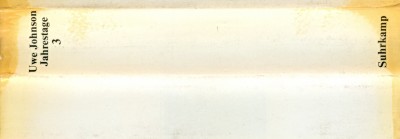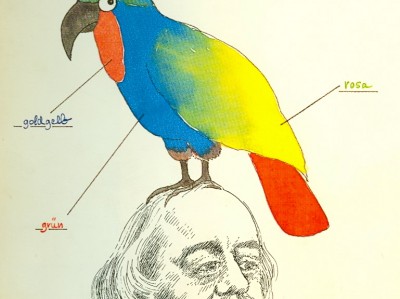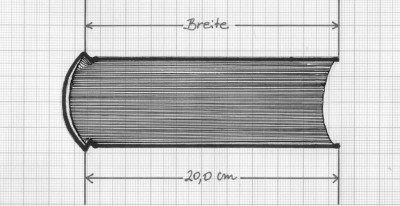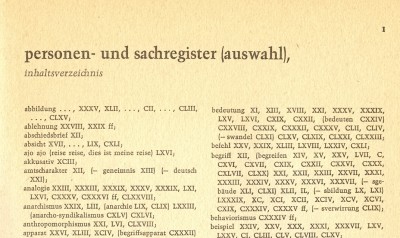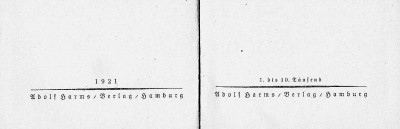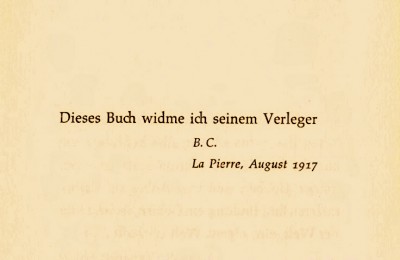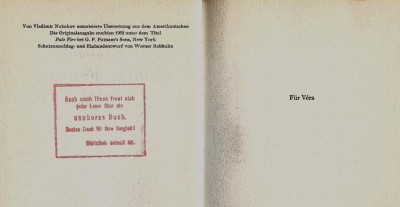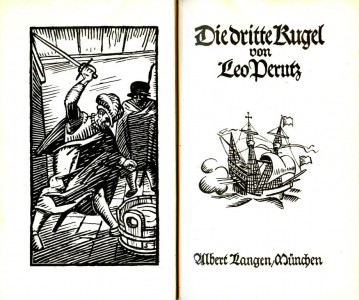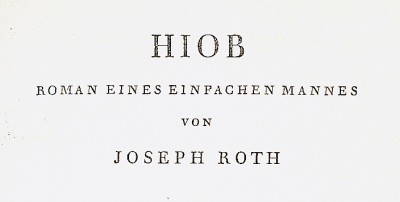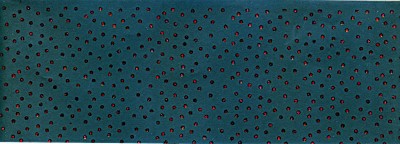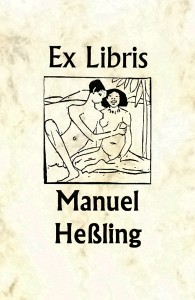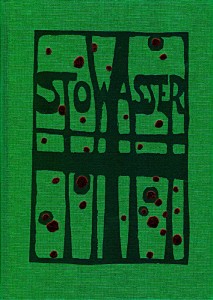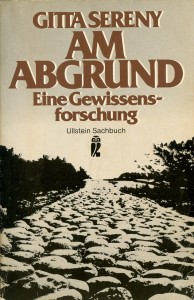Am 25. März 1996 wurde der Arno-Schmidt-Förderer Jan Philipp Reemtsma, Erbe eines guten Anteils der nicht nur traditions-reichen Reemtsma Cigarettenfabrik, von dem Berufsverbrecher Thomas Drach uns seinen Gehilfen auf seinem Grundstück in Hamburg überwältigt und entführt. Erst nach zähen Verhandlungen und der Übergabe von 30 Millionen D-Mark Lösegeld kam Reemtsma nach 33 Tagen Gefangenschaft am 26. April 1996 wieder frei. Die Polizei war hierbei von der Familie des Entführten bewusst nicht einbezogen worden, auch die Medien wurden erst informiert, als alles vorbei war. So liefen die öffentlichen Fahnungsmaßnahmen nach den Tätern und dem Lösegeld erst Anfang Mai 1996 an. Dabei spielte auch eine Liste von Büchern eine Rolle, die die Kidnapper ihrem Opfer zur Ablenkung besorgt hatten. Im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel wurden die Sortimenter gebeten sich daran zu erinnern, ob sie die insgesamt 19 Titel, oder doch mindestens einige von ihnen, in der fraglichen Zeit an ein und denselben Kunden verkauft hätten. Im Anschluss an die Aufzählung der Bücher heißt es: „Am vielversprechendsten erscheint der Ermittlungsansatz bei Die Sammlungen des Prado, Hüben und Drüben und Peter Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft. Diese Bücher dürften nur in größeren Fachbuchhandlungen erhältlich sein.“ (Tipps erbeten: Reemtsmas Bücher; in: Börsenblatt Nr. 38 v. 10. Mai 1996, S. 4.) Wer hat sich wohl diesen vermeintlich erfolgsträchtigen Hinweis ausgedacht? Die Polizei wohl kaum! Polizeiliche Ermittler, die sich in ihrer Freizeit mit kulturphilosophischen Analysen beschäftigen, gibt es noch nicht einmal in schwedischen Kriminalromanen unserer Zeit. Es dürfte wohl der befreite Philologe und Sozialforscher Reemtsma selbst gewesen sein, der dies den Fahndern in die Feder diktierte. Dabei überschätzte er aber die Außergewöhnlichkeit seines Buchwunsches in diesem Fall vollkommen. Zum Zeitpunkt der Entführung war Sloterdijks Erfolgsbuch schon sein 13 Jahren auf dem Markt und erlebte gerade seine 13. Auflage. Es gehörte sich für jeden Möchtegern-Intellektuellen jener Zeit, es mindestens im Regal stehen zu haben. Selbst in Bahnhofsbuchhandlungen konnte man den beiden lilafarbenen Bänden aus der edition suhrkamp nicht entgehen. Ob solche Lektüre dem bedauernswerten Millionärssohn in seiner Haftzeit genützt hat? Vielleicht – und sei’s nur, weil er das Soldatensprichwort beherzigte, das dort auf S. 403 zitiert wird: „Lieber fünf Minuten feig als ein Leben lang tot.“ Über seine 33 traumatisierenden Tage in Drachs Gewalt hat Jan Philipp Reemtsma bekanntlich ein Buch geschrieben: Im Keller. Damit ist er sogar auf Lesereise gegangen. Allerdings hat er sich geweigert, es zu signieren. Man steckt nicht drin! [Den Hinweis auf den BöBla-Artikel und eine Kopie des Originaltextes verdanke ich meiner Freundin Annette Breithaupt.]
Archive for the ‘Biblioskopie’ Category
Leseliste für Entführungsopfer
Monday, 20. February 2012Eulenbücher
Friday, 10. February 2012Marcus Jauer befasste sich neulich auf einer ganzen FAZ-Seite mit jenen belletristischen Büchern, die zwar millionenfach verkauft, aber von den Feuilletons üblicherweise keines Blickes gewürdigt werden. Dazu zählen heute Autorinnen wie Sabine Ebert aus Freiberg bei Dresden, die mit ihrer fünfbändigen Hebammen-Saga aus dem Hochmittelalter mittlerweile die Zwei-Millionen-Grenze überschritten hat – wohlgemerkt nicht beim Umsatz in Euro, sondern mit der Stückzahl abverkaufter Exemplare! Oder ein merkwürdiger Mensch namens Sebastian Fitzek, der mit extrem grausamen Krimis besonders bei Frauen einen eigentlich nicht glaubhaften Erfolg feiert. Da diese Art von Bestsellern sich den gängigen Kriterien der Literaturkritik entziehen, finden sie bei den seriösen Fachleuten keinerlei Resonanz. Daher hat sich neben jener äußerst produktiven literarischen Subkultur auch eine nicht minder fleißige Diskussionsgemeinde etabliert, natürlich im Internet. Im größten privaten Literaturforum deutscher Sprache, der Büchereule, tauschen Leser emsig ihre Meinungen aus. Ein Sonderfall in diesem trivialen Unfeld ist wohl die Autorin Bärbel Schmidt, die im Hauptberuf und unter ihrem bürgerlichen Namen als Verlagsvertreterin für DTV und Klett-Cotta unterwegs ist. Unter ihrem Pseudonym Dora Heldt erklimmt auch sie mit ihren Schmökern vordere Plätze in den Bestsellerlisten. Über Heldts bürgerliche Vergangenheit heißt es in dem FAZ-Artikel: „Bärbel Schmidt hat Anfang der achtziger Jahre Buchhändlerin gelernt, damals stand unter ,Frauenbuch‘ die feministische Literatur im Regal. Sie erinnert sich, wie sie sich gewehrt hat gegen Romane von Eva Heller, die sie heimlich gelesen hat, oder an die Scham, bei manchen Kundinnen schon am Eingang zu wissen, dass sie Nicht ohne meine Tochter von Betty Mahmoody kaufen würden.“ – Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen! Auch diese beiden Autorinnen gehören unbedingt in meine Trendbücher-Liste. Aber wann soll ich die Zeit finden, so etwas zu lesen? „Damals,“ so heißt es zum Schluss über Bärbel Schmidt, „hätte sie die Bücher, die sie jetzt schreibt, nicht ins Sortiment genommen. Aber das ist lange her.“ (Marcus Jauer: Die Bestseller; in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 240 v. 15. Oktober 2011, S. 44.)
Eichhörnchens Mühsal
Wednesday, 25. January 2012Im neuen Jahr kommt im Antiquariat Revierflaneur durchschnittlich eine Bestellung pro Tag herein. Somit ist das Bestellaufkommen wieder leicht gestiegen, seit ich mein Angebot um Taschenbücher erweitert habe. Gestern zum Beispiel habe ich eine Sammlung von rund 50 Insel-Taschenbüchern online gestellt – und schon heute am frühen Morgen ging eine Bestellung eines Titels aus diesem Konvolut ein. Ich machte ihn gleich nach dem Frühstück versandfertig und brachte die Büchersendung zum Postkasten am Anfang der Oberstraße. Kaum hatte ich den Luftpolsterumschlag durch den Schlitz geschoben, da rutschte mir das Herz in die Hose: Ich hatte vergessen, den Umschlag zu frankieren! Wie ägerlich. Die nächste (und einzige) Leerung würde laut Anzeige auf dem gelben Kasten um 15:45 Uhr stattfinden. Also blieb mir nichts andres übrig, als mich um diese Zeit auf die Lauer zu legen und abzuwarten, bis der Fahrer auf seiner Tour hier vorbeikam, um ihn zu bitten, den Umschlag nachfrankieren zu dürfen. Nun wollte ich unbedingt sichergehen, dass ich nicht zu spät kam, denn heutzutage muss man ja damit rechnen, dass die Leerung vorzeitig stattfindet, weil der vermutlich schlecht bezahlte Leiharbeiter so bald wie möglich wieder daheim sein will. Also war ich bereits um 15:15 Uhr zur Stelle. Eine geschlagene Stunde später, durchgefroren wie ich inzwischen war, wollte ich gerade aufgeben, als der Wagen endlich vorfuhr. Ein offenbar sehr unter Zeitdruck stehender Hüne mit grimmer Miene wartete gar nicht erst ab, bis ich mein Begehren vorgetragen hatte, sondern blaffte mich gleich an: „Ich darf nix rausgeben. Verboten!“ Ich blieb freundlich und erklärte ihm behutsam den Fall. Darauf der ungehaltene Mann: „Aber wie sollen wir denn Ihren Brief finden, auf die Schnelle? Ich hab keine Zeit!“ Längst hatte ich meinen Umschlag erspäht und griff danach: „Da ist er schon.“ Passende Marken hatte ich vorbereitet, eine selbstklebende 55er sowie je eine 10er und 20er zum Anlecken. Nun waren aber meine Finger dermaßen steif von der Kälte, dass ich mich ungeschickt anstellte und prompt die 55er-Marke zerriss. Ich klebte sie leidlich zusammengefügt auf den Umschlag, die beiden anderen Marken kreuz und quer daneben. Nun fürchte ich, dass die maschinelle Portoerkennung bei der Post diese seltsame Frankierung nicht durchgehen lässt und somit mein ganzer Aufwand vergeblich war. Und dies alles für einen Rechnungsbetrag von 13,35 Euro! Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen …
Mohr und General
Monday, 16. January 2012Dieses Buch ist sogar im Wilpert-Gühring gelistet, dem Handbuch des Antiquars, das die Erstausgaben deutscher Dichtung verzeichnet und somit als Prüfstein dafür gilt, ob ein Buch wirklich als „EA“ angeboten werden kann und damit ein deutlich höherer Preis verlangt werden darf, als für alle späteren Auflagen des gleichen Titels. Allerdings haftet meinem Exemplar ein kleiner Fehler an, insofern es sich nur um die Taschenbuch-Ausgabe in zwei Bänden handelt, die zwar gleichzeitig mit der gebundenen Ausgabe herauskam, aber vermutlich für EA-Sammler nicht in Betracht kommt. Die Rede ist von der wundervollen Montage Gespräche mit Marx und Engels, die Hans Magnus Enzensberger 1973 für den Insel-Verlag zusammengestellt hat. Auf rund 700 Seiten versammelt das Werk Berichte von Augenzeugen, die den Theoretikern des wissenschaftlichen Sozialismus und Mitbegründern der „Internationale“ persönlich begegnet sind – und zwar in sehr unterschiedlicher Beziehung: als Freunde oder Feinde, Familienmitglieder oder Polizeispitzel, Genossen oder Abtrünnige. Dies Buch liest sich sehr lebendig und vermittelt gerade in seiner Widersprüchlichkeit einen ungleich glaubwürdigeren Eindruck von den Personen als die bekannten hagiographisch angelegten Lebensbeschreibungen. Im Anhang lässt Enzensberger dann noch Marx und Engels selbst zu Worte kommen, nämlich in einem „Injurien- und Elogenregister“, in dem er ein alphabetisches Namenverzeichnis der wichtigsten Gewährsleute seiner Montage mit den Äußerungen versieht, die Marx und Engels über diese von sich gaben. (Ich erinnere mich noch gut, dass der Schwall von Beschimpfungen, den die beiden über Bakunin ergießen, nicht wenig dazu beigetragen hat, mich fortan für den Anarchismus zu erwärmen.) – Im Wilpert-Gühring (2. Aufl.) findet man das Buch übrigens unterm Stichwort Enzensberger als Nr. 24.
Freitag der Dreizehnte
Friday, 13. January 2012Ob Glücks- oder Unglückstag – dieser Freitag hatte es in sich. Zum ersten Mal erreichte mein Antiquariat eine Bestellung aus dem ferneren fremdsprachigen Ausland. (Bislang kamen bloß Bestellungen aus Österreich und der Schweiz.) Ein Kunde aus New York orderte Martin Kippenbergers Frauen. Und welch ein Zufall, dass mein Ältester gerade noch in Essen weilt und mir erstens helfen konnte, per E-Mail die näheren Einzelheiten dieser Transaktion mit dem Kunden abzusprechen, because my English is not so good. Und zweitens nun das kleine Bändchen aus dem Merve-Verlag morgen auf seinen Flug nach New York mitnehmen kann. Der Kunde hat einen auf Künstlerbücher spezialisierten Laden in Greenwich Village und spart auf diese Weise 50 US-$ Transportkosten. Ich hoffe sehr, dass er meine erschöpfend ehrliche Beschreibung des Exemplares richtig verstanden hat und nicht enttäuscht ist. Es handelt sich um einen Fehldruck des Bandes 93 aus der Reihe Internationaler Merve Diskurs, bei dem eine Bogenseite nicht bedruckt wurde, weshalb acht Seiten leer sind. Auf zwei dieser Seiten habe ich seinerzeit Anfang der 1980er Jahre persönlich zwei mir „passend“ scheinende Schwarzweißfotos von Frauen eingeklebt. Zudem stattete ich das Büchlein mit einem zusätzlichen Umschlag aus, indem ich es mit einer Roth-Händle-Stangenverpackungsfolie beklebte [siehe Titelbild]. Leider ist es dadurch für jemanden, der es nicht kennt, kaum mehr zweifelsfrei zu identifizieren, da es drinnen keine Titelseite, kein Impressum usw. enthält. Das kann man ja übrigens auch in der Kippenberger-Biografie seiner Schwester Susanne nachlesen: „Zwischen all den komplizierten theorielastigen (post-)stukturalistischen Texten kam nun Martin mit einem Band, der nur aus Bildern bestand, in dem allein das drin war, was draußen draufstand, nicht mehr und nicht weniger: ,Frauen‘. Fremde Frauen, Freundinnen, Kolleginnen, unsere Mutter auch, lachend in seinem Arm. Die einzigen Worte haben auf dem Umschlag Platz: vorne Autor, Titel, Verlag, hinten das Impressum.“ (Susanne Kippenberger: Kippenberger. Der Künstler und seine Familie. Berlin: Berlin Verlag, 2007, S. 188.) Ich bin sehr gespannt, ob Mr B. D. bei der Übergabe keine Schwierigkeiten macht. Wie auch immer die Geschichte ausgeht, werde ich so auch nicht klüger, was die Frage betrifft, ob das heutige Datum nun ein glückliches oder unglückliches Omen bedeutet.
Am Rande bedacht
Wednesday, 04. January 2012In meiner Jugend war ich davon überzeugt, verrückt zu sein, weil ich mich als so sehr anders empfand als meine Klassenkameraden. Ich interessierte mich für Psychiatrie und fand bald heraus, dass die Gesundheit, die sie im Irren wiederherstellen wollte, nichts anderes war als eine gesellschaftliche Norm, angepasst an die Erfordernisse eines produktiven Gemeinwesens. So entdeckte ich bald die Anti-Psychiatrie und las dort mit Zustimmung, dass die Geschäftigkeiten dieses Gemeinwesens im Gegenteil auf die totale Destruktion hinausliefen: „Mit Sicherheit werden wir uns selbst ausrotten, falls wir nicht unser Verhalten befriedigender als gegenwärtig regulieren.“ Unbefriedigt wie ich war erschien mir dies sehr plausibel, ebenso wie die Beschreibung unserer Defizite, die uns zum Opfer unserer eigenen Einrichtungen und Gewohnheiten machten: „Wir sind nicht einmal fähig, das Verhalten am Rande des Abgrunds adäquat zu bedenken. Doch wir bedenken weniger, als wir wissen; wir wissen weniger, als wir lieben; wir lieben sehr viel weniger, als es gibt. Und wir sind präzise so viel weniger, als wir sind.“ Daraus zog ich den Schluss, dass ich all meine Anstrengungen darauf richten müsste, so viel zu werden wie ich war; so viel wie möglich von dem zu lieben, was es gab; alles zu wissen, was ich liebte; und alles zu bedenken, was ich dann wüsste – um schließlich mein Verhalten am Rande des Abgrunds immerhin adäquat bedenken zu können. Als ich aber bereits an der ersten Hürde gescheitert war, glaubte ich erkannt zu haben, dass ich meine Hoffnung nicht mehr auf mich selbst setzen konnte. Doch stand mir nicht zu, alle Hoffnungen fahren zu lassen: „Wer sind wir, daß wir entscheiden könnten, es gebe keine Hoffnung mehr?“ Zumindest sei ja, wie der Prophet der Anti-Psychiatrie schrieb, jedes Kind „ein potentieller Prophet, gestürzt in die äußere Dunkelheit.“ (Alle Zitate aus Ronald D. Laing: Phänomenologie der Erfahrung. A. d. Engl. v. Klaus Figge u. Waltraud Stein. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1969, S. 24.) – Wenn ich Texte wie diesen heute wieder lese, wundere ich mich sehr, dass mir damals ihr Predigtton gar nicht auffiel und -stieß.
Kreuzungen, Knochen
Tuesday, 03. January 2012Lyrik (1). Immer wieder kehre ich zu den Versen zurück, die mich mit achtzehn, neunzehn Jahren umwarfen. Als könnte ich an ihnen prüfen, ob ich mir treu geblieben bin? So singt die polnische Dichterin Wisława Szymborska 1957: „Vertraut mit den großen Räumen | zwischen Himmel und Erde | verlieren wir uns im Raum | zwischen Erde und Kopf. | Der Weg vom Leid zur Träne | ist interplanetarisch. | Unterwegs vom Trug zum Sein | ergraut unser Kinderschopf.“ Ja, ich empfinde die gleiche Verlorenheit – und in diesem Gefühl eine solche Nähe, zu der polnischen Dichterin und zu dem Jungen, der ich war, als ich diese Nähe und diese Verlorenheit zum ersten Mal spürte. Unsterbliche Gedichte können Wegmarken in der Zeit sein, wie Saurierknochen an Kreuzungen aufgepflanzt. Aber auf meinem Weg gibt es nur sehr wenige Marken dieser Art. Ich weiß nicht, ob ich das bedauern soll. (Wisława Szymborska: Den Freunden; in: Salz. A. d. Poln. v. Karl Dedecius. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1973, S. 94.)
Prozess-Ungeheuer
Monday, 02. January 2012Pünktlich zum Dickens-Jahr habe ich mit der Lektüre von Bleakhaus begonnen, in der Übersetzung von Gustav Meyrink und in einer wunderschönen, hundert Jahre alten dreibändigen Ausgabe des Verlags von Albert Langen in München. Man denke: noch mit Kustoden! Der Roman um die juristische Erbschaftsfehde Jarndyce kontra Jarndyce ist der neunte aus der Feder des produktiven Briten, entstanden zu Beginn seines fünften Lebensjahrzehnts. Schon im ersten Kapitel beeindruckt mich der Einfallsreichtum des Autors, wenn er die kaum glaubhafte Verschleppung des Urteils in diesem Prozess anhand überaus komischer Vergleiche und Maßstäbe deutlich werden lässt: „Der kleine Kläger oder Beklagte, dem man ein neues Schaukelpferd versprochen, wenn ,Jarndyce kontra Jarndyce‘ geschlichtet sein würde, ist darüber groß geworden, hat sich ein lebendes Pferd gekauft und ist in die andere Welt getrabt.“ (Bd. I, S. 11.) Nach dem wenig amüsanten Roman von Herrndorf verschafft meinem angeschlagenen Gemüt vielleicht, hoffentlich dieses wohl bei allem Sarkasmus unschuldig erheiternde Meisterwerk über menschliche Schwächen und Dummheiten den nötigen Ausgleich.
Langeweile. Nichts …
Saturday, 31. December 2011Zum Abschied von diesem Jahr muss ich meine größte, wichtigste Entdeckung dieses Jahres noch einmal zum Ausdruck bringen: die immer und überall unterschätzte destruktive Macht im Menschen, die ihn entweder vernichtet oder zu schrecklichen Taten treibt, die ihn über seine Verhältnisse leben, die Natur und damit seine Lebensgrundlagen zerstören lässt und deren so harmlos, schlicht, fade klingender Name da lautet: Langeweile! Natürlich bin ich nicht der Entdecker dieser unterschätzten und noch längst nicht ans Ende, oder besser: zu allen ihren Enden hin ausgedachten Erkenntnis. Zur Feier des Tages zitiere ich hier als einen frühen Gewährsmann Pascal: „Langeweile. Nichts ist dem Menschen unerträglicher als völlige Untätigkeit, als ohne Leidenschaften, ohne Geschäfte, ohne Zerstreuungen, ohne Aufgabe zu sein. Dann spürt er seine Nichtigkeit, seine Verlassenheit, sein Ungenügen, seine Abhängigkeit, seine Unmacht, seine Leere. Allsogleich wird dem Grunde seiner Seele die Langeweile entsteigen und die Düsternis, die Trauer, der Kummer, der Verdruß, die Verzweiflung.“ (Über die Religion und über einige andere Gegenstände (Pensées). A. d. Frz. v. Ewald Wasmuth. Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1978, S. 75.) – Aber wer verstünde mich, wenn ich bekennen würde, dass ich das neue Jahr 2012 einer genaueren Untersuchung der Langeweile, ihrer Ursachen und Folgen widmen will?
Schwindende Verstörung
Friday, 30. December 2011Manchmal erweist es sich als Vorteilhaft, noch ein paar mehr Bücher griffbereit zu haben als den engsten Kreis der dringlichst benötigten, die Tausendschönsten. In den letzten Tagen war ich wieder mit der bibliographischen Erfassung von Serien für mein Antiquariats-Angebot befasst, genauer gesagt mit der Reihe der Suhrkamp-Taschenbücher, die seit 1971 erscheinen. Heute stieß ich dabei in einem Tagebuch von Peter Handke auf Notizen aus seinem Pariser Krankenhausaufenthalt vom März 1976. Obwohl mich Handkes manierierte Prosa noch nie recht begeistern konnte, las ich doch diese Seiten mit einigem Interesse, Stellenweise gar mit Anteilnahme. Die Erklärungen für diese unübliche Empathie sind schnell bei der Hand. Einmal stehe ich, gerade acht Wochen nach meiner Klinikentlassung, noch immer unter dem wenngleich verblassenden Eindruck dieses Erlebnisses und finde in Handkes Schilderungen manche Ähnlichkeit zu eigenen Beobachtungen und Empfindungen. Hinzu kommt, dass ein mir sehr nahestehender Mensch neuerdings von dem gleichen Leiden betroffen ist, das zu Handkes Klinikeinweisung geführt hat. Ja, es ist seltsam, wie fremd man empfindet, wenn man aus einer solchen Angst zurück in die dumpfe Sorglosigkeit gestoßen wird: „An diesem schönstmöglichen Tag der Welt gehe ich, aus dem Krankenhaus weggelassen, umher mit dem Gefühl(?), ich hätte nichts versäumt, wenn ich jetzt tot wäre.“ Mir fiel heute auf einem gewohnten Weg, den ich wenige Tage nach meiner Entlassung beim erstmaligen Beschreiten voller Entzücken neu sah, dieses nun uneinholbar verlorene Glück wieder ein. Ein solcher Verlust! Und ich erinnere mich – aber auch das ist vergangen – an dieses verschobene Verhältnis zu den fremden Mitmenschen in den Straßen, wie es Handke offenbar ähnlich (und doch ganz anders) empfand: „Seltsam: daß ich es unter den jungen, übermütigen, ausgelüfteten, luftigen, lebenslustigen Menschen am Boulevard nicht mehr aushielt – und daß ich mich hier, im Park, unter Älteren, Müderen, Frauen mit Pudeln, Sitzenden auf den verrosteten grünen Eisenstühlen, Kindern, so viel wohler fühle!“ (Das Gewicht der Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1979, S. 90 f.) Kann man denn von einer solchen Erschütterung nicht mehr bewahren als ein paar spröde Zeilen und ein blasser werdendes Erinnern?
Lebens Zenit
Thursday, 29. December 2011Ein anderer Mann, für den ich früh allerhöchste Verehrung empfand und der im Laufe der Jahre nur immer noch in meiner Achtung stieg, ist Bertrand Russell. In seiner Autobiographie beschreibt er, wie er im Alter von gerade einmal 28 Jahren seinen großen intellektuellen Durchbruch erlebte: „Meine Empfindungen ähnelten denen, die einen überkommen, wenn man im Nebel einen Berg erklettert, bei Erreichung des Gipfels den Nebel plötzlich weichen und das Land auf fünfzig Kilometer im Umkreis klar vor sich liegen sieht.“ Solche Gefühle hatte ich ebenfalls, aus vermutlich viel geringerem Anlass, in meiner Kindheit. Allerdings waren sie nicht Ergebnis einer geistigen Anstrengung, sondern überkamen mich eher impulsiv. Plötzlich begriff ich etwa, dass alle Dinge immer herabfielen, wenn ich sie losließ, und dass dies doch eigentlich nicht selbstverständlich war. Oder ich entdeckte, dass mein Spiegelbild das gleiche tat wie ich, und zwar exakt gleichzeitig. Aber natürlich meint Lord Russell hier einen viel erhabeneren Erkenntnisschritt, wenn er fortfährt: „Intellektuell war der September 1900 der Höhepunkt meines Lebens. Ich sagte mir dauernd selbst vor, jetzt endlich hätte ich etwas geleistet, was der Mühe wert war, und auf der Straße meinte ich, ich müsse jetzt ganz besonders aufpassen, nicht überfahren zu werden, ehe ich das zu Papier gebracht habe.“ Genau diese Sorge ist mir ebenfalls vertraut. Sie betraf gewisse Einsichten, die mich unter dem Einfluss psychotroper Substanzen beschlichen hatten. Allerdings genügte es mir, sie einigen vertrauten Mitmenschen mündlich mitzuteilen, was ich heute sehr bedaure. Der absolut nüchterne Bertrand Russell hingegen war so viel klüger und fleißiger als ich: „Anfangs Oktober machte ich mich daran, The Principles of Mathematics niederzuschreiben, wozu ich schon mehrfach erfolglose Versuche unternommen hatte. […] Während der Monate Oktober, November und Dezember schrieb ich jeden Tag meine zehn Seiten, so daß das Manuskript am letzten Tag des Jahrhunderts beendet war […].“ (Autobiographie I. 1872-1914. A. d. Engl. v. Harry Kahn. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1977, S. 223 f.) Nein, solch edlen Höhepunkt meines Lebens, noch dazu mit präzisem Timing zur Jahrhundertwende, vermag ich nicht vorzuweisen. Ich bin wohl eher ein Mensch der Ebene denn ein Gipfelstürmer. Mir reicht es schon, wenn ich alltäglich einen kleinen geistigen Hüpfer machen kann. Und wenn es mir dann noch gelingt, ihn leidlich auf die Zeile zu bringen, dann bin ich froh.
Common Little Man
Wednesday, 28. December 2011Kaum jemand dürfte in seinen Jugendjahren einen solch übermäßigen Verschleiß von Vorbildern, Idolen, Vaterfiguren gehabt haben wie ich. Zwischen meinem sechzehnten und meinem neunzehnten Lebensjahr wechselte ich meine Hausgötter wie die Socken, meist trug ich mehrere gleichzeitig nebeneinander oder übereinander, teils in beißender Kombination. Und so innig ich jeden von ihnen liebte und verehrte, wenn ich gerade in frischer Liebe entbrannt war, so abgeschmackt und peinlich fand ich ihn bald darauf, wenn ich seine Schwächen und Begrenzungen erkannt zu haben meinte. Die Halbwertzeiten dieser Idolatrien wurden immer kürzer, meine Ansprüche an die Exzentrik meiner Vordenker immer strenger. – Wenn ich heute an diese Zeit der Unreife zurückdenke, ist Scham das vorherrschende Gefühl. Aber ein paar Namen kann ich heute noch nennen, ohne rot zu werden. Einer von ihnen ist Wilhelm Reich, von dem ich mich so unmittelbar angesprochen und durchschaut fühlte wie von kaum einem seiner Konkurrenten: „Ich sage dir, kleiner Mann: Du hast den Sinn für das Beste in dir verloren. Du hast es erstickt, und du mordest es, wo immer du es in anderen entdeckst, in deinen Kindern, deiner Frau, deinem Mann, deinem Vater und deiner Mutter. Du bist klein und willst klein bleiben, kleiner Mann.“ (Rede an den kleinen Mann. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1984, S. 31.) Bei aller Bizarrerie seiner Wolkenkanonen und Orgonakkumulatoren scheint mir Reich noch heute geadelt durch den Hass und die Verfolgungen, dener er seitens seiner Gegner ausgesetzt war. Wozu diese Hartnäckigkeit, dieser Vernichtungszwang gegen einen harmlosen Irren? Und noch heute komme ich nicht darüber weg, wie klar er selbst seinen Untergang prophezeit hat, ohne darüber doch jede Hoffnung aufzugeben: „Was immer nun du mir angetan hast oder noch antun wirst, ob du mich als Genie verklärst oder als Wahnsinnigen einsperrst, ob du mich nun als deinen Retter anbetest oder als Spion hängst oder räderst, früher oder später wirst du aus Not begreifen, daß ich die Gesetze des Lebendigen entdeckte und dir das Handwerkszeug gab, dein Leben mit Willen und Ziel zu lenken, wie du bisher nur Maschinen lenken konntest.“ (Ebd., S. 124.)
Krieg verbindet
Tuesday, 27. December 2011Am 30. März 1974 schreibt Peter Weiss, unterwegs zu Recherchen in Spanien, in sein Notizbuch: „Es gibt immer viel mehr, was die Menschen verbindet, als was sie trennt. Warum dann Krieg? Immer viel mehr verständnisvolle Menschen als rohe. Warum dann diese Destruktion?“ (Notizbücher 1971-1980. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981, S. 298.) Ich stutze. Stimmt das? Wie soll ich den Wahrheitsgehalt dieser Sätze prüfen? Ich vergleiche ihren Gehalt mit meinen eigenen, ganz persönlichen Erfahrungen. Wenn ich fremde Menschen kennenlerne, dann empfinde ich sie vielmehr immer als haupsächlich anders. Nach Gemeinsamkeiten, die mich mit ihnen verbinden, muss ich lange suchen. Und wenn ich mich bemühe, mich ihnen verständlich zu machen, dann gelingt mir dies eher selten. – Aber vielleicht war Weiss ja ein ganz anderer Mensch als ich? Ich muss sogar gestehen, dass ich nahezu täglich, wenn ich mich unter die Menschen mische, beim Einkaufen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder einfach auf der Straße, eine Rohheit wahrnehme, die mich verschreckt und die mein Verständnis überfordert. Allerdings sehe ich auch, dass die Menschen durch viele Gemeinsamkeiten einander immer ähnlicher zu werden scheinen; mir jedoch werden sie so immer fremder und bedrohlicher. Kann es sein, dass der Schriftsteller in seinem schwedischen Exilidyll ganz weltfremd geworden war? Mögen immerhin seine subjektiven Empfindungen von den braven Mitmenschen wahrhaftig gewesen sein – aber wie kann ein Intellektueller, der vom dialektischen Materialismus geprägt war, die Wirklichkeit des Krieges aus der Perspektive subjektiver Empfindungen in Frage stellen? Sehr sonderbar.
Sammlers Bescheidenheit
Sunday, 25. December 2011In den letzten Jahren habe ich das Interview als eine vollwertige literarische Kunstform entdeckt; was natürlich keineswegs bedeutet, dass nun Interviews, wie sie mit den langweiligen Prominenzen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltungsindustrie geführt und alltäglich in den Zeitungen und Magazinen veröffentlicht werden, per se schon Kunstwerke sind, die die Beachtung einer gebildeten Leserschaft und die Beurteilung der professionellen Kritik verdienten. Aber es gibt doch in diesem ohrenbetäubenden Allerweltspalaver immer wieder einmal Kleinodien des Gesprächs, der Befragung, die es verdienen, in eine Textsammlung der literarischen Meisterwerke aller Gattungen und Sprachen aufgenommen zu werden. Einige Interviews des im April dieses Jahres gestorbenen André Müller sind darunter; manche in der New Yorker Literaturzeitschrift Paris Review erschienene Autorengespräche; und viele verstreut veröffentlichte Einzelstücke, die ich hier und dort im Laufe von Jahrzehnten zusammengetragen habe, eine Sammlung, die es dringend nötig hat, gesichtet und ausgedünnt zu werden. Unbedingt würde ich die Gespräche hinzurechnen, die Osvaldo Ferrari 1984 bis 1986 in Genf mit Jorge Luis Borges geführt hat. Leider gibt es bisher nur eine Auswahl in deutscher Übersetzung (von Gisbert Haefs). Natürlich müssten aber auch Interviews mit jenen Unbekannten vertreten sein, die weniger durch ihren erlauchten Geist, durch ihre Beiträge zu Kunst und Wissenschaft unser Interesse verdienen, sondern allein durch das wahrhaftige Bekenntnis zu ihrem einfachen Leben, mit einem Wort: durch ihre Authentizität. Hier denke ich an Hubert Fichtes Interviews aus dem Palais d‘Amour oder die langen Interviews per brieflicher Befragung, die Paul Moor mit Jürgen Bartsch im Gefängnis geführt hat, um nur zwei Beispiele zu nennen, die mich nachhaltig geprägt haben. Natürlich gehören auch Verhöre hinzu, die Befragungen von Tätern und Zeugen vor Gericht. Zuletzt würde vielleicht ein tausendstimmiges Oratorium aus Fragen und Antworten dabei herauskommen, zwischen Himmel und Hölle, ohne Anfang und Ende. Alles Gerede mündete dann in diesen einen polyphonen Gesang, wie Mallarmé erklärt hat: „Tout au monde existe pour aboutir à un livre“, was Borges 1951 zum Motto seines Essays Vom Bücherkult machte, woran ihn Ferrari in einem seiner Interviews erinnerte. (Vgl. Lesen ist denken mit fremdem Gehirn. Zürich: Arche Verlag, 1990, S. 89.) – Vielleicht hätte ich mich doch mit dem ehrbaren Handwerk des Anthologisten bescheiden sollen, statt mich dazu berufen zu fühlen, selbst zu schreiben?
Zufall fleischgeworden
Friday, 23. December 2011In den letzten Wochen plagte mich erneut der Gedanke, nun vielleicht doch ein wenig Zeit darauf zu verwenden, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Aber warum? Weil ich zufällig wieder einmal in dem so sehr erheiternden Buch von Luke Rhinehart gelesen hatte, das ich vor 37 Jahren entdeckte und das meinen Lebensgang wenn nicht bestimmt, so doch in einem kleinen, aber feinen Moment beeinflusst hat. Und dort steht gleich im Vorwort der Satz: „Ich erzähle meine Lebensgeschichte aus jenem bescheidenen Grund, der bisher noch jeden Autobiographen zur Arbeit gedrängt hat: der Welt zu beweisen, daß ich ein großer Mann bin.“ (Der Würfler. A. d. Am. v. Franz Scharpfender. Wien, München, Zürich: Verlag Fritz Molden, 1972, S. 10.) Na, so bescheiden wie Rhinehart bin ich gerade nicht. Ich würde verlangen, dass ich mir durch das Aufschreiben meiner Lebensgeschichte selbst beweisen könnte, mein Leben nicht verfehlt zu haben. Und damit ich mir bei diesem Versuch nicht fortwährend etwas in die Tasche lügen könnte, würde ich mir einen unbefangenen und unbestechlichen Leser vorstellen, der schließlich über diese Frage zu entscheiden hätte. Keinen geringeren als dich.
Haufen Schlamm
Thursday, 22. December 2011Wie erscheint der Tod in Flauberts vielleicht größtem Roman, Bouvard et Pécuchet aus dem Jahr 1881? Ganz richtig, in Gestalt eines Hundes. Die berühmte Stelle hat es mir schon damals angetan, als ich das Buch zum ersten Male las, vor genau einem Vierteljahrhundert. Damals hatten wir noch keinen Hund. Mein Verhältnis zu Hunden war gestört, ich hatte Angst vor ihnen, wenn ich ihnen auf der Straße begegnete. Handelte es sich um besonders große Tiere, dann wechselte ich nicht selten den Bürgersteig, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Über Hundebesitzer, die ihr Tier nicht an der Leine führten, konnte ich mich sehr erregen. Einem toten und gar verwesenden Hund bin ich hingegen bisher noch nicht begegnet, wie es den Herren Pécuchet und Bouvard einst widerfuhr: „Kleine Schäfchenwolken standen am Himmel, die Glöckchen des Hafers wiegten sich im Wind, an einer Wiese murmelte ein Bach, als plötzlich ein furchtbarer Gestank sie stehenbleiben ließ, und sie sahen auf dem Kies zwischen Brombeergestrüpp den Kadaver eines Hundes liegen. Seine vier Glieder waren vertrocknet. Der weitgeöffnete Rachen entblößte unter bläulichen Lefzen elfenbeinweiße Fangzähne; an Stelle des Bauches war da ein erdfarbener Haufen Schlamm, der zu beben schien, so lebendig wimmelten darunter die Würmer. Sie kribbelten hin und her, von der Sonne beschienen, von Fliegen umsummt, in diesem unerträglichen Geruch, diesem wilden, gleichsam verzehrenden Geruch.“ (Gustave Flaubert: Bouvard und Pécuchet. A. d. Frz. v. Erich Marx. Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, 1959, S. 303.) Längst haben wir nun unseren Hund. Sie ist schon alt. Vielleicht sehr bald wird sie sterben. Aber den Würmern und Fliegen wollen wir sie nicht überlassen.
typographophobie tödlich
Wednesday, 21. December 2011„[…] ich sage die wahre geschichte von der anderen seite dem inneren entrissen mit vertauschten rollen ohne weiteren aufschub sie stießen mich in den schrank im zweiten stock ich spreche von uns in eine kiste schlugen mich grün und blau ansichtssache wie es hätte anfangen sollen in meinen kurzen hosen eines kleinen jungen ich spreche von mir schschsch es ist sommer wieder lügen wir müssen den jungen verstecken schschsch flüstert mutter unter tränen es tut weh ständig zu verlieren […]“ (Raymond Federman: Die Stimme im Schrank. A. d. Am. v. Peter Torwerk unter Mitarb. v. Silvia Morawetz. Hamburg: Kellner, 1989.) Dies ist immer der Ausgangspunkt auch für mich gewesen, das verwöhnte Jüngelchen aus den fetten Fünfzigern. Es hat aber von da an noch ein paar Jährchen gedauert, bis ich begriff, woher die Migräne kam. Bis ich aus der Kiste kriechen und den Schrecken hinterm schönen Schein von Geborgenheit erkennen konnte. Ja, es ist Ansichtssache, wie ich anfangen sollte. Ich suche noch immer das rechte Beginnen. Dieses Blog ist nur ein weiterer meiner vielen Umwege, eine erneute meiner zahllosen Ausreden. So sitze ich im Parterre und starre aus dem Fenster in den stillgelegten Haushaltswarenladen, während mich aus dem Hintergrund E2-E4 von Old Lazy Bones Manuel Göttsching am Leben hält.
Verklemmte Tür
Monday, 19. December 2011Auf seiner Polenreise im Herbst des Jahres 1924 kam Alfred Döblin auch nach Lublin. Dass er überhaupt eine solche Rundreise unternahm, darf verwundern, denn eigentlich hielt er, mir darin sehr ähnlich, vom Reisen gar nichts. Dass das Reisen bilde nannte er einen törichten Gemeinplatz, durch nichts belegt, weder durch eigene Erfahrung noch durch den Bildungsstand der Vielreisenden. Ich applaudiere! Dennoch lese ich seine Geschichten aus Polen teils mit großem Vergnügen, teils mit beträchtlichem Erstaunen, nahezu immer mit Gewinn. Was ihnen fehlt, das ist ein kleinster gemeinsamer Nenner des Themas, vielleicht auch ein stilistischer Bogen, der sich über allem wölbte, jedenfalls irgendetwas, das dem Buch die gewisse Geschlossenheit gäbe, die der Leser doch erwartet, wenngleich vielleicht nur aus alter Gewohnheit? Aber in Lublin, ja, da entdeckte ich nun etwas, das mich doch gegen das Buch einnahm. Döblin erzählt hier die Geschichte von seinem Aufenthalt in einem, „wie man sagt“, guten Hotel. „Zu den erstaunlichsten Dingen in diesem Hotel gehört meine Tür.“ Und nun erzählt er in Begriffen und Einzelheiten von der Besonderheit dieser Zimmertür, die sich verschließen lässt, aber nicht immer öffnen und beinahe nie ohne Mühen und Sorgen; erzählt dies umständlich und mit einer unterschwelligen Bedeutungslast versehen, dass man meint, dies müsse unbedingt von Franz Kafka stammen. Und so es denn nicht von diesem direkt gestohlen wurde, dann doch immerhin unverschämt nachgeäfft. Man bedenke, gerade in diesem Jahr war Kafka gestorben, im Wesentlichen unerkannt, aber doch immerhin einem Kreis von Kennern bekannt, wenn noch nicht durch seine Romane, so doch durch einen guten Teil seiner Erzählungen. Alfred Döblin wird diese Erzählungen gekannt haben. Ich will ihm auch nicht vorwerfen, dass er sich dem Einfluss dieses so viel Stärkeren nicht hat entziehen können, ihm willfahrte bis ins Imitat. Aber es ist schon ein starkes Stück, wenn man Stellen liest wie diese, über das Aufschließen der Zimmertür: „Das Schloß […] war völlig verstockt, von einer enormen Tiefe, durch die ganze massive Tür durch. Man durchbohrte mit dem Schlüssel die ganze Tür, stieß ihr mitten ins Herz und – kam innen heraus. Gerade das war falsch. Man mußte drin bleiben. Die Tür ließ dem Angreifer ruhig das Behagen, zuzustoßen, und schon saß er auf. Man mußte bei einer gewissen Tiefe haltmachen. Bei welcher: das war eben das Geheimnis. […] Ich betastete sorgfältig, zärtlich das Innere des Schlosses. Denn es hatte keinen Sinn, hier grob zu werden. Wie ein Tier ließ das Schloß alles mit sich machen. Ich suchte, gespannt, sehr höflich, scheinheilig. Endlich fand ich die fragliche Tiefe, drehte herum, einmal, zweimal, – manchmal [mein Herz erstarrte] dreimal, viermal, fünfmal. Es konnte immer so weiter gehen; ich würde nie ermitteln, wann ich aufzuhören hatte.“ (Alfred Döblin: Reise in Polen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1993, S. 163 f.) – Ins wirkliche Lublin musste der Autor nicht reisen, um dies schreiben zu können; aber vermutlich in Gedanken nach Prag. Reisen bildet nicht, sehr wohl aber Lesen.
Kullernde Kartoffeln
Saturday, 17. December 2011Manche Reiseberichte von Journalisten der „Siegermächte“ durchs demolierte Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden hierzulande in deutscher Übersetzung erst mit großem zeitlichen Abstand zum grausigen Geschehen veröffentlicht. Vor die Aufarbeitung haben die Götter die Verdrängung gesetzt! Der Schwede Stig Dagerman war mir zuerst 1977 durch sein Hörspiel Der Entdeckungsreisende aufgefallen. Ich las dann seine Erzählungssammlung Spiele der Nacht mit der atemberaubenden Miniatur Ein Kind töten. Deshalb musste ich zugreifen, als mir im Ramschkasten vor Baedeker auf der Kettwiger Straße Anfang der 1980er Jahre seine zwölf Reportagen aus dem verwüsteten Trizonesien vom Herbst 1946 in die Finger fielen. Als ich neulich wieder einmal in diesem leider etwas schlampig edierten Bändchen blätterte, stieß ich auf folgende Episode, die durch ihre filmreife Tragikomik beeindruckt. An einer stark frequentierten Brücke in Hamburg verkauft ein fliegender Händler ein Kartoffelschälmesser. Er findet wenig Zuspruch, denn Kartoffeln sind schließlich Mangelware. Vor diesem Hintergrund ereignet sich nun folgendes Missgeschick: „Eine kleine alte Tante mit einem großen Sack Kartoffeln hat es gerade in dem Augenblick geschafft, auf das Trittbrett der Bahn zu gelangen, als sich der Wagen in Bewegung setzt. Ihr Sack kippt um, die Schnur geht auf und die Alte schreit. Als der Wagen an uns vorbeirollt, beginnen die Kartoffeln gegen die Brückenführung zu trommeln. Im Gedränge um den Verkäufer entsteht plötzlich eine heftige Bewegung, und als die Straßenbahn die Brücke passiert hat, steht der Verkäufer beinahe allein am Geländer, während sich sein Publikum zwischen hupenden Armeefahrzeugen und kriegsbemalten Volkswagen um Kartoffeln schlägt. Schulbuben füllen ihre Ranzen, Arbeiter stopfen ihre Taschen voll, Hausfrauen öffnen ihre Handtaschen für Deutschlands meist gesuchte Frucht.“ (Stig Dagerman: Deutscher Herbst ’46. A. d. Schwed. v. Günter Barudio. Köln-Lövenich: „Hohenheim“-Verlag, 1981, S. 34.) – Zufällig zeigte ARTE nun den 2009 nach dieser Buchvorlage aus historischen Archivaufnahmen zusammengesetzten Dokumentarfilm 1946, Herbst in Deutschland von Michaël Gaumnitz. Und erstaunlicherweise gibt es darin eine Szene mit einem sehr ähnlichen Malheur, wenngleich dabei die Kartoffeln von einem Lkw herunterfallen. Könnte es etwa sein, dass Dagerman einige der von ihm beschriebenen Ereignisse gar nicht im wirklichen Leben, sondern bloß auf der Leinwand gesehen hat? Etwa in der Wochenschau Welt im Bild, die nach dem Zweiten Weltkrieg von der US-amerikanischen und britischen Besatzungsmacht in den intakten Münchner Bavaria-Studios produziert und vor den Filmaufführungen gezeigt wurde? – Und wenn! Würde es der Qualität und Authentizität von Dagermans „Augenzeugen“-Berichterstattung Abbruch tun?
Trockener Applaus
Friday, 16. December 2011Als Routineleser entwickelt man im Lauf der Jahrzehnte eine Dickfelligkeit, da muss schon Unerhörtes zwischen zwei Deckeln geschehen, damit man ein Buch nach ein paar Seiten aus der Hand legt und sagt: ,Puh! Das trifft mich ja ohne Unterlass ein ums andere Mal mitten ins Herz und mitten ins Hirn. Wie kann denn solch eine Übereinstimmung möglich sein?‘ Zuletzt widerfuhr mir das mit den Lektürenotizen von Gerhard Amanshauser, wo mir gleich zu Anfang mehrere meiner Hausgötter – Paul Scheerbart, Oskar Panizza, Fritz Mauthner – begegneten. Nun sind das ja nicht eben Allerweltsnamen, die einem alle Nasen lang in den Feuilletons begegnen. Aber um wie viel mehr musste mich entzücken, dass ich auch in den Antipathien Übereinstimmungen entdeckte, wie etwa gegen Thomas Bernhard, dem A. treffend einen „Manierismus des Schimpfens“ vorhält; oder gegen Peter Handke, dessen Künstler-Pose ich bereits in den 1970er Jahren affektiert fand, heute aber geradezu degoutant nennen muss. A. zitiert einen bekannten Ausspruch Handkes, der es „ein sicheres Zeichen“ nannte, dass einer „kein Künstler“ sei, wenn er das „Gerede von der ,Endzeit‘“ mitmache. Dieses Notat Handkes (aus Phantasien der Wiederholung von 1983) fand schon damals verschiedentlich Widerspruch, so des wackeren Wolfgang Hildesheimer, der es 1986 in einer Kritik in der Zeit schlicht „unverständlich“ nannte. Das wäre mir indes noch zu viel der Rücksichtnahme. Viel besser passt und so viel hellsichtiger ist A.s Verdikt von der „Tugendpest“, die sich in solchem Selbstverständnis des lobpreisenden Künstlers, des edlen, über alle schnöde Endlichkeit erhabenen Dichters kundtue. – Zu der hochgemuten Hymne des Novalis, zitiert nach den Paralipomena zu ,Die Lehrlinge zu Sais‘ vom Spätsommer 1798, die da lautet: „Der Mensch hat immer symbolische Philosophie seines Wesens – in seinen Werken und seinem Thun und Lassen ausgedrückt – Er verkündigt sich und sein Evangelium der Natur. Er ist der Messias der Natur“ … zu dieser Hymne auf das Wesen Mensch und des Menschen Wesen aus besseren Zeiten merkt A. bitter an: „Ein vermutlich mißlungenes Wesen, vor kurzer Zeit aus unglücklichen Zufällen entstanden und jüngst von einer seuchenartigen Vermehrung betroffen, die zu seinem baldigen Untergang führen muß, hält sich für den ,Messias der Natur‘. Allenfalls kann es noch den Titel ,Henker der Natur‘ für sich beanspruchen.“ – Ebenso schnöde wie wahr! (All dies gefunden und nachempfunden auf den ersten paar Seiten von Gerhard Amanshauser: Sondierungen und Resonanzen. Heidenreichstein: Verlag publication PN°1 Bibliothek der Provinz, o. J. [2007], S. 25-33.)
[Gewidmet Günter Landsberger, dessen Hinweis vom 20. August 2008 ich die Bekanntschaft mit A. und dem zitierten Buch verdanke.]
Wunder satt
Thursday, 15. December 2011Wenn man meint, als Leser viel Zeit sparen zu können, indem man sich mit dem Lesen von Aphorismen begnügt, der tägliche Kalenderspruch als Buchersatz für den eiligen Sinnsucher sozusagen, dann liegt man natürlich falsch, denn auf diesem Felde verliert man die scheinbar gewonnene Zeit bei der Sisyphusarbeit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Schlechte oder doch schwache Sprichwörter und Redewendungen, Zitate und Sentenzen sind leider die Regel, von der es bloß zwei seltene Ausnahmen gibt: Aphorismen, die nicht den geringsten Makel haben und unmittelbar erleuchten; und solche, die einen geringen Makel haben und dadurch mittelbar erhellen. Zur ersten Kategorie zähle ich eine Vielzahl der Sudelbuch-Notizen des unübertrefflichen Lichtenberg; zur zweiten beispielsweise ein paar Bemerkungen aus den Notizen von Ludwig Hohl, wie etwa diese: „Mir ist durchaus klar, daß es keinen Gott gibt. – Aber es gibt die Welt, das ist schon verwunderlich genug.“ (Die Notizen oder Von der unvoreiligen Versöhnung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981, S. 733.) Hieran ist mancherlei fragwürdig. Um die Nichtexistenz von etwas zu behaupten, muss man sich zunächst ja dessen „Wesen“ auf irgendeine Weise vorgestellt haben, seine Form und Beschaffenheit etwa, oder seine abstarkten Merkmale. Und dieser Vorstellungsinhalt muss auch meinem Gesprächspartner, Zuhörer, Leser vertraut sein, um meine Negation von dessen Existenz überhaupt verstehen, bejahen oder vielleicht auch ablehnen zu können. Ersetzte man das Wort Gott in Hohls Satz durch das Wort Xyll, so wüsste niemand, was gemeint ist, es sei denn, es gäbe ein solches Wort in einer fremden Sprache und der Angesprochene beherrschte zufällig dieses Idiom. Nun handelt es sich bei dem Wort Gott insofern um einen besonderen Typ von Substantiven, als ihm kein konkretes Ding in der sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit entspricht, von bildlichen Gottesdarstellungen aus der Zeit vor Erfindung der Fotografie und Berichten über Gotteserscheinungen einmal absehen. Insofern gibt es Gott durchaus, so wie es zum Beispiel auch das Einhorn gibt, allerdings nicht als reales Lebewesen auf unserer Erde, sondern als Fabeltier, das der Phantasie unserer Vorfahren entsprungen ist. Indirekt lassen sich aus Hohls Aphorismus zwei Fragen ableiten: Warum hatten unsere Ahnen es nötig, zu der doch wahrlich vor konkreten Wundern nur so strotzenden wirklichen Welt mancherlei Hirngespinste hinzuzuerfinden, mit denen sie ihre Sagen, Märchen und Mythen bevölkerten? Und zweitens: Warum tun sich auch heute noch viele Menschen, vermutlich sogar die große Mehrzahl der Zeitgenossen gegen alle Vernunft schwer damit, auf diese Selbsttäuschung zu verzichten? Insofern ist Ludwig Hohls Aphorismus nicht übel: Es ist ja nicht das schlechteste Ergebnis, wenn ein schiefer Satz aus seinem Dunkel zwei gerade Fragen ans Licht bringt.
Verspätete Grasmücken
Wednesday, 14. December 2011Gegen Klassiker gleich welcher Art hat man mir in der Schule eine Aversion antrainiert, gegen die ich bis heute nur schwer ankomme, obwohl ich längst begriffen habe, wie unvernünftig solche prinzipiellen Vorbehalte sind. Und doch mag ich meinen rebellischen Büchner lieber als den Geheimrat von Goethe, stelle den von Selbstzweifeln zerfressenen Robert Walser turmhoch über Thomas Mann, wie mir die Aberkennung der Mündigkeit eher ein Testat von Genialität zu sein scheint als die Verleihung des Nobelpreises. Wenn ich Goethe dankbar bin, dann zuallererst dafür, dass er einen Kauz wie Johann Peter Eckermann zum Protokollanten seiner alltäglichen mündlichen Belehrungen gemacht hat; allerdings nicht etwa, weil ich dieses nur zu oft neunmalkluge und selbstgefällige Geschwafle des greisen Dichters nicht entbehren könnte, sondern weil Eckermann selbst durch seine Protokolle der Vergessenheit entrissen wurde. So findet sich eine der schönsten Stellen in den Gesprächen mit Goethe für mich unterm Datum des 26. September 1827, an dem die beiden ungleichen Männer per Kutsche einen Ausflug zum Jagdschloss Ettersberg unternahmen: „Hinter Lützendorf, wo es stark bergan geht und wir nur Schritt fahren konnten, hatten wir zu allerlei Beobachtungen Gelegenheit. Goethe bemerkte rechts in den Hecken hinter dem Kammergut eine Menge Vögel und fragte mich, ob es Lerchen wären. – Du Großer und Lieber, dachte ich, der du die ganze Natur wie wenig andere durchforscht hast, in der Ornithologie scheinst du ein Kind zu sein!“ Und nun tauschen Goethe und sein „treuer Eckermann“ plötzlich die Rollen, letzterer ist mit einem Mal der Belehrende, während das große Genie sich in seiner ganzen naiven Kenntnislosigkeit offenbart; und was man immer behauptet: dass Goethe einer der letzten Generalisten gewesen sei, der das Wissen seiner Zeit noch in allen Bereichen überblicken konnte, es erweist sich hier als eine romantische Verklärung. „,Hm!‘ sagte Goethe, ,Sie scheinen in diesen Dingen nicht eben ein Neuling zu sein.‘“ Man beachte den peinlich späten Zeitpunkt dieser Erkenntnis! Seit gut vier Jahren kannte Goethe seinen Adlatus nun bereits, sah und sprach ihn zeitweise täglich – und hatte doch von dessen phänomenalen vogelkundlichen Kenntnissen bis zu diesem milden Herbsttag nicht das Mindeste gewusst. (Vgl. Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Hrsg. v. Adolf Bartels. Buchschmuck v. Walter Heßling. Jena: Eugen Diederichs, 1908, Bd. II, S. 331 ff.)
Bleibende Blüten
Tuesday, 13. December 2011Das Werk eines Lyrikers darf aber, ungeachtet dessen, was ich vorgestern zum Thema Anthologien gesagt habe, in besonderen Fällen durchaus auch in einer eigenständigen Buchausgabe zur Geltung kommen. Anders gesagt, es gibt Dichter, die mehr als die sprichwörtliche Handvoll großer Gedichte zu Papier gebracht haben, auf die Gottfried Benn grundsätzlich das bewahrenswerte Lebenswerk eines jeden Poeten beschränken wollte. Schließlich sollten wir doch wenigstens auf diesem über alle Regeln erhabenen Felde der Literatur von Prinzipien verschont bleiben! Und so habe ich auch nicht nötig zu begründen, warum Entsorgt von Nicolas Born auf der ewigen Hitliste jener Gedichte sehr weit oben steht, denen ich niemals untreu werden kann, die ich liebe, die mein Herz immer wieder verstören. Und allein um dieses Gedichtes willen ist es nötig, alle Gedichte von Born in einem dicken Band versammelt zu haben, bis zu dem allerletzten titellosen Vierzeiler aus dem Nachlass: „Als einmal der Zug in Fußgängertempo verfällt: | bleibende Blüten und Vogelstimmen: | wir sind zurückgekehrt | nur etwas verschlissen von Schnelligkeit.“ (Nicolas Born: Gedichte. Hrsg. v. Katharina Born. Göttingen: Wallstein Verlag, 2005, S. 235 f. und 401.)
Wesensschichten überwuchert
Monday, 12. December 2011Am 12. März 1922 erschien, mit dem Titel Die Wartenden überschrieben, in der Frankfurter Zeitung ein Essay von Siegfried Kracauer, der so beginnt: „Es gibt gegenwärtig eine große Anzahl von Menschen, die, ohne voneinander zu wissen, doch alle durch ein gemeinsames Los verbunden sind.“ Im Anschluss daran beschreibt der Autor moderne Großstädter mit Begriffen, bezeichnet ihre Stimmungen und Eigenschaften mit Ausdrücken, die mich selbst, nahezu neunzig Jahre später, zu der Annahme verführen, dass ich einer von diesen gewesen, so ich denn ihr Zeitgenosse hätte sein sollen. Kracauers Aufsatz mag aus heutiger Sicht vom Vorgefühl der bevorstehenden Katastrophe inspiriert erscheinen; das Erwartete, von dem er spricht, sich im Weltenbrand des Krieges und in der Shoah erfüllt haben. Warten ist in einer die Beschleunigung selbst perpetuierenden Gegenwart, die gar zu bald in jedem Augenblick schon Vergangenheit ist, keine zeitgemäße Haltung mehr. Aber was die vormals Wartenden zu Schicksalsgefährten machte, nämlich „das metaphysische Leiden an dem Mangel eines hohen Sinnes in der Welt, an ihrem Dasein im leeren Raum“, das dürfen wir auch jetzt noch als den blinden Fleck im bunten Panorama unserer Verstandeskonstruktionen erleiden, durch die wir unsere Tage leidlich ertragen. (Zit. nach Siegfried Kracauer: Das Ornament der Masse. Essays. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1963, S. 106.)
Metzelnde Mobile
Sunday, 11. December 2011Auch ein paar Anthologien sollen ihre Existenzberechtigung im meiner Sammlung behaupten, und zwar hauptsächlich, damit auch literarische Kurzformen wie Gedicht, Tagebuch-Aufzeichnung oder Brief zur angemessenen Geltung kommen. So erhalten Autoren Zutritt, die mir nie wichtig genug waren, um mir eines ihrer Werke anzuschaffen, aber immerhin durch diese Hintertür mit besonders geglückten Kostproben ihres Könnens einen der billigen Stehplätze beanspruchen mögen. Heute begrüße ich Léon Bloy, Vertreter eines anachronistischen katholischen Extremismus. Immerhin war der Mann intelligent genug, sich schon hundertundein Jahr vor der Jahrtausendwende nicht von dem Trubel mitreißen zu lassen, mit dem seine Zeitgenossen das Jahr Neunzehnhundert begrüßten, und lieferte im Oktober dieses Jahres in seinem Tagebuch dafür eine milchmädchenhaft einfache Begründung: „Viele Menschen wollten – und wollen noch heute – das Jahr 1900 zum ersten Jahre des 20. Jahrhunderts machen. Untrüglicher Beweis für das allerorts wahrzunehmende Absterben der menschlichen Vernunft. Als ob einer, der hundert Francs zu fordern hat, sich für bezahlt anzusehen hätte, wenn sein Schuldner ihm neunundneunzig auf den Tisch des Hauses hinzählt!“ (Zit. nach Gustav René Hocke: Europäische Tagebücher aus vier Jahrhunderten. Motive und Anthologie. Wiesbaden und München: Limes Verlag, 1986, S. 859.) Und im August des folgenden Jahres diagnostizierte er mit prophetischer Hellsicht eins der Grundübel des nun wirklich angebrochenen Jahrhunderts: „Auch Auto gibt’s. Teuflische, menschenmordende Besessenheit einer wildgewordenen Menschheit. Sicherheit auf den Straßen gab’s einmal. Heute morgen zeigte uns unser Kutscher eine dieser Maschinen, welche vor kurzem eine alte Frau überfahren und zu Tode gebracht hat und nun zu neuem Gemetzel gerüstet dasteht. Strafe natürlich gleich Null. Der ,Verkehrssünder‘, richtiger ,Amokläufer‘, mußte ein paar lumpige Taler auf den Tisch des Hauses zahlen und die Sache war abgetan.“ (Ebd., S. 863.)
Zurückweichende Merkmale
Saturday, 10. December 2011Manche Bücher behaupten ihren Platz in meiner nächsten Nähe allein als Muntermacher für getrübte Stimmungslagen. Aber ist das ein geringschätziges Urteil? Im Gegenteil. Nicht auszudenken, zu welchen nicht mehr gut zu machenden Kurzschlusshandlungen ich mich hätte hinreißen lassen, stünde nicht stets die entzückende Werkausgabe von Hector Hugh Munro in greifbarer Nähe. Überkommen mich wieder einmal Selbstvernichtungswünsche, dann reicht beispielsweise eine Personenbeschreibung aus seiner Feder wie diese, mich vom Rand des Abgrunds zurückzureißen: „Lucas war ein mehr als wohlgenährter Zeitgenosse, […] von einer Gesichtsfarbe, die bei Spargel als Zeichen höchster Kultur gelten mochte, in seinem Falle aber wohl nichts anderes war als das Ergebnis sorgfältig vermiedener körperlicher Ertüchtigung. Stirn und Haaransatz waren die einzig zurückweichenden Merkmale einer in jeder anderen Hinsicht aufdringlichen und anmaßenden Persönlichkeit.“ (Saki: Base Theresa; in: Biest und Überbiest. A. d. Engl. v. Claus Sprick. Zürich: Haffmans Verlag, S. 206.) Wenn der Tag mit dem Lachen über eine solche Charakterisierung beginnt, darf mir viel zustoßen, ohne mich zu erschüttern; endet er so, muss ich mindestens fünf weitere Saki-Geschichten lesen, bis ich einschlafen kann.
Hinterm Reiterhof
Friday, 09. December 2011Anfang der 1990er Jahre hatte ich die Marotte, Bücher per Stichprobe zu prüfen, indem ich genau eine Seite las. Es war keine willkürlich ausgewählt Seite, sondern prinzipiell die Seite 35. Wie ich gerade zu dieser Seitenzahl kam, das ist eine verwickelte Geschichte. Hier geht es mir um etwas anderes: „Die Krypta ist ein Kriminalroman, ein Kriminalroman in zwei Teilen, dessen zweiter Teil peinlichst genau alles das zerstört, was der erste sich aufzubauen bemüht hat […]“ – las ich Mitte Juni 1992 auf Seite 35 eines Romans, den mir Uschi Engelbrecht vom Hanser-Verlag „als ausgewiesenen [!] Oulipo-Fan“ zugeschickt hatte, verbunden „mit dem ausdrücklichen Wunsch, daß Sie aus dem Labyrinth des Buches, in dem man sich gerne verliert, wieder auftauchen.“ Zweimal Dankeschön für Uschi Engelbrecht: einmal für das Buch, das ich bis auf Seite 35 nicht gelesen habe; und zweitens für den Wunsch, der nicht in Erfüllung gegangen ist. Denn ich nahm den zitierten Satz über den wohl fiktiven Kriminalroman zum Anlass, selbst einen Kriminalroman zu schreiben, der nach dem besagten Strickmuster gebaut sein sollte. Dieses Unternehmen erwies sich allerdings recht bald als ein Labyrinth, aus dem ich streng genommen bis heute nicht wieder aufgetaucht bin. In zwei Punkten irrte freilich die freundliche Verlagsangestellte: Ich war und bin kein Oulipo-Fan, und schon erst recht kein „ausgewiesener“; und ich verliere mich nicht „gerne“, weder in Büchern noch in der Wirklichkeit. – Der zitierte Satz geht übrigens so weiter: „[…] das klassische Verfahren zahlreicher Rätsel-Romane, das hier auf einen fast karikaturistischen Höhepunkt getrieben wird.“ (Georges Perec: 53 Tage. A. d. Frz. v. Eugen Helmlé. München: Carl Hanser Verlag, 1992, S. 35.) Das mag für die Krypta stimmen, meine Furie hingegen verrennt sich in den uferlosen Ebenen der Langeweile.
Jacke wie Hose
Thursday, 08. December 2011Vor 350 Jahren berichtet Samuel Pepys vom Missgeschick eines Mr. Townsend, „daß er nämlich kürzlich mit beiden Beinen durch ein Hosenbein gestiegen und so den ganzen Tag herumgelaufen“ sei. (Tagebuch aus dem London des 17. Jahrhunderts. A. d. Engl. v. Helmut Winter. Stuttgart: Philipp Reclam, 1980, S. 69.) Wie soll man sich denn das vorstellen? Dann müsste Townsend Beine gehabt haben wie ein Storch; oder Hosen so weit wie Röcke? Übrigens bezeichnete das Wort Hose im Deutschen ja ursprünglich das einzelne Hosenbein, wie in dem berühmten Reklamespruch von Lichtenberg noch deutlich wird: „Wer zwei Paar Hosen hat, mache eins zu Geld und schaffe sich dieses Buch an.“ (Sudelbücher, Heft E, 79.) – Es hilft alles Deuten und Raten nichts, manche Stellen in alten Büchern muss man entweder für kryptisch oder für frech gelogen halten.
schlupp! zur Welt gebracht
Wednesday, 07. December 2011Was, würde ich mir wünschen, sollte ein ernst zu nehmender Kunstrichter hundert Jahre nach meinem Tod über mich und mein Geschreibsel urteilen? Schön wäre etwa: „Er ist die personifizierte Vollkommenheit; und man kann das eigentlich bloß konstatieren.“ So darf sich nur ein unterschätzter Kritiker über einen ebenso unterschätzten Poeten und Künstler äußern. Hier ist es Egon Friedell, den ich zitiere (Kulturgeschichte der Neuzeit. München: Verlag C. H. Beck, 1974, S. 1322) und dem ich unbedingt beipflichte, ist doch der so maßlos Verehrte kein geringerer als der allerfrüheste Urheber meines Kunstverstands, meiner Lachlust, meiner Melancholie. (Größenwahn ist in der Einsamkeit ein bezauberndes Gefühl.)
Grünspan fern der Heimat
Tuesday, 06. December 2011Was mich bei aller gefahrvollen Abenteuerlust früher Entdecker und Weltreisender stets am meisten beeindruckt hat, das ist ihr Wagemut, sich von allen üblichen Hilfs- und Rettungsmitteln der menschlichen Zivilisation so weit zu entfernen, dass in manchem Notfall einer Verletzung oder Erkrankung möglicherweise keinerlei Hoffnung auf Heilung mehr bestünde, die daheim noch zu kurieren gewesen wäre. Andererseits imponiert mir das praktische Wissen solcher Leute, wie sie sich in der Mannschaft des Kapitäns James Cook bei seiner zweiten Südseereise zusammengefunden hatten, die so leicht durch nichts zu erschüttern waren. – So berichtet etwa der neunzehnjährige Georg Forster ganz nebenbei, warum er sich am 23. April 1773 einem Landgang in der neuseeländischen Dusky-Bay nicht hatte anschließen können, den verschiedene Offiziere unternahmen. „Wir hätten sie gern begleitet; aber Durchlauf und Colik hielten uns am Bord zurück. Beydes kam von der Sorglosigkeit des Kochs her, der unser kupfernes Küchen-Geschirr ganz von Grünspan hatte anlaufen lassen.“ (Reise um die Welt. Hrsg. v. Gerhard Steiner. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1983, S. 177.) Wenn ich mir vorstelle, ich wüsste mich vor Leibkrämpfen, Durchfall und Erbrechen nicht zu halten, weit weg von jeder Ambulanz und jedem ärztlichen Rat; und dann zeigte mir so ein schmieriger Smutje seine grün angelaufenen Kupferpfannen und -töpfe … grauenhaft!
Leid entfesselt
Monday, 05. December 2011Ende der 1970er Jahre kursierte unter linken Antiquaren der Geheimtipp, dass Hugo Balls Die Flucht aus der Zeit von 1946 beim Verlag Josef Stocker in Luzern noch ganz regulär lieferbar sei; zwar keine Erstausgabe aus dem schmalen Werk des Dadaisten, denn ursprünglich waren diese Tagebuchnotizen 1927 bei Duncker & Humblot in München erschienen – aber immerhin! Auch ich orderte das Buch zum Listenpreis von 13,50 Schweizer Franken. Leider hat es einen braunen Fleck im Vorderschnitt. Ich lese: „Die Fehler, die man am andern entdeckt, sind oftmals nur die eigenen. Wer sich mit diesem Gedanken vertraut macht, hat großen Nutzen davon.“ (Eintrag vom 6. April 1920, S. 281.) Daran musste ich im Krankenhaus denken, als mir jeder meiner insgesamt fünf Zimmernachbarn seine halbe Lebens- und ganze Leidensgeschichte erzählte, ohne sich auch nur im Mindesten für mich und mein Ach und Weh zu interessieren. Aber ganz so war ich selbst ja bisher auch aufgetreten! Seither zügele ich mich immerhin gelegentlich, wenn meine Tiraden und Jammerarien mich wieder einmal mit sich reißen wollen und unaufmerksam zu machen drohen fürs nicht minder traurige Los meiner Zuhörer.
Schmerz vergangen
Sunday, 04. December 2011Früher hatte ich noch die schlechte Angewohnheit, meinen Namen und das Anschaffungsdatum in meine Bücher zu schreiben. Glücklicherweise muss mir sehr bald ein kundiger Kollege in der Buchhandlung, in der ich seit dem 16. Oktober 1978 arbeitete, den Tipp gegeben haben, meinen Besitzvermerk wenn schon dann jedenfalls nicht auf die Titelseite zu schreiben, die sei so etwas wie das Hymen des Buches und müsse unbedingt rein und unbeschädigt bleiben. Vielleicht das allererste Buch, das ich an meinem ersten Arbeitsplatz mit Kollegenrabatt erwarb, war eine gebundene Ausgabe der Tagebücher von Franz Kafka (Hrsg. v. Max Brod. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1967). Darin strich ich irgendwann eine Stelle aus dem März 1922 an, als der Autor gerade noch zwei Jahre zu leben hatte: „Früher, wenn ich einen Schmerz hatte und er verging, war ich glücklich, jetzt bin ich nur erleichtert, habe aber das bittere Gefühl: ,wieder nur gesund, nicht mehr‘.“ (S. 415.) – Diese Wandlung habe ich, wie es scheint, nun auch durchgemacht, wenngleich ich eher von einem flauen denn von einem bitteren Gefühl sprechen möchte.
Kopfschnitt entstaubt
Saturday, 03. December 2011Als ich in nur einer Woche meine gesamte Arbeitsbibliothek neu ordnete, blieben für jedes Buch im Mittel gerade mal ein paar Minuten Aufmerksamkeit. Damit diese Schnelldurchsicht – vom eigentlichen Zweck der Übung, der Neuordnung, einmal abgesehen – nicht ganz nutzlos sein sollte, blätterte ich die meisten Bücher wenigstens kurz an, las hier und da wahllos ein paar Zeilen, schaute ins Inhaltsverzeichnis oder ins Register. Und wenn ich dabei, was nicht eben selten geschah, eine Stelle erspähte, die mein Interesse weckte, dann legte ich dort zwischen die Seiten einen jener postkartengroßen, hauchdünnen, säurefreien Notizzettel, die ich schon seit vielen Jahren als Lesezeichen und Vorratsspeicher für Gedankenblitze nutze. Gelegentlich notierte ich auf diese Blättchen mit spitzem Bleistift ein paar Ideensplitter, eine Assoziation oder eine Frage, zu der mich die vom Zufall ausgewählte Textstelle angeregt hatte und die ich einer genaueren Betrachtung zu einem späteren Zeitpunkt für wert befand. Und vielleicht würde hieraus ja der eine oder andere Beitrag zu meinem Blog heranreifen?
Geist händisch
Friday, 02. December 2011Nach einer Lebenskrise habe ich immer das Verlangen, Ordnung zu schaffen. So war ich diesmal, nach der Rückkehr aus der Klinik, zunächst zu keiner anderen Handlung in der Lage, als etwas zu tun, das ich schon lange vor mir hergeschoben und zu dem ich mich dank vermeintlich wichtigerer Aufgaben doch nie hatte aufraffen können: meine Büchersammlung zu ordnen. Jeder, der aus einer großen in eine wesentlich kleinere Wohnung umziehen musste, kennt die Schwierigkeit, alles Hab und Gut in die neue, knappe Behausung so hineinzustopfen, dass man noch einigermaßen weiß, wo was zu finden ist. So lebte ich in meiner Bibliothek seit Sommer vorletzten Jahres im quälenden Dauerzustand einer Unübersichtlichkeit, die das glückliche Finden eines bestimmten Buches zum Zufall und das zufällige Entdecken eines längst nicht mehr vermissten Buches zur Regel werden ließ. Dies mag für eine Weile reizvoll sein. Und so bewog mich mein sanguinisches Temperament sehr bald, mir diese eigentlich unbefriedigende Arbeitsbedingung als eine weitere Exzentrizität meines kauzigen Wesens schönzureden. Wenn ich nach dem Wortlaut eines Satzes aus Wittgensteins Tractatus suchen wollte, aber leider das Buch nicht fand und mir stattdessen Hebbels Tagebücher in die Hände fielen, dann blätterte ich darin so lange, bis ich auf einen Ausspruch stieß, der mir noch ungleich besser in den Zusammenhang zu passen schien. Wenn es stimmt, dass Not erfinderisch macht, dann gilt nach meiner Erfahrung erst recht, dass Faulheit zu wahren Geniestreichen verleiten kann – gelegentlich jedenfalls. Da ich nun aber die neu gewonnene Lebensperspektive nutzen wollte, um manche träge Gewohnheit und insbesondere auch meine Arbeitsweise zu überdenken, begann ich gleich mit der übelsten Kärrnerarbeit und räumte die Bibliothek meines Arbeitszimmers vollständig aus den Regalen, sortierte sie und räumte sie anschließend wieder ein. Das klingt, so leicht dahingesagt, wie ein Handumdrehen, fühlt sich aber in der Wirklichkeit eher an wie das Zermahlen aller Knochen im Fleische. Was mich dennoch halbwegs bei Laune hielt, das waren die vielfältigen Wiedersehensfreuden, wenn mancher längst vergessene Schatz, seit gefühlten Ewigkeiten in der zweiten Reihe schmachtend, wohin die Willkür des chaotischen Einzugs ihn verbannt hatte, plötzlich wieder sein Präsenzrecht behaupten durfte. Jedenfalls reichten solche Glücksimpulse, um aus den finsteren Tälern grenzenloser Erschöpfung immer wieder heraufzufinden ans Licht. Nun umgibt mich die Handbibliothek in feinster Ordnung, ich weiß wieder, was sie birgt und wozu ich sie nutzen kann. Die wertvollste Erfahrung aber, die mir dieser körperliche Gewaltakt bescherte, soll diesen knappen Expeditionsbericht krönen. Mir wurde doch deutlich wie nie zuvor, welch unersetzlichen Wert eine solche Textsammlung in ihrer Konkretion als Fülle von mit Händen greifbaren Büchern hat. Besäße ich diese ungefähr tausend Werke stattdessen als Textdateien auf einer Festplatte, wäre die Aufgabe einer Neusortierung oder Umstrukturierung gewiss mit ein paar Anschlägen auf der Tastatur zu erledigen gewesen. Aber diese kinderleichte Arbeit in Minutenschnelle hätte auch keinerlei Spuren bei mir hinterlassen, von Glücksmomenten ganz zu schweigen. Es ist eben so viel mehr als nur verdrossene Treue zu einem antiquierten Medium, das uns Hirntiere zu Skeptikern angesichts der bevorstehenden E-Book-Revolution macht. Wenn man den Geist von seinen mit Händen greifbaren Werkzeugen nimmt und in einem virtuellen Raum isoliert, dann wird eine grauenhafte Verödung die Folge sein – für den Geist so sehr wie für die wirkliche Welt.
Kürzer treten
Thursday, 01. December 2011Die Entwürfe zu diesem ersten Posting nach der langen Krankheitspause hätten den Brennstoff liefern können zu einem völlig neuen Blog mit dem Titel Scheiterhaufen. So nannte ich einst im paranoiden Jahr 1984 mit vollem Recht einen ersten Romanversuch, dessen Überbleibsel noch irgendwo auf meiner Spur durch verschollene Keller und Speicher in schimmelnden Kisten gammeln mögen. Aber daran wollte ich nun doch nicht anknüpfen, denn schließlich war es alles nichts, was ich mir da so zusammenspann in den vergangenen endlosen Wochen – und nichts schien selbst mir ein wenig zu gering. Nun hatte ich mir aber frühzeitig für den Neubeginn ein Ultimatum gesetzt; nämlich heute. Ich bin ja, was die Inspiration betrifft, ein etwas kauziger Fall. Wenn eine erlösende Eingebung hartnäckig sich verweigert, dann führe ich sie per höchstrichterlichem Beschluss herbei. Hiernach lautet ab dato die formale Regel für alle künftigen Beiträge in diesem Blog, dass sie nurmehr einen Absatz haben sollen, statt wie bisher deren fünf. Das wird zweifellos auf den Stil, die Tendenz, die Frequenz und den Inhalt meiner Kurzprosa Auswirkungen haben, von denen ich mich aber ebenso überraschen lassen muss wie die geschätzte Leserin, der geneigte Leser.
Melancholie unterm Regenbogen
Thursday, 15. September 2011In den vergangenen Tagen habe ich meine Sammlung von Taschenbüchern aus der edition suhrkamp für die Angebotsliste meines Versandantiquariats erfasst. Der Anschaffungszeitraum reicht von 1972 bis 1992. (Danach habe ich wohl auch noch das eine oder andere Bändchen dieser bunten Reihe erworben, doch stehen diese „jüngeren“ Bücher noch nicht zum Verkauf.)
Der geniale Einfall von Willy Fleckhaus, die Umschläge der ersten Taschenbücher im Suhrkamp-Verlag ohne Abbildungen zu gestalten, einfarbig und mit einer schlichten Linotype Garamond; und dass die Farben in der Zusammenschau aller Bände das gesamte Spektrum abbildeten – dieser Einfall hat sicher manchen Buchliebhaber dazu verführt, möglichst ausreichend viele dieser Bändchen zu erwerben, um daraus einen schönen Regenbogen ins Regal zaubern zu können. Nur die von Hannes Jähn gestalteten Taschenbücher der Sammlung Luchterhand kamen noch puristischer daher; und die erschienen erst sieben Jahre später. Alle anderen „pocket books“ in Deutschland, ob von Rowohlt, Fischer, Heyne, Ullstein oder Goldmann, imitierten ihre Vorbilder aus den angloamerikanischen Verlagen und gingen mit schreiend bunten Titelbildern auf Kundenfang.
Mit dem Erscheinen des ersten Bändchens in der edition suhrkamp, Bertolt Brechts Leben des Galilei, war das Taschenbuch 1964 endlich „stubenrein“ geworden. Anfangs wurden die Billigbücher mit solch reißerischen Reihennamen wie rororo von seriösen Buchhändlern ja noch boykottiert, wobei sich hinter dieser Hochnäsigkeit handfeste wirtschaftliche Bedenken verbargen. Die Sortimenter der 1950er-Jahre fürchteten nämlich, das wachsende Angebot billiger Taschenbücher würde bald die Preise für „richtige“ Bücher kaputt machen. Aber auch von den typischen Taschenbuchpreisen, die immer auf 80 Pfennig endeten, grenzte sich Suhrkamp bewusst mit runden D-Mark-Preisen ab. In der gleichen Zeit warb Reemtsma für seine Zigarettenmarke Atika mit dem Slogan: „Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.“ Ich müsste mich sehr irren, wenn diese Glimmstängel nicht auch einen glatten Preis gehabt hätten. (In den 1960er-Jahren kostete eine Schachtel mit 21 Zigaretten der Marke HB 1,90 DM.)
Was waren das also für besondere Geschmäcker, die diese Taschenbücher bevorzugten? Schüler der Frankfurter Schule, bewegte Studenten, Intellektuelle, Sozialkritiker, Fortschrittliche, Experimentierer, Alternative.
Indem ich nun jeden einzelnen dieser 115 Bände in die Hand genommen und mehr oder weniger gründlich inspiziert habe, musste ich feststellen, dass ich mich an die meisten kaum mehr erinnern konnte. Woraus hatte sich der Kaufimpuls genährt? Warum interessierte ich mich beispielsweise für Sozialistische Realismuskonzeptionen, nachvollziehbar gemacht durch „Dokumente zum 1. Allunionskongreß der Sowjetschriftsteller“? Das scheint auf den ersten Griff völlig unerfindlich. Schlage ich das Buch aber auf, entdecke ich eine hoffnungsvolle Rede von Ernst Toller, gehalten am 28. August 1934 in Moskau. Keine fünf Jahre später erhängte er sich in New York. Auch ein langer Bericht von Klaus Mann ist hier abgedruckt, voller Optimismus noch. Doch, es könnte lohnend sein, sich diese Dokumente einmal genauer anzuschauen. Jetzt stelle ich sie für 6,50 Euro beim ZVAB online; es ist ja kaum wahrscheinlich, dass sie einen Liebhaber finden.
Deutschland umsonst (II)
Friday, 22. July 2011Nun habe ich Michael Holzachs letztes Buch ausgelesen. Es hielt zugleich weniger und mehr, als ich mir von ihm versprochen hatte. Ich will mit den Defiziten beginnen.
Für einen Fußmarsch von fast einem halben Jahr fällt die Ausbeute an Erlebnissen, Beobachtungen, Gedanken und Gefühlen eher mager aus, und dies erst recht, wenn man noch die reinen Phantasiebilder abzieht, die der Autor gelegentlich einstreut, und außerdem jene Passagen, in denen er Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend mitteilt, aufgerührt durch den Besuch von Ortschaften, in denen er früher einmal gelebt hat. Es entsteht der Eindruck, dass Holzach eigentlich verschiedene Bücher hat schreiben wollen. Der Versuch, gleich mehrere Konzepte zwischen nur zwei Deckel zu pressen, ist gründlich missraten. Die Verarbeitung einer teils als traumatisch erlebten Vergangenheit, die Erkundung sozialer Missstände in einem Wohlfahrtsstaat der 1980er-Jahre, das Abenteuer eines Gewaltmarsches unter Verzicht auf Geld und Beförderungsmittel, die Erkundung der eigenen psychischen und physischen Grenzen – daraus hätte man gut vier Bücher machen können; und vermutlich vier bessere Bücher als dieses, das von allem etwas bringt, aber von allem zu wenig.
Wenn dennoch mache Episoden haften bleiben, als Momentaufnahmen ohne Ansehen ihrer Bedeutung im Gesamtzusammenhang der Geschichte, dann spricht dies für die gelegentlich scharfe, fast mikroskopische Beobachtungsgabe und Darstellungssorgfalt des Autors. Als vielleicht besonders treffendes Beispiel für diese Qualität fällt mir die Einlösung einer „Durchreisebeihilfe“ in Form eines „Lebensmittelgutscheins“ ein, bei der es darum geht, die großzügig gewährten acht Mark („in Worten, acht, Spirituosen- und Tabakwaren ausgenommen“) möglichst auf den Pfennig genau auszuschöpfen. (Holzach, a.a.O., S. 88 f.) Auch sind die meisten der zahllosen knappen Porträts von Weggefährten, Obdach- und Arbeitgebern und Obrigkeitsvertretern markant, glaubwürdig und einprägsam. Dass der Autor Humor hat, zeigt sich am deutlichsten an diesen Karikaturen.
Ein lustiges Buch ist dies aber nicht. Dafür sorgt von der ersten bis zur letzten Seite ein melancholischer Grundton. Die Tristesse der Unbehaustheit ist stellenweise so bedrückend, dass man versucht ist, Deutschland umsonst vorzeitig aus der Hand zu legen. Alkoholismus wird vielfach als eine Hauptursache für Obdachlosigkeit angeführt. Wenn man dieses Buch gelesen hat, begreift man, dass andersrum auch ein Schuh draus wird: Obdachlosigkeit ist nämlich ohne Alkohol auf längere Sicht kaum zu ertragen.
Bleibt die Frage, um die es ja in dieser Serie über Trendbücher vordergründig geht: Was hat Michael Holzachs Reisebeschreibung durch ein Wohlstandsland für mehr als zwei Jahrzehnte zu einem solchen Dauerbrenner gemacht? Einmal steht das Buch in enger Verwandtschaft zum Werk von Günter Wallraff, der ja mit seinen „unerwünschten Reportagen“ seit 1969 vorgemacht hat, wie man durch das Ausprobieren von riskanten Lebensumständen zu aufschlussreichen Erfahrungen kommt und mit den abenteuerlichen Berichten darüber viele Leser findet. Zweitens macht der genial-knappe Titel neugierig auf eine Erfahrung, die niemand freiwillig machen möchte, die jeden mindetens theoretisch bedroht und auf die man sich darum gern einmal in der Phantasie einlässt – in der Erwartung schauriger Details, aber vielleicht auch in der Hoffnung auf praktische Ratschläge, die einem notfalls nützlich sein könnten: Man weiß ja nie! Und drittens hat vermutlich das tragische Ende des Autors dazu beigetragen, dass er nun von einer Aureole der Lauterkeit umgeben ist: Der Mensch, der sein Leben für einen Hund opferte. (Die Verfilmung als vierteilige TV-Serie unter dem Titel Zu Fuß und ohne Geld aus dem Jahre 1995 setzte vermutlich einen weiteren Kaufimpuls, indem viele vorherige Leser sie damit kommentierten, das Buch sei aber besser.)
Deutschland umsonst (I)
Monday, 04. July 2011Dieses Buch werde ich wohl damals stapelweise verkauft haben, im Jahr 1982, als es erschien. Die gebundene Ausgabe im Verlag Hoffmann und Campe in Hamburg ging drei Jahre lang weg wie geschnitten Brot, zehn Auflagen und fast hunderttausend Exemplare wurden zum Stückpreis von 28 Mark abgesetzt, und dann noch einmal so viel als Ullstein-Taschenbuch für 7,80 Mark. Üblicherweise ist ein Bestseller dann vom Tisch. Aber bei Michael Holzachs Reisebericht Deutschland umsonst wagte HoCa 1993 gar noch einen weiteren Aufguss, diesmal als Paperback für 18 Mark; und auch der war immerhin noch so erfolgreich, dass er es bis 2006 auf solze 13 Auflagen brachte! Was ist bloß dran an diesem Buch? Ich wollte es wissen und lese es gerade.
Den Anstoß zu meiner Erinnerung an den Bericht eines jungen Mannes, der „zu Fuß und ohne Geld durch ein Wohlstandsland“ wandert – so die bündige Zusammenfassung des Themas im Untertitel –, gab mir indirekt dessen ehemaliger Weggefährte, der Essener Fotograf Timm Rautert, der regelmäßig bei proust ausstellt und auftritt. Als ich mich in der Wikipedia über Rautert informierte, las ich über ihn, er habe seit 1974 für das ZEITmagazin „in enger Kooperation mit dem Journalisten Michael Holzach überwiegend sozialkritische Themen“ fotografiert. Ein Klick auf Michael Holzach und es machte Klick! Ich erinnerte mich augenblicklich wieder an dessen Dauerbrenner von vor nahezu dreißig Jahren. Dass der Autor 1983 auf so tragische Weise ums Leben gekommen war, wusste ich nicht – oder hatte es jedenfalls längst vergessen.
Die Erstausgabe von Deutschland umsonst bekam ich antiquarisch über ZVAB zum Preis von 10,40 €, zwar leicht schiefgelesen und, dem Geruch nach zu urteilen, aus einem Raucherhaushalt, aber ansonsten sauber und mit tadellosem Schutzumschlag – an den ich mich prompt erinnerte, als ich das Buch in Händen hielt. Das Titelfoto stammt von Rautert und zeigt den Autor mit seinem Hund Feldmann, einem Boxermischling aus dem Hamburger Tierasyl, der ihn auf seiner Wanderschaft begleitete und schließlich Holzachs Tod verursachte.
Wie es dazu kam, dass Holzach sich 1980 für ein halbes Jahr ohne einen Pfennig Geld auf den Weg machte und die Bundesrepublik von Nord nach Süd und wieder zurück durchwanderte, das beschreibt er ziemlich genau in der Mitte seines Buches, unmittelbar bevor er sich mit Timm Rautert an der Kanalbrücke in Altenessen trifft. Er empfand damals sein Leben als „sozial engagierter Journalist“ auf die Dauer als pure Heuchelei. Die ging ihm schließlich so sehr an die Nieren, dass er seinen guten Job bei der ZEIT an den Nagel hängte. Für ein Jahr lebte er bei der deutschstämmigen Wiedertäufersekte der Hutterer in Kanada, die einen urchristlichen Kommunismus praktiziert. (Auch über dieses Abenteuer schrieb er ein Buch, Das vergessene Volk.) Und dann, so Holzach, „grub ich meinen alten Plan wieder aus, eine autobiographische Wanderung durch Deutschland zu machen“ – autobiographisch insofern, als er all jene Orte aufsuchte, die in seinem Leben irgendwann eine besondere Rolle gespielt hatten, wie Holzminden, Heppenheim oder Bergisch-Gladbach.
Was Holzach unterwegs erlebt, lässt sich keineswegs auf einen einfachen Nenner bringen, obwohl das Buch sich damals vielleicht mittels solcher Vereinfachungen vermarkten ließ: ,Mitten im Wohlstandsland BRD herrscht das bitterste Elend und hält jene grausam umklammert, die einmal schuldlos aus der bürgerlichen Ordnung gefallen sind.‘ Das ist aber keineswegs die Botschaft, die das Buch vermittelt. Eher geht es um die Selbsterfahrung des Autors, der wissen möchte, was mit ihm geschieht, wenn er sich ohne Geld durchschlagen muss. Aber erklärt die Neugier am Verlauf eines solchen Experiments allein schon den sensationellen Verkaufserfolg dieses Buches? Das kann ich nicht recht glauben.
[Fortsetzung folgt. – Titelbild © Timm Rautert & Verlag Hoffmann und Campe.]
Plan einer Trendbuch-Analyse (1955-2005)
Wednesday, 29. June 2011Vor drei Jahren wurde ich von meiner Ansprechpartnerin bei Westropolis mal gebeten, einen „Beitrag über die Literatur der 1980er Jahre“ zu schreiben. Auf meine Nachfrage, was genau damit denn gemeint sei, stellte sich heraus, dass es um die in Deutschland damals erfolgreichsten Bücher gehen sollte, und unter diesen dann möglichst um solche, die den „Geist des Jahrzehnts“ besonders gut zum Ausdruck brächten. Das dürften Romane so gut wie Sachbücher sein! Die anderen freien Autoren des Kulturblogs der WAZ-Mediengruppe sollten parallel dazu die Musik, die Kunst, den Film und die Mode der 80er in Erinnerung bringen.
Wenn ich mich nicht sehr irre, war ich dann schließlich der einzige Gastautor, der den Auftrag ernst nahm und sein Soll erfüllte; kein Wunder, denn es stellte sich bald heraus, dass die Aufgabe mit einigem Aufwand verbunden war. Dabei hatte ich noch einen berufsbedingten Startvorteil, war ich doch im fraglichen Jahrzehnt ohne Unterbrechung als Buchhändler mit allen damals aktuellen literarischen Trends hautnah in Berührung gekommen. Und dennoch erswies sich ein erstes Brainstorming noch nicht als sehr ergiebig, zumal ich bei jedem zweiten Titel, der mir spontan einfiel, nicht hundertprozentig sicher war, ob er denn nun wirklich in diesem Jahrzehnt das Licht der Welt erblickt hatte. Ich hatte also einiges zu recherchieren und musste zudem die Spiegel-Bestsellerlisten der Jahre 1981 bis 1990 durchsehen, um meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen.
Was dabei herauskam, waren zwei Folgen Literatur der Achtziger, eine über Sachbücher und eine über die Belletristik dieses Dezenniums. In diesem Falle glaube ich nicht, dass es sich lohnt, meine alten Texte für Ostropolis zu überarbeiten. Sehr wohl aber scheint mir ihr Thema noch immer reizvoll, wenngleich nicht mit der willkürlichen Limitierung auf ein Jahrzehnt. Dass jedoch der Erfolg von Büchern etwas aussagt über das Denken und Empfinden der Menschen in der Zeit, in der diese Bücher – zur Freude ihrer Verleger und der Buchhändler – jene als Leser in großer Zahl für sich gewinnen, das erscheint mir immer noch evident und einer eingehenderen Betrachtung würdig.
Wenn von Erfolgsbüchern die Rede ist, dann meint man damit entweder Bestseller oder Kultbücher. Beide Begriffe möchte ich mit jeweils guten Gründen für mein Projekt vermeiden. Die reine Auflagen- bzw. Absatzzahl erscheint mir als Maßstab für die Wirkung eines Buches fragwürdig, sagt sie doch noch nichts darüber aus, ob der reißend verkaufte Schmöker auch gelesen wurde. Bestes Beispiel ist für mich hier immer Das Foucaultsche Pendel von Umberto Eco, das sich als Nachfolger seines populären Meisterwerks Der Name der Rose verkaufte wie geschnittenes Brot, aber die meisten Leser maßlos enttäuschte. (Ich persönlich kenne nur zwei Menschen, die von dem 750 Seiten starken Buch mehr gelesen haben als die ersten fünfzig.) Viele Erfolgsautoren sind da ja zugleich anspruchsloser und geschickter als Eco. Wenn sie einmal ein literarisches Erfolgsrezept gefunden haben, dann kochen sie daraus Jahr für Jahr ihr immergleiches Süppchen und haben ausgesorgt. Auch diese Art Serien-Bestseller von Leuten wie Johannes Mario Simmel, Heinz G. Konsalik, Donna Leon oder Georges Simenon sagen mindestens eins über ihre Leser aus: dass sie die Wiederholung des Immergleichen, längst Vertrauten lieben. Hohe Verkaufszahlen täuschen also starke Wirkung oft nur vor. Und das imposante Wort vom Kultbuch scheint mir ebenfalls für meine Absichten ungeeignet, da irreführend. So werden nach meiner Beobachtung nicht selten Bücher genannt, deren Titel jeder kennt, bei deren Nennung auch jeder ein mehr oder weniger deutliches Bild vor Augen hat – und die doch kaum jemand wirklich gelesen hat. Der Name sagt es ja schon deutlich: Kultobjekte werden aus der Distanz verehrt, vor allzu unmittelbarer Begegnung schützt sie ein stillschweigendes Berührungsverbot. Auch eilt ihnen meist der Ruf voraus, dass sie schwer zugänglich sind. Die Wirkungsgeschichte von Kultbüchern gibt indirekt zwar auch Auskunft über den Zeitgeist, doch soll dieser Aspekt hier nicht mein Thema sein.
Mir geht es vielmehr ganz banal um gesellschaftliche Trends, die sich im meist kurzlebigen Erfolg einzelner Bücher spiegeln. Die Frage, die sich mir in jedem einzelnen Fall stellen wird, lautet deshalb zunächst: Woher rührt das Interesse für gerade dieses spezielle Thema, das im vorliegenden Buch erstmals, oder doch erstmals auf diese Weise, abgehandelt wird? Und anschließend denke ich darüber nach, welchen der bekannten Grundrichtungen langfristiger sozialer Entwicklung dieses Interesse entspringt. Vielleicht komme ich aber auch zu dem Ergebnis, dass Bücher gerade deshalb erfolgreich sind, weil sie sich den vorherrschenden Trends verweigern und einen völlig neuen Ton anschlagen, der Neugier weckt. Insofern will ich das Ergebnis meiner Untersuchung offen halten. Ich beschränke mich bei meiner Studie auf die Zeit von 1955 bis 2005 und auf Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum.
Ostware in Kommission
Saturday, 29. January 2011Gestern habe ich einen kleinen, ausgewählten Buchbestand in Kommission für mein Versandantiquariat übernommen, aus der Bibliothek eines DDR-Autors und seiner Ehefrau, die im Gefolge der Biermann-Ausbürgerung in den Westen übersiedelten. Es sind insgesamt 120 Titel, darunter einige mehrbändige Werke, nach Büchern gezählt 135 Stück, größtenteils aus den volkseigenen Verlagen des gescheiterten und vergangenen sozialistischen Staats- und Wirtschaftsexperiments. (Sie werden bei mir die Artikel-Nummern 1901 bis 2020 bekommen.)
Heute habe ich mir diese Ware mehrfach durch die Finger gleiten lassen, um ein Gefühl für sie zu entwickeln. Zwar kenne ich Bücher aus dem alten deutschen Osten ja schon längst und habe sie immer mal wieder, meist auf Flohmärkten, vereinzelt erworben, so etwa die schätzenswerten Klassiker-Bändchen aus der Sammlung Dieterich. Aber hier habe ich es nun mit einer geballten Ladung zu tun, fast drei Regalmeter, lauter Bücher, denen man den verwalteten Mangel vermutlich schon ansah, als sie noch nagelneu waren. Jetzt aber ist das schlechte Papier nachgedunkelt, oft gar noch unregelmäßig, weil verschiedene Qualitäten in einer Auflage vermischt wurden. Die Umschläge sind viel empfindlicher als die lackierten Hochglanzhüllen auf schwerem, solidem Papier, die wir im Westen längst gewohnt sind, und entsprechend rissig, fleckig und abgegriffen. Wenn gar Klebebindung die sonst erfreulich lange vorherrschende Fadenheftung ablöst, ist sie noch weniger haltbar als unser Lumbeck.
Das kann man bei den Paperbacks der so liebevoll gestalteten Reihe Lyrik international bei Volk und Welt studieren, die schon drei Jahrzehnte nach ihrem Erscheinen aus dem Leim gehen. Fürsorglich wurden die empfindlichen weißen Kartonbände zum Schutz in hauchdünne Pergamentpapierhüllen eingeschlagen. Aber die sehen vielleicht aus! Es ist ein Trauerspiel, wie lumpig die vielfach inhaltlich und formal doch so ambitionierten Editionen rein äußerlich in die Welt geschickt wurden; besser: geschickt werden mussten, weil es auch hier wenn nicht an allem, so doch an den geeigneten Produktionsmitteln und -techniken haperte. (Faiererweise will ich aber nicht verschweigen, dass auch das kapitalistische Verlagswesen, dem diese durchaus zur Verfügung stehen, grauenhaft schlecht gemachte Bücher auf den Massenmarkt wirft. Man denke nur an anglo-amerikanische Pocketbooks! Und auch die französischen Livres de poche sind selten besser.)
In den kommenden Tagen wird also meine Hauptbeschäftigung die Erfassung dieser Bücher für mein Antiquariatsangebot bei ZVAB sein. Dann werde ich beim zweiten, intimeren Blick nicht nur auf, sondern auch in diese Bücher gewiss manche Anregung empfangen. Und vielleicht, wer weiß, wird ja sogar der eine oder andere unerwartete Artikel für dieses Weblog aus der Begegnung?
Einstweilen ein Vierzeiler von Ho chi Minh: „Im Schlaf ist jedes Angesicht ehrlich und rein. | Das Wachsein teilt uns erst in Gut und Böse ein. | Ach, gut und böse – keinem angeboren. Nur: | Schuld ist vor allem die Erziehung – nicht Natur.“ (Gefängnistagebuch. Aus dem Chines. übertr. von Erhard u. Helga Scherner. Berlin: Verlag Volk und Welt, 1976, S. 92. – Das Titelbild entnahm ich dem Einband dieser Broschur, entworfen v. Horst Hussel u. Lothar Reher.)
Protected: Christine Lavant: Aufzeichnungen
Tuesday, 30. November 2010Reck-Malleczewen: Tagebuch
Monday, 29. November 2010Reck-Malleczewen, Friedrich Percyval [d. i. Friedrich (Fritz) Reck]: Tagebuch eines Verzweifelten. [Hrsg., m. e. Vorw. u. e. Nachw. v. Curt Thesing.] Lorch (Württemberg) / Stuttgart: Bürger-Verlag, 1947. – 202 & 2 S. & 1 Taf. mit dem Porträt d. Verf. v. Franz Herda im Frontispiz [s. Titelbild], 21,0 x 13,8 cm, OPb., Fadenheftung. – Rücken fehlt, Einband zum Gelenk hin mit Schadstellen, innen gut. – Erstausgabe, 1.-5. Tsd.
Nico Rost berichtet in seinem Tagebuch aus dem Konzentrationslager Dachau unterm Datum vom 15. April 1945 von der Begegnung mit einem völlig erschöpften und abgemagerten, etwa sechzigjährigen Mithäftling, der wie er selbst in der Krankenbaracke liegt, nun aber zurück in Block 25 verlegt werden soll, wo Flecktyphus herrscht. Inständig bittet ihn der Mann, sich für ihn einzusetzen, denn er fürchte, im Falle seiner Verlegung nicht mehr lange zu leben. Als Rost nach seinem Namen fragt, stellt er sich als Friedrich Reck-Malleczewen vor. Nun ist aber verbürgt, dass der Schriftsteller dieses Namens bereits zwei Monate zuvor, im Februar 1945 in Dachau zu Tode kam; lediglich das genaue Tagesdatum ist umstritten. Vermutlich bediente sich der Unbekannte nur des damals prominenten Namens, um seine Chance auf Rosts Unterstützung zu verbessern, der ein belesener Mann war. „Kennen Sie meine Bücher?“, hatte ihn der Fremde gefragt. Und Rost musste nicht lange überlegen: „Einige wohl, unter anderem einen historischen Roman über Jan Bockelson [den Münsteraner Wiedertäufer], ein sehr gut geschriebenes, technisch vortreffliches Buch, äußerst spannend, jedoch ohne Tiefe, ferner eine Studie über Charlotte Corday, auch Frau Übersee und, natürlich, Bomben auf Monte Carlo.“ Rost erinnerte sich aber auch daran, was er seinem Gegenüber freilich taktvoll verschwieg: dass Reck-Malleczewens Studie über die Mörderin Jean Paul Marats ein absolut konterrevolutionäres Buch war und bei ihrem Erscheinen 1937 der Reaktion in die Hand spielte. (Vgl. Nico Rost: Goethe in Dachau. Berlin: Verlag Volk & Welt, 1999, S. 279 ff.)
Antifaschistische Bekenntnisbücher, geheime Tagebücher und unter höchster Geheimhaltung verfasste Briefwechsel aus dem linken Lager – von Sozialdemokraten, Sozialisten, Kommunisten aller Schattierung, selbst von Anarchisten – gibt es ohne Zahl. Hingegen haben solche Dokumente wie das vorliegende, aus der Feder konservativer Feinde des Nazi-Regimes, eher Seltenheitswert. Das Tagebuch eines Verzweifelten ist eines von diesen raren Büchern. (Die Tagebücher Theodor Haeckers, der bei Reck sogar vorkommt, sind ein weiteres Beispiel.) Beeindruckend an ihnen ist die nahezu vollkommene Isolation ihrer Verfasser. Die Linken konnten doch meist noch auf ein verborgenes Netzwerk vertrauen, hatten geheime Verbindungen zu abgetauchten oder unerkannt in perfekter Tarnung lebenden Genossen, mit denen sie sich austauschen konnten und die ihnen in der Not vielleicht zu Hilfe kamen. Männer wie Reck oder Haecker hingegen scheinen auf verlorenem Posten, in großer Einsamkeit gekämpft zu haben. So klagt auch Reck in seinem Tagebuch einmal, „daß das bitterste Herzeleid in diesen Jahren uns Heimgebliebenen aus der wachsenden Vereinsamung, aus dem Fehlen der Kameraden, aus dem Absterben der Gegner sowohl wie der Gesinnungsgenossen entspringt.“ (Reck-Malleczewen , a. a. O., S. 78.)
Desto imposanter der unglaubliche Furor, mit dem der Gutsbesitzer und Arzt Friedrich Percyval Reck-Malleczewen seine Flüche gegen die braune Brut aufs Papier speit. Eine Kostprobe: „Mein Leben in diesem Pfuhl geht nun bald ins fünfte Jahr. Seit mehr als zweiundvierzig Monaten denke ich Haß, lege mit Haß mich nieder, träume ich Haß, um mit Haß zu erwachen: Ich ersticke in der Erkenntnis, der Gefangene einer Horde böser Affen zu sein und zermartere mir das Hirn über das ewige Rätsel, daß dieses nämliche Volk, das vor ein paar Jahren noch so eifersüchtig über seinen Rechten wachte, über Nacht versunken ist in diese Lethargie, in der es diese Herrschaft der Eckensteher von gestern nicht nur duldet, sondern auch, Gipfel der Schande, gar nicht mehr imstande ist, die eigene Schmach als Schmach zu empfinden …“ (Ebd., S. 22.) Man liest diese Tiraden mit einigem zwar teils grausligem Genuss, zumal der Verfasser einen unerschütterlichen Humor hat, der sich hier freilich im Gewand des Sarkasmus zeigt. Und sehr richtig betont er immer wieder, dass es ganz besonders die völlige Humorlosigkeit der Nazis ist, die ihre Entmenschlichung bedingt und befördert. (Adolf Hitler hat sein persönliches Verhältnis zum Humor und zum Lachen vielleicht am deutlichsten, obgleich unfreiwillig offenbart, als er anlässlich der Eröffnung des Winterhilfswerks im Berliner Sportpalast am 30. September 1942 sagte: „Die Juden haben einst auch in Deutschland gelacht. Ich weiß nicht, ob sie auch heute noch lachen oder ob ihnen nicht das Lachen bereits vergangen ist. Ich kann aber auch jetzt nur versichern: Es wird ihnen das Lachen überall vergehen.“)
Man zuckt freilich beim Lesen in diesem Tagebuch eines Verzweifelten immer wieder zusammen, wenn die merkwürdige Vokabel „Verniggerung“ vorkommt, die Reck bedonders gern verwendet, so wie er die stumpfsinnigen Parteigenossen, die grölend durch die Straßen ziehen, „weiß gebliebene Nigger“ nennt. Über solche aus heutiger Sicht unmöglichen Entgleisungen muss man gnädig hinwegsehen, um sich an den zivilisationskritischen Lichtblicken dieses sturköpfigen Anachronisten erfreuen zu können. So ist für ihn evident, „daß das Benzin, als Urquell alles motorisierten Glücksgefühles, zur tiefen Verkommenheit der Menschheit mehr beigetragen hat als der vielgeschmähte Alkohol.“ (Ebd., S. 47.) Eine wahrhaft hellsichtige Erkenntnis aus dem Jahre 1937, deren Wahrheit selbst sieben Jahrzehnte später noch den Wenigsten dämmert!
Protected: Carl Bulcke et al.: Schönes Rheinland
Friday, 26. November 2010Walter Höllerer et al.: Das Gästehaus
Wednesday, 24. November 2010Peter Bichsel / Walter Höllerer / Klaus Stiller / Peter Heyer / Hubert Fichte / Wolf Simeret / Elfriede Gerstl / Jan Huber / Hans Christoph Buch / Wolf D[ieter] Rogosky / Martin Doehlemann / Corinna Schnabel / Nicolas Born / Joachim Neugröschel / Hermann Peter Piwitt: Das Gästehaus. Roman. Berlin: Literarisches Colloquium, 1965.– 234 & 2 S., 19,5 x 14,6 cm, OBrosch. m. OSchU., Fadenheftung. – Namenszug u. Datum auf Schmutztitel, Fleckchen auf Kopfschnitt, Umschlag mit wenigen kleinen Läsuren am oberen Rand. – Erstausgabe. – Gemeinschaftsroman in der Tradition von Die Versuche und Hindernisse Karls (1808) und Der Roman der Zwölf (1908); angeregt von Walter Höllerer.
Unabhängig von den genannten Vorbildern lag ein solches Experiment Mitte der 1960er-Jahre zweifellos in der Luft, brach doch nun eine Zeit an, in der der isolierte „Einzelkämpfer“ gegenüber dem Kollektiv ins Hintertreffen geriet. Das bürgerliche, noch schlimmer: kleinbürgerliche Subjekt, der Individualist ohne Verwurzelung in den Massen, ohne Kontakt zur werktätigen Bevölkerung galt aus Sicht der revolutionären Wortführer der Studentenbewegung jener fernen Zeit als Auslaufmodell eines solipsistischen Lebensentwurfes. Wie schon bald die Vorreiter der 68er-Bewegung die Kleinfamilie als kleinste Einheit des privaten Lebens verwarfen und durch das Modell der Kommune, später Wohngemeinschaft genannt, abzulösen suchten, so hielt auch das Teamwork Einzug in die Schulen und Universitäten, als vermeintlich effizientere und zudem solidarischere Technik der Bildung, Forschung und schöpferischen Arbeit.
Ich erinnere mich noch gut, dass es – besonders in psychedelisch gelockerter Geistesverfassung – sehr viel Spaß machen konnte, zu viert oder fünft um einen runden Tisch zu hocken und gemeinsam ein großes Blatt Papier mit Farben und Pinseln zu beschmieren. Merkwürdigerweise hat sich in meinem Besitz kein einziges dieser kollektiv gefertigten Bilder erhalten, obwohl ich ein ausgesprochener Aufbewahrer bin. Sollten vielleicht die Ergebnisse der gemeinschaftlich begangenen „Schmierage“, nüchtern betrachtet, doch nicht mehr ganz so erheiternd gewesen sein? (Ansehnlicher waren da fallweise die Ergebnisse unserer Zufallszeichnungen in der Tradition des Cadavre exquis der Surrealisten, aber hierbei trennte ja der Knick im Papier die einzelnen Teilnehmer ganz scharf voneinander, sodass von einem Kollektivbild streng genommen nicht die Rede sein konnte.)
Immerhin war ein kollektiver Malakt noch praktikabel, während das gemeinschaftliche Schreiben von vornherein ein Unding blieb. Natürlich konnte man sich auf ein Thema, einen Handlungsverlauf, ein Sujet einigen – um dann die verschiedenen Aufgaben zu verteilen. Aber dann saß wieder jeder allein in seinem Kämmerlein und schrieb vor sich hin; von einer kollektiven Arbeit konnte mithin keine Rede sein. Und so heißt es auch ganz offenherzig im Klappentext zu diesem Buch: „Die Aufgabe dieses Gemeinschaftsromans wurde von Walter Höllerer angeregt; in Diskussionen wurde sie präzisiert, wurden die Umstände im einzelnen abgesprochen und in weiteren Zusammenkünften und Lesungen der Kapitelentwürfe das Ganze immer weiter modifiziert und wechselseitig abgestimmt.“ Wozu aber dieser ganze Aufwand? Oder, wie der Klappentext ganz richtig fragt: „Was könnte der Reiz dieses Unternehmens sein?“ Die selbst gegebene Antwort lautet, dass die ungewöhnlichen Arbeitsbedingungen für die Autoren eine interessante Herausforderung darstellten. Sie zwangen, so heißt es, zu einer ungewohnten „Disziplin, dem anderen zuhören zu müssen, sich auf das einstellen zu müssen, was der andere vorgab.“ Das mag wohl so gewesen sein und man kann es umstandslos als eine interessante Übung im Rahmen von creative writing durchgehen lassen.
Aber muss man das Ergebnis veröffentlichen? „[…] in den hier vorliegenden Texten bleibt der Reiz,“ behauptet der anonyme Klappentexter, „diese Arbeit noch einmal verfolgen zu können, die Art zu sehen, wie jeder nach Maßgabe dessen, was abgesprochen war, einem Einheitsstil entgegenarbeitete oder ihm vielleicht erlag; mit welchen inneren und äußeren Problemen er sich abgab, sie gleichsam in dieses Gästehaus steckte und wie er der Welt, die vorgegeben war, die Interpretation lieferte.“ Das verräterische „noch einmal“ erweist endgültig, dass die einzigen Adressaten dieses Buches, die einen Gewinn aus seiner Lektüre ziehen können, die Teilnehmer des Experiments, seine Autoren sind. Alle anderen, wir außenstehenden Literaturfreunde, wissen ja eben nicht, was abgesprochen war, welche Probleme sich ergaben und welche Kompromisse geschlossen wurden oder auch nicht. So bleibt die Eingangstür zu diesem abweisenden Gästehaus uns Fremden, den unbeteiligten Lesern, leider verschlossen.
Fernando Pessoa: „Algebra der Geheimnisse“
Monday, 08. November 2010Pessoa, Fernando: „Algebra der Geheimnisse“. Ein Lesebuch. Mit Beiträgen von Georg R[udolf] Lind, Octavio Paz, Peter Hamm u. Georges Güntert. Mit zahlreichen Abbildungen. Zürich: Ammann Verlag, 1986. – 193 & 5 S. m. 18 Abb. [auf den S. 31-50], 19,0 x 12,0 cm, ill. OBrosch., Rücken minimal nachgedunkelt, sonst wie neu. – Erstausgabe. – Bibliothek des Herrn Parnok, Bd. 8. – ISBN: 3-250-01057-X.
Vielleicht – wenn nämlich die Zeitläufte einmal gerechter mit ihren edelsten Geisteskindern umgehen sollten – werden die Bücher aus dem Zürcher Ammann-Verlag, der von 1981 bis zum Juni dieses zu Ende gehenden Jahres existierte, von Kennern und Könnern gesammelt als die in ihrer Zeit nahezu unvergleichlichen verlegerischen Heldentaten hoch ambitionierter, selbstausbeuterischer Literaturidealisten, namens Marie-Luise Flammersfeld und Egon Ammann. Solch ein Bändchen wie das hier und heute aus blanker Not für nur 18 Euro verscherbelte kann ich aber nicht nur deshalb nicht unkommentiert hingeben. Mein heutiges Geschreibsel soll vielmehr zuvörderst den Zweck erfüllen, dem nun auf sich selbst zurückgeworfenen Paar, das sich – wer weiß wie – doch gewiss trotz aller gründlichen Erwägung plötzlich nach dem geplanten Selbstentzug dieser durch nahezu drei Dezennien ertragenen Freudenlast aufrecht hielt, ein winzigkleines Glückshagelkorn auf seine (hoffentlich) noch gemeinsame Bettdecke prasseln zu lassen, wohl wissend, wie schnell solche Beglückungen von heute schon morgen dahingeschmolzen sind.
Aber selbst dann bleibt doch noch immerhin ein feucht-fröhliches Tröpfchen, wenngleich als nur bitterer Trost: „Wenn es etwas gibt, was dieses Leben uns gewährt und wofür wir, vom Leben selbst abgesehen, den Göttern dankbar zu sein hätten, so ist es die Gabe, uns zu verkennen: uns selbst zu verkennen und uns gegenseitig zu verkennen.“ (Fernando Pessoa: Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares. A. d. Port. v. Georg Rudolf Lind. Zürich: Ammann Verlag, 1985, S. 132.)
Was wären wir schließlich, ohne diese Begabung zum Selbstbetrug? Einsamste Wanderer, verloren in unendlicher Leere. Aber ist es denn wirklich so unausstehlich schlimm, dass wir die Linderung unserer existenziellen Leiden einer Täuschung verdanken?
Vom Leben hat der vielnamige Pessoa nicht viel mehr verstanden als – immerhin – das Wesentliche. Doch das ist nicht genug, denn zum Überleben gehört das Unwesentliche unbedingt auch hinzu, ist gar das zuletzt Bestimmende. Und dieser Zugang ist dem insofern nur halben Mann aus Lissabon, nimmt man seine Aphorismen ernst, zeitlebens verschlossen geblieben; sehr zur Freude von uns aus dem Durchschnitt gezückten Lesern, die an der Peripherie des Verständlichen ihr Entzücken finden. (Besudelte Klingen, die wir sind.)
[Das Titelbild zeigt die Truhe mit den zum Zeitpunkt seines Todes 1935 unveröffentlichten Manuskripten Fernando Pessoas und im Hintergrund die Bibliothek des Dichters; aus dem hier veräußerten und besprochenen Buch, S. 48.]
Rahel Sanzara: Das verlorene Kind
Thursday, 04. November 2010Sanzara, Rahel [i. e. Johanna Bleschke]: Das verlorene Kind. Roman. Berlin: Verlag Ullstein, 1926. – 442 & 6 S., 19,0 x 12,8 cm, Okt., Fadenheftung. – Schiefgelesen, am Schnitt leicht fleckig und minimal bestoßen, Umschlag unfrisch. Das Exemplar bietet sich an, fachmännisch neu aufgebunden zu werden. – Erstausgabe. Das Romandebüt der Autorin war zunächst als Vorabdruck in der Vossischen Zeitung in Berlin erschienen. – [Artikel-Nr.: 000346].
„Hier spricht eine deutsche Dichterin von überraschender Kraft des Bildes und der Stimme. Sie erzählt eine tief aufwühlende Geschichte von guten Menschen, die Furchtbares erleben.“ So steht es auf dem kartonierten Einband des Ullstein-Buches, nicht etwa auf einer verkaufsfördernden Banderole, sondern auf dem Einbanddeckel selbst. Wir dürfen also, wie schon die Leser vor 84 Jahren, darauf gefasst sein, dass uns Grauen und Schrecken bevorstehen. Es geht tatsächlich um ein Individualverbrechen, wie es kaum schlimmer auszudenken ist: um den Sexualmord an einem vierjährigen Mädchen.
Das Buch ist aber aus weiteren Gründen bemerkenswert, wurde doch seiner Autorin gleich in zweifacher Hinsicht Unlauterkeit vorgeworfen. Erstens nämlich habe sie den Fall, den sie mit romanhaften Ausschmückungen erzählt, aus dem bei Brockhaus in Leipzig in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erscheinenden Neuen Pitaval gestohlen. (Einem ganz ähnlichen Vorwurf sah sich in jüngster Zeit Andrea Maria Schenkel mit ihrem Krimi-Bestseller Tannöd ausgesetzt.) Und zweitens habe sie das Buch nicht allein verfasst, sondern mit erheblicher Unterstützung durch ihren Lebensgefährten, den renommierten Schriftsteller Ernst Weiß. Besonders der zweite Verdacht erhielt zusätzliche Nahrung, als Sanzara den ihr zugesprochenen Kleist-Preis des Jahres 1926 ohne Begründung ablehnte. Damit verzichtete sie immerhin auf die bedeutendste literarische Auszeichnung der Weimarer Republik, vergleichbar dem Büchner-Preis im Deutschland der Nachkriegszeit. (Volker Weidermann hat den „Fall Sanzara“ in seinem zum 75. Jahrestag der Bücherverbrennung durch die Nazis erschienenen Buch der verbrannten Bücher 2008 auf knapp zwei Seiten abgehandelt und über den Tonfall des Romans richtig geurteilt, dass er heutigen Lesern „gefühlsschwer, mythisch verschlungen, sentimental und schaurig vorkommen“ müsse, „selbst wenn man den expressionistischen Zeitgeschmack abzieht“, und zudem wohl zutreffend erkannt, dass dieses Erfolgsbuch der Johanna Bleschke nur deshalb „dem Feuer übergeben“ wurde, weil ihr Pseudonym so jüdisch klang.)
Dass sich das Paar Weiß / Sanzara schon fünf Jahre früher auf die spektakuläre literarische Vermarktung von menschlichen Extremsituationen kapriziert hatte, kann man in einem Feuilleton des unvergleichlichen Joseph Roth nachlesen, erschienen im Berliner Börsen-Courier vom 12. Mai 1921. Roth war am Vorabend Zeuge gewesen, wie Rahel Sanzara die Weiß-Novelle Franta Zlin las. Die handelt von einem Soldaten, „der im Feld einen Unterleibsschuß erhält und das Geschlecht verliert. Invalid, am invalidesten zurückkehrt, seine junge Frau langsam in den Tod treibt, weil ihre Gegenwart ihm Bitternis, Qual, Vorwurf, täglichen Tod bedeutet. Der dann mit einem Mädchen von der Straße ins Hotel geht und seine verkrüppelte Geschlechtlichkeit in ohnmächtiges Morden wandelt; Geschlechtsdrang in Tötungsdrang umsetzt. Er prügelt das Mädchen halbtot und entflieht, gemeinsam mit einem aus dem Gefangenenlager ausgebrochenen russischen Kriegsgefangenen. Im Wald wird Franta Slin [!], der Perlen und Geld (Kriegsbeute) bei sich führt, von dem Russen ermordet. In seinem letzten Traum erlebt er noch die ersehnte Befreiung. Er träumt von der polnischen Jüdin, die er im Feld vergewaltigt hatte.“ Aus heutiger Sicht, nach Auschwitz und Hiroshima, mag es naiv erscheinen, wenn Roth seinen Eindruck von diesem Rezitationsabend mit diesen Worten summiert: „Vielleicht ist […] in keiner der vielen Antikriegsgeschichten die Bestialität der vaterländischen Mörderei eindringlicher in menschliches Bewußtsein gehämmert worden als in Franta Slin.“ (Joseph Roth: Werke I. Das journalistische Werk. 1915-1923. Hrsg. v. Klaus Westermann. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1989, S. 557 f. – Anm.: Roth schreibt den Nachnamen des Protagonisten der Novelle konsequent falsch mit S.)
Fußnote. Gottfried Benn hat seinerzeit „das Buchereignis des Jahres 1926“, neben Albert Ehrenstein, Carl Zuckmayer und anderen namhaften Kollegen, begrüßt und gefeiert – und in einem Plagiat überschriebenen Artikel im Unterhaltungsblatt der Vossischen Zeitung vom 11. Dezember 1926 gegen den Vorwurf mangelnder Originalität verteidigt (nachzulesen in: Sämtliche Werke. Band III. Prosa 1. 1910-1932. Stuttgart: Klett-Cotta, 1987, S. 166 ff). Im nun bald zu Ende gehenden Jahr hat der Dichter und Büchner-Preisträger Durs Grünbein diesen ollen Benn-Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 23. Februar 2010 plagiiert, um der plagiierenden Axolotl-Roadkill-Autorin Helene Hegemann beizuspringen – und uns vielleicht den Gedanken nahzubringen, dass aber auch wirklich gar nichts echt sei, im Sinne von ,einmalig‘ und ,ursprünglich‘. Die Parallele war insofern geglückt, als auch das Hegemann-Plagiat im trivialen Ullstein-Verlag erschien; anderersits aber doch missglückt, weil Sanzara bloß einen anonymen Pitaval früherer Zeiten bestohlen haben mag, während Hegemann nachweislich einem leibhaftigen, wenngleich virtuellen Zeitgenossen namens Airen in die Tasche griff.
Rückzieher
Wednesday, 03. November 2010Vor knapp vier Wochen habe ich hier den Ausverkauf meiner Bibliothek bekannt gemacht und angekündigt, dass ich jedem verkauften Buch einen Abschiedsgruß mit auf den Weg geben würde. Dieses freibleibende Angebot muss ich nun leider aus drei guten Gründen widerrufen oder doch wenigstens modifizieren.
Erstens habe ich mich mit diesem Versprechen unter einen Druck gesetzt, der der Qualität meiner Arbeit – sowohl als Antiquar als auch als Blogger – abträglich ist. Naturgemäß ist das Bestellaufkommen starken Schwankungen unterworfen. Mal kommen tagelang keine Bestellungen herein, dann wieder sind es mehrere pro Tag. Sollte gar mein ungewöhnliches Projekt plötzlich über den kleinen Kreis meiner Leser hinaus bekannt werden, müsste ich fürchten, mit dem Schreiben der „Abschiedsgrüße“ nicht mehr nachzukommen, wodurch die Besteller, die vielleicht gar nicht wissen, was es mit meinem sonderlichen Projekt auf sich hat, ungebührlich lange auf das Eintreffen ihrer Bücher warten müssten. Denn eins ist klar: Ich kann unmöglich einen solchen Abschiedsgruß verfassen, wenn mir das Buch nicht mehr vorliegt – oder doch jedenfalls nicht mit den qualitativen Ansprüchen, denen ich bisher genügen wollte.
Zweitens hat sich bei der Arbeit an den mittlerweile 18 Blog-Beiträgen zu diesem „Ausverkauf“ herausgestellt, dass längst nicht jedes meiner Bücher den Aufwand verdient, den ich ihm hier angedeihen lasse. Den Eindruck, dass ich etwa ein Büchersammler wäre, dem niemals Fehlkäufe unterlaufen sind, will ich dann doch nicht erwecken, bei aller geschäftstüchtigen Betriebsamkeit, die mich antreibt, mich selbst, meine Bibliothek und mein Geschäft in einem möglichst günstigen Licht erscheinen zu lassen. Nun könnte ich solche Missgriffe zwar mit angemessenen Verrissen auf den Weg schicken – aber wie würde es bei einem Kunden ankommen, wenn ich ihm mit allen Mitteln meiner Beredsamkeit nahebrächte, dass ich ihm mindestens nach meinem Urteil die Katze im Sack angedreht habe? Er müsste sich rechtens betrogen vorkommen und hätte vielleicht gar einen von mir, dem Verkäufer, gratis gelieferten Reklamationsgrund.
Und drittens schließlich gibt es in „meiner“ Bibliothek, die ja doch auch eine in vielen Jahren gewachsene Familienbibliothek ist, allerlei Bücher, die nicht auf meinem Mist gewachsen sind, sei es, dass sie uns zum (möglicherweise unwillkommenen) Geschenk gemacht wurden, sei es, dass sie den Bedürfnissen der übrigen Familienangehörigen entsprachen, über die ich mich erstens prinzipiell nicht äußern will und die zweitens meist längst verjährt sind. Warum über solche Fremdkörper meditieren, auf Teufel komm raus?
Fazit: Ab sofort werde ich nur noch jenen verkauften Büchern aus meiner Bibliothek einen Abschiedsgruß mit auf den Weg geben, die diesen Aufwand verlohnen. Und ich werde diesen Gruß künftig auch nicht mehr als Zertifikat auf die Rückseite der Rechnung des Empfängers drucken, denn die Mehrzahl der Empfänger ist von dieser „Beigabe“ vermutlich ohnehin mehr irritiert als erfreut gewesen. Und als Titel dieser Artikel werde ich ab sofort den (nötigenfalls verkürzten) Titel des verabschiedeten Buches wählen, statt der nichtssagenden Nummernfolge, wie bisher.
[Aus den genannten Gründen unterbleibt bei den Artikeln dieser Rubrik künftig auch der Hinweis auf den Erwerber mit dessen Initialen, seinem Wohnort und der Verkaufspreis-Angabe.]
Artikel-Nr. 0018-1312
Tuesday, 02. November 2010Zürn, Unica: Im Staub dieses Lebens. Dreiundsechzig Anagramme. Berlin: Alpheus Verlag, 1980. – 79 & 1 S., Porträtfoto d. Autorin im Frontispiz, 20,5 x 12,8 cm, Okt., Fadenheftung. – Der empfindliche Einband vorn mit größerem braunem Fleck, ohne den Transparentpapier-Umschlag, innen tadellos. – Erste Ausgabe dieser Sammlung von Anagrammen aus dem Nachlass. – ISBN: 3-922555-04-7.
Der Suicid ist ja (leider?) mittlerweile zu einem Signum exaltierter Kreativität geworden. Rechnen wir an dieser Stelle, der hier gewürdigten Wort-(besser: Buchstaben-)künstlerin zu Ehren, einmal zurück, wer nach ihr diesen allerletzten Weg wählte, dieser Zwangslage nicht entweichen konnte: David Foster Wallace, Jürg Federspiel, Hunter S. Thompson, Tristan Egolf, Hans A. Pestalozzi, Lothar Baier, Gilles Deleuze, Ernest Bornemann, Gert Prokop, Sandra Paretti, Guy Debord, Niklaus Meienberg, Gisela Elsner, Jerzy Kosinski, Bruno Bettelheim, Sandor Marai, Hermann Burger, Christian Schultz-Gerstein, Richard Brautigan, Arthur Koestler, Thaddäus Troll, Walter E. Richartz, Romain Gary, Harry Martinson, Jean Amery, Robert Neumann, B. S. Johnson, Henry de Montherlant, Bernward Vesper und Peter Szondi – und dann eben Unica Zürn, am 19. Oktober 1970 in Paris, als sie sich von einem Fensterbrett hinunterkippen ließ, aufs Pariser Kopfsteinpflaster.
Kein Zweifel: Das ist eine Elite! Jede Einzelne, jeden Einzelnen von ihnen möchte ich an mein wummerndes Herz drücken. Was sind das doch für gequälte, für quälend authentische Liebeslebende!
Wenn ich die erotischen, um nicht zu sagen: pornographischen Zeichnungen des Lebensgefährten dieser Wortkünstlerin Zürn, von Hans Bellmer nämlich, vor meinen Blick schieben wollte, dann könnte ich zu dem Ergebnis kommen, dass Unica Zürn aus ganz anderen Gründen der Sprung vom Fensterbrett in die Tiefe, auf das harte Pariser Pflaster unvermeidlich blieb. Aus welchen Gründen aber? Das bliebe dann doch ein unbeantwortetes Rätsel. Wenn ich nun aber andererseits dem großartigen grafischen Künstler Bellmer die Schuld in die Schuhe schieben wollte, am vorzeitigen, selbstständigen Tod der Dichterin Unica Zürn, wohl seiner Geliebten, dann wäre ich doch wohl ein rechter Spießer, oder? Ein Paradoxon aus Bigotterie und Libertinage.
Oder? „Sink ein in Asche, ans Bild der Stille, bald muss ich weg.“ (S. 24.)
[Abbildung aus dem ausverkauften Band, Frontispiz: Unica Zürn 1935.]
Artikel-Nr. 0017-1225
Tuesday, 02. November 2010Lewitscharoff, Sibylle: Montgomery. Roman. Stuttgart / München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2003. – 351 & 1 S., 20,9 x 12,7 cm, OPb. m. OSchU. – Neuwertig, ungelesen. – Erstausgabe. – ISBN: 3-421-05680-3.
Da ich mich ja zum Ungelesenhaben bekannt habe, kann ich dieses Buch nur im großen Radius umkreisen, will ich mich nicht selbst der Lüge überführen.
Selbst wenn ich einen zufälligen, beliebigen Blick hineintäte, zum Beispiel auf Seite 166, wo die Frage lautet: „,Haben wir noch genügend Orangen im Haus?‘“ – und die Antwort: „,Orangen und Zitronen‘“ … müsste ich befürchten, dass mein Kiebitzen, Stibitzen im Buch der Lewitscharoff eine Knickspur hinterließe, dem Kunden, dem Käufer, dem künftigen Leser als ein Störfall, eine Vorprägung, Irritation seines ursprünglichen Leseerlebnisses erschiene: ,Warum klappt das Buch denn immer ungewollt an dieser Stelle auf?‘ – Ja, warum?
Wie die Sonne strahlte, dem weißen Mädchen aus Bulgarien! Dem Mädchen der schlimmen Liebe. Es waren ja Orange und Zitrone, die Federico Garcia Lorca bedichtete, bevor sein Blut den Boden seines vergewaltigten Andalusien benetzte.
Nein! Ich halte mich zurück. Ich schicke dieses Buch ungelesen, und ungeprägt von schwergewichtigen Bedeutungen hinein ins Bodenlose einer filmreifen Verzweiflung – von der ich allerdings nicht sagen kann, wie weit sie trägt.
Artikel-Nr. 0016-0367
Thursday, 28. October 2010Negri, Antonio: Die wilde Anomalie. Baruch Spinozas Entwurf einer freien Gesellschaft. A. d. Ital. v. Werner Raith. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 1982. – 288 S., 20,8 x 13,0 cm, Okt. – Neuwertig, ungelesen. – Erste Ausgabe der deutschen Übersetzung. Die ital. Originalausgabe ersch. 1981 u. d. T. L’anomalia selvaggia. Saggio su potere e potenza in Baruch Spinoza im Verlag von Giangiacomo Feltrinelli in Mailand. – ISBN: 3-8031-3507-9.
Zufällig hat der Perlentaucher heute ein Eichendorff-Zitat in seiner Headline: „Ich glaube, die Leute in Italien sind alle verrückt.“ Ich kannte mal einen in Deutschland Zwischenstation machenden Anarchisten Gianfranco C., der meinen Lebensüberdruss besser verstand als jeder andere, mit dem ich eitel darüber sprach, mir zu diesem letzten Schritt Mut machte und mir nur den einen Rat mit auf den Weg gab, den ich dann doch nicht beschritt: „Wenn Du Dich verabschiedest, dann nimm aber doch immerhin möglichst viele Bullen mit ins Jenseits!“ Die Leute in Italien sind (oder waren damals wenigstens) wenn nicht verrückt, so doch immerhin ein Stückchen weiter an den Durchblick auf tiefere Erkenntnis gerückt als die deutschen Gartenzwerge. Ich hingegen erfreue mich ohne Skrupel meines allen Versuchungen zum konsequenten Opfergang trotzenden Durchschnittsdaseins – Gartenzwergendasein hin oder her.
Dass der Linsenschleifer aus Amsterdam einen selten unbescholtenen Blick auf die ewige Wahrheit hatte, wusste ich seit meiner gründlichen Lektüre von Bertrand Russells Panorama auf das abendländische Denken, A History of Western Philosophy (1945), besser als mancher Überflieger. Kaum einer der dort vorgestellten Philosophen erschien in Russells Porträt so rein und lauter, wie eben Spinoza.
Und an eben jenen Philosophen klammert sich der opferfreudige Sozialist Negri mit diesem Essay, mit dem er erneut eine Utopie entwickeln will, inmitten untergehender Hoffnungen auf ein besseres Diesseits. Ich hätte dieses Buch so gern gelesen, verstanden und in privater Praxis überwunden, wenn mir die Zeit dazu geblieben wäre. So gebe ich es dann also eilig weg und hoffe, dass es andernorts immerhin doch eine bessere Wirkung entfalten wird, denn als Mauerblümchen in meinem Lager.
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 68,50 Euro geht dieses Buch in den Besitz von U. S. in Landau über.
[Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt aus dem Umschlagbild von Hans Peter Willberg.]
Artikel-Nr. 0015-0613
Thursday, 28. October 2010Ertl, Josef: Bundestagsreden und Zeitdokumente. Mit einem Vorwort von [Bundeskanzler] Helmut Schmidt. Hrsg. v. Horst Dahlmeyer. Bonn: Verlag az studio bonn, 1979. – 8 S. & 8 unpag. Kunstdruck-Taf. & 308 S., 20,5 x 11,2 S., goldgepr. OLw. m. OSchU. – Umschlag unfrisch, etwas muffig. – Erstausgabe. – Widmungsexemplar: „Mit den besten / Wünschen / J. Ertl 19. 1. 82.“
Das Exemplar stammt aus dem Nachlass eines Essener Verlegers und frühen F.D.P.-Mitglieds. Der Verlag az studio bonn bestand von 1966 und 1980 und war spezialisiert auf die Publikation von Bundestagsreden, überwiegend aus dem konservativ-liberalen Lager (u. a. von Carlo Schmid, Adenauer, Strauß, Wehner, Barzel, Scheel, Genscher, Erhard, Brandt, Thomas Dehler und Helmut Schmidt). Meine Freunde werden sofort erkennen, dass ich zu einem Buch wie diesem nur gekommen sein kann wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde. Und doch haben auch solche Bücher eine Berechtigung, ernst genommen zu werden. Der Bayer Josef Ertl war für die F.D.P. von 1961 bis 1987 Mitglied des Deutschen Bundestags und von 1969 bis 1983 Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Wenn mich diese Ressorts interessieren, dann naturgemäß unterm Aspekt des humanen Naturverschleißes, der ungehemmten Domestikation oder Elimination von Flora und Fauna nach den zudem fragwürdigen Bedürfnissen des Menschen. Pünktlich mit dem Einzug der Grünen in den Bundestag 1983 endete allerdings die lange Amtszeit von Ertl. Mit solchen prinzipiellen Fragestellungen wie den anfangs von der jungen Partei aufgeworfenen hatte sich dieser schmerbäuchige Hüne nicht zu befassen. In aller naiven Unschuld schwenkt er gigantische Bierseidel [s. Titelbild aus dem veräußerten Buch], lässt sich von einem „Fellbereiter“ über dessen sicher noch nicht von PETA verschärften Probleme unterrichten oder schunkelt mit seiner herben Gattin auf dem Münchner Oktoberfest.
Finster-hinterweltlerische Zeiten, möchte man meinen. Andererseits mutet es aus heutiger Sicht doch auch wieder rührend demokratisch, unverbraucht optimistisch, offenherzig und ehrlich an, dass dieser Minister zur Dokumentation und vielleicht auch Rechtfertigung seiner politischen Tätigkeit auf deren Höhepunkt eine Auswahl seiner Bundestagsreden in die Druckerei schickte. Ertl scheint tatsächlich geglaubt zu haben, dass das jemand liest. (Aber doch nicht etwa jemand wie ich?) Oder immerhin muss er überzeugt gewesen sein, dass diese Zeugnisse seiner feinsinnigen Eloquenz im Streit um die Agrarpolitik der 1970er-Jahre in der BRD verdienen, für eine Nachwelt bewahrt zu werden, die sich daran entzücken würde, welch fein ziselierte Retourkutschen einstens ein Minister für Milch, Brot und Läberwurscht ritt. (Überhaupt scheint mir, dass dem Verständnis der deutschen Nachkriegspolitik ohne die eingehende Würdigung der individuellen Minderwertigkeitskomplexe ihrer Protagonisten eine entscheidende Dimension fehlt.)
Und noch ein ,Aber‘! Über sich selbst hinaus wächst selbst ein solcher Ertl, wenn er in den Schlussworten seiner Reden einen etwas weiteren Horizont in den Blick nimmt. So sagt er etwa am 21. April 1977 in der 23. Sitzung des Deutschen Bundestags in dessen 8. Legislaturperiode zum Abschluss seiner Rede über „Strukturpolitik“: „Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen. Agrarpolitiker und Ernährungspolitiker dürfen die Augen nicht vor den großen Herausforderungen verschließen, die durch Bevölkerungswachstum und damit zunehmenden Hunger in der Welt auf uns alle zukommen. Ich habe manchmal Angst, daß man glaubt, die großen Probleme des Jahres 2000 bestehen vorwiegend auf dem Energiesektor. Das Ernährungsproblem könnte für die Menschheit im Jahre 2000 ebenso schwer wiegen wie das Energieproblem. Auch daran müssen wir, glaube ich, heute und morgen denken. Wir müssen dabei wissen, daß Agrarproduktionen wie nur ganz wenige andere Produktionen enorm abhängig von Menschen, Boden und Klima sind, so daß sich aus diesen natürlichen drei Faktoren von vornherein zwangsläufig Beschränkungen ergeben. Es ist, glaube ich, auch notwendig, daran zu denken, daß das Jahr 2000 nicht so weit weg ist, damit wir uns nicht eines Tages schuldig machen.“ (S. 174 f.) – Allerdings erweist sich gerade in diesem letzten Satz des Josef Ertl doch auch wieder seine geistige Beschränkung. Er hätte ja lauten müssen: „[…] damit wir nicht eines Tages erkennen müssen, dass wir uns heute schuldig gemacht haben.“
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 11,35 Euro geht dieses Buch in den Besitz von Herrn B. B. in Offenburg über.
Artikel-Nr. 0014-1161
Wednesday, 27. October 2010Reventlow, Franziska Gräfin zu: Der Geldkomplex / Herrn Dames Aufzeichnungen / Von Paul zu Pedro. Drei Romane. München: Biederstein-Verlag, 1958. – 304 S., 20,7 x 12,4 cm, OLw., Kopffarbschnitt, Fadenheftung. – Ohne den OSchU., der empfindliche gelbe Einband an den Deckelrändern nachgedunkelt, am Rücken ausgeblichen, Namenszug u. Datum auf Vorsatz, sonst gut. – Erste Ausg. dieser Zusammenstellung. – Die Originalausgaben erschienen zuerst 1916, 1913 bzw. 1912 im Verlag von Albert Langen in München. – Mit einem Nachwort von Friedrich Podszus.
Die verkrachte Gräfin ist mir erstmals im Zusammenhang mit meinen frühen Oskar-Panizza-Forschungen interessant geworden. Ihr störrisches Beharren auf ihrem leidenschaftlichen Freiheitsdrang gegen alle Versuchungen eines auskömmlich-sorglosen Adelslebens in der preußisch-hanseatischen High-Snobiety und ihre Kompromisslosigkeit als Liebhaberin gleich mehrerer grell unterschiedlicher Männer machten sie, wie mir schien, zu einer schillernden Kreuzung zwische Femme fatale und heiliger Jungfrau. Dass die Feministinnen der 1970er-Jahre zur Gräfin ein eher gespaltenes Verhältnis hatten, obwohl sie doch solch ein auftrumpfendes Beispiel von Selbstständigkeit abgab, schien mir ein weiteres Verdachtsmoment – nicht gegen die tolle Fanny, sondern gegen deren olle Enkeltanten.
Die Romane der Reventlow? Sind vielleicht noch lesenswert, wenn man die Zeitumstände sehr genau unter die Lupe nehmen will. So schreibt zum Beispiel der auch nicht immer ganz verlässliche Bohème-Kenner Emil Szittya über die Entstehungsgeschichte des ersten Romans dieser zur Trilogie zusammengefassten Sammlung: „In Askona lebte ganz zurückgezogen ein russischer Baron Rechenberg. […] Wir beratschlagten jahrelang, wie wir Rechenberg eine Familie beschaffen könnten, bis es sich endlich Erich Mühsam zur Pflicht machte, ihm eine Frau mit einem Kinde zu verschaffen. Das Opfer war die Schriftstellerin Gräfin Reventlow (eine in Deutschland sehr bekannte Schriftstellerin). Sie brauchte Geld und heiratete darum den Baron Rechenberg; aber, wie es schon in derartigen Kinostücken Sitte ist, es gab im Testament eine Klausel, nach der sie die Erbschaft doch nicht bekamen, sondern ihr Sohn. Gräfin Reventlow schrieb darauf aus Grauen über die unangenehme Affaire einen Roman Geldkomplex. Ihr Sohn, der noch heute [1923] in Askona wohnt, soll nach ihrem Tode [1918] das Geld geerbt haben; aber da sich das Geld in Rußland befindet, wird er nicht viel davon haben.“ (Emil Szittya: Das Kuriositäten-Kabinett. Konstanz: See-Verlag, 1923, S. 99 f.)
Was mich persönlich noch an der Geschichte interessieren könnte, das wäre eine Fußnote zur Geschichte der Gräfin, die Geschichte ihres verzärtelten, über alles geliebten, 1897 geborenen Sohnes – ist er doch der Prototyp jener Heerscharen im Zuge der Emanzipation vaterlos gebliebenen, von befreiten Müttern alleinerzogenen, verhätschelten Einzelsöhnen. Was ist aus ihrem „Bubi“, dem unehelich geborenen, vergötterten, maßlos „das Göttertier“ genannten Sohn Rolf geworden? Er lernte den Beruf des Photographen, heiratete 1923 die Lehrerin, Frauenrechtlerin, Sozialdemokratin und Redakteurin Else Reimann, war Mitte der 1920er-Jahre in Heidelberg als Gewerkschaftssekretär der freien Angestelltenverbände tätig, trennte sich bei der „Machtergreifung“ der Nazis von Frau und Kind und floh 1933 in die Tschechoslowakei, nahm seit Herbst 1936 auf Seiten der Sozialisten am Spanischen Bürgerkrieg teil, floh 1939 nach Algier und kehrte erst 1953 nach Deutschland zurück. Rolf von Reventlow starb am 12. Januar 1981 in München.
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 7,35 Euro geht dieses Buch in den Besitz von Frau A. Z. in Freising über.
[Das dekorative Initial der Autorin im Titelbild, vom Einbanddeckel der hier veräußerten Ausgabe, stammt von Werner Rebhuhn.]
Artikel-Nr. 0013-0291
Tuesday, 26. October 2010Schopenhauer, Arthur: Vorlesung über Die gesammte Philosophie | d. i. Die Lehre vom Wesen der Welt und von dem menschlichen Geiste. In vier Theilen. Erster Theil. Theorie des gesammten Vorstellens, Denkens und Erkennens. 1820. Zusammen mit: Probevorlesung (1820) | Lobrede (1820) | Dianoiologie (1821). A. d. handschriftlichen Nachlaß. Hrsg. u. eingel. v. Volker Spierling. – München: R. Piper, 1986. – 573 & 3 S., 19,0 x 12,1 cm, Okt. – Sauber u. kaum gelesen. – Erste Aufl. dieser Taschenbuchausg. – ‘Serie Piper’, Bd. 498. – ISBN: 3-492-00798-8.
Das ist nun wirklich merkwürdig, ein Fall wie aus Paul Kammerers Buch Das Gesetz der Serie. Gestern bestellte ein Kunde aus Kiel den dritten Band aus der vierbändigen Taschenbuch-Ausgabe der Berliner Vorlesungen von Arthur Schopenhauer von 1820/21, die Metaphysik des Schönen – und heute nun möchte ein Kunde aus Wien den ersten Band haben. (Die Bände zwei und vier hatte ich bereits im Juli nach Bergisch Gladbach verkauft.) Man möchte fast meinen, dass vorgestern das Philosophische Quartett mit dem Schopenhauer-Biographen Rüdiger Safranski getagt und dieser ein paar eingängige Sätze über die vergriffenen Vorlesungs-Skripte fallen gelassen hat.
An einer Stelle des (leider nicht durch Register erschlossenen) Buches unterscheidet der bittere Pessimist mit Bezug auf Machiavelli und Hesiod drei Arten von Köpfen: die große Mehrheit jener, die bloß im Dunklen herumtappen und nur das Vorgepredigte nachbeten können; eine wesentlich kleinere Zahl jener, die immerhin Urteilskraft haben, zwischen Wahrem und Falschem zu unterscheiden; und schließlich die überaus seltenen Köpfe, die ganz eigenständig „etwas ausfinden, erfinden, erdenken“ können, mithin über „schöpferische Denkkraft“ gebieten.
Ich stelle mir gerade vor, wohin es mit uns gekommen wäre, wenn es sich geradezu umgekehrt verhielte und die Mehrzahl unserer Population schon immer – oder doch immerhin ab einem gewissen Umschlagpunkt unserer Evolution – mit schöpferischer Denkkraft versehen wäre. Die chaotischen Bilder, die sich mir da aufdrängen, sind keineswegs erfreulich. Ich muss an die Kindergärtnerin denken, die sich beklagte, dass ihr Arbeitsalltag mit der neuen Gruppe kaum noch zu ertragen sei, weil sie „einfach zu viele Kreative“ dabei hätte.
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 51,50 Euro geht dieses Buch in den Besitz von W. K. in Wien über.
[Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt des Umschlags von Federico Luci unter Verwendung des Gemäldes Kreidefelsen auf Rügen von Caspar David Friedrich (nach 1818), das im Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten in Winterthur aufbewahrt wird.]
Artikel-Nr. 0012-0293
Tuesday, 26. October 2010Schopenhauer, Arthur: Metaphysik des Schönen. Philosophische Vorlesungen Teil III. A. d. handschriftlichen Nachlaß. Hrsg. u. eingel. v. Volker Spierling. 1820. München: R. Piper, 1985. – 229 & 11 S., 19,0 x 12,1 cm, Okt. – Sauber u. ungelesen. – Erste Aufl. dieser Taschenbuchausg. – ‘Serie Piper’, Bd. 415. – ISBN: 3-492-00798-8.
Schopenhauer erweist sich besonders auch in seinen Vorlesungen als ein Meister der Begriffsbestimmungen (Definitionen). Die bis ins letzte Komma ausgereiften Satzgebilde führen uns Schritt für Schritt, oder vielleicht noch genauer: Schnitt um Schnitt an den Kern des zu begrenzenden Gegenstands. Ein Beispiel? Nach Schopenhauer „besteht Genialität in der Fähigkeit sich rein anschauend zu verhalten, sich in die Anschauung zu verlieren, und die Erkenntniß, welche ursprünglich nur zum Dienste des Willens da ist, diesem Dienste zu entziehn, d. h. sein Interesse, sein Wollen, seine Zwecke, ganz aus den Augen zu lassen, sonach seiner Persönlichkeit sich auf eine Zeit völlig zu entäußern, um nur noch übrig zu bleiben als rein erkennendes Subjekt, klares Weltauge: und zwar dieses alles nicht auf Augenblicke; sondern so anhaltend und mit so vieler Besonnenheit, als nöthig ist, um das Aufgefaßte durch überlegte Kunst zu wiederholen, und (wie Göthe sagt [Faust I, Verse 348-349]) ,was in schwankender Erscheinung schwebt zu befestigen in dauernden Gedanken‘ […].“ (S. 67 des hiermit veräußerten Buches.)
Man möchte fragen, ob es schon genügen soll, aus der Welt heraus in dieses klare Weltauge zu schauen? Oder ob man gar anstreben darf, aus diesem klaren Weltauge auf die Welt zu schauen? Und wird man, ist erst einmal der rein anschauende Blick gewagt und geglückt, jemals noch auf triviale, praktische, zweckdienliche Weise aus der Wäsche kucken können? Nicht ohne Grund verbindet Schopenhauer ja diese Art Anschauung mit dem Verlust seiner selbst.
Gerade einmal fünf Studenten hörten sich 1920 diese Vorlesungen Schopenhauers in Berlin an, während bei seinem großen Kontrahenten Hegel der Hörsaal mit über 200 Studenten bis zum Bersten gefüllt war. Auch dieser „Philosophie-Star“ seiner Zeit hatte einen Begriff von Genie, mit dem er sich ganz konventionell auf „Göttlichkeit“ und „Erhabenheit“ ausruhte. Wenig inspiriert, so könnte man urteilen; eine auf den Hund gekommene Philosophie, die sich die Begeisterung nicht einmal verbieten muss, weil sie schlicht keine hat.
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 33,35 Euro geht dieses Buch in den Besitz von Herrn M. M. in Kiel über.
[Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt des Umschlags von Federico Luci unter Verwendung des Gemäldes Junotempel von Caspar David Friedrich (um 1828-1830), das in der Hamburger Kunsthalle aufbewahrt wird.]
Artikel-Nr. 0011-0472
Friday, 22. October 2010Tüngel, Richard / Hans Rudolf Berndorff: Stunde Null. Deutschland unter den Besatzungsmächten. Mit einem Essay von Laszlo F. Földenyi. Berlin: Matthes & Seitz Berlin, 2004. – 440 S., 21,5 x 12,6 cm, OPb. m. OSchU. – Neuwertig. – Die Erstausgabe ersch. zuerst 1958 bei Christian Wegner in Hamburg u. d. T. Auf dem Bauche sollst du kriechen… Deutschland unter den Besatzungsmächten. – ISBN: 3-88221-809-6.
Eins der ersten Bücher, die nach dem Generationswechsel im Verlag Matthes & Seitz und dem Umzug von München nach Berlin erschienen sind. Ehrlich gesagt habe ich mir damals für den nun modisch unter „Matthes & Seitz Berlin“ firmierenden Verlag keine Zukunft ausmalen können. Mittlerweile ist eine beeindruckende Backlist zu bestaunen, der die gerade erst in Angriff genommene Jean-Henri-Fabre-Werkausgabe vielleicht einmal die Krone aufsetzen wird.
Das Buch von Tüngel und Berndorff interessierte mich ursprünglich, weil ich es im Vergleich zu anderen „Trümmergeschichten“ lesen wollte, neben Büchern wie Tage des Überlebens von Margret Boveri oder Der Untergang von Hans Erich Nossack. Meine Eltern, Jahrgang 1926 bzw. 1928, schwiegen sich über ihre Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegserlebnisse aus, von ein paar eher komischen Anekdoten aus dem Luftschutzkeller, oder von Hamsterfahrten ins Sauer- oder Münsterland abgesehen. Gern wird für dieses Beschweigen der Vergangenheit vereinfachend der Begriff „Verdrängung“ bemüht. Es mag sein, dass man das Verschweigen schrecklicher Tatsachen und Erlebnisse durch die Täter als Verdrängung bezeichnen kann. Meine Eltern aber waren zur Tatzeit zu jung, um in schuldhafte Verstrickung geraten zu können. Das macht sie nicht besser als ihre schuldig gewordenen Landsleute, sie hatten nur einfach Glück – soweit man von Glück sprechen kann, wenn einen das Schicksal nicht zum Täter, sondern „nur“ zum Opfer bestimmt. Hier kann ich mich, einmaliger Fall einer unwahrscheinlichen Annäherung, sogar ausnahmsweise an die Seite Helmut Kohls stellen, der zur Rechtfertigung seines umstrittenen Kanzlerworts sagte: „Die Gnade der späten Geburt ist nicht das moralische Verdienst meiner Generation, der Verstrickung in Schuld entgangen zu sein. Gnade meint hier nichts weiter als den Zufall des Geburtsdatums.“ (Bloß weiß der Ex-Kanzler im Unterschied zu mir nicht, dass er nicht weiß, wovon er spricht, wenn er Zufall sagt.) Insofern erkläre ich mir die Verschwiegenheit meiner Eltern über ihre doch gewiss abenteuerliche und lehrreiche Kindheit in der Nazizeit und Jugend im Krieg hauptsächlich mit ihrer fürsorglichen Rücksichtnahme auf uns doch in eine ganz andere, friedvolle Zeit hineingeborenen, unschuldigen Kinder. (Dass eine vermeintlich angestrebte „Verdrängung“ bei meinen Eltern ohnehin zu keinem Erfolg führte, das sah ich zum Beispiel daran, wie meine Mutter bei den in den 1960er-Jahren noch oblogatorischen Probealarmen aus der Fassung geriet; oder besonders pointiert daran, dass mein scheinbar kerngesunder Vater, 24 Jahre nach Kriegsende, gerade mal 43 Jahre alt, urplötzlich an einem Leberleiden krepierte, das er sich in britischer Kriegsgefangenschaft „geholt“ hatte.)
Das hiermit verabschiedete Buch erfüllte nur am Rande meine Erwartungen, den alltäglichen Geruch und Geschmack jener Jahre um 1945 in Deutschland besser spüren zu können. Sein Hauptgegenstand ist nicht die sinnliche Realität der Stunde Null, sondern (schon wieder!) die intellektuelle Konstruktion, die zwar provisorische, aber doch energisch betriebene Renovierung zivilisierter Verhältnisse in Politik, Wirtschaft, Technik und Kultur aus der Sicht zweier Presseleute. Wenn ich es dennoch mit Interesse gelesen habe, war es vermutlich die erst im Laufe der Lektüre erwachende Anteilnahme an der Lage von Besiegten unterm Joch siegreicher Invasoren.
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 10,10 Euro geht dieses Buch in den Besitz von I. H. v. V. in Hannover über.
[Titelbild vom Schutzumschlag des besprochenen Buches: Der Goetheforscher Ernst Beutler mit seinem Sohn in der Ruine des Frankfurter Goethe-Hauses, Sommer 1945. – Übrigens habe ich das heute verkaufte Buch auch schon einmal unmittelbar nach meiner Lektüre hier gewürdigt.]
Artikel-Nr. 0010-1416
Wednesday, 20. October 2010Friedenthal, Richard: Karl Marx. Sein Leben und seine Zeit. München / Zürich: R. Piper Verlag, 1981. – 652 & 4 S. u. 16 unpag. Kunstdruck-Taf. m. 27 Abb. & 6 weitere Abb. im Text, 21,9 x 13,7 cm, OLw. m. OschU. – Rückentitel etwas abgeblättert, feiner Namenszug u. Datum auf Schmutztitel, Schnitt wenig angestaubt, leicht muffig. – Erstausgabe. – 1. bis 15. Tsd. – ISBN: 3-492-02713-X.
Wenn es mehr solcher Enzyklopädisten wie Richard Friedenthal gegeben hätte, dann hätten vermutlich die papierenen Enzyklopädien den Kampf gegen Wikipedia & Co. nicht so schnell verloren. Die Verlage für solche Nachschlagewerke, wie hierzulande Brockhaus und Meyer, in Frankreich Larousse, im englischsprachigen Raum der Verlag der Encyclopædia Britannica, haben in den vergangenen Jahrzehnten ihr Heil in immer umfangreicheren, schmuckvolleren – und unpraktischeren Lexika gesucht. Friedenthal ist 1932 im Auftrag des Berliner Knaur-Verlags genau in die entgegengesetzte Richtung marschiert. Sein Konversationslexikon in einem [!] Band verzeichnete „nur“ 35.000 Stichworte auf knapp tausend zweispaltigen Seiten. Und doch kann man noch heute mit diesem kaum ein Pfund schweren Büchlein die erstaunliche Erfahrung machen, dass es – die Aktualität mal außen vor gelassen – fast immer genau das verrät, was man zu wissen wünscht. Wenn man sich dazu noch vergegenwärtigt, dass dieses überaus erfolgreiche Wissenskompendium im Manteltaschenformat das Werk eines einzigen Mannes war, wo in der Zeit des Niedergangs der vorgenannten Protzlexika ganze Heerscharen von Fachgelehrten beschäftigt werden mussten und dennoch nicht deren schließlichen Untergang verhindern konnten, dann muss man neugierig werden und sich fragen, was für ein stupend gebildeter und blitzgescheiter Mann dieser Richard Friedenthal gewesen sein muss! [Das Titelbild zeigt den Ausschnitt eines Porträtfotos von Richard Friedenthal von Rosemarie Clausen, vom rückwärtigen Umschlag des hier veräußerten Buches.]
1938 entkam der Jude Friedenthal gerade noch rechtzeitig vor den Nazis nach England. Ich weiß nicht mehr, wo ich ’s gelesen habe, vielleicht in einem Brief Friedenthals an Stefan Zweig, aber es ist mir unauslöschlich haften geblieben, dass er zwischen den Seiten der Bücher in seiner umfangreichen Bibliothek, die er ins Exil gerettet hatte, immer wieder Spuren von Putz und Geröll entdeckte, die von einem der schrecklichen „Baedeker bombings“ der „Krauts“ herrührten – der Deutschen also, die anhand präziser Pläne in den Baedeker-Reiseführern bis weit ins britische Hinterland hinein als Vergeltungsmaßnahme für den alliierten Angriff auf Lübeck im März 1942 ihren tödlichen Bombenhagel hinabregnen ließen. (Solcherlei Kleinigkeiten merkt man sich halt, wenn man 17 lange Jahre in der nun nicht mehr existierenden Buchhandlung gleichen Namens in Essen gearbeitet hat.)
Dass aber der Autor des Lexikons seinen bis heute nicht verblassten Nachruhm einer weiteren literarischen Großtat verdankt, nämlich seinen vielleicht nicht ,definitiven‘, aber doch immerhin auch heute noch gut zu lesenden Biographien von Goethe (1963), Luther (1967), Jan Hus (1972) und schließlich Karl Marx (1981), das ist schon staunenswert. Und erstaunlich auch, dass der Piper-Verlag damals gleich bei der ersten Auflage mit 30.000 Stück auftrumpfte! Heute, zwanzig Jahre nach der Niederlage des kommunistischen Machtblocks, würde er sich vermutlich nur noch ein Zehntel zutrauen. Jetzt, da ich das dicke Buch wieder zur Hand nehme, um es versandfertig zu machen, überkommt mich fast Lust, es noch einmal zu lesen. Aber nein, es ist verkauft, und damit Schluss!
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 12,10 Euro geht dieses Buch in den Besitz von Herrn A. T. in Mecklenburg-Vorpommern über.
Artikel-Nr. 0009-0498
Saturday, 16. October 2010Koestler, Arthur: Die Gladiatoren / Sonnenfinsternis / Ein Mann springt in die Tiefe. Drei Romane. M. e. Nachw. d. Autors. Bern / Stuttgart / Wien: Alfred Scherz Verlag, 1960. – 701 & 3 S., 20,7 x 13,3 cm, OLw. m. Deckel- u. Rückenprägung. – Umschlag m. kleinen Randläsionen, Papier altersbedingt gebräunt. – Erste Ausgabe dieser Zusammenstellung mit dem Nachwort. – Die engl. Originalausgaben erschienen u. d. T. The Gladiators (1939), Darkness at Noon (1940) und Arrival and Departure (1943).
Dieses Buch bekam ich vor ein paar Jahren mal von einem über 90-jährigen Herrn geschenkt, der mittlerweile verstorben ist. Er war zeitlebens sehr kulturbeflissen, allerdings galt seine große Liebe eher dem Theater. Zugleich war er sehr sparsam und liebte es, kleine Gefälligkeiten, um die er mich und andere bat, statt mit Geld mit kleinen Geschenken zu entlohnen, wenn eben möglich aus dem scheinbar unerschöpflichen Fundus seines eigenen Krimskrams, ihm selbst unwillkommene Geschenke, für die er angestrengt nach dankbaren Abnehmern suchte. Das klingt nun vielleicht abschätzig, so meine ich es aber keineswegs. Vielmehr hatten diese originellen Kompensationen auch etwas sehr Rührendes, steckte doch immer viel Nachdenken und Kombinieren dahinter. Nach Arthur Koestler hatte er mich einmal völlig ohne jeden erkennbaren Zusammenhang gefragt: Ob ich den denn kennte, was ich von ihm gelesen hätte, was ich von ihm hielte? Da dachte ich gleich: ,Nachtijall, ick hör dir trappsen!‘ Und richtig, ein paar Wochen später kam er mit der dicken Schwarte, drei Romane in einem Band, um die Ecke. [Das Titelbild zeigt die Initialen des Autors im vorderen Einbanddeckel.] Das war insofern eine kleine Enttäuschung, als ich sowohl Die Gladiatoren als auch Sonnenfinsternis in wenn nicht schönen, so doch originellen Einzelausgaben bereits besaß. Na gut, geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul. Und da ich schon dabei bin, Redewendungen vom laufenden Meter abzuspulen, hier gleich die nächste: Ich machte gute Miene zu bösem Spiel.
Der Name Koestler begegnete mir zum ersten Mal, als ich mich für den Spanischen Bürgerkrieg (Juli 1936 bis April 1938) interessierte, auf der Suche nach den wenigen Beispielen gelebter Utopie, nach einer Welt ohne Herren und Knechte, ohne Eigentum und Diebstahl, buddelnd nach dem Strand unterm Pflaster, nach der verlorenen Zeit, als das Wünschen wenn nicht geholfen, so doch immerhin gelindert hat, nämlich den Schmerz über das verlorene Paradies. Arthur Koestler gefiel mir in diesem Zusammenhang insbesondere wegen seiner schillernden Widersprüchlichkeit. In diesem Zusammenhang will ich nicht wieder das berühmte Wort von Conrad Ferdinand Meyer über den Menschen im Widerspruch zitieren, sondern zur Abwechslung mal Pier Paolo Pasolini, der wusste „wie widersprüchlich man sein muss, um wirklich konsequent zu sein.“ Dessen Beispiel zeigt ja, dass die Konsequenz eines nach Gewaltlosigkeit strebenden Revolutionärs schließlich in den gewaltsamen Tod führen muss. Wenn Koestler sein Engagement als Kriegsberichterstatter auf Seiten der Republikaner (nicht der Anarchisten um Buenaventura Durutti) im Spanischen Bürgerkrieg überlebt hat, war das wohl mehr Glück als Verstand. Ein Vaterland hat der aus Ungarn stammende Österreicher, deutschsprachige Sohn eines jüdischen Industriellen, der zudem in Englisch und Französisch schrieb, nie gehabt, nicht gekannt und kaum gewollt. Meine ganz große Verehrung für Arthur Koestler setzte aber viel später ein und hatte völlig andere Ursprünge, auf die ich später, anlässlich des Verkaufs anderer seiner Bücher aus meiner Bibliothek, sicher noch einmal zu sprechen kommen werde. (Vorausgesetzt, sie finden einen Käufer.)
Den dritten der hier versammelten Romane, Ein Mann springt in die Tiefe, hätte ich vielleicht doch gern einmal gelesen. Jedenfalls ist der Anfang – und ich bin ein Spezialist für die Ästhetik und Magie von Romananfängen – mindestens überdurchschnittlich gut gelungen: „Na, dann los, dachte der junge Mann, beugte den Oberkörper unbeholfen vor und sprang – es sah mehr nach einem Unfall als nach Absicht aus – in die Tiefe.“ (Ich nenne in meiner ewigen Hitliste der besten Romananfänge gegenwärtig nur 97 besser gelungene!)
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 52,10 Euro geht dieses Buch in den Besitz von M. Sch. in Berlin über.
Artikel-Nr. 0008-1100
Thursday, 14. October 2010Guha, Anton Andreas: Ende. Tagebuch aus dem 3. Weltkrieg. Königstein/Ts.: Athenäum Verlag, 1983. – 181 & 3 S., 20,4 x 12,5 cm, Okt. – Einband knickspurig, unten von Kinderzähnen benagt, aber problemlos noch lesbar. – Erstausgabe. – ISBN 3-7610-8279-7.
Erinnern wir uns. Im April des Jahres 1983 stoppte das Bundesverfassungsgericht mit einer einstweiligen Verfügung die seit dem Vorjahr geplante Volkszählung in der Bundesrepublik Deutschland und knickte so vor der an Massenhysterie grenzenden Paranoia weiter Teile der aufgeklärten Bevölkerung ein. Man darf aber nicht vergessen, dass damals noch längst kein Gorbatschow in Sicht war, um Perestroika und Glasnost auszurufen und den auf mehr oder weniger kleiner Flamme köchelnden kalten Krieg abzulöschen. Die neue Seuche AIDS wurde wenig später durch einen Spiegel-Artikel, den ich auf dem Wartestuhl eines Friseursalons an der Alfredstraße las, salonfähig in den Fluren der Gesellschaft des Spektakels (Guy Debord). Steckte nicht am Ende gar der Papst hinter dieser neuen Pest, die vorwiegend Schwule und promiske Lebeleute betraf? (Johannes Paul II. hatte aber doch gerade erst Galileo Galilei rehabilitiert. Vielleicht bloß zur Tarnung?) Am 22. Oktober versammelten sich im Bonner Hofgarten Hunderttausende, um für Frieden und Abrüstung und gegen den NATO-Doppelbeschluss zu demonstrieren. Insgesamt etwa 1,3 Millionen Menschen bekundeten in der Bundesrepublik Deutschland an diesem Tag ihre Abneigung gegen die Nachrüstung. Dieses Datum markiert somit den Siedepunkt der als „Heißer Herbst“ bekannte gewordenen Jahreszeit 1983.
Insofern wird das hiermit verscherbelte Buch erkennbar als ein typischer „Wellenreiter“. Gut gemeint, aber doch im Rückblick bloß noch komisch: „Die gefährlichste Nachricht aber aus Saudi-Arabien: Die US-Verbände der schnellen Eingreiftruppe sollen so gut wie aufgerieben worden sein. Die Sowjets haben die besseren Nachschubverbindungen. Amerikanische Entsatzversuche aus Stützpunkten in Oman und Somalia scheiterten. Viele Erdölfelder stehen in Flammen.“ (S. 130) Und auf dem hinteren Deckel lesen wir heute staunend: „Chaos, Panik, Durst, Tod, Auflösung aller sozialen Ordnung, in der Luft Millionen Tonnen Staub und Asche. Die Staubpartikel sind Träger der radioaktiven Strahlung, der nichts und niemand entgehen kann.“
Das Buch kommt ja als Tagebuch daher. Und weil mich Tagebücher aller Art, selbst fiktive, zunehmend interessieren, werde ich mir wohl bei Gelegenheit ein Ersatzexemplar zulegen müssen, wenn eben möglich ohne die hier zu beklagenden Kinderzahnbisse [s. Titelbild]. Die Kinder, die diesen Schaden anrichteten, sind mittlerweile vermutlich schon groß und würden sich wundern, wenn sie wüssten, welche Sorgen sich ihre Eltern Mitte der 1980er-Jahre um ihre Zukunft gemacht haben.
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 26,00 Euro geht dieses Buch in den Besitz Herrn T. H. im thüringischen Rudolstadt über.
Artikel-Nr. 0007-0086
Thursday, 14. October 2010Weiss, Ernst: Der Aristokrat. Boëtius von Orlamünde. Roman. Hamburg: Claassen Verlag, 1966. – 229 & 3 S., 20,5 x 12,8 cm, OLw. m. aufgeklebtem Rückenetikett, Fadenheftung. – Einband und Kopfschnitt fleckig, ohne den Umschlag. – Erste Auflage der Neuausgabe. – Die Erstausgabe erschien 1928 u. d. T. Boëtius von Orlamünde (W.-G.², 22).
Bei manchen Büchern vermag ich die Motive, die mich vor langer Zeit zu ihrem Kauf verführten, nicht mehr vollständig zu ergründen. So in diesem Fall. Es muss da am 25. Februar 1982 mehreres zusammengekommen sein, um mir im Antiquariat der Stern-Buchhandlung in Düsseldorf die sechs Mark aus dem Portemonnaie zu kitzeln, die das wenig ansehnliche Buch kostete. Witzig übrigens der mehrstufige Preisverfall, wie er im hinteren Deckel ablesbar ist [s. Titelbild]. Ich habe diese Entwertungskaskade extra nicht ausradiert, denn sie verrät ja einiges über die Verkäuflichkeit des als schwierig verschrienen Autors Ernst Weiss. Wenn man nach ihm die Hand ausstreckt, bekommt man von Kennern schon mal zu hören: „Ernst Weiss? Das wollen Sie sich antun? Aber dann lesen Sie doch lieber gleich Musil!“
Robert Musil kannte ich allerdings schon vergleichsweise wie meine staubige linke Westentasche, Anfang der 1980er-Jahre, wenngleich ich in seinem MoE auch im dritten Anlauf nach einem guten Drittel steckenblieb. Ernst Weiss war mir aufgefallen als Mentor und Geliebter der Rahel Sanzara, deren Roman Das verlorene Kind (1926) ich ebenfalls im Angebot habe. (Ernst Weiss soll zu diesem Buch einen nicht unerheblichen Beitrag geleistet haben, weshalb er unter W.-G.², 20 als Mitverfasser gelistet ist.) Gut möglich ist allerdings auch, dass ich mich durch den ja nicht ganz üblen Anfang des Buches verführen ließ, und der geht so: „Ich heiße Boëtius Maria Dagobert von Orlamünde, oder besser gesagt, ich nenne mich Orlamünde. Das historische Geschlecht derer von Orlamünde ist im 16. Jahrhundert ausgestorben. Orlamünde ist also hier bloß ein Name. Ich entstamme einem anderen uradeligen Geschlecht, das ich nicht nennen will. Trotz meines hochklingenden Namens bin ich nicht viel. Auch meine Eltern lebten in den erbärmlichsten Verhältnissen. Wußten sie es? Täuschten sie sich? Sie besaßen noch Reste früheren Glanzes, aber sie hungerten, und unser alter Diener David mit ihnen.“ – Ich glaube nachträglich, dass mein Kaufentschluss spätestens nach dem mit „Trotz“ beginnenden Satz, den man sich ja nicht oft genug auf der Zunge zergehen lassen kann, unrevidierbar war.
Was macht der Hinterkopf? Der Hinterkopf sagt bei solch trivial häufigen Schriftstellernamen wie Mann, Walser, Roth oder eben Weiss, dass man doch den Heinrich nicht wegen der Prominenz seines Bruders Thomas vernachlässigen soll, den Robert aus dem Schatten von Martin und all die kleinen Pinscher namens Philip, Eugen, Di[e]ter, Jürgen oder Patrick wenigstens in ein mildes Funzellich treten lassen soll. So auch im Falle Weiss. Wir werden dem Peter seinen selbstzerstörerischen Opfermut niemals vergessen – aber was kann denn der erstgeborene Ernst dafür? Vielleicht wollte ich mit dem Kauf dieses Aristokraten-Romans dem Heiligen des Proletariats eins auswischen? Wenige Tage später, am 10. Mai 1982, ist Peter gestorben.
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 26,00 Euro geht dieses Buch (mit den drei gleichzeitig bestellten) in den Besitz von Herrn T. H. im thüringischen Rudolstadt über.
Artikel-Nr. 0006-0096
Thursday, 14. October 2010Die Geister des gelben Flusses. Chinesische Märchen. Aus dem Chinesischen und mit Anmerkungen von Richard Wilhelm. Mit einem Nachwort von Prof. Dshu Bai-Lan [in anderer Transkription Zhu Bailan] von der Nanking-Universität (d. i. Klara Blum). Rudolstadt: Greifenverlag, 1955. – 363 & 1 S. m. 8 ganzseitigen Abb., 19,5 x 13,0 cm, OLw., Fadenheftung. – Ohne den OschU. v. Hans Jordan. – Einband unfrisch. – Lizenzausgabe vom Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf für die DDR. – Veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 384-220/11/55 – „Der Vertrieb nach Westberlin und Westdeutschland ist nicht gestattet.“ [Erfolgt nun aber doch, allen Restriktionen früherer Zeiten zum Trotz.] – Mit einer Widmung in Bleistiftschrift auf dem Vorsatz: „F. / l. Döchting | zum 15. 5. 1960 | herzlichst überreicht | von den | Parentes nominales [Nenneltern].“
Da ich jetzt das Buch nach Jahren wieder in die Hand nehme, scheint es mit vor allem wegen dieser verschollenen Klara Blum (1904-1971) erheblich und erwähnenswert. Mit diesen begeisterten Worten singt sie die Lobeshymne dieser aus dem chinesischen Volksmund geschöpften Geschichten: „Überwältigend zeigt sich in vielen Märchen der geniale Schönheitssinn des chinesischen Volkes. Welche Fülle, welche Feinheit der Einbildungskraft hat sich diese schmerzensreiche Nation noch in ihrem bittersten Elend bewahrt! Wie zart und duftig und verhalten spöttisch ist das Märchen von den Blumenelfen! [S. 106-110] Wie anmutig schwebt die Mondfrau vorüber, sie, die von manchen Chinesinnen als Vorläuferin der Frauenemanzipation angesehen wird [S. 45 f.]. Welche Musik der Farben läßt der Magier Morgenhimmel spielen, der verkörperte Wunschtraum, ein Mensch zu sein, dem alles gelingt [S. 67-71]. Und wie leuchten die wundertätigen Perlen der Drachenprinzessin, die wundertätigen Perlen der chinesischen Phantasie in der Nacht des leidenden Volkes, während es allmählich die Kräfte sammelte, seiner Nacht und seinen Leiden ein Ende zu machen! [S. 124-128]“ (S. 356).
Richard Wilhelm, der Doyen der Sinologie in Deutschland und trotz aller heutigen Einwände wegen seiner mangelnden Kenntnisse, etwa des Taoismus, und seiner von einem missionarisch Protestantismus getrübten Sicht auf Zhōngguó, das Reich der Mitte, auch aus heutiger Sicht mit seinen Übersetzungen des I-Ging und Tao Te King der wohl wirkmächtigste Pionier der China-Forschung in Deutschland, hat eine erste, noch schmale Sammlung chinesischer Volksmärchen unter diesem Titel zuerst 1926 als Heft 66 der Kranz-Bücherei im Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt am Main herausgebracht. Da ich dieses schmale Bändchen nicht kenne, vermag ich nicht zu sagen, ob der „Bildschmuck nach chinesischen Motiven von Josefine Fleck“, den es laut Beschreibung enthält, mit den acht anonymen Abbildungen identisch ist, die die mir vorliegende Ausgabe von 1955 zieren. [Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt aus der Abbildung Der Hagelgott (S. 15).] Zum Abschied gebe ich hier die als „Kindermärchen“ einsortierte Geschichte Wer ist der Sünder? (S. 14) wieder, die das uralte Motiv des ,Wetterurteils‘ variiert:
»Es waren einmal zehn Bauern, die gingen miteinander über Feld. Sie wurden von einem schweren Gewitter überrascht und flüchteten sich in einen halbzerfallenen Tempel. Der Donner aber kam immer näher, und es war ein Getöse, daß die Luft ringsum erzitterte. Kreisend fuhr ein Blitz fortwährend um den Tempel her. Die Bauern fürchteten sich sehr und dachten, es müsse wohl ein Sünder unter ihnen sein, den der Donner schlagen wolle. Um herauszubringen, wer es sei, machten sie aus, ihre Strohhüte vor die Tür zu hängen; wessen Hut weggeweht werde, der solle sich dem Schicksal stellen. – Kaum waren die Hüte draußen, so ward auch einer weggeweht, und mitleidlos stießen die andern den Unglücklichen vor die Tür. Als er aber den Tempel verlassen hatte, da hörte der Blitz zu kreisen auf und schlug krachend ein. – Der eine, den sie verstoßen hatten, war der einzige Gerechte gewesen, um dessentwillen der Blitz das Haus verschonte. So mußten die neun ihre Hartherzigkeit mit dem Leben bezahlen.«
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 26,00 Euro geht dieses Buch (mit den drei gleichzeitig bestellten) in den Besitz von Herrn T. H. im thüringischen Rudolstadt über.
Artikel-Nr. 0005-0219
Wednesday, 13. October 2010Franquin, André: Schwarze Gedanken. Hamburg: Carlsen Verlag, 1990. – 191 & 1 S., 18,0 x 11.0 cm, Okt. – Ohne Titelseite, sonst solides, sauberes Exemplar. – 1. Auflage. – Die Originalausgaben erschienen 1981 u. 1984 u. d. T. Idées Noires no 1- no 3 bei Audie Fluide Glacial in Paris. – Carlsen Pocket, Bd. 2. – ISBN 3-551-79002-7.
André Franquin (1924-1997) ist so etwas wie der finstere Schatten des anderen bedeutenden Großmeisters der Comic-Kunst aus Belgien, des freundlichen Hergé mit seinem Welterfolg Tintin (deutsch als Tim und Struppi berühmt und geliebt). Sein böser Stift übte sich zunächst an Spirou und Fantasio, um dann mit seiner ersten eigenen Kreation Gaston ganz zu sich selbst zu finden. Franquin ist ein Großmeister des Schwarzen Humors, und wenn es zu André Bretons Zeiten schon Comics gegeben hätte, wäre Franquin gewiss in dessen berühmte Anthologie aufgenommen worden.
Auch ganz wörtlich arbeitet Franquin mit sehr viel Schwarz [s. Titelbild, Ausschnitt aus S. 191 des hier veräußerten Buches – © Carlsen Verlag, Hamburg]. Das Männlein, das sich unter diesem im Schwarzen kriesenden Geier von dannen pirscht gen schwarzem Horizont, dieses Männlein muss aus urheberrechtlichen Gründen hier leider unterschlagen werden.
Franquin litt übrigens zeitlebens an Depressionen. Ob wegen oder trotz seiner makaber-witzigen Bildgeschichten, das wird ein ewiges Rätsel der Geschichte der „Neunten Kunst“ bleiben.
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 26,00 Euro geht dieses Buch (mit den drei gleichzeitig bestellten) in den Besitz von Herrn T. H. im thüringischen Rudolstadt über.
Artikel-Nr. 0004-0839
Wednesday, 13. October 2010Olson, Charles: Nennt mich Ismael. Eine Studie über Herman Melville. Nachw. v. Klaus Reichert. [A. d. Am. v. Wulf Teichmann.] München: Carl Hanser Verlag, 1979. – 132 & 4 S., 20,2 x 13,2 cm, Okt. – Einband nachgedunkelt bzw. lichtrandig, innen gut. – Erste Ausgabe dieser Übersetzung. Beiliegend eine lose Titelei mit dem Hinweis auf den Übersetzer – Erschienen in der Schriftenreihe Literatur als Kunst, hrsg. v. Walter Höllerer. – Die amerik. Originalausg. des ersten Buches von Charles Olson erschien 1947 u. d. T. Call Me Ishmael bei City Light Books in San Francisco. – ISBN 3-446-12738-0.
Was hier in wenigen Zeilen an großen Namen aufgefahren wird, ist schon imposant. Charly Olson dürfte mir erstmals über den Weg gelaufen sein, als ich mich mit dem Komponisten John Cage beschäftigte, der natürlich im Zusammenhang mit meinen Zufallsforschungen interessant für mich werden musste. Habe ich irgendwo gelesen, dass Olson der Erfinder des Ausdrucks post-modernism war, oder verwechsle ich ihn da mit Robert Creeley? Seine Melville-Studie hat mich jedenfalls hervorragend eingestimmt auf meine erste, dann doch gescheiterte Moby-Dick-Lektüre, aber das ist ein anderes Thema und betrifft ein größeres Buch.
Klaus Reichert hätte ich gern einmal persönlich kennengelernt, ich kann die Zusammenhänge, in denen der Anglist als Übersetzer und Vermittler meine Leserouten kreuzte, gar nicht mehr alle hersagen. Da er bereits 1965 ein edition-suhrkamp-Bändchen mit Gedichten von Olson als Herausgeber und Übersetzer betreut hat, läge die Vermutung nahe, dass auch dessen Call Me Ishmael von Reichert übertragen wurde. Hier hat aber das Lektorat von Hanser offenbar geschlampt, denn auf dem Titel fehlt jede Angabe zum Übersetzer [s. Titelbild, links], und auch im rückseitigen Impressum sucht man diesbezügliche Angaben vergeblich.
Das hat nun offenbar – und durchaus verständlicherweise – dem tatsächlichen Übersetzer Wulf Teichmann ganz und gar nicht gefallen. Und so musste der Verlag die vervollständigte Titelei als 14,7 x 10,5 cm großes Zettelchen dem Buch beigelegt werden [s. Titelbild, rechts]. Meist gehen solche Zettelchen mit den Jahren irgendwann verloren, deshalb werden sie gelegentlich sogar – wenn nämlich die „vergessenen“ Mitarbeiter hartnäckiger auf ihrem Recht bestehen – im Buch festgeklebt. Nun, das hatte Wulf Teichmann 1979 vielleicht nicht mehr nötig, als Übersetzer so bekannter Autoren wie Alexander Trocchi, Oscar Wilde, Peter Ustinov, Alan Silitoe, Thomas Pynchon, Isaac Bashevis Singer, Ross Macdonald, Charles Bukowski, Erica Jong, Eric Ambler und Virginia Woolf. Aber bereits bei Teichmanns Übertragung von Ustinovs Krumnagel von 1971 hatte der Verlag (damals die DVA in Stuttgart) ihn zu erwähnen vergessen. Vielleicht ging es bei Olson nun ums Prinzip? Verständlich. Die Leistung der (guten) Übersetzer wird noch immer nicht ausreichend gewürdigt. Und Teichmann ist ein sehr guter!
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 27,50 Euro geht dieses Buch in den Besitz von G.-M. J. in Zürich über.
Artikel-Nr. 0003-0348
Tuesday, 12. October 2010Asquith, Cynthia: Ein Leben mit Tolstoj. Die Ehe der Gräfin Sofja mit Leo Tolstoj. A. d. Engl. v. Arno Dohm. München: Biederstein Verlag, 1962. – 361 & 3 S. u. 4 Kunstdrucktaf., 20,7 x 12,4 cm, OLw. m. aufgeklebtem Rückenetikett, im OSchU., Fadenheftung. – Der Umschlag unfrisch, etwas rissig, mit Spuren von Klebefilm [s. Titelbild], das Buch selbst sehr gut erhalten. – Erste Ausgabe d. deutschen Übers. – Die engl. Originalausgabe erschien 1961 [recte: 1960] u. d. T. Married to Tolstoy bei Houghton Mifflin in Boston.
Immerhin wollte ein Essener Antiquar vor wohl annähernd 25 Jährchen auch schon vierundzwanzig Westdeutschmark von mir, für dieses angeknüselte Exemplar der Ehegeschichte des Grafen mit dem ewigen Krieg zum ewigen Frieden im Gepäck.
Die Geschichte, die Lady Cynthia Mary Evelyn Asquith (1887-1960), sonst eine Verfasserin von Gespenstergeschichten, in ihrem wohl ambitioniertesten Buch erzählt, ist ja nun jüngst wieder einem größeren Publikum durch die Verfilmung von Michael Hoffman in Erinnerung gebracht worden; oder meinetwegen dem größten Teil des ohnehin schon kleinen Publikums, das sich für dergleichen überhaupt noch interessiert, erstmals zu Gemüte geführt worden. Und wenn sie in der verfilmten Version eine gewisse Aufmerksamkeit erfuhr, dann lag das vermutlich weniger an den einst so aufregenden ,Prinzipien‘ des Grafen Tolstoi, an denen sich seine Gattin aufrieb und die sie schier zur Verzweiflung trieben, als vielmehr an den mimischen Befähigungen von Helen Mirren, die die Sofia darstellen durfte. Dass Eheständigkeit bei aller ausgefransten Alleingangserziehungskunst überhaupt noch eine Gegenwart hat, von der Zukunft ganz zu schweigen, das ist doch ein kleines Wunder, nicht unbedingt von des Grafen Gnaden.
Ich frage mich, ob es ein besser dokumentiertes Beispiel für den ehelichen Zank gibt, als dieses Buch. Jeder Gatte und jede Gattin, jedes Ehepaar, das sich bis auf Blut zankt, sollte verpflichtet werden, dieses Buch zu lesen, wieder und wieder, bis ihm endlich alle Lust, zu zanken, ausgetrieben ist. Wenn man aber dieses Buch als Single liest, so wird man sich bestätigt finden, diese Hölle auch künftig in weitestem Bogen zu umgehen. „Jedem Zank folgte eine leidenschaftliche Versöhnung. Einmal meint sie danach: ,Ich könnte sterben vor Glück und vor Demut in Gegenwart eines solchen Mannes … Ich liebe ihn bis zum äußersten von ganzem Herzen.‘ Zwei Tage später klagt sie, ihr sei zumute wie ,einer Teufelin in Gegenwart eines Heiligen‘.“ (S. 48).
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 53,50 Euro geht dieses Buch in den Besitz von A. B. in Workum (Niederlande) über.
Artikel-Nr. 0002-1186
Tuesday, 12. October 2010Eugenides, Jeffrey: Die Selbstmord-Schwestern. Roman. A. d. Am. v. Mechthild Sandberg-Ciletti. Berlin: Byblos Verlag, 1993. – 210 & 2 S., 21,4 x 13,8 cm, goldgepr. OPb. m. OSchU. – Kopfschnitt etwas nachgedunkelt, sonst gut. – Erste Ausg. d. dt. Übers. – Die am. Originalausg. ersch. zuerst 1993 u. d. T. The virgin suicides bei Farrar, Straus and Giroux in New York. – ISBN: 3-929029-12-X.
Als ich das Buch kaufte, kurz nach seinem Erscheinen, häuften sich mal wieder die vorzeitigen Abdankungen in meinem allernächsten Bekanntenkreis. Es scheint, dass ich Suizidanten geradezu anziehe wie das Fliegenpapier die Stubensurrer. Schrrrr – und flapp! Bitte, ich will jetzt nicht makaber klingen, das Thema ist ja aller Ehren wert. Vielleicht ist der Selbstmord das Dessert der Endzeit-Gourmets. Zusammenhänge? Bitteschön. In einem meiner Bücher der Bücher, eins von denen, die ich nie verkaufen werde, stieß ich anno Tobak auf den Hinweis: „morgenthaler, w., letzte aufzeichnungen von selbstmördern, 1945“ (S. CCI). Solche authentischen Hinterlassenschaften zeugen doch vermutlich von ehrlicheren Einsichten in die kompromisslose Ausweglosigkeit eines Daseins, als der Roman eines Mannes, der sich nicht umbringen, sondern bloß reüssieren will als Romancier, und sei’s unter Aufbringung aller spektakulären Mittel, Mord und Totschlag, gar Selbsttotschlag, noch dazu von ganzen Geschwistergruppen. (Eugenides wird ja hierzulande als würdiger Konkurrent und früher Freund von Jonathan Franzen verkauft.)
Aber ich will nicht ungerecht sein. Ich habe das Buch kurz nach Kauf in wenigen Tagen ,verschlungen‘, wie man so sagt. Aus unerfindlichen Gründen klebte zwischen den Seiten 54 und 55 ein Post-it mit der Notiz: „Hallo Jacinta, hallo Susanne! Wir könnten uns evtl. etwas verspäten. Wartet unbedingt! Manuel + Ulla“. Wenn ich mich heute frage, warum Gijs Sierman für ihre (seine?) Umschlaggestaltung [s. Titelbild] ein Puzzle-Raster gewählt hat, muss ich gestehen: Ich weiß es nicht. Ich weiß es vielleicht nicht mehr. Eventuell hätte ich auf diese Frage eine Antwort geben können, vor Jahr und Tag, knapp nachdem ich das Buch gelesen habe. Aber immerhin hatte ich das Buch doch nicht sofort nach der Lektüre vergessen, denn als ich Jahre später den wundervollen Film Lost in Translation von Sofia Coppola sah, erinnerte ich mich sehr gut, dass diese Regisseurin mit einer Verfilmung des Eugenides-Romans debütiert hatte. (Diese Verfilmung habe ich allerdings bis heute nicht gesehen.)
Wenn ich heute, kurz vorm Abschied, das Buch willkürlich aufschlage, fällt mein blasser Blick, unschuldig wie er immer ist, auf den Satz: „Letztlich war es nicht der Tod, den sie überraschend fand, sondern die Hartnäckigkeit des Lebens.“ – Yeah, mijnheer, das finde ich ebenso.
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 25,35 Euro geht dieses Buch in den Besitz von R. H. in Düsseldorf über.
Ausverkauf en détail
Tuesday, 12. October 2010Probehalber habe ich mal ein Stück aus meiner Bibliothek nahezu an mich selbst verkauft, um für das künftige Prozedere dieser neuen Selbstdarstellungsweise einen verbindlichen Rahmen zu konstituieren.
Der Kunde resp. Käufer erhält neben dem Buch eine Musterrechnung und auf deren Rückseite ein Musterzertifikat zu seinem erworbenen Unikat aus der streng limitierten Auflagenarbeit Bibliothek des Revierflaneurs.
Gleichzeitig erscheint zum Abschied hier ein Artikel über das veräußerte Buch – mit einer präzisen bibliographisch-antiquarischen Beschreibung, einer kurzen Erklärung, wie und warum es in meinen Besitz gelangte, einer grundsätzlichen Bewertung des betreffenden Werks bzw. seines Autors aus meiner heutigen Sicht, einer sehr persönlichen Liebeserklärung an das spezielle Buch und einem Abgesang in Heller und Pfennig.
Die Preise, zu denen ich meine Unikate im Rahmen dieser Auflagenarbeit feilbiete, sind freibleibend. Interessanterweise spiegelt ja die Reihenfolge des Abverkaufs, der Stück für Stück in meinem Weblog unter der Rubrik Ausverkauf nachvollziehbar ist (und bleibt), einen allgemeinen Trend, die gegenwärtige Mode unter hiesigen Lesern (oder immerhin Käufern), das populäre und aktuellste Interesse wider. Der auf diese Weise ausgefilterte Bodensatz wird aber, je konzentrierter desto kurioser, in seinem Verkaufswert steigen, denn die Erwerber der letzten verbleibenden Stücke sind die eigentlichen Helden dieses nicht auf Durchschnittlichkeit, sondern aufs Extreme zielenden Kommerzexperiments. Dies wird sich gewiss auch in der Kuriosität der Abschiedsgrüße an die letzten Bücher widerspiegeln. Somit ist nicht nur jedes der auf diesem Weg und auf diese Weise veräußerten Bücher ein Pinselstrich zu meinem intellektuellen Selbstporträt und zugleich ein Dokument unserer Kultur in dieser Zeit; sondern es ist auch die von mir nur mittelbar und begrenzt beeinflusste Reihenfolge, in der die Perlen meiner Bibliophilie hier von der Schnur gezogen werden, die uns ein markantes Zeugnis unserer gegenwärtigen Denkungsart, unserer Vorlieben und Abneigungen ausstellt. Zukünftig wird man jedenfalls sagen können: Je höher die Abverkaufsnummer, desto exquisiter, abgedrehter, freakiger der Geschmack des spät berufenen Erwerbers. (Oder, für Blöde: Je später die Buchkäufe, desto höher die Preise!)
Mit Beginn dieser Internet-Verscherbelung einer Bibliothek, die als Ganze ein unersetzliches Kunstwerk ist, sind genau 1.475 Bücher lieferbar. Die komplette Verkaufsedition ist vorweg auf 3.333 Bücher limitiert. Sie soll – abzüglich der bis dahin veräußerten Bücher – bis spätestens zum 31. Dezember 2011 verfügbar sein.
Artikel-Nr. 0001-1535
Tuesday, 12. October 2010Valentin, Karl: Sturzflüge im Zuschauerraum. Der gesammelten Werke anderer Teil. Hrsg. v. Michael Schulte. M. e. Vorw. v. Kurt Horwitz. München: R. Piper Verlag, 1969. – 308 & 3 S. & 17 unpag. Kunstdruck-Taf. m. 22 Abb., 20,4 x 12,2 cm, OLw. m. montierten Leinenrücken- u. -deckelschildern, Fadenheftung. – Ohne den OSchU., Einband etwas angestaubt, an den Gelenken minimal eingerissen, eine Ecke bestoßen, Schnitt angestaubt, Bleistiftwidmung auf Vorsatz, leicht muffig, insgesamt noch gut. – Erstausgabe dieser Zusammenstellung.
Die Anschaffung dieses Buches fällt wohl in die Zeit, als ich Karl Valentins filmisches Werk mittels VHS-Videocassetten ,aufarbeitete‘. Das dürfte so Anfang der 1980er-Jahre gewesen sein. Was mich damals in Bann schlug, war die Totalität seines Gesamtwerks als eine alle Lebensbereiche durchdringende Besessenheit. Er war ja nicht bloß Schriftsteller, Komiker, Sänger, Musiker, Tänzer, Pantomime, Kostümschneider, Maskenbildner, Schauspieler, Stimmenimitator, Kunstraucher, Hanswurst, Dadaist, Surrealist usw., sondern auch noch Filmregisseur, Hörspieldramaturg, Requisiteur, Photograph, Sportler, Akrobat, Chef & Geliebter (von Liesl Karlstadt), Tierzüchter, Dompteur, Dressurreiter und nicht zuletzt Museumseinrichter. Sein legendäres Karl-Valentin-Museum verfolgte mich als Phantom einer optimalen Antibürgerwohnung. Es in der Realität anzuschauen – denn es gibt ja wohl eine Touristenattraktion dieses Namens in München –, das kam für mich gar nicht in Betracht; erstens, weil ich meine phantastische Imagination um keinen Preis mit der sicher ernüchternden Realität konfrontieren wollte, und zweitens, weil ich ohnehin nicht reise. Aber ich baute mir desto lieber in meinem Souterrain in der Frankenstraße 215 mein eigenes Kuriositätenkabinett zusammen, das zugleich zur Bühne meiner Literarischen Soireen XXIX bis CIV (1. November 1991 bis zum 1. August 2008) werden sollte. Zuvor aber benamste ich meinen zweiten Sohn nach ,Karl dem Großen‘.
Irritierend bis heute erscheint mir an Valentin zweierlei. Erstens, dass er es vermochte, eine dermaßen avancierte, geradezu avantgardistische Komik unbemerkt ganz nah ans ,gemeine Volk‘ heranzuschmuggeln. Und zweitens, dass ein Mann von dieser Herzensgüte – denn wie soll man ohne Herzensgüte ein erfolgreicher Humorist sein? – dermaßen herzlos mit seinen engsten Mitmenschen, hier: besagter Liesl Karlstadt umgehen konnte.
Das anlässlich dieses Abschieds von einem schönen Buch besonders zu würdigende Detail ist rein äußerlich, die beiden auf Deckel und Rücken montierten Papieretiketten, vorn die ineinander verschlungenen Initialen [s. Titelbild]. Dabei fällt mir auf, dass K ja nun nicht nur der erste Buchstabe von Karl, sondern auch von Karlstadt ist. Aber wir wollen die Buchstabenmystik nicht zu weit treiben: Liesl hieß mit bürgerlichem Namen Elisabeth Wellano.
Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 26,35 Euro geht dieses Buch in den Besitz von Valentin Hessling über. [In diesem Fall wurde der Rechnungsbetrag bereits beglichen von Ursula Heßling anlässlich des heutigen, 25. Geburtstags unseres Sohnes.]
Abschied von meiner Bibliothek
Saturday, 09. October 2010Mit vierzehn Jahren kaufte ich von meinem Taschengeld, drei D-Mark wöchentlich, meine ersten eigenen Bücher. In der Buchhandlung Neher im Eckhaus Rüttenscheider Straße 75 in Essen, drei Minuten von der elterlichen Wohnung im Süthers Garten entfernt, kosteten die billigsten Taschenbücher von rororo, dtv oder aus der Fischer-Bücherei damals 2,80 DM. Bis dahin hatte sich die Leseratte, die ich immer schon war, aus den objektiv überschaubaren, subjektiv als unerschöpflich empfundenen Beständen der Stadtbibliotheks-Filiale im Rüttenscheider Sparkassenhaus versorgt, zu der man über einen Aufzug und durch lange, merkwürdig riechende Flure gelangte: ,Vorsicht, nicht stürzen! Heute frisch gebohnert!‘ Ich lieh gern aus, aber die Rückgabe nach vier Wochen war häufig mit Wehmut verbunden, nämlich immer dann, wenn ich mich in einem Buch verloren hatte. Dann riss ich mir vor der Theke, hinter der eine distinguiert-vertrocknete Bibliothekarin hockte, ein Stück meiner selbst aus der Seele. Für eine halbe Ewigkeit, denn damals waren ja ein paar Monate schon eine sehr lange Zeit, keimte in mir das unstillbare Verlangen, irgendwann einmal selbst viele Bücher zu besitzen. Wieviele Bücher? Jedenfalls genug. Was wäre denn aber jemals wohl genug? Das würde sich wohl einstmals erweisen. So legte ich in zunächst bescheidenen wöchentlichen Taschenbucherwerbungen den Grundstock zu meiner hoffentlich irgendwann einmal unübertrefflich großen, vor allem aber unfassbar inhaltsreichen Bibliothek.
Die Bücher, die ich las, verdrehten mir den Kopf, machten mich rebellisch, ließen mich an der Schulweisheit zweifeln und bald auch an der Schule selbst verzweifeln, warfen mich aus der Bahn und hätten zweifellos im Handumdrehen eine gescheiterte Existenz aus mir werden lassen, wenn eben diese scheinbar so schädlichen Bücher mich nicht zugleich doch auch mit einer gewissen Belesenheit ausgestattet hätten, die mir in einem eher zufällig zustande gekommenen Bewerbungsgespräch in der größten Buchhandlung am Platze trotz fehlender Abschlusszeugnisse das Wohlwollen des Geschäftsführers verschaffte, damit einen Ausbildungsplatz und in den folgenden siebzehn Jahren eine Karriere als Buchhändler, die mich in die glückliche Lage versetzte, meine private Bibliothek zu erweitern, in einem Maße, was die Menge betrifft, und in einer Weise, was die Qualität angeht, wie ich’s mir zuvor niemals hätte träumen lassen. Damit wir uns recht verstehen: Ich habe mir in diesen langen Jahren meiner buchhändlerischen Tätigkeit niemals auch nur ein einziges Reclamheft widerrechtlich angeeignet. Wohl aber habe ich alle Vorteile genutzt, die sich mir so nah an der Quelle boten: vom Kollegenrabatt über die Leseexemplare bis hin zu der rechtzeitigen Information über interessante Neuerscheinungen. Aber der Sinn stand mir nicht allein nach den jeweils aktuellsten Provokationen, sondern ich versorgte mich auch auf Flohmärkten und aus Antiquariaten mit verschollenen Kuriositäten vergangener Widerständigkeit. Und während ich nebenher an meinem eigenen ,Meisterstück‘ arbeitete, dem vieltausendseitigen Buch Zufall (unveröffentlicht), metastasierte mir unter der Hand eine wildwüchsige ,Zufallsbibliothek‘ zum Monstrum.
Damit ich’s nicht vergesse! Neben diesem Leben als Bücheran- und -verkäufer (sowie nebenbei natürlich auch Bücherleser) lebte ich noch das frisch fromm fröhlich freie Leben eines unpapierenen Liebhabers, Ehemanns und Kindsvaters, als hungriger, durstiger, politischer, ästhetischer, friedliebender, kampflustiger, ängstlicher, kranker, trotzköpfiger, zweifelnder, verbitterter, großmäuliger, unmäßiger, süchtiger, handzahmer, waidwunder, vergesslicher, wetterwendischer, sturer, nachtragender, kompromissloser, anbiedernder, gnadenloser, katzbuckelnder, hochfahrender, widersprüchlicher, konsequenter Durchschnittstrottel der extraordinären Art. Dieses mit sich selbst identische Doppelleben wäre umsonst gelebt, hätte es nicht seinen Eindruck geschunden und würde es nicht seinen Ausdruck finden: in eben meiner unvergesslich individuellen Bibliothek. Jede Anschaffung war ja das Testament einer überschäumenden, orgasmischen Erkenntnis-Euphorie: Das ist es! Und wie ich diesen ständig wachsenden Fundus durch all die Jahre mit mir geschleppt habe, vom Süthers Garten in die Friederikenstraße, von hier in die Steinhausenstraße, von dort in die Giesebrechtstraße, von hier in die Carmerstraße (Geburt zweier Kinder), von dort in die Huffmannstraße (Geburt eines Kindes), von hier in die Trappenbergstraße (Geburt zweier Kinder), von dort in die Frankenstraße, von hier in die Messelstraße und von dort zuletzt hierher in die Oberstraße – das ist eine nahezu unglaubliche, jedenfalls heroische Geschichte, die zu erzählen mir aber meine angeborene Bescheidenheit zumindest an dieser exponierten Stelle verbietet. Und nun? Jetzt stehen all diese abertausend Bücher halbwegs sicher in einer Halle nahebei und werden Stück für Stück erfasst, wie die Rekruten vor der Schlacht. Kanonenfutter! Ich habe mich entschlossen, mich von jedem einzelnen von ihnen zu trennen. Was dereinst so hochfahrend aufgebaut wurde, muss nun peu à peu wieder abgetragen werden. Aber kommentarlos? Doch weißgottnicht! An den Kommentaren soll es nicht hapern.
Und wie? Dieser Bücherberg verdient es doch wohl, ebenso liebevoll und bedächtig abgetragen zu werden, wie er einst aufgeschichtet wurde, oder? Mein letzter Umzug war nicht nur für mich persönlich, sondern erst recht für meine Bibliothek eine Beinahe-Katastrophe, ein traumatisches Desaster erster Ordnung. Was ich aus der Garage in der Frankenstraße noch mit knapper Not in den Keller in der Messelstraße hinübergerettet hatte, das fand nun in der jetzigen Wohnung überhaupt keinen Platz mehr. In einhundertdreiundfünfzig Kartons verpackt, schwebte der größte Teil meiner erlesenen, mit unsäglicher Mühe aus tausendundeinem Zufallsglück zusammengetragenen Büchersammlung über einem Abgrund aus Verschimmeln, Vermodern und Vergessen. Wohin damit? Unsere neue Wohnung hatte bloß wenige Zimmer, noch weniger fensterlose Wände, tiefe Decken. Wohin mit meinen seitenreichen Schätzchen? Tageweise befiel mich Panik. Da konnte ich fünfzig Kisten in Rolf Rexhausens Konsumanstalt an der Theodorstraße zwischenlagern. Für weitere knapp vermessene vierzig Kisten wurde mir die befristete Unterbringung im Venusweg avisiert. So verlockend der Straßenname sein mochte, so finster bleckte doch die Perspektive mit den fauligen Zähnen, dass meine lieben Bücher dort in unerreichbare Ferne verrückt sein würden! – Trübselig saß ich mit unserer Hündin Lola an einem nasskalten Septembermorgen auf einer der beiden Bänke paar Meter neben unserer neuen Wohnung auf der Hundekackwiese, als mein Minuten später entzückter Blick auf den Garagentoren vis-à-vis zu ruhen begann, wo ein Zettelchen meine erwachende Aufmerksamkeit fesselte. Was war denn das? Ein glückliches Geschick! – Dort hinten sind sie nun untergebracht, meine ungeschätzten, unschätzbaren Lieblinge, tausendundeine Köstlichkeit, geschöpft mit bittrer Zunge aus dem Sumpf des Niedergangs, der Vermoderung, dem ewigen Vergessen entrungen. Ist denn nicht der Titel ,muffig‘ ein Ehrenzeichen, Siegel vielmehr der Unvergänglichkeit? Otto hieß, glaube ich, der Suhrkamp-Vertreter, der dem Staub nachsagte, das beste Konservierungsmittel für Bücher zu sein.
Tausendfünfhundert meiner vielfach liebkosten Bücher habe ich mittlerweile sorgfältig eingetragen in meine persönliche Liste bei ZVAB. Das ist nur ein Bruchteil, aber immerhin schon einmal ein Anfang. Achtundvierzig Bücher habe ich auf diesem Wege vom 9. Mai bis zum 7. Oktober dieses Jahres verkauft, für 1.221,50 Euro. Ich weiß nicht, ob das mehr oder weniger Geld ist, als ich zum Erwerb dieser Bücher einmal, einstens, ehedem eingesetzt habe. Das ist mir auch etwas gleichgültig, nicht wenig, nicht viel, kaum einerlei, mehrenteils wurscht, überdies schnuppe! Doch so kann es ja nicht weitergehen, kaum mit meinen armen Büchern, erst recht nicht mit mir, der ich doch ein Könner bin. Was ich kann, das ist: Bücher erkennen. Bücher finden, Bücher lesen, Bücher bewerten und schließlich auch Bücher verkaufen, denen ich meinen Stempel aufgedrückt habe – und denen ich künftig mein Urteil mit auf den Weg geben werde. – Und das wird diese Bücher adeln in einem Maß, das seinesgleichen suchen wird. (Auf den Weg? Ja, auf welchen Weg denn? Selbst diese Frage zu beantworten wird kostbarer sein, als den Weg zu beschreiten.) Und darum habe ich mich heute entschlossen, meinen Büchern künftig einen Abschiedsgruß mit auf den Weg zu geben, sowohl ganz materiell in Gestalt eines Zertifikats in der jeweiligen Büchersendung an den zahlenden Käufer, als auch virtuell, parallel als Artikel in meinem Weblog. Da wird die Rede sein von den Umständen und Zusammenhängen des Bucherwerbs, von den Erfahrungen meiner Lese, von Hinter- und Vordergründen, von Assoziationen und Dissoziationen, von Crash und Crux. Die leere Gemengelage des Ver- und Missverstehens wird hier, auf diesen Fundamenten, Höhen, Tiefen und Zwischensphären ihr Stelldichein feiern mit der Hohlheit des Understatements. So mag der Ausverkauf des vom Munde meiner Kinder bitter abgesparten Geistesschatzes doch noch die eine oder andre Süßigkeit zu ihrem Troste abmelken. – Sei’s drum; koste es, was es wolle!
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (XVII & Schluss)
Saturday, 28. August 2010Ursprünglich hatte ich geplant, hier noch ein paar Bemerkungen über die losen ,Fundstücke‘ in alten Büchern zu machen, die man in Trödelkisten literaturferner Ramscher und in Kellerregalen oder Koffern auf Speichern verstorbener Onkel und Tanten findet: Notizzettel, Kalenderblätter, Fahrkarten, Fotos, Kinobilletts, Glanzbilder, Ansichts- und Visitenkarten, Briefe, Werbezettel und vielerlei mehr [s. Titelbild]. Meist sind diese papierenen Einleger wohl als Lesezeichen verwendet worden. Dann ist es interessant festzuhalten, zwischen welchen beiden Seiten genau man sie gefunden hat, denn das könnte Auskunft geben über einen Schwachpunkt des Buches, an dem beim früheren Leser das Interesse erlahmte. Vielleicht ist er ja aber auch über der Lektüre plötzlich verstorben? Doch auch das könnte schließlich ,literarische Gründe‘ gehabt haben, wer weiß … Diese waghalsige Spekulation lässt vielleicht ahnen, welche exotische Landschaft sich der Phantasie bei diesem Thema darbietet. Ich verkneife mir das Thema dennoch auf ein anderes Mal, denn eigentlich gehört solches Treibgut ja nicht wesentlich, sondern bloß zufällig zum Buch. Der Antiquar wird ein Fundstück nur dann im Buch belassen, wenn ein inhaltlicher Zusammenhang zu seiner vorübergehenden Unterkunft feststellbar ist, beispielsweise wenn es sich um eine Rezension des Buches handelt oder gar um einen Brief des Autors an den Leser. In allen anderen Fällen gehört es in den Papierkorb – oder in eine Kuriositätensammlung von der Art, wie ich sie tatsächlich seit langer Zeit zusammengetragen habe [s. die willkürlich zusammengestellten Kostproben im Titelbild].
Hier bleibt mir nur, zum Abschluss noch eine grundsätzliche Bemerkung über die Buchbeschreibung als warenkundliche Facharbeit des Altbuchhändlers loszuwerden.
Das Buch ist, wenn ich nicht sehr irre, das am höchsten diversifizierte Industrieprodukt der Warenwelt. So viele verschiedene Artikel, wie es von dieser Ware gibt, kann kein anderes Handelsgut auch nur annähernd vorweisen.
An dieser Stelle mache ich erst mal einen Absatz und atme tief durch, denn es lohnt sich vielleicht für den Leser, über diese möglicherweise gewagte Behauptung gründlich nachzudenken. – Gibt es nicht vielleicht doch ein serienmäßig hergestelltes Produkt, dessen Vielfalt in seiner Diversifikation das Buch in den Schatten stellt? Kleidungsstücke als Gattung würden mir am ehesten noch einfallen; oder vielleicht auch Nahrungs- und Arzneimittel? Hierbei fällt es aber doch schwer, um bei letztgenannten zu bleiben, eine Charge von der anderen zu unterscheiden, während die Unterschiede verschiedener Buchauflagen durchaus sinnfällig hervortreten können. Wesentlicher ist aber noch ein anderer Unterschied: Pharmazeutika und Lebensmittel sind Verbrauchsgüter mit einer mehr oder weniger kurzen Verfallsdauer. Und selbst Textilien nutzen sich ab, fallen den Motten zum Fraß, kommen aus der Mode und wandern spätestens nach ein paar Jahrzehnten in die Kleidersammlung und zuletzt in den Reißwolf. Barbaren, die Bücher in Altpapiercontainer werfen, sieht man in hiesigen Breiten hingegen eher selten.
Was folgt daraus? Die Zahl verschiedener Bücher auf Erden vermehrt sich ständig, denn auch die vor vielen Jahrzehnten erschienenen sind fast ausnahmslos noch existent, wenn nicht in allen einzelnen Exemplaren – dafür hat in Europa allein schon der Zweite Weltkrieg mit seinen Städtebombardements gesorgt –, so doch in etlichen Einzelstücken. Je größer die Auflage war, umso höher ist in aller Regel die Zahl der ,Überlebenden‘. Und je betagter diese Bücher sind, desto mehr unterscheiden sie sich voneinander, obwohl sie doch beim Verlassen der Buchfabrik einander ähnelten wie ein Ei dem anderen. Somit individualisiert die Zeit nun auch noch die einzelnen Exemplare ein und derselben Auflage, nämlich durch genau jene Spuren, die ich in den Folgen XI bis XVI dieses Kleinen Einmaleins der Buchbeschreibung aufgezählt habe. Vielleicht ist es insofern nicht zu gewagt zu sagen: Kein serienmäßig hergestelltes Ding auf dieser Welt verdient so sehr wie das Buch die Liebe und die Achtung des menschlichen Individuums, weil kein anderes ihm in seiner Einzigartigkeit so sehr entspricht.
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (XVI)
Thursday, 26. August 2010Sehr verbreitet ist das freihändige Unterstreichen oder Anmarkern einzelner Worte, das Markieren von Textzeilen, ja ganzer Absätze, das Anstreichen längerer Passagen am Rand und das Niederschreiben kurzer oder auch längerer Marginalien auf dem Außensteg oder als ,Fußnoten‘ auf dem Fußsteg. Verwendet werden hierzu weiche oder harte Bleistifte, Kopier- und Buntstifte in allen Farben, Kugelschreiber, Federhalter, Tintenfüller, in neuerer Zeit auch Textmarker in allen möglichen und unmöglichen Farben, vorzugsweise in floureszierenden oder gar phosphoreszierenden Gelb- oder Grüntönen.
Meist sind solche Hinterlassenschaften eifriger Leser nicht oder nur mit einem Aufwand zu beseitigen, den der Wert selbst des lupenrein sauberen Buches nicht rechtfertigt. Und doch kann ich nicht leugnen, dass mich gelegentlich die individuellen, manuellen Hinzufügungen in Büchern mehr beschäftigen und bewegen als der ,neutrale‘ Inhalt der Bücher selbst, werfen erstere doch eine Reihe von Fragen auf, die nicht bloß detektivisch veranlagten Sammlern manch reizvolle Stunde des Grübelns und Spekulierens bescheren können.
Was mögen das etwa für Menschen sein, denen es offenbar ein unabweisliches Bedürfnis ist, alle paar Seiten ihrer heftigen Zustimmung oder auch ebenso heftigen Ablehnung expressiven Ausdruck zu verleihen, indem sie den Blattrand mit Ausruf- oder Fragezeichen garnieren? Von solchen wohl meist cholerisch veranlagten Lesern findet man dort eine reiche Vielfalt stakkatohafter Kurzkommentare dieser Art: ,Ach was!‘ – ,So, so.‘ – ,Wiedenn-wodenn-wasdenn?‘ – ,Seit wann?‘ – ,Unsinn?‘ – ,Hört, hört …‘ – ,Olala!‘ – ,Nett gesagt.‘ – ,Sehr wahr!‘ – ,Damals schon?‘ – ,Prüfen!‘ – ,Siehe oben S. 80.‘ – ‚Äußerst fragwürdig.‘ – ,Überholt.‘ – ,Pfui!‘ – ,Schön wär’s ja!‘ – ,Autor wiederholt sich.‘ – ,Etc. pp.‘ – ,Kommt mir bekannt vor.‘ – ,Quelle?‘ – ,Bravo!‘ – ,Oha!‘ – ,Ich glaub’s nicht!‘ – ,Wenn das so einfach wär …‘ – ,Muss wohl heißen: Pessimismus! – ,Heute kaum noch. (s. EU!)‘ – ,Rechenfehler?‘ – ,Empörend!‘ – ,Lachhaft!!‘ – ,Falsch!!!‘ usw. (Alle Beispiele aus einem vom unbekannten Vorbesitzer kraftvoll annotierten Exemplar der Memoiren eines prominenten deutschen Nachkriegspolitikers.) Solche Leser erwarten offenbar von der Lektüre keineswegs neue Einsichten, gar die Korrektur eigener Vorurteile. Sie wissen längst schon, was falsch ist und was wahr. Und so lesen sie Bücher allein deshalb, um ihre unumstößlichen Wahrheiten bestätigt zu sehen, ganz gleich, oder der Autor mit ihnen einer Meinung ist (dann applaudieren sie ihm), oder ob er das Gegenteil behauptet (dann pfeifen sie ihn aus).
Gänzlich andere Motive muss man jenen fleißigen Stricheziehern unterstellen, die mit ihren diversen Stiften zwischen den Zeilen unterwegs sind, um das eigentlich Wesentliche eines Textes (genauer: das, was sie dafür halten) aus dem vielen Unwesentlichen (genauer: aus dem, was sie dafür halten) herauszuschälen und für alle Zeiten blitzschnell verfügbar zu machen. Für diese leicht ungeduldige Sorte Leser zählen vor allem die konkreten Ergebnisse ihrer Bemühungen. Sie stellen gern Fragen wie: ,Und was heißt das jetzt unterm Strich?‘ – ,Aber was folgt für mich ganz konkret daraus?‘ – ,Lässt sich das auch in einem einfachen Satz auf den Punkt bringen?‘ Für solche Menschen wurden vermutlich einst die Zehn Gebote des alttestamentlichen Dekalogs ersonnen. Die Folgen sind bekannt! Als ,terrible simplificateur‘ hat zuerst Jacob Burckhardt diesen gefährlichen Typus bezeichnet, der danach trachtet, alle Weisheit dieser Welt an seinen plumpen Fingern abzählen zu können und ganze Bibliotheken zu einer Handvoll Thesen einzudampfen.
Rührend wird aber selbst dieser Thesen- und Parolenschmied gelegentlich; wenn er nämlich die Kontrolle über seinen Stift verliert und ganze Absätze, ja seitenweise jede Zeile unterstreicht. Dann führt er sein Vorhaben unwillkürlich selbst ad absurdum, denn abwegig ist es ja von vornherein insofern, als ein Buch nun einmal genau den Umfang hat, den es hat. So ist es hinzunehmen, so ist es zu belassen, da gibt es nichts hinzuzutun oder wegzunehmen. Und auch zu streichen oder hervorzuheben ist da nichts. Wenn man schon partout einen Extrakt aus einem Buch für sich persönlich ziehen will, dann tue man dies doch in einem separaten Heft und verunziere nicht das feine Buch mit seinen ungehobelten Einfällen [s. Titelbild].
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (XV)
Wednesday, 25. August 2010Eine solche Aufwertung des einzelnen Buchexemplars durch seine erwiesene edle Herkunft begegnet uns nicht nur in Gestalt des prominenten Besitzvermerks, sondern weit häufiger als Widmung des Autors an den Leser. ,Doppelt getrüffelt‘ ist ein gewidmetes Buch natürlich dann zu nennen, wenn auch der namentlich genannte Empfänger und also Vorbesitzer des Buches eine prominente Person ist. (Ganz nebenbei: Mir ist der Bekanntheitsgrad eines Zeitgenossen, ganz gleich durch welche medialen Sensationen er erreicht sein mag, schnurzpiepegal. Ich bitte darum, die Erläuterung solcher wertsteigernden Effekte auf dem Antiquariatsmarkt nicht dahingehend misszuverstehen, dass etwa meine persönliche Wertschätzung eines konkreten Buches auch nur im geringsten von solchen Autographen beeinflussbar sei. Auch hier kommt es mir zuallererst auf den Inhalt an.)
Heutzutage in den Zeiten der Lesereise, auf die die armen Bücherschreiber von ihren Verlegern gehetzt werden, damit sie bloß nicht so bald dazu kommen, ein neues Buch zu schreiben; in diesen traurigen Zeiten also wird der Antiquariatsmarkt geradezu überschwemmt von signierten Büchern. Ein tschechischer Autor steht bei mir im Verdacht, auf den Vorsatz jedes einzelnen Exemplares eines seiner Bücher schwungvoll mit violettem Filzstift seinen Namen hingeschneit zu haben. Da wäre dann ausnahmsweise ein unsigniertes Exemplar das rarere und folglich teurere!
Meist bleibt als Ergebnis solcher Signierstunden, nach erschöpfender Lesung und nach der sich anschließenden nicht minder strapaziösen Fragestunde, kaum mehr als ein unleserliches Autogramm in ein paar Dutzend Büchern. Was soll das? Aber manche der in langer Schlange Anstehenden sind sich nicht zu schade, beim Poeten am Signierfließband um eine spezielle Zueignung nachzusuchen: „Herr G., könnten Sie vielleicht bitte schreiben: ,Für die hagere Inge diesen dicken Butt, Ihr G. G.‘? Was tut man nicht alles für die treuen Fans!
Viel interessanter sind da oft die Widmungen der unbekannten Schenker an nicht minder unbekannte Empfänger, zum Geburtstag, zur Eheschließung, zur Scheidung, nach bestandener Prüfung oder zu sonst einem bedeutsamen Anlass – den man manchmal nur indirekt erschließen kann.
Das oben [s. Titelbild] reproduzierte Beispiel fand ich auf dem Vorsatzblatt der zweiten Auflage von Sven Hedins Amerika im Kampf der Kontinente (Leipzig: F. A. Brockhaus, 1943). Da heute nicht mehr jeder Leser Sütterlinschrift fließend entziffern kann, hier meine Transkription: „Herrn Kamerade [!] Berghaus | mit herzlichen Wünschen für | sein Wohlergehen und für | eine gesunde Heimkehr gewidmet | von den Berufskameradinnen | und Berufskameraden in | der Heimat. | Dessau, Weihnachten 1943.“ Das Buch liegt vor mir wie neu und ungelesen. Ob es den besagten Kameraden Berghaus an der Front überhaupt noch erreicht hat? War er vielleicht in einem der U-Boote im Atlantik im Kampfeinsatz gegen alliierte Kriegs- und Handelsschiffe? Und bedurfte er dort vielleicht der moralischen Stärkung durch dieses amerikakritische Buch? Solche anonymen Widmungen, die immerhin Fragen aufwerfen und zum Nachdenken anregen, finde ich jedenfalls wesentlich reizvoller als die Auftragssentenzen von Bestsellerromanciers auf Erfolgstournee.
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (XIV)
Tuesday, 24. August 2010Nun also zu den ganz bewussten Kennzeichnungen, die die Eigentümer oder Nutzer von Büchern an oder in diesen auf unterschiedliche Weise vornehmen.
Früher war es im europäischen Bürgertum ein weit verbreiteter Usus, die Bücher der privaten Bibliothek mit einem persönlichen Exlibris zu versehen, also mit grafisch gestalteten Einklebzetteln, deren Motiv oft einen Bezug zum Namen, zum Beruf, zu den Vorlieben oder Leidenschaften oder auch zu Charaktereigenschaften des Bücherfreundes hatten. Solche manchmal sehr geschmackvollen Klebebildchen können das Buch im günstigsten Fall sogar aufwerten. Dies gilt natürlich erst recht, wenn das Exlibris von einem bedeutenden Künstler wie Frans Masereel entworfen wurde [s. Titelbild]. Manchmal ziert das Exlibris den Innendeckel, manchmal den Vorsatz, gelegentlich findet man es auch auf dem Frontispiz gegenüber der Titelseite, wenn dieses frei ist. Der Niedergang der stilvollen Klebebilder begann spätestens mit der Verbreitung von anonymen Exlibris-Zetteln als Dutzendware, bei denen der Name auf gepunkteter Linie von Hand eingetragen werden musste. So wurde aus einer noblen Sitte im Handumdrehen eine schnöde Unsitte, die aber erfreulicherweise bald wieder verschwand. Da kann man seinen Namen ja gleich ins Buch schreiben, was soll das doch jedenfalls beliebige und beziehungslose Bildchen dabei?
Und schon sind wir beim handschriftlichen Besitzvermerk, der mit dem Exlibris immerhin noch das Motiv gemeinsam hat, nämlich das Buch vor Diebstahl, Verlust durch Verwechslung – oder durch die Vergesslichkeit (,Vergesslichkeit‘?) der Mitmenschen zu schützen. Denn bekanntlich haben Bücherleiher ja neben anderen Schwächen die Angewohnheit, die Rückgabe zum vereinbarten Termin zu verpassen. Leiher und Verleiher verlieren sich aus den Augen, und erst Jahre später, etwa bei einem Umzug, fallen ersteren dann die fremden Bücher wieder in die Hände. Oft erinnern sie sich nicht mehr, von wem sie sie geborgt hatten. In diesen und ähnlichen Fällen ist es für alle Beteiligten erfreulich, wenn Bücher einen Besitzvermerk tragen. Wo dieser im Buch angebracht wird, ist Geschmacksache. So findet man Namenszüge oder Stempel im vorderen oder hinteren Innendeckel, auf dem Vorsatzblatt und auf dem Schmutztiel. Keinesfalls darf man jedoch die Titelseite hiermit verunstalten – eigentlich müsste man sogar sagen: beschädigen! (Vgl. hierzu meine Ausführungen über die Bedeutung der Titelseite.)
Ob man es nun beim Eintrag von Vor- und Familiennamen belässt, ob man die vollständige Anschrift hinzusetzt (die sich freilich von Zeit zu Zeit ändern kann), ob man das Datum der Anschaffung vermerkt, den Ort des Erwerbs, den Namen der Buchhandlung bzw. des Antiquars oder gar, so es sich um ein Buchgeschenk handelte, den Namen des Schenkers, das bleibt jedem Sammler selbst überlassen. Verwendet man einen Tintenfüller oder gar Kugelschreiber, so ist die Eintragung nur schwer und jedenfalls kaum spurlos zu entfernen, was für das Buch in aller Regel eine Wertminderung auf dem Antiquariatsmarkt bedeutet. Andererseits sind radierfähige Besitzvermerke, etwa mit weichem Bleistift, kein wirksamer Schutz gegen Diebstahl oder Unterschlagung.
Ganz selten geschieht es, dass dem Stöberer auf dem Bücherflohmarkt ein Buch in die Hände fällt, das durch den Besitzvermerk als verschollenes Erbe eines ganz Großen identifizierbar ist. Entdeckte ich zum Beispiel die Erstausgabe von Theodor Lessings Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen mit dem datierten Namenszug von Franz Kafka auf dem Vorsatz, würde mein Sammlerherz einen Sprung von hier bis nach Hannover machen.
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (XIII)
Sunday, 22. August 2010Naturgemäß betreffen echte Beschädigungen zuallererst den Bucheinband, dann erst das ,Innenleben‘, den papierenen Buchblock mit dem geistigen Inhalt des körperlichen Objekts. Schließlich dient ja der Einband dem Schutz dieses Wesenskerns. Wenn er Angriffe aller Art abwehrt und dabei selbst oberflächlichen oder auch tiefer gehenden Schaden nimmt, so ist dies nicht mehr als seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, so möchte man meinen.
Andererseits gilt manchen Bücherfetischisten ein makelloser, unversehrter Einband als der schönste Schmuck des Buches. Genau besehen nehmen solche Leute aber doch eine reine Äußerlichkeit für das Eigentliche, die Kleidung und Maskerade für das nackte Wesen, für das sie gemacht sind. Spätestens an dieser Entgleisung wird deutlich, dass Bücherliebhaber nicht unbedingt auch Leser sein müssen, et vice versa. Ich kannte einen Sammler, der mir stolz ein wunderbar gebundenes Exemplar von Boccaccios Decamerone unter die Nase hielt, das er vor vielen Jahren bei einem Antiquar in Palermo erstanden hatte: Ganzleder, goldgeprägte Titel auf Rücken und Deckel, echte Bünde, dies alles in tadelloser Erhaltung. Bei genauerer Untersuchung dieses Schmuckstücks erwies es sich allerdings als Blindband, enthielt es doch nur lauter unbedruckte Seiten. Ich brachte es nicht übers Herz, ihn auf dieses kleine Defizit hinzuweisen, und beließ ihn in seinem Glauben, einen Schatz in seiner Sammlung zu bergen.
Einbände können Flecken aller Art aufweisen. Sie können einreißen, was ihnen bei Pappeinbänden besonders häufig an den viel strapazierten Gelenken widerfährt. Aber auch Leinenbände neigen dort zu Verschleiß. Sie können Stauchungen erleiden, vorzugsweise am Kapital oder an der Basis des Rückens. Auch die Ecken sind oft gestaucht oder gar umgeknickt. Der Buchblock reißt vielfach an den Innengelenken aus dem Einband, einzelne Lagen oder Seiten können sich lösen, wozu besonders die vorderen und hinteren Partien des Buches neigen. Schließlich ist der Schnitt rundum anfällig gegen Beschädigungen durch spitze, scharfe, harte und schwere Gegenstände oder durch Stürze von hohen Regalbrettern, wodurch Seiten zudem knickspurig werden oder einreißen können.
Eine besondere Erwähnung verdienen an dieser Stelle die Buchumschläge, die ja insofern eine schon beinahe dekadente Übertreibung bedeuten, als sie zum „Schutz des Schutzes“ dienen, indem sie nämlich den schützenden Einband ihrerseits einhüllen und die oberflächlichsten Abnutzungen von diesem fernhalten sollen. Schutzumschläge sind daher folgerichtig die ersten Opfer von Beschädigungen. Sie ziehen Flecken förmlich an, bleichen aus, reißen ein und werden knickspurig [s. Titelbild]. Es gibt tatsächlich Sammler, die darum die Schutzumschläge ihrer Bücher in separaten Behältnissen aufbewahren und die Bücher, so sie sie doch einmal aus dem Schrank nehmen, um gar darin zu lesen, ersatzweise in lederne Futterale kleiden, um sie so vor allen Gefahren zu bewahren.
Und dann gibt es noch Beschädigungen durch unbewussten Vandalismus, etwa durch Kleinkinder, die die Schwarz-Weiß-Illustrationen in einer Klassikerausgabe in einem unbeobachteten Moment mit Wachsmalstiften kolorieren, oder durch unwissende Hausangestellte, die die rückseitig unbedruckten Seiten herausreißen und als Einkaufszettel nutzen. Hier gilt tatsächlich der alte Satz des Terentianus Maurus: Habent sua fata libelli.
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (XII)
Saturday, 21. August 2010Während die Alterung ihre Spuren auch an einem ungenutzten, ungelesenen Buch hinterlässt, wird die Abnutzung, wie schon ihr Name sagt, erst mit dem Gebrauch fühlbar oder sichtbar. Ein von mehreren Personen gründlich gelesenes Buch ist auch für den Laien erkennbar nicht mehr ,wie neu‘ und damit nicht mehr als ,neuwertig‘ anzubieten, wenngleich es im Einzelfall gar nicht einmal so einfach ist, seinen Verschleiß präzis auf den Begriff zu bringen.
Oft ist es lediglich eine gewisse Lockerung der Lagen oder Seiten im Einband, die den Eindruck von Abgenutzheit erweckt; oder eine leichte Stumpfheit des Kopf-, Vorder- und Fußschnitts; vielleicht auch ein unbestimmtes Gefühl von Abgegriffenheit, sowohl des Umschlags als auch des Einbands. Diese schwachen, aber doch nicht zu leugnenden Abnutzungsspuren sind weit davon entfernt, Buchschäden im eigentlichen Sinn zu sein. Der erfahrene Buchfreund spürt aber untrüglich, dass dieses gute Stück, das er da in Händen hält, von einem anderen Liebhaber schon viele Male zur Hand genommen wurde, oder vielleicht auch durch viele Hände vieler Liebhaber gegangen ist. Das Buch ist also gleichsam ausgespült und zugleich aufgeraut vom Schweißflor und Profil der unbekannten Hände, die nach ihm gegriffen, in ihm geblättert und zwischen seinen Seiten nach Freude, Ablenkung, Belehrung oder Erkenntnis gegraben haben.
Die offensichtlichste Spur vielfachen Gebrauchs eines Buches ist die Schiefstellung seines Rückens, wie bei einem in die Jahre gekommenen Lastenträger oder Möbelpacker. Solche ,schiefgelesenen‘ Bücher [s. Titelbild] können übrigens allenfalls dann geheilt werden, wenn sie fadengeheftet sind. In diesem Fall nimmt sie der Buchbinder vollständig auseinander und zieht neue Fäden ein. Bei Paperbacks oder Hardcover-Bänden, die gelumbeckt sind, kann die ,Schieflage‘ nur vorübergehend behoben werden, indem die Verleimung zum Rücken hin abgeschnitten, der Buchblock aufgeraut und wiederum nach dem Lumbeckverfahren verleimt wird. Die zuletzt beschriebene Reparatur kann man natürlich nicht beliebig oft wiederholen, weil der Bundsteg irgendwann aufgebraucht ist und somit Textverlust droht. Sie wird sich bei solch minderwertigen Büchern allerdings auch ohnehin kaum lohnen.
Während das schiefgelesen Buch in die Verantwortung der Hersteller fällt und nicht etwa in die der Leser, die diesem Buchleiden keineswegs durch eine besonders schonende Technik des Umblätterns entgegenwirken können, muss man eine lange Reihe anderer Gebrauchsspuren aufs Schuldkonto banausischer Leser schreiben. Ich will gar nicht von den hässlichen ,Eselsohren‘ sprechen, die offenbar vor Erfindung des Lesezeichens die einzige Möglichkeit waren, eine Leseunterbrechung im Buch zu markieren. Ich habe mir sagen lassen, dass man in einigen unzivilisierten Ländern noch viel rabiater verfährt, indem man die gelesenen Blätter augenblicks aus dem Buch rupft und einer rein physischen Zweitnutzung zuführt!
Die Verwendung von Wurst- oder Käsescheiben als Lesezeichen ist hingegen wohl ähnlich selten anzutreffen wie der Missbrauch des Buchs als Fliegenklatsche oder als Wurfgeschoss zum Vertreiben von Nagetieren.
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (XI)
Saturday, 21. August 2010In den ersten zehn Folgen habe ich jene Erkennungsmerkmale eines Buches vorgestellt, die allen Exemplaren eines Titels gemeinsam sind, wenn sie in jungfräulicher Reinheit, eins wie das andere ununterscheidbar gleich, die Druckerei und Binderei verlassen und als makellose Neuerscheinungen in den Buchhandlungen eintreffen. Das sind, wie wir gesehen haben, der Autorenname und gegebenenfalls die Namen weiterer Mitarbeiter, der Titel auf dem sauberen Titelblatt, Name und Ort des Verlags, das Erscheinungsjahr, der Umfang nach Seiten, das Format, die Einbandart und zuletzt noch fallweise die graphische Gestaltung.
Sobald aber das einzelne Buch seinen ersten privaten Besitzer erreicht hat, ist es einer Vielzahl von erodierenden, makulierenden, gar ruinierenden Geschehnissen ausgesetzt, die Spuren auf seinem empfindlichen Corpus hinterlassen und es damit unterscheidbar machen von allen Geschwistern seiner Auflage, und zwar in der Regel ein für alle Male. Fast immer mindern solche Spuren den ästhetischen oder praktischen Wert des Buches. Es wird aber auch von Fällen zu reden sein, in denen im Gegenteil eine manchmal sogar erhebliche Wertsteigerung zu verbuchen ist, wenn nämlich diese Spuren Rückschlüsse auf die Provenienz eines Buches erlauben oder dieses spezielle Exemplar sonstwie veredelt wurde. (Vielleicht eröffne ich hier gelegentlich eine neue Serie, in der ich einige der solcherart ,getrüffelten‘ Bücher meiner Bibliothek vorstelle und erzähle, wie sie in meinen Besitz gelangten.)
Was nun die Art der Spuren betrifft, die fast alle Bücher nach einer gewissen ,Lebenszeit‘ an sich tragen, so kann man vier große Gruppen unterscheiden: Alterung, Abnutzung, Beschädigung und Kennzeichnung.
Alterungsspuren können selbst bei pfleglichem Gebrauch und schonender Lagerung auftreten, etwa wenn das Papier von so schlechter Qualität ist, dass es mit den Jahren nachdunkelt, der Schutzumschlag oder Einband lichtrandig wird usw. Ein privater Sammler wird die Ansprüche professionell eingerichteter Archive kaum herstellen können, die ihre Bestände bei gleichbleibender Luftfeuchtigkeit und Temperatur konservieren und so dem Zahn der Zeit mit allerdings beträchtlichem Kostenaufwand trotzen. Immerhin wird man den legendären ,Bücherwurm‘, der früher als tierischer Buchschädling gefürchtet war, in heute üblichen hygienischen Verhältnissen einer Wohnung mit Standardkomfort kaum mehr antreffen. Auf der Hut sein sollte man allerdings vor versteckten Verfallsbeschleunigern im Buch. So kann die an sich ja verständliche Gewohnheit, Kritiken und Rezensionen zwischen den Seiten des besprochenen Buches zu verstecken, nach etlichen Jahren für böse Überraschungen sorgen, wenn nämlich solche Zeitungsartikel, auf billigstes Papier gedruckt, nachgedunkelt sind und die Bräunung auf die Buchseiten überschlug. Auch Werbekarten des Verlags haben gelegentlich einen solchen unwillkommenen Effekt. Nicht nur das Raumklima, sondern auch das Sonnenlicht kann zu sichtbarer Alterung führen, wenn die Einbände oder Buchrücken ihm dauerhaft ausgesetzt sind und hierdurch ausbleichen. Solche Verfärbungen sind besonders unschön, wenn unterschiedlich große Bücher nebeneinander standen und sich darum die Bleiche fleckenweise abzeichnete. Austrocknung des Leims tritt besonders bei der ersten Generation gelumbeckter Bücher häufig auf, als diese Bindetechnik noch nicht ausgereift war. Trotz aller Vorsicht führt dies bald zum Bruch der Bindung, in manchen Fällen bis hin zur ,Loseblattsammlung‘. Buchumschläge mit Cellophan-Kaschierung, eine Mode – oder eigentlich Unsitte – der 1960er- und 1970er-Jahre, verlieren ihren glanzvollen Teint auch ohne menschliches Zutun von den Rändern her durch Abplatzen der hauchdünnen Kunststofffolien. (Hilft man nach, um die hässlichen Fransen und Fetzen loszuwerden, reißt man leicht auch schon mal Fehlstellen in die darunterliegende Farbschicht. Dies fällt dann allerdings in die Kategorie ,Beschädigung‘.)
Und schließlich können auch lästige Geruchsspuren zur Beeinträchtigung des Buchgenusses beitragen. Möglicherweise rührt der strenge Duft daher, dass Bücher ihr Heim mit starken Rauchern teilen mussten? Weit häufiger begegnen in den Kisten der Trödler und Flohmarkthändler Bücher, die durch feuchte Lagerung muffig geworden sind, wogegen es noch kein Heilmittel zu geben scheint. Der Erfinder eines nachhaltigen ,Bücherdeodorants‘ würde sich jedenfalls große Verdienste unter den Sammlern erwerben und könnte mit dem Verkauf eines patentierten Mittels an sie und die Händler reich und berühmt werden.
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (X)
Thursday, 19. August 2010Vor dem Zeichen war das Bild. Und so müssten eigentlich die Bilderbücher vor allen Lesebüchern Erwähnung finden. Immerhin spiegelt sich diese Entwicklungsgeschichte noch immer in dem Weg, den jedes Kind beschreitet, wenn es vom Seher zum Leser wird. Mein Vater hat meiner Ungeduld nachgegeben und mir lange vor der Einschulung eine appetitliche ,Bild-Buchstaben-Karte‘ gemalt und geschrieben: A a wie Apfel, B b wie Banane, C c wie Citrone und so fort bis Z z wie Zwetschge. Die ABC-Bücher und Fibeln für die I-Männchen sind die ersten Bücher, die den Weg in die neue Welt des Lesens, Verstehens und Phantasierens bereiten.
In den Büchern der Erwachsenen spielen Bilder meist eher eine Nebenrolle, zur gelegentlichen Illustration des Erzählten oder als schmückende Dekoration. Man mag ja sogar prinzipielle Einwände gegen solche Bebilderungen finden, die schließlich die Vorstellungskraft des Lesers in engere Bahnen lenkt und insofern seine Phantasie nicht beflügelt, sondern beschneidet. Bei Sach- und Fachbüchern können Abbildungen hingegen eine nahezu unverzichtbare Ergänzung sein. Botanische oder zoologische Monographien sind ohne Pflanzen- bzw. Tierbilder kaum vorstellbar, und auch ein Schachbuch erleichtert dem Nutzer den Nachvollzug erheblich, wenn das eine oder andere Stellungsbild eingestreut ist.
Jede literarische Epoche kennt aber auch für ihre poetischen Werke Meister der Bildkunst, die dem Sprachkunstwerk eine so kongeniale Visualisierung zur Seite stellen, dass ihre kretaive Leistung verdient, als gleichrangig gewürdigt zu werden. Dennoch ist es üblich, in Bücherverzeichnissen den Schriftsteller immer an erster, den Illustrator an zweiter Stelle zu nennen. Das mag seine Berechtigung schon deshalb haben, weil ja dieser sein Werk meist lange vollendet hat, bevor jener zum Pinsel oder Buntstift greift. Und schon gar wird sich der Umschlag- oder Einbandgestalter damit zufriedengeben müssen, in der Liste der Mitwirkenden an einem Buch erst an dritter oder vierter Stelle genannt zu werden.
Zweifelhaft wird die Rangfolge aber bei einer neueren Gattung illustrierter Bücher, den Comics. Denn hier arbeiten Autoren (wie z. B. René Goscinny) oft so eng mit Zeichnern (wie in diesem Fall Albert Uderzo) zusammen, dass man eine Vorrangstellung weder aus der zeitlichen Abfolge ihrer kreativen Leistungen noch aus deren Bedeutung für das Ergebnis ableiten kann.
Schließlich gibt es noch Bücher, bei denen die Abbildungen ganz im Vordergrund stehen oder die sogar ausschließlich Bilder zeigen und auf Text ganz verzichten, wie Bildbände mit Malerei oder Photographien. Hier sollte es im Regelfall natürlich der Künstler sein, der als Urheber des Werkes genannt wird, und nicht etwa ein Herausgeber oder Verfasser des Vorworts.
[Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt aus der Umschlagillustration von Volker Kriegel zu dem 1987 im Haffmans-Verlag in Zürich erschienenen Buch Flauberts Papagei von Julian Barnes.]
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (IX)
Tuesday, 17. August 2010Materialkundlich gesehen besteht das traditionelle Buch mindestens aus 1. Papier und 2. Druckfarben: dem sog. Buchblock; zudem aus 3. Bindemitteln wie Fäden oder Klammern, 4. Pappe und Bezugsstoff wie Leinen, Leder, Kunststoff, Pergament u. ä. sowie 5. Leim: dem sog. Einband. Letzterer hält die losen Seiten oder Lagen zusammen, schützt sie gegen Verschmutzung oder Beschädigung und verleiht dem Buch Stabilität, die für eine aufrechte Lagerung im Regal oder Bücherschrank zweckmäßig ist.
Je nachdem, ob der Einband als handwerkliches Einzelstück von einem Buchbinder gefertigt oder maschinell und serienmäßig für eine komplette Buchauflage produziert wurde, spricht man von einem Handeinband oder von einem Verlagseinband. Die wenigen von Hand gebundenen Bücher in meiner Bibliothek kann ich an den Fingern beider Hände abzählen. Über die drei Bände von Heinrich Manns Kaiserreich-Trilogie habe ich früher bereits einmal berichtet und noch früher sogar Abbildungen der kostbaren Einbände ins Netz gestellt.
Was nun die weit überwiegende Zahl der industriell gebundenen Bücher in meinen Regalen betrifft, so wäre, würde ich sie nach Erscheinungsjahr sortieren, ein trauriger Niedergang der Produktqualität unübersehbar. Im Gefolge des Taschenbuchs, das seinen Massenerfolg (ab 1950) dem niedrigen Preis verdankte, welcher wiederum durch die Einführung der Klebebindung nach Emil Lumbeck (1886-1979) möglich war, begannen die Verlage Mitte der 1960er-Jahre, auch bei gebundenen Büchern auf die haltbare Fadenheftung zu verzichten und den Buchblock zu lumbecken. Und nur wenige Jahre später entwickelten die Buchhersteller Verfahren, die es ermöglichten, Pappdeckel mit feinen Prägeprofilen zu versehen, die auf den ersten Blick selbst beim Fachmann den Eindruck einer Leinenstruktur vortäuschten. Erst recht ließen sich natürlich Laien von dieser Camouflage täuschen.
Diese beiden objektiven Verschlechterungen der materiellen Buchqualität erfolgten natürlich aus reinen Kostengesichtspunkten und unter Konkurrenzdruck. Wozu Geld in den Luxus einer Buchausstattung investieren, den kaum ein Leser wahrnimmt? Dann steckt man die eingesparten Mittel doch lieber in die Werbung oder erhöht den Umsatz durch Preisnachlass. Mit der Verbilligung der Bücher blieb der Anspruch auf der Strecke, mit ihrem Erwerb einen dauerhaften Wert anzuschaffen. Bezeichnend für diesen Trend zum Ex-und-hopp-Buch war auch die Entwicklung des Schutzumschlags, dessen immer grellere, glänzendere Erscheinung den Blick von der Verödung des Inhalts, nämlich des Buches selbst ablenkte. [Das Titelbild zeigt die vierbändige Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm aus dem Eugen DiederichsVerlag, in wundervoll verzierten Halbleinenbänden mit Lesebändchen – aber gelumbeckt!]
So sind in den letzten Jahrzehnten selbst halbwegs akzeptable Verlagseinbände in der Massenproduktion immer seltener geworden, wobei das deutsche Verlagswesen im internationalen Vergleich sogar noch vorbildlich ist. Der neueste Schrei ist die alberne Masche, in billigst gebundene Bücher und selbst in manche Taschenbücher Lesebändchen zu kleben, als wären mit dieser albernen Überflüssigkeit die eigentlichen Mängel auszugleichen. Ich habe übrigens noch nie ein gelesenes Buch gesehen, bei dem das Lesebändchen sich nicht unter der Nutzung in ein verschmutztes, ausgefranstes, geradezu unappetitliches Etwas verwandelt hätte. Für die kleine Schar anspruchsvoller Buchkäufer, die sich noch einen Rest sinnlicher Empfänglichkeit für solche Dinge bewahrt haben, gibt es eine Handvoll ambitionierter Verlage, die die Kultur des schönen, zweckmäßigen und haltbaren Buches pflegen. Die Andere Bibliothek, von Franz Greno und Hans Magnus Enzensberger 1985 gegründet, hat hier Maßgebliches geleistet und vorgeführt, dass ein solches Unternehmen mindestens für eine Zeit existenzfähig sein kann. Einige kleinere Verlage, wie die Friedenauer Presse in Berlin, der Weidle Verlag in Bonn oder zuletzt der Düsseldorfer Lilienfeld Verlag, haben solide und zugleich entzückend schöne Bücher vorgelegt, doch man muss immer um die Existenz dieser kleinen Unternehmen bangen.
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (VIII)
Monday, 16. August 2010Nach dem Seitenumfang ist eine weitere quantitative Eigenschaft des Buches sein Format. Zwar das Bemühen der Buchhersteller, ihren Produkten durch ein auffallendes Äußeres besondere Aufmerksamkeit zu verschaffen, bisweilen seltsame Blüten getrieben, trotzdem begegnen uns runde, selbst drei- oder fünfeckige Bücher sehr selten. Gewöhnlich hat das Buch eine rechteckige Form, wobei das Hochformat die Regel und das Querformat seltene Ausnahme ist.
Traditionell wurden die Formatbezeichnungen von Büchern aus der Zahl der Bogenfalzungen abgeleitet. Ein einfach gefalzter Bogen ergab einen Folio-Band, zweifach einen Quart-, dreifach einen Oktav-Band. In England galten aber andere Bezeichnungen und Maße als in Frankreich und Deutschland, und so hat sich mittlerweile international eine Maßangabe aus Breite mal Höhe in Zentimetern durchgesetzt. Die Breite steht traditionell an erster Stelle, weil dies irgendwann einmal für die Papiermaße eingeführt wurde. Ich halte diese Regel aber für unsinnig, da die Höhe erstens wichtiger für den Nutzer ist. (Regalabstände!)
Zweitens aber kann die Höhe eines Buches, als Entfernung von der oberen zur unteren Einbandkante, immer exakt angegeben werden. Zur Ermittlung der legt man das Lineal an der rechten Kante des Einbanddeckels an und misst bis zum Buchrücken. Doch da wird es problematisch! Der Rücken ist bekanntlich bei den meisten gebundenen Büchern ab einer bestimmten Buchdicke rund. Nun weiß man nicht, an welcher Stelle genau man das Lineal ablesen soll. Gilt der ,höchste‘ Punkt der Rundung als Messpunkt? Ich habe mich entschieden, die Falzkante des Gelenks zu meiner persönlichen Messnorm zu erklären [s. Titelbild] und entgegen der geltenden Regel die Breite erst an zweiter Stelle zu nennen. Ist also der erstgenannte Messwert kleiner als der zweite, so handelt es sich um ein Querformat. Außerdem runde ich nicht wie üblich auf ganze Zentimeter, sondern gebe millimetergenaue Messwerte an.
Eins meiner größten Bücher ist übrigens (mit 43,4 x 33,2 cm) Arno Schmidts Julia oder die Gemälde, eins meiner kleinsten eine Miniaturausgabe von Rosa Luxemburgs Briefe aus dem Gefängnis (5,2 x 4,0 cm).
Und dann hat ein Buch, und sei es noch so seichten Inhalts, immer auch ein Gewicht. Selbst ,leichte‘ Bücher können also ganz schön schwer sein. Spätestens bei meinen zahlreichen Wohnungswechseln wurde mir dies ein ums andere Mal wieder bewusst, und zwar immer schmerzlicher, ließ doch mit den Jahren mein körperliches Leistungsvermögen nach, während der Umfang meiner Bibliothek, und damit ihr Gesamtgewicht, stetig zunahm. Ich kannte mal einen Berliner Antiquar, der einen Teil des Warenbestandes in seiner Mietwohnung lagerte, gestapelt immer ganz behutsam längs der Zimmerwände, denn der Holzfußboden knarrte bedenklich und er träumte nachts von einem Durchbruch in die darunterliegende Wohnung. Vielleicht liegt das Durchschnittsgewicht gebundener Bücher bei 400 Gramm, dann bringt es eine Bibliothek von fünftausend Bänden auf zwei Tonnen. Das sollte man sich vor Augen führen, bevor man sich gerade für diese unbequeme Sammelleidenschaft entscheidet.
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (VII)
Sunday, 15. August 2010Werke des Geistes nach quantitativen Gesichtspunkten zu beurteilen, das kann nur einem Banausen in den Sinn kommen. Vielleicht fährt ein solcher gerade deshalb alljährlich nach Bayreuth, weil die Wagner-Opern „so imposant lang“ sind. Da hat man doch was für sein Geld! Und beim Flächengigantismus der Malerei des zu Ende gehenden Jahrzehnts fragt man sich ebenfalls, ob diese Quadratmeterprotzerei sich nicht bloß einer neureichen Klientel andienen will, die mangels ästhetischer Argumente die Auswahl ihres Wandschmucks damit begründet, dass sie die riesigen Wände in ihren Villen „schließlich irgendwie vollkriegen“ muss.
Beim Buch hingegen kommt selbst der kulturloseste Einfaltspinsel kaum auf den Gedanken, dass sein Wert sich an der Zahl der Seiten ablesen ließe. Allenfalls in jener fernen Zeit, als die Alphabetisierung der Bevölkerung sich noch auf eine kleine Minderheit beschränkte, konnte der große Rest des Volks die Bibel allein schon deshalb für das ,Buch der Bücher‘ halten, weil sie nun mal eine besonders dicke Schwarte ist. Ich habe hier und dort bereits ein paar Gedanken zum dicken Buch in unserer Zeit geäußert. Nun geht es um den Umfang unterm Gesichtspunkt einer quantitativen Bemessungsgröße, ohne jede inhaltliche Wertsetzung.
Man kann die prinzipielle Frage stellen, wieviele Seiten denn mindestens zusammengebunden sein müssen, damit das Ergebnis überhaupt als Buch bezeichnet werden kann. Üblicherweise nennt man acht oder sechzehn oder auch zweiunddreißig Seiten im Verbund, in dieser Größenordnung meist bloß durch Metallklammern zusammengehalten, eher Heft als Buch. Solche Gebilde haben in der Regel keinen festen, sondern einen flexiblen, biegsamen Einband. Doch auch tausend Seiten dicke Bücher kommen heute flexibel gebunden auf den Markt. Es käme aber wohl niemand auf den Gedanken, einen solchen schwergewichtigen Band ein Heft zu nennen. Also müssen wir uns damit begnügen, dass die terminologisch Abgrenzung des Buches nach quantitativen Kriterien unscharf bleibt.
Immerhin kann man aber bei jedem Buch die Seitenzahl unzweideutig präzis angeben, wenngleich auch hier ein paar Tücken lauern und der Antiquar Vorsicht walten lassen muss, damit ihm keine Ungenauigkeiten oder gar Fehler unterlaufen. So genügt es beispielsweise nicht, hinten im Buch nach der letzten gedruckten Seitenzahl Ausschau zu halten und allenfalls noch die paar eventuell folgenden, nicht nummerierten Seiten hinzuzuzählen. Gerade bei älteren Büchern kommt es vor, dass ein vorgeschalteter Teil – bestehend z. B. aus dem Vorwort, einer Einleitung, Widmungen, dem Inhaltsverzeichnis etc. – mit römischen Zahlen versehen wird, bevor die arabische Paginierung des ,eigentlichen‘ Werkes beginnt. (Vollständig römisch paginierte Bücher sind hingegen sehr selten; s. Titelbild.) Sodann sind oft Abbildungen im Buch verstreut, die auf einem besonderen Kunstdruckpapier wiedergegeben werden. Diese Blätter fallen meist aus der durchgehenden Seitenzählung heraus und sollten gesondert erwähnt werden. Und schließlich ist es üblich, dass nicht mehr zum eigentlichen Inhalt gehörige Seiten am Schluss, welche der Verlag häufig zu Werbezwecken nutzt, getrennt angegeben werden.
Eine genaue Angabe des Umfangs eines Buches sieht dann zum Beispiel so aus: XVI & 356 & 12 S. & 16 unpag. Kunstdruck-Taf. m. 22 ungez. Abb.
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (VI)
Saturday, 14. August 2010Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1969. – In dieser Form erscheinen die Verlagsangaben in der Regel in den antiquarischen Buchbeschreibungen. Dabei wäre der Ortsname in den meisten Fällen entbehrlich, denn schließlich ziehen solche Firmen ja nicht dauernd von einer Stadt zur anderen. Der über hundert Jahre alte Verlag von Ernst Rowohlt, um im Beispiel zu bleiben, ist dabei schon verhältnismäßig mobil gewesen. Er wurde 1908 in Leipzig gegründet, residierte nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin, nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst in Stuttgart und Baden-Baden, bevor er 1950 nach Hamburg umzog und 1960 sein bis heute letztes Domizil in Reinbek fand. Weil Verleger meist eitle Menschen sind, breiten sie ihre Firmengeschichte mindestens alle 25 Jahre in detailreichen Chroniken aus. Diese Bücher können, neben den von besonders selbstverliebten Verlegern alljährlich herausgegebenen Verlagsalmanachen, wertvolle Rechercheinstrumente für den Antiquar sein.
Die – neben dem Namen des Autors und dem Titel – wichtigste bibliographische Angabe ist jedenfalls das Erscheinungsjahr. Eine Liste mit Veröffentlichungen eines Autors wird in aller Regel hiernach, also chronologisch in der Reihenfolge von deren Erscheinen geordnet sein. Dagegen könnte man mit Fug und Recht einwenden, dass doch vielmehr das Jahr der Entstehung bzw. Fertigstellung eines Schriftwerkes viel aussagekräftiger sei als das Jahr seiner Publikation, die ja nicht selten durch mancherlei Zufälle erst viele Jahre später, gelegentlich gar erst lange nach dem Tod des Autors erfolge. Mag sein! Und doch gilt als eigentliches ,Geburtsjahr‘ eines Buches das seiner ersten Vervielfältigung durch den Druck, die ja seinen öffentlichen Auftritt vor einem größeren Publikum erst möglich macht. Zudem ist der Entstehungszeitpunkt, oder richtiger: -zeitraum weit öfter unbekannt und auch nicht mehr ermittelbar, wohingegen indirekte Hinweise es meist erlauben, auch jene eher seltenen Bücher, in denen sich keine Jahreszahl ihres Erscheinens finden lässt, aufs Jahr genau zu datieren.
So wird das gelegentlich unvermeidliche Kürzel o. J. (für ,ohne Jahresangabe‘) oder lateinisch s. a. (für ,sine anno‘) nach manchmal geradezu detektivischen Ermittlungen vom Antiquar zu ergänzen sein durch einen Zusatz in eckigen Klammern, wie [ca. 1850], [zw. 1956 u. 1963] oder [nach 2004]. Hierbei können übrigens auch die sonst eher ungeliebten handschriftlichen Eintragungen der Vorbesitzer antiquarischer Bücher, wie Anschaffungsvermerke oder Widmungen, von großem Nutzen sein. In vielen Fällen hilft auch ein Blick in den Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, der mittlerweile auch online verfügbar ist und für die meisten undatierten deutschen Bücher des 20. Jahrhunderts erfreulich zuverlässige Jahresangaben ausweist.
Für den Antiquar, der schließlich mit dem Verkauf alter Bücher seinen Lebensunterhalt bestreiten muss, ist das Erscheinungsjahr eines Buches, das er in Händen hält, aber noch aus einem anderen Grund bedeutsam. Viele Sammler haben sich nämlich auf den Erwerb von Erstausgaben (EA) spezialisiert. Dies mag der Laie für eine Narretei halten, unterscheiden sich doch spätere Auflagen ein und desselben Titels meist weder äußerlich noch vom Inhalt her von den Exemplaren der ersten Auflage. Es ist hier nicht die passende Gelegenheit, diese vermeintliche Marotte nach allen Dimensionen menschlicher Leidenschaft auszudeuten. Die Folge besagter Spezialisierung ist jedenfalls, dass Erstausgaben stets einen deutlich höheren Preis erzielen als alle weiteren Nachauflagen – selbst wenn diese ,um wichtige Zusätze erweitert‘, ,korrigiert‘ oder ,überarbeitet‘ erscheinen.
Und natürlich steigt der Preis einer Erstausgabe noch, wenn diese in einer verhältnismäßig kleinen Auflage erschien und das Buch anschließend ein ,Renner‘ wurde, es auf astronomische Auflagenzahlen brachte und sich zum ,Kultbuch‘ oder ,Klassiker‘ mauserte.
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (V)
Friday, 13. August 2010Wenn jemand ein Buch geschrieben hat, dann hat er vier Möglichkeiten. Entweder verbrennt er es, dann ist es aus der Welt und er hat seine Ruhe. Oder er versteckt es in seiner Schublade, dann ist es mindestens fürs Erste aus der Welt, aber seine Ruhe hat er damit noch nicht, denn immerhin weiß er, dass da das Buch im Versteck lauert und vielleicht einmal hervorkommt, und sei es nach seinem Tod, und dann doch noch in die Welt hüpft, und was dann? Drittens kann er hergehen und es auf eigene Rechnung vervielfältigen, sagen wir hundert Stück per Xerokopierer® und Bindomatic®, um sie dann persönlich in der kleinen Welt seines Freundes- und Bekanntenkreises zu verschenken. Um seine Ruhe ist es dann voraussichtlich endgültig geschehen, denn er wird sich den Kopf zerbrechen, ob die vielen Lobesworte, die er anschließend zu hören bekommt, nicht falsche Komplimente sind, bis er irgendwann eines der per Hand gewidmeten und nummerierten Exemplare in einer Flohmarktkiste entdeckt, versehen mit überaus schmerzvollen Randnotizen und zum Preis von zwei Euro.
Darum wählt der Buchschreiber, der es wissen will, die vierte Variante, schickt die hundert xerokopierten und bindomaticgebundenen Exemplare seines Erstlingswerks per Post an zunächst bedeutende, dann aufstrebende, schließlich experimentierfreudige Verlage, erhält zunächst Absagen auf Vordrucken, dann Vertröstungen in persönlicher Form und schließlich Zusagen unter der Voraussetzung, dass er für einen Teil der Produktionskosten selbst aufzukommen bereit ist. Wenn ihm überm Schreiben noch nicht aller Realitätssinn abhandengekommen ist, lässt er es dabei bewenden. Er freut sich, dass ihn die wertvolle Erkenntnis, zum Schriftsteller nicht geboren zu sein, so wenig Zeit und Geld gekostet hat, um sich alsbald einer anderen Freizeitbeschäftigung zuzuwenden. Gehört er hingegen zu jener Sorte von Sturköpfen, die sich jede durch professionelle Gutachter erteilte Abfuhr nur als weitere Bestätigung ihrer vermeintlichen Genialität erklären können, dann wird die Irrfahrt richtig teuer und dauert schlimmstenfalls lebenslänglich.
Andererseits wächst die Produktion von Büchern und anderen Druckerzeugnissen in Deutschland Jahr für Jahr, sowohl in absoluten Stückzahlen (über eine Milliarde) als auch nach Zahl der verschiedenen Titel (mehr als hunderttausend). Folglich werden die Verlage, die diese Papierflut zu verantworten haben, immer wieder neue Autoren entdecken, denn es sterben ja auch ständig welche weg, deren Auswurf unmöglich allein durch Mehrarbeit der verbleibenden kompensiert werden kann. Schließlich herrscht aufseiten der Leser unausrottbar das Vorurteil, nach dem die jeweils allerneuesten Bücher den älteren unbedingt vorzuziehen sind, wie ja auch alle anderen Produkte wie Elektrogeräte, Fahrzeuge, Nahrungs- und Genussmittel, Hygieneartikel usw. laufend optimiert und den sich wandelnden Bedürfnissen und Moden angepasst werden.
Wenn bei meinem Leser aus dem bis hierher Gesagten der Eindruck erwachsen sollte, ich stünde dem Verlagswesen als solchem und auch den einzelnen Verlagen eher kritisch gegenüber, so bin ich gut verstanden worden. Aber noch in den finstersten Keller verirrt sich ab und zu ein Streifchen Licht. Und so will ich zum versöhnlichen Abschluss meiner Ausführungen über Buchverlage doch ein Gutes hervorheben, das sie immerhin durch ihre Namen als Bestandteil der Buchbeschreibung mit sich bringen.
Dem erfahrenen Leser, Sammler, Händler von Büchern wird nämlich durch kaum eine andere autobiographische Angabe mehr über ein ihm unbekanntes Buch und seinen Autor verraten, als eben durch dessen Zugehörigkeit zu einem Verlagsprogramm, das ihm vertraut ist. Wenn mir jemand sagt, dass ein Buch bei Diogenes oder Droemer Knaur, bei Lambert Schneider oder Langenscheidt, bei Kiepenheuer & Witsch oder Matthes & Seitz erschienen ist, dann weiß ich es auf einer imaginären geistigen Landkarte zu lokalisieren, weit zuverlässiger als durch das Lesen einer Inhaltsangabe oder Zeitungskritik. Hierfür sei den Verlagen gedankt!
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (IV)
Thursday, 12. August 2010„In der arbeitsteiligen Wirtschaft des sozialistischen Staats ist ein Industrieprodukt wie das Buch naturgemäß Ergebnis von vieler Menschen Hände Arbeit. Papierhersteller, Setzer, Drucker, Buchbinder, Packer, Typografen, Grafiker, Layouter, Lektoren und andere produzierende und gestaltende Werktätige begleiten das Buch auf seinem Weg von der Idee zum konkreten Objekt.“ So oder ähnlich könnten die ersten beiden Sätze in einem Berufsschulbuch über Das Druck- und Verlagswesen in der DDR für Lehrlinge in Buchhandel und Verlag gelautet haben. Da bei der Lektoratstätigkeit die Hände keine vorrangige Rolle mehr spielen, hätte man deren Aufnahme in die Liste als eine jener vielen kleinen Unredlichkeiten der Volksgenossen im Kombinat ,Lehren und Lenken‘ hinnehmen müssen, die immer dann unterlaufen, wenn sich das Denken entlang ideologischer Leitlinien bewegen muss. Immerhin träfe auf die Lektoratsarbeit aber wieder zu, was im dritten Satz über die namenlosen Helfer gesagt worden wäre: „All diese Menschen verschwinden hinter ihrer fachkundigen Arbeit und sind namentlich im fertigen Buch nicht vermerkt, obwohl doch ohne sie dieses Produkte niemals den Markt erreichen und die Bürger belehren oder erfreuen könnte.“
Wem wird also dann die Ehre zuteil, mit seinem bürgerlichen Namen neben dem Autor als Mit-Urheber oder Koproduzenten irgendwo im Buch, wenn nicht gar auf der Titelseite genannt zu werden? Bei Neuausgaben älterer, vielleicht schon ,klassischer‘ Werke ist es oft ein Herausgeber, der sich um die Neuedition besondere Verdienste erworben hat, indem er die früheren Ausgaben verglich, vielleicht gar Manuskripte des Autors hinzuzog und so zu einer fehlerfreien, gar historisch-kritischen Ausgabe zu gelangen. Vielleicht gibt es den prominenten Verfasser des Vor- oder Nachwortes, der seinen guten Namen und ein paar kluge Gedanken zur Verfügung stellt, um dem Buch eines etwa bislang unterschätzten Autors zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen? Manche Bücher bedürfen zum Verständnis des Laien fachkundiger Erläuterung, für die ein Kommentator sorgt. Und große Verantwortung für die Lesbarkeit bei allen im Original fremdsprachigen Werken trägt schließlich der Übersetzer, ohne dessen schwierige Arbeit uns ein Großteil der Weltliteratur unzugänglich bliebe. Alle diese ,Autoren in der zweiten Reihe‘ verdienen es, im Buch genannt und somit auch in die bibliographische Beschreibung aufgenommen zu werden, um ihnen im Erfolgsfall für ihre Leistungen die gebührende Anerkennung zollen, andernfalls aber auch berechtigte Kritik an die zuständige Adresse richten zu können.
Und dann gibt es noch, beosnders bei wissenschaftlichen Werken, die Danksagung der Verfasserin an all die offen oder im Verborgenen mitwirkenden Helfer, die sie auf dem beschwerlichen Weg bis zum nun endlich fertig vorliegenden Werk begleitet, sie mit Rat und Tat unterstützt, ihr in schwierigen Phasen Mut zugesprochen und ihr in zahllosen Detailfragen unschätzbar wertvolle Tipps gegeben haben, bis hin zu Tante Mienchen mit ihrem beruhigenden Kamillentee und Kater Bonifatius, der etliche überaus störende Fliegen fing.
Ob es eine solche Reverenzlitanei verdient, in eine antiquarische Autopsie aufgenommen zu werden, außer vielleicht als originelle Dekoration, das ist Geschmacksache und vielleicht davon abhängig, ob unter den genannten Personen namhafte Geistesgrößen auszumachen sind, deren Glanz auf die Danksagende abstrahlt. Letzteres wird häufiger einmal bei einem Vorbild, Freund oder Lehrer des Autors der Fall sein, der von ihm mit einer gedruckten und damit öffentlich gemachten Zueignung oder Widmung bedacht wurde.
Es stehen also gelegentlich im Buche sehr viele (Personen-)Namen, die neben dem Autor, in der zweiten oder dritten Reihe, ihren Platz finden; den nach dem Verfasser wichtigsten habe ich dabei allerdings aus guten Gründen noch ausgespart, da er nur mit einer Einschränkung hinzugehört: den Verleger. Er soll in der nächsten Folge zu seinem Recht kommen.
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (III)
Wednesday, 11. August 2010Wie heißt dieses Buch? Wie heißt dieses Buch? – Nein, ich beginne nun nicht, in ganzen Sätzen zu stammeln. Vielmehr halte ich in meiner linken Hand ein ganz reales Buch, während ich die erste Frage stelle. Und dann gebe ich mir selbst die Antwort auf diese Frage, indem ich den Titel des Buches nenne. Der Mathematiker, Logiker, Konzertpianist, Taoist und Zauberer Raymond M. Smullyan hat es geschrieben. Es heißt im amerikanischen Original What Is the Name of This Book?, in der deutschen Übersetzung Wie heißt dieses Buch? – Gleichzeitig halte ich in der rechten Hand ein Buch des Geschichtsprofessors, Pataphysikers und ständigen provisorischen Sekretärs des ,Ouvroir de Litterature Potentielle‘ (OuLiPo), Marcel Bénabou, das den paradoxen Titel hat: Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres, zu Deutsch: Warum ich keines meiner Bücher geschrieben habe.
In dieser Pose wollte ich gleich eingangs deutlich machen, dass uns das Stichwort ,Titel‘ auf ein überaus doppelbödiges, schwankendes, sumpfiges, verspiegeltes, nebliges Gelände entführt. Wenn Bénabou keines seiner Bücher geschrieben hat, besser: wenn er keines jener Bücher verfasste, die auf der Titelseite seinen Namen tragen, wie er gleich im Titel seines Buches Warum ich keines meiner Bücher geschrieben habe? vorausschickt, das ebenfalls seinen Namen trägt, wer hat dann eben dieses Buch geschrieben, in dem erklärt werden soll, warum er keines seiner Bücher schrieb? Und darf man denn überhaupt diesem Geständnis über die vermeintliche Nicht-Autorschaft von Bénabous Büchern trauen, wenn doch selbst dieses Geständnis eingestandenermaßen nicht von Bénabou stammt? Ebensogut könnte der Titel seines Buches dann lauten: Pourquoi je n’ai écrit ce livre?
Da der Autorenname allein kaum taugt, ein Buch schon äußerlich unverwechselbar zu machen oder gar inhaltlich zu kennzeichnen – weil erstens Autoren eine Neigung haben, wenn schon dann gleich mehrere Bücher zu veröffentlichen; weil zweitens verschiedene Personen gelegentlich den gleichen Namen tragen und solche Duplizitäten auch den schreibenden Stand nicht verschonen; und weil schließlich Personennamen nur zufällig einmal etwas über den Träger und damit vielleicht auch indirekt über das Ergebnis seiner Tätigkeit, hier: das geschriebene Buch aussagen – da also ein Buch mit nichts als dem Namen seines Verfassers auf dem Titel ebenso nichtssagend wie verwechselbar ist, verzichtet kein Autor auf die Gelegenheit, alles was er drinnen mit hunderttausend Worten sagen will, draußen mit einer Handvoll, allenfalls einem knappen Dutzend Wörtern immerhin anzudeuten.
Als die Geschichte der gedruckten Bücher ihren Anfang nahm, waren deren Autoren noch wesentlich spendabler mit den Auskünften, die sie im Titel dem möglichen Käufer und Leser erteilten: So heißt einer der ersten Erfolgsromane der deutschen Literatur: Der abentheuerliche Simplicissimus Teutsch | Das ist: Die Beschreibung deß Lebens eines seltzamen Vaganten | genant Melchior Sternfels von Fuchshaim | wo und welcher gestalt Er nemlich in diese Welt kommen | was er darinn gesehen | gelernet | erfahren und außgestanden | auch warumb er solche wieder freywillig quittirt. Drei Jahrhunderte später sind die Romantitel auf wenige Buchstaben geschrumpft: Knulp (Hermann Hesse 1915), Hiob (Joseph Roth 1930), Bin (Max Frisch 1945), Watt (Samuel Beckett 1953), Pnin (Vladimir Nabokov 1957), Frost (Thomas Bernhard 1963); bis hin zu einbuchstabigen Titeln wie V. (Thomas Pynchon 1963) und A (Andy Warhol 1968). Seither geht’s langsam wieder aufwärts. So erscheint in diesem Jahr ein Roman von Jan Faktor mit dem schon fast barock anmutenden Titel Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag.
Was will eigentlich der Titel eines Buches beim potenziellen Käufer bezwecken? Die Autoren schlagen ihren Verlegern oft Titel vor, von denen sie annehmen, dass sie neugierig machen könnten auf den Inhalt. Den Verlegern hingegen ist mehr daran gelegen, dass die Titel einprägsam sind, damit sie bei der Mund-zu-Mund-Propaganda nicht dauernd auf der Strecke bleiben. Bei der unüberschaubar großen Zahl von Büchern gibt es in der Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Leser naturgemäß nur sehr wenige Titel, die wirklich im Gedächtnis vieler Leser haften bleiben. So überrascht es nicht, dass die Buchtitel der Romane dieser Sommersaison 2010 zum überwiegenden Teil völlig nichtssagend sind. Bei aller bemühten Originalität nahezu bedeutungslos sind Namentitel wie Juja, Thennberg, Kornblum, Ben, Harold, Robinson und Julia, Pascolini, Die Erdbeeren von Antons Mutter, Der Sturz des Friedrich Voss, Alles über Sally, I am Airen Man, Axolotl Roadkill, Die Akte Rosenherz, Hellersdorfer Perle, Spaziergänger Zbinden, Kokoschkins Reise, Mihriban pfeift auf Gott, Sevilla, Grunewaldsee, Berlin Palace, Von Dschalalabad nach Bad Schallerbach und Hummeldumm. Kaum wesentlich mehr zur Anregung konkreter Vorstellungsinhalte liefern solche Ein-Wort-Titel wie Schonzeit, Kennung, Meeresstille, Schaumschwester, Silberfischchen, Heimaturlaub, Runterkommen, Horchen, Vorliebe, Bodenlos, Möchtegern, auch dann nicht, wenn sie um den bestimmten Artikel ergänzt werden: Der Liebespakt, Die Herrenausstatterin, Das Fenster, Die Leinwand, Der Koch, Das Matratzenhaus. Nicht viel besser bestellt ist es um die folgenden blässlichen Titel, bei denen man sich kaum vorstellen kann, dass es sie nicht schon mindestens einmal gegeben hat, und zwar vermutlich in allen bedeutenderen Nationalliteraturen der Welt: Die komische Frau, Die verlorenen Stunden, Der Sommer in dem Folgendes geschah, Zur falschen Zeit, Und dann diese Stille, Das Beste daran, Vorläufige Ankunft, Wenn Du wiederkommst, Ans Meer, Durch den Wind, Die Welt ist im Kopf, Komödie des Alterns, Wir vier, Roman unserer Kindheit, Ich weiß nicht und Das war ich nicht. Immerhin einen leichten Kitzel auf dem präfrontalen Kortex lösten bei mir folgende Titel aus: Vom Atmen unter Wasser, Einladung an die Waghalsigen, Liebe ist ein hormonell bedingter Zustand, Und im Zweifel für dich selbst, Der Mann der durch das Jahrhundert fiel, Sogar Papageien überleben uns, Am Anfang war die Nacht Musik und Kolonie der Nomaden. Kein richtiger ,Kracher‘ ist darunter, zum Beispiel so etwas wie Kühe in Halbtrauer. Aber wirklich unsterblich gute Romane sind ja ebenfalls sehr selten, warum sollte es sich dann mit den Titeln anders verhalten.
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (II)
Tuesday, 10. August 2010Auf den Autorennamen folgt in Bücherlisten in aller Regel der Titel des Buches. Der äußerlich augenfälligste Platz für dieses Gespann sind am Objekt der Auflistung selbst der Buchrücken und Buchdeckel. Maßgeblich für die einwandfreie Identifikation eines Buches ist jedoch die Titelseite, als Vorderseite des Titelblatts. Um welche Seite genau handelt es sich dabei aber? Jedenfalls ist es eine Seite ganz weit vorn im Buch, bevor dessen eigentlicher Inhalt beginnt. Und prinzipiell handelt es sich um eine rechte Buchseite; oder, was aufs Gleiche hinausläuft, um die Vorderseite eines Blattes. Daher trüge die Titelseite jedenfalls eine ungerade Seitenzahl, so sie denn mit einer Seitenzahl versehen wäre. Allerdings haben die ersten vier, sechs oder gar acht Seiten eines Buches in aller Regel gar keine Seitenzahlen, meist begegnet dem Leser die Ziffer 7 als erste Seitenzahl im Buch. Rechnet man von dort zurück, so ist die Titelseite oft eine Seite 3 oder 5, aber darauf ist kein Verlass. Was man immerhin noch sicher von ihr sagen kann: Sie ist in jedem Falle die dritte Seite der sog. Titelei. Hierunter versteht man nun wieder etwas ganz eigenes, nämlich folgende vier Seiten in dieser Reihenfolge: Schmutztitel, Frontispiz, Titelseite und Impressum. (Die Seiten eins, zwei und vier in diesem Quartett werden weiter unten noch eingehend zu würdigen sein.)
Was steht nun eigentlich auf der Titelseite? Was ist dort üblicherweise zu lesen? Name des Autors, Titel des Buches, Name (und gelegentlich auch Ort) des Verlags. Weitere Informationen – wie Untertitel, Gattungsbezeichnungen, Namen von Herausgebern oder Übersetzern usw. – können hinzukommen. Und in aller Regel sind die paar Worte in einer größeren Schrifttype gesetzt als der Rest des Buches, sein eigentlicher Inhalt.
Warum ist nun das Titelblatt für ein Buch so bedeutungsvoll, dass es seinen antiquarischen Wert erheblich mindert, wenn es bekritzelt, bestempelt, beschädigt oder gar vollständig entfernt ist? Ganz einfach deshalb, weil das Buch mit diesem Blatt seine Identität verliert. Es geht ihm ähnlich wie dem Seemann Gales in B. Travens Roman Das Totenschiff: Es hat in diesem Fall kein Alter, keine Herkunft und keinen verbürgten Namen; es existiert offiziell gar nicht und hat insofern auch keinen irgendwie bestimmbaren Wert. Es ist ein nichtswürdiges Nichts. Und es ist bezeichnend, dass Bibliotheken sich mit ihren Stempeln vorzugsweise auf der Titelseite verewigen, denn damit berauben sie das Buch für alle Zeit seiner Möglichkeit, in der freien Welt (des Marktes) eine Rolle zu spielen, ganz so wie der Souverän, der seinem Sklaven ein Brandzeichen auf die Stirn presst, ihn für alle Zukunft an sich bindet.
In einer verschollenen Anthologie von Erzählungen rund um das Thema Buch habe ich vor langer Zeit einmal die Geschichte eines pathologischen Bibliomanen gelesen, der sich aufs Sammeln von Titelblättern spezialisiert hatte. Er stahl diese, wann immer sich ihm die Möglichkeit dazu bot: aus den Büchern der Buchhandlungen und Antiquariate, aber auch aus Privatbibliotheken und sogar aus Kirchen, wo manchmal eine alte Bibel unbeaufsichtigt auf dem Altar auslag. Er besaß ein eigens gefertigtes Spezialmesser, welches ihm erlaubte, das Titelblatt mit einer einzigen blitzschnellen Handbewegung herauszutrennen, und zwar so überaus geschickt, dass selbst ein geübtes Auge nicht mehr erkennen konnte, dass sich an dieser Stelle je ein Blatt Papier befunden hatte. Der Urheber dieses seltenen Falls von Vandalismus und Buchfrevel war im Volksmund unter dem Namen Bookripper bekannt. Ich weiß nicht mehr, durch welches Missgeschick er schließlich zur Strecke gebracht wurde, sehr genau erinnere ich mich aber an sein Motiv. Er war auf der Suche nach der perfekten Titelseite, bei der einach alles stimmt: das Verhältnis von Höhe zu Breite des Blattes, die Art und Farbe der Schrifttype, die Proportionen der Zeilenlängen und Schriftgrößen, aber auch etwaiger Schmuckleisten und Ornamente bis hin zur harmonischen Einbettung eines Verlagssignets oder gar einer Illustration.
Heute hätte es ein solcher Titelseiten-Fetischist leichter. Er müsste nicht die Bücher selbst beschädigen, um seine Kollektion zu bereichern, sondern könnte sich mit Scans der edlen Buchtitel begnügen. – Mein Titelbild heute zeigt das Frontispiz (von Wilhelm Schulz) und die Titelseite von Leo Perutz: Die dritte Kugel. (München: Albert Langen, 1915.)
Kleines 1×1 der Buchbeschreibung (I)
Wednesday, 04. August 2010Listen gleich welcher Art müssen stets nach einem beherrschenden Ordnungsprinzip ausgerichtet sein, damit das einzelne Objekt, das in ihnen gelistet ist, schnell auffindbar bleibt. Meist sind die Objekte alphabetisch, gelegentlich auch numerisch geordnet, wobei in jedem Fall der ordnende Begriff, gleich ob Wort oder Zahl, als sog. Lemma am Anfang der Objektbeschreibung steht. Bei Bücherlisten ist es bewährte Tradition, dass Familien- und Vornamen des Autors eines Schriftwerks das maßgebende Lemma für die Sortierung bilden. Diese schlichte Konvention ist im Regelfall unproblematisch, birgt in Einzelfällen allerdings mancherlei Tücken.
Was, wenn ein Buch einen Autorennamen gar nicht vorweisen kann? An der altisländischen Edda haben vermutlich verschiedene Verfasser mitgewirkt, von denen Snorri Sturluson bloß ein zufällig namentlich bekannter ist. Auch das Nibelungenlied oder die Bibel haben entweder viele Autoren oder keinen. In solchen Fällen tritt üblicherweise der Titel als Lemma an die Stelle des Autors. Auch Lexika, Wörterbücher und ähnliche Nachschlagewerke sind meist das Ergebnis kollektiver Mitwirkung zahlreicher Beiträger, weshalb Duden oder Brockhaus unter ihren Titeln gelistet werden. Es sei denn, dass sich ein namentlich auf der Titelseite ausgewiesener Herausgeber um die Zusammenstellung der Texte aus verschiedenen Quellen besonders verdient gemacht hat. In diesem Falle gebührt ihm ersatzweise das Recht an der vakanten Autorschaft. Den Bärenanteil solcher Fälle machen Anthologien aller Art aus. In seltenen Fällen ist aber keinerlei Urheber eines Druckwerks angegeben. Die Verfasser politischer oder pornographischer Schriften hatten in weniger liberalen Zeiten gute Gründe, ihre Identität hinter einem Pseudonym zu verstecken oder solch heikle Bücher gleich anonym erscheinen zu lassen. Manchmal verbergen sich hinter einem fingierten Personennamen wie Nicolas Bourbaki auch ganze Autorenkollektive.
Der sorgfältige Antiquar wird bemüht sein, Pseudonyme zu lüften und auch die Autoren anonymer Werke zu ermitteln. Hierfür gibt es Nachschlagewerke und auch schon Listen im Internet. Grundsätzlich gilt aber für die sachgerechte Autopsie, dass zunächst lediglich jene Angaben zu vermerken sind, die dem vorliegenden Buch selbst entnommen werden können, genauer: der Titelseite; also nicht etwa dem Umschlag, Buchrücken oder -deckel. Alle Ergebnisse etwaiger detektivischer Nachforschungen des Antiquars sind in eckige Klammern […] zu setzen.
Mancherlei Tücken bergen zudem Namen aus fremden Sprachen. Die Akzente bei dem Franzosen Prosper Mérimée richtig zu platzieren ist noch eine vergleichsweise leichte Übung, da geht die korrekte Schreibweise des Tschechen Václav Beneš Třebízský schon etwas schwerer von der Hand. Immerhin ist mittlerweile die Darstellung selbst exotischer Sonderzeichen dank PC und Textverarbeitungs-Programm möglich. Verwirrung entsteht immer wieder bei ostasiatischen Autoren, weil Vor- und Familienname verwechselt werden. In der dortigen Namensordnung steht, ähnlich wie in manchen Gegenden Bayerns, der Familienname an erster und der Vorname an zweiter Stelle: Ono Yoko. Als die Japanerin im Okzident reüssierte, passte sie ihren Namen an und nannte sich hinfort Yoko Ono. Vorsichtshalber sollte man bei Japanern, Chinesen, Koreanern oder Vietnamesen immer prüfen, ob der Titel die konventionelle oder die westlich angepasste Reihenfolge wiedergibt, bevor man sich zum Beispiel für die Sortierung und Ablage unter „Ono, Yoko“ entscheidet.
Dass ein Autoren- oder Herausgeber-Name als entscheidendes Ordnungswort korrekt wiedergegeben werden muss, ist unmittelbar einleuchtend, denn als Lemma erfüllt er nur dann seine Funktion, wenn er das Objekt, das ihm zugeordnet ist, in jeder noch so langen Auflistung gleichartiger Objekte bequem auffindbar macht. Aber natürlich birgt der Name darüber hinaus noch weit mehr Erkenntnismöglichkeiten über das mit ihm verbundene Objekt. Was ist zur Biographie der Person zu ermitteln, die sich hinter diesem Namen verbirgt? Welche Werke hat sie gegebenenfalls noch verfasst oder herausgegeben? Und welche Rückschlüsse erlauben diese biographischen und bibliographischen Hintergründe auf das vorliegende Werk? – Mir wird bei dieser Gelegenheit bewusst, dass ich als Büchermensch vermutlich wesentlich mehr Namen von Autoren kenne, deren Bücher ich gelesen habe oder doch vom Hörensagen kenne, als Namen von Mitmenschen meiner realen Lebenswelt. Ist das befremdlich; oder gar erschreckend? Lebe ich, Schatten meiner selbst, auf weite Strecken aus zweiter Hand in einer irrealen Parallelwelt, auf Kosten der authentischen Realitätserfahrung?
Antiquariat (II)
Thursday, 15. April 2010Mehr als ein Vierteljahr ist nun ins Land gegangen, seit ich die Eröffnung meiner Firma – Manuel Hessling Antiquariat Revierflaneur – hier bekannt gab. Unvorhergesehene Widrigkeiten aller Art hemmten meine Unternehmungslust ein ums andere Mal. Erst jetzt, so scheint’s, kann ich endlich Nägel mit Köpfen machen.
Heute habe ich die ersten hundert Bücher aus dem Lager gezogen, sie abgestaubt, durchgesehen, auf versteckte Mängel geprüft und auf ihren Verkaufswert taxiert. Ich stellte eine bunte Mischung zusammen, ließ mich dabei vom Zufall bestimmen, suchte nicht nach besonders wertvollen Preziosen. Schließlich sollte es ja ein represäntativer Querschnitt sein, den ich da sozusagen als Kostprobe an den Internet-Vertrieb melden würde. Wenn ich meine komplexen Gefühlsregungen bei dieser Arbeit auf einen einfachen Begriff bringen müsste, so würde ich sagen: Es beschlichen mich „gemischte Gefühle“ – und diese halten auch noch an.
Einerseits bin ich froh, mich nun endlich zu diesem Schritt durchgerungen zu haben: mich nämlich von einem großen Teil meiner längst über jedes vernünftige Maß hinaus angeschwollenen Bibliothek zu trennen. Andererseits sind mit manchem Buch, das ich in der Hand und in meinem Herzen wäge, so viele intensive Erinnerungen verbunden, dass es mir manchmal erscheint, als würde mit dieser Trennung ein Stück meiner eigenen Geschichte ausradiert.
Dies gilt besonders für Bücher, die ich noch als Jugendlicher von meinem schmalen Taschengeld gekauft habe. Nach langem Zögern und Zagen habe ich mich damals speziell zu diesem Buch durchgerungen und dafür auf ein paar andere verzichtet, die mit ihm konkurrierten. So war es zum Beispiel mit dem kleinen Bildbändchen The Living Theater – Paradise Now. (Ein Bericht in Wort und Bild. Text Erika Billeter. Fotos Dölf Preisig. Bern München Wien: Rütten+Loening Verlag, 1969.) Das habe ich vermutlich 1972 in einem Modernen Antiquariat an der Rüttenscheider Straße gekauft, für 3,95 DM statt 9,80 DM. Wie beneidete ich damals die lebensfrohen Akteure der Theatertruppe von Julian Beck (1925-1985) und Judith Malina (*1926). Ich hätte am liebsten mit meinen 16 Jahren die Schule geschmissen und wäre aufgebrochen, um mich diesen spielfreudigen Hippies anzuschließen. Wenn ich heute in dem Büchlein blättere, das ich schon seit vielen Jahren nicht mehr in die Hand genommen habe, dann fühle ich mich sofort wieder in diese Jugendträume hineinversetzt.
Ich schreibe 18,00 Euro hinein und verabschiede mich von ihm mit einem wehmütigen Lächeln. Vielleicht ist das viel zu teuer? Aber es ist mir lieb und teuer. Billiger gebe ich’s nicht her. Wahrscheinlich werde ich mit diesem Unternehmen auf keinen gründen Zweig kommen. Aber warten wir es ab.
Unangeleint
Wednesday, 20. January 2010Vergangene Woche starb in Berlin kurz vor Vollendung ihres 69sten Lebensjahrs die linke Essayistin Katharina Rutschky, die einer größeren Öffentlichkeit Ende der 1970er-Jahre durch das von ihr herausgegebene Quellenbuch zur „Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung“ bekannt wurde. Dessen Titel, Schwarze Pädagogik, ging danach in den allgemeinen Wortschatz ein zur Bezeichnung eines durch Jahrhunderte geübten Erziehungsstils, der es sich nicht zur vornehmsten Aufgabe machte, die natürlichen Anlagen des Kindes durch liebevolle Zuwendung nach Möglichkeit zu fördern, sondern ihm stattdessen mit einem großen Arsenal physischer und psychischer Strafwerkzeuge Disziplin, Fleiß und Gehorsam anzudressieren. (Rutschky selbst war übrigens kinderlos, und ihre Tätigkeit als Lehrerin beschränkte sich auf junge Erwachsene im zweiten Bildungsweg. Ich überlasse es dem Leser, ob er dieses praktische Defizit bei der Parteinahme in pädagogischen Diskursen für einen Vor- oder Nachteil halten will.)
Mir war Katharina Rutschky in den 1980er-Jahren als gelegentliche Beiträgerin zu Wagenbachs Freibeuter aufgefallen. Aus traurigem Anlass habe ich in den vergangenen Tagen ihre kurzen, aber hoch konzentrierten Geschichtsbetrachtungen zur Pädagogik noch einmal durchgesehen und bin dabei auch auf einen Text gestoßen, der mich heute naturgemäß sehr interessiert: Die kleine und die große Pause. Eine Anleitung zum Nichtstun oder: Gibt es Grenzen der pädagogischen Vergesellschaftung? (in: Freibeuter. Vierteljahresschrift f. Kultur u. Politik. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 1987, Heft 33, S. 31-42.) Dass sie bei „Ausflügen in den real existierenden Feminismus“ bereits vor zehn Jahren mit Alice Schwarzers neuem Spießertum im gefälschten Gewand der Aufklärung abgerechnet hat, spricht sehr für die geistige Unabhängigkeit dieser Feministin der ersten Stunde, wenngleich ich skeptisch bin, ob sie bei den betroffenen Akteurinnen damit mehr erreicht hat als die Verurteilung als Ketzerin und Nestbeschmutzerin. (Emma und ihre Schwestern. München: Carl Hanser Verlag, 1999.)
Völlig übersehen hatte ich aber bisher, dass Katharina Rutschky auch Autorin eines ganz außergewöhnlichen Buchs über bellende Zweibeiner ist: Der Stadthund. (Von Menschen an der Leine. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 2001.) Ausnahmsweise zitiere ich hier mal den Klappentext: „Wohl wenige Themen sind so sehr geeignet, die Menschheit in zwei Parteien zu spalten, wie die Frage, ob man in der Großstadt einen Hund halten soll. Katharina Rutschky, streitbare Publizistin aus Berlin, ist bekennende Hundehalterin. Mit ihrem Cockerspaniel namens Kupfer flaniert [!] sie täglich durch die Straßen der Hauptstadt. – Eines der geistreichsten und unterhaltsamsten Tierbücher seit langem! Pflichtlektüre für Hundehasser und Hundeliebhaber!“ Naja, die Hundehasser wird man wohl kaum zur Lektüre verpflichten können, ebensowenig wie die Emma-Abonnentinnen zum Lesen des vorgenannten Buches. Andererseits muss man auch nicht wie ich selbst auf den Hund gekommen sein, um großen Gewinn aus diesen Reflexionen einer langjährigen Stadthundehalterin ziehen zu können, und zwar längst nicht nur über die doch sehr speziellen Fragen der Erziehung, Ernährung und Pflege solcher Vierbeiner.
Im Rahmen meines Flaneurblogs ist besonders das 8. Kapitel, „An einem Tag wie jeder andere“, von Interesse. Hier beschreibt Rutschky, wie sie sich in Begleitung von Kupfer – dessen Vorgänger Nickel heiß – durch die Stadtlandschaft bewegt, welche Begegnungen mit Hunden, Fahrrädern, Hundehaltern und Hundelosen dabei vorkommen, welche Verbote dabei zu befolgen sind – oder auch bewusst übertreten werden können, und was dann passiert. Wer dergleichen nie erlebt hat, bekommt einen guten Eindruck davon, wie das Spazierengehen in Gesellschaft des Tieres nicht nur einen völlig anderen Charakter bekommt, andere Prioritäten gesetzt werden und die Wahrnehmung der Wege sich schärft, wohingegen die Fixierung des Ziels gelegentlich in Vergessenheit gerät. Der Leser bekommt auch eine Ahnung davon, wie sich das Zeitempfinden verändert: „Allmählich wird meine Zeit knapp; wenn man als privilegierter Heimarbeiter nämlich nicht über ein hoch entwickeltes Pflichtgefühl verfügt, kann einen jeder Hund mit seiner unerschöpflichen Lust am Streunen und Herumziehen zum Vertrödeln vieler kostbarer Arbeitszeit animieren. Die vorhin erwähnte Regel […], die besagt, dass der Hund unter allen Umständen einen täglichen Anspruch auf sechzig Minuten Ausgang hat, Erde und Wasser inklusive, dient also auch dem Schutz des Menschen vor Verführung. Ich habe mir angewöhnt, nie ohne Armbanduhr mit Kupfer loszuziehen.“ (Ebd., S. 143 f.) Erde und Wasser inklusive? Das heißt, dieser Cockerspaniel will nicht nur auf Pflaster laufen; und Kupfer liebt es, im Wasser zu tollen.
Die wichtigste Erkenntnis lautet darum: Wenn man seinem Hund Gutes tut, tut man in aller Regel auch sich selbst etwas Gutes! Tierhaltung bringt die Rückkehr zu einem „animalischen Egoismus“ mit sich. Vor unseren beiden letzten Umzügen war zum Beispiel die artgerechte Wohnlage für unsere Lola durchaus ein wesentliches Kriterium bei der Wohnungssuche. Dass wir dennoch bis vor einem halben Jahr keinen Wald in fußläufig erreichbarer Nähe hatten und uns mit einem mickrigen Park begnügen mussten, war ein echtes Manko für unseren Hund, aber auch für uns selbst. Indem wir nun die Interessen unserer Hündin in unsere Erwägungen einbezogen, schlossen wir gewisse Objekte von vornherein aus und fanden so schließlich ein neues Heim, das nicht nur hundgerecht, sondern auch uns Menschentieren überaus gemäß ist.
Welt, Zahl und Bild
Sunday, 17. January 2010Die Empfehlung, man solle keiner Statistik vertrauen, die man nicht selbst gefälscht hat, gilt seit Mitte des vorigen Jahrhunderts als fester Bestandteil des Skeptizismus gegenüber den durch Zahlen scheinbar unbezweifelbar gemachten Tatsachenbehauptungen über unsere unüberschaubar vielfältige und sich dazu noch rasend schnell verändernde Welt. Wer den Satz zuerst gedacht, ausgesprochen oder niedergeschrieben hat, das liegt weiterhin im Dunklen, doch deutet einiges darauf hin, dass er im Duell der Titanen moderner Massenmanipulation geboren wurde: Winston Churchill und Joseph Goebbels hatten im Zweiten Weltkrieg die Aufgabe, die Kampfmoral ihrer jeweiligen Völker durch überzeugende Erfolgszahlen hochzuhalten. Da lag ein solcher Satz zur sardonischen Diskreditierung des Gegners geradezu in der bleihaltigen Luft. Gegenüber statistischen Darstellungen der Wirklichkeit ist jedenfalls ein gesundes Misstrauen grundsätzlich am Platze. Die technischen Möglichkeiten zur Verzerrung der Realität im Interesse einer Beeinflussung des Betrachters sind so vielfältig, wie sie nur sein können, wenn sich der erfindungsreiche Menschengeist vor die Aufgabe gestellt sieht, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Aber ebenso wahr ist, dass das trockene Zahlenwerk plötzlich eine entzückende Inspirationskraft entfalten kann, wenn die Statistiker und Infografiker von der Leine interessengeleiterter Auftraggeber gelassen und nur so, zu „Erbauung und Belehrung“, aber mit Esprit und gutem Willen tätig werden dürfen. Zum Jahreswechsel sind gleich zwei handliche Bücher erschienen, die sich, wenngleich auf sehr unterschiedliche Weise, genau dies zur Aufgabe gemacht haben.
Die Welt in Zahlen 2010 von der Wirtschaftszeitschrift brand eins hat ihren Ursprung in einer ständigen Rubrik des seit zehn Jahren monatlich erscheinenden Magazins. Zwei kleine Schönheitsfehler will ich gleich eingangs monieren, um mich sodann den vielen Vorzügen des Buches zuzuwenden. Schon die Rubrik hat sich einen stilistischen Tick zu eigen gemacht, der nun auch im Buch gehäuft auftritt und einem mit der Zeit ganz gehörig auf den Wecker fallen kann: Bandwurmartige Bezeichnungen der nachfolgenden Zahlenwerte werden in voller Länge wiederholt. Ein Beispiel gefällig? „Durchschnittliche Verweildauer bei der Online-Nutzung in Deutschland im Jahr 1998, in Minuten pro Tag: 77 – Durchschnittliche Verweildauer bei der Online-Nutzung in Deutschland im Jahr 2001, in Minuten pro Tag: 107 – Durchschnittliche Verweildauer bei der Online-Nutzung in Deutschland im Jahr 2008, in Minuten pro Tag: 120.“ (brand eins: Die Welt in Zahlen 2010. Statista. Hamburg: brand eins Verlag, 2009, S. 112.) Muss das sein? Die unnötige Verweildauer beim Lesen dieses doch sonst so interessanten Buches hätte sich durch Vermeidung solcher Mätzchen reduzieren lassen. Der zweite Wermutstropfen ist der Preis von 22 Euro für ein Taschenbuch von 250 Seiten.
Dies waren die beiden Wermutstropfen, nun folgt Ambrosia. Ich hätte nicht gedacht, dass Hunde in der Rangfolge der häufigsten Haustiere erst an dritter Stelle kommen, nämlich nach Katzen und Kleintieren. Auch erstaunt mich, welches die beiden mit Abstand häufigsten Farben neu zugelassener Autos im Jahre 2007 waren, nämlich Grau und Schwarz. Dass auf jeden dritten Deutschen eine zugelassene Handfeuerwaffe kommt, jagt mir einen gehörigen Schrecken ein. Seit ich weiß, welches die bei Frauen häufigste aller Operationsarten in deutschen Krankenhäusern ist, nämlich die Rekonstruktion der Geschlechtsorgane nach Dammriss bei der Geburt, frage ich mich, ob die Ausbildung unserer Hebammen reformbedürftig ist. Dass mir kein einziges der zehn umsatzstärksten verschreibungspflichtigen Medikamente wenigstens dem Namen nach bekannt ist, wundert mich ebenso wie der Umstand, dass auf Platz eins dieser Liste mit Risperdal ein Mittel gegen Psychosen steht. Soll es mich mit Mitleid erfüllen, dass 774 Millionen Menschen auf der Welt dieses Buch allen schon deshalb nicht lesen können, weil sie Analphabeten sind? Oder soll ich sie vielmehr beneiden, weil ihnen damit erspart bleibt, die vielen traurigen, erschreckenden und wütend machenden Zahlen in diesem Buch zur Kenntnis nehmen zu müssen? Übrigens hat auch hierzulande jeder fünfte Schüler mittlerweile Probleme mit dem Lösen einfachster Rechenaufgaben. Nach den vier Kapiteln „Was Wirtschaft treibt“, „Was Unternehmern nützt“, „20 Jahre Wiedervereinigung“ und „Was Menschen bewegt“ folgen als besonderes Schmankerl noch einige Seiten mit Prognosen über „Deutschland 2050“. Da werden ein paar Trends des ersten Jahrzehnts in diesem neuen Jahrtausend für die nächsten vierzig Jahre ohne Rücksicht auf Plausibilität extrapoliert. Demnach hätte zum Beispiel die SPD kein einziges Parteimitglied mehr und die Kinopreise lägen bei 9,44 Euro – die allerdings niemand bezahlen würde, denn die Zahl der Kinobesucher betrüge 0,0 Millionen.
Die große Jahresschau – Alles, was 2010 wichtig ist heißt das zweite Buch zur Lage von Welt und Nation. Auch in diesem Fall haben die Autoren, Matthias Stolz und Ole Häntzschel, ihre ersten Meriten mit einer Zeitschriftenrubrik erworben, mit der „Deutschlandkarte“ im ZEITmagazin. Und auch dieses Buch hat leider eine kleine Macke, es verzichtet auf Seitenzahlen. So muss man der Verlagsankündigung glauben, die uns 240 Seiten verspricht. Oder nachzählen, um bestätigt zu finden, dass das Versprechen gehalten wird. Es freut mich schon, dass das Buch nur 12,95 Euro kostet, geradezu begeistert bin ich aber, dass es – ein Taschenbuch! – fadengeheftet ist. Aber das sind Äußerlichkeiten. Der Content, wie man in Neusprech sagt, ist tatsächlich hinreißend. Im Vorwort erklären die Autoren knapp und deutlich, was sie mit diesem Buch versucht haben: „Das wahre Schmuddelkind journalistischer Texte ist die Infografik. Sie leidet von allen Zutaten, die zur journalistischen Veröffentlichung gehören, unter dem schlechtesten Ruf. […] Wir dachten, es sei Zeit, sie einmal aus ihrem Schattendasein zu befreien. Wetten, auch die Infografik hat eine humorvolle und unterhaltsame Seite?“ (Matthias Stolz / Ole Häntzschel: Die große Jahresschau – Alles, was 2010 wichtig ist. München: Knaur, 2010, S. 6 f.)
Naturgemäß kann ich in spröden Worten die mit den visuellen Möglichkeiten der Infografik virtuos spielende Umsetzung von Statistiken nur sehr unzulänglich beschreiben. Ich muss stattdessen auf eine Leseprobe verweisen, die der Verlag freundlicherweise ins Internet gestellt hat – und auf die Großzügigkeit dieses Verlages vertrauen, der es mir hoffentlich nicht übel nimmt, wenn ich eine besonders schöne Grafik hier als Titelbild verwende. Die zunächst etwas überanstrengt wirkende These, dass der sonntägliche Kirchgang in den letzten Jahrzehnten vom Schlachtenbummel auf den Fußballplatz abgelöst wurde, ist wohl noch nie so überzeugend (und dabei tatsächlich auch humorvoll) veranschaulicht worden. Ich bin bekanntlich weder dem einen noch dem anderen Ritual verfallen. Beten und jubeln sind mir gleichermaßen fremd. Aber ich bin noch längst nicht fertig mit der Frage, warum um Himmels Willen eine so schnelle Trendwende von der Kontemplation in die Exaltation erfolgen konnte.
[Titelbild aus dem zuletzt besprochenen Buch, S. 24/25: „Kirche gegen Bundesliga“. – © Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München.]
Antiquariat (I)
Saturday, 02. January 2010Noch eine Neuigkeit fürs neue Jahr ist bekannt zu machen: Seit dem 1. Januar 2010 bin ich Inhaber eines Gewerbebetriebs, da ich zu diesem Termin am 14. Dezember 2009 bei der Gewerbemeldestelle im 17. Obergeschoss des Essener Rathauses ein Gewerbe nach § 14 GewO angemeldet und die hierfür fällige Gebühr in Höhe von 20,00 € entrichtet habe. Die angemeldete Tätigkeit ist „Einzelhandel mit antiquarischen Büchern über das Internet“.
Für dieses neue Tätigkeitsfeld muss ich hier eine Kategorie nicht eigens anlegen, ich setze fort, was ich zaghaft schon unter „Bibliotheca Curiosa“ begonnen habe. Indem ich mich öffentlich von meinen Büchern trenne, lasse ich ihnen zum Abschied allerletzte Gerechtigkeit widerfahren.
Eben habe ich die „Bekenntnisse eines Bibliomanen“ gelesen, in denen ich mich vielfach spiegeln konnte, wenngleich ich nicht in allen Punkten mit ihrem Autor übereinstimme. Auch der Totalausverkauf von Privatbibliotheken wird thematisiert: „Gelegentlich kommt es vor, dass ein Bibliomane beschließt, all seine Bücher zu verkaufen. [Christian] Galantaris erwähnt [1998 in seinem Manuel du bibliophile] zwei Fälle von Bibliomanen, die ihre Bücher bei der von ihnen selbst organisierten Versteigerung wie unter Zwang zu hohen Preisen zurückkauften: Graf von Bédoyère und Baron Jérome Pichon. Letzterer verbrachte die letzten siebzehn Jahre seines Lebens damit, jene Bücher aufzuspüren und zurückzukaufen, die ihm am Tag der Versteigerung trotz aller Bemühungen abhanden gekommen waren.“ (Jacques Bonnet: Meine vielseitigen Geliebten. A. d. Frz. v. Elisabeth Liebl. München: Droemer Verlag, 2009, S. 141.) Ich bin dennoch zuversichtlich, dass ich mich von vier Fünfteln meines Bestandes trennen kann, ohne einen wirklichen Verlust zu empfinden. Und wenn ich tatsächlich ausnahmsweise einmal bereuen sollte, mich von einem Buch getrennt zu haben, so dürfte es dank ZVAB in aller Regel ohne große Umstände und Kosten wiederzubeschaffen sein.
Bonnet zitiert auch einen Ausspruch von Jules Janin (1804-1874): „Wer in einer einzigen Stunde alle Leiden dieser Welt erfahren möchte, muss nur eines tun: seine Bücher verkaufen.“ Ich kannte bisher nur jenen ganz ähnlichen Satz, den Alexander von Humboldt (1769-1859) zu Protokoll gegeben haben soll: „Wer die Qualen der Hölle schon auf Erden kennen lernen will: der verkaufe seine Bibliothek!“ (Arno Schmidt: Müller oder vom Gehirntier; in: Tina oder über die Unsterblichkeit. Frankfurt am Main u. Hamburg: Fischer Bücherei, 1966, S. 55.)
Doch auch dieses Menetekel kann mich nicht erschrecken. Erstens will ich ja nicht meine ganze Bibliothek verkaufen, sondern nur einen – wenngleich erheblichen – Teil. Dieser Abbau hinterlässt keine Ruine, sondern sorgt im Gegenteil dafür, dass der zentrale Prunkbau freigelegt wird, um in seiner ungetrübten Pracht nur desto herrlicher erstrahlen zu können. Und zweitens soll diese große Veräußerung ja Schritt für Schritt dokumentiert werden. Nein, ein Bibliomane bin ich wohl bei aller Sammelwut doch nicht. Allerdings stelle ich mir vor, einen Teil des Verkaufserlöses in Zukäufe zu reinvestieren. Und ich kann nicht leugnen, dass es die Aussicht auf den Zukauf echter Desiderata meiner Sammlung ist, der mich am stärksten zu diesem Geschäft motiviert.
[Fortsetzung: Antiquariat (II).]
Blutregen
Thursday, 08. October 2009Gestern habe ich tatsächlich die allerletzten Bücherkisten ausgepackt und ihren Inhalt in die Lagerregale verfüllt. Ja, dieser Ausdruck, wie aus einer Großmolkerei mit Massentierhaltung, passt ganz gut zu der viehischen Plackerei, der ich mich in den vergangenen Tagen ausgesetzt sah.
Viele Male musste ich mir Gewalt antun, wenn ein Buch meine Aufmerksamkeit erheischte, das ich schon seit Jahren nicht mehr in Händen gehalten und gar schon nahzu vergessen hatte. Nur zu gern hätte ich der Zeit nachgesonnen, als ich es für meine Bibliothek erwählte, den Gründen auf der Spur, die es für mich eingenommen hatten; zu gern hätte ich mir die Frage gestellt, ob ich es gelesen und mit welchem Ergebnis aus der Hand gelegt haben mochte. Aber der unbarmherzige Scherge, den ich mir selbst in den Nacken gesetzt hatte, ließ keinen Müßiggang zu. Hier galt es einzig und allein zu prüfen, ob der Platz auf den Brettern für das in den Kisten reichen würde. Also rief er mir ein ums andere Mal sein Kommando ins Gewissen, wenn ich in Nachdenklichkeit zu versinken drohte: ,Weiter, weiter! Auspacken, einräumen! Zum Träumen ist später noch Zeit genug.‘
Wie Schneeflocken tanzten die Bücher vor mir im Neonlicht des Archivs. Die Masse, die ich zwar geahnt hatte, überwältigte mich dann doch. Das war zweifellos nicht mehr gesund. So viele Bücher! Wie hatte ich es nur so weit kommen lassen können? Als mein zweiter Sohn die letzte Sackkarrenladung abgesetzt hatte, meinte er in seiner unnachahmlich trockenen Art: „Nun habe ich aber fürs Erste wirklich genug von deinen Büchern, Vater.“ Dieser Überdruss war ihm und allen anderen, die mir in den letzten Wochen und Monaten wissentlich oder unfreiwillig geholfen hatten, meine Bibliothek erstmals seit vielen Jahren wieder an einem Orte zusammenzuführen, wahrlich nicht zu verdenken. Ich danke euch von Herzen …
In der vergangenen Nacht träumte ich, dass ich aus dem Fenster eines Sanatoriums in eine dunkle Winterlandschaft hinausspähte, weil ich jemanden erwartete, der mich hier besuchen wollte. Es schneite auch in diesem Traum, aber die Schneeflocken waren blutrot. Das wunderte mich zwar nicht weiter, aber ich machte mir Sorgen, mein Besucher könnte sich auf seiner Wanderschaft die Kleidung ruinieren.
(Übrigens vermisse ich jetzt, obwohl ich wirklich alle Kisten ausgepackt habe, immer noch einige Bücher, die ich bei dieser Herkulestat fest gehofft hatte endlich wiederzufinden.)
An Land
Monday, 28. September 2009Jetzt, da ich tatsächlich schneller als gedacht eine angemessene Unterbringungsmöglichkeit für den größten Teil meiner Bibliothek aufgetan habe, bin ich auf eine Weise wunschlos glücklich, die mich schon wieder misstrauisch macht.
Ich dosiere die Aufenthaltszeiten in meinem neuen Refugium streng, als wollte ich dem Risiko vorbeugen, einer Überdosis zum Opfer zu fallen. Immerhin habe ich nun alles ausgepackt, was noch in den „Bücherkatakomben“ der vorigen Wohnung lagerte. Im nächsten Schritt gilt es, die ca. 65 Kisten aus der K.-Anstalt bei Freund R. heranzuschaffen, doch das hat keine Eile. (Obzwar: Ich brenne drauf!)
Noch reichen ja auch glücklicherweise die Geldmittel, billige Regale anzuschaffen usw. So wird es mir gelingen, zum ersten Mal seit unvordenklichen Zeiten tatsächlich all mein Papier geordnet aufzustellen und greifbar zu haben, ohne quälende Sucherei, die dann doch in der Hälfte der Fälle in ein schmerzvolles Nichtfinden mündet.
Fast ist der Gegensatz zu heftig: zwischen einerseits dem noch vor wenigen Wochen durchlittenen Hundeelend, als ich gewärtigen musste, auf Jahre und Jahre vom größten Teil meiner Schätze und Schätzchen getrennt zu sein, sie zudem eher schlecht als recht untergebracht zu wissen, allen Gefahren ausgesetzt, die mit der Zeit aus Büchern Altpapier werden lassen; und andererseits dem Glück, wie oben angedeutet und ansonsten kaum beschreiblich.
Nun klammere ich mich geradezu an die paar vom Umzug noch verbliebenen Pflichtaufgaben, lästige Trivialitäten wie die endgültige Entrümpelung der „Katakomben“, die bis zum Ende des Monats über die Bühne gegangen sein muss. Das ist das trockene Brot, das jemand hinabwürgt, damit ihm der köstliche Wein nicht zu sehr zu Kopfe steigt.
Exlibris
Monday, 24. August 2009Zukünftig werde ich mich von einem beträchtlichen Teil meiner nicht unbeträchtlich umfänglichen Bibliothek trennen müssen, aus Gründen der Lagerkosten und -umstände, der Zweckmäßigkeit, der Anpassung meiner Arbeitsmittel an meine Arbeitsbedürfnisse und weil ich mich nun ganz bewusst auf eine Lebensphase einlasse, die zu vernünftiger Selbstbescheidung, maßvollem Rückzug und Konzentration auf das Wichtigste zwingt.
Auf diese bevorstehende Auflösung meiner Büchersammlung freue ich mich schon deshalb, weil ich dabei endlich die Gelegenheit finden werde, jedes einzelne meiner vielen Bücher noch einmal in die Hand zu nehmen, mich an die Gründe und Wege zu erinnern, die es in meinen Besitz geführt haben; an die Motive, die mich zu seiner Anschaffung ermunterten; oder an die Zufälle, die es mir scheinbar absichtslos in die Hände spielten.
Bietet man heute, in dieser immer illiterater, ja bibliophober werdenden Zeit, auf dem Antiquariatsmarkt Bücher an, dann hat man üblicherweise desto bessere Chancen, sie loszuwerden, je jungfräulicher, sauberer, unbeschädigter sie sich erhalten haben. „Wie neu” ist die beste Reklame für ein altes Buch, und je älter es tatsächlich ist, desto mehr wird es durch seine äußerliche Frische und Unversehrtheit aufgewertet.
Dabei gab sich doch zu allen Zeiten der wahre Liebhaber antiquarischer Bücher dadurch zu erkennen, dass er die individuellen Spuren, die ihre Vorbesitzer in ihnen hinterlassen hatten, als das Salz in der Suppe seiner Sammelei schätzte. Besitzvermerke, Widmungen, Anstreichungen und Marginalien, beigefügte Zeitungsartikel, eingeklebte Buchhändlerzeichen und manch andere Hinterlassenschaften machten und machen das Massenprodukt Buch ja gerade erst zu einem unverwechselbaren Einzelstück.
So spiele ich tatsächlich mit dem Gedanken, jedes einzelne Buch, das meine Bibliothek verlässt, mit meinem Exlibris zu versehen, selbst wenn dies von manchem unkundigen Käufer zunächst als wertmindernd empfunden werden sollte oder ihn gar vom Kauf abhält. Vielleicht erweist sich ja aber nach Jahren oder Jahrhunderten einmal, dass Bücher mit diesem Zeichen ein ganz eigenes Wesen haben und unter ihnen allen ein geheimes Band besteht, das sie irgendwann wieder zusammenführen wird.
[Das Titelbild zeigt das Exlibris des Verfassers nach einem Holzschnitt von Otto Mueller.]
Der kleine Stowasser
Thursday, 12. March 2009Manche Autoren und Herausgeber waren mit ihren Nachschlagewerken so erfolgreich, dass ihr Familienname mit den Jahren zum Markenzeichen geworden ist und in seltenen Fällen gar für eine ganze Gattung steht. So steht Baedeker geradezu als Synonym für Reiseführer, Brockhaus für Lexika, Duden für deutsche Wörterbücher, Diercke für den Schulatlas – oder eben der Stowasser fürs Schulwörterbuch im Fach Latein. Erstmals im Jahre 1894 von dem Wiener Gymnasiallehrer Joseph Maria Stowasser in den Verlagen von Georg Freytag (Leipzig) und Friedrich Tempsky (Prag und Wien) herausgegeben, erschien es seither in regelmäßigen Neubearbeitungen als das Standardwerk seiner Art. So ist der Kleine Stowasser bis heute jedem „alten Lateiner” und jedem jungen Pennäler ein Begriff und nach wie vor auf dem Weg zum Großen Latinum ein stets zuverlässiger Begleiter.
Habe ich da nicht einen schönen Werbetext zusammenfabuliert? Dabei bedürfen Bücher wie die zuletzt genannten ja gar keiner Reklame. Ihre Anschaffung wird den Schülern traditionell zwangsweise auferlegt, und Bücher, die man erwerben muss, sind in aller Regel selbst dann unbeliebt, wenn die Kosten dank Lernmittelfreiheit der Staat übernimmt. Zudem war das Erlernen einer „toten” Sprache wie Latein noch nie sonderlich populär. Und wenn ich mir mein Exemplar des Kleinen Stowasser aus dem Jahr 1968 ansehe, so war dieses Buch schon rein äußerlich kaum dazu angetan, die Abneigung gegen dieses schrecklich verstaubte Schulfach zu mildern. Die deutschen Wörter waren damals noch in Fraktur gesetzt, um sie von den lateinischen deutlich abzuheben. Was für die Schüler vor dem Zweiten Weltkrieg eine Erleichterung bei der Handhabung des Wörterverzeichnisses gewesen sein mag, war für uns eine zusätzliche Schikane, denn diese sonderbare Druckschrift, bei der man zum Beispiel z und g leicht verwechseln konnte und es zwei verschiedene s gab, von denen das eine wie f aussah, las man sonst nirgendwo mehr.
Seit Ende der 1970er-Jahre setzte sich dann sogar in diesem altehrwürdigen Schulbuchverlag allmählich ein fortschrittlicher Geist durch. Unter der Gesamtredaktion von Hubert Reitterer und Wilfried Winkler erschien 1979 ein völlig neu bearbeiteter Kleiner Stowasser, erstmals ohne Frakturschrift. (Seither sind lateinische Wörter im Stowasser in Antiqua und deutsche in Grotesk gesetzt.) Und weitere 15 Jahre später hatte sogar ein kreativer Kopf in der Werbeabteilung des Verlags den originellen Einfall, den österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser (1928-2000), einen entfernten Verwandten des Altphilologen Stowasser, mit der Gestaltung des Einbandes [s. Titelbild] zu beauftragen, nachdem das kauzige Multitalent schon 1989 durch eine Sonderausgabe der Brockhaus-Enzyklopädie als Buchkünstler hervorgetreten war. (Seinen Künstlernamen leitete Hundertwasser vom russischen Wort sto ab, das „hundert” bedeutet.)
Ich beneide die heutigen Schüler um dieses wunderschöne Wörterbuch, in dem ich stundenlang blättern und schmökern könnte, allein schon, weil es mir Spaß macht, versteckte Wurzeln nur scheinbar ursprünglich deutscher Wörter im Lateinischen zu entdecken. Ich bin mit einem mittelprächtigen Kleinen Latinum vom Gymnasium abgegangen und daher heute leider nicht in der Lage, die Oden des Horaz im Original zu lesen. Aber obwohl ich das deutsche Sprichwort vom Hans kenne, der nimmermehr lernt, was er als Hänschen nicht gelernt hat, will ich mich mit meinen zahlreichen Bildungsbeschränkungen nicht abfinden. Mein jüngster Sohn hat Nachhilfe in Latein nötig. Mal sehen, wie weit ich ihm helfen kann.
Stowasser. Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch von J. M. Stowasser, M. Petschenig u. F. Skutsch. Gesamtredaktion: Fritz Lošek. München: Oldenbourg Schulbuchverlag, 2006. – XXXIV & 574 S., 17,0 x 24,0 cm, Leinwand, Fadenheftung. – Originalpreis: 24,95 €.
Gitta Sereny: Am Abgrund
Tuesday, 10. March 2009Seit langer Zeit schon hat mich kein Buch mehr so aus der Bahn geworfen wie dieses. Ich mag es eigentlich niemandem zur Lektüre empfehlen; die Verantwortung für die Spuren, die sie hinterlässt, möchte ich nicht tragen. Aber noch mehr belastet mich die Vorstellung, dass dieses Buch auf Leser treffen könnte, die ihm mit Gleichgültigkeit begegnen. Schließlich weiß ich, welche Formen seelischer Verarmung möglich sind, welche Fälle von Abstumpfung unbehandelt vor sich hin vegetieren. Übrigens ist schon die Editionsgeschichte dieses Buches geeignet zu verstören. Nach seinem Erscheinen im englischen Original vergingen mehr als sechs Jahre, bis es auch in einer deutschsprachigen Fassung vorlag – nachdem es, wie die Autorin in ihrer Danksagung eingangs lakonisch bemerkt, „bereits in allen anderen westlichen Sprachen veröffentlicht” worden war. Gitta Sereny, Tochter eines Ungarn und einer Deutschen, hatte zwar ihre Kindheit und frühe Jugend in Wien verbracht, lebte aber seit mehr als vier Jahrzehnten nicht mehr im deutschen Sprachraum. Der Ullstein-Verlag hätte gut daran getan, Into That Darkness von einem professionellen Übersetzer ins Deutsche übertragen zu lassen, statt diese Aufgabe der Autorin zu überlassen. So gibt es manche Holprigkeiten in der deutschen Erstausgabe von 1979. Für die überarbeitete Neuausgabe beim Piper-Verlag, aus dem Jahr 1995, wurde Helmut Röhrling als Übersetzer gewonnen. Beide Ausgaben sind seit vielen Jahren vergriffen und auch antiquarisch nicht immer leicht zu beschaffen.
Ausgangspunkt von Serenys „Gewissensforschung”, wie sie das Buch im Untertitel nennt, ist die Lebensgeschichte des Kommandanten der Vernichtungslager Sobibor und Treblinka, Franz Stangl (1908-1971). Sie hatte im April und Juli 1971 Gelegenheit, mit Stangl in Düsseldorf zahlreiche Gespräche zu führen, wo dieser in Untersuchungshaft saß und auf das Ergebnis seiner Revision gegen das Urteil wartete, das über ihn verhängt worden war: lebenslange Haft wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes an mindestens 400.000 Juden. Zudem hat sie viele weitere Gespräche mit Zeitzeugen, Opfern und Tätern und deren Angehörigen geführt. Sie hat die Orte des grauenvollen Geschehens in Polen aufgesucht und umfangreiches Quellenstudium betrieben. Es ist, bei allem Unglück, das wie Pech an diesem Thema klebt, doch ein seltener Glücksfall, fast so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit, dass dieser infernalische Stoff in Gitta Sereny seine gleichermaßen akribische wie sensible Meisterin gefunden hat.
Der Sommer 1943 hätte so schön sein können, auch in dem kleinen Dorf Treblinka im Osten Polens. „Aber Sie müssen sich einmal vorstellen, was es für uns bedeutete, hier zu leben.” Der darum bittet, ist Francizek Zabecki, zur Zeit des Gesprächs 65 Jahre alt, früher Mitglied der polnischen Untergrundarmee und Vorsteher des Ortsbahnhofs von Treblinka. „Jeden Tag, ganz früh am Morgen diese Stunden des Entsetzens, wenn die Züge ankamen, und die ganze Zeit – schon nach den ersten Tagen – dieser Geruch – diese dunkle neblige Wolke, die über uns hing, die den Himmel in diesem heißen und schönen Sommer bedeckte, sogar an den herrlichsten Tagen – nicht eine Regenwolke, die Erlösung von der Hitze versprach, sondern eine schweflige Dunkelheit, die diesen pestartigen Gestank in sich trug. – Ganz zu Anfang gab es eine Periode, während der meine Frau überhaupt nichts mehr tun konnte. Sie konnte den Haushalt nicht mehr versorgen, sie konnte nicht kochen, sie konnte nicht mit den Jungen spielen, sie konnte nicht essen und kaum schlafen. Sie hatte eine Art völligen Nervenzusammenbruch. Als ich Kriegsgefangener gewesen war, war sie zurechtgekommen, aber jetzt war sie völlig zusammengebrochen. Dieser extreme Zustand, in dem sie sich befand, dauerte etwa drei Wochen. Dann wurde sie fast pathologisch teilnahmslos: Sie tat ihre Arbeit, bewegte sich, aß, schlief, sprach … aber alles wie ein Automat …” (S. 162 f.)
Ganz willkürlich habe ich diese kleine Textprobe herausgegriffen, weil ich sie eben erst gelesen habe und nun das Bild von Pan Zabeckis leidender Frau in mir herumgespenstert, wie in den vergangenen Tagen viele ähnlich starke Bilder mit mir ihr Unwesen trieben, mich vor sich herscheuchten, mir an die Gurgel gingen und meine Träume verseuchten. (Ich habe zum ersten Mal, soweit ich mich erinnere, im Traum etwas gerochen.) Warum tue ich es mir an, in diesen Abgrund hinabzusteigen? Weil es ja unvermeidlich ist, wenn ich die Wahrheit unseres gegenwärtigen Zustands nicht umgehen will, eines Zustands, der immer einer nach diesen Ereignissen sein wird, auch als eine Folge davon. Machen wir uns nichts vor, es kann sich immer wiederholen, wenn wir es nicht in Schach halten. Dieses Buch sollte stets lieferbar sein.
Gitta Sereny: Am Abgrund. Eine Gewissenserforschung. Gespräche mit Franz Stangl, Kommandant von Treblinka, und anderen. Frankfurt/M, Berlin, Wien: Ullstein Verlag, 1979. – 416 S., 2 Lagepläne u. 15 Fotografien, 11,8 x 17,8 cm, kartoniert. – ‚Ullstein Sachbuch‘, Nr. 34024. – Originalpreis 12,80 DM.