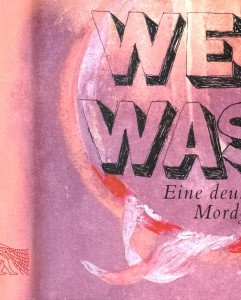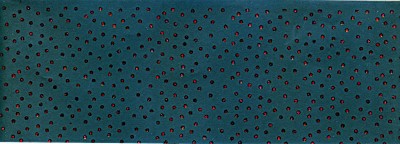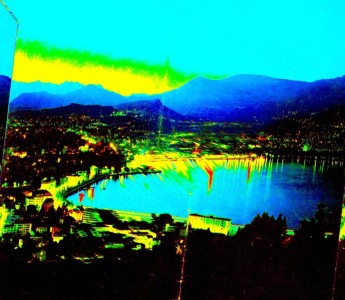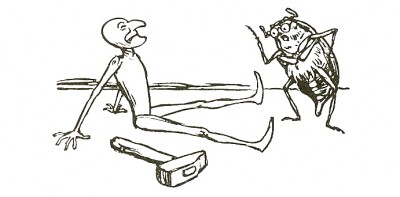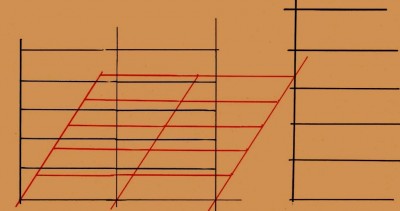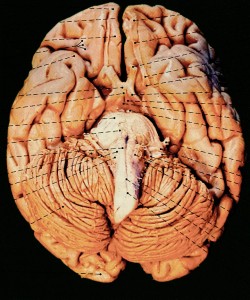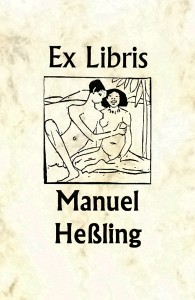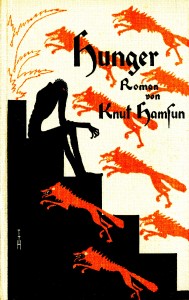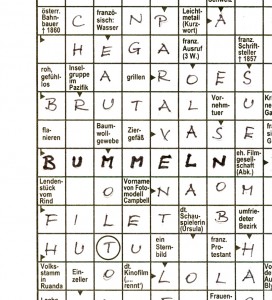Author Archive
Saturday, 21. November 2009

Erst nach Beendigung meines Wer–Weiß–Was–Lektüreberichts entdeckte ich das Interview, das Silvia Bovenschen dem womöglich momentan gewieftesten Literaturpropagandisten unterm Tarnkäppchen der Kritik in Feuilleton, Funk und Fernsehen, Denis Scheck (* 1964), auf der Frankfurter Buchmesse gewährt hat und das man nun in voller Länge online anhören, -sehen und -staunen kann.
Zu Beginn gleich ein Gutes, was über dieses Gespräch zu sagen ist: Es ist lang! Das ist insofern erfreulich, weil es den nötigen Raum lässt für allerlei Randständiges, das nicht unmittelbar und schnurgerade auf die Frage abzielt, ob sich die Neunzehneurofünfundneunzig für das vorgestellte Buch denn nun lohnen oder nicht. Und gerade diese Nebensächlichkeiten an der Peripherie sind die unerwarteten Tinten- oder meinetwegen – schließlich geht es ja um einen Krimi – Blutkleckse, die das zuvor gemachte Bild vom Buch und mehr noch von seiner Autorin um ein paar überraschende Akzente bereichern. Gerade auf der Buchmesse werden ja unzählbare, unerträgliche, unnötige Un-Gespräche geführt, zwei- bis vierminütige Small Talks, die im ganz wörtlichen Sinne im Vorbeigehen entstanden sind, aber auch insofern, als sie nur ein Aneinandervorbeireden dokumentieren, im Rhythmus eines gut gelaunten, scharf beschleunigten Aneinandervorbeifragens und -antwortens.
Hier aber findet die Autorin fast eine halbe Stunde lang Zeit und Gelegenheit, etwas über das Interieur ihres Elternhauses zu erzählen, über grottenschlechte Impressionisten an den Wänden und über die unterschiedlichen Bücherstapel auf den Nachttischen von Mama und Papa Bovenschen, hie Proust und Daphne du Maurier traulich vereint, dort zwei Stapel über die Kunst der Hethiter [s. Titelbild], worin sie die katholische und die protestantische Variante des Bildungsbürgertums repräsentiert sieht; und schließlich findet sie Zeit zu einer längeren declaration of human faults, die ich gern einmal als kleine Kostprobe in ganzer Länge wiedergeben will.
Scheck hatte gefragt, ob wir wirklich so dämlich und beschränkt seien wie die Menschen in Bovenschens Roman, wofür sie dort von den vier Außerirdischen zu Recht verworfen werden, worauf die Autorin erwidert: „Na ja, wenn ich mir das so anschaue, was in einigen Weltgegenden und zuweilen auch bei uns so passiert, denke ich, mit dieser Gattung kann nicht sonderlich viel los sein, und dann kommt es mir auch so vor, als wären wir eher so eine ,Panne der Evolution‘ als die ,Krönung‘ irgendeiner ,Schöpfung‘ … und ich denke, diese Schwärze ist auch in mir. Also, ich will das nicht leugnen: Ich habe die pessimistischsten Annahmen über die Natur des Menschen. – Aber ich habe natürlich auch … ich habe eine Liebe zu vielen Dingen, ich habe eine Liebe zu vielen Menschen, ich finde, dass es so etwas gibt wie Schönheit. Und das besteht unversöhnt in mir, nebeneinander, ich will da auch nichts versöhnen, und vielleicht geht all mein Schreiben darauf hinaus, und das literarische Schreiben gönnt mir im Unterschied zum theoretischen oder essayistischen die Möglichkeit, das nebeneinanderher laufen zu lassen, also da nicht ,einerseits – andererseits‘ sagen zu müssen oder ,dialektischerweise‘ oder irgendsowas, ja? Sondern ich kann das nebeneinander hart stellen, und dann kann sich jeder das heraussuchen, wozu er neigt. Also ich kann das in mir nicht versöhnen – das ist eine private Antwort, die ich ihnen da gerne gebe – und will es inzwischen auch nicht mehr in mir versöhnen.“ (Denis Scheck: Interview mit Silvia Bovenschen vom 16. Oktober 2009 © ARD.)
Ganz werde ich den Verdacht nicht los, als sei diese Melancholie, die hier beschrieben ist, schon dem Kind Silvia Bovenschen einverleibt gewesen. Über dieses, so Bovenschen wörtlich, „eklige“ Kind sagt sie rückblickend einen Satz, der in seiner Unbarmherzigkeit kaum zu überbieten ist und der im angeregten Geplaudere über ein anregendes Buch am Rande einer maßlosen Messe wohl unterging, weshalb ich ihn hier für die Ewigkeit retten möchte. Sie sagt den Satz: „Ich hätte mich nicht gehabt haben mögen.“
[Titelbild von Noumenon v. 13. Juli 2007: “A rather close up photograph of Eflatunpinar’s main part. Eflatunpinar is a Hittite site found in modern Beyşehir district of Konya/Turkey.” GNU Free Documentation License.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Unversöhnt
Wednesday, 18. November 2009

Mein liebstes Nachschlagewerk zum Allgemeinwissen, die gemeinnützige Wikipedia, sammelt wieder einmal Spenden. Wer dem Aufruf folgt, darf auch gern einen Kommentar hinterlassen: „Haben Sie einen Gedanken, den Sie der Welt mitteilen möchten? Sie können bis zu 200 Zeichen eingeben.“ Wikimedia Deutschland freut sich über Spenden in jeder Höhe, die Beträge von 25, 50, 75 und 100 € sind voreingestellt, es darf aber auch gern ein bisschen mehr sein.
Schaut man sich die Kommentarliste im Spendenticker etwas genauer an, dann stolpert man immer wieder einmal über einen vermeintlichen Knauser, der gerade eben 1 € locker macht. Tatsächlich dient diese eher symbolische „Spende“ aber nur als Eintrittsgeld für jene kritischen Zeitgenossen, die die Gelegenheit nutzen, ihren Frust über die gegenwärtige Entwicklung bei Wikipedia abzuladen. So schreibt heute ein anonymer Spender, es gehe dort neuerdings zu „wie bei Aschenputtel: Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Relevanz bei Wikipedia, Platz für Irrelevanz bei Wiki-Waste.“
Wiki-Waste? Diese streitbare Website im Wiki-Format versteht sich als eine Art Schrottplatz für alles, was aus der deutschsprachigen Wikipedia rausgeschmissen wurde. Gut, das klingt zunächst in meinen Ohren sympathisch, bin ich doch jeder Verschrobenheit und Fliegenbeinzählerei gegenüber prinzipiell aufgeschlossen. Allerdings hat mir die Wikipedia gegenüber den meist bierernsten Print-Enzyklopädien gerade deshalb imponiert, weil sie eben auch abgelegenste Forschungsgegenstände respektiert und zudem ein weites Herz hat für jede Art von Scherz, Satire und Ironie, vorausgesetzt, dass eine tiefere Bedeutung dabei nicht ganz aus dem Blick gerät. So findet sich dort selbstverständlich ein ausführlicher Artikel über die putzigen Nasenschreitlinge (lat. Rhinogradentia), und wer nach der berühmten Steinlaus (lat. Petrophaga loriori) sucht, beißt ebenfalls nicht auf Granit. Um was für Artikel handelt es sich nun aber, die nach dem Urteil der empörten Streiter wider die Zensur bei Wikipedia vor die Tür gesetzt wurden? Wer das unbedingt wissen will, der wird nun bei Wiki-Waste fündig. Ob er dort glücklich wird oder wenigstens fröhlich, das möchte ich allerdings bezweifeln.
Ein paar Kostproben gefällig? Dem Rotstift zum Opfer fiel beispielsweise der Artikel über das „Pallindrom“, einfach deshalb, weil es sich „Palindrom“ schreibt, da beißt nun mal keine Steinlaus den Faden von ab. Kymbrisch ist eine Sprache? Nein, aber Kymrisch ist eine Sprache. Interessanter wird’s schon, wenn ansonsten unbekannte Personen oder Körperschaften durch einen beauftragten oder selbst erstellten Wikipedia-Artikel auf sich aufmerksam zu machen versuchen, aus Eitelkeit oder Geschäftsinteresse Popularität vortäuschen oder erlangen wollen oder gar sich selbst oder ihre Produkte auf diesem Wege kostenlos zu bewerben trachten. Eine ganze Reihe von gelöschten Beiträgen in Wiki-Waste riecht verdächtig nach dieser Sorte Schleichwerbung, z. B. die über Zenvo Automotive, den „Tapgitarristen“ Mathias Sorof oder den Engelberger Klosterbrotverfeinerer Heinrich Hess, dessen Nachfahren meinetwegen emsige Genealogen sein mögen, aber wen juckt’s?
Ins Straucheln komme ich aber mit meinen Vorbehalten gegen den Eifer der Wikiwastianer, wenn ich einen so rührend emsigen Artikel wie den über Akashlina lese. Der Autor ist erkennbar kompetent und der behandelte Gegenstand kann bei der Fülle der Belegstellen unmöglich gänzlich irrelevat sein. So wird sich doch wohl in Dreiteufelsnamen jemand finden, der den Text und auch das Gedicht von [s. Titelbild] Jibanananda Das (1899-1954) in verständliches Deutsch überträgt, oder?
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Tuesday, 17. November 2009

Worüber ich einmal gebloggt habe, das vergesse ich so schnell nicht. Vor ein paar Tagen tauchte der Name der kubanischen Bloggerin Yoani Sánchez (* 1975) wieder in den Medien auf (vgl. Peter Burghardt: Neue Angst. Kubas berühmteste Bloggerin wird entführt, beleidigt, geschlagen; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 262 v. 13. November 2009, S. 15). Im Mai vorigen Jahres hatte ich über Sánchez berichtet, weil sie vom US-amerikanischen TIME magazine auf seine „Liste der 100 einflussreichsten Leute der Welt“ gesetzt worden war.
Das Castro-Regime macht der couragierten Kritikerin im eigenen Lande nach wie vor mit allen Mitteln das Leben schwer. Neulich beschrieb sie in einem Interview, welche Mühen es sie kostet, überhaupt einen Beitrag in ihrem eigenen Blog zu publizieren: „Grundlegend ist, dass ich wegen der langsamen Internet-Verbindungen auf Kuba vor allem offline arbeite. Weil ich zu Hause legal keinen Internet-Zugang haben darf, schreibe ich Texte auf meinem PC, speichere sie auf einem USB-Stick und stelle sie dann in einem der öffentlich zugänglichen Internet-Cafés online – und das möglichst schnell, weil es für mich ziemlich teuer ist. Am Anfang konnte ich den Blog noch selbst verwalten. Ende März vergangenen Jahres wurden von der Regierung aber Filter installiert, die das unmöglich machten.“ (Ole Schulz: „Die Revolution ist gestorben“. Interview mit Yoani Sánchez; in: Focus Nr. 14 / 2009 und online.)
Vor ihrem Haus treiben sich immer wieder finstere Gestalten herum, die sie einschüchtern wollen. Am Freitag, dem 6. November 2009 kam es nun zu einem massiven Übergriff, bei dem Sánchez um ihr Leben fürchtete. Unbekannte Täter wollten sie daran hindern, an einer Anti-Gewalt-Demonstration teilzunemen, die an diesem Tag in Havanna stattfand. Sie zerrten sie und ihren Begleiter Orlando Luis Pardo in ein Auto. Was dort geschah, beschreibt das Entführungsopfer auf ihrem Blog so: „Im Auto war schon Orlando, unbeweglich gemacht durch einen Karategriff, der ihn mit dem Kopf am Boden festhielt. Einer setzte sein Knie auf meine Brust, der andere schlug mir vom Vordersitz aus in die Nierengegend und auf den Kopf, damit ich den Mund öffnete und das Papier freigäbe. In einem Augenblick hatte ich den Eindruck, ich würde nie mehr aus jenem Auto herauskommen. ,Bis hierher haben wir es dir durchgehen lassen, Yoani. Jetzt ist Schluss mit deinen Mätzchen,‘ sagte der, der neben dem Fahrer saß, wobei er meinen Kopf an den Haaren hochzog. Auf dem Rücksitz lief ein seltsames Schauspiel ab: Meine Beine nach oben gestreckt, mein Gesicht gerötet vom Blutdruck und am ganzen Körper Schmerzen, auf der anderen Seite befand sich Orlando, in Schach gehalten von einem professionellen Schläger. In einem Akt der Verzweiflung schaffte ich es, diesen Mann durch seine Hose hindurch an den Hoden zu packen. Ich krallte meine Nägel hinein, da ich glaubte, er würde meine Brust bis zum letzten Seufzer abquetschen. ,Bring mich schon um‘ rief ich ihm zu, mit dem letzten Atemzug, der mir blieb, und derjenige, der vorne mitfuhr, riet dem Jüngeren: ,Lass sie atmen!‘“ (Nach der deutschen Übersetzung von Iris Wißmüller aus Yoani Sánchez‘ Blog Generation Y.)
Schließlich wurden beide mit körperlichen und seelischen Verletzungen wieder freigelassen. Offenbar hat die internationale Popularität der Freiheitskämpferin die Auftraggeber dieses Kidnappings dann doch vor der letzten Konsequenz zurückschrecken lassen.
Der Mut und die unverbrüchliche Treue zu den eigenen Überzeugungen, die mit wachsendem Druck von außen eher noch erstarken, müssen das Herz jedes freiheitsliebenden Menschen erfreuen. Kaum war der erste Schreck überwunden, da meldete sich Yoani Sánchez im Web zurück. Und wieder applaudierten ihre zahllosen anonymen Sypathisanten in Kuba und aus aller Welt in den Kommentaren des Internet, machten ihr Mut und feuerten sie an. Dieser Aufstand begeistert nicht nur durch seine Gewaltfreiheit, sondern auch durch seinen Humor. Im Handumdrehen wurde das Verbrechen in einem Comic dargestellt; und der Lebensgefährte der Bloggerin, der Journalist Reinaldo Escobar (* 1947), fordert einen mutmaßlichen Agenten des kubanischen Staatssicherheitsdiensten namens „Rodney“ [s. Titelbild] zum Duell – aber ganz unblutig, nur mit Worten.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Lass‘ sie atmen
Monday, 16. November 2009

Na, um das gleich vorauszuschicken: Nachdem ich das Buch aus der Hand gelegt hatte, blieb leider, leider doch eine kleine Enttäuschung, wie nach einer verpassten Chance. Der ganz großartige Wurf ist Silvia Bovenschen mit ihrem in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlichen Kriminalroman Wer Weiß Was leider dann doch nicht gelungen.
Vielleicht liegt das daran, dass sie dem Buch zu viel aufgebürdet hat. Es sollte Rätsel sein („Wer hat’s getan?“), Milieustudie und Gesellschaftskritik, Vielfältigkeitsprüfung einer begabten Charakterzeichnerin und intelligente Parodie auf die Gattung. Es sollte uns das alte Thema von Schuld und Freiheit des Willens, Sühne und Vergebung noch einmal in vollem Ernst nahebringen, um es fast im gleichen Atemzuge durch den Kakao zu ziehen. Und es sollte dies alles in einem streng berechneten, um kein Wort verlegenen und doch kein Wort verschwendenden, wahrhaft meisterlichen Tonfall tun.
Vielleicht ist es symptomatisch, dass der ansonsten sorgsam lektorierte Roman zum Ende hin dann doch ein paar Fehlerchen aufweist (ein überzähliges „sie“ auf S. 256, Z. 22; „im panisch verschlechtertem [!] Zustand“, S. 262, Z. 8/9; „Gott sein [!] Dank“, S. 270, Z. 32), gipfelnd in dem schrecklich falschen Satz: „Diese Frau, überlegte sie jetzt, die in ihrem strengen schwarzen Kostüm vor mir sitzt, sorgsam gekleidet und gepflegt, doch nur, um eine textile und kosmetische Sperre zwischen ihr [!] leibliches [!] Sein und das [!] der anderen zu errichten, macht den Eindruck“ usw. – Ich vermute mal, an der Stelle von „zwischen etwas errichten“, was ja unbedingt den Dativ nach sich ziehen muss – „zwischen ihrem leiblichen Sein und dem der anderen zu errichten“ – hat hier ursprünglich ein anderes Verb gestanden, z. B. „zu setzen“ oder „zu stellen“.
Das ist freilich nur eine dumme Kleinigkeit, aber sie deutet doch darauf hin, dass Autorin und Verlag zuletzt unter Zeitdruck gearbeitet haben. Ich möchte mir, weil ich anfänglich so positiv voreingenommen für Wer Weiß Was war, mit gutem Willen ausmalen, was aus dem Buch hätte werden können, wenn die Autorin die Courage und Geduld aufgebracht hätte, ihren Verlag gegen alle Abmachungen zu vertrösten, um noch ein Vierteljährchen auf die Fertigstellung und den letzten Schliff zu verwenden.
Aber so funktioniert der Literaturbetrieb bekanntlich nicht. Da wird knapp kalkuliert, mit der Zeit – und leider auch mit den Mitteln für die Ausstattung. Dieses Buch ist, was den materiellen Aspekt betrifft, wieder ein trauriges Beispiel für billiges Blendwerk. Gegen Pappdeckel als Einbandmaterial will ich ja gar nichts sagen, aber dass die Fadenheftung wie so oft nicht dransitzt, das schmerzt. Schon nach meiner ersten, wahrlich schonenden Lektüre ist das Buch schiefgelesen und wird auch so bleiben, wie jeder Kenner weiß. Aber die Laien sind in der überwältigenden Überzahl und lassen sich von den völlig überflüssigen Lesebändchen beeindrucken. (In diesem Fall ist’s gar ein goldenes.) Ach, das ist so traurig und steht in eklatantem Missverhältnis zur – bei allen kleinen Einschränkungen – hohen Qualität des Inhalts. Was kann man da nur tun? Was weiß ich!
[Titelbild: Porträtfoto Silvia Bovenschen von Jürgen Bauer im Umschlag ihres vorletzten Buches Verschwunden. © S. Fischer Verlag.]
Posted in Würfelwürfe | 1 Comment »
Monday, 16. November 2009

Heute las ich zum zweiten Mal bei „Generationen betrachten“ in Oberhausen. Knapp zwanzig Zuhörer, darunter nur drei oder vier Männer. Die Kundenzahlen in den Buchhandlungen, wo zwei Drittel der Romanleser Leserinnen sind, weisen in die gleiche Richtung: Die kulturelle Schwindsucht breitet sich vom maskulinen Rand des Humanen her aus. Auch insofern bin ich mal wieder eine der Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Etwas mulmig ist mir dabei schon vor diesen Damenkränzchen.
Immerhin freut mich, dass ich es offenbar nicht allen recht machen konnte, sonst hätte ich an mir selbst zweifeln müssen: Vier Besucherinnen verabschiedeten sich unter vernehmbaren Missfallenskundgebungen in der Pause. Ich würde zu viel reden und zu wenig lesen, sowas stelle man sich doch nicht unter „Vorleseabend“ vor. Und dafür acht Euro Eintritt! Das passte nun allerdings so zauberhaft zu Johann Peter Hebels Kalendergeschichte vom Seltsamen Spazierritt, die ich eingangs zum Besten gegeben hatte, dass ich mit einem Schmunzeln zur Tagesordnung übergehen und meinen letzten Programmpunkt, Hans Carl Artmanns zotige Geschichte How much, schatzi?, vom Leder ziehen konnte.
Ich hatte die Veranstaltung unter den Titel „Glück im Unglück“ gestellt, als mir noch kein Schimmer aufgegangen war, was ich lesen würde. Tatsächlich verlegte ich mich bei der Textauswahl dann auf meine brandaktuellen Favoriten respektive Neuentdeckungen: Emmanuel Bove (durch Harald Wiesers Vermittlung in Menschen und Masken), Gisela Elsners Schrauben-Text (leicht gekürzt) und Was ist denn? von Raymond Carver. Gern hätte ich auch aus dem Krimi der Bovenschen gelesen, aber welches der fünfzig kurzen Kapitelchen hätte ich da auswählen sollen? Nein, dieser Roman wirkt nur als ein Ganzes. Immerhin habe ich die distinguierte Dame ausführlich vorgestellt und hoffe, dass es mir gelungen ist, die eine oder andere Zuhörerin für Silvia Bovenschen in toto zu interessieren.
Auf der Hinfahrt mit Bus und Bahn kämpfte ich immer noch gegen eine hartnäckige Art von Kopfschmerz, die mich schon seit zwei Tagen belästigte, vermutlich witterungsbedingt, denn nach ein paar winterlich kalten Tagen hatte es sich plötzlich wieder erwärmt. Nachdem ich mein Gepäck im Veranstaltungsraum an der Goebenstraße abgeladen hatte, blieb noch etwas Zeit und ich ging an die frische Luft. Nur wenige Schritte entfernt entdeckte ich den Altmarkt mit seiner Siegessäule. In stiller Zwiesprache mit der freundlichen Nike über mir [s. Titelbild] löste sich mein Kopfgrimmen in Rauch auf und verschwand mit den vorbeiziehenden Wolken hinterm Horizont.
Wie üblich trug mich dann mein frei assoziiertes Geplauder durch den Abend wie ein gut aufgepumptes Schlauchboot. Anschließend auf der ungemütlichen Heimfahrt, mit Besoffenen und streitlustigen Raufbolden in einem Abteil, graue Melancholie. Auch das wie üblich. Alles Sinnen und Trachten liegt ja dazwischen: hier der goldene Kranz der Siegesgöttin weit über unseren wehen Häupten, dort das lakritzig-klebrige Pech, von Aasvögeln erbrochen, in der Gosse zu unseren wunden Füßen.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Glück und Pech
Sunday, 15. November 2009

Die „linke Wochenzeitung“ (Selbsttitulierung) Jungle World, die sich 1997 nach einem Redakteursputsch in der Jungen Welt ausgründete, gehört zu jenen sich als „kritisch-undogmatisch-antiimperialistisch-linksliberal-unorthodox“ verstehenden Medien, die ich regelmäßig, wenngleich nur sporadisch lese, um mich über den jeweils aktuellen Zustand der Debattenkultur in Deutschland zu unterrichten.
Heute stolperte ich dort zufällig in einer Einlassung des Aachener Politikwissenschaftlers Dr. Richard Gebhardt (* 1970) zur neuesten Provokation des Kölner Kardinals Joachim Meisner (* 1933) über ein bemerkenswertes Statement zu einem Thema, das mich andernorts auch einmal beschäftigt hat: Passt das von Gerhard Richter gestaltete Südquerhausfenster im Kölner Dom zu einem christlichen Sakralbau? Gebhardt schreibt dazu: „Das von Gerhard Richter geschaffene Domfenster war nicht nach dem Geschmack des Erzbischofs. Es passe eher in eine Moschee, meinte er. […] Der Kölner Kardinal ist ein Wiederholungstäter. Empörte Proteste werden ihn auch fortan nicht beeindrucken. Vielleicht aber der Umstand, dass ein Blick auf das von Richter gestaltete Fenster wöchentlich mehr Menschen in den Dom lockt als alle Predigten des Erzbischofs im ganzen Jahr.“
Mal abgesehen davon, dass ich nie verstehen werde, warum ein kritischer Geist bei einem Heimspiel seine begrenzten Kräfte darauf verschwendet, seine gleichgesinnten Leser zu beifälligem Kopfnicken zu veranlassen, immer wieder und wieder den billigen Konsens beschwörend, der in diesem Falle heißt, dass der Herr Meisner ein so makelloses Feindbild abgibt, wie man’s schon lange nicht mehr hatte; abgesehen auch davon, dass das Missfallen des Kardinals nicht auf ästhetische Bewertungen gründete, also mitnichten, wie Gebhardt schreibt, ein Geschmacksurteil war, sondern vielmehr ein theologisch hergeleitetes; und schließlich auch abgesehen von der durchaus bezweifelbaren, erkennbar schadenfrohen Annahme, Meisner sei durch den Zulauf zu beeindrucken, den das von ihm ungeliebte Fenster im Gegensatz zu seinen Predigten findet, denn man könnte zum Beispiel fragen, ob sich dieser Zulauf nicht zu einem beträchtlichen Teil dem Protest des Kardinals gegen dieses Glasfenster verdankt – abgesehen also von all diesen Unschärfen und Oberflächlichkeiten in Gebhardts Argumentation interessiert mich vor allem die Frage: Was bedeutet das Fenster?
Dass es nichts darstellt, in dem bunten Mosaik aus 10.512 farbigen Glasquadraten kein gegenständliches Motiv erkennbar ist und auch keine abstrakte Form, wie zum Beispiel ein Kreuz oder ein Muster, das sieht jeder Betrachter auf den ersten Blick. Ergäbe sich etwa ein Ornament, so wäre die Gedankenverbindung des Kardinals halbwegs verständlich, der hier aus unerfindlichen Gründen eine Nähe zur Gestaltung islamischer Moscheen zu erkennen meint. Allerdings hat schon Nicola Kuhn seinerzeit im Tagesspiegel mit Recht darauf hingewiesen, Meisner offenbare mit dieser Assoziation „seine Ahnungslosigkeit, was christliche Kunstgeschichte betrifft. Nicht nur im Islam, auch hier gibt es das Ornament seit jeher. Die vom Kardinal offenbar bevorzugte Gegenständlichkeit ist eine Variante der Kirchenfensterkunst. Zugleich watscht er die Muslime und die maurische Formensprache ab. Als sei ornamentale Kunst beliebiger als figürliche Glasmalerei – und weniger wert.“
Aber wir können das Ornament getrost abhaken, hier ist keins zu erkennen. Nun könnte sich hinter der Anordnung ja dennoch eine Regelmäßigkeit verbergen, wenn etwa jede Farbe einer Zahl oder einem Buchstaben entspräche und sich aus der Zahlenfolge ein Code ergäbe, zum Beispiel für das menschliche Genom. Aber der Künstler hat deutlich gemacht, dass dem nicht so sei und die Anordnung rein zufällig. Er habe lediglich dort eingegriffen, wo sich zufällig doch erkennbare Muster einstellten, zum Beispiel habe sich durch eine Häufung von weißen Quadraten in einer Ecke eine Eins ergeben. Den Vorwurf, sein Werk passe besser in eine Moschee, wies Richter befremdet zurück. Er habe keine Beziehung zum Islam und hätte niemals einen solchen Auftrag angenommen. Richter gab zu, dass seine Fenstergestaltung nicht katholisch sei. „,Aber wie sähe eine katholische Gestaltung aus, die nicht plagiatorisch die Historie beschwört und nicht kunstgewerblich ist?‘, fragte er. Auch wenn er im Domfenster den Zufall als überwältigende Macht darstelle und nicht als göttliche Vorsehung, befinde sich das Fenster dennoch im sakralen Rahmen am richtigen Platz. Richter erklärte, er fühle sich als Spross des Christentums, der ,ohne den Glauben an eine höhere Macht oder etwas Unbegreifliches‘ nicht leben könne.“ (Welt online v. 31. August 2007.) – Vielleicht glaubt ja Richter eben an den Zufall als an die höhere Macht? Wie gelangte aber dann sein Glasbild in den Dom zu Köln? Doch nicht etwa durch Vorsehung?
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Im Jungle
Monday, 09. November 2009

Gute Interviews können auf zweierlei Weise zustande kommen. Der Königsweg führt naturgemäß über die minutiöse Vorbereitung des Interviewers auf seinen Gesprächspartner, getreu dem alten Satz von Hesiod folgend, dass vor den Erfolg die Götter den Schweiß gesetzt haben. Sodann gehört der Mut dazu, Fragen zu stellen, die den Interviewten aus der Fassung bringen oder ihn, sofern es sich um einen Prominenten handelt, doch mindestens dazu verleiten, mehr von sich preiszugeben als das längst allseits vertraute Bild, das er sich mit der Unterstützung seiner Imageberater zugelegt hat. Wenn dann noch souveräne Spontaneität in der unmittelbaren Gesprächssituation hinzukommt, und zwar idealerweise auf beiden Seiten, beim Frager und beim Befragten, dann entsteht eins jener kleinen Kunstwerke, die über den Tag hinaus eine ästhetische Geltung behaupten. (Wer Beispiele solcher meisterhaft geführten Interviews sucht, der wird auf der Website des in dieser Hinsicht Maßstäbe setzenden André Müller fündig.)
Die andere, ferner liegende, darum im Ergebnis jedoch nicht weniger beachtliche „Herstellungstechnik“ eines lesenswerten Interviews geht gerade von den entgegengesetzten Voraussetzungen aus. Hier stolpert der Fragensteller seinem bedauernswerten Opfer vor die Füße wie, bestenfalls, ein harmloser Banause, im schlimmeren Falle aber wie ein gemeingefährlicher Ignorant. Das Wenige, was er über sein Gegenüber in Erfahrung gebracht hat, stammt aus der Wikipedia, wovon er noch die Hälfte vergessen, die andere Hälfte falsch verstanden hat. Was einem solchen Interviewer an Kenntnissen mangelt, sucht er meist durch Keckheit auszugleichen. Oft finden wir diese Konstellation, wenn ein junger Nachwuchsjournalist auf einen Intellektuellen im Greisenalter losgelassen wird. Das Aneinandervorbeireden kann in solchen Scheindialogen zu grotesken Verzerrungen führen, auf dass das Ergebnis schon wieder reizvoll ist. Wenn dann noch eins unserer aufstrebenden Lifestyle-Magazine den Mut oder die Instinktlosigkeit besitzt, ein solchermaßen entgleistes Gespräch zu publizieren, dann kann auch dies, wo nicht für bare Münze, so doch für wahre Kunst genommen werden. (Wie kommt es nur, aber oft erinnern mich Interviews der beschriebenen Machart an die Bilder von Otto Dix.)
Jüngst haben Sacha Batthyany und Mikael Krogerus für die Zürcher Zeitungsbeilage Das Magazin (# 45 v. 6. November 2009) an der Bar des Hotels Kempinski in Berlin ein Interview mit dem ungarischen Literatur-Nobelpreisträger Imre Kertész geführt, der heute seinen achtzigsten Geburtstag feiert. Gleich schon zu Beginn ihres Fragespiels unterläuft den beiden „Recherche-Journalisten“ der erste Schnitzer: Sie werfen das Konzentrationslager Buchenwald und das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in einen Topf. „Sie waren 15, als Sie über Auschwitz nach Buchenwald deportiert wurden. Wussten Sie, wo Sie hinkommen werden?“ – „Nein. Neunzig Prozent der ungarischen Juden hatten keine Ahnung von den Konzentrationslagern.“ – „Wann haben Sie verstanden, was das [also Buchenwald] für eine Art Lager war?“ – „Bei der Ankunft haben wir noch nichts verstanden. Auch die Erwachsenen nicht. Sie ahnten überhaupt nicht, was passieren würde. Nicht mal bei der Selektion verstanden sie, was der Arzt mit ihnen machte. […]“ Kertész spricht also in seiner Antwort von seiner Ankunft in Auschwitz, da war er übrigens erst 14 ½ Jahre alt. Noch wird nicht ganz klar, dass Frager und Antworter aneinander vorbeireden. Später fragen die beiden dann: „Werden Sie nicht jeden Tag durch Ihre KZ-Tätowierungen an diese Zeit erinnert?“ Und nun erkennt Kertész, dass seine jugendlichen Gesprächspartner augenscheinlich ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben: „Ich hatte eine Nummer, eingenäht in meine Uniform, aber keine Tätowierung. Tätowiert wurde man nur in Auschwitz, nicht in Buchenwald, da müssen Sie besser recherchieren.“ Und dann spürt er, wie oberflächlich das Interesse dieser jungen Leute ist: „Hören Sie, was ist so interessant daran, über so ekelhafte Themen zu sprechen? Mit jungen Leuten würde ich viel lieber über etwas Schönes sprechen. Über Kunst oder schöne Frauen.“ Dazu fällt den „jungen Leuten“ nichts besseres ein, als den alten Mann der Verdrängung zu bezichtigen: „Ist es unangenehm, darüber zu sprechen?“ Das fragen sie allen Ernstes jenen Schriftsteller, der es wie kaum ein anderer seiner Leidensgefährten verstanden hat, alles ans Licht zu bringen, was er in der Hölle des Konzentrationslagers erleben musste. (Und später entblöden sie sich nicht, Kertész als Ignoranten vorzuführen, der den Namen Heidi Klum noch nie gehört hat: „Sie wollten doch über schöne Frauen reden.“)
Dann wird es interessant. Ninck und Batthayany befragen Kertész zu seiner Meinung über andere Bücher „über diese Zeit“. Er rühmt Celans Todesfuge, „die wunderbaren Essays von Jean Améry“, Ist das ein Mensch? von Primo Levi (den sie falsch Levy schreiben) und das schmale Werk des Polen Tadeusz Borowski. „Doch der Rest ist Kitsch […]. Das Lagerleben als Story, das geht nicht.“ Und was mit den Filmen sei? Mit dem berühmtesten Film zum KZ-Thema, Schindler’s List? Und jetzt macht der große Schriftsteller die beiden naiven jungen Männer für einen Moment sprachlos: „Schindler’s List? Der schlimmste Film von allen. Das ist alles scheissfalsch, ich kann das nicht anders sagen. […] Der Ausgangspunkt ist falsch. Dieses positive Denken. Spielberg erzählt die Geschichte aus dem Blick eines Siegers. Am Ende laufen die Leute in einer Reihe und singen, als ob die Menschheit gesiegt hätte. Der Ausgangspunkt eines KZ-Films kann nur der Verlust sein, die Niederlage der europäischen Kulturzivilisation. Das ist die Wahrheit: Holocaust-Erlebnisse sind universelle Erlebnisse. Der Holocaust ist kein deutsch-jüdischer Krieg, wer das denkt, der kommt zu nichts. Der Holocaust ist ein universelles Versagen aller zivilisatorischen Werte, und lange Zeit dachte ich, wir hätten daraus etwas gelernt. Aber ich lag falsch.“
Ja, wir lagen falsch. Und noch in diesem läppisch missglückten Interview wird genau dies deutlich.
[Titelbild: Zwei unbekannte Häftlinge blicken im Januar 1945 durch den Stacheldrahtzaun des Konzentrationslagers Auschwitz. – Laurence Rees: Die Nazis. München / Zürich: Diana Verlag, 1997, S. 190. – © Novosti.]
Posted in Würfelwürfe | 1 Comment »
Saturday, 07. November 2009

Ich noch nicht, denn ich bin gerade einmal auf Seite 147 angelangt, habe somit noch nicht die Hälfte des wunderbaren Kriminalromans gelesen, der mich seit Anfang des Monats bei Laune hält. (Bettlektüre.) Ich habe zwar schon ein paar Ideen, wer der Mörder sein könnte, oder auch die Mörderin, wie ich mich beeile ausdrücklich zu ergänzen, denn ich habe „die feministische Sprachreform vollzogen“, die auf Seite 10 in Erinnerung gerufen wird. Zwar könnte ich mich trotzdem bewusst von solchen formalen Zwängen distanzieren, aber nach dem, was die Autorin an anderer Stelle über den beliebten „Verstoß gegen die political correctness“ geschrieben hat – „er war einmal witzig, als das Korrekte im Übermaß verordnet wurde, aber jetzt, wo es das Bemühen darum kaum noch gibt, spricht der Verstoß gegen die Verstoßer“ (Verschwunden. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2008, S. 33) – bin ich verunsichert, ob mein Trotz gegen die feministische Sprachreform doch schon wieder chauvinistisch ist.
Die Autorin ist mir nicht erst durch dieses Buch aufgefallen. Schon durch die durchweg hymnischen Besprechungen ihrer Betrachtungen zur Idiosynkrasie, Über-Empfindlichkeit, war ich auf sie aufmerksam geworden (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000). Als dann vor drei Jahren ihre Notizen über das Unvermeidliche erschienen, Älter werden, da machte ich das Buch meiner Gefährtin zum Geschenk, die es mit Gewinn gelesen hat und darauf Wert legt, dass dies kein Buch über das Alter sei, sondern eben, wie der Titel ja ausdrücklich sagt, ein Buch übers Älterwerden (Frankfurt am Main: S. Fischer, 2006). Ich selbst habe aus Gründen, die zu erklären mich jetzt überfordern würde, beide nicht sehr umfänglichen, aber auf den ersten Blick hochkonzentrierten Bücher nicht gelesen. Aber sie stehen auf dem langen Bord meiner demnächst zu lesenden Bücher weit vorn und sind neuerdings noch ein gutes Stück weiter vorgerückt – weil nämlich Wer Weiß Was, das jüngste Buch der Autorin, mich schon nach den ersten Seiten im Sturm erobert hat (Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2009).
An Silvia Bovenschen (* 1946), von der hier – Liebhaber der höchsten Humorkunst werden es längst erkannt haben – die Rede ist, berückt mich allerhand: ihr Feinsinn; die grazile Technik; der erkennbare Fleiß beim Feilen an Details; nicht zuletzt die nie schlummernden Selbstzweifel, die sie davor bewahren, sich von den Fliehkräften ihrer beachtlichen Originalität aus der Bahn tragen zu lassen. Mancher Leser, der über die Liste der „Figuren“ auf den Seiten 7 und 8 des Kriminalromans stolpert und sich fragt, ob er sich einen Roman mit dreißig namentlich genannten Personen zumuten will, nicht gerechnet die beiden Tiere und vier nicht näher spezifizierte Wesen, die auf die überwiegend unglaubwürdig klingenden Namen Ertzuj, Iopö, Jkln und Kurt hören sollen … mancher von diesem Entree abgeschreckte Leser mag das Buch also gleich wieder aus der Hand legen, womit er sich freilich um einen Hochgenuss brächte, soviel kann ich schon nach 147 Seiten sagen. Auch der Schutzumschlag ist bestimmt nicht jedermanns Sache, ich mochte ihn selbst dann nicht, als ich herausgefunden hatte, dass seine Urheberin Sarah Schumann (* 1933) mit der Autorin die Wohnung teilt und eine international renommierte Künstlerin im Gefolge des Surrealismus ist. (Darf man so sagen?)
Dass ich hier auf eine Goldader gestoßen bin, dringend nun auch die älteren Bücher der Silvia Bovenschen lesen muss und jene, die noch nicht zu meiner Bibliothek gehörten, beschaffen – das wurde mir noch zusätzlich bestätigt, als ich bei der Recherche nach Informationen über die Autorin und ihr Werk auf so sympathische Internetseiten stieß wie die Website und das Blog von Jürgen Bräunlein, der ein sehr aufschlussreiches Portrait von Silvia Bovenschen geschrieben hat; oder das erstaunliche Monnier Beach Blog der Buchhandlung Reul in Kevelaar, wo eine Appetit machende Rezension von Verschwunden verschwände, wenn ich sie nicht hier ans Licht zerrte.
Und nun nehme ich, wie der als schweigsam und sanft bekannte Bibliothekar Simon Menzel in Bovenschens Buch, meine Brille ab und reibe mir die Augen, als sei plötzlich nach diesem gewollten Ausbruch eine tiefe Müdigkeit über mich gekommen.
[Schluss folgt zum Schluss. – Titelbild: Porträtfoto Silvia Bovenschen von Jürgen Bauer im Umschlag des besprochenen Buches. © S. Fischer Verlag.]
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Thursday, 05. November 2009

In den 1970er-Jahren, als es zum guten Ton gehörte, wenigstens näherungsweise Bescheid zu wissen, wenn die Rede vom Strukturalismus war, machte ich mich daran, das bekannteste Werk seines Hauptvertreters zu lesen, Traurige Tropen von Claude Lévi-Strauss.
Was ich an Neugier und gutem Willen zu viel hatte, mangelte mir nur zu oft an Ausdauer. Und so legte ich auch dieses wichtige Buch nach einem knappen Drittel aus der Hand, um mich einer anderen „Pflichtlektüre“ zuzuwenden.
Heute, dreißig Jahre später, blätterte ich zum ersten Mal wieder darin und zäumte das Pferd diesmal von hinten auf. Ich las die letzte Seiten des letzten Kapitels, das in der deutschen Übersetzung mit dem Titel „Die Rückkehr“ überschrieben ist und war erschüttert über die luzide Prophetie, die dieser Ethnologe und Philosoph hier in einer erbarmungslos unmissverständlichen Sprache zu Papier gebracht hat:
„Die Welt hat ohne den Menschen begonnen und wird ohne ihn enden. Die Institutionen, die Sitten und Gebräuche, die ich mein Leben lang gesammelt und zu verstehen versucht habe, sind die vergänglichen Blüten einer Schöpfung, im Verhältnis zu der sie keinen Sinn besitzen; sie erlauben bestenfalls der Menschheit, ihre Rolle im Rahmen dieser Schöpfung zu spielen. Abgesehen davon, daß diese Rolle dem Menschen keinen unabhängigen Platz verschafft und daß sein überdies zum Scheitern verurteiltes Bemühen darin besteht, sich vergeblich gegen den universellen Verfall zu wehren, erscheint der Mensch selbst als Maschine – vollkommener vielleicht als die übrigen –, die an der Auflösung einer ursprünglichen Ordnung arbeitet und damit die organisierte Materie in einen Zustand der Trägheit versetzt, der eines Tages endgültig sein wird. Seitdem der Mensch zu atmen und sich zu erhalten begonnen hat, seit der Entdeckung des Feuers bis zur Erfindung der atomaren Vorrichtungen, hat er – außer wenn er sich fortgepflanzt hat – nichts anderes getan als Millionen von Strukturen zerstört, die niemals mehr integriert werden können. Ohne Zweifel hat er Städte gebaut und Felder bestellt; doch handelt es sich auch hier nur um Maschinen, die dazu bestimmt sind, Trägheit zu produzieren, und zwar in einem Tempo, das in keinem Verhältnis zur Menge an Organisation steht, das die gebauten Städte und die bestellten Felder implizieren. Was die Schöpfungen des menschlichen Geistes betrifft, so besitzen sie Sinn nur in bezug auf ihn, und sie werden im Chaos untergehen, sobald dieser Geist verschwunden sein wird. […]“ (Claude Lévi-Strauss: Traurige Tropen. A. d. Frz. v. Suzanne Heintz. Köln / Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1970, S. 366 f.)
Ich zitiere den Schluss nicht bis zum Ende, das nicht zu ertragen ist. Am vergangenen Wochenende ist Claude Lévi-Strauss im Alter von hundert Jahren in Paris gestorben.
[Titelbild: Umschlaggestaltung für das zitierte Buch von Hannes Jähn (1934-1987).]
Posted in Oikos | Comments Off on Entropologie
Tuesday, 03. November 2009
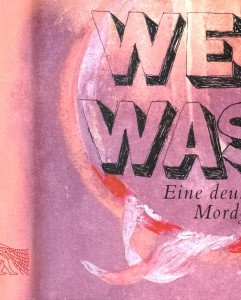
Fragt man mich nach meinen Lieblingsbüchern oder, noch schlimmer, meinem einen allerliebsten Lieblingsbuch, dann verweigere ich prinzipiell die Antwort und liefere ersatzweise eine Beschreibung dessen, was Bücher an sich haben müssen, um sich aus der Vielzahl der Bücher, die ich lesend prüfe, als besonders beglückende hervorzuheben. Im Regelfall ist Lesen für mich eine, wenngleich meist angenehme, Art von Arbeit, nach der ich, wenn ich sie abgeschlossen, das betreffende Buch also bis zum Ende gelesen oder aber als ungenießbar aus der Hand gelegt habe, ein Gefühl der Erleichterung verspüre: Geschafft! Ganz selten aber fällt mir ein Buch zu, bei dem ich schon nach wenigen Seiten den irrationalen Wunsch verspüre, dass es nie zu einem Ende kommen möge. Ich drossele dann sofort mein Lesetempo, lese jeweils nur eine kleine Portion, gönne mir pro Tag bloß ein paar Seiten und finde ein außergewöhnliches Vergnügen darin, wann immer ich ein solches Buch wieder zur Hand nehme, mir zunächst die beim vorigen Mal gelesenen Seiten erneut zu Gemüte zu führen, wobei ich, auch das macht ja die besondere Qualität dieses Buches aus, stets überrascht bin, dass ich beim ersten Lesen längst nicht alle Feinheiten seiner Machart durchschaut noch alle Einzelheiten seines Inhalts angemessen gewürdigt habe.
Lange, zu lange musste ich zuletzt auf diese ebenso beglückende wie seltene Erfahrung warten. Ich war schon geneigt zu glauben, meine Ansprüche seien mittlerweile zu hoch, um noch einmal in den Genuss eines Buches kommen zu können, das die beschriebene Wirkung auf mich haben würde. Seit ein paar Tagen nun lebe ich mit einer Lektüre wie im Rausch.
Das Buch, das ich lese, ist ein Kriminalroman. Ich habe vor etlichen Jahren eine Phase durchlesen, in der ich Krimis im Dutzend verschlang. Einige wenige – von der Highsmith, von Boileau und Narcejac, von Patrick Quentin – hinterließen aus verschiedenen Gründen einen bleibenden Eindruck. Etlichen bei meinen Freunden beliebten, von ihnen vielfach gelobten Autoren dieses Genres versuchte ich mich mehrfach anzunähern, ohne etwa mit Georges Simenon, Raymond Chandler, Friedrich Glauser oder Boris Akunin so recht warm werden zu können.
Auf jene Krimileser, denen es darum ging, im Verlauf der Handlung möglichst frühzeitig den Täter zu erraten, sah ich mit leichter Geringschätzung herab. Literaturgenuss ist doch kein Ratespiel! Ein Kriminalroman soll bekanntlich vor allem spannend sein. Was das betrifft hielt ich es aber eher mit Krimis, bei denen ich mit einem längst bekannten Täter zittern musste, der mit allen Mitteln seiner Entlarvung zu entgehen versucht. Wie er da immer weiter in die Enge getrieben wird und in hoffnungslosen Situationen, in denen der Leser längst alles verloren glaubt, trotzdem noch einen Ausweg findet, wenngleich natürlich nur für ein weiteres kurzes Weilchen – das konnte, wenn es vom Autor meisterlich betrieben wurde, schon einen unvergleichlichen Genuss bereiten.
In dem Kriminalroman, der mir jetzt den so lange entbehrten Hochgenuss bereitet, steht nun aber die Frage nach dem Täter, genauer: der Identität des Mörders, steht jenes konventionelle Whodunit überraschenderweise im Vordergrund.
[Wird fortgesetzt und aufgeklärt.]
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Monday, 02. November 2009
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Fadenschein
Sunday, 01. November 2009

Dreizehn Jahre und drei Monate hatten wir auf Rufweite zu diesem Edeka-Laden gewohnt und regelmäßig dort eingekauft.
Doch nein, das ist nicht ganz richtig! Als wir in den Stadtwald zogen, war das Grundstück in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, auf dem der Laden dann bald stand, für ein Weilchen noch ein ungepflegtes Brachland, „Kleppes Feld“ genannt, wo ein Altwarenhändler sein Geschäft betrieb. Für Lebensmitteleinkäufe mussten wir die Hauptstraße bergauf zum Stadtwaldplatz, wo ebenfalls ein Edeka-Laden residierte, oder bergab zum Stiftplatz, wo die Konkurrenz mit niedrigeren Preisen lockte, unter oft wechselnden Firmennamen wie co-op, Depot und vielleicht noch weiteren, die ich längst vergessen habe. (Heute gibt es dort einen Getränkemarkt.)
Dann ergriffen wir die Flucht vor dem Dauerlärm der Hauptstraße, den wir zwar bewusst kaum mehr wahrnahmen, der uns aber dennoch an die nervliche Substanz ging. Nahezu fünf lange Jahre betraten wir „unseren“ Edeka-Laden nicht mehr, weil wir in einem anderen Stadtteil wohnten, wo wir stattdessen Stammkunden bei einem Kaiser’s wurden. Wir gewöhnten uns an ein geringfügig anderes Angebot, an unbedeutend abweichende Preise: hierfür ein paar Cent mehr, dafür ein paar Cent weniger. Und wir vergaßen die Gesichter der Kassiererinnen, die uns so viele Jahre lang nahezu Tag für Tag unser Haushaltsgeld abgenommen hatten, um uns an andere Kassiererinnen zu gewöhnen, die dies mit der gleichen freundlichen Selbstverständlichkeit taten.
Nun sind wir wieder zurückgezogen in die Nähe des Edeka-Ladens der Jahre 1991 bis 2004. Und es ist eine merkwürdige Erfahrung, wie die Zeit hier scheinbar stehengeblieben ist. Die Einrichtung wurde modernisiert, das schon. Manche Produkte wurden aus dem Programm genommen, andere kamen hinzu. Beim dritten, spätestens vierten Besuch hat man sich wieder orientiert. Hinter den Kassen nehme ich die altbekannten Gesichter wahr, wenige neue, was vermuten lässt, dass auch Kassiererinnen ausgeschieden sind, aber an die erinnere ich mich nicht mehr.
Und nun das Erstaunliche: Ich selbst werde nicht wiedererkannt, von keiner einzigen der Kassiererinnen. Habe ich mich etwa äußerlich so sehr verändert? Oder ist diese Asymmetrie der Wahrnehmung ganz natürlich, aus den verschiedenen Rollen von Personal und Kundschaft erklärlich? Vielleicht habe ich ja auch ein ausgesprochenes Inkognito-Gesicht, das im Gedächtnis meiner Mitmenschen kaum Spuren hinterlässt, ein Gesicht wie Noface in dem gleichnamigen, meisterlichen Roman von W. E. Richartz. Diese Erfahrung verunsichert mich. Aber warum? (Und es verunsichert mich zusätzlich, dass ich auch auf diese letzte Frage keine Antwort weiß.)
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Noface
Saturday, 31. October 2009

Vielleicht war es auch der Geist von Raymond Federman, der mich Anfang des Monats aus dem Tritt gebracht hat.
Federman starb am 6. Oktober früh um 6:15 Uhr im Alter von 81 Jahren im kalifornischen San Diego an Krebs. Seine Tochter Simone, die ihn in der langen Zeit seiner Erkrankung begleitet hatte, war auch in der Stunde seines Todes bei ihm. Über fast alles, was das Menschenleben ausmacht, wenn das Nebensächliche von ihm abgestreift wird, zum Beispiel in einem Augenblick höchster Todesangst, hat Raymond Federman geschrieben, als Erzähler und als Dichter. Für den letzten Augenblick vor dem Ende hat er seinen Wunsch in ein Gedicht gekleidet, Am Ende, in meiner Übersetzung:
Manche sterben heroisch
auf dem Schlachtfeld
andere aufbegehrend
mit einem Sprung von der Klippe
viele jedoch sterben
unerwartet
im Schlaf
ohne es zu erleben
während eine Vielzahl
in Angst und Feigheit dahingeht
auf den Krankhausstationen
sehr wenige scheiden
schmalos dahin
ohne sich zu sträuben
Ich hingegen wünsche mir zu sterben
gerade so eben
ohne Begeisterung
Man muss wissen, dass Raymond Federman dem Tod vor sehr langer Zeit, Mitte Juli 1942 in Paris im allerletzten Augenblick von der Schippe gesprungen ist, als 14-jähriger Judenjunge, den seine beherzte Mutter vor den Nazischergen in einem Schrank versteckte.
Ich weiß, dass Raymond Federman über diese klaustrophobe Erfahrung ein Buch geschrieben hat, The Voice in the Closet – La voix dans le cabinet de débarras – Die Stimme im Schrank. Ein einziger Satz. Diesen 75 Seiten langen Satz las Simone ihrem Vater in der Nacht seines Todes noch einmal vor, in einem Atemzug. Sie kam bis Seite 61, dann
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Am Ende
Saturday, 31. October 2009

Vor dem Zweiten Weltkrieg hatten die taktischen Scharmützel zwischen den Geschlechtern noch Stil. Eben lese ich an entlegenem Ort den Anfang einer kleinen Geschichte, die das Missverstehen, das Missverstehenwollen und Missverstehenmüssen von Männern und Frauen, diese uralte Geschichte seit Adam und Eva, zum Thema hat. Hier beginnt die Geschichte so:
„,Liebling, würde es dich sehr kränken, wenn ich stürbe?‘ fragte einmal Herr Vopalka seine entzückende Frau, so unerhört geistreich, wie nur Ehemänner fragen können. – ,Ja‘, antwortete sie ohne Ueberzeugung und widmete ihre volle Aufmerksamkeit ihrer eleganten Toilette, in der sie sich vor dem Spiegel mit kritischem, aber zufriedenem Blick betrachtete. – Dann setzte sie sich vor dem Spiegel auf einen kleinen Hocker, der eher einem Polster als einer Sitzgelegenheit glich und betrachtete, ein wenig den Rock hebend, ihre langen schlanken, in elegantes Spinnweb holzbrauner Strümpfe gekleideten Beine. – ,Was würde dich am meisten traurig machen?‘ bohrte der Gatte, mit der Ehemännern eigenen, unermüdlichen Gründlichkeit weiter. – ,Das ich ein Jahr lang schwarze Strümpfe tragen müsste, die mir wahrscheinlich nicht stehen würden,‘ sagte ganz aufrichtig Madame, bei dieser Vorstellung einigen Missmut in Augen und Stimme. – Sie hatte ihrer Ueberzeugung nach die Wahrheit gesagt und damit einen Fehler gemacht. Die Männer sind schon so, dass sie an Lügen glauben, je angenehmer die Lüge, desto fester, und dass sie die Wahrheit verwerfen, oder sie als einen Witz betrachten, den die von ihnen geliebte Frau gemacht hat. – Der Gatte, Herr Vopalka, lachte ein glückliches Lachen […].“
Die rabenschwarze, zyanbittre Story heißt Die schwarzen Strümpfe und stammt von Zdena Jindrova, einer Tschechin vermutlich, über die in den mir zugänglichen Literaturgeschichten (und selbst im Internet, das doch sonst immer alles weiß und kennt) nichts herauszufinden ist. Sie erschien am 15. August 1938 in der Pariser Tageszeitung, dem Blatt der deutschen Emigranten in Frankreich, auf Seite 4 der Sonntagsbeilage (3. Jg., Nr. 763). Da ich sonst nicht viel über dieses merkwürdige Stück Kurzprosa herausgefunden habe, teile ich hier immerhin noch mit, dass in diesem letzten Friedensjahr vor Beginn der großen Schlächterei der 15. August kein Sonntag, sondern ein Montag war. Vielleicht hängt diese Unstimmigkeit damit zusammen, dass am 15. August in katholischen Ländern und also auch in Frankreich Mariä Himmelfahrt gefeiert wird.
Aus dem so viel undelikateren Jahr 2009 werfe ich für einen Moment einen sehnsuchtsvollen Blick zurück in eine Epoche, als Frauen noch schreiben durften, wie „die Männer“ schon so sind – und Männer dies lasen, mit einem Schmunzeln oder voller Abscheu, je nach Façon. Dann fällt mir ein, dass solcherlei Plaudereien der feinen Gesellschaft am Abgrund stattfanden. Noch war die Hauptstadt der Liebe frei; aber nicht mehr lange, und gänzlich humorlose Männer würden auf den Plan treten, die zwar auch an Lügen glaubten, aber nicht an die Lügen ihrer neckischen Gattinnen auf dem Schminkschemel, sondern an die Lügen eines brutalen Surmâle. Und für undeutsche Schminkereien und Seidenstrümpfe gleich welcher Farbe würde es dann keinen Platz mehr geben.
So wird jede noch so wohlige nostalgische Träumerei über die zynischen Idyllen der Vorkriegszeit, gar jeder Vorkriegszeit, durch den ungetrübten Blick auf die Folgen zuschanden.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Vopalka lacht
Tuesday, 27. October 2009

… melancholisch macht:
Der Anblick via Livestream vom nahezu leeren Plenarsaal im Berliner Reichstag, in einer Sitzungspause. Die immerzu tropfenden Regenrinnen an den Bushaltestellen meiner Vaterstadt im Herbst, diese offensichtliche Fehlkonstruktion zu Lasten des Steuerzahlers, und die über diesen kleinen Skandal lamentierenden älteren Herrschaften. Prousts Augen. Alte Straßenbahncarnets, undatierbar, als Lesezeichen in meinen Büchern, jeweils an der Stelle, wo ich offenbar das Lesen aufgegeben habe, und scheinbar mit Recht.
Verrottete Minigolfanlagen; noch schlimmer, wenn sie sich Kleingolfanlagen nennen. Ältere Ehepaare auf Wanderschaft im winterlichen Wald, nicht neben-, sondern hintereinander staksend mit ihren rückenfreundlichen Trockenskiern. Zwecklos gewordene Unterstellmöglichkeiten an aufgegebenen Bahnstrecken im Hochsommer.
Plattgefahrene Igel, Tauben, Frösche, Kastanien, Eicheln, Pizza- und Zigarettenschachteln, Ameisen pp. Und was mag das einmal gewesen sein?
Missverständnisse resp. Missverhältnisse, wie zum Beispiel kleine Kinder von Eltern, die besser deren Großeltern sein sollten.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Was mich …
Monday, 26. October 2009
Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Sunday, 25. October 2009
Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Saturday, 24. October 2009
Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Thursday, 08. October 2009
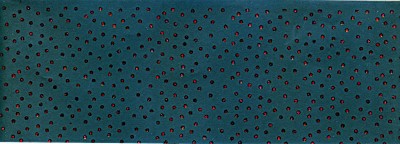
Gestern habe ich tatsächlich die allerletzten Bücherkisten ausgepackt und ihren Inhalt in die Lagerregale verfüllt. Ja, dieser Ausdruck, wie aus einer Großmolkerei mit Massentierhaltung, passt ganz gut zu der viehischen Plackerei, der ich mich in den vergangenen Tagen ausgesetzt sah.
Viele Male musste ich mir Gewalt antun, wenn ein Buch meine Aufmerksamkeit erheischte, das ich schon seit Jahren nicht mehr in Händen gehalten und gar schon nahzu vergessen hatte. Nur zu gern hätte ich der Zeit nachgesonnen, als ich es für meine Bibliothek erwählte, den Gründen auf der Spur, die es für mich eingenommen hatten; zu gern hätte ich mir die Frage gestellt, ob ich es gelesen und mit welchem Ergebnis aus der Hand gelegt haben mochte. Aber der unbarmherzige Scherge, den ich mir selbst in den Nacken gesetzt hatte, ließ keinen Müßiggang zu. Hier galt es einzig und allein zu prüfen, ob der Platz auf den Brettern für das in den Kisten reichen würde. Also rief er mir ein ums andere Mal sein Kommando ins Gewissen, wenn ich in Nachdenklichkeit zu versinken drohte: ,Weiter, weiter! Auspacken, einräumen! Zum Träumen ist später noch Zeit genug.‘
Wie Schneeflocken tanzten die Bücher vor mir im Neonlicht des Archivs. Die Masse, die ich zwar geahnt hatte, überwältigte mich dann doch. Das war zweifellos nicht mehr gesund. So viele Bücher! Wie hatte ich es nur so weit kommen lassen können? Als mein zweiter Sohn die letzte Sackkarrenladung abgesetzt hatte, meinte er in seiner unnachahmlich trockenen Art: „Nun habe ich aber fürs Erste wirklich genug von deinen Büchern, Vater.“ Dieser Überdruss war ihm und allen anderen, die mir in den letzten Wochen und Monaten wissentlich oder unfreiwillig geholfen hatten, meine Bibliothek erstmals seit vielen Jahren wieder an einem Orte zusammenzuführen, wahrlich nicht zu verdenken. Ich danke euch von Herzen …
In der vergangenen Nacht träumte ich, dass ich aus dem Fenster eines Sanatoriums in eine dunkle Winterlandschaft hinausspähte, weil ich jemanden erwartete, der mich hier besuchen wollte. Es schneite auch in diesem Traum, aber die Schneeflocken waren blutrot. Das wunderte mich zwar nicht weiter, aber ich machte mir Sorgen, mein Besucher könnte sich auf seiner Wanderschaft die Kleidung ruinieren.
(Übrigens vermisse ich jetzt, obwohl ich wirklich alle Kisten ausgepackt habe, immer noch einige Bücher, die ich bei dieser Herkulestat fest gehofft hatte endlich wiederzufinden.)
Posted in Bibliotheca Curiosa, Rêverie, Würfelwürfe | Comments Off on Blutregen
Tuesday, 06. October 2009

Das letzte Vierteljahr sollte diesmal das beste werden, wozu nicht viel gehört. Denn das erste war bestimmt von der Suche nach einer neuen Bleibe, das zweite von den Umzugsvorbereitungen und das dritte vom Umzug selbst. Nun müsste es mir doch eigentlich vergönnt sein, zur Abwechslung auch mal ganz schlicht und einfach zu wohnen.
Stattdessen fühle ich mich aber noch immer seelisch wie wundgescheuert von den Strapazen der vergangenen Monate. So kann ich beispielsweise den ständig lauernden Verdacht nicht mehr loswerden, irgendetwas ganz Entscheidendes vergessen zu haben, das unbedingt noch zu tun ist und nicht mehr nachgeholt werden kann, wenn ich es im richtigen Moment zu tun verabsäume. Manchmal, wenn ich neulich nachts wach lag und mich die langweiligste Lektüre nicht in den Schlaf schieben konnte, fürchtete ich, dass der Umzug einen bleibenden Schaden an oder in mir angerichtet haben könnte.
Vielleicht bin ich ja dispositionell ein extrem immobiler Mensch? Vielleicht wäre es mir am liebsten, an einem Ort geboren zu sein, mein liebes langes Leben am gleichen Platze hinzubringen und ebendort auch zu sterben? Vielleicht geht’s wider meine Natur, wenn die zufälligen äußeren Umstände mir alle paar Jahre einen Wohnungswechsel aufnötigen? Dafür spräche ja zum Beispiel auch, dass ich mich selbst zu kleinsten Reisen nur mit allergrößter Kraftanstrengung aufraffen kann und unterwegs die meiste Zeit übellaunig, kränklich und unglücklich bin.
Ich weiß schon: „Reisen bildet.“ So sagt man jedenfalls. Aber man sagt ja manches, das sich bei genauerer Betrachtung als vollkommener Blödsinn erweist: „Der erste Eindruck ist der beste.“ – „Wer rastet, der rostet.“ – „Was lange währt, wird endlich gut.“ Für diese und manch andere Redensarten habe ich im wirklichen Leben mindestens ebensoviele Gegenbeispiele wie Bestätigungen gefunden. So kenne ich manche Globetrotter, deren Verstand nach all der Weltenbummelei kaum über ihre eigene Nasenspitze hinausreicht, von Bildung ganz zu schweigen. Der Übergang vom Nomadentum zur Sesshaftigkeit war der größte Schritt des streunenden Affen auf dem Weg zum Dr. phil. Und wenn am Eingang zum dritten nachchristlichen Jahrtausend die Zweibeiner regelmäßig ihre trauten vier Wände verlassen und als hochtourige Touristen durch die Weltgeschichte preschen, dann ist das keineswegs die Krönung des Fortschritts, sondern ein atavistischer Rückfall in unbehauste Zeiten, als es noch keinen „Lieferservice für alles“ gab.
Pascal war bekanntlich der Ansicht, „daß alles Unglück der Menschen einem entstammt, nämlich daß sie unfähig sind, allein in ihrem Zimmer bleiben zu können. Kein Mensch, der genug zum Leben hat, würde sich, wenn er es nur verstünde, zufrieden zu Haus zu bleiben, aufmachen, um die Meere zu befahren oder eine Festung zu belagern.“ (Blaise Pascal: Über die Religion und über einige andere Gegenstände – Pensées. A. d. Frz. v. Ewald Wasmuth. Heidelberg: Lambert Schneider, 1978, S. 77.) Bei mir war’s von Kind auf gerade umgekehrt. Meine Mutter drangsalierte mich, ich solle doch bei dem schönen Wetter hinausgehen auf die Straße, mit meinen Altersgenossen spielen, statt mich immer hinter Büchern zu verkriechen. Wenn ich so weitermachte, würde ich ja ein rechter Eigenbrötler, ein Stubenhocker gar, den niemand zum Freund haben wolle! – So nahm das Elend schließlich auch mit mir seinen Lauf.
[Wird gelegentlich vielleicht fortgesetzt.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Homo immobilis (I)
Saturday, 03. October 2009

Heute auf den Tag genau vor 350 Jahren strandete ein Seemann und Abenteurer als offenbar einziger Überlebender auf einer unbewohnten und entlegenen Insel im Mündungsgebiet des Orinoco. Sein Name: Robinson Crusoe.
Aber diese Geschichte ist „nur“ erfunden, nämlich von einem Mann namens Daniel Defoe (~1660-1731), der gerade erst in der wirklichen Welt erschien, als sich der angebliche Schiffbruch zutrug. Dieser Daniel Foe, so sein eigentlicher Name, war der Sohn eines Kerzenziehers, ein durch Leichtsinn und politische Abenteuer hoch verschuldeter Bankrotteur, der diesen und viele weitere Romane schrieb, um mit den übrigens eher dürftigen Erträgen seiner Vielschreiberei seine zahlreichen Gläubiger halbwegs bei Laune zu halten. Auch sein – neben The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders (1722) – erfolgreichstes Werk, eben The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe (1719), machte ihn nicht reich, wohl aber seine Verleger: Neben der Bibel ist es angeblich das auf der Welt am meisten verbreitete Buch. (Vgl. Georg Bremer: Der Mann, der Robinson war; in: Die Zeit Nr. 30 v. 18. Juli 1986, S. 54.)
Angeregt wurde Defoe zu seinem Abenteuerroman durch die Lebensgeschichte des schottischen Seemanns Alexander Selkirk (1676-1721), der als Segelmeister auf der Cinque-ports, einem britischen Kaperschiff auf Beutefahrt im Südpazifik, mit seinem Kapitän in Streit geriet und im Oktober 1704 auf Más-a-tierra, einer der Juan-Fernandez-Inseln, ausgesetzt wurde. „Während Defoe seinen Robinson 28 Jahre, zwei Monate und 19 Tage auf seiner Insel verbringen läßt, braucht Selkirk ,nur‘ vier Jahre und vier Monate auszuharren.“ (Ebd.) Anfang Februar 1709 erlösen ihn zwei englische Schiffe aus seiner Isolation. Am 3. Dezember 1713 erscheint in Nr. 26 der Zeitschrift The Englishman ein ausführlicher Bericht über Selkirks Insel-Eremitage, den Defoe höchstwahrscheinlich kannte. (Vgl. Der wahre Robinson oder Das Walten der Vorsehung. Leben und Abenteuer des Alexander Selkirk. Zusammengestellt u. hrsg. v. Nikolaus Stingl. Nördlingen: Robinson Verlag Brunner & Lorch, 1980, S. 140-145.) Einiges spricht sogar dafür, dass Defoe dem Vorbild für seinen Robinson einmal persönlich begegnet ist.
Heute hat Lothar Müller in der SZ dankenswerterweise auf dieses von den zunehmend alberner werdenden Google-Doodle-Moglern natürlich nicht erkannte Jubiläum hingewiesen und seine Bedeutung hervorgehoben, sollte doch „der Jahrestag des 30. September 1659 als Feiertag in der Geschichte der Romankunst begangen werden. Er ist in der Epoche der Heraufkunft des Romans das Gegenstück zu jenem 16. Juni 1904, der seit dem Ulysses von James Joyce als Tag der Unabhängigkeitserklärung des Romans der Moderne gefeiert wird.“ (Lothar Müller: „Hier kam ich am 30. September 1659 an Land“; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 225 v. 30. September 2009, S. 14.)
Übrigens war der 30. September des Jahres 1659 ein Dienstag; und seine Nacht wurde vom Vollmond erhellt.
[Wird fortgesetzt. – Das Titelbild zeigt eine Illustration Ludwig Richters zu Joachim Heinrich Campes Robinson der Jüngere.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Robinsontag (I)
Wednesday, 30. September 2009
Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Tuesday, 29. September 2009
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Hörfunk (I)
Monday, 28. September 2009
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Wechselwahl
Monday, 28. September 2009

Nun kenne ich die Evangelische Kirche Rellinghausen auch von innen. Heute gab der international bekannt Organist und Orgelkomponist Gerd Zacher, der seit vielen Jahren in Essen lebt, ein Konzert aus Anlass seines 80. Geburtstags am 6. Juli. Er spielte zum Beginn und zum Abschluss zwei Ricercari aus dem Musicalischen Opfer von Johann Sebastian Bach, sodann drei eigene Kompositionen: Szmaty (1968), Trapez (1993) und Vocalise (1971).
Der Kircheninnenraum ist völlig unbedeutend, seine Schlichtheit bloß gewöhnlich, frei von jedem „negativen Pathos“. Vielleicht fünfzig Personen meist älteren Jahrgangs hatten sich eingefunden. Sie applaudierten der stellenweise geradezu schmerzhaft schrillen und unberechenbaren Musik, vermutlich aber wohl eher ihrem Interpreten, der hier viele seiner Werke uraufgeführt hat, mit Anstand und Ausdauer.
Die viermanualige Orgel der Firma Karl Schuke (Berlin), die hier im Jahr 1968 in Betrieb genommen worden ist, bietet nach den Worten von Sabine Rosenboom, der Kantorin der Evangelischen Kirche Rellinghausen, „reiche Möglichkeiten der klanglichen Kombination der Register (Klangfarben), da die vier verschiedenen Werke – das Hauptwerk, Rückpositiv, Brustwerk und Schwellwerk – eine für diese Größenordnung erstaunliche Vielgestaltigkeit im Miteinander und Gegeneinander des Musizierens“ erlauben.
Ebenfalls aus Anlass des Geburtstags von Gerd Zacher erschien ein Werkverzeichnis des Komponisten, Interpreten und Musikschriftstellers, das von Verena Funtenberger, der Leiterin der Musikbibliothek in der Essener Stadtbibliothek, zusammengestellt und am heutigen Abend kostenlos verteilt wurde. Das Heft hat 136 Seiten und enthält auch eine lesenswerte „Biographie mit Koordinaten“ Zachers von seinem langjährigen Weggefährten, dem chilenischen Komponisten Juan Allende-Blin, sowie ein Gespräch, das Matthias Geuting mit Zacher geführt hat, unter der programmatischen Überschrift: „Je zweckfreier die Musik bleibt, um so hilfreicher wird sie“.
Meine Gefährtin freilich, die ein so viel feineres und geschulteres Ohr hat als ich, konnte dieses Klangerlebnis nicht als reines Vergnügen empfinden. Selbst die Stücke von Bach, den sie doch sonst über alles stellt, waren in Zachers Interpretation gar nicht nach ihrem Geschmack. Ich möchte es mit meinem Interesse an Gerd Zacher damit aber dennoch vorläufig nicht bewenden lassen, gibt es doch allerlei, was meine Neugier wach hält; und sei es die bisher nur im Manuskript vorliegende, kleine Schrift Über den Zufall in der Musik „chance operation and discipline“ (John Cage), die auf S. 102 des Werkverzeichnisses genannt wird.
[Titelbild: Gerd Zacher während der Interpretation Nr. 10 No(-)Music © Anita Jakubowski 1987.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Orgelkonzert
Monday, 28. September 2009

Jetzt, da ich tatsächlich schneller als gedacht eine angemessene Unterbringungsmöglichkeit für den größten Teil meiner Bibliothek aufgetan habe, bin ich auf eine Weise wunschlos glücklich, die mich schon wieder misstrauisch macht.
Ich dosiere die Aufenthaltszeiten in meinem neuen Refugium streng, als wollte ich dem Risiko vorbeugen, einer Überdosis zum Opfer zu fallen. Immerhin habe ich nun alles ausgepackt, was noch in den „Bücherkatakomben“ der vorigen Wohnung lagerte. Im nächsten Schritt gilt es, die ca. 65 Kisten aus der K.-Anstalt bei Freund R. heranzuschaffen, doch das hat keine Eile. (Obzwar: Ich brenne drauf!)
Noch reichen ja auch glücklicherweise die Geldmittel, billige Regale anzuschaffen usw. So wird es mir gelingen, zum ersten Mal seit unvordenklichen Zeiten tatsächlich all mein Papier geordnet aufzustellen und greifbar zu haben, ohne quälende Sucherei, die dann doch in der Hälfte der Fälle in ein schmerzvolles Nichtfinden mündet.
Fast ist der Gegensatz zu heftig: zwischen einerseits dem noch vor wenigen Wochen durchlittenen Hundeelend, als ich gewärtigen musste, auf Jahre und Jahre vom größten Teil meiner Schätze und Schätzchen getrennt zu sein, sie zudem eher schlecht als recht untergebracht zu wissen, allen Gefahren ausgesetzt, die mit der Zeit aus Büchern Altpapier werden lassen; und andererseits dem Glück, wie oben angedeutet und ansonsten kaum beschreiblich.
Nun klammere ich mich geradezu an die paar vom Umzug noch verbliebenen Pflichtaufgaben, lästige Trivialitäten wie die endgültige Entrümpelung der „Katakomben“, die bis zum Ende des Monats über die Bühne gegangen sein muss. Das ist das trockene Brot, das jemand hinabwürgt, damit ihm der köstliche Wein nicht zu sehr zu Kopfe steigt.
Posted in Bibliotheca Curiosa, Würfelwürfe | Comments Off on An Land
Monday, 28. September 2009

Ich komme erst allmählich dahinter, dass unsere neue Bleibe wirklich ganz ausgezeichnete Anbindungen an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat.
Da sind zunächst die Bushaltestellen der Linien 142, 144 und 194, beinahe „direkt vor der Tür“, aber eben doch nicht so nah, dass sie störten (s. Titelbild). Der 142er bringt mich in drei Minuten zum Stadtwaldplatz (von wo ich in acht Minuten den S-Bahnhof Stadtwald zu Fuß erreichen kann), in acht nach Rüttenscheid. Mit dem 194er bin ich in elf Minuten in Bredeney, in entgegengesetzter Richtung bringt er mich in 13 Minuten nach Steele, in 24 Minuten nach Kray und in einer guten halben Stunde nach Gelsenkirchen. Der 144er ist zwar eigentlich ein „Schulbus“ der nur am frühen Morgen und zur Mittagszeit verkehrt. Aber wenn ich meine Schwiegereltern in Überruhr besuchen will, ist auch diese Verbindung sehr nützlich für mich. Die Straßenbahnhaltestelle der Linie 105 am ehemaligen Rathaus Rellinghausen erreiche ich zu Fuß ohne Eile in fünf Minuten. Mit ihr gelange ich in acht Minuten zum Bahnhof Essen-Süd (mit der S-Bahn-Verbindung Richtung Essen-Hauptbahnhof bzw. nach Düsseldorf und Köln), in 15 Minuten zum Essener Hauptbahnhof und in 24 Minuten zum Berliner Platz.
Die Linie 105 verkehrt an Werktagen im Zehn-Minuten Takt, der 142er und der 194er zwanzigminütig; frühmorgens, spätabends, samstags und an Sonn- und Feiertagen natürlich in größeren Abständen. Allerdings ist meine Heimatstadt Essen, wie übrigens die meisten Städte im Ruhrgebiet, nicht unbedingt ein Mekka für Nachteulen. Die letzte U- oder S-Bahn ab Essen-Hauptbahnhof fährt schon um um 23:23 Uhr! Das hat soeben Matthias Stolt in der immer wieder interessanten Deutschlandkarte gezeigt (in: ZEITmagazin Nr. 38 v. 10. September 2009, S. 10). Aber aus dem Alter bin ich schließlich raus, wo man Spaß daran hat, unter der Woche die Nacht zum Tage zu machen.
Wäre für mich wegen meiner Schwerbehinderung die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel nicht ohnehin bis auf einen Jahresbetrag von 60 Euro für die Wertmarke kostenfrei, dann käme ich in den Genuss der Beförderung mit Bus und Bahn am billigsten mit einem Ticket1000 9 Uhr der Preisstufe A1, für das ich gerade mal 36 Euro monatlich berappen müsste.
Es stimmt schon: Manchmal kommt ein Bus mit Verspätung, hin und wieder werden Fahrgäste in der Bahn durch laute Handytelefonate lästig oder verströmen einen säuerlichen Körpergeruch. Solche kleinen Schönheitsfehler des ÖPNV werden von den Autofahrern, also der erdrückenden Mehrheit der Menschen hierzulande, immer wieder als Begründung bemüht, warum sie sich ein Leben ohne ihre Privatkarossen nicht vorstellen können. Aber ich argwöhne, dass dies nur Ausreden sind und der wahre Grund tiefer liegt.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Rundgang (XI)
Saturday, 26. September 2009
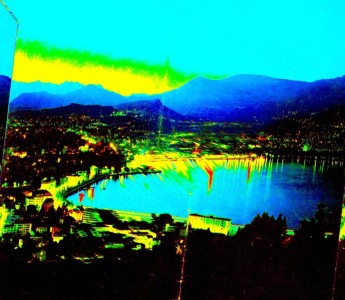
Merkwürdige Werbung im Schaufenster einer „alternativen“ Fahrschule. Ein Poster mit dem Bildnis eines Kindes, offensichtlich an das berühmte Che-Guevara-Porträt angelehnten. Darüber der Slogan: It’s time for another revolution – Zeit für Deine Bedürfnisse! Unter diesem Werbeplakat eine modellhafte Liliputwelt. Ein Plastik-VW-Bus, ein Streifen Sand mit ein paar Muscheln und Seesternen und dergleichen Abenteuerurlaubskitsch mehr.
Wenn ich versuche, die unterschwellige Botschaft dieses Arrangements ans Licht zu zerren bzw. deutlich werden zu lassen, dann kommt dabei ungefähr Folgendes heraus:
„Wenn du zu jenen Idealisten gehörst, die sich in der Vergangenheit überwiegend um die Mühseligen und Beladenen unserer Erde gekümmert haben und die zwangskolonisierten Völker der Dritten Welt befreien wollten, dann ist es jetzt aber höchste Zeit, dass du dich endlich auch einmal um dich selbst kümmerst. (Und hast du es noch nicht vernommen: ,Dritte Welt‘ sagt man längst nicht mehr. Heute ist ,Eine Welt‘ angesagt!)
Klar, die Revolution war ein tolles Event, Idealismus pur, aber jetzt können mal andere den Kampf weiterführen. Du hingegen hast dir redlich verdient, auf große Tour zu gehen und das Leben ab sofort mal ganz hedonistisch zu genießen. Damit du diesen Geschmack von Freiheit und Abenteuer auf die andere Art unbeschwert und sorgenfrei erfahren kannst, solltest du aber zuallererst einen Führerschein machen. Das befreit richtig!
Wenn du dann endlich die Fleppe hast, dann drück doch mal kräftig aufs Gaspedal. Wer weiß denn, wie lange das Benzin noch halbwegs erschwinglich ist?“
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Reweljuschn
Saturday, 26. September 2009

H. erzählt mir von dem Krimiautor Janwillem van de Wetering (1931-2008), der auf der Suche nach der Wahrheit zunächst bei dem betagten Bertrand Russell (1872-1970) in London Philosophie studiert habe. Als er dort keine ihn befriedigenden Antworten auf seine vielen Fragen fand, empfahl ihm Russell angeblich, nach Japan in ein Zenkloster zu gehen.
Mal abgesehen davon, dass ich für eine Begegnung van de Weterings mit Russell keinen Beleg finde und er nach meinen Informationen vielmehr 1958 kurzzeitig als „freier Student“ Philosophievorlesungen bei Alfred Jules Ayer (1910-1989) am UCL in London hörte, bevor er sich auf den Weg nach Kyoto begab, forderte diese Einleitung zu einem offenbar von Sympathie für van de Wetering getragenen Porträt des Niederländers meinen Widerspruch heraus.
Die alte Geschichte von dem unerschütterlich Fragenden, der sich mit einfachen Antworten nicht zufriedengeben will und immer weiter und immer tiefer fragt und bohrt und beharrt – sie hat ihre ursprüngliche Faszinationskraft für mich längst vollkommen verloren. Es kommt nicht drauf an, dass man die richtigen Antworten gibt, sondern dass man die richtigen Fragen stellt? Nein! Auch das ist eine Täuschung, denn es gibt keine „richtigen“ Fragen, wie es auch keine „falschen“ und erst recht keine „dummen“ Fragen gibt.
Die Vorstellung von einem bohrenden Wahrheitssucher, der in die weite Welt hinauszieht, um dort Antworten auf seine „letzten Fragen“ zu finden, hätte mich vielleicht vor vierzig Jahren noch angeheimelt. Aus dem Alter bin ich aber längst raus. Ich erinnere mich, dass die Kunden in der Buchhandlung, die nach den Krimis mit den Amsterdam-Cops fragten, eine erkennbar andere Sorte abgaben als jene, die sich für Sjöwall-Wahlöös Kommisar Martin Beck erwärmten. Die Erfahrung, dass man die Menschen nach ihrer Krimi-Lektüre, oder ganz generell nach ihren literarischen Interessen in Gruppen sortieren kann, wo sie dann untereinander auch viele weitere Ähnlichkeiten aufweisen, hat mich entscheidend geprägt. Und ich bin für alle Zukunft zu ernüchtert, um noch annehmen zu können, dass man in einem Krimi „bedeutsamere“ Fragen finden kann als die, wer zum Teufel der Täter ist.
Ansonsten gilt bis auf Weiteres: Es gibt für uns und von uns Menschen keine „endgültigen“ Antworten und keine „letzten“ Fragen.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Whodunit?
Friday, 25. September 2009

Gerade erst vor vier Jahren bei Klartext in Essen erschienen und schon wieder im Ramsch: der wunderbare große Bildband über die legendäre Krupp-Jubiläumsfeier zum hundertjährigen Bestehen der Firma im Jahre 1912. Die Bücherverschrottung findet in immer kürzeren Intervallen statt. Ich erinnere mich noch gut, dass zum Beispiel die Tagebücher von Hugo Ball, Die Flucht aus der Zeit, in der 1946er-Ausgabe des Stocker-Varlags in Luzern bis weit in die 80er-Jahre hinein ganz regulär lieferbar waren, zum Preise von dreizehneinhalb Schweizer Franken. War damals der Lagerplatz so viel billiger – oder die Geduld der Verleger einfach größer?
Verwunderlich auch, dass Autor und Verlag nicht bis zum Jubiläumsjahr 2012 gewartet haben. Da hätte die ThyssenKrupp AG doch gewiss eine stattliche Menge als Präsent für Freunde im In- und Ausland abgenommen. Nun kann man zwar in drei Jahren einen preiswerten Nachdruck herstellen, falls gewünscht mit besonderem, „individualisiertem“ Einband oder speziellen Vorsatzblättern des Unternehmens. Aber ein solches Präsent kommt doch mindestens bei jenen Beschenkten nicht gut an, die sich das Buch bereits 2005 zum Preis von ursprünglich 29,95 Euro zugelegt haben – und das sind schließlich jene, die wenigstens oberflächlich an der Geschichte Krupps interessiert sind. Bei den anderen Jubiläumsgratulanten bedankt man sich ohnehin besser mit einem Fläschchen Krimsekt.
Das Jubiläumsbuch zum Jubiläum kostet nun bei den örtlichen Großbuchhändlern, bei der Mayerschen und Thalia, nurmehr ein Drittel seines Originalpreises und wird so hoffentlich noch viele dankbare Käufer, Leser und vor allem Betrachter finden. Die verdient es nämlich, denn es bietet eine Fülle nie zuvor veröffentlichter Bilder mit großer Aussagekraft und hohem Erkenntniswert. „Herr Prof. Dr. h. c. mult. Berthold Beitz (*1913) und die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung“ haben als Inhaber des Historischen Archivs Krupp in Essen die Abdruckgenehmigung für diese Bilder erteilt. Ausdrücklich heißt es aber einschränkend: „Die Bildrechte verbleiben weiterhin beim Historischen Archiv Krupp.“
Tja, was heißt das nun für mich, den kirchenmausarmen Non-Profit-Blogger? Darf ich meinen doch ganz unschuldig für dieses schöne (und zudem jetzt selbst für mich noch erschwingliche) Buch werbenden Artikel nicht mit einem Bild aus dem besagten Buch schmücken? Zum Beispiel mit jenem Foto des „Stammhauses“ von 1935, inmitten der Werksanlagen zwischen der Rückseite des neuen Hauptverwaltungsgebäudes und dem Martinwerk 3? Na gut, dann scanne ich dieses berühmte Bild nicht von Seite 57 des neuen Buches, sondern von der Tiefdrucktafel gegenüber Seite 206 des Buches von Wilhelm Berdrow, das zum Jubiläum 150 Jahre Krupp 1937 [!] erschienen ist.
(Und der guten Form halber hier auch die vollständigen bibliographischen Angaben beider Bücher. Wilhelm Berdrow: Alfred Krupp und sein Geschlecht. 150 Jahre Krupp-Geschichte 1787-1937 nach den Quellen der Familie und des Werks. Mit über 100 Bildern im Text und auf 32 Tiefdrucktafeln. Berlin: Verlag für Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistik Paul Schmidt, 1937. – Klaus Tenfelde: „Krupp bleibt doch Krupp“. Ein Jahrhundertfest: Das Jubiläum der Firma Fried. Krupp AG in Essen 1912. Essen: Klartext Verlag, 2005.)
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Stammhaus
Friday, 25. September 2009
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Ein Präsident
Friday, 25. September 2009

Noch so ein Motiv rund ums Buch, das es mir seit Langem angetan hat: der Dichter als Vorleser. Als Buchhändler „in leitender Stellung“, zeitweise zuständig für Werbung und Marketing, hatte ich mich neben anderen honorigen Aufgaben auch um Autorenlesungen zu kümmern – ein nicht immer ganz einfaches, oft sogar nervtötendes, selten dankbares Tätigkeitsfeld. Die Autoren kamen meist schon mit Vorbehalten in unsere Stadt. Zwischen Düsseldorf gestern und Münster morgen war ihnen vom Verlag zum Überfluss und -druss noch diese langweilige Ruhrmetropole aufs Auge gedrückt worden.
Wir Buchhändler sehen den Lesungen ja auch oft mit gemischten Gefühlen entgegen. Im günstigsten Fall hat der Gast die Talente eines guten Alleinunterhalters, liest nicht viel, erzählt lieber, was ihm gerade in den Sinn kommt, führt vor, dass Dichter auch bloß Menschen aus Knochen, Sehnen und Speck sind et cetera. Als einen solchen herzlichen Menschenfreund habe ich als seltenes Beispiel Volker Elis Pilgrim in guter Erinnerung. Was für ein Buch er damals vorgestellt hat, der eigentliche Anlass seines Besuchs also? Ist mir völlig entfallen.
Gegen solche seltenen Ausnahmen stehen leider etliche Totalversager, was Rezitationskunst und Selbstdarstellung betrifft. Peter Handkes Lesung zum Beispiel, wohl aus Der kurze Brief zum langen Abschied, eine der ersten, die ich noch als namenloser Zuhörer besuchte? Ein schnell und dauerhaft wirkendes Schlafmittel, das mich ein für alle Mal gegen diesen schriftstellernden Poeten einnahm. – Und Hans Mayer mit seinen Erinnerungen, Ein Deutscher auf Widerruf? Die Herablassung in Person! Er beschwerte sich bitterlich bei seinem Publikum, dass es nicht in größerer Stückzahl erscheine, um den Ausführungen eines so bedeutenden Mannes zu lauschen, wie er doch bekanntermaßen einer sei. Er komme gerade aus Detmold oder Wesel, selbst da seien mehr Menschen erschienen als hier, in dieser „angeblichen Großstadt namens Essen“. Damals gab es das Wort „fremdschämen“ noch nicht, vermutlich ist es aber einem Buchhändler bei einem solchen peinlichen Anlass eingefallen.
Das Verhältnis unserer Dichter zu den Buchhandlungen, in denen sie auf Geheiß ihrer Verleger lesen müssen, ähnelt dem Verhältnis von uns Buchhändlern zu den Dichterlesungen, die uns die Freizeit rauben und kaum zusätzlichen Umsatz bringen, aufs Haar in der Suppe: Man mag’s nicht, man ekelt sich und könnte laufen gehen. Ein schönes Beispiel für diese Aversion habe ich gerade eben in einem veröffentlichten Tagebuch gefunden, aus der Nachbarstadt Dortmund und insofern besonders interessant für den Revierflaneur: „15. 3 [1972] – 10.33 Abfahrt nach Dortmund und ein schönes diesiges Blau über einige 100 Kilometer verheißungsvoll hingestreckt, also richtig ,Frühling läßt sein blaues Band …‘ In D. dann allerdings als erster Eindruck ein Hotelrestaurant mit dem Namen ,Bahnhofsblick‘, was mir nicht gerade einladend schien und am ehesten noch den ,drei Paßbildern‘ entsprach, die man mir im voraus für Presse u. Veranstaltungskalender abgefordert hatte. Auch war kein Abholer / Cicerone am Zug, wie es allgemein üblich ist, im Hotel kein Grußbilett oder sonstiges Aufmerksamkeitszeichen bei der Rezeption hinterlegt, nicht mal eine Telefonnummer, an die ich mich hätte wenden können, also abends allein u. zufuß zum ,Museum am Ostwall‘, wo die Lesung stattfinden sollte. Der Empfang durch die beiden Kultursachverständigen Herren Wolf u. Thiemann (o. ä.) entsprechend frostig bis unhöflich und die drei Einführungssätze vor Beginn auch nicht gerade zum lustigen Loslegen ermunternd. Das Publikum zunächst von fast einschläfernder Geduld, anscheinend schon jahrelang hinter dem Gatter gehalten u. insofern unsicher, ob man bei Bedarf lachen oder applaudieren oder wenigstens versonnen nicken dürfe. Erst in der unvermeidlichen Diskussion plötzlich von der Aggressivität losgelassener Hofhunde: ,Möchte’ mal fragen, ob Se ne unbewältigte Vergangenheit ham?!‘ War Gottseidank durch u. durch erkältet, fast schon taub, so daß ich meiner Geburtsstadt angemessen begegnen konnte: ,Nee, Vergangenheit, schon alles klar, aber Ihre Gegenwart wohl in diesem musischen Kreis eher einem Mißverständnis zu verdanken.‘ Erstes Wiedersehen mit D-Mund nach meinem Geburtstag am 25. 10. 29. – Kühler unpersönlicher Abschied. Sachlich Tasche gepackt. Blicklos lieblose Pfoten berührt.“ (Peter Rühmkorf: TABU II. Tagebücher 1971-1972. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2004, S. 208 f.)
Man möchte dem nachgehen in die Einzelheiten, der eine der beiden „o. ä.“ namhaft gemachten Gastgeber ist noch einwandfrei identifizierbar, es dürfte sich um Dr. Eugen Thiemann (1925-2001) gehandelt haben, der das Museum am Ostwall in den Jahren von 1967 bis 1987 leitete. Im Unterschied zu ihm gibt es das wenig einladende Hotelrestaurant Bahnhofsblick noch immer, die Adresse ist Königswall 18. Der Fußweg zum Museum dürfte in zehn Minuten zu bewältigen gewesen sein, man könnte ihn, quasi in memoriam, getreulich abschreiten, wenn man denn wüsste, ob Rühmkorf den weiteren, aber sichereren Weg über den Burgwall gewählt oder sich sozusagen querbeet durchgeschlagen hat, zum Beispiel über die Plätze von Amiens und Netanya zum Markt und dann durch die Brauhaus- und Viktoriastraße ans Ziel. Spätestens hier endet aber die Rekonstruktion einer peinlich missglückten Heimkehr, das Museum am Ostwall hat am 18. Juni seine Tore an diesem Ort endgültig geschlossen und wird im Mai 2010 mit neuem Schwung – „Das Kunstmuseum als Kraftwerk“ – im Dortmunder U eröffnen. – Und was sagt der Fatzke da aus der dritten Reihe? „Möchte’ mal fragen, ob Se ne unbewältigte Vergangenheit ham?!“ Na, das erinnert doch, als wär’s das Negativ zum Positiv, an dieses bekannte Gedicht des verstorbenen Meisters: „[…] Wollte nur mal fragen, wie’s so ist. / Wollte nur mal sehn, ob meine Sterne / Noch am Leuchten sind / Und man mich in der Ferne / Etwa gar vermißt … // Wollte eigentlich, / wollte, weil mein Sinn für das Posthume / wie bekannt in engen Grenzen bleibt / und der Geist auf seiner schmalen Krume / ungenetzt nur parfümierte Blumen treibt, / also, wollte fragen, ob man sich … […].“
[Hier gehts zur Fortsetzung Vorlesepein (II).]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Vorlesepein (I)
Saturday, 19. September 2009
Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Friday, 18. September 2009

Heute ist die Feinauswahl jener Grobauswahl der 154 deutschsprachigen Romane bekanntgegeben worden, die zwischen dem 1. Oktober 2008 und dem 16. September 2009 erschienen sind. Eine siebenköpfige Jury hat aus den zuvor nominierten 20 Büchern nun noch einmal sechs selektiert, die sie aus gewissen Gründen für die besten hält. Der Jury gehören bei dieser fünften Verleihung des Deutschen Buchpreises sechs Literaturkritiker und ein Buchhändler an: Richard Kämmerlings (Frankfurter Allgemeinen Zeitung), Michael Lemling (Buchhandlung Lehmkuhl, München), Martin Lüdke (freier Literaturkritiker), Lothar Müller (Süddeutsche Zeitung), Iris Radisch (Die Zeit), Daniela Strigl (Literaturkritikerin und -wissenschaftlerin) und Hubert Winkels (Deutschlandfunk).
Dieser hochrangige Literaturpreis, der schon mit dem französischen Prix Goncourt und dem englischen Booker Prize verglichen wurde, bringt dem Sieger immerhin 25.000 Euro und jede Menge Publicity und seinem Verlag hohe Verkaufszahlen ein. Wo soviel Geld im Spiel ist, lässt der Verdacht nicht auf sich warten, dass die Kriterien der Auswahl und schließlichen Prämierung eben doch nicht rein ästhetische, literarische sind. Im vorigen Jahr um diese Zeit hat es eine hitzige Diskussion über diese Frage gegeben, bei der die Stellungnahme von Monika Maron mir in besonders guter Erinnerung geblieben ist, weshalb ich sie hier in voller Länge zitiere: „Es ist vollkommen gleichgültig, ob die Shortlist akzeptabel ist oder nicht, ob das prämierte Buch den Preis verdient haben wird oder nicht, weil dieser Preis kein Buchpreis, sondern ein Marketingpreis ist. Es geht nicht um Literatur, sondern um die Verkäuflichkeit von Literatur ohne großen Aufwand, vom Stapel weg wie die neueste Single vom neuesten Superstar. Diese krawallige Castingshow dient weder den Verlagen, noch weniger den Autoren, sondern vor allem den bestsellersüchtigen Buchhandelsketten, deren vielgeschmähtes Geschäft wir mit diesem Preis nun aber selbst auf die Spitze treiben. Dieser Preis gehört abgeschafft, schreibt Michael Lentz; recht hat er. Statt dessen spielen alle mit, weil sie fürchten, sonst nie mehr auf den Listen von Hugendubel und Thalia zu landen oder nie wieder, nicht einmal schlecht, rezensiert zu werden, denn die Literaturkritik ist der andere Gewinner des Spektakels. Plötzlich hat sie wieder Macht, nachdem ihre Hymnen oder Verrisse für den Verkauf nahezu wirkungslos geworden waren. Wären wir nicht so unsolidarisch wie wir sind, würden wir, die Autoren, den Buchpreis boykottieren, statt uns als Spielmaterial für Marketingstrategien vorführen zu lassen. Es gibt genügend Preise, die der ernsten und wenig glamourösen Arbeit des Bücherschreibens angemessen sind. Dieser ist es nicht.“ (Monika Maron am 17. September 2009 im „Lesesaal“ von FAZ.NET zu der Frage: „Was taugt die Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2008?“)
Da ich nun schon einmal etwas misstrauisch geworden bin, fällt mir doch auf, dass nahezu alle großen belletristischen Verlage in dieser Auswahl vertreten sind: S. Fischer, Hanser, C. H. Beck, Kiepenheuer & Witsch, Resident und Suhrkamp. Keiner kommt doppelt vor – und ein Außenseiter hat es auch nicht geschafft. Komischerweise fielen aber alle Namen der ursprünglichen Longlist, die mir mindestens vom Hörensagen vertraut waren – Sibylle Berg, Thomas Glavinic, Reinhard Jirgl und Brigitte Kronauer – dem Rotstrich der Juroren zum Opfer, mit einer Ausnahme: Herta Müller. Haben also diesmal ganz junge Schreiber eine Chance bekommen? Das kann man auch wieder nicht sagen, denn von den verbliebenen Autorinnen und Autoren der Shortlist zähle ich vier zu meiner Generation: Der Älteste, Norbert Scheuer, ist fünf Jahre älter, Rainer Merkel acht Jahre jünger als ich. Allein Stephan Thome (* 1972) und Clemens J. Setz (* 1982) kann man als Nachwuchsautoren bezeichnen. Nachdem Leseproben aus allen zwanzig Büchern schon in einem Reader präsentiert wurden, der seit dem 23. August in den Buchhandlungen ausliegt, kann man sich von den sieben Finalisten nun ein genaueres Bild machen. Alle sieben Bücher sind erschienen. Erfreulicherweise sind die meisten Romane verhältnismäßig schmal, allein der Wälzer des Jüngsten, von Clemes J. Setz, fällt mit seinen über siebenhundert Seiten aus dem Rahmen. Immerhin muss man aber doch 2.205 Seiten bewältigen und 124,50 € auf den Zahlteller legen, wenn man im Bilde sein will, was die Kenner von der lesenden Zunft in diesem Bücherherbst 2009 für lesenswert halten.
Aber da gibt es ja noch abertausende von Büchern aus den vergangenen Jahren und Jahrhunderten, die ungelesen in den Schränken und Regalen meiner Zuwendung harren. Das Vergnügen, das sie verheißen, hat teils wesentlich vertrauenswürdigere Fürsprecher als die oben genannten Herrschaften und ist zudem ganz kostenlos, denn diese Bücher sind ja längst bezahlt. Woher kommt es nur, dass wir uns immer von der vermeintlichen Brisanz des Aktuellen anstecken lassen? Schon in meiner Zeit als Buchhändler (1978 bis 1995) kam mir irgendwann der Novitäten-Hype im Halbjahresturnus reichlich albern vor. All diese Ignoranten, die an einem meterlangen Klassikerregal – das gab es damals bei G. D. Baedeker an der Kettwiger Straße noch – vorbei auf mich zusteuerten mit der Frage nach dem allerneuesten Roman: Wie degoutant! Und ich gestehe frank und frei: Ich würde mich freuen, wenn der diesjährige Kassenschlager eben nicht vom Deutschen Buchpreisträger käme, sondern von einem Geheimtipp aus der zweiten oder dritten Reihe, aus einem der zahllosen Kleinverlage von Lilienfeld bis Blumenbar, die kein Kassenwart und kein Marketingfritze auf der Rechnung hatte.
Posted in Würfelwürfe | 3 Comments »
Tuesday, 15. September 2009
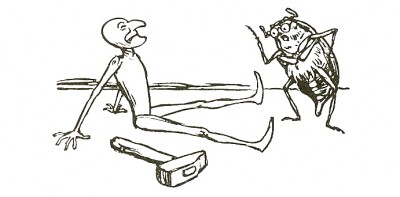
Wenn die Oma immer schussliger wird und schließlich ihr Rezept vom Doktor am Bankschalter vorlegt, dann ist das eher komisch, allenfalls tragikomisch. Wenn aber ein von allen Medien, Verlagen und seinen Standesgenossen bis zuletzt noch als Doyen der Literaturkritik umschmeichelter, wortgewaltiger, weitläufig belesener Mann des Geistes und der Feder allwöchentlich die Auflösungsprozesse seiner Urteilskraft öffentlich vorführt, dann ist das tragisch – und zudem eine Gemeinheit jener, die ihm dazu die Bühne stellen.
So geschieht es stets am Sonntag in „seiner“ Frankfurter Allgemeinen keinem Geringeren als dem armen Marcel Reich-Ranicki, dessen Verdienste um die TV-adäquate Popularisierung unterhaltender Literatur nicht hoch genug zu schätzen und zu loben sind. Eigentlich sollte er doch auf seine alten Tage nicht nötig haben, dermaßen minderwertige Kolumnen abliefern zu müssen. Ich habe vor über zwei Jahren, damals noch in meinem Westropolis-Blog, einen ersten Stoßseufzer in Richtung FAS-Chefredaktion abgeschickt, den armen alten Mann vor sich selbst in Schutz zu nehmen. Aber vermutlich haben Leserbefragungen ergeben, dass sein guter Name immer noch für ein paar Prozent der Abonnenten ein Beweggrund ist, das Blatt nicht abzubestellen. Anders kann ich mir jedenfalls nicht erklären, warum diese Zeitung ihm immer noch die Treue hält. Oder sind die dort Verantwortlichen schlicht zu feige, ihrem „Starautor“ die Wahrheit zu sagen? Wenn er vor Jahren im Fernsehen sein grandseigneureskes Gehabe gelegentlich überzog, dann war dies selbst mit der Dickfelligkeit eines abgehärteten Glotzeguckers kaum noch zu ertragen. Jetzt aber tritt uns kein kauziger Grandseigneur mehr entgegen, vielmehr verschleift sein Tonfall ins dumpf Onkelhafte – und das grenzt nun wirklich an Folter.
Zuletzt hatte Reich-Ranicki sein Heil in der Kürze gesucht und allerknappste Frage-Antwort-Textchen veröffentlicht nach dem Schema: „Warum ist der Autor X heute vergessen? – Weil es sich nicht lohnt, sich seiner zu erinnern.“ Dass er selten eine Begründung für seine Verbannungsurteile für nötig hielt, musste man schon deshalb durchgehen lassen, weil die Fragenden ihre Irritation ja auch nicht begründeten. An dieser Stelle sei mein Argwohn nicht verschwiegen, ob sich Reich-Ranicki nicht nur die Antworten, sondern oft auch die Fragen selbst ausdenkt. Wenn ein Peter Hausmann (Dresden) den Großkritiker was fragt, dann ist es ja schlicht unmöglich zu beweisen, dass in Dresden kein Mann dieses Namens lebt. Ein bekennender Filou war Reich-Ranicki ja immer schon. Und selbst wenn man ihm hier auf die Schliche käme, könnte ihm das nichts mehr anhaben, er wäre vermutlich noch stolz auf seine Schlitzohrigkeit und froh, endlich mal wieder in der Bild-Zeitung zu stehen.
Bei der angeblichen Waltraud Fink, die dem Briefkastenonkel von der FAS in den vergangenen beiden Wochen den folgenden Steilpass zu einer weit ausholenden Antwort lieferte, wird auf die Angabe eines Absendeortes ganz verzichtet: „Wie beurteilen Sie den Literaturkritiker Kurt Tucholsky?“ Nachdem Reich-Ranicki im ersten Teil seines wohl summarisch gemeinten Statements zu Tucholsky festgestellt hat, dass dieser Rezensent keine „Gutachten eines Sachverständigen“ verfasst habe, sondern „Bekenntnisse und Geständnisse eines Betroffenen“, kommt er in Teil zwei auf die Arbeitsbedingungen, um nicht zu sagen: auf die Arbeitsmoral seines großen Vorbilds zu sprechen. Man lese und staune: „Den meisten seiner Rezensionen kann man anmerken, wie rasch er sie schrieb und wie selten er sich bemühte, tiefer in die Materie einzudringen, und wie oft er sich mit Pauschalurteilen und mit gewöhnlichen Klischees begnügte.“ Und nun folgt eine sehr entlarvende Begründung, warum Reich-Ranicki meint, „seinen“ Tucholsky, sozusagen von Rezensent zu Rezensent, dennoch auf das Höchste loben zu müssen. Damit hat er nicht nur eine Ausrede, sondern gleich noch ein namhaftes Vorbild für seine eigene Faulheit und Schlampigkeit.
Gerade fiel mir beim Auspacken meiner Bibliothek die schöne kleine Taschenbuchausgabe von Bierbaums Kasperlegeschichte Zäpfel Kerns Abenteuer (frei nach Pinocchio) in die Hände, die der Insel-Verlag dankenswerterweise 1977 neu herausgebracht hat, und gar mit den alten Illustrationen von Arpad Schmidhammer (s. Titelbild). Der bedeutendste Kritiker unseres Landes in dieser Zeit konnte das Buch nicht finden, „in keinem Nachschlagebuch und in keiner Literaturgeschichte.“ Dafür wusste er aber neulich zu berichten, dass Thomas Manns Buddenbrooks bei ihrem Erscheinen zunächst völlig verkannt worden seien und es lange gedauert habe, bis das Urteil diesem Meisterwerk gerecht wurde. Als die Interviewerin erstaunt nachhakt, macht er wieder, was er immer macht, wenn er bei einem Fehler erwischt wird, viele Male konnten wir’s im Literarischen Quartett bewundern: Er beharrt kurz auf seinem Irrtum, im Brustton der Überzeugung, um dann blitzschnell zu einer weniger angreifbaren Behauptung überzuleiten. – Ach, es ist so fad! Und ich werde nun ganz gewiss kein Wort mehr über den Mann verlieren.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Immer schlimmer
Monday, 14. September 2009

Nachdem ich nun gestern Abend alle fünf Artikel gelesen habe, komme ich leider zu einem niederschmetternden Ergebnis. Aber der Reihe nach. – Was uns Julia Encke vom Auftritt der Oulipo-Autoren Hervé Le Tellier, Jacques Roubaud, Ian Monk, Frédéric Forte, Olivier Salon und Marcel Bénabou in einer halben Spalte mitteilt, das richtet sich an Leser, die von Oulipo noch nie zuvor gehört haben – und führt sie nach nur sechzig kurzen Zeilen zu der beruhigenden Einsicht, dass sie sich diesen Namen auch zukünftig nicht merken müssen. Die Kulturwissenschaftlerin Julia Encke hat ein viel beachtetes Buch über die Sinnesorgane im Krieg der Neuzeit geschrieben. Nach der Befassung mit einem so ernsten Thema reagiert man vielleicht notgedrungen ablehnend auf das, was Encke den „Sprachfuror von manischen Sprachformalisten […], von Grammatikfetischisten und Spielern“ nennt. Über die Oulipo-Stars, die am 11. September 2009 in Berlin auf der Bühne des Internationalen Literaturfestivals saßen und „Selbstporträts in Arbeitsproben“ zum Besten gaben, erfahren wir leider nicht viel mehr, als dass sie dabei kicherten: „Sie kicherten eigentlich ununterbrochen. […] Da kicherte man dann auch, in diesem traumhaft vergangenen Theater.“
Na, vielleicht war ja bei dem Erzählwettbewerb am Broadway mehr los, bei dem der Ungar Péter Zilahy, zurzeit Stipendiat im Einstein-Haus in Caputh, seine Geschichte Das Opfer vorgetragen hat. Das ist allerdings schon ein Weilchen her, was die Sonntagszeitung schamvoll verschweigt. Der Leser hätte sonst auf die Frage verfallen können, warum ihm ein New Yorker Bühnenauftritt vom 21. Mai dieses Jahres mit solcher Verspätung noch zum Frühstück serviert wird. Aber Zilahy ist selbst nicht einer von der schnellen Truppe, die Meldung von seiner Spoken-Word-Performance im Symphony Space steht heute noch als Ankündigung (!) auf seiner Homepage. Wenn man sich die vier Archivbilder von dem sympathischen Fabulierer anschaut, wie er da „frei sprechend, ohne Notizen“ wild gestikuliert, dann bereut man, nicht dabeigewesen zu sein, wie das Publikum, abgezählte „840 Zuschauer“, den jungen Ungarn feierten. Schwarz auf weiß nachgelesen ist der Text leider keinen Pfifferling wert. Offenbar ein Seitenfüller der FAS-Redaktion, die nun mal die Übersetzung von Matthias Fienbork bezahlt hat und sich nun mit argem Verzug gezwungen sieht, sie mangels besserer Alternativen zu verwenden.
Jochen Reinecke hat ja mit seiner Idee zum Dauerbrenner Gehen Sie ins Netz? für die nächsten tausend Jahre ausgesorgt. Er verbindet wöchentlich einen originellen Link-Tipp mit einer kleinen Denksportaufgabe, bei der eine Google-Suchabfrage gefunden werden muss, die zu einem bestimmten Ergebnis führt. Für diese Art Hirnakrobaktik habe ich keine Zeit, aber die Links schaue ich mir gelegentlich an. Diesmal wurde mir in Aussicht gestellt, dass ich hier oder dort ein Phantombild erzeugen könnte, das ich zukünftig auf meiner Website als „Porträt des Herausgebers“ zeigen könnte. Na, so ganz bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden (s. Titelbild).
Mit dem Universalgenie, dem Stettiner Studienrat Hermann Graßmann, lohnt sich‘s vielleicht, eingehendere Bekanntschaft zu schließen. Ein Kandidat für meine Eccentrics? Nach dem, was sich Sabine Wienand in der FAS über ihn abgerungen hat, komme ich zu keinem endgültigen Entschluss. Das Bild macht 825 Quadratzentimeter aus, ihr Text kommt bloß auf 370! Langsam kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass in dieser Sontagszeitungsredaktion ausgesprochene Sonntagsschreiber am Werke sind, Zeilenschinder, die sich jeden einzelnen läppischen Satz abquälen müssen wie ein Obstipierter seine Wurst.
Was bleibt? M. R.-R.s Antwort auf die Frage von Waltraud Fink, wie der Kritiker-Papst den Literaturkritiker Kurt Tucholsky beurteilt. Na, für heute habe ich mich genug geärgert, da mache ich einen eigenen Beitrag draus.
[Und der folgt morgen.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Sonntagszeitung? (II)
Sunday, 13. September 2009

Warum hält man eine Sonntagszeitung? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der eine Abonnent erträgt, zum Beispiel, die plötzliche Leere am Frühstückstisch nicht, wenn man nach sechsfacher morgendlicher Zeitungslektüre gerade an jenem Tag darauf verzichten soll, an dem man Zeit hätte, ihr ohne jede Hektik zu frönen. Ein anderer findet unter der Woche gar nicht die Zeit, sich das tagesaktuelle Weltgeschehen von der Presse erzählen und erklären zu lassen; so hofft er, am Tag des Herrn eine Zusammenfassung geliefert zu bekommen. Dieser wie jener nimmt vielleicht auch an, dass die Sonntagszeitung sozusagen in feinerem Gewand daherkommt, besonders proper und mit Liebe herausgeputzt, als wollte sich der Journalismus von seiner besten Seite zeigen.
Die beiden Sonntagszeitungen, die mir schon aus meiner Jugend bekannt sind, kamen für mich aus politischer Abneigung nicht in Frage: die Bild am Sonntag und die Welt am Sonntag, beide aus dem Hause Springer. Erst als die Frankfurter Allgemeine im September 2001 landesweit eine eigene Sonntagsausgabe herausbrachte, ließ ich mich zu einem Abonnement verführen, für zuletzt 14,50 € monatlich, das sind 174 € im Jahr oder rund 3,30 € pro Ausgabe – also 40 Cent mehr als am Kiosk oder beim Bäcker. Da stutzt man schon, denn sonst ist doch in aller Regel ein Abo billiger: wegen der langfristigen Verpflichtung, die man da eingeht, auch wegen der Regelmäßigkeit des Bezugs. Zudem zahlt man mindestens für ein Vierteljahr im Voraus. Aber gut, der Zusteller muss ja auch von etwas leben. Und ob die FAS ihren Preis für mich wert ist, das will ich nicht von solchen Kleinigkeiten, gar Kleinlichkeiten abhängig machen.
Sondern ausschließlich vom Inhalt – und vom Nutzen, den mir dieser Inhalt bringt. Und was das betrifft, muss ich zunächst einmal bekennen, dass von dem Dutzend „Heften“, aus denen die Sonntagszeitung besteht, mich zwei Drittel rein gar nichts angehen: Sport, Wirtschaft, Geld & Mehr, Reise, Technik & Motor, Immobilien, Beruf und Chance sowie zwei „Hefte“ Inserate fliegen unbesehen in die Altpapierkiste. Allein dem politischen „Mantel“, dem Feuilleton und den Teilen Wissen und Gesellschaft widme ich ein Viertelstündchen lang meine Aufmerksamkeit, auf der Suche nach Artikeln, die ich am Abend dann eingehender studieren will.
Heute waren es genau fünf: auf S. 24 ein Bericht (von Julia Encke) über den Auftritt von sechs Autoren der Gruppe Oulipo beim Literaturfestival in Berlin; auf S. 27 die deutsche Übersetzung einer Geschichte des Ungarn Péter Zilahy, mit der er einen Erzählwettbewerb im Symphony Space am New Yorker Broadway gewonnen hat; auf S. 29 die stets höchst ärgerliche Rubrik Fragen Sie Reich-Ranicki, die ich mir nie entgehen lasse, weil ich mich über ganz bestimmte Angelegenheiten gern ärgere; auf S. 65 die Rubrik Gehen Sie ins Netz? von Jochen Reinecke; und auf S. 68 ein ganzseitiger Artikel über Das Universalgenie von der Odermündung, den Stettiner Studienrat Hermann Graßmann, der ja ein Kandidat für meine Eccentrics sein könnte. Ob auch nur ein einziger dieser Texte hält, was ich mir von ihm verspreche, das weiß ich noch nicht. Aber schon jetzt kann ich sagen, dass diese Ausbeute viel zu dürftig ist, um den regelmäßigen Pflichtbezug der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung weiter vor meinem Haushaltsplan, meiner Gefährtin und meinem Gewissen zu rechtfertigen. (Letzterem gegenüber kann ich unmöglich verantworten, dass ein gutes Pfund Papier bedruckt wird für diese lächerlichen sechs Artikel, die auf einen Bogen à 30 Gramm passen.)
Ich habe das Abo übrigens schon vor ein paar Tagen gekündigt, gerade noch rechtzeitig vor Beginn des vierten Quartals. Wie üblich war die Abbestellung längst nicht so bequem wie seinerzeit die Bestellung. Eine E-Mail-Adresse speziell zur Kündigung findet man im Impressum nicht. Also sandte ich meine Nachricht an sonntagszeitung@faz.de. Von dort erhielt ich umgehend meine E-Mail zurück, mit persönlichem Abesender, aber ohne jeden Kommentar. Ich fragte sicherheitshalber noch mal nach: „Sehr geehrte Frau Regine Henry, darf ich diese ,Nachricht‘ als Bestätigung der Wirksamkeit meiner Kündigung verstehen? Bitte, teilen Sie mir doch noch mit, ab wann die Kündigung wirksam wird.“ Frau Henry antwortete prompt: „E-Mails in Sachen Abo bitte immer an: vertrieb@faz.de. Ich habe Ihre E-Mail dahin weitergeleitet und bereits eine Eingangsbestätigung erhalten. Post von dort erhalten Sie extra.“ – Und tags drauf kam dann auch diese Extrapost: „Kündigungsbestätigung – Sehr geehrter Herr Hessling, schade, dass Sie sich zur Kündigung des Abonnements der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung entschlossen haben. Selbstverständlich respektieren wir die Gründe, die zu der Entscheidung geführt haben. Vielleicht geben Sie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die als fundierte Informationsquelle gedient hat, dennoch eine neue Chance? Zum Abschluss hier nun der aktuelle Status des Abonnements: Das Abonnement der Sonntagszeitung endet am 30.09.2009.“ Der Respekt, der hier meinen Gründen gezollt wird, ist nun in der Tat so selbstverständlich, dass ich mich frage, warum er dennoch ausdrücklich bekundet wird. Vielleicht, um mich daran zu erinnern, dass es heutzutage durchaus Vertragspartner gibt, die Kündigungen nicht so einfach akzeptieren bzw. vorsorglich Verträge schließen, die im Kleingedruckten Hürden verstecken, durch die eine vorzeitige Kündigung nahezu unmöglich oder doch mindestens äußerst beschwerlich und zeitaufwändig gemacht wird? – Was das angeht, ist die FAS immerhin ein fairer Geschäftspartner gewesen, über den ich mich insofern nicht beklagen kann.
[Teil 2 folgt morgen.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Sonntagszeitung? (I)
Saturday, 12. September 2009

Die Kirche der evangelischen Gemeinde Rellinghausen ist uns schon auf einem früheren Rundgang begegnet. Seither habe ich sie aus ganz unterscheidlichen Perspektiven und von verschiedenen Standorten aus betrachtet. So zeigt das Titelbild sie von einem Waldweg aus, den ich bei meinen Spaziergängen mit Lola häufig passiere.
Inzwischen weiß ich, dass das „im Bauhausstil 1934-35 errichtete denkmalgeschützte Gebäude […] der dritte evangelische Kirchenbau Rellinghausens an dieser Stelle [ist]. Der letzte Neubau war notwendig geworden, als infolge des Bergbaus die Kirchengemeinde innerhalb von 40 Jahren von 800 auf 8.000 Mitglieder angewachsen war.“ (Holle, a. a. O., S. 6 f.) Die erste reformierte Kirche wurde 1663 eigeweiht, aber schon zehn Jahre später von durchziehenden französischen Truppen Ludwigs XVI. nahezu zerstört. Ein zweiter Kirchenbau, von dem es auch noch alte Fotos gibt, entstand in den Jahren 1772-75. (Vgl. Ludwig Potthoff: Rellinghausen im Wandel der Zeit. Essen: R. Bacht, 1953, S. 108-112.)
Der gegenwärtige Pfarrer, Andreas Volke-Peine, hat die Geschichte seiner Gemeinde und Kirche in Rellinghausen anlässlich des Jubiläums 1996 „aus evangelischer Sicht“ dargestellt. (Vgl. die Festschrift 1000 Jahre Rellinghausen. Essen: Bacht Verlag, 1995, S. 44-48.) Über die schwierige Zeit der Kirche im Nationalsozialismus und den Kampf zwischen den Deutschen Christen und der Bekennenden Kirche am Ort schreibt er: „Die Zeugnisse aus dieser Zeit lassen erkennen, daß auch in der Rellinghauser Gemeinde die Fahne mit dem Hakenkreuz Anhänger hatte und mancher evangelische Christ sich vom Führer verführen ließ. Aber es gab auch stets eine Fraktion, die fest zur Bekennenden Kirche stand und den Mut hatte, offen gegen das nationalsozialistische Gedankengut anzugehen.“ (Ebd., S. 48.)
Betreten habe ich die Kirche immer noch nicht. Ich nähere mich ihr bewusst, langsam, nichts übereilend. Und ich habe nun auch einen gebührenden Anlass gefunden:
Am 26. September, heute in zwei Wochen, gibt der Komponist Gerd Zacher aus Anlass seines 80. Geburtstags ab zwanzig Uhr ein Orgelkonzert in dieser Kirche. Auf dem Programm stehen zwei Ricercari von Johann Sebastian Bach aus dem Musikalischen Opfer und drei Werke von Zacher selbst: Szmaty (1968), Trapez (1993) und Vocalise (1971).
Posted in Godzilla, Würfelwürfe | Comments Off on Rundgang (X)
Friday, 11. September 2009

Mein neuer Telekommunikationsdienstleister, der eigentlich Handyhändler ist, aber solchen kommunikationstechnischen Anachronisten wie mir zuliebe im Nebenberuf auch noch Festnetzanbieter, wendet sich in seiner aktuellen Mobilfunkwerbung offenbar an Kunden, die dreißig Jahre jünger sind als ich und insofern noch viel mehr Zeit zu verschwenden haben. Trotzdem (oder gerade deshalb?) ist die Zeit eine zentrale Botschaft des Marketings dieses Global Players: „Lebe im Jetzt. Surf sofort. […] Es ist Deine Zeit.“ So heißt es in der plump-vertraulichen Duz-Form, an die man ja schon von Ikea her gewöhnt ist.
So ganz möchte man sich’s aber doch nicht mit mir verderben, denn auf der zweiten Seite werde ich dann wieder ganz förmlich gesiezt: „Holen Sie sich das Surf-Sofort-Paket […] und surfen Sie mit DSL-Speed ab der ersten Minute. […] Sofort telefonieren und surfen ohne Wartezeit […] Auspacke, anschließen und gleich lossurfen! Mit dem […] Surf-Sofort-Paket müssen Sie nicht lange warten. Surfen und telefonieren Sie sofort los! […] Konzentrieren Sie sich vom ersten Tag an auf das Wesentliche: Ihren Spaß.“ (Das Titelbild zeigt, wie genau man sich diese Art konzentrierten Spaßes eines solchen stolzen Telekommunikations-Kriegers vorzustellen hat.)
Ich muss da mal nachhaken. Ist denn die mittlerweile zu einem allgegenwärtigen Zeitvertreib gewordene Telefonitis tatsächlich ein Quell der Freude? Ist – Hand aufs Herz! – der Zwang zur telefonischen Erreichbarkeit rund um die Uhr und an jedem beliebigen Ort und Örtchen spaßig? Genau besehen tröstet uns diese Werbebotschaft nur mit dem Fitzelchen Zeit, das man spart, weil der Zutritt zum grenzen- und endlosen Palaver im Idealfall ruckzuck von statten geht. Ansonsten gilt: Wenn du hier eintrittst, lass alle Hoffnung fahren. Das Instrument, das du dir da nichtsahnend hast an die Backe nähen lassen, ist ein wahrer Zeitvampir.
Ich beobachte überdies gerade aus nächster Nähe, dass es ein extrem zeitraubendes Unternehmen ist, aus einem solchen ruckzuck geschlossenen Telefonvertrag wieder herauszukommen. Und übrigens gilt hier, wie sonst nur für den Junkie, das grausame Gesetz: Einmal Handy, immer Handy!
Eines muss der Neid den Werbefuzzis solcher Konzerne wirklich lassen: Es gelingt ihnen, ihren Zielgruppen, den juvenilen Kunden ihrer Auftraggeber, Scheiße für reinstes Gold anzudrehen. So lautet etwa eine ihrer unglaublichen Verheißungen: „Telefonieren Sie zum Beispiel günstig in andere Mobilfunknetze oder endlos in ausländische Festnetze.“ Wirklich endlos telefonieren? Ist es das, was sich der Warrior Nr. 10 erträumt? Dann wäre ihm ein Job in einem der zahlreichen Callcenter zu empfehlen. Da bekommt er sogar noch ein kleines Gehalt für seine Lieblingsbeschäftigung.
Posted in Time Machine, Würfelwürfe | Comments Off on Time is Honey
Thursday, 10. September 2009

Im ICE nach Frankfurt am Main lauschte ich vor einigen Jahren dem Gespräch zweier Mitreisender, eines sehr ungleichen Paares. Eine offenbar nicht mehr nur leicht alkoholisierte Dame mittleren Alters berichtete ihrem Gegenüber, einem geschniegelten Bürschchen im Angelo-Litrico-Anzug und mit dem Odeur von Zino Davidoffs Cool Water, von ihrer schweren Kindheit ohne Vater. (Nennen wir der Einfachheit halber den Jungen künftig Andy und die Alte Bożena.)
Bożena behauptete, ihr trauriges Dasein dem Seitensprung eines berühmten polnischen Schriftstellers zu verdanken, der Deutschland anlässlich der Uraufführung eines seiner Stücke besucht habe. Erst auf dem Totenbett habe ihre Mutter, die in den späten 50er- und frühen 60er-Jahren als Souffleuse am Stadttheater gearbeitet hatte, ihr dies gestanden. Bożena schien den Tränen nahe, als sie von ihren vergeblichen Bemühungen berichtete, von ihrem leiblichen Vater, „dem Dichter, diesem Schwein“ als seine Tochter anerkannt zu werden. Ich saß unmittelbar hinter den beiden und hatte keine Chance, die detailreiche Schilderung dieser Familientragödie zu überhören. Ich hätte die Geschichte aber wohl schon am nächsten Tag wieder vergessen, wenn der Erzeuger der Erzählerin nicht ausgerechnet ein Schriftsteller hätte sein müssen. Dieses kleine Detail passte nicht zu ihr, zum Milieu ihrer Herkunft, zu den übrigen Umständen des in jeder Hinsicht bescheidenen Daseins. Wäre der angebliche oder tatsächliche Papa ein berühmter Musik- oder Filmstar gewesen und hätte er z. B. Elvis Presley oder Alain Delon geheißen: geschenkt. Aber ein polnischer Schriftsteller, dessen Name unserem Andy natürlich nichts sagte und den selbst ich nur vom Hörensagen kannte? Damit konnte man als geltungssüchtige Hochstaplerin kaum renommieren.
„Ja, ich weiß, den kennen nur gebildete Leute, aber für die ist er eine Berühmtheit. Vor ein paar Jahren ist seine Autobiographie erschienen und ich komme indirekt auch drin vor. Natürlich nicht mit Namen, so schlau ist der Suffkopp noch, dass er mir keine Beweise an die Hand gibt, ihn zur Verantwortung zu ziehen. Aber sonst stimmt alles bis ins kleinste Detail.“ So etwa sprach Bożena. Und mein täglich um tausende Zellen ärmer werdendes Gehirn reservierte ihr und ihrem Hallodri von Vater ein winziges Kämmerchen, wo die beiden ein kümmerliches Dasein am Rande der Vergessenheit fristeten.
Bis ich vor ein paar Tagen im Prospekt eines Ramschers blätterte und darin auf ein interessantes Angebot stieß: „Miłosz, Czesław: Mein ABC. Von Adam und Eva bis Zentrum der Peripherie. – Miłosz folgt in seinem Rückblick auf das 20. Jahrhundert nicht der Chronologie, sondern den ,unvorhersehbaren Assoziationen‘ seiner Erinnerung, die er auf die Willkürlogik des Alphabets bringt. In einer Vielzahl von Stimmen, Porträts und Begegnungen läßt Miłosz das Jahrhundert Revue passieren und verzichtet auf jede selbstglorifizierende Prätention. Ü: Doreen Damme. Gb., 180 S., DEA, (Hanser 2002), R, früher € 15,90, jetzt € 6,00 Nr. 13322.“ – Ach, dachte ich bei mir, ist das nicht der Schürzenjäger aus dem ICE? Bożenas Daddy? Und ist dieses ABC nicht vielleicht genau besagtes Buch, in dem ihre Mutter als dessen kurzzeitige Geliebte vorkommt, zwar mehr oder weniger gut getarnt, aber vielleicht für mich als unfreiwilligen Mitwisser durchaus erkennbar?
Um es kurz zu machen: Er ist es nicht. Ich habe schlichtweg zwei polnische Dichternamen verwechselt. Beide hatten für mich nur eins gemein, dass ich nie eine Zeile von ihnen gelesen hatte. Ich weiß mittlerweile, wer der Richtige gewesen wäre, aber der interessiert mich nun nicht mehr die Bohne. Denn dieser „Falsche“, Czesław Miłosz (1911-2004), ist wirklich und wahrhaftig eine große Entdeckung für mich! Und die gewundenen Wege, auf denen ich zu dieser Offenbarung gelangte, passen ihr wie ausgemessen und angegossen: Habent sua fata libelli. – Übrigens hätte mich bei dieser Verwechslung stutzig machen müssen, dass Miłosz im Unterschied zu dem wahren Verdächtigen Nobelpreisträger war – ein Detail, dass Bożena in ihrer Geschichte ganz sicher nicht unterschlagen hätte, hätte es doch vermutlich selbst den teilnahmslosen Andy mächtig beeindruckt.
[Fortsetzung: Verwechslung (II).]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Verwechslung (I)
Wednesday, 09. September 2009
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Personality Show
Tuesday, 08. September 2009
Posted in Eccentrics, Würfelwürfe | Comments Off on Protected: So kompliziert
Monday, 07. September 2009

Einen liebevoll gestalteten, handlichen Wanderführer der unmittelbaren Umgebung hat die Bürgerschaft Rellinghausen – Stadtwald e. V. herausgegeben. (Marlies Holle: Wandern auf kultur- und industriegeschichtlichen Pfaden in Rellinghausen/Stadtwald. Essen o. J. [2004].)
Die Wanderwege, von denen einer geradewegs vor dem Fenster meines Arbeitszimmers vorbeiführt, erstrecken sich von der Siedlung Altenhof im Westen bis zur Gaststätte „Zornige Ameise“ im Osten, von der Zeche Ludwig im Norden bis zur Zeche Gottfried-Wilhelm im Süden.
Tatsächlich sind die Spuren des Kohleabbaus, von dem das ganze Revier viele Jahrzehnte lebte und dem es seine rasante Entwicklung im 19. Jahrhundert verdankte, noch überall zu entdecken, wenn man nur aufmerksam ist und darauf achtet. So führt uns einer unser bevorzugten Spaziergänge durch den Schellenberger Wald regelmäßig an einem durch Gitter abgetrennten Areal vorbei, das auf Warntafeln als „Tagesbruch“ ausgewiesen ist.
Gestern las ich in dem genannten Wanderführer, dass sich im Wald bei Schloss Schellenberg, in der Nähe des Mattheywegs noch zahlreiche „Pingen“ entdecken lassen, Schürfstellen an der Erdoberfläche, die von den Anwohnern zur Versorgung ihres privaten Haushaltes ausgebeutet wurden. Und: „Noch immer tritt hier an manchen Stellen Kohle zu Tage.“ (Holle, a. a. O., S. 9.)
Also hielten wir gestern die Augen offen und entdeckten tatsächlich am Fuße eines Hügels, an dessen Gipfel sich ein alter Baum klammerte und unter dem das Erdreich durch Ausschwemmungen in Bewegung geraten war, einige Stückchen Kohle (s. Titelbild).
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Rundgang (IX)
Sunday, 06. September 2009

Gleich zwei Romane mit dem Anspruch, sich als „Jahrhundertromane“ behaupten zu können, werden in diesem Jahr in deutscher Übersetzung vorgelegt. Was für eine Anmaßung, möchte man einwenden, wo das 21. Jahrhundert gerade erst einmal acht Jahre und acht Monate alt ist. Aber die Verlage, die sie hierzulande herausbringen, bürgen durchaus für Seriosität. Auch weilen beide Autoren nicht mehr unter den Lebenden, womit eine wesentliche Voraussetzung für Unsterblichkeit erfüllt ist. Und schließlich sind die beiden Bücher, wie es sich für dergleichen gehört, dick wie Moby.
Da wäre also erstens Roberto Bolaño mit 2666. (A. d. Span. v. Christian Hansen. München: Carl Hanser Verlag, 2009. – 1096 S., Pb. m. Lesebändchen, Fadenheftung. – 29,90 €.)
Und da wäre zweitens David Foster Wallace mit Unendlicher Spaß. (A. d. Am. v. Ulrich Blumenbach. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2009. – 1547 S., Pb. m. zwei Lesebändchen, gelumbeckt. – 39,95 €.)
Weder der Chilene noch der Mann aus den USA waren dafür bekannt, fröhliche Menschen zu sein. Foster Wallace litt seit frühester Jugend an Depressionen und hängte sich schließlich Ende vorigen Jahres im Alter von nur 46 Jahren unter seine Schreibstubendecke. Und Bolaño war gerade einmal 50 Jahre alt, als sein jahrelanges Leberleiden ihn hinwegraffte, auch er ein Verzweifelter, dessen Gedanken zeitlebens um Krankheit und Tod kreisten. Können wir von solchen Leidenden erwarten, dass uns ihre Werke ermuntern? Wenn wir aber aus ihnen keine Kraft schöpfen wollen, was dann? Finden wir in solchen Büchern immerhin eine Einsicht, die uns mit unserer Zeit so weit aussöhnt, dass wir den morgigen Tag überstehen? Es sei zugestanden, dass Kunst niemals am Maße ihrer praktischen Nützlichkeit gemessen werden kann. Aber geradezu umbringen sollte uns ein Roman doch auch nicht, oder?
(Romane wie diese beiden gehen übrigens noch einen Schritt weiter, sie treten nicht bloß als Jahrhundert-, sondern gar als Endzeitromane auf. Sie wollen nicht allein das letzte Wort über die Epoche sprechen, der sie entstammen und für die sie stehen, sondern vielmehr das letzte Wort überhaupt – insofern sie unterstellen, dass dies eben die letzte Epoche sei.)
Posted in Babel, Würfelwürfe | Comments Off on Romanendzeit
Saturday, 05. September 2009

Aus besonderen Anlässen wird gelegentlich das bekannte Google-Symbol auf der Startseite der Suchmaschine – zwei blaue Gs, je ein rotes O und E, ein grünes L und ein gelbes O – grafisch mehr oder weniger stark verfremdet. Aus den beiden Os wird dann z. B. eine Harry-Potter-Brille; und wir User erfahren, ob wir’s nun wissen wollen oder nicht, dass just an diesem Tag der letzte Band dieses unsäglichen Fantasy-Zyklus ausgeliefert wird.
Oft sind die Bilder selbsterklärend, manchmal aber rätselt man, was sich denn nun wieder hinter diesem Google-Doodle – so der Name der Spielerei – verbergen mag. Dann reicht es, mit dem Mauszeiger auf das Logo zu fahren, und man liest in einem kleinen Textfeld, das sich automatisch öffnet, einen sogenannten „Tooltip“, auch „ALT-Tag“ genannt, der das Rätsel aufklärt. Da steht dann z. B. „Christopher-Street-Day“ oder „60 Jahre Currywurst“. Klickt man sodann auf das Google-Doodle, erhält man die Ergebnisse der Suchabfrage zu dem jeweiligen Begriff, wie sonst üblich.
Heute ist das zweite, sonst gelbe O in einer Art Glaskolben oder Kristallzylinder zu sehen, der sich nach oben hin verjüngt:

Auf dem Kolben ruht ein Hut mit breiter Krempe, den man aber auch als Halbkugel mit einer flachen Scheibe interpretieren könnte, oder als stilisierten Saturn mit seinen Mondringen, oder als unbekanntes Flugobjekt. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt – zumal uns diesmal kein Tooltip auf die Sprünge hilft.
Klickt man auf das Doodle, dann erhält man die Links zu den (zurzeit, nämlich um 10:00 Uhr MEZ) „ungefähr 49.000 Ergebnissen“ die sich mit der Frage befassen, was das ominöse Ding bedeuten soll, wobei diese Ausbeute nur die deutsche Google-Site betrifft. Auch in vielen anderen Ländern wird diskutiert und spekuliert, was es mit dem „rätselhaften Phänomen“, dem „Misteri inspiegabili ed insoluti“, dem „onverklaarbare verschijning“, dem „Fenómenos Inexplicáveis“ oder dem „Unexplained Phenomenon“ auf sich hat.
Hier die überraschende Lösung. Bei dem halbkugelförmigen Ding am Kopf des „Salzstreuers“ handelt es sich um ein stählernes Kunstobjekt, das sich auf dem Essener Ardeyplatz befindet, nur fünf Minuten von meiner neuen Wohnung entfernt (s. Titelbild). Schon immer haben die Bürger von Rellinghausen gerätselt, was sich wohl darunter befinden mag. Nun hat Google freundlicherweise dieses Rätsel gelüftet. Ein transparenter Kristall-Stalaktit reicht hier fünf Meter tief in den Boden. Eingeschlossen wie ein Insekt im Bernstein befindet sich darin ein O, das freilich auch als Null gelesen werden kann. Und wie hat kein anderer als Gottfried Wilhelm Leibniz die Null genannt? „… eine wunderbare Zuflucht des göttlichen Geistes – beinahe ein Zwitter zwischen Sein und Nicht-Sein.“ (Hier zit. nach Charles Seife: Zwilling der Unendlichkeit. Eine Biographie der Zahl Null. A. d. Am. v. Michael Zillgitt. Berlin: Berlin Verlag, 2000, S. 150.) – Das Rätsel ist also nicht mehr, was das auf dem Bild darstellt, sondern nur noch, warum Google es ausgerechnet heute doodelt.
Posted in Würfelwürfe | 1 Comment »
Friday, 04. September 2009
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Frischer Anschluss
Friday, 04. September 2009

Mittlerweile haben wir unseren neuen Stadtteil wieder ein bisschen besser kennengelernt – nämlich statistisch. Am vergangenen Sonntag fanden ja in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt.
Das (nicht barrierefreie) Wahllokal für unseren Stimmbezirk, einen von vier in Rellinghausen, befand sich in der Albert-Einstein-Schule am Ardeyplatz (s. Titelbild). Dummerweise hatten wir unsere Wahlbenachrichtigungen nicht dabei und die Wahlhelfer hatten einige Mühe, uns Neubürger in ihrer langen Liste zu finden. Aber schließlich erhielten wir dann doch die drei Wahlzettel, einen für die Wahl des Oberbürgermeisters, einen zur Wahl des Stadtrates und einen zur Wahl der Bezirksvertretung.
Nachdem nun die Ergebnisse im Internet veröffentlicht sind, wissen wir, dass es zum Stichtag 3.060 Wahlberechtigte in unserem neuen Stadtteil gab, von denen sich rund 60 Prozent an diesen Wahlen beteiligt haben. Rellinghausen gehört zu jenen Stadtteilen, in denen der OB-Kandidat der CDU, Franz-Josef Britz, die Mehrheit der Stimmen für sich gewinnen konnte, allerdings relativ knapp gefolgt vom Kandidaten der SPD, Reinhard Paß, der stadtweit zum neuen Essener Oberbürgermeister gewählt wurde. Die Kandidatin der Grünen, Hiltrud Schmutzler-Jäger, erreichte in Rellinghausen nur knapp über fünf Prozent, sogar noch etwas weniger als Christian Stratmann von der FDP.
Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich auch aus den Zahlenverhältnissen der beiden anderen Wahlen. Rellinghausen ist ein politisch eher konservativ orientierter Stadtteil mit hohem Stimmanteil für die beiden großen Volksparteien: Zusammen bringen sie es auf gut drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen. Radikale Parteien wie die Republikaner, Die Linke oder die DKP sind weit abgeschlagen. Und die Freie Wählergemeinschaft des Essener Bürger-Bündnisses, die nach ihrer Gründung vor ein paar Jahren vom Zorn vieler Wähler auf den „roten Filz“ im Rathaus profitieren konnten, sinkt in unserem Stadtteil wie auch im übrigen Stadtgebiet zurück in die Bedeutungslosigkeit.
Interessant ist vielleicht noch folgende Berechnung. Die Einwohnerstatistik nach Stadtteilen (Stand: 30. September 2009) weist für Rellinghausen 3.628 Personen aus. Zieht man hiervon die 3.060 Wahlberechtigten ab, dann wohnen hier also 568 Menschen unter 16 Jahren. Dieser geringe Anteil von nur 15 Prozent entspricht aber dem Durchschnitt in Deutschland ziemlich genau.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Rundgang (VIII)
Thursday, 03. September 2009

Das zehnte Kapitel von Knut Hamsuns zweitem Roman, Mysterien, erzählt von einem Besuch des von aller Welt verspotteten und geschundenen Minute auf Nagels Zimmer, in dessen Verlauf sich der undurchschaubare Held dieses verwirrenden Buches, wie man so sagt: hoffnungslos betrinkt. (Knut Hamsun: Mysterien. A. d. Norw. v. J[ulius] Sandmeier. Nachw. v. Edzard Schaper. Zürich: Manesse Verlag, 1958, S. 200-230.)
Da der in jeder Hinsicht bescheidene Minute kaum einmal etwas sagt, besteht dieses starke Kapitel des Romans im Wesentlichen aus einem Monolog des Johan Nilsen Nagel, von dem der Leser an dieser Stelle immer noch nicht weiß, in welcher Angelegenheit er die kleine norwegische Küstenstadt besucht, ob er wirklich nur nach Entspannung sucht oder etwas Böses im Schilde führt, was er mit seinen vermeintlich „guten Taten“ bezweckt und so fort.
Anfangs sind die Ausführungen Nagels gegenüber seinem Schützling Minute noch halbwegs verständlich. Doch je mehr er dem Alkohol zugesprochen hat, desto fahriger wird seine Rede. Dieser schrittweise Zerfall der Stringenz seiner Rede, diese Zersetzung von Logik und Syntax, dieser allmähliche Übergang zu scheinbar völlig unzusammenhängenden Gedankenfragmenten gelingt Hamsun so gut, dass ich stellenweise den Verdacht hegte, er habe sich vorm Schreiben dieses Kapitels volllaufen lassen.
Es gibt ja durchaus dergleichen literarische Selbstversuche mit Rauschzuständen. So soll der Autor der Schatzinsel sich zu seiner vielleicht besten Novelle, der Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, durch exzessiven Koksgenuss anregen lassen haben: „Äußerst interessant ist eine Studie über Robert Louis Stevenson (1850-1894). Nach einer Analyse des amerikanischen Arztes Myron G. Schultz (1971) soll der weltberühmte englische Autor im Herbst 1885 Kokain als Medikament gegen seinen chronischen Katarrh erhalten haben. Die Droge wurde damals in der medizinischen Welt als Wundermittel gegen alle möglichen Krankheiten gefeiert und just zu jener Zeit erschien auch in der britischen Ärzteschrift The Lancet ein sehr positiver Artikel über die Wirkungen des Alkaloids. Schultz vermutet nun, daß Stevenson unter dem Einfluß dieser Droge sein bekanntestes Werk Dr. Jekyll and Mr. Hyde schrieb. Und zwar verfaßte er zwei Versionen des Buches innerhalb von sechs Tagen, eine unglaubliche Leistung, vor allem, nachdem er vorher lange Zeit äußerst unproduktiv gewesen war. Sowohl dieser physische und psychische Gewaltakt (der sehr für die Wirkung von Kokain spricht) als auch die Handlung des Romans sprechen für die aufgestellte Hypothese: Der Held der Erzählung verwandelt sich unter dem Einfluß eines Pulvers (!) über Nacht aus einem angenehmen, gütigen Zeitgenossen in einen bösartigen Unhold, der Menschen tötet. In dieser Verwandlung ist sehr plastisch der charakterzerstörende Effekt des Kokains bei anhaltendem Mißbrauch wiedergegeben.“ (Wolfgang Schmidbauer / Jürgen vom Scheidt: Handbuch der Rauschdrogen. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2004, S. 193 f.; vgl. Myron G. Schultz: The Strange Case of Robert Louis Stevenson; in: Journal of the American Medical Association 216, 1971, S. 90-94.)
Dass Knut Hamsun im Laufe seines langen Lebens häufig dem Alkohol zusprach und für einen langen Lebensabschnitt vermutlich gar als Alkoholiker bezeichnet werden darf, ist bekannt. Dass er den Alkoholrausch also nicht nur aus der unbeteiligten Betrachtung seiner besoffenen Zeitgenossen, sondern schon früh auch aus eigenem Erleben kannte, ist somit kaum bestreitbar. Und sein Biograph Ferguson teilt sogar mit, dass er sich bei der Niederschrift von Mysterien „Inspiration aus Sprit“ holte, wenn seine Arbeit ins Stocken geriet und sein Kopf sich anfühlte „wie ein abgehackter Fischkopf mit klaffendem Maul“, der einfach alle Denktätigkeit eingestellt hatte: „Wenn das eintrat, ließ er für gewöhnlich die Arbeit liegen und ging in die Stadt, setzte sich in ein Theater oder ging in eine obskure Bar etwas trinken.“ (Robert Ferguson: Knut Hamsun – Leben gegen den Strom. Biographie. A. d. Engl. v. Götz Burghardt. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992, S. 194.) – Vielleicht ist das zehnte Kapitel von Mysterien ja unmittelbar nach einem solchen Besuch in dieser obskuren Bar zustande gekommen, wer weiß?
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Inspiration
Wednesday, 02. September 2009
Posted in Godzilla, Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Du tu dies, du das!
Wednesday, 02. September 2009

Endlich komme ich wieder dazu, alte Freundschaften zu erneuern, wenngleich vorläufig nur fernmündlich. Nachdem unsere Rufnummer infolge eines Wechsels des Anbieters geändert werden musste, liefen die Bemühungen einiger mir nahestehender Menschen, mit mir in Verbindung zu treten, wiederholt ins Leere, vorzugsweise natürlich jener, die den Austausch per E-Mail nicht zu ihren geläufigen Kommunikationstechniken zählen. Weil mir selbst dieser Informationsweg ganz selbstverständlich geworden ist, konnte es mir geschehen, dass ich diese „Anachronisten“ für ein Weilchen gar nicht mehr auf der Rechnung hatte. An alle Adressen in unserem Outlook-Sammelverteiler hatte ich eine knappe E-Mail mit unserer neuen Anschrift und Telefonnummer geschickt und irrigerweise angenommen, damit meine Pflicht getan zu haben. Daran sieht man, wie folgenreich es ist, wenn man an einer neuen Kommunikationstechnik, aus welchen Gründen auch immer, nicht teilnimmt. In letzter Konsequenz führt es wohl zur sozialen Isolation.
Ich selbst suche einen für mich maßgeschneiderten Mittelweg und entscheide nach gründlicher Prüfung von Fall zu Fall, welche „Werkzeuge“ ich für den Austausch von Informationen mit meinen Mitmenschen nutzen will und auf welche ich bewusst verzichte. Dabei bemühe ich mich, wo eben möglich auf zeitraubendes und nervtötendes Hightech-Spielzeug zu verzichten. Dass der Gebrauch der meisten dieser Gerätschaften stark suchtbildend ist – sonst wären sie ja nicht so erfolgreich –, das weiß ich zur Genüge und bin deshalb auf der Hut, bevor ich mich mit ihnen einlasse.
Sehr zum Erstaunen vieler besitze ich zum Beispiel noch immer kein Mobiltelefon. Während des Umzugs, als wir zeitweise weder in der „alten“ noch in der „neuen“ Wohnung einen Festnetzanschluss hatten und dauernd getrennt unterwegs waren, teils zwischen den beiden Wohnungen, teils auf dem Weg zu Baumärkten, Möbelgeschäften usw., da erwies es sich vorübergehend als ausgesprochen bequem und vor allem zeitsparend, dass mir meine Gefährtin ihr Zweithandy zur Verfügung gestellt hatte. Ich begann, mich an diesen vermeintlichen Luxus zu gewöhnen und erwog für eine kurze Zeit, mir selbst einen solchen Quasselknochen zuzulegen.
Dann machte ich mir aber doch rechtzeitig die Nachteile dieser Optionen bewusst: ständig auch unterwegs erreichbar zu sein und von überall her mit jedem Fernsprechteilnehmer in Verbindung treten zu können. Wollte ich das? Wenn ich entspannt und frohen Sinnes durch den Wald spazierte, dann riss mich urplötzlich dieses zunächst anonyme Klingeln aus meinem Wohlbehagen, das sich dann in einer Stimme personifizierte, die mich bat, einem meiner Söhne etwas auszurichten oder ein persönliches Treffen mit mir vereinbaren wollte oder mich fragte, ob ich vielleicht die Handynummer von diesem oder jener wüsste oder sich am Ende gar – tatsächlich? angeblich? – verwählt hatte. Selbst wenn das Telefonat selbst nur eine Minute gedauert hatte, brauchte ich anschließend eine Viertelstunde, bis ich diese Störung mental und emotional restlos verdaut und vergessen hatte.
Ich kenne den Einwand, dass man den Signalton eines Handys ja mit einem Tastendruck jederzeit abstellen kann. Aber tut man das? Es gelingt vielen Zeitgenossen ja nicht einmal, daran zu denken, wenn sie sich in ein Symphoniekonzert oder eine Kirche begeben. Schließlich läuft dieses „Auflautlosstellen“ des Apparates ja auch seinem Prinzip und seinem eigentlichen Anspruch ständiger Empfangsbereitschaft zuwider. Sicher, es gibt diese Momente, wo ich vorm Supermarktregal stehe und mich frage, ob ich meiner Gefährtin Johannisbeer- oder Brombeermarmelade mitbringen sollte. Jetzt wäre es doch so einfach, diese Frage mit einem kurzen Handytelefonat zu klären. Aber dagegen stehen etliche andere Momente, in denen ich unterwegs von Anrufern gestört würde. Und die Zeit, in der ich unterwegs bin, empfinde ich auch deshalb als eine angenehme, weil ich dabei eben gerade vor Störungen dieser Art sicher bin. Es reicht doch schon, wenn daheim jederzeit das Telefon klingeln kann, oder? – Immerhin, dort leiste ich mir schon seit Urzeiten einen schnurlosen Quasselknochen (s. Titelbild).
Posted in Dingwelt, Würfelwürfe | Comments Off on Quasselknochen
Tuesday, 01. September 2009

Ich war so um die sechzehn Jahre alt, als ich zum ersten Mal erkannte, wie Sprache manipuliert und zur Manipulation instrumentalisiert werden kann, wie durch Um- und Entwertung von Begriffen politische Gegner diskreditiert, marginalisiert oder gar kriminalisiert werden, wie durch penetrante Wiederholung von falsch verwendeten Wörtern deren Sinn schließlich völlig entstellt, ja geradezu ins Gegenteil verkehrt wird. Das so facetten- wie lehrreiche Beispiel, an dem sich all dies aufzeigen durchschauen ließ, was das Wort „Anarchismus“.
Die politischen Gewalttäter um Andreas Baader und Ulrike Meinhof, die sich in der Roten Armee-Fraktion (RAF) formiert hatten, um durch Banküberfälle, Sprengstoffattentate, Entführungen und zuletzt Mordanschläge die BRD unter Druck zu setzen, wurden erst lange Zeit in den bürgerlichen Medien allgemein als „Anarchisten“ bezeichnet, bevor sich schließlich der bis heute gültige Begriff „Terroristen“ durchsetzte, der dann freilich für gewalttätige Untergrundarmeen jeglicher Couleur Verwendung fand und findet.
Sehr bald fand ich heraus, dass die RAF mit den Zielen des klassischen Anarchismus wenig gemein hatte, vielmehr sowohl in ihren Vorstellungen von der „Zeit nach dem Sieg“ als auch im Verhalten untereinander während des bewaffneten Kampfes viel eher stalinistische Züge aufwies. Betrachtete man von der anderen Seite her den Anarchismus seit Michail Bakunin, dann fielen zwar einige terroristische Taten ins Auge, die die Zeitgenossen schockierten und die bis heute in den Geschichtsbüchern stehen. Doch kann kein unvoreingenommener Betrachter mit Blick auf das ganze Phänomen dieser politischen Geistesrichtung zu dem Ergebnis kommen, dass terroristische Gewalt einen bedeutenden Wesenszug des Anarchismus ausmacht oder gar mit diesem identisch ist.
Idee, Geschichte und Perspektiven des Anarchismus hat einer seiner besten Kenner der neueren Zeit, Horst Stowasser, vor zwei Jahren in einem Standardwerk zum Thema, zugleich seinem Lebens-Hauptwerk, auf 500 Seiten erschöpfend dargestellt. (Anarchie! Hamburg: Edition Nautilus / Verlag Lutz Schulenburg, 2007.) Wer in unseren langweilig perspektivlosen Zeiten, in denen selbst Träume nur noch gegen Eintrittsgeld zu haben sind, eine Ahnung von den Lüsten des politischen Utopismus gewinnen will, dem sei dieses Buch wärmstens ans Herz gelegt. Eine kleine Kritik kann ich mir nicht verkneifen: dass die Gewaltfrage, die doch auch den Anarchismus lange beschäftigt hat, bei Stowasser nahezu völlig ausgeklammert wird. Als ich im Zusammenhang mit meiner Pynchon-Lektüre über das Bombenattentat am Chicagoer Haymarket recherchierte, verwunderte mich, dass dieses Ereignis in Anarchie! überhaupt nicht vorkommt. Das Kapitel über den „Anarchismus und die Bombe“ (S. 315-326) ist leider das schwächste des sonst so leidenschaftlichen und gehaltvollen Buches.
Den Verdiensten des Autors um die theoretische und praktische Wiederbelebung des Anarchismus in unserer Zeit und in diesem Land tut das aber keinen Abbruch. Horst Stowasser ist heute im Alter von nur 58 Jahren in Neustadt an der Weinstraße gestorben.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Anarchie!
Tuesday, 01. September 2009

Wenn ich aus der sicheren Distanz mehrerer Wochen und nach dem zwischenzeitlichen Hinaustragen von drei Müllbeuteln auf den Augenblick der Wahrheit zurückschaue, dann vermag ich die verschiedenen Faktoren, die zu meiner (oder unserer?) Entscheidung führten, vermutlich nicht mehr vollständig aufzuzählen, geschweige denn exakt zu gewichten.
Nicht unwesentlich war der optische, akustische, haptische Eindruck, den schließlich ein knallroter 22-Liter-Baseboy auf mich machte. Endlich einmal ein reales Exemplar jener unüberschaubar großen Produktfamilie aus dem Hause Wesco vor mir zu sehen, statt immer bloß Popup-Bildchen aus dem Internet, das war vielleicht kein sonderlich überzeugendes Kaufargument für gerade dieses Exemplar, vermittelte aber doch offenbar einen ausreichend starken Kaufimpuls, um 169 Euro locker zu machen – und dazu noch 3,50 Euro für zwanzig Original-Müllbeutel der Nobelmarke.
Zu diesem dann mich selbst überraschend schnellen Entschluss kam es wohl auch deshalb, weil mir das ergebnislose Hin und Her, das Abwägen von Für und Wider, das wenig zielführende Spekulieren über Eventulaitäten, Risiken, Vor- und Nachteile schließlich ganz furchtbar auf den Wecker ging. Verdammt noch mal, ich war die fliegenumwölkten Provisorien an der Türklinke leid!
Jetzt steht „the brave fireman“, wie ich unseren Wesco mittlerweile getauft habe, brav auf seinem Stammplatz zwischen der Schlachtbank und Lolas Näpfen, sagt kein Wort, klappt per Fußtritt mühelos auf, bedarf zum Zuklappen aber eines leichten Kläpschens mit der Hand, muss nur einmal pro Woche geleert werden und gibt sich auch mit No-Name-Müllbeuteln problemlos zufrieden.
Mit anderen Worten: Dafür, dass wir uns vor seiner Anschaffung so lange geziert haben, erweist sich „the brave fireman“ als ein überaus genügsamer und diensteifriger Mitbewohner.
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Monday, 31. August 2009
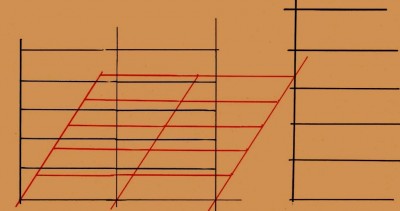
Ein Parallelogramm ist ein Viereck mit paarweise parallelen Seiten. Bei einem Parallelogramm sind die einander gegenüberliegenden Seiten gleich lang. Auch die einander gegenüberliegenden Winkel sind gleich groß. Ein Rechteck ist ein Viereck mit vier gleichen, also rechten Winkeln und insofern ein spezielles Parallelogramm. Auch beim Rechteck sind die gegenüberliegenden Seiten gleich lang.
Ein konkretes Beispiel für ein Rechteck ist das gewöhnliche Bücherregal. Der Rahmen des Regals besteht aus einem Boden und einer gleich langen Decke sowie zwei ebenfalls gleich langen Seitenteilen. Alle vier Winkel sollten im Idealfall 90° betragen. Sonst ist das Regal schief und droht umzukippen.
Etliche Bücherregale verschiedener Größe und unterschiedlicher Bauart befanden sich in meinem Bücherkeller unter der „alten“ Wohnung. Sie bildeten dort ein für den unvorbereiteten Besucher labyrinthisch erscheinendes Gewirr von Gängen und Sackgassen. Einer dieser irritierten Inspizienten sprach einmal von meinen „Bucherkatakomben“, ein zwar etwas übertriebener Ausdruck, den ich dennoch gern übernahm.
Nun stellte sich also die wenig verlockende Aufgabe, dieses mit den Jahren ständig weiter gewucherte Ungetüm von Bücherlager aufzulösen, die ineinander verwachsenen, verbundenen und verwobenen Regale leerzuräumen und abzubauen. Dabei hatte ich von den ursprünglichen statischen Gegebenheiten offenbar keinen rechten Plan mehr, denn es widerfuhr mir das Missgeschick, dass ich ein Regal leerte und teilweise demontierte, das eine unentbehrliche Stützfunktion für zwei weitere, noch voll beladene Regale hatte. Der katastrophale Effekt dieser voreiligen Demontage war, dass sich die Seitenwände beider Regale (schwarz) mit lautem Knirschen und Ächzen in Schräglage begaben und die ursprünglich rechteckigen Rahmen sich in Parallelogramme verwandelten (rot). Wenn die Regale nicht vollends in sich zusammenbrachen, so nur deshalb, weil sie in einem weiteren, etwas entfernt stehenden Regal (fett schwarz) einen Widerpart fanden, der ersatzweise die fehlende Stützfunktion übernahm (rechts im Bild).
Welche Folgen dieser Beinahezusammenbruch für mein schwaches Herz und meinen ohnehin schon stark angegriffenen Gemütszustand hatte, erzähle ich bestimmt kein anderes Mal. Der Schaden an den betroffenen Büchern konnte erfreulicherweise durch eine äußerst gewagte Bergungsaktion in engen Grenzen gehalten werden. Mein neues Bücherlager, das gerade im Aufbau befindlich ist, wird jedenfalls nicht wieder planlos wuchern wie ein Myzel, sondern systematisch aufgerichtet.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Umzugsreste (III)
Sunday, 30. August 2009
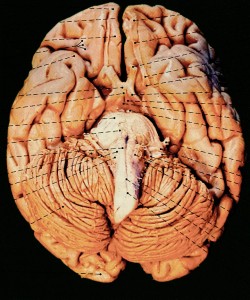
Einer der vielen Romane, die ich immer schon mal schreiben wollte, ist jener für das Science-Fiction-Genre von einem Neurologen, der bei der Messung sehr feiner Hirnströme von kürzlich Verstorbenen, die ihm mit einem von ihm entwickelten neuen Mikrosensor gelingt, auf den Gedanken verfällt, dass den vermeintlich entseelten Toten noch etwas Traumartiges durch den Kopf geht.
Vielleicht, so seine Spekulation, gebären die Zersetzungsvorgänge der Hirnrinde ja schreckliche Phantasien, die auffallend jenen albtraumhaften Vorstellungen ähneln, die seit Jahrhunderten mit Fegefeuer und Hölle verbunden werden.
Unser leicht verrückter Wissenschaftler beschließt, begrenzte Bezirke seines Gehirns für Erkundungen solcher Zersetzungsprozesse zu opfern und führt diese im Selbstversuch herbei. Diese waghalsigen Experimente bestätigen scheinbar seine Theorie. Allerdings sind die Schreckensszenen, die er im abgeschlossenen Theater seines Schädels aufführt, von kurzer Dauer.
Eine unangenehme Begleiterscheinung der autodestruktiven Eingriffe ist zudem, dass der Neurologe partiell mentale Ausfälle erleidet. Sein Gedächtnis weist irritierende Lücken auf. Er tut Dinge gegen seinen eigenen Willen. Die Versuchung, in einem finalen Showdown sein verbliebenes Gehirn zu opfern und dadurch letzte Gewissheit zu erlangen, wird unwiderstehlich.
Dann geschieht das Unfassbare … (Bis hierher und nicht weiter.)
Posted in Märchen, Würfelwürfe | Comments Off on Unschreibbare Romane II
Sunday, 30. August 2009

Mit dem 31. Juli endeten Vertrag und Mietzahlungsverpflichtung in unserer „alten“ Wohnung, von der wir uns ursprünglich einmal so viel versprochen hatten, wovon das Wenigste eingelöst wurde, die wir aus allerlei Gründen schließlich sogar zu hassen gelernt hatten und als deren größter Makel sich erwies, dass sie leider keine „Seele“ hatte. („Seele“, in Anführungszeichen wohlgemerkt, versteht hier wohl jeder, auch jene Sorte säkularisierter Nüchterlinge, zu der leider auch ich mich zählen muss, die mit der Seele ohne Anführungszeichen als einer Art immaterieller Innerei des Menschen nichts anzufangen wissen, schon gar nicht, wenn sie ihnen als ein unverfallbares Agens für die Ewigkeit verkauft werden soll.)
Neue Freunde meiner Söhne bemerkten bei ihrem Antrittsbesuch in unserer „alten“ Wohnung nicht selten, dass diese Räume eine Kälte ausstrahlten, ohne genau sagen zu können, wodurch genau dieser Eindruck entstand. „War hier mal eine Zahnarztpraxis oder so was?“, fragte in aller Unschuld der siebzehnjährige P.
Vermutlich hatten wir bei der allerersten Besichtigung selbst genau diesen Eindruck gehabt, was damals auch erklärlich war, denn der Vormieter hatte die Räume nicht als Wohnung genutzt, sondern dort ein Institut für wissenschaftliche Analysen betrieben. An den Wänden liefen ringsum Kabelkanäle zur Vernetzung zahlreicher PCs, unsere spätere Küche war bisher als Fotokopierraum genutzt worden, unter den Decken hingen Plexiglaskästen mit Neonröhren usw. Wir aber hatten in wenigen Wochen alles, was nur von Ferne an die Büroatmosphäre gemahnte, restlos beseitigt, übertüncht, versteckt oder verfremdet. Deshalb war es einigermaßen erstaunlich, dass das kühle Institutsklima in dieser Wohnung bis zuletzt spürbar blieb, wie ein hartnäckiger Geruch nach Lysol, Salmiak oder Katzenpisse, der in den tiefsten Ritzen zu stecken scheint und mit keinem noch so radikalen Geruchsneutralisierer zu beseitigen ist.
Beim Einzug in die „neue“ Wohnung erlebten wir infolgedessen einen wahren Kulturschock. Hier steckt in allen Ecken und Winkeln Leben und Geschichte. Als wir vor Jahren die „alte“ Wohnung ausgemessen hatten, waren wir eher bereit, an der Präzision unseres Millimeterpapiers zu zweifeln als an den Gegebenheiten in diesem Zweckbau, wenn sich beim Aufzeichnen des Grundrisses einmal ein nicht ganz rechter Winkel ergab. Hier hingegen gibt es tatsächlich keinen einzigen ganz rechten Winkel – und diese leichte Schiefheit mutet uns so freundlich und menschlich an, dass wir uns fühlen wie in einem Märchen oder guten Traum.
Das Hexenhäuschen ist urgemütlich und hat „Seele“ satt; und die Hexe ist eine gute Fee!
Posted in Oikos, Würfelwürfe | 1 Comment »
Wednesday, 26. August 2009

Ich werde insgeheim gewusst haben, warum ich die Geschichte von Suche und Erwerb eines idealen Küchenabfallbehälters für ein kleines Weilchen auf Eis gelegt habe. Heute jedenfalls fiel mir das Fragment aus eins, zwei, drei Folgen plötzlich wieder ein wie eine im Ansatz stecken gebliebene Sünde, die schon deshalb keine Vergebung findet, weil es ihr am krönenden Abschluss mangelt. Küchenlateiner würden es vielleicht einen cogitus interruptus nennen.
Der Anlass? Ich schnupperte heute ganz oberflächlich im Beibuch zur endlich erschienen deutschen Übersetzung von David Foster Wallace‘ magnum opus, genauer gesagt in den spaßigen – nicht humorvollen! – Bemerkungen des Übersetzers Ulrich Blumenbach, gemeint als Antwort auf die Frage, „wie ich Infinite Jest lieben und trotzdem übersetzen lernte”, als ich schon auf der vierten Seite auf folgende Stelle stieß:
„Schon auf der ersten Seite stößt man auf die zunächst unverständliche Überschrift ,Year of Glad‘. Im Lauf der Lektüre stellt sich heraus, dass unsere julianisch-/gregorianische Zeitrechnung durch die ,Sponsorenzeit‘ abgelöst worden ist. Amerikanische Konzerne können sich vom Staat ein Jahr kaufen und nach ihren Produkten benennen. Wallace gibt den Jahren nun sehr profane Produktnahmen. Das Year of Glad der ersten Seite heißt so nach einer weitverbreiteten Müllbeutelmarke […].” (Ulrich Blumenbach: Am Fuß vom Text; in: David Foster Wallace – Unendlicher Spaß. Zusatzmaterial. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2009, S. 16.) – Na, wenn der Name einer Müllbeutelmarke zur allerersten Kapitelüberschrift in einem „Jahrhundertroman” taugt und zur Bezeichnung des letzten Jahres einer fiktiven neuen Zeitrechnung, dann ist das ganze Müllthema vielleicht doch nicht so trivial, wie ich zuletzt selbstkritisch meinte.
Wo waren wir also? Ja, richtig: Es gab da diesen Streit zwischen meiner Gefährtin und mir, bei dem es um die Frage ging, ob der fest zur Anschaffung in den Blick genommene Pushboy (oder meinetwegen auch Baseboy) von der Nobelfirma Wesco nun ausschließlich mit Marken-Müllbeuteln der gleichen Firma zu versehen sein würden, oder ob wir es auch bei gleich- oder immerhin ähnlichformatigen No-Name-Müllbeuteln würden bewenden lassen können, wenn hierdurch laufende Kosten zu verringern wären.
Nach dieser Episode stockte die Erzählung, wie auch unser Kaufvorhaben ins Stocken geriet. Insgeheim malte ich mir aus, wie es wohl wäre, wenn ich vollendete Tatsachen schüfe und kaltblütig sowohl einen 50-Liter-Pushboy von Wesco zum Preis von 130 Euro als auch zehn Packungen à 20 Wesco-Original-Müllbeutel zum Preis von insgesamt 39,90 Euro kaufte, um endlich das Problem vom Tisch zu haben und mich wieder wichtigeren Fragen zuwenden zu können. Andererseits: Konnte ich mir einen solchen Affront gegen meine Gefährtin in dieser durch die Umzugskatastrophe ohnehin schon angespannten Gemütslage, ständig zwischen Hysterie und Apathie schwankend, wirklich leisten? Was, wenn das Müllensemble aus irgendwelchen unvorhergesehenen Gründen nun nicht funktionierte? Dann trug ich die volle Verantwortung und würde unweigerlich auf unabsehbare, jedenfalls sehr lange Zeit Hohn und Spott ertragen müssen: „Wer wollte denn partout seinen Kopf durchsetzen? Ich weigere mich jedenfalls, den Müll rauszubringen. Diese Würgerei bei jedem Rausnehmen des Müllbeutels aus diesem Monstrum tue ich mir nicht an. Viel Spaß!” – Nein, zu diesem Schwerthieb durch den gordischen Knoten konnte ich mich nicht ermannen.
[Wird vielleicht fortgesetzt.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Pushkids (IV)
Tuesday, 25. August 2009

Da ich dies schreibe, sind’s noch 6 Tage, 05 Stunden, 02 Minuten und 32 Sekunden bis zu den Kommunalwahlen am kommenden Sonntag. Woher ich das so genau weiß? Von der Website der Freien Wähler – ESSENER BÜRGER BÜNDNIS, wo eine Digitaluhr den Countdown zu dieser Stimmabnahme runterzählt.
Das EBB steht in einer Linie mit ähnlichen Gruppierungen in anderen Revierstädten, die sich vor ein paar Jahren aus Kreisen des bürgerlichen Mittelstands gebildet haben, geeint durch tiefe Unzufriedenheit über den Klüngel der etablierten Parteien und die selbstgefällige Saturiertheit ihrer Lokalmatadore.
Liest man die Programme und Erklärungen solcher selbsternannten „Stachel im Fleisch der etablierten Parteien”, in diesem Falle zum Beispiel das Essener Bürger-Manifest und die Essener Erklärung, dann findet man dort vieles getadelt, das man selbst auch tadeln würde, manches gewünscht, was wohl jeder wünschenswert findet – aber kaum einen Plan, wie und mit welchen Mitteln dieses zu vermeiden und jenes zu erreichen sei. Wenn das EBB bei der letzten Kommunalwahl dennoch einen Achtungserfolg verbuchen konnte, so erklärt sich das vermutlich aus der Ratlosigkeit jener Wähler, die von den traditionellen Parteien enttäuscht sind, aber davor zurückschrecken, den extremen Parteien am rechten oder linken Rand ihre Stimme zu geben.
Welches Potenzial in dieser mit Ratlosigkeit gepaarten Verdrossenheit steckt, das hat zuletzt die Begeisterung für den Politiksatiriker Horst Schlemmer alias Hape Kerkeling gezeigt. Nun will es die Ironie des Schicksals – denn an eine böse Absicht zynischer Werbefuzzis, die sich hier einen Scherz mit ihrem Auftraggeber erlaubt haben, wagt man nicht zu glauben -, dass der Oberbürgermeister-Kandidat des EBB auf den Wahlplakaten aussieht wie eine Satire der Satire. Heute flatterte mir auf der regennassen Rellinghauser Straße ein solches Udo-Bayer-Plakat vor die Füße (s. Titelbild).
Ich weiß ja, man soll als mündiger Bürger seine Wahlentscheidung nicht von Äußerlichkeiten abhängig machen. Aber wer es zulässt, dass ein solches imageschädigendes, mitleiderregendes, das Auge beleidigendes Bild tausendfach am Straßenrand plakatiert wird, dem mag man nicht so recht vertrauen, wenn er ankündigt, er wolle im Falle seiner Wahl das Image dieser Stadt aufbessern. Dies nur in aller Bescheidenheit und um das Mindeste zu sagen.
Posted in Provinzglossen, Würfelwürfe | Comments Off on Rundgang (VII)
Monday, 24. August 2009
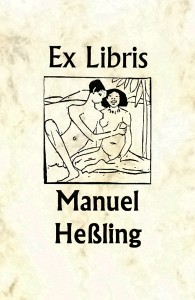
Zukünftig werde ich mich von einem beträchtlichen Teil meiner nicht unbeträchtlich umfänglichen Bibliothek trennen müssen, aus Gründen der Lagerkosten und -umstände, der Zweckmäßigkeit, der Anpassung meiner Arbeitsmittel an meine Arbeitsbedürfnisse und weil ich mich nun ganz bewusst auf eine Lebensphase einlasse, die zu vernünftiger Selbstbescheidung, maßvollem Rückzug und Konzentration auf das Wichtigste zwingt.
Auf diese bevorstehende Auflösung meiner Büchersammlung freue ich mich schon deshalb, weil ich dabei endlich die Gelegenheit finden werde, jedes einzelne meiner vielen Bücher noch einmal in die Hand zu nehmen, mich an die Gründe und Wege zu erinnern, die es in meinen Besitz geführt haben; an die Motive, die mich zu seiner Anschaffung ermunterten; oder an die Zufälle, die es mir scheinbar absichtslos in die Hände spielten.
Bietet man heute, in dieser immer illiterater, ja bibliophober werdenden Zeit, auf dem Antiquariatsmarkt Bücher an, dann hat man üblicherweise desto bessere Chancen, sie loszuwerden, je jungfräulicher, sauberer, unbeschädigter sie sich erhalten haben. „Wie neu” ist die beste Reklame für ein altes Buch, und je älter es tatsächlich ist, desto mehr wird es durch seine äußerliche Frische und Unversehrtheit aufgewertet.
Dabei gab sich doch zu allen Zeiten der wahre Liebhaber antiquarischer Bücher dadurch zu erkennen, dass er die individuellen Spuren, die ihre Vorbesitzer in ihnen hinterlassen hatten, als das Salz in der Suppe seiner Sammelei schätzte. Besitzvermerke, Widmungen, Anstreichungen und Marginalien, beigefügte Zeitungsartikel, eingeklebte Buchhändlerzeichen und manch andere Hinterlassenschaften machten und machen das Massenprodukt Buch ja gerade erst zu einem unverwechselbaren Einzelstück.
So spiele ich tatsächlich mit dem Gedanken, jedes einzelne Buch, das meine Bibliothek verlässt, mit meinem Exlibris zu versehen, selbst wenn dies von manchem unkundigen Käufer zunächst als wertmindernd empfunden werden sollte oder ihn gar vom Kauf abhält. Vielleicht erweist sich ja aber nach Jahren oder Jahrhunderten einmal, dass Bücher mit diesem Zeichen ein ganz eigenes Wesen haben und unter ihnen allen ein geheimes Band besteht, das sie irgendwann wieder zusammenführen wird.
[Das Titelbild zeigt das Exlibris des Verfassers nach einem Holzschnitt von Otto Mueller.]
Posted in Bibliotheca Curiosa, Würfelwürfe | Comments Off on Exlibris
Saturday, 22. August 2009

Allwöchentlich mittwochs und samstags stieren Millionen jackpotberauschte Deutsche auf die rotierende Glaskugel mit den 49 Zahlenbällen in Erwartung eines Hauptgewinns, von dem sie (naiverweise, weil gegen jede Erfahrung) annehmen, dass er sie glücklicher machen wird.
Mit ganz ähnlichen Gefühlen und Erwartungen stiere ich alle paar Tage in die Ramschkisten der Buchhändler und Antiquare, nicht gerade in der maßlosen Hoffnung, das große Los zu ziehen, aber doch immerhin mit der genügsameren Zuversicht, vielleicht einen Namen oder Titel zu entdecken, der mich für ein halbes Stündchen amüsieren, ärgern, anregen oder immerhin ablenken kann – wobei dieses letzte Ergebnis des Lesens mir mittlerweile nicht mehr unbedingt als das minderwertigste erscheint.
Heute zum Beispiel klaubte ich mit spitzen Fingern ein schmales Bändchen aus dem zeitgenössischen Unflat und Unrat: von Starkult bis Pophistorie, vom Ratgeber für Steuerbetrüger bis zum Reiseführer durch Feuchtgebiete. Unter einem so unscheinbaren wie abgegriffenen Umschlag verbarg sich ein bestens erhaltener dunkelroter Leineneinband und hinter dem Rücken des Buches lockte ein Titel, der vielleicht eine gleißende Erkenntnis verheißen wollte, vielleicht aber auch ein bloßer Bluff war: Der Idealismus – ein Wahn. Sein Autor, der deutsch-jüdische Arzt, Philosoph, Nietzscheaner Oscar Levy, war mir zuvor wohl noch nie begegnet, jedenfalls erinnerte ich mich weder an seinen Namen noch an sein Konterfei. Dessen muss ich mich allerdings wohl kaum schämen, denn selbst die knappen Wikipedia-Artikel (in Deutsch und Englisch) verraten wenig über diesen nahezu vergessenen Denker. Desto erstaunlicher ist, dass der Berliner Parerga-Verlag 2005 eine auf sechs Bände angelegte Werkausgabe gestartet hat, deren Band 4 ich hier zum Hohn- und Spottpreis von acht Euro in Händen hielt.
Ich konnte wieder einmal nicht widerstehen. Nachdem ich auf dem Heimweg per Ö-pe-en-vau, in musikalischer Begleitung einiger Klavierstücke von Eric Satie aus dem iPod, Kostproben aus dem verramschten Buch aufgesogen habe, muss ich meine Euphorie mit allen Mitteln mäßigen.
Es scheint, dass dieser Levy in seiner am 7. März 1937 vollendeten Kampfschrift, deren englische Originalausgabe The Idiocy of Idealism 1940 erschien, auf den Punkt genau mit mir übereinstimmt in seiner Auffassung, dass Judentum und Christentum, Kommunismus und Faschismus alle miteinander aus einem fatalen Ursprung kommen und in ein Verhängnis münden. – Nun werde ich das Buch noch einmal gründlich lesen. Sollte ich tatsächlich den Jackpot geknackt haben?
[Das Titelbild zeigt Oscar Levy mit seiner Enkeltochter Jacqueline im April 1946 in Boars Hill bei Oxford; aus Oscar Levy: Der Idealismus – ein Wahn. Hrsg. v. Leila Kais. Berlin: Parerga Verlag, 2006, S. 132.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Bücherlotterie
Friday, 21. August 2009

Heute jährt sich der Tod meines Vaters zum vierzigsten Mal. Ich kann davon nur berichten, was mir durch vielfache mündliche Erzählungen über dieses Ereignis in der Erinnerung haften geblieben ist. Deutlicher gesagt: durch meine vielfach wiederholte Schilderung des Todestags aus meiner Sicht. Denn meine Mutter beschwieg diesen tiefsten Einschnitt in meinem Leben ebenso wie die näheren und ferneren Verwandten und Bekannten, die übrigens nur einen sehr beschränkten Personenkreis ausmachten. Meine Großmutter väterlicherseits brach augenblicklich in Tränen aus, wenn die Sprache auf ihren Hansi kam. Sie hatte nach dem älteren Sohn Kuno im Krieg und ihrem Ehemann durch Asthma und Herzinsuffizienz nun auch noch den dritten und letzten „meiner Männer” verloren.
Ich also bin an diesem sonnigen Sommerferientag des Jahres 1969 mit meinem Cousin Jörg ins Kino gegangen. Wir sahen im Filmstudio am Glückaufhaus eine klamaukige Komödie um ein Wettfliegen aus der Frühzeit der Aviatik. Wann immer mich ein Film begeistert, muss ich ihn jedem erzählen, der mir über den Weg läuft, das war schon damals so und gilt noch heute. Und wann immer sich meine Zuhörer einen solchen Film, durch meine Erzählung animiert, persönlich ansehen, berichten sie nachher prompt von einer herben Enttäuschung. Dann habe ich wohl wieder einmal „ausgeschmückt”, „übertrieben” oder gar die Handlung „völlig verfälscht”, wie meine Gefährtin schmunzelnd anmerkt. „Er kann es einfach nicht lassen.”
Am 20. August des besagten Unglücksjahres kam ich zu meinem größten Bedauern gar nicht dazu, den für meine damaligen Ansprüche wirklich todkomischen Film über die Abenteuer der Fliegerasse meiner Mutter und meiner Tante zu erzählen, die mit merkwürdig verspannten Gesichtern in unserem Wohnzimmer am gläsernen Couchtisch beisammensaßen. Ich weiß noch, dass ich nur schwer meinen Ärger darüber verwand, den beiden Frauen kein noch so müdes Lachen entlocken zu können. Es war das letzte Mal, dass ich mit dem Geborgenheitsgefühl eines Sohnes einschlief, der den Schutz eines Vaters genießt.
Die Teilnahme an der Beisetzung der Urne wollte unsere Mutter uns ersparen. Das war lieb gemeint, hatte aber für mich fatale Folgen. Ich, der Vielredner, verstummte von da an allsogleich, wann immer die Sprache auf meinen Vater kam. Dieses eisige Schweigen spürte nahezu jeder, der arglos meinen wunden Punkt getroffen hatte, und wechselte ohne Verzug das Thema.
So war die plötzliche Abwesenheit meines Vaters, sein spurloses Verschwinden von einem Tag auf den anderen, für mein Empfinden eher einem Taschenspielertrick zu verdanken denn einem Trauerfall. Zwei Wochen zuvor hatte er sich noch mit uns am Nordseestrand im Sand gewälzt und war voller Zuversicht auf eine lange, friedvolle und genussreiche Zukunft gewesen. In diesem Sommer vor vierzig Jahren erreichten die menschlichen Ausdrucksformen Fest, Verbrechen und Abenteuer durch Woodstock, die Manson-Morde und die Mondlandung unerreichte Steigerungsformen. Alle drei Ereignisse hat mein damals dreiundvierzig Jahre alter Vater gerade noch miterlebt. Damit würde ich ihn trösten, wenn er sich über die Kürze seines Lebens beklagte.
Posted in Memento, Würfelwürfe | Comments Off on Selbstbeschreibung (I)
Friday, 21. August 2009

Zusammenstellungen von Zitaten nach gewöhnlichen oder ungewöhnlichen Kriterien haben mich immer schon angezogen. Sammlungen letzter Worte berühmter Sterbender besitze ich gleich drei und habe hierüber andernorts vor Jahr und Tag auch einmal gebloggt. Als ich neulich den größten Teil meiner Bibliothek auslagern musste, da blieb etwa die beeindruckend reichhaltige Zitatensammlung Geld von Robert W. Kent und Lothar Schmidt von der Zwangsausbürgerung verschont (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1990).
Ein ungleich bescheidener auftretendes, dennoch nicht genug zu lobendes Sammelsurium bitterböser Zitate bietet das Büchlein Dichter beschimpfen Dichter, das ich aus gegebenem, aber zu verschweigendem Anlass heute wieder einmal zur Hand nahm. Wir verdanken es dem jüngst verstorbenen Jörg Drews und seinen ungenannten „Freunden in Berlin und Pisa, in Zürich und in Hille, in Paris und in Scheeßel, in Jerusalem und in Bielefeld, vor allem aber Sabine Kyora”. (Dichter beschimpfen Dichter II. Ein zweites Alphabet harter Urteile. Zusammengeststellt u. m. e. Nachwort beschlossen v. Jörg Drews & Co. Zürich: Haffmans Verlag, 1992, S. 137.)
Jetzt erst wird mir bewusst, dass ich mit dem Buch, dessen knapp 140 Seiten im Kleinoktav-Format viel zu schnell weggelesen sind, bloß den zweiten Teil einer Folge besitze. Ich finde darin zwar allerlei hässliche Invektiven gegen die großen und kleineren Geister der Weltliteratur, in alphabetischer Reihenfolge von Aeschylos bis Zola. Aber mancher, den ich gerade heute gern beschimpft sähe oder als Schimpfenden hörte – Knut Hamsun, Ludwig Hohl, Harald Wieser – fehlt zu meinem Bedauern. Vielleicht muss ich mir den ersten Band von 1990 doch noch zulegen? Aber da sehe ich, dass Drews 2006 zudem eine „vollst. überarb., ergänzte und erw. Neuausg.” bei Zweitausendeins in die Welt geschickt hat …
Reizvoll wäre es vielleicht, die gegenseitigen Invektiven der Damen und Herren Dichter wie eine lückenlose Perlenkette oder einen chronologischen Staffellauf zu arrangieren, von der jüngsten Rempelei eines Bachmann-Preisträgers gegen seinen renommierten Juror bis zurück zu Homer, der dann schließlich auch noch Opfer einer Beschimpfung wird, nämlich durch Voltaire: „Wenn die Bewunderer Homers aufrichtig wären, so würden sie die Langeweile eingestehen, die ihnen ihr Liebling oft verursacht.” (Dichter beschimpfen Dichter II, a. a. O., S. 57.) Bloß fände Homer vermutlich keinen Ahnen mehr, bei dem er sich für die widerfahrene Schmähung schadlos halten könnte.
Etwas aus der Reihe fällt in Drews negativem Pantheon übrigens Walter Kempowski, dem es als einzigem gestattet wird, sich selbst zu beschimpfen: „Ich bin der Sonnyboy der deutschen Gegenwartsliteratur. Ein hingeschissenes Fragezeichen.” (Ebd., S. 66.) – Wenn ich so vermessen wäre, dem nachzueifern, dann würde ich vielleicht über mich sagen: „Ich bin ein nervöses Hüsteln, das eilige Passanten aus dem brennenden Dornbusch zu vernehmen meinen.”
Posted in Babel, Godzilla, Würfelwürfe | Comments Off on Kastanie aus Feuer
Tuesday, 18. August 2009

Gestern kam ich in Hamsuns Mysterien an die Stelle, wo die Pfarrerstochter Dagny Kielland sich nach einem langen Gespräch mit dem mysteriösen Fremden Johan Nilsen Nagel für den schönen Abend bedankt: „Jetzt kann ich auch meinem Verlobten etwas erzählen, wenn ich schreibe. Ich werde sagen, daß Sie ein Mann sind, der mit allen wegen allem uneinig ist.” (Knut Hamsun: Mysterien; in: Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Deutsche Originalausgabe besorgt u. hrsg. v. J[ulius] Sandmeier. Erster Band. München: Albert Langen, 1921, S. 307.)
Zufällig fällt mir nahezu gleichzeitig beim Auspacken meiner Bücherkartons Hohls schmales Bändchen Daß fast alles anders ist in die Hände, ich vermute hier einen Bezug und lese erstmalig den titelgebenden Essay. Tatsächlich finde ich darin Sätze, die immerhin Berührungspunkte zu der Charakterisierung Nagels haben, und sei es ex negativo: „Die Leute, die sagen, daß sie eben ,festen Boden unter den Füßen haben‘, sind bodenlose Leute (an nichts teilnehmend, nicht im geringsten verfügend, quallig).” (Ludwig Hohl: Daß fast alles anders ist. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1984, S. 122.)
Hohl nennt viele Beispiele und zitiert wenige Gewährsleute – Kafka, Schopenhauer, Musil, Kraus und natürlich Lichtenberg – für seine grundstürzende Ansicht, dass fast alles anders sei, „anders als fast alle Menschen, fast immer, es sich vorstellen”. (Ebd., S. 121.) Grundfalsch sei zum Beispiel auch die Vorstellung, die die Menschen vom Schreiben haben, das (nach einem Wort von Musil) keine Tätigkeit, sondern ein Zustand sei. Und nicht ausdrücklich, aber aus einigen Andeutungen wird klar, dass dies keineswegs ein angenehmer Zustand ist.
Noch etwas, das leidlich hierzu passt. In der letzten Sonntagszeitung las ich eine wegen ihrer Prägnanz zitierenswerte Einlassung des Sozialpsychologen Harald Welzer zu der Frage, warum der gegenwärtige Wahlkampf in Deutschland so fade sei. Welzer erkennt ganz richtig, dass die Vorstellungswelt der Politiker „an die Wohlstandsgesellschaft und ihre Basiskonzepte Wachstum, Fortschritt und Wettbewerb gebunden ist, Wenn all das in Frage steht, bricht ratloses Schweigen aus. Unsere Parteien können Zukunft ausschließlich als verbesserte Gegenwart denken. Das funktioniert aber nicht mehr, wenn Staatsverschuldung, Klimawandel, Artensterben plötzlich klarmachen, dass die Gegenwart besser ist, als die Zukunft je sein wird. Der Fortschritt schreitet nicht mehr fort, und was wächst, sind lediglich die Probleme von morgen. Daher diese radikale Phantasielosigkeit.” (Lichtgestalt; in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Nr. 33 v. 16. August 2009, S. 19.)
Noch einmal Ludwig Hohl: „Die Welt ist anders … Und jene mächtigsten Männer, die sie lenken (welche gar nicht so mächtig sind und gar nicht so sehr Lenkende, sondern viel mehr Getriebene), sie können uns nichts bringen – wenn nicht das allgemeine Bewußtsein vorerst geändert worden ist -, sie können zu nichts anderem hinführen als zum Ende der menschlichen Welt.” (Hohl, a. a. O., S. 130.)
Posted in Eccentrics, Würfelwürfe | Comments Off on Anders
Sunday, 16. August 2009

Noch mal zur Wahl? Bitteschön. Wo die Parteien der bürgerlichen Mitte zwölf Quadratmeter große Stellwände auf die grüne Wiese stellen, da müssen sich die Extremisten vom linken und rechten Flügel mit beklebten Pressspanplatten im Zeitungsformat begnügen, die sie an Laternenpfählen und Ampeln aufhängen.
Dass sich dabei gelegentlich unbeabsichtigte Korrespondenzen mit den Signalen und Hinweisschildern ringsum ergeben, taugt immerhin ab und zu mal zur willkommenen Erheiterung des wahlmüden Passanten.
Unser leicht makaberes Beispiel aus der Nachbarschaft lässt die Frage offen, ob die von den Republikanern versprochene Sicherheit, Sauberkeit und Lebensqualität demnächst für Friedhofsruhe in unserer Stadt sorgen soll oder ob diese löblichen Werte nach dem Wahlsieg der nationalistischen Partei bloß auf dem angezeigten Gottesacker hergestellt werden.
Wüsste der Betrachter nicht, dass das rote Verkehrsschild sich dort bereits seit Jahr und Tag befindet, er könnte mutmaßen, es sei von einem Konkurrenten aus dem sozialistischen Lager bewusst dort platziert worden, um die Werbebotschaft der Reps zu konterkarieren.
Vielleicht hat sich aber auch ein intelligenter Undercoveragent als Plakatierer in die Reihen der Rechtsradikalen eingeschlichen und treibt nun dort seinen grimmigen Schabernack. Immerhin sind doch dergleichen missglückte Propagandamaßnahmen allemal unterhaltsamer als die öden Großflächen der Profis.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Rundgang (VI)
Saturday, 15. August 2009

Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen stehen unmittelbar bevor. Auch in Rellinghausen werben die Parteien mit Plakaten größeren oder kleineren Formats um die Stimmen der Wahlberechtigten.
Von Mal zu Mal beklemmender erscheint mir die Austauschbarkeit der Parolen und Personen, mit denen sich die großen Parteien CDU und SPD zur Wahl stellen.
Ist es am Ende gar die gleiche Werbeagentur, die die Kandidaten fürs Amt des Oberbürgermeisters mit diesen immer gleichen quergestreiften Schlipsen und aktuellen Brillengestellen vor ein blasses blaugrau bzw. graublau gestellt hat, mit dem roten Farbklecks in der rechten bzw. linken unteren Ecke?
Klar, dass der Kandidat der regierenden Partei im Gespräch mit dem noch amtierenden Oberbürgermeister gezeigt wird, den er schließlich beerben will. Die Slogans – „Oberbürgermeister für Essen”, „Oberbürgermeister für unsere Stadt”, „Energie für Essen”, „Verantwortung für Essen” – sind so nichtssagend und substanzlos, als gälte es, um jeden Preis den bisherigen Rekord der niedrigsten Wahlbeteiligung zu brechen.
Und welche Assoziationen will uns die linke untere Ecke des SPD-Plakats nahelegen? Schnell weiterblättern?
Posted in Würfelwürfe | 1 Comment »
Saturday, 15. August 2009

Was den grauenvollsten Umzug angeht, den wir je zu absolvieren hatten, so sind wir jetzt wohl, toi-toi-toi, aus dem Gröbsten raus.
Man tut gut daran, die meisten Erinnerungen an Missverständnisse, Zerstörungen, Verletzungen, Anstrengungen, Ängste, Entsagungen, Verluste und Enttäuschungen zu verdrängen und sich einer erholsamen Zukunft in einer Wohnung zuzuwenden, die es immerhin wert war, all diese Schrecknisse auf sich zu nehmen. Etwas und einiges bleibt aber doch zurück. Nehmen wir für heute nur die kaum noch sichtbare Narbe an der Spitze meines linken Zeigefingers.
Ich war gezwungen, zeitweise ohne jede fremde Hilfe in vier Zimmern ein praktisches Klickparkett zu verlegen, nicht zu verwechseln mit billigem Laminat, da es aus Vollholz besteht, die reine Natur. Aber es funktioniert doch ganz ähnlich. Planken von ebensolchen Abmessungen, wie sie bei dem holzimitierenden Kunststoffboden üblich sind, gilt es ineinander zu fügen, wozu mit Schlagholz, Schlageisen und Hammer zu hantieren ist. Die seit Friedrich Theodor Vischer sprichwörtliche Tücke des Objekts tritt hierbei besonders rücksichtslos in ihre Rechte. Und wenn der Dilettant dann noch die mangelnde Routine durch besinnungslose Wut auszugleichen versucht, ist ein Unfall nahezu unvermeidlich. Eines sommerlichen Julimorgens traf ich mit dem Hammer nicht das Holz, sondern besagten Zeigefinger. Da platzte das Fleisch auf, Blut spritze auf das frisch verlegte Birkenholz, Panik überschwemmte die verbliebene Vernunft, deren letzter Rest immerhin den wackligen Beinen befahl, Hilfe in einer nahe gelegenen Apotheke zu suchen.
Dabei hatte ich noch das Glück, auf eine trostreiche und patente Apothekerin zu treffen, die mir umstands- und gar noch kostenlos einen tadellosen Wundverband anlegte. Der Schmerz traf erst zehn Minuten später ein und ließ mich nach Luft schnappen. Mein Hausarzt besah sich die Verletzung und bereitete mich darauf vor, dass der Nagel vielleicht gezogen werden müsse. War dies nicht eine aus China bekannte Foltermethode? Ach nein, da waren ja Bambusspitzen mit im Spiel. Außerdem versprach mein Arzt mir für diesen Fall eine örtliche Betäubung. Und außerdem wachse der Nagel ja nach.
Der Nagel musste nicht dran glauben, doch sendet die Fingerspitze sechs Wochen nach dem Missgeschick noch immer irritierende Empfindungen ans Hirn. Jede Berührung mit gleich welchem Gegenstand fühlt sich dort an, als träfe er auf rohes Fleisch. Wenn ich mich rasiert habe, spüre ich auf der Wange, die der rechte Zeigefinger als samtigweich registriert, mit dem linken Zeigefinger ein dichtes Borstenfell. Und weil ich diesen Finger aussparen muss, wenn ich Wechselgeld aus meinem Portemonnaie zusammenlese, entgleiten mir die kleineren Münzen immer wieder und ich komme mir vor wie ein alter Tattergreis. Wie kann ein einziger falscher Schlag im Bruchteil einer Sekunde solch weitreichende Folgen haben!
(Wird fortgesetzt.)
Posted in Würfelwürfe | 4 Comments »
Thursday, 13. August 2009

Und dann der Wald! Dieser schöne Weg gehört noch nicht im engeren Sinn dazu. Keine fünf Minuten laufe ich auf meinen kranken Füßen und habe diesen Durchblick!
An Werktagen begegnet man vormittags kaum einer Menschenseele in den weitläufigen Waldstücken rings um Rellinghausen. Am Nachmittag machen dann vornehmlich die berufstätigen Hundebesitzer ihre Pflichtgänge, ein paar ältere Herrschaften staksen mit ihren Nordic-Walking-Stöcken einher. Die übrigen paarhunderttausend Bürger dieser Stadt hocken wohl vor ihren Bildfunkgeräten, shoppen in der Mall oder stehen noch im Stau. Was das kostet!
Der Wald kostet nichts. Eintritt frei. Das mag wohl einer der Hauptgründe sein, weshalb er nur von wenigen Spinnern wie mir geschätzt wird. Wofür kein Geld verlangt wird, das kann schließlich nicht viel taugen. Selbst die ständig wachsende Zahl der Arbeitslosen, die ja kaum Geld haben, treiben sich lieber in den Fußgängerzonen, an Trinkhallen oder auf Spielplätzen herum, als in der freien Natur für lau lustzuwandeln.
An den Wochenenden und besonders bei jenem Wetter, das nach landläufiger Meinung als ein schönes anzusehen ist, begegne ich häufiger Rentnerehepaaren in größeren Gruppen, angeregt plaudernd, meist nach Geschlechtern zu Kleingruppen sortiert. Leider nur sehr vereinzelt treffe ich sodann auf Eltern, die ihren Großstadtkindern wenigstens gelegentlich und nicht nur im Urlaub die Begegnung mit der freien Natur ermöglichen wollen.
Ansonsten aber bin ich herrlich allein, von der Hündin abgesehen, die sich aber im Wald noch unauffälliger gibt als auf gepflasterter Straße. Die Wonnen der Waldeinsamkeit erinnern mich dabei an das Vergnügen entlegener Lektüre. Beide Genüsse werden mir noch köstlicher, wenn ich sie ganz exklusiv für mich allein habe. Ich muss zugeben, dass man mir nach diesem Geständnis vorwerfen kann, ein elitärer Sonderling zu sein. Aber es gibt doch schließlich schlimmere Verirrungen, oder?
Posted in Snapshot | Comments Off on Rundgang (IV)
Wednesday, 12. August 2009

Kaum 200 Meter südwestlich von unserer neuen Wohnung und in der gleichen Straße befindet sich die Kirche der evangelischen Gemeinde Rellinghausen mit angegliedertem Kindergarten, Jugendräumen und Gemeindeamt. Auch eine Gemeinschaftsgrundschule, die Ardeyschule, befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche.
Die moderne Kirche ist bekannt für ihre Orgel, auf der der bekannte Organist und Komponist Gerd Zacher gern und häufig gespielt hat.
Bei offenem Fenster hören wir den Stundenschlag der Kirche, auch die Viertelstunden werden geschlagen und jetzt gerade, um sieben Uhr abends, ruft ein drei Minuten langes Geläut offenbar die Gläubigen zu einem Gottesdienst. Erstaunlicherweise ist mir dies bisher nicht als störend erschienen. Dies mag einerseits daran liegen, dass unsere Fenster in geschlossenem Zustand gut isolieren. Aber vielleicht bin ich auch in den letzten Jahren gegenüber solchen ungefragten Kundgebungen mir fremder Überzeugungen toleranter geworden.
Den Turm der Kirche sehe ich von Weitem, wenn ich mit der Straßenbahnlinie 105, aus der Innenstadt kommend, über die Rellinghauser Straße heimwärts fahre.
Betreten habe ich die namenlose Kirche bisher noch nicht.
Posted in Snapshot | 1 Comment »
Wednesday, 12. August 2009

Etliche meiner Rundgänge mit kleinerem oder größerem Radius unternehme ich an der Seite unserer Mischlingshündin Lola, die in wenigen Tagen zehn Jahre alt wird.
Ein Motiv für unseren Umzug aus dem Moltkeviertel nach Rellinghausen war, dass wir dem Tier auf seine alten Tage gönnen wollten, regelmäßiger als in den letzten Jahren Waldluft zu schnuppern. Von der letzten Wohnung aus war bequem nur ein kleiner Park erreichbar. Wollten wir autolosen Hundehalter Lola mehr bieten, mussten wir mit der S-Bahn in den Stadtwald fahren. Diesen Aufwand regelmäßig auf uns zu nehmen hatten wir uns fest vorgenommen, als wir Anfang 2005 in die Messelstraße zogen. Bald blieben aber unsere Vorsätze auf der Strecke. Verspätete Bahnen, der Zwang zu perfektem Timing, wollte man bei der Rückfahrt keine langen Wartezeiten auf verdrecktem Bahnsteig in Kauf nehmen und manch andere Hemmnisse führten dazu, dass wir die Tour mit Lola in den Stadtwald wenn überhaupt nur an den Wochenenden unternahmen.
Nun also liegt der Schellenberger Wald nahezu direkt vor unserer Haustür. Dieser ausgedehnte Forst war übrigens einer der Gründe, warum die Bürgermeisterei Rellinghausen im Jahr 1910 zur Stadt Essen eingemeindet wurde: „Für Rellinghausen bringt dies einige Vorteile, da die Gemeinde nicht in der Lage gewesen war, die dringend notwendige Kanalisation anzulegen und die Verkehrsprobleme zu lösen. Auch Essen hatte ein großes Interesse an der Vereinigung, weil der größte Teil des Stadtwaldes in Rellinghausen lag.” (Klaus Wisotzky: Vom Kaiserbesuch zum Euro-Gipfel. 100 Jahre Essener Geschichte im Überblick. Essen: Klartext Verlag, 1996, S. 52.)
Der gemeinsame Ausgang von Herr und Hund hat ja aber bekanntlich nicht nur die angenehme Wirkung, dass sich beide auf ihre alten Tage Bewegung verschaffen, frische Luft atmen und den Blick weiter schweifen lassen, als dies in der engen Kammer möglich ist; für das reinliche Tier ist er vielmehr Notwendigkeit aus unabweislicher Notdurft, die es nie und nimmer im Bau seiner Halter verrichten will. Was dies betrifft ist es gar nicht hoch genug zu schätzen, wenn sich in unmittelbarster Nähe der Wohnung ein kleines Dickicht befindet, wo die Hinterlassenschaften so separat abgelegt werden können, dass sie keinen menschlichen Schuh beschmutzen und keine menschliche Nase beleidigen.
Voilà! Hinter diesen Bänken, auf denen offenbar nie ein anderer Platz nimmt als der Verfasser dieses Weblogs, hat Lola den stillen Ort gefunden, an dem sie sich ganz entspannt erleichtern kann, ohne jemals jemandem lästig zu fallen.
Posted in Snapshot | Comments Off on Rundgang (II)
Tuesday, 11. August 2009

Nie wieder hat man eine bessere Chance, die Dinge deutlich zu sehen, wie bei der ersten Begegnung. Gewohnheit lässt den Blick verschwimmen und macht schließlich blind.
(Die verbreitete Auffassung, dass der erste Eindruck, speziell bei der Begegnung mit Menschen, auch der beste sei oder sich später zumindest oft als ein solcher erweise, teile ich hingegen nicht. Im Rückblick auf meine zahlreichen Bekanntschaften erinnere ich mich an gleich viele Fälle, wo das Gegenteil galt und mein erster Eindruck durch ein besseres Kennenlernen vollständig überholt wurde.)
Deshalb habe ich beschlossen, meine neue Wohnumgebung in den kommenden Tagen und Wochen wenn nicht systematisch, aber doc h gründlich, mit der Kamera in der Hand, zu durchstreifen und dabei festzuhalten, was mir bemerkenswert, typisch, kurios oder befremdlich erscheint.
Kaum trete ich vor die Haustür, da trifft mich schon der Blick eines steinernen Schlossers vom Giebel des Hauses via-à-vis.
Ich bin nach gründlicher Selbstprüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass es ein freundlicher Blick ist. Der friedliche Handwerker ist mir zugetan und ich denke, dass der Schlüssel, an dem er gerade feilt, für mich bestimmt ist. Ich denke noch weiter und male mir aus, dass der Schlüssel zu jener Tür passt, hinter der sich verbirgt, wonach ich schon so lange suche. Es hat aber wenig Sinn, beim Anblick des reglosen Schlossers ungeduldig zu werden. Gut Ding will Weile haben! Und übrigens habe ich ja auch besagte Tür noch nicht gefunden.
(Wird fortgesetzt.)
Posted in Snapshot | Comments Off on Rundgang (I)
Sunday, 09. August 2009

In wenigen Tagen läuft nach vierzig Jahren die Ruhezeit für dieses Urnengrab ab. Deshalb nutzte ich heute eine günstige Gelegenheit, es mir zum ersten und letzten Mal anzuschauen.
Schön, dass es unter einem alten Ahornbaum liegt. Dass der Vorname in dieser Koseform gewählt wurde, lässt Raum für Spekulationen.
Eine sentimentale Regung, die ich für nicht ganz ausgeschlossen gehalten hatte, stellte sich nicht ein. Wieder machte ich die überraschende Beobachtung an mir, dass mich Friedhöfe keineswegs traurig stimmen oder gar bedrücken. Eher im Gegenteil fühle ich mich beschwingt, frohgemut und durch die Beobachtung des Eifers amüsiert, mit dem wacklige Witwen die Gräber ihrer Vorangegangenen pflegen.
Auch mit dem Tod hat der Gottesacker für mein Empfinden nur von Ferne etwas zu tun. Hier passt einmal das pervers missbrauchte Wort Entsorgung und gewinnt seine ursprüngliche Unschuld zurück.
Als meine Begleiter die Frage aufwerfen, wie ich selbst es denn gern hätte, posthum, betreffs die Verbringung der sterblichen Hülle, die dann wohl nicht mehr meine ist, bleibe ich unentschieden und verweigere eine Antwort. Vorläufig reicht mir für diesen Fall, dass ich meine Organe zur Weiterverwendung freigegeben habe. Was mit dem Rest geschieht, scheint mir völlig belanglos.
Posted in Memento, Würfelwürfe | 2 Comments »
Sunday, 09. August 2009
Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Saturday, 08. August 2009
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Dran!
Friday, 07. August 2009

Einer der vielen Romane, die ich immer schon mal schreiben wollte, ist der von dem Junggesellen Mitte dreißig, der in der Herrenabteilung eines großen Bekleidungshauses einer wenig attraktiven Großstadt arbeitet und sich schon längst ums Leben gebracht hätte, wenn er nicht so antriebslos wäre.
Sein einzig starkes Gefühl, seit er sich erinnern kann, ist ein bodenloser Hass gegen seine Mutter, eine inzwischen pensionierte Lehrerin für Mathematik und Musik. Wann immer er in den letzten Jahren mit einem Mädchen oder einer jungen Frau vertraulich wurde, musste er ihr so bald wie möglich von diesem Hass erzählen, in den schrillsten Farben malte er diesen Hass aus, und stets gipfelten seine Tiraden in Mordphantasien von geradezu lodernder und schwärender Bestialität.
Zwar verhielten sich die Herzensdamen dieses bösen Buben im Einzelnen je nach ihrem Temperament und ihrer Tagesform sehr unterschiedlich, doch in einem Punkt gingen sie konform: Mit diesem armen Irren wollten sie keineswegs noch vertrauter werden, als es ihnen nun durch ein offenbares Missgeschick widerfahren war.
Besonders eindrucksvoll an den dramatischen Darbietungen des unglücklichen Anzugverkäufers wären für seine Zuhörerinnen jene kurzen szenischen Einlagen gewesen, bei denen er gewisse gestische Marotten und sprachliche Ticks seiner Mutter gekonnt imitierte – wenn, ja wenn sie denn das zweifelhafte Vergnügen gehabt hätten, die garstige Frau persönlich kennenzulernen. Dann nämlich hätten sie nicht schlecht gestaunt über das imitatorische Genie ihres Verehrers. So aber mussten sie die affektierten Auftritte und hysterischen Ausbrüche, die er ihnen vorspielte, für alberne und maßlose Übertreibungen halten.
Womit niemand und am wenigsten der Sohn gerechnet hätte, das geschieht. Die überaus agile Alte, die seit Menschengedenken nicht einmal über ein Schnüpfchen geklagt hatte, fällt eines lauen Julitages bei ihrer Morgengymnastik plötzlich tot um. Der Sohn ist wie verwandelt, fühlt sich von einer schweren Last befreit, wird am offenen Grab von einem Lachanfall überwältigt etc. pp. Doch dann bemerkt er, zunächst nur als schwache Ahnung, dann als zunehmenden Verdacht, schließlich als böse Gewissheit, eine unwiderstehliche Veränderung seines Verhaltens: Er übernimmt zwanghaft die Ticks und Marotten seiner Mutter. Diesmal aber spielt er sie nicht, sie mischen sich vielmehr ununterscheidbar in sein ganz alltägliches Auftreten. (Bis hierher und nicht weiter. Wie für alle meine unschreibbaren Romane gibt es auch für diesen keinen sinnvollen Schluss.)
Posted in Märchen, Würfelwürfe | Comments Off on Unschreibbare Romane (I)
Wednesday, 05. August 2009

Ich weiß gar nicht mehr, wer die ohnehin schon nicht geringe Konfusion noch verschärfte, indem er die Beutelfrage ins Spiel brachte.
Üblicherweise wirft man seinen Müll in unseren reinlichen Zeiten ja nicht sozusagen ungeschützt in den Abfalleimer. Vielmehr befindet sich in diesem schmucken Gefäß ein weiterer, geringfügig kleinerer und weniger ansehnlicher Eimer. Und um auch diesen „Eimer im Eimer” vor ekligen Verschmutzungen zu bewahren, wird er mit einem Müllbeutel ausgekleidet.
Nun hatten wir bei unseren Internetrecherchen auf der Wesco-Website gesehen, dass es für die Baseboys und Pushboys aus dem Sauerland auch spezielle Abfallbeutel mit Zugband gibt. Meine Gefährtin witterte gleich Geschäftemacherei: „Da zahlt man bloß für den Namen. Ich hole die Beutel wie bisher bei ReWe oder Aldi.”
Nun musste ich freilich zu bedenken geben, dass die meisten Abfallsammler von Wesco ja gerade durch ihre ungewöhnlichen Proportionen ins Auge stechen und sich eben deshalb dem Liebhaber gediegener Haushaltwaren als unverwechselbare Design-Schmuckstücke einprägen. Ich argwöhnte, dass sich möglicherweise ein für die Firma Wesco angenehmer Nebeneffekt dieser individuellen Formgebung daraus ergab, dass in ihre Eimer ausschließlich Wesco-Beutel passen. Meine Gefährtin murmelte etwas, das so klang wie „was nicht passt, wird passend gemacht”, aber damit konnte sie kaum sich selbst, geschweige denn mich überzeugen. „Du glaubst doch nicht, dass ich einen weit über hundert Euro teuren Abfalleimer kaufe, der für die Ewigkeit halten soll, um dann ewig an irgendwelchen unpassenden Billigbeuteln herumzuzerren!”
Als wir an diesem Punkt unserer warenkundlichen Recherchen in Sachen Abfalleimer angelangt waren, hätte ich nicht mehr darauf gewettet, dass wir überhaupt noch einmal zu einem neuen Eimer kommen würden. Seit etlichen Tagen entsorgten wir sehr zur Freude eines munteren Fruchtfliegenschwarms unsere Küchenabfälle provisorisch in Plastikeinkaufstüten, die wir an die Klinke einer Zimmertür hängten.
(Wird fortgesetzt.)
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Tuesday, 04. August 2009
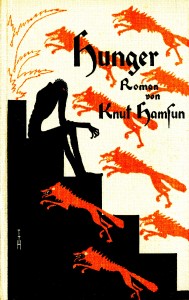
Es gibt in allen Schichten und Professionen und gab zu allen Zeiten wie auch heute noch vereinzelte Menschen, die sich durch einen heroischen Starrsinn aus der gewöhnlichen Gemeinschaft hervortun, oft zu deren Belustigung, fast immer zu ihrem eigenen Schaden. Diese knorrigen Solitäre, einsamen Kämpfer für eine unbezweifelte „Wahrheit”, gehen eher aufrecht vor die Hunde, als dass sie nur einen Fingerbreit von ihren Überzeugungen abrückten. Solch ein armer Tropf war der norwegische Erzähler Knut Hamsun, dessen Geburtstag sich heute zum 150. Mal jährt.
Als ich vor achtunddreißig Jahren erstmals Hunger las, war dies – neben der gleichzeitigen Begegnung mit Kafkas Amerika und Büchners Lenz – einer der Glücksfälle, die mich auf kürzestem Weg zu einem anspruchsvollen Lesergeschmack führten. Hamsuns Debutroman von 1890 wurde dann hundert Jahre nach seinem Erscheinen noch einmal bedeutsam für mich, als ich eine anorektische Phase durchmachte und bis auf 59,2 Kilo herunterhungerte.
Wenige Wochen vor seinem frühen Tod Ende 1993 hatte ich eine kurze Korrespondenz mit dem aus Essen stammenden Helmut Salzinger. Ich wollte mich bei ihm beliebt machen und sandte Hamsuns Mysterien als rororo-Erstauflage nach Odisheim. Der Gärtner im Dschungel bedankte sich, dies sei ein merkwürdiger Zufall. Er habe das Buch einst als Kind im Bücherschrank einer Tante in Essen gesehen, bevor das Haus und damit auch die Mysterien ein Opfer des Bombenhagels wurden. Nun werde er es also endlich lesen. Ich weiß nicht, ob die Zeit dazu noch gereicht und ob ihm der Roman gefallen hat.
Die Welt ist klein! Heute ist es ausgerechnet Brigitte Kronauer, die Knut Hamsun in der Süddeutschen Zeitung zum 150sten gratuliert – auch sie eine gebürtige Essenerin. (Das ist schon erstaunlich, denn wesentlich mehr nennenswerte Schriftsteller hat meine Heimatstadt im vorigen Jahrhundert nicht hervorgebracht.) Kronauer empfiehlt, nachdem sie über Hamsuns politische Verirrungen berichtet hat: „Man halte sich an seine Werke. Zu eigenem Nutzen und Gewinn lese man wenigstens einmal im Leben Hunger, erst recht den darauf folgenden, genialen Roman Mysterien, in dem es der Held noch einfallsreicher, ja epiphanischer versteht, an einer (diesmal klein-)städtischen Gesellschaft zu verzweifeln.” (Brigitte Kronauer: „Die unendliche Beweglichkeit meines bißchens Seele”;in: SZ Nr. 177 v. 4. August 2009, S. 12.) – Ich zögerte einen kurzen Augenblick, bevor ich vor zwei Wochen meine fünfzehnbändige Hamsun-Werkausgabe (München: Albert Langen, 1921-30) dann doch in eine Kiste für die neue Wohnung packte und nicht in eine Kiste für das Außenlager. Nun bin ich froh über meine Entscheidung, auch eingedenk des wahnwitzigen Nachrufs, den der Norweger am 2. Mai 1945 auf Adolf Hitler veröffentlichte. (Vgl. Robert Ferguson: Knut Hamsum – Leben gegen den Strom. A. d. Engl. v. Götz Burghardt. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992, S. 555.)
Eine Rezitation von Hunger gibt es von dem großartigen Mimen und Vorleser Oskar Werner, für Menschen, die das Selbstlesen bereits verlernt haben, ein nahezu gleichwertiger Ersatz. Ich selbst werde mir wohl bald einmal Hamsuns spätes Tagebuch Auf überwachsenen Pfaden gönnen.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Jetzt erst recht!
Monday, 03. August 2009
Als Bewohner der achtgrößten Stadt Deutschlands waren wir voller Zuversicht, in der City gleich mehrere Haushaltswarengeschäfte, Design-Studios oder Kaufhausabteilungen zu finden, wo wir die verschiedenen Modelle des bekanntesten Abfalleimerfabrikats würden in Augenschein nehmen können. Zwei enervierende Stunden belehrten uns eines Besseren. Lediglich in einem alteingesessenen Fachgeschäft am Theater waren drei Exemplare der Produktlinie „Baseboy” vorrätig, in Weiß, Rot und Neusilber, Fassungsvermögen 20 Liter.
Das waren nun die üblichen Treteimer, wie man sie schon aus den 1950er-Jahren kannte, die mit der speziellen Wesco-Erfolgsstory nur bedingt etwas zu tun hatten. Ihren Namen konnten wir uns nicht recht erklären. Bedeutete das englische „base” nicht so viel wie gemein, niedrig, niederträchtig, minderwertig, unedel? Oder spielte es auf den laut Herstellerwerbung „extrem standfesten Sockel” an, auf dem der Behälter ruht, eben auf seine Basis? Mein Hauptargument gegen ein vorschnelles Umschwenken vom Pushboy auf den Baseboy war aber, dass der Tretmechanismus des Letzteren gewiss komplizierter und somit anfälliger für Defekte wäre als der primitive, aber grundsolide Kippmechanismus des Pushers. Und wir suchten ja schließlich einen Abfalleimer für die Ewigkeit. Immerhin waren wir nun doch einigermaßen verunsichert und vertagten die Kaufentscheidung, wozu auch das wenig enthusiastische Auftreten des Verkäufers und der stolze Preis von 169 Euro beitrugen.
Um so bald wie möglich zu einem hieb- und stichfesten Entschluss zu kommen, besprachen wir das Thema nun mit allen unseren Freunden. Dabei stellte sich heraus, dass es ebensoviele Ansichten übers optimale Wegschmeißen gibt wie Wegschmeißer. Nur zwei Beispiele. Eine erfahrene Hausfrau gab zu bedenken, dass beim Versenken schmieriger Lebensmittel durchs Pushmaul des Pushboys dessen Verschmutzung nie ganz zu vermeiden sei. „Da bekommt ihr Spaß, wenn es alle zwei Wochen heißt, den festgetrockneten Schmodder abzubürsten!” Und ein Hobbykoch aus der Nachbarschaft plädierte mit Nachdruck für den Treteimer: „Der Einsatz von drei Extremitäten beim Wegwerfen – rechter Fuß auf dem Pedal, linke Hand hält den Teller, rechte Hand schiebt mit der Gabel die Reste in die Tonne – ist und bleibt ergonomisch einfach unübertroffen!”
Ich bin manchmal kindisch. Zum Beispiel dann, wenn ich eine einmal gefasste Meinung noch verteidige, wenn sie schon längst als widerlegt gelten kann. So führte ich nun für den Pushboy ins Feld, dass er dank seines imposanten 50-Liter-Volumens nur selten geleert werden müsse, weniger als halb so oft wie der Baseboy. Der Einwand meiner Gefährtin folgte auf dem Fuße: „Den Riesensack darfst dann aber du zur Mülltonne schleppen. Und außerdem: Wenn der Abfalleimer so selten geleert wird, fängt’s bald an zu stinken. Und die Wolken von Fruchtfliegen, die dann unsere Küche heimsuchen, sehe ich auch schon lebhaft vor mir.”
Ich verzog mich eingeschüchtert an meinen Schreibtisch und verglich am Monitor die Farbmuster der diversen Wesco-Eimer. Was das anging, taten sich Pushboy und Baseboy nicht viel. Was aber, wenn ich mich jetzt rettungslos in den Pushboy in Silber verlieben würde? Das war der einzige Ton, in dem der Baseboy nicht lieferbar war. Nein, Unsinn, auch damit würde ich nicht durchkommen.
(Wird fortgesetzt.)
Posted in Würfelwürfe | 1 Comment »
Sunday, 02. August 2009

Ein wesentlicher Stressfaktor beim Umzug ergab sich aus der allgegenwärtigen leidigen Frage: „Aufbewahren oder wegwerfen?” Wir entdeckten Dinge, die zu besitzen wir längst vergessen und die wir in den vergangenen viereinhalb Jahren niemals entbehrt hatten. Uns begegneten zahllose Fehlkäufe, unwillkommene Geschenke von dubiosester Provenienz, angeknackste, aber doch noch nicht restlos defekte Sächelchen, Krimskrams von ausschließlich sentimentalem Wert, originelle Staubfänger und provozierend hässliches Zeugs, das vielleicht doch noch zu dokumentarischen Zwecken taugte.
Erschwert wurde das Abwerfen dieses vielgestaltigen Ballasts durch den vertrauten Umstand, dass wir uns nur in der Minderheit der Fälle über Wert oder Unwert eines jeden Einzelstücks einig wurden. Zudem befand ich mich aus bekannten Gründen in diesen Konfliktfällen stets in der schwächeren Position. Wer zehntausend Bücher um sich herum angestaut hat, sollte sich hüten, seine Gefährtin wegen lächerlicher fünf Dutzend Paar Schuhe einen Messie zu schimpfen.
Nachdem wir uns wochenlang über das Bleiberecht toter Gegenstände in unserem Haushalt gestritten hatten, beschlossen wir, uns zum Ende dieser Zerreißprobe mit einem nützlichen neuen Gegenstand zu belohnen: einem besonders schönen, soliden und zweckmäßigen Küchenabfalleimer! In den mehr als drei Jahrzehnten unserer häuslichen Gemeinschaft hatten wir etliche kleine, mittlere und große Mülleimer aus Kunststoff oder Metall in unserer Küche beheimatet, alle hatten ihre funktionalen oder ästhetischen Nachteile gehabt und waren schnell verschlissen, was aber dank ihres geringen Preises leicht zu verschmerzen war. Warum sollten wir uns jetzt nicht einmal einen Abfalleimer für die Ewigkeit gönnen?
Nach oberflächlicher Orientierung über das gehobene Abfalleimerangebot verständigten wir uns bald darauf, dass eigentlich nur eins jener stilvollen Entsorgungsgefäße aus dem Hause Wesco in Frage kam. Schon die Erfolgsstory der Firma M. Westermann & Co. aus dem sauerländischen Arnsberg war uns rundweg sympathisch: „Schon bald nach seiner Gründung im Jahr 1867 spezialisierte sich das Unternehmen auf die Verarbeitung von Blechen für Haushaltwaren und baute das Sortiment stetig aus. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hielt der ,Ascheimer‘ Einzug in das Produktsortiment und nach dem Krieg produzierte Wesco seinen ersten ,Treteimer mit Fuß‘.” (Wesco-Website) Den ganz großen Durchbruch verdankt Wesco aber einer glücklichen Fügung. Egbert Neuhaus weilte als jüngster Spross im Familienbetrieb Anfang der 1970er-Jahre als Austauschstudent in Texas. Dort fielen ihm die typisch amerikanischen Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 50 Litern und mehr auf, die ursprünglich für die Gastronomie entwickelt worden waren, dank der leichtsinnigen Mentalität der Wegwerfgesellschaft jedoch längst auch Einzug in die Privathaushalte gefunden hatten. Bald produzierte Wesco nach dem Vorbild der amerikanischen Trash cans ähnlich geräumige Abfallsammler, die in Anlehnung an den Schriftzug auf der großen Einwurfklappe hierzulande auf den Namen „Pushboy” getauft wurden.
So machten wir uns am ersten Tag nach der erfolgreichen Wohnungsübergabe von der neuen Wohnung aus auf den Weg in die Essener Innenstadt, um unseren ersten und letzten Pushboy zu erstehen. (Fortsetzung folgt.)
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Saturday, 01. August 2009

Nach gezählten siebzig Tagen und einer gefühlten drei viertel Ewigkeit bin ich wieder daheim in meinem Weblog. Unterdessen war ich mit allerlei Verrichtungen befasst, die so gar nicht zum Repertoir meiner erprobten Fähigkeiten und erwiesenen Begabungen gehören, die meistenteils Anstrengungen ungeübter Muskeln, Knochen und Gelenke erforderten und deren erfolgreiche Bewältigung eine motorische Geschicklichkeit der Extremitäten voraussetzte, über die ich allenfalls in den vordersten Gliedern meiner Schreibfinger gebiete. Das Abenteuer, das mir solche Schindereien abverlangte, hört auf den harmlosen Namen Umzug.
Wenn Benjamin Franklin 1757 in Poor Richard’s Almanack den Stoßseufzer zum Himmel schickte, Three removes are as bad as a fire!, dann scheint mir dies nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen noch untertrieben. Dieser Umzug war ein Flächenbrand, durch den ohne Unterlass Kapitän Haddocks Mille millions de mille sabords! trampelten. Wäre ich nicht schon immer ein herzhafter und rücksichtsloser Flucher gewesen, ich hätte diese frohe Kunst unweigerlich gelernt, auf dem langen und beschwerlichen Weg aus der alten in die neue Wohnung.
Bei allen Verletzungen und Verstörungen, Beschädigungen und Beschämungen einer gar schröcklichen Zeit – die sich paradoxerweise einerseits ins Unermessliche zu dehnen schien, wenn ich nämlich mit diesen unüberschaubaren und nicht enden wollenden Plackereien befasst war, während sie andererseits rasend schnell verstrich, angesichts des gnadenlos näher rückenden, definitiven Auszugstermins aus dem gekündigten Wahnsitz Nummer 10 – war doch die schlimmste der Qualen der notgedrungene, wenngleich vorübergehende Verzicht aufs Schreiben.
Einen solchen Tort werde ich mir nie, nie wieder antun. Dies Haus, Wahnsitz Nummer 11, verlasse ich nur mehr in Rückenlage und mit den Füßen voran! Und bis dahin will ich keinen Tag mehr verstreichen lassen, dem ich nicht an dieser Stelle je nach Gusto meinen Tadel oder meine Jauchzer hinterherschicke. Wenn ich zum Schweigen verurteilt bin, werde ich ganz kümmerlich und miesepetrig und stumpfsinnig. Das darf sich niemals mehr wiederholen!
(An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Helfer: Heinrich F., Mario R., Ronald K., Christoph K., Johannes M., Hannerlore M., Jakob T., Christoph Sch., Dominik V., Gabi N., David P., Tim T., Ludger C., Susanne B., Thomas B., Söhnke N., Pablo F., Ulf G., Christian F., Benedikt R., Paul H. und meine Kinder.)
Posted in Würfelwürfe | 3 Comments »
Friday, 22. May 2009

Doch noch mal kurz da.
Es muss zwischendurch ein Überraschungsbesuch vermeldet werden. Seit vorgestern bin ich stolzer Besitzer der deutschen Übersetzung von Teil I des so sehnlich erwarteten Meisterwerkes als Vorab-Leseexemplar des Verlages und habe bereits die ersten 50 Seiten gelesen. Es muss! Das kann um keinen Preis vermieden werden.
Wenn Bolaño dieses Niveau bis zuletzt und ohne Längen und Wiederholungen hält und wenn schließlich das Ganze sich als etwas Gerundetes erweist, das mehr vorstellt als die Summe seiner fünf Teile, dann habe ich nach vielen Jahren erfolgloser Suche endlich einen Roman gefunden, der es verdient, neben meine fünf, sechs Lieblinge gestellt zu werden. (Es erübrigt sich wohl eigens darauf hinzuweisen, dass ich von meinen Lieblingsromanen die ersten fünf niemandem persönlich und schon erst recht nicht potenziell allen verraten will und den möglichen sechsten aus verständlichem Grund keinem verraten kann?)
Ich habe laut gelacht und stumm und still gestaunt!
Und was bei allem das Beste und Schönste ist: Ich liebäugele unterm Eindruck dieser Lektüre tatsächlich wieder mit dem Gedanken, mich auf meine alten Tage doch noch mal an ein Romänchen zu machen. War die Gelegenheit je so günstig? – Und schon wieder weg. Bis zum August.
[Dieser Beitrag geht an Beate Scherzer von der Buchhandlung proust in Essen.]
Posted in Interventionen, Würfelwürfe | 5 Comments »
Sunday, 10. May 2009

„Diesesmal habe ich Ihnen durch meinen Bedienten sagen lassen, daß ich nicht zu Hause wäre, nach dem Billet aber, das Sie mir deswegen geschrieben haben, werde ich bei dem nächsten Besuch, womit Sie mich beehren werden, die Ehre haben es Ihnen auf der Treppe selbst zu sagen. Ich bin pp.”
(Georg Christoph Lichtenberg: Sudelbücher. Heft L, Nr. 164. Göttingen 1796.)
Posted in Interventionen, Würfelwürfe | 3 Comments »
Friday, 08. May 2009

Gelegentlich nimmt mein Streben nach intellektueller Redlichkeit krankhafte Formen an. Besonders beim Zitieren von Textstellen aus zweiter oder dritter Hand beschleicht mich ein schlechtes Gewissen, worauf ich weder Kosten noch Mühen scheue, näher an den Ursprung der durchgereichten Worte heranzukommen. Zuletzt geschah mir dies im Eröffnungsartikel zur Serie Wohnende, wo ich Samarqandi nach Idries Shah nach Lisa Alther zitierte, Letztere in einer deutschen Übersetzung von Gisela Stege.
Besonders störten mich in diesem Zitat eines Zitats die drei Auslassungspunkte, denn ich weiß nur zu gut, dass man durch die Unterschlagung von verbindenden Textstellen die Aussage eines Autors verfälschen, ja geradezu in ihr Gegenteil verkehren kann. Wie peinlich wäre es doch, wenn mir ein kritischer Leser nachweisen könnte, dass jener Samarqandi aus dem 13. Jahrhundert mit seinem Satz keineswegs etwas über die prägende Bedeutung von Berufen habe sagen wollen, was für jeden deutlich erkennbar sei, der sich nur die Mühe mache, die von Lisa Alther unterschlagene Stelle bei Samarqandi oder mindestens doch bei Idries Shah (1924-1996) nachzulesen. – Um wieder ruhig schlafen zu können, besorgte ich mir also dessen Caravan of Dreams in einer deutschen Übersetzung. Dort fand ich die fragliche Passage unterm Titel „Rang und Nation” in voller Länge. (Die von Lisa Alther weggelassenen Stellen habe ich durch Kursivsetzung kenntlich gemacht.)
„Verschiedene Gruppen innerhalb der Gemeinschaft stellen in Wirklichkeit ,Nationen‘ dar. – Hüte dich vor Leuten, die dir Fragen stellen, zu denen sie sich bereits eine Meinung gebildet haben, die sie bloss bestätigt haben möchten oder mittels derer sie dir – unbewusst – Ablehnung entlocken wollen, um damit ihre eigene Überzeugung zu stützen. – Die Verbindung mit solchen Menschen ist nicht nur fruchtlos: sie ist das Merkmal des Unwissenden. – Der Klerus, die Ärzte, Literaten, Adligen und Bauern könnte man tatsächlich als ,Nationen‘ bezeichnen; denn jede dieser Gruppen ist ihren eigenen Sitten und Denkgewohnheiten verhaftet. Die Vorstellung, dass diese Leute, bloss weil sie in demselben Land wohnen und dieselbe Sprache sprechen, gleich sind wie du, ist eine Haltung, die es zu überprüfen gilt. Alle Erleuchteten lehnen letztendlich diese Annahme ab.” (Idries Shah: Karawane der Träume. Lehren und Legenden des Ostens. A. d. Engl. v. René u. Clivia Taschner. Basel: Sphinx Verlag, 1982, S. 193.)
Meine Befürchtung hat sich also als gegenstandslos erwiesen. Tatsächlich wirken sogar die beiden Sätze über Menschen, die nur immer wieder ihre vorgefassten Ansichten bestätigt sehen wollen, wenn nicht wie ein Fremdkörper, so doch wie ein Einschub, der mit dem eigentlichen Kerngedanken der Passage nur bedingt etwas zu tun hat.
So gesehen hätte ich mir die 8,90 €, die mich das Buch im Antiquariat gekostet hat, gut sparen können. Nun kommt aber ein zweiter, vielleicht ebenfalls krankhafter Prozess in Gang, der eine Kompensation der verschwendeten Mittel herbeizuführen sucht. Ich beginne, mich für ein Buch zu interessieren, das mich sonst allein schon wegen seiner Umschlagillustration auf Distanz gehalten hätte [s. Titelbild]. – Und nun entdecke ich dies und jenes, das mir Spaß macht, wie das Sprichwort: „Wenn du ein Schreiber sein willst, so schreib und schreib und schreib.” (Ebd., S. 200.)
Posted in Babel, Würfelwürfe | Comments Off on Karawanserei
Tuesday, 05. May 2009
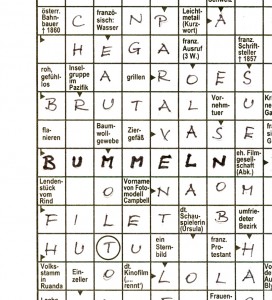
Manche Innovationen sind uns bereits so zur Selbstverständlichkeit geworden, dass wir erstaunt sind, wenn wir von ihrem verhältnismäßig geringen Alter erfahren. So bin ich baff, dass es Kreuzworträtsel vor hundert Jahren noch nicht gab. Ich hätte geschworen, dass diese crossword puzzles zu Zeiten von Lewis Carroll (1832-1898) längst auf der Welt waren – oder, falls nicht, dass sie spätestens dieser große Rätselfreund und Wortakrobat, Schöpfer des Jabberwocky, ersonnen hätte.
Neuerdings vertreibe ich mir eine tägliche Wartezeit, zu der mich das Alter nötigt, mit dieser unschuldigen und anspruchslosen Zerstreuung. Ich gestehe gern, dass ich keineswegs den Ehrgeiz habe, solche strapaziösen Kopfzerbrecher wie Um die Ecke gedacht von Eckstein aus dem ZEITmagazin oder Das Kreuz mit den Worten von CUS aus dem SZ-Magazin zu lösen. Ich bevorzuge vielmehr die guten alten Schwedenrätsel, bei denen man die Fragen nicht erst auf dem Umweg über Zahlen herbeischaffen muss, weil sie in den sogenannten „Blindkästchen” bequemerweise gleich zur Stelle sind. Den bekannten Nachteil dieser Variante nehme ich gern in Kauf, dass sie nämlich mit einem verhältnismäßig geringen Repertoire gesuchter Begriffe auskommen müssen, weil die Fragen aus Platzgründen kaum mehr als zwei, drei Worte lang sein dürfen. Auch habe ich nicht den Ehrgeiz, jedes Rätsel lückenlos zu lösen. Meist fehlen mir zuletzt so entlegene Realien wie ein „Ort in Hordaland (Norw.)” oder ein „kanadischer Wapitihirsch“, was meinem Selbstbewusstsein wenig schadet. Ich kann Odda und den Elk zwar in den Auflösungen am Ende des Rätselheftes nachschlagen, doch das scheint mir wenig sinnvoll, denn solche verbalen Exotika haben weder in meinem aktiven noch in meinem passiven Wortschatz Platz und Nutzwert.
Was mir hingegen wirklich Spaß macht, ist das spielerische Training planvoller Suche nach Synonymen und der Entschlüsselung von Definitionen, das diese Rätselform für eine Weile bietet. Im günstigsten Fall bringt sie mich sogar zum Nachdenken über den engen Rahmen der Wortsuche hinaus. So wollte mir eben ein Synonym für „flanieren” mit sieben Buchstaben partout nicht einfallen. (Titelbild: Ausschnitt aus einem unvollständig gelösten Schwedenrätsel; aus: Schwedenrätsel Großband Nr. 49. Hrsg. v. Gerhard Melchert. Hamburg: Martin Kelter Verlag, o. J., S. 24.) Erst nachdem ich vier Buchstaben durch senkrecht kreuzende Begriffe beitragen konnte, wurde klar, dass der Rätselsteller nur „bummeln” gemeint haben konnte. (Hätte ich schon eher seine Bekanntschaft gemacht, wer weiß, vielleicht hätte ich mich dann Kohlenpottbummler genannt.)
Das Wort „bummeln” kenne ich aus meiner Kindheit aus folgenden Verwendungen: „Wir machen heute einen Einkaufsbummel (resp. Schaufensterbummel).” – „Wir fahren mit dem Bummelzug.” – Einkaufsgänge an der Hand meiner Mutter, durch die Essener Innenstadt, waren jedenfalls alles andere als entspanntes Flanieren, sondern im Gegenteil schreckliche Hetzereien, weil von Geschäft zu Geschäft Preise verglichen werden mussten, damit zuletzt doch das Hemd oder die Hose bei C & A gekauft werden konnte: „Bummel doch nicht so!” Die Bevorzugung einer lahmen Zugverbindung, mit Zwischenhalten in jedem Kleinkleckersdorf, wurde durch die Verwendung des Wortes Bummelzug, das wohl Gemütlichkeit vorgaukeln sollte, kaum verzeihlicher, wenn das Abteil gestopft voll war mit quengelnden Kindern, zeternden Müttern und Zigarre rauchenden Vätern. Und der Schaufensterbummel an Sonntagen auf Rüttenscheider und Huyssenallee verdiente zwar seinen Namen, weil er langsam, ziel- und zwecklos war, trug aber ebenfalls wenig dazu bei, mich mit dem Bummeln anzufreunden.
Wie schön also, dass es die unverbrauchten und nicht vorbelasteten Wörter aus anderen Sprachen gibt, die im Kern etwas sehr Ähnliches oder gar das Gleiche bedeuten, aber frei sind von den quälenden Erinnerungen aus widrigen Umständen. So flaniere ich denn und verbitte mir, ein Bummelant geschimpft zu werden.
Posted in Jabberwocky, Würfelwürfe | 4 Comments »
Monday, 04. May 2009

… als die Zeitung von gestern? Ach was, eine gut abgehangene Zeitung vermag mir geradezu Aktualitätskicks zu verpassen, dass es eine wahre Freude ist. Messiemäßig horte ich darum auch stets einen pfundigen Vorrat vor sich hin gilbender in- und ausländischer Blätter, hauptsächlich Feuilletons, Wissenschafts- und Gesellschaftsteile, gelegentlich aber auch Fetzen aus anderen Ressorts, auf dass mir in faden Stunden der inspirierende Input nicht ausgehe. Dann grapsche ich blindlings ins Volle und lasse mich überraschen, welche Gedankenmelodie der Zufall meinem Hirnkasten abnötigt.
Heute also ein noch nahezu taufrisches Blatt, die Seite 34 aus Nr. 43 der diesjährigen FAZ vom 20. Februar. Dort widmet Anja Hirsch den soeben im Piper-Verlag erschienenen ersten beiden Bänden einer neuen Ausgabe von Sándor Márais Tagebüchern vier muntere Spalten. Nun wüsste ich gern, ob diese Edition meiner siebenbändigen Ausgabe aus dem Oberbaum-Verlag von 2001 etwas voraushat. Wie soll ich mir aber folgenden Satz der Rezensentin erklären? „Vereinzelt erschienen auch hierzulande bereits Auszüge, unter anderem zwei [?] Bände im Oberbaum Verlag.” Ein Blick in den Online-Katalog der Deutschen Nationalbibliothek hätte doch ausgereicht, um diesen plumpen Fehler zu vermeiden!
Die Oberbaum-Ausgabe ist, wie ihre Leser wissen, ein editorisches Kuriosum ohnegleichen. Nach einem ersten Band, der „Auszüge, Fotos, Briefe, Dokumentationen” bringt, folgen in Band 2 die Tagebücher von 1984 bis zum Freitod des Autors 1989, dann geht es weiter mit Band 3 und den Jahren 1976 bis 1983 und so fort in umgekehrter Chronologie, bis wir schließlich im siebten und letzten Band bei den Einträgen aus den Kriegsjahren 1943 und 1944 angelangt sind.
Die Frage, ob ich mir nun zu meiner vorhandenen noch eine weitere Ausgabe der Tagebücher jenes ungarischen Diaristen zulegen soll, muss ich mir also selbst beantworten. Die FAZ-Rezension ist da wenig hilfreich, ich bin auf meinen Spürsinn angewiesen. Die eben erschienenen Piper-Bände der Jahre 1943 bis 1945 haben zusammen über 900 Seiten, in meiner Oberbaum-Ausgabe kommen dieselben drei Jahre gerade einmal auf 274 Seiten. Wenn es dort im Impressum heißt: „Textkritische, leicht gekürzte Ausgabe”, dann kann dies wohl nur als Etikettenschwindel bezeichnet werden. (Immerhin erklärt diese Rechnung, dass die neue Ausgabe laut Anja Hirsch auf stolze 14 Bände angelegt sein soll. Sibylle Mulot im Spiegel spricht allerdings von einer laut Verlag „heute noch nicht endgültig feststehenden Zahl von Bänden”.) Fraglos muss die FAZ-Rezensentin ihr Handwerk erst noch lernen. Da sie nicht einmal sachlich korrekte Informationen liefert, erstaunt ein Satz wie dieser kaum mehr: „Diese Bände gehören neben Julien Green, Virginia Woolf und viele andere manische Jahrhundert-Überschreiber gestellt.” Ja, was denn nun? Erst hievt Anja Hirsch Márai auf ein Niveau mit zwei ganz großen Tagebuchschreibern des 20. Jahrhunderts – und dann relativiert sie dieses höchste Lob gleich wieder, indem sie von vielen anderen spricht, die offenbar auch auf einer Höhe mit den drei Vorgenannten liegen.
Zum Abschluss und zur Erholung von solcherlei schummriger Ungefährheit und windelweicher Ungefährlichkeit ein Zitat aus Sándor Márais Tagebuch. Man schreibt das Jahr 1944, Budapest liegt wie halb Europa in Trümmern. Der Romancier, dem das Romaneschreiben gründlich vergangen ist, blättert in alten Illustrierten: „Mir fällt ein sieben Jahre altes Esquire-Heft in die Hand. Ich studiere die Annoncen. All diese Whiskys, Automarken, Tennisschläger, Schlangenlederschuhe, Edelsteine, modisch geschnittenen Herrenhemden, die aus rätselhaften Materialien hergestellte Damenunterwäsche, diese Welt, die von den Raffinessen des Details nie genug bekommt -, gibt es sie tatsächlich noch irgendwo? Wieder muß ich daran denken, daß ich in Budapest drei Tage vergeblich auf der Suche nach einem Schuster war, der mir einen Flicken aufsetzt.” (Sándor Márai: Tagebücher 7. 1943-1944. Ausgew. u. a. d. Ung. übers. v. Christian Polzin. Hrsg. v. Siegfried Heinrichs. Berlin / St. Petersburg: Oberbaum Verlag, 2001, S. 194.)
[Fortsetzung: Nichts ist älter (II).]
Posted in Langsamkeit, Würfelwürfe | Comments Off on Nichts ist älter (I)
Sunday, 03. May 2009

Seit Erfindung der Treppe gibt es dreierlei Wohnweisen: unten, oben und dazwischen.
Der Mieter im Parterre gewinnt am schnellsten Land, wenn das Haus unsicher wird, eroberte also etwa in den Bombennächten des letzten Krieges regelmäßig die besten Plätze im Keller; aber auch im zivilen Brandfall hat er die besseren Karten, bleibt ihm doch der freie Fall ins Sprungtuch erspart; andererseits muss er aber vor Dieben besonders auf der Hut sein, die den Weg durchs Fenster notfalls per Räuberleiter bewältigen können. (Wohnsinn 8, 9, 10 und 11.)
Der Mieter unterm Dach thront über allen, genießt eine weite Aussicht und quält sich tagtäglich im Treppenhaus, in jungen Jahren nur auf-, in späteren dann auch abwärts. Er überlegt sich dreimal, ob er noch für ein Viertelstündchen vor die Tür gehen soll, zu einem kleinen Abendspaziergang durch die laue Frühlingsluft. Des Straßenlärms ist er leidlich enthoben, nicht aber der Flüche der Paketboten. (Wohnsinn 1, 3, 4, 5 und 6.)
Alles, was sich zwischen diesen beiden Hemisphären tummelt, also die überwiegende Mehrheit der Etagenhausbewohner, führt ein nicht so klar akzentuiertes Grauzonendasein, hat welche unter und welche über sich, fühlt sich vielleicht unbewusst eingequetscht, umso mehr, wenn sich außerdem ein Nachbar zur Rechten und ein Nachbar zur Linken bemerkbar machen und die Wände, wie üblich, noch dünner sind als die Decken und Böden. (Wohnsinn 2 und 7.)
Ich habe alle drei Wohnweisen intensiv erfahren und weiß, wovon ich rede, wenn ich sage: Allein schon diese Lokalisation ist die halbe Miete und entscheidet gegebenenfalls über Wohl und Wehe des Wohnenden.
Posted in Flanerie, Würfelwürfe | 2 Comments »
Sunday, 03. May 2009

Nicht unwesentlich bestimmt sich der Flaneur als ein Umwegegeher. Er hat eingesehen, dass auf den geraden Strecken, den kürzesten Verbindungen zwischen zwei Punkten wenig zu finden ist und meist nur das Erwartbare, von Gewissheiten und Plänen Entwertete. Das Stöbern des Flanierenden hingegen geschieht planlos, wohl auf der Suche, aber ohne Wissen nach was. Müßig zu sagen, dass die Bewegung des Flanierens nicht auf Straßen und Wege beschränkt ist, sich vielmehr auch in ganz anderen Zielgebieten unternehmungslustiger Neugier bewähren kann.
Weit abseits von jenem weitläufigen Thema, das ich ab heute einzukreisen beginne, stieß ich auf folgende Einsicht des persischen Physikers und Heilkundigen Najib al-Din Abu Hamid Muhammad ibn Ali ibn Umar al-Samarqandi: „Die verschiedenen Gruppen der menschlichen Gesellschaft sind, angesichts der Realität, eigentlich ,Nationen‘ […]. Man könnte Kleriker, Ärzte, Literaten, Adelige und Bauern im Grunde als Nationen bezeichnen; denn jede Gruppe hat ihre eigenen Gebräuche und Denkschemata. Die Idee, sie seien genau wie man selbst, nur weil sie im selben Land leben oder dieselbe Sprache sprechen, ist eine Vorstellung, die des Überdenkens bedarf.”
Für alle, die es interessiert, hier der Routenplan für den Umweg. Ich fand diese Passage als Motto in Lisa Althers herzerfrischend unbefangenem Roman Hautkontakte (a. d. Am. v. Gisela Stege. Berlin – Frankfurt/M – Wien: Verlag Ullstein, 1977, S. 5), die sie wiederum der Sammlung alter sufistischer Geschichten von Idries Shah, Caravan Of Dreams, entnommen hat (London: The Octagon Press, 1968). Althers Buch habe ich mir erst neulich antiquarisch besorgt, weil ich eine kurze Episode daraus, Fesselnde Ehe, erneut mit Erfolg bei meiner Lesung in Oberhausen zum Besten gegeben hatte und gern einmal den Kontext kennenlernen wollte, in dem sie steht. Ich kannte diese groteske Geschichte um einen peinlich missglückten sexuellen Exzess, bei dem ein Paar Handschellen eine verhängnisvolle Rolle spielt, aus dem von Hermann Kinder herausgegebenen „Handbuch der literarischen Hocherotik”, Die klassische Sau (Zürich: Haffmans Verlag, 1986, S. 446-451), das ich 1986 von dem inzwischen verstorbenen Verlagsvertreter Jac Flessenkemper vor 23 Jahren zum Geburtstag geschenkt bekam. Jacs Widmung auf dem Vorsatz: „Trau keinem unter 30!”
Zurück zu al-Samarqandi. Der Gedanke, den er uns in aller Bescheidenheit ans Herz legt, ist ebenso schlicht wie berückend. Wenn man die Menschen nach ihrer Nationalität, nach ihrer Sprache oder ihrem Heimatland unterscheidet und hieraus Schlüsse auf ihre „Gebräuche und Denkschemata” ziehen zu können meint, dann ist es ebenso statthaft und sinnvoll, nach ihrer Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe zu fragen, denn diese ist mindestens ebenso prägend für ihr Verhalten und ihr Denken. Ich kann dieser Idee nur beipflichten, und dies sogar aus eigener Erfahrung, war ich doch unzweifelhaft in jenen 17 Jahren als Händler in einem offenen Ladengeschäft ein anderer Mensch als in den darauf folgenden zwölf Jahren, als ich einer Bürotätigkeit nachging.
Ich bin sogar davon überzeugt, dass es noch eine Reihe weiterer Gruppenzugehörigkeiten für jeden in der Zivilisation beheimateten Menschen gibt, von denen jede einzelne mehr Wirkung für seine „Gebräuche und Denkschemata” hat als seine Staatsangehörigkeit! Zum Beispiel sind Menschen ja nicht nur nebenbei Essende und Trinkende, weshalb Jean Anthèlme Brillat-Savarin im Aphorismus 4 zu seiner Physiologie des Geschmacks vielleicht etwas vollmundig erklärt hat: „Sage mir, was du ißt, und ich will dir sagen, was du bist!” (A. d. Frz. v. Emil Ludwig. Frankfurt am Main: Insel-Verlag, 1979, S. 15.) Aber auch darum soll es hier nicht gehen, sondern um uns Menschen als Wohnende. Und was den Leser unter dieser Überschrift künftig erwartet, sind ein paar Beobachtungen und Gedankensplitter zu einer noch zu schreibenden „Psychophysiologie des Wohnens”.
Posted in Flanerie, Würfelwürfe | 1 Comment »
Wednesday, 29. April 2009
Posted in Memento, Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Lächerlich
Tuesday, 28. April 2009

Zwei Top-Meldungen konkurrieren heute auf der Titelseite der SZ um meine Aufmerksamkeit: Bayern feuern Klinsmann (mit Bild) und Schweinegrippe erreicht Europa (ohne Bild, denn ein paar mit Mundschutz maskierte Mexikaner gab’s schon gestern). Indes taugt auch der arbeitslose Trainer hinterm Steuer seines Autos gut zur Illustration der Pandemiepanik, schaut er doch drein, als hätte er sich diese Seuche bereits eingefangen und mit seiner Entlassung die letzte Chance verpasst, von Dr. Rüdiger Degwert mit einer Anstaltspackung Tamiflu versorgt zu werden.
Wenn mich schon Aufmacher und Eckenbrüller auf Seite eins mit ihrem unfreiwilligen Zusammenspiel – Bananenflanke von Libero auf Linksaußen – in Feiertagslaune versetzen, dann weiß ich aus Erfahrung, dass mich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Seite vier der eine oder andere krause Kommentar beglücken wird, wie gemacht zur Vorführung in meinem apokalyptischen Kasperltheater.
Und richtig! Werner Bartens schafft es, auf Teufel komm raus dem Grippethema 134 Zeilen abzuringen, die dem besorgten Leser beim Frühstück zwar nicht verraten, was etwa zu tun sei, um nicht zu den Abermillionen Toten zu zählen, die demnächst zu beklagen sein könnten, aber ihm doch immerhin die tröstliche Gewissheit geben, dass selbst der kluge Kommentator von der SZ, was das angeht, in keiner komfortableren Lage ist. Und außerdem: „Es kann sein, dass die Schweinegrippe in wenigen Tagen vorbei sein wird, manche Infektionen begrenzen sich aus unbekannten Gründen selbst.” Nun ja, warum auch nicht? Theoretisch denkbar ist ja sogar, dass erfolglose Fußballtrainer freiwillig zurücktreten, wenngleich mir ein konkretes Beispiel für diese Variante gerade nicht einfallen will. Das heißt aber weniger als nichts, denn was Fußball betrifft bin ich ein mindestens so blutiger Laie wie der Herr Bartens in Sachen Epidemiologie. Darum versteigt der sich auch lieber in ein Gebiet, auf dem jeder fidele Selbstdenker ein halbwegs vertrauenerweckendes Texterl hinbekommen kann: das der Wahrnehmungs-Psychologie und Erkenntnis-Philosophie: „Viren kann man nicht sehen, riechen oder schmecken. Sie sind sinnlich kaum zu erfassen, diese Eigenschaften teilen sie mit Strahlen, Genen und dem Klimawandel.” Offenbar sind das lauter Sachen, die Bartens für zugleich unsichtbar und gefährlich hält. Aber schon stutze ich und frage: Was ist an Genen gefährlich? Sind Gene nicht zuallererst einmal ausgesprochen nützlich, brav und liebenswert, geradezu lebensnotwendig? Nun ahne ich zwar, was Bartens im Hinterkopf hatte, als er die Gene hier einreihte. Hat nicht zufällig eben erst eine bayerische Agrarministerin den Anbau einer gentechnisch manipulierten Kartoffel namens Amflora zugelassen? Pfui Deibel, denkt da der Verbraucher, aber ich muss das Zeug ja nicht essen. „Den meisten Menschen”, so Werner Bartens, „fehlen […] Phantasie und naturwissenschaftliche Kenntnisse”, um diese und ähnliche Bedrohungen wahrzunehmen. Gleichzeitig registriert er eine „mediale Pandemie”: „Den Viren gleich verbreiten sich Informationen in Windeseile um den Globus, seriöse Berichte wie gehetzte Panikmache.” Was geschieht, wenn auch und gerade die seriösesten Berichte unweigerlich zu Panik führen, sagt der Kommentator lieber nicht. Und er enthält uns auch eine genauere Schilderung dessen vor, was er sich im Zusammenhang mit der Grippegefahr unter Panik vorstellt. Gesine Schwan, die Präsidentschaftskandidatin, meinte vorige Woche im Redaktionsgespräch beim Münchner Merkur: „Wenn sich dann [in zwei bis drei Monaten] kein Hoffnungsschimmer auftut, dass sich die Lage verbessert, dann kann die Stimmung explosiv werden.” Dafür musste sie landauf, landab und selbst von ihren Sympathisanten kräftige Prügel einstecken, der Art, sie würde soziale Unruhen ja geradezu herbeireden. Wenig später dazu befragt, mit welchen Szenarien sie denn rechne, stellte sie bei FOCUS Online klar, sie rechne nicht mit brennenden Barrikaden. „Wir haben aber in der gegenwärtigen Krise die Verantwortung, weder zu dramatisieren oder gar Ängste zu schüren noch die Realität auszublenden.” Das könnte, wenn das Virus es will, wortwörtlich nun auch bald Ulla Schmidt sagen, unsere Gesundheitsministerin.
Werner Bartens hat in seinem Meinungsallerlei noch einen Wurstzipfel schwimmen, und der schmeckt so: „Die vage Zeitangabe, wann das Super-Virus entstehen könnte, und die Verdrängung des Unsichtbaren führten dazu, dass die meisten Menschen solche Warnungen nicht ernst nahmen. […] Jetzt könnte eine neue und gefährliche Grippe entstanden sein. Doch niemand außer ein paar Experten wollte die permanente Bedrohung vor dem Ernstfall zur Kenntnis nehmen. Sie war wohl zu schleichend und zu abstrakt.” Leider verrät uns der Kommentator nicht, was denn zur Vorbeugung hätte getan werden können, wenn die Warnungen vor der permanenten Bedrohung von den meisten Menschen und nicht nur von ein paar Experten zur Kenntnis und ernst genommen worden wäre. Und dass es einer besonderen Phantasieleistung bedarf, sich die vielleicht bevorstehende Grippe-Pandemie vorzustellen, ist ebenfalls Unsinn. Bartens erwähnt ja selbst den Musterfall, die berühmte „Spanische Grippe” der Jahre 1918 und 1919, die mittlerweile sehr detailreich dokumentiert ist. Vermutlich eine halbe Milliarde Menschen, ein Drittel der damaligen Weltbevölkerung, erkrankte seinerzeit durch die Infektion mit dem Influenzavirus vom Subtyp A/H1N1, geschätzte 50 Millionen starben weltweit daran. Heute wären es bei gleichen Anteilen 225 Millionen Tote, das entspricht etwa der Bevölkerung Indonesiens.
Was offenbar den Verstand der meisten Zeitgenossen übersteigt und sie zu den unsinnigsten Scheinerklärungen und Spiegelfechtereien verführt, das ist nicht die Tücke des Unsichtbaren, die Unwägbarkeit des Unberechenbaren, die Unfassbarkeit des Unbegreiflichen, wie Werner Bartens sich selbst und uns Lesern weismachen will. Es ist schlicht und einfach die Unfähigkeit, angesichts globaler Bedrohungen einer gewissen Kategorie und Dimension unsere prinzipielle Ohnmacht zu erkennen und einzugestehen.
Posted in Homo laber, Würfelwürfe | 3 Comments »
Tuesday, 28. April 2009

Kürzlich entdeckte ich im Angebot eines Versandantiquars einen Titel, der meine Neugier weckte: Die Bibliothek der Zukunft von Dieter E. Zimmer, über „Text und Schrift in Zeiten des Internets”, erschienen im Ullstein Taschenbuch Verlag in Berlin („früher 9,95 €, jetzt 4,50 €”).
Das Büchlein ist acht Jahre alt, für diese Thematik also allenfalls noch von historischem Interesse. Es befasst sich auf 393 Seiten laut Prospekt „mit allen Fragen der Umwälzung”: „E-Book, virtuelle Weltbibliothek, E-Text, Hypertext, Enzyklopädien, Fachzeitschriften, Katalogrecherche, Geschichte der Textverarbeitung, Urheberrecht, Die Sterblichkeit der Information, www-Fakten und Zahlen.” Noch vor einem Jahr hätte ich so etwas für die Abteilung „Anachronismen und Kuriositäten” meiner Bibliothek bestellt. Jetzt, da ich nicht weiß, wo und wie meine Bücher und ich künftig wohnen werden, nehme ich von solchen Anschaffungen schweren Herzens Abstand.
Ich hätte Zimmers Buch übrigens gleich neben mein zwölf (!) Jahre altes SmartBooks Computer-Lexikon von Peter Fischer gestellt, in dem als Suchmaschine zwar schon Yahoo verzeichnet ist, nicht jedoch Google. Dafür sind dort noch rührenderweise uralte typographische Termini wie „Hurenkind” und „Schusterjunge” verzeichnet. Und vom Begriff „Icon”, der mittlerweile sogar schon in den Duden aufgenommen wurde, wird man allen Ernstes auf „Ikone” verwiesen, um dort die Erklärung zu lesen: „Bildsymbol, Sinnbild in grafischen Benutzeroberflächen oder Menüs. Beispiel: Gänsekiel für Textverarbeitungsprogramm.”
Apropos Icon. Unnötig zu sagen, dass ein ganz neuer Begriff wie „Favicon”, eine Legierung aus favourite und icon, in Fischers smartem Lexikon noch nicht vorkommt. Es benennt „ein kleines, 16×16 oder 32×32 Pixel großes Bildsymbol oder Logo, das in der Adresszeile eines Browsers links von der URL angezeigt wird und meist dazu dient, die zugehörige Website auf wiedererkennbare Weise zu kennzeichnen.” (Wikipedia)
Seit gestern ist die Adresse meines Weblogs mit einem solchen Favicon versehen. Mein Bildsymbol ist, versteht sich, der Zylinder, jener schwarze Hut, der im Weltende des Jakob van Hoddis dem Bürger vom spitzen Kopf flog. Was weiter geschah? Siehe Titelbild (von Wilhelm Busch).
Posted in Time Machine, Würfelwürfe | Comments Off on Favicon
Monday, 27. April 2009
Posted in Memento, Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Monday, 27. April 2009

hallo allerseits, euer gott ist unter die mikroblogger gegangen. bevor der papst den gleichen weg einschlägt will ich euch nur eins sagen:
Posted in Twitter | 1 Comment »
Sunday, 26. April 2009

„Der Betreiber der Website revierflaneur.de ist um Fehlerfreiheit in formaler und inhaltlicher Hinsicht bemüht.” So lautet der erste Satz zur Sorgfalt meiner Texte dieses Weblogs, die ich am 27. Juli 2008 im Impressum versprochen habe.
Welche Mühen sich im Einzelnen aus diesem anspruchsvollen Vorsatz ergeben, das wird der Leser nur ermessen können, wenn er selbst einmal probiert hat, einen in jeder Hinsicht richtigen Text herauszubringen. Vom Buchstabendreher bis zum fehlenden Komma, vom falschen Fall bis zur hässlichen Wiederholung lauern Fehler und Makel in jeder Zeile. Dagegen helfen nur Wachheit und Übung, Sorgfalt und Fleiß – und selbst damit kommt man nicht ins Ziel, denn bekanntlich ist man leider oft blind für die eigenen Versehen. So kann ich mich glücklich schätzen, dass eine ausgezeichnete Korrektorin jeden einzelnen meiner Texte unmittelbar nach der Veröffentlichung auf Herz und Nieren prüft.
Ich habe es aber insofern besonders glücklich getroffen, als diese strenge Gegenleserin mein Geschreibsel nicht nur auf formale Mängel durchsieht, sondern weit darüber hinaus auch ein feines Gespür für mancherlei andere Schwächen hat. – Dafür ein Beispiel aus jüngster Zeit.
In meinem Beitrag AtD VII.10 schrieb ich gestern den Satz: „Zeitweise war ich mir beim Pynchon-Projekt vielleicht wie jemand vorgekommen, der versteckte Anspielungen reihenweise abknallt wie die Karnickel bei der Treibjagd.” Weil ich so selten „Karnickel” schreibe, ganze drei Mal bisher in diesem Weblog, musste ich der letzten Gewissheit zuliebe noch einmal im Duden nachschlagen, ob man nicht etwa „Kanickel” schreibt, ein Zweifel, der so abwegig nicht ist, da man ja auch nicht „Karninchen” schreibt. Meine gute Seele mit dem scharfen Blick und dem noch schärferen Verstand erspähte aber einen ganz anderen Lapsus: „Treibjagd macht man auf Hasen u. a., Kaninchen (im Bau lebend) jagt man mithilfe von abgerichteten Frettchen oder Raubvögeln.” (Ich lasse die „Treibjagd” bewusst im gestrigen Artikel stehen und verlinke von dort auf den heutigen, als kleine Hommage an M. C.)
Ein merkwürdiger Zufall ist, dass letzten Montag mein Freund H. F. gesprächsweise einen ganz ähnlichen Fehler monierte. Im Beitrag Schnee von gestern hatte ich geschrieben: „Mich selbst erinnern sie [meine Blog-Texte] an die Schwimmer beim Angeln, die das Anbeißen der Beute signalisieren sollen. Wenn tief unter der spiegelglatten, friedvollen Wasseroberfläche ein riesiger Raubfisch mit der Nase an den Köder stößt, dann löst er damit bloß ein ganz feines Zucken im treibenden Schwimmer aus, kaum wahrnehmbar.” Zum Angeln von Raubfischen, so mein Freund, setze man keine Schwimmer ein, die kämen nur bei Friedfischen zur Anwendung. Das stimmt zwar und es war mir ebensowenig bekannt wie die Technik der Kaninchenjagd. Aber hier möchte ich doch einwenden, dass ich ja in dieser Metapher gar nicht behauptet habe, Angler, Angel, Schwimmer und Köder hätten es auf den Raubfisch angelegt.
[Titelbild: Wilhelm Busch.]
Posted in Babel, Würfelwürfe | 4 Comments »
Thursday, 23. April 2009
Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Wednesday, 22. April 2009
Posted in Oikos, Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Wednesday, 22. April 2009

Eine nette Anekdote erzählt Schlingensief unterm Datum vom 24. Januar [2008], er wacht gerade aus einer sanften Vollnarkose auf, die ihm vor der Bronchioskopie verabreicht wurde:
„Da stand eine Mutter an einem Kinderbettchen gegenüber. Im Dämmerzustand habe ich sie gebeten, sie solle doch mal zu mir kommen. Ich habe sie gefragt: Was hat Ihr Kind? Was ist mit Ihrem Kind? Sie sagte, das rollt immer so komisch auf den Fußballen ab, das läuft immer nur ganz vorne auf den Zehenspitzen. Wissen Sie, warum Ihr Kind das tut?, sagte ich. Weil Ihr Kind einfach besonders intelligent ist. Ihr Kind ist einfach ein hochintelligentes Wesen, ein Autist. Das sind die, die auf Zehenspitzen durch die Welt laufen. Die haben so viel zu denken, dass sie auf dieser Erde nur ganz vorsichtig gehen können. Und das ist bei Ihrem Kind so. Ihr Kind ist ein Genie, habe ich im Halbschlaf gemurmelt. Und die Mutter hat mich angestrahlt, war wahnsinnig glücklich in dem Moment und hat auch ihr Kind so schön angelächelt, als hätte sie es neu begriffen. Und als ich weggefahren wurde, hat sie mir zugelächelt. Das war wunderschön.” (Christoph Schlingensief: So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2009, S. 59.)
Angeblich hat nun Alexander Kluge, der seit Jahren immer mal wieder den väterlichen Schutzengel für Schlingensief mimt, etwas herausgefunden, „was der Leser ohnehin weiß: Christoph Schlingensief selbst ist dieses Kind.” (Christopher Schmidt: Der Dreckskerl da drinnen; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 90 v. 20. April 2009, S. 14.) Schön, dass Schmidt weiß, was der Leser weiß. Ich weiß, dass Schlingensief keinen Geringeren als mich meint, passt seine Beschreibung des auf Spitzen gehenden Knaben doch zum Verwechseln auf mich. Einziger Schönheitsfehler: Ich bin kein Kind mehr, sondern gar ein paar Jährchen älter als Schlingensief. Aber vielleicht hat es sich ja nicht um eine reale Wahrnehmung, sondern um einen Fiebertraum gehandelt?
Was die Schulmedizin, unter deren Messer sich Schlingensief begeben musste, dem Spitzengeher aus seinem Traum angetan hat, konnte man mal für kurze Zeit bei Westropolis bewundern. Ein Foto meines operierten rechten Fußes brachte die Leser dieses Kulturblogs allerdings so in Rage, dass ich dieses Bild durch eins von Arno Schmidts Häuschen im heimeligen Schneegestöber ersetzen musste. (Die diversen Kommentare kann man immer noch dort nachlesen.)
Hier bin ich ja nun mein eigener Herr und kann meinen autistischen Fuß herzeigen, wie es mir gerade passt.
Posted in Würfelwürfe | 1 Comment »