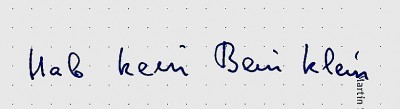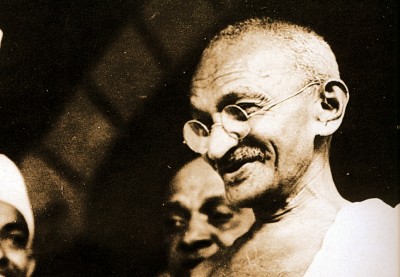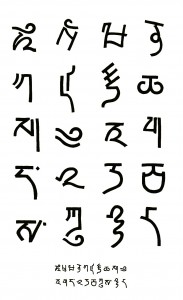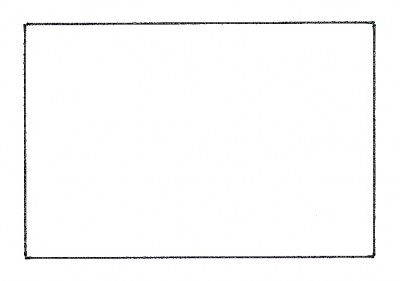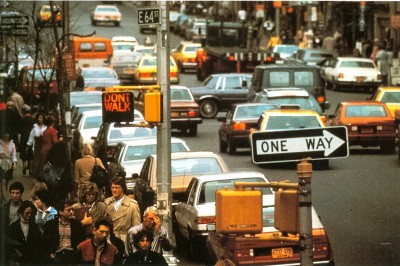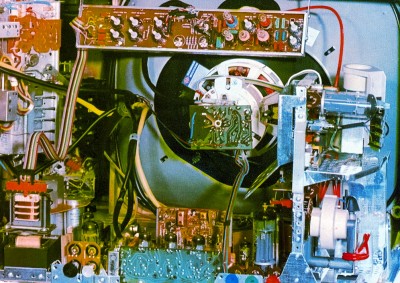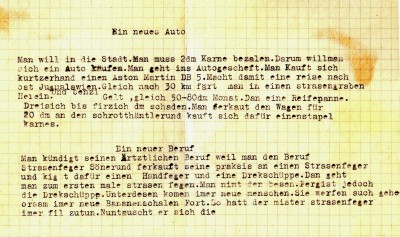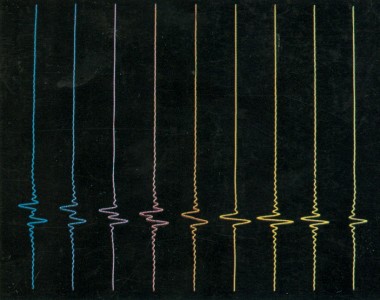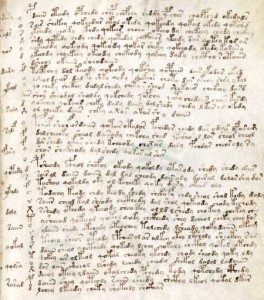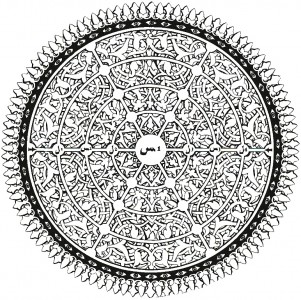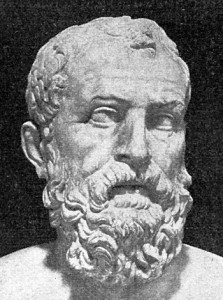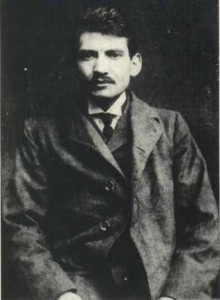Archive for the ‘Würfelwürfe’ Category
Wednesday, 01. April 2009

Ein denkwürdiger, bemerkenswerter, wertvoller Tag ist für mich immer schon einer gewesen, an dem ich ein neues Wort lernte. Heute kam ich dazu auf Umwegen, als mir zu einem jüngst getanen Ausspruch von Joachim Kardinal Meisner die schöne Bibelstelle einfiel, wo es – nach der Verdeutschung von Martin Luther – heißt: „Verstehestu die Sache / so vnterrichte deinen Nehest / Wo nicht / so halt dein maul zu.” (Jesus Sirach 5, 12.)
Um die Stelle hier korrekt zitieren zu können, nahm ich meine abgenutzte Jerusalemer Bibel zur Hand – und stolperte unmittelbar vor dem gesuchten Satz über einen anderen, der meine Neugier weckte: „Worfle nicht bei jedem Wind, / und geh nicht auf jedem Pfad!” (Jesus Sirach 5, 9.) Worfeln? Hatte ich nie gehört. Was sollte das denn sein? Jetzt weiß ich’s. Schon vor Urzeiten trennte man so die Spreu vom Weizen, und zwar nicht im übertragenen Sinne. Das gedroschene Stroh wurde aus einem flachen Korb, der Worfel, bei Wind in die Höhe geworfen (s. Titelbild). Dann wurde die leichte Spreu fortgeweht, während das schwerere Korn in den Korb zurückfiel. Entscheidend war für das Gelingen dieser Arbeit, dass der Wind genau die richtige Stärke hatte. War er zu schwach, fiel die Spreu mit dem Korn zurück in den Korb; war er zu stark, wurde auch das Korn davongeweht. So erklärt sich der Ratschlag: „Worfle nicht bei jedem Wind.” Im übertragenen Sinne könnte man vielleicht sagen: Urteile nicht, wenn du zu unbeteiligt bist; aber auch nicht, wenn du zu parteiisch bist.
Meisner sprang jüngst dem Papst bei, nach dessen umstrittener Einlassung zur Haltung der katholischen Kirche über die Art und Weise, wie die Verbreitung von Aids in Afrika bekämpft werden sollte. Benedikt XVI. meinte im Gespräch mit dem französischen TV-Journalisten Philippe Visseyrias, das Problem Aids könne man nicht bloß mit Werbeslogans überwinden. „Wenn die Seele fehlt, wenn die Afrikaner sich nicht selbst helfen, kann diese Geißel nicht mit der Verteilung von Kondomen beseitigt werden. Im Gegenteil, es besteht das Risiko, das Problem zu vergrößern.” Die wie üblich unbesonnenen, ja geradezu hysterischen Reaktionen aus dem Lager der Papstgegner zwischen Merkel und Cohn-Bendit reduzierten Benedikts Statement auf den Satz: „Kondome erhöhen Aids-Gefahr!” Wieder einmal hatte der Papst erreicht, dass man über ihn sprach, dass sich ein großer Teil seiner Gegner dabei blamierte und dass seine Anhänger ihm applaudieren konnten.
Einer der routiniertesten Trittbrettfahrer päpstlicher Verkündungen ist seit Beginn des Ratzinger-Pontifikats sein Landsmann Meisner. Auch in der Kondom-Frage konnte der Kardinal zu Köln wie üblich sein Maul nicht halten: „Dem Papst wurde unterstellt,” so ereiferte sich Meisner in BILD, „er habe alle Welt aufgefordert, keine Kondome zu benutzen. Das hat er aber gar nicht getan. Der Papst hat keinen Mann, der wahllos mit Frauen schläft, aufgefordert, jetzt auch noch auf Kondome zu verzichten. Vielmehr hat er darauf hingewiesen, dass man dafür sorgen muss, dass solche Männer auf ihren unverantwortlichen Umgang mit Sexualität verzichten. Er verlangt eine ,Humanisierung der Sexualität‘, wie der Papst das genannt hat. Dazu muss man, wie das die Kirche tut, die Armut bekämpfen und vor allem die Frauen stark machen.”
Dass sich immer noch zahllose Zeitgenossen wahlweise über die Meinungsäußerungen von Leuten wie Ratzinger oder Meisner empören oder ihnen begeistert zustimmen, hat zwei plumpe Gründe. Erstens: Diese Männer antworten nicht klar und deutlich auf die Fragen, die man ihnen stellt. Zweitens: Sie beherzigen nicht den guten Rat aus Jesus Sirach 5, 12. Insofern sind sie ihren Pendants vom anderen Lager zum Verwechseln ähnlich. Die hören nicht genau hin und lassen sich dazu verführen, missverständliche Statements in ihrem Sinne auszulegen, woraufhin man ihnen berechtigterweise vorwerfen kann, mit haltlosen Unterstellungen zu agitieren. Und was Jesus Sirach betrifft, sind sie auch keinen Deut besser als die geistlichen Würdenträger.
[Wird fortgesetzt.]
Posted in Homo laber, Würfelwürfe | 1 Comment »
Sunday, 29. March 2009
Posted in Oikos, Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Saturday, 28. March 2009

Zu Beginn des Monats war ich auf die eben erschienene deutsche Übersetzung von Nicholson Bakers Human Smoke aufmerksam geworden, eine Montage aus Zitaten zur Vorgeschichte und zum Verlauf des Zweiten Weltkriegs, von August 1892 bis zum 31. Dezember 1941, mit der der amerikanische Romancier aus der vorgeblichen Neutralität des Archivars seinen bitteren Beitrag zum Pazifismus leisten will in einer Zeit, in der wir vom ewigen Frieden vielleicht weiter entfernt sind als je zuvor.
Mittlerweile habe ich die ersten 150 der insgesamt 500 Textseiten gelesen und kann mir vielleicht ein vorläufiges, vorsichtiges Urteil erlauben. (100 weitere Seiten entfallen auf die Quellennachweise und das Personen- und Sachregister.) Wohl noch nach jedem Krieg hat man die allgemeine Frage, wie er hat entstehen können, auf die speziellere verengt, welcher der kriegführenden Parteien die Schuld an seinem Ausbruch anzulasten sei. In aller Regel ziehen die Besiegten hierbei den Kürzeren, denn die Sieger haben mit dem Krieg auch die Vorherrschaft über die Geschichtsschreibung gewonnen.
Wenn ich Baker richtig verstehe, will er das ewige bipolare Einerlei von Täter und Opfer, Angreifer und Verteidiger, Sieger und Besiegtem überwinden, indem er eine dritte Stimme wieder ins Spiel bringt, die in dieser Deutlichkeit erstmals im 20. Jahrhundert vernehmbar war: die des Pazifismus, jenes radikalen Humanismus über alle Staatengrenzen und ideologischen Gegensätze hinweg, dessen vielleicht bekannteste Parteigänger Bertha von Suttner, Mahatma Gandhi und Aldous Huxley waren.
Das Buch ist bei seinem Erscheinen in Großbritannien und den USA im vergangenen Jahr von der Kritik mehrheitlich verrissen worden. Dem Autor wurde unterstellt, dass er mit seinem blauäugigen Pazifismus jene Appeasement-Politik zu rehabilitieren suche, die doch gerade 1938 gegenüber Adolf Hitler de facto gescheitert und damit für alle Zukunft diskreditiert sei. Dabei ist Nicholson Bakers Hinweis doch zunächst einmal sehr ernst zu nehmen, dass die demokratischen Staaten der westlichen Welt ihre Kriegsbeteiligungen nach 1945 allesamt mit dem Verweis auf das Verhängnis einer Nachgiebigkeit à la Appeasement gerechtfertigt haben und dass dieses reflexartig vorgebrachte Argument mittlerweile auch zum Führen von Offensivkriegen taugt, wie zuletzt gegen Saddam Hussein. Selbst wenn die Schlüsse, die die Zitate in Menschenrauch nahelegen, falsch sein sollten, weil sie durch eine selektive und manipulative Zusammenstellung suggeriert werden, so ist doch gegen die gute Absicht nichts einzuwenden, dieses große Thema „Appeasement vs. Präventivkrieg” noch einmal etwas gründlicher und voraussetzungsloser in den Blick zu nehmen, als dies zuletzt üblicherweise geschah.
Einerlei, ob ich Bakers Thesen, so sich solche denn überhaupt eindeutig ausmachen lassen, zuletzt folgen werde oder nicht – ein Lob muss ich dem Buch schon jetzt spenden: Es verdeutlicht, dass wir es uns zu leicht machen, wenn wir glauben, 1 + 1 = Krieg sei eine zuverlässige Gleichung zur Erklärung und Begründung des Massengemetzels.
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Krieg dem Kriege (III)
Friday, 27. March 2009

Neulich traf ich eine alte Bekannte, die mir von einem schweren Schicksalsschlag berichtete. Sie hatte bei einem Brand ihrer Wohnung buchstäblich alles verloren. Oder, wie sie es ausdrückte: „Alles bis auf mein Leben, die paar Sachen, die ich auf dem Leib trug – und mein Auto, mit dem ich gerade unterwegs war, als sich der Kurzschluss ereignete.” Ich wollte gerade weit ausholen und sie in phantasievoller Detailfreude bedauern, denn ich erinnerte mich sofort an eine Vielzahl beneidenswert schöner Dinge in ihrem Haushalt, an eine Standuhr etwa, ein Erbstück vom Urgroßvater mütterlicherseits, oder an eine Erstausgabe von Koeppens Tauben im Gras, mit einer sehr ungewöhnlichen Widmung des Autors. „Du wirst lachen”, fiel sie mir ins Wort, „aber ich bin schon längst darüber hinweg. Und ich habe mich lange nicht mehr so frei und unbeschwert, so voller Tatendrang und Lebenslust gefühlt wie in den letzten Wochen. Es ist wie ein radikaler Neubeginn, die ganz große Chance, meinen Alltag von Grund auf neu zu ordnen.”
Ein paar Tage später besuchte ich sie in ihrem neuen Heim, einer kleinen Wohnung unterm Dach eines Altbaus, sehr hell, sehr still – und sehr leer. Ein Bett, ein Tisch, zwei Stühle, ein schmaler Spind; in der winzigen Küche ein Gasherd, ein Waschbecken, eine Art Anrichte und der unentbehrliche Kühlschrank, der allerdings etwas aus dem Rahmen fiel. „Den hatte ich kurz vor der Katastrophe neu bestellt und er war glücklicherweise noch nicht geliefert worden. Der Rest ist, wie du siehst, gebrauchter Kram, von Freunden, vom Flohmarkt und vom Sperrmüll.” Erstaunlicherweise schien mir das Dachstübchen geräumiger als die frühere, vergleichsweise geradezu weitläufige Wohnung meiner Bekannten, in der man ständig auf der Hut sein musste, nicht über eins ihrer ausgesucht dekorativen und gewiss wertvollen Möbelstücke zu stolpern.
Ich wurde zwar im weiteren Verlauf unserer Unterhaltung den Verdacht nicht ganz los, dass sie sich mit ihrem Bekenntnis zu diesem geradezu mönchischen neuen Dasein über den Schmerz des Verlustes hinwegtrösten wollte. Andererseits war nicht zu leugnen, dass ich sie lange nicht mehr so aufgeräumt und ausgeglichen erlebt hatte wie an diesem Abend. Und unser Gespräch war erstaunlich „konzis”, wenn das das richtige Wort ist; man könnte vielleicht auch sagen: „unabgelenkt”. Ich trank dazu ein Glas Wasser aus dem Kran, was mir als sehr passend erschien.
Ein paar Tage nach diesem eindrucksvollen Antrittsbesuch in der neuen Wohnung meiner Bekannten stürzte mein Rechner ab. Auch dies war in gewisser Weise ein „Stubenbrand”, bei dem allerlei überflüssige „Einrichtungsgegenstände” unwiederbringlich verloren gingen: Textdateien, E-Mails, Adressen und manches mehr. Nach dem ersten Schreck nahm auch ich diese unfreiwillige Entrümpelung meines virtuellen Arbeitszimmers als eine willkommene Gelegenheit an, mein Tagwerk völlig neu einzurichten. Das hat mich knapp zwei Wochen gekostet, in denen ich nahezu mit nichts anderem beschäftigt war.
Die neue Übersichtlichkeit auf Festplatte und Monitor bewirkt durchaus eine erfreuliche Klarheit der Gedanken. Mit dem alten Archiv sind auch seine Ordnungssysteme auf Nimmerwiedersehen versunken und ich kann mir jetzt ganz neue ausdenken, die die zu spät erkannten Schwächen der alten vermeiden. Heute, um nur ein Beispiel zu nennen, lege ich mir gerade neue „Lesezeichen” in meinem Internet-Browser an. Im Ordner „Medien” etwa hatte ich vor dem Absturz die Links zu mindestens 50 Online-Auftritten nationaler und internationaler Zeitungen abgelegt, von der WAZ bis zur New York Post. Völlig überflüssig! Jetzt habe ich mich auf ein knappes Dutzend beschränkt. Ich ahne allerdings, dass in ein paar Jahren der schleichende Wildwuchs diese wohltuende Übersichtlichkeit wieder zunichte gemacht haben wird. Aber dann wird vermutlich, hoffentlich wieder ein Kurzschluss im System für Tabula rasa sorgen.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Stubenbrand
Thursday, 26. March 2009

A: »Erschrick bitte nicht. Ich bin es! Erkennst du meine Stimme noch?« – B: »A? Nein! Ich glaube es nicht!« – A: »Doch, ganz richtig, ich bin es. Ich bin ganz zufällig in der Stadt, hab geschäftlich hier zu tun, du weißt, was ich meine. Vermutlich ist es eine sehr schlechte Idee gewesen, dich anzurufen. Verzeih mir, ich …« – B: »Nein, bitte! Leg nicht auf. Ich denke gerade in letzter Zeit wieder ständig an dich. Du musst wissen, dass ich sehr krank bin.« – A: »Das tut mir leid.« – B: »Du musst mich nicht bedauern, jeder bekommt, was er verdient. Aber ich würde dich so gern sehn. Wo bist du jetzt?« – A: »Daraus kann nichts werden. Ich hocke in einem schäbigen kleinen Hotel am anderen Ende der Stadt und warte auf meinen Geschäftsfreund, der mich spätestens in einer halben Stunde abholen wird. Anschließend muss ich Venezuela so schnell wie möglich verlassen, wie du dir denken kannst.« – B: »Dann ist es wirklich grausam, dass du mich angerufen hast.« – A: »Ich konnte nicht widerstehen.« – B: »Was soll ich nun davon halten?« – A: »Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, weil ich dir eine Frage stellen muss.« – B: »Bin nicht eher ich diejenige, die das Recht hat, Fragen zu stellen? Nicht nur eine, sondern viele Fragen.« – A: »Ich kann dir deinen Zorn nachfühlen. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Es ist lange her und wir sollten es ruhen lassen. Meine Frage betrifft übrigens auch gar nicht die Vergangenheit.« – B: »Es ist lange her, ja, vielleicht nach dem Kalender und bestimmt für dich. Für mich ist es aber, als wäre es gestern gewesen. Für mich sind die Uhren in jener Nacht stehengeblieben, als du …« A: »Still! Sei still, sonst muss ich auflegen.« – B: »Schon gut.« – A: »Was ist das übrigens für ein kleiner Dicker, der dich an den Wochenenden regelmäßig besucht?« – B: »Du bist doch ein verfluchter… Du hast mich bespitzeln lassen.« – A: »Ich muss eben gewisse Vorkehrungen treffen, wie du weißt. Meine Neugier ist rein professionell.« – B: »Der ,kleine Dicke‘, wie du Y nennst, ist ein entfernter Verwandter, der lange in Europa gelebt hat. Ein Seelenarzt. Er besucht mich als guter Freund und Therapeut. Wenn ich ihn nicht hätte, wäre ich längst in den Guri gesprungen. War das deine Frage?« – A: »Nein. « – B: »Was dann?« – A: »Entschuldige mich einen Moment, bitte.« – B: »Was ist denn jetzt?« – A: »Ich bin sofort wieder da.«
A: »Da bin ich wieder.« – B: »Ist dein ,Geschäftsfreund’ eingetroffen?« – A: »Nein, ich habe nur die Vorhänge zugezogen, damit ich Licht machen kann. Es dämmert bereits.« – B: »Ja, das weiß ich. Aber ich liebe die Dunkelheit, seit ich das Leben hassen gelernt habe.« – A: »Ganz die alte B: Neigung zur Übertreibung. Melodramatische Zustände. Suizidale Phantasien. Oder wie nennt dein Freund, der Seelenarzt, dergleichen?« – B: »Jetzt hör mir mal gut zu, mein Lieber: Ich verspüre nicht die geringste Neigung, mir deine ebenso taktlosen wie unverschämten Spötteleien über meinen gesundheitlichen Zustand anzuhören. Wenn ich noch nicht aufgelegt habe, dann allein deshalb, weil …« – A: »Weil was?« – B: »Ach, ich weiß es auch nicht. Vielleicht, weil ich neugierig bin und gerade nichts Besseres zu tun habe.« – A: »Apropos: Was tust du denn eigentlich so? Ich meine: Wovon lebst du?« – B: »Das ist wieder ein Thema, über das ich nicht mit dir zu sprechen gedenke.« – A: »Schade. Ich habe mich jedenfalls etwas gewundert, dass du nicht mehr untervermietest. Ganz mutterseelenallein in diesem riesigen Haus, das ist doch etwas verwunderlich, findest du nicht? Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren zu meiner Zeit die Untermieter deine einzige Erwerbsquelle, wenn man mal davon absieht, dass du nebenher noch …« – B: »Schweig!« – A: »Schon gut. Lassen wir die Vergangenheit ruhen.« – B: »Eben. Willst du mir nicht endlich deine Frage stellen? Deine die Gegenwart betreffende Frage?« – A: »Was glaubst du?« – B: »Was weiß denn ich, was du mich fragen willst. Wir haben uns seit … lass mich rechnen … bestimmt seit achtzehn Jahren nicht mehr gesehen, nichts voneinander gehört. Woher soll ich also wissen, was du mich fragen willst? Ich war gerade auf dem besten Weg, dich endlich zu vergessen. Und jetzt stell sie endlich, deine gottverdammte Frage!«
A: »Ich habe sie doch schon gestellt: Was glaubst du?« – B: »Ach, nein! Du willst mit mir über Glaubensfragen diskutieren? Ausgerechnet du? Vermutlich hast du noch gestern bei einem deiner Flittchen gelegen; und heute schneidest du einem wildfremden Menschen für ein paar lausige Bolívares die Kehle durch. Zwischendurch aber kommt dir in den Sinn, die gute alte A anzurufen und mit ihr ein gepflegtes Telefongespräch über religiöse Themen zu führen. Sag mal: Hast du sie noch alle?« – A: »Die Frage ist mir ganz ernst.« – B: »Na, schön. Aber warum stellst du sie ausgerechnet mir? Auch wenn es lange her ist, müsstest du dich doch noch gut daran erinnern, dass ich mit dem lieben Gott und der unsterblichen Seele und der Wahl zwischen Himmel und Hölle rein gar nichts anfangen kann.« – A: »Das war vor zwanzig Jahren so, ich weiß. Aber es könnte sich ja mittlerweile geändert haben.« – B: »Wie kommst du darauf? Hast du auch meine geheimsten Gedanken ausspionieren lassen? Hast du mir Hellseher vor die Haustür gestellt?« – A: »Mach dich nicht lustig.« – B: »Ich habe vielmehr den Eindruck, dass du dich über mich lustig machen willst.« – A: »Weit gefehlt.« – B: »Ach A, hättest du doch nicht angerufen!«
A: »Willst du meine Frage nun beantworten? Die Zeit läuft uns davon.« – B: »Ja!« – A: »Was, ,ja‘?« – B: »Meine Einstellung hat sich geändert.«
A: »Ich dachte es mir.« – B: »Du dachtest es dir. Warum?« – A: »Es hat nie zu dir gepasst.« – B: »Was?« – A: »Na, der Unglaube. Nenne es, wie du willst.« – B: »Ich glaube nicht, dass du auch nur von ferne einen Begriff davon hast, was ich meine, wenn ich zugebe, dass sich meine Haltung in diesen Dingen geändert hat. Weil du nämlich damals meine ganz andere Auffassung ebenfalls völlig missverstanden hast.« – A: »Mag sein.« – B: »Glaub mir, es ist so. – Eines kann ich aber nicht begreifen.« – A: »Nämlich?« – B: »Warum ausgerechnet dieses Thema dich so sehr beschäftigt, dass …« – A: »Ich habe eben ein paar Erfahrungen gemacht.« – B: »Willst du mir davon erzählen?« – A: »Vielleicht später einmal. Jetzt muss ich Schluss machen. Leb wohl, einstweilen.« – B: »Warte noch! Ich muss dich … hallo?«
Posted in Werke | Comments Off on 8° 22′ N 62° 39′ W
Wednesday, 25. March 2009

… ist es nun schon wieder her, dass ich diesen Schreibversuch mit einem Text über meine ersten Online-Schach-Erfahrungen gestartet habe. Nahezu täglich ist seither ein fünf Absätze langer Beitrag von mir unter dieser Adresse erschienen. In den seltenen Fällen, da dies nicht geschah, am 16. Dezember, 8. und 9. März, waren es ausschließlich technische Schwierigkeiten, die die Publikation verhinderten.
„Täglich erscheint ein Beitrag mit jeweils fünf Absätzen, in seltenen Fällen erfolgt die Publikation eines Beitrags mit einem Tag Verzögerung.” So lautet die Verpflichtung, die ich mir freiwillig auferlegt und im Impressum definiert habe. Diese möglicherweise etwas zwanghaft anmutende Regel hat natürlich ihren guten Grund. Verfolgt man die Entwicklungsgeschichte von Weblogs jeglicher Couleur, ist nämlich folgendes Muster überaus verbreitet. Die Neulinge starten mit den besten Absichten, es sprudelt geradezu aus ihnen heraus, sie publizieren anfangs mehrere Artikel pro Tag, kommen dann aber aus der Puste, die Abstände zwischen den Beiträgen werden immer größer und schließlich versiegt die Quelle ihrer Eingebungen ganz, ihre Kräfte erlahmen und sie bleiben auf der Strecke. Das Netz ist so in wenigen Jahren zu einem gigantischen Weblog-Friedhof geworden. Allerdings fristen die unzähligen Gräber dieses virtuellen Gottesackers ein Schattendasein abseits der öffentlichen Wahrnehmung, denn es gibt keine Wegweiser, die auf sie verweisen, keine Wege, die zu ihnen hinführen würden.
Mit meiner Selbstverpflichtung wollte ich mir immerhin die Peinlichkeit ersparen, mit stolzgeschwellter Brust als Marathonläufer an den Start zu gehen, um hundert Meter später mit hängender Zunge zugeben zu müssen, dass ich besser gleich als Sprinter angetreten wäre. Das dürfte mir wohl gelungen sein. Eine andere Frage ist freilich, ob die Texte ein einigermaßen gleichbleibendes Niveau halten konnten. Das eher nicht. Wie sollte ich jederzeit vermeiden können, dass sich der eine oder andere Tiefausläufer meines Stimmungsklimas in meinem Geschreibsel niederschlägt? Bin ja schließlich auch nur ‘n Mensch!
Die Versuchung war daher zuletzt keine kleine, bei einer Art „Frühjahrsputz” eine Anzahl schwächerer Elaborate aus dem Vorratsspeicher zu eliminieren, was ja in dieser schönen neuen Datenwelt herrlich einfach ist, rückstands- und geräuschlos per Mausklick. Nun bin ich aber leider ein ausgesprochener Sammler und werfe so schnell nichts weg, ganz gleich, ob es sich um fremde Briefe, schlechte Bücher oder eigene Texte handelt. Erst wenn die Schubladen, Regale, Schränke, Kisten und Keller aus allen Nähten platzen, kann ich mich dazu durchringen, Ballast abzuwerfen. Auch der Speicherplatz, den ich bei meinem Webhoster gemietet habe, ist natürlich begrenzt. Aber ich habe von den 2.500 MB, die mir dort zur Verfügung stehen und für die ich monatlich 8,90 € bezahle, gerade einmal acht Prozent genutzt. Warum also entrümpeln, wenn der weitaus größte Teil der Lagerhalle leer steht?
Ich mache also weiter wie bisher. Erklärungsbedürftig bliebe insofern nur noch mein langes Schweigen in den letzten zwölf Tagen. Was soll ich sagen? Dass ich Urlaub gemacht habe? Dass ich mich einer gesundheitlichen Generalinspektion unterziehen musste? Dass ich ein hartnäckiges RSI-Syndrom auskurieren musste? Schön wär’s ja, wenn diese zwölf Tage so leicht zu erklären wären, doch ist der Grund [s. Titelbild], am Rande der Legalität, ein überaus komplexer, für gewöhnliche Sterbliche völlig unverständlicher, für ungewöhnliche Sterbliche unter Umständen sogar gefährlicher – und muss darum hier mit vornehmem Schweigen übergangen werden. Da sich dergleichen aber rein theoretisch jederzeit wiederholen kann, habe ich im diesbezüglichen Absatz des Impressums eine kleine Ergänzung vorgenommen.
Posted in Interventionen, Würfelwürfe | 2 Comments »
Thursday, 12. March 2009

So was kommt dabei heraus, wenn man einen ehemaligen Kulturstaatssekretär damit beauftragt, den Interviewer zu spielen. Dabei sollte doch eigentlich eine renommierte Wochenzeitung wie die ZEIT wissen, dass die Kunst des Interviewens kein hemdsärmelig zu bewerkstelligendes Nebengeschäft für jeden hergelaufenen Politiker und Schreiberling ist, mag er es zu noch so großer Prominenz und Macht gebracht haben.
Da stellt dieser Michael Naumann tatsächlich und ungelogen die dümmste und hohlste aller Interviewer-Fragen – und zwar keinem Geringeren als Philip Roth, dem von ihm hoch favorisierten Nobelpreis-Kandidaten: „Sind Sie glücklich, Mr. Roth?” (Wer es nicht glauben mag, kann es hier nachlesen: Die Zeit der neuen Ernsthaftigkeit. Ein Gespräch mit dem amerikanischen Schriftsteller Philip Roth über das Alter, den Antiamerikanismus und sein Leben in den Büchern; in: Die Zeit Nr. 6 v. 29. Januar 2009, S. 48.)
Und was antwortet Mr. Roth? „Ich frage mich nicht, wer oder was ich bin. Ich bin derjenige, der an diesen und mit diesen Büchern arbeitet. Schreiben ist nicht identisch mit Selbstfindung. Es gleicht mehr der Arbeit an einem Objekt, das aus Charakteren, Handlungen und Wörtern gemacht ist. Ich arbeite die ganze Zeit.” Das antwortet Mr. Roth nicht etwa auf Fragen danach, was er sich selbst fragt oder wer er ist oder was das Schreiben für ihn bedeutet oder was er die ganze Zeit über tut, wenngleich jede einzelne dieser Fragen längst nicht so bescheuert gewesen wäre wie die von Herrn Naumann gestellte. Entweder hat Mr. Roth gar nicht gehört bzw. verstanden, was Herr Naumann von ihm wissen wollte; oder dessen Frage hat ihn dermaßen perplex gemacht, dass er daraufhin nur noch völligen Unsinn zum Besten geben konnte.
Doch Herr Naumann lässt nicht locker. „ZEIT: Aber sind Sie glücklich? ROTH: Das frage ich mich niemals. ZEIT: Warum nicht? ROTH: Weil es mich nicht interessiert. Ich frage mich nur: Geht es voran mit der Arbeit? Und wenn ich an einem Buch sitze, bin ich lebendig. Ich wache morgens auf und will sofort an die Arbeit. Die schlimmste Zeit ist diejenige zwischen zwei Büchern. Dann weiß ich nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich gehe in drei Museen, und dann ist das erledigt. Aber was soll ich mit meiner Zeit anfangen? Ich bin einfach zum Schreiben da, und wenn ich nicht schreibe, komme ich mir vor wie ein Wagen, dessen Räder im Schnee durchdrehen.”
Jetzt wissen wir’s. Es wäre keine gute Idee, den Nobelpreis für Literatur an Mr. Philip Roth zu vergeben, denn damit würde man ihn kaum glücklich machen. Und selbst wenn man ihn glücklich machte, würde er dies vermutlich gar nicht merken, denn er fragt sich nach eigenem Bekenntnis ja niemals, ob er glücklich ist. Es interessiert ihn nicht. Und die Reise nach Stockholm würde ihn nur von der einzigen Beschäftigung abhalten, die ihn wirklich interessiert. Insofern ist es natürlich kompletter Humbug, wenn man in einem nicht namentlich gezeichneten Intro zu dem ZEIT-Interview (S. 47) liest: „Wahrscheinlich ist kein Schriftsteller so oft als Kandidat für den Nobelpreis genannt worden – eine jährliche Folter, die er wahrlich nicht verdient hat. Die Schwedische Akademie sollte sie durch eine rasche Vergabe beenden.” Da steht tatsächlich „Folter”. Ich fasse es nicht.
Posted in Nonsens, Würfelwürfe | 2 Comments »
Sunday, 08. March 2009

Im Januar dieses Jahres gab der US-amerikanische Romancier Philip Roth (74) dem deutschen Verleger und ehemaligen Kulturstaatsminister Michael Naumann (66) ein Interview. Äußerer Anlass des Gesprächs war das Erscheinen der deutschen Übersetzung von Roths dreiundzwanzigstem Roman, Indignation, unter dem Titel Empörung. Philip Roth ist somit ein für heutige Verhältnisse emsiger Autor. Zum Lesen kommt er nebenher offenbar kaum. „Sie schreiben sehr schnell,” meint Naumann. „Thomas Pynchon schreibt so langsam, weil er sich von seinen erdichteten Charakteren nicht trennen mag.” Mal abgesehen davon, dass Pynchon vermutlich zwanzig- oder fünfzigmal so schnell schreibt wie Roth, wenn man nämlich unterm Akt des Schreibens mehr versteht als das bloße Zu-Papier-Bringen einer Geschichte, ist die Erklärung, die Naumann für diese angebliche Langsamkeit von Pynchons Arbeit findet, vollkommener Humbug. Roth kann ihm nicht widersprechen, denn er kennt Pynchon offenkundig nicht. So fragt er Naumann über Pynchon aus, der ihn aber auch nicht kennt, sondern nur so tut als ob.
Naumann erzählt Roth noch etwas, das der nicht weiß: Im Oktober vorigen Jahres habe Horace Engdahl (60), Ständiger Sekretär der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die die Nobelpreise verleiht, sich abfällig über die amerikanischen Schriftsteller geäußert. Sie seien zu empfänglich für die Trends ihrer eigenen Massenkultur, worunter die Qualität ihrer Werke leide. Daraus zieht Michael Naumann den Schluss, weder Thomas Pynchon (70) noch Don DeLillo (71), weder Paul Auster (60) noch Richard Ford (63), weder John Updike (75, inzwischen verstorben) noch sein Gegenüber habe damit wohl noch eine Chance, den Nobelpreis für Literatur zugesprochen zu bekommen. Solche Spekulationen finde ich immer ausgesprochen langweilig, wie ja dieser bestdotierte Literaturpreis der Welt ohnehin an Ödnis kaum mehr zu überbieten ist. Statt Naumanns kleine Stichelei im Gewande einer peinlichen Anbiederung mit einem Achselzucken zu quittieren, oder noch besser mit einem unendlich langgezogenen Gähnen, geht Philip Roth hier tatsächlich an die Decke wie das HB-Männchen seligen Angedenkens:
„ROTH: Also, das hat er [Horace Engdahl] nicht gesagt. ZEIT: Doch, doch. ROTH: Aber warum? ZEIT: Vielleicht hat er einen antiamerikanischen Vogel? ROTH: Jeder, der irgendetwas von Literatur versteht, weiß, dass die amerikanische Literatur seit 1945 von dauerhafter, ja größter Stärke ist. Ich könnte mindestens 12, nein 15 amerikanische Autoren nennen … Also, nein, das kann er nicht gesagt haben. ZEIT: Hat er. Aber was weiß er?” (Michael Naumann: Die Zeit der neuen Ernsthaftigkeit. Ein Gespräch mit dem amerikanischen Schriftsteller Philip Roth über das Alter, den Antiamerikanismus und sein Leben in den Büchern; in: Die Zeit Nr. 6 v. 29. Januar 2009, S. 47 f.) Es scheint ihm also tatsächlich etwas zu bedeuten, diesen Preis noch entgegenzunehmen. Nun könnte man zu Roths Gunsten vermuten, dass er bloß auf das Preisgeld in Höhe von 10 Millionen schwedischen Kronen scharf ist, das sind umgerechnet immerhin 1.086.650 US-$. Aber das ist es nicht.
Lieber Philip Roth! Jeder, der irgendetwas von Literatur versteht, weiß, dass die Vergabe des Nobelpreises noch niemals etwas über die Schönheit, Stärke, Sinnlichkeit, Originalität und formale Gediegenheit eines literarischen Werkes ausgesagt hat. Von Paul Heyse bis Harold Pinter ist die Liste der Preisträger ein Verzeichnis von Sternen zweiter bis dritter Ordnung. Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka, Robert Musil, Fernando Pessoa, Vladimir Nabokov, Jorge Luis Borges – sie alle sucht man vergeblich auf dieser Liste.
Das erste Buch von Philip Roth, das ich gelesen gelesen habe, war Portnoys Beschwerden. Das fischte ich als rororo-Bändchen aus einer Trödelkiste in Werden, Mitte der 1980er-Jahre. Ich habe mich streckenweise köstlich amüsiert über die Unbefangenheit, mit der er hier pubertäre Wettbewerbe – „Wer spritzt am weitesten?” – und familiäre Bräuche karikiert. In weiteren zehn Romanen von Roth war ich vermutlich auf der Suche nach etwas, das sich diesem unschuldigen ersten Leseerlebnis vergleichen ließe. Leider ohne Erfolg. Je älter Philip Roth wurde, desto „bedeutungsvoller” wurden seine Romane. Damit ich nicht falsch verstanden werde: Man kann diese vielen Bücher gut lesen, sie sind unterhaltsam, abwechslungsreich, amüsant, zynisch und manches mehr. Aber zu den ganz Großen gesellt sich Philip Roth damit sicher nicht. Und insofern sollte es mich nicht wundern, wenn er in diesem Jahr den Nobelpreis für Literatur erhielte, zumal der alte Schwede mit dem antiamerikanischen Vogel sein Amt zum 1. Juni 2009 an den Historiker Peter Englund (50) weitergeben wird.
[Es wird noch schlimmer: Fortsetzung folgt!]
Posted in Nonsens, Würfelwürfe | Comments Off on Glücklos (I)
Saturday, 07. March 2009

Als ich vor dreißig Jahren begann, meine Brötchen im Buchhandel zu verdienen, schwappte gerade die erste ganz große Ratgeberwelle über den Verkaufstresen. Der Gentleman-Spekulant André Kostolany entführte uns ins Wunderland von Geld und Börse und enthüllte die Kunst, ein Vermögen zu machen. Die Kräuterhexe Maria Treben ermunterte uns, unsere kleinen und großen Wehwehchen mit den himmlischen Gaben aus der Apotheke Gottes zu kurieren. Und gleich ein halbes Dutzend strahlender Mutmacher, von Josef Kirschner über Paul Murphy und Thorwald Dethlefsen bis hin zu Norman Vincent Peale, predigten die Glück und Erfolg versprechende Kraft des positiven Denkens.
Wenn auch nur die Hälfte der abertausend Käufer dieser Gebrauchsanweisungen für ein erfülltes Erdendasein zwischen den Buchdeckeln gefunden haben, was sie sich erhofften, dann dürfte ich, als Händler solcher papierenen Heil- und Hilfsmittel, mir meinen Stammplatz im paradiesischen Jenseits zweifellos verdient haben.
So dachte ich wenigstens bis zum 15. September vorigen Jahres, als Lehman Brothers Insolvenz anmeldete, die globalisierte Finanz- und Wirtschaftsordnung ins Rutschen geriet und vor meinem inneren Auge jene Kostolany-Kunden der frühen 1980er-Jahre vorbeidefilierten, jammernd und klagend, mit erhöhtem Blutdruck und schweren Depressionen. Ich weiß nicht, welches Kräutlein Maria Treben für diesen Fall im Körbchen hatte. Ich meine mich aber zu erinnern, dass Kostolany-Kunden als Zweitbuch vielleicht noch den dicken Konz, Tausend ganz legale Steuertricks, zur Kasse trugen, kaum jedoch das Kräuterbuch der schlichten Naturheilkundlerin aus dem oberösterreichischen Grieskirchen.
Allenfalls könnte sich der eine oder andere dieser in dunkle Nadelstreifenanzüge gewandeten Spekulanten einen Stimmungsaufheller aus den Think-Positive-Tanks von Dr. Murphy & Co. geschnappt haben, für alle Fälle. Dort liest er dann jetzt, dass noch der schlimmste Schicksalsschlag sein Gutes hat – wenn man nur den rechten Blickwinkel findet.
Den findet man zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung vom 20. Februar 2009. Darin liest der gebeutelte und geplünderte Investor auf Seite 16: „Krise als Klimaretter – Flaute lässt CO2-Ausstoß sinken. Der Ausstoß von Treibhausgasen könnte aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise in diesem Jahr um bis zu acht Prozent zurückgehen. Das berichteten Meteorologen am Donnerstag auf dem Extremwetter-Kongress in Bremerhaven. Vor allem der erhebliche Rückgang des Wachstums in China führe dazu, dass die Treibhaus-Emissionen zwischenzeitlich nicht ansteigen.” Wir müssen uns bloß daran gewöhnen, dass schlechte Nachrichten für die Menschheit in aller Regel gute Nachrichten für den Rest der Erde sind – und uns dann noch unseren humanen Egoismus abgewöhnen. Ein Ratgeber von Josef Kirschner zielte allerdings in die entgegengesetzte Richtung, hieß er doch Die Kunst, ein Egoist zu sein. – Ach, ich fürchte, ich habe meinen Stammplatz im Paradies verwirkt!
Posted in Oikos, Würfelwürfe | Comments Off on Glück im Unglück
Friday, 06. March 2009

Ganz am Rande: Meine Haare haben mich nie glücklich gemacht. Vielleicht am ehesten ansehnlich waren sie in meinen allerersten Lebensjahren. Eine blonde Lockenpracht ist auf den Farbfotos der frühen 1960er-Jahre zu sehen, am Strand von Noordwijk aan Zee.
Dann wurde mir ein Kurzhaarschnitt verordnet, schließlich sollte man mich doch nicht mit einem Mädchen verwechseln. Die regelmäßigen Friseurbesuche an der Seite meines Vaters fand ich quälend wie alles, was mir eine künstliche Steifheit abnötigte und mich zu Tode langweilte.
Bald kam der Pilzkopf als neuer Standard, die Diktatur der Popkultur. Wer ihn bei den Eltern nicht durchsetzen konnte, wurde in der Schule gehänselt und hatte bei den Mädchen schlechte Karten. Mein Pech war, dass mir lange Haare nicht standen – oder, wörtlich genommen, eben gerade: völlig chaotische Wirbel. „Huch, die sind ja wie Draht!” So der Coiffeur im Salon Frank. „Da bricht mir glatt die Schere ab, har-har!”
Jetzt, in den besten Jahren, sind meine Haare fein wie Spinnfäden geworden. Ob das mit meinen veränderten Ernährungsgewohnheiten zusammenhängt? Oder mit meinen immer filigraner werdenden Denkgewohnheiten? Am Hinterkopf wird eine kahle Stelle Jahr für Jahr größer und größer, der sie umschließende Haarkranz schmaler und schmaler, wie ein Rauchring, den man gegen die Decke bläst.
Indes habe ich noch immer kein einziges graues Haar. Das Enzym Katalase ist in meinen Zellen offenbar noch ausreichend vorhanden und neutralisiert das Wasserstoffperoxid, das somit auch weiterhin keine Chance hat, das Enzym Tyrosinase anzugreifen und so die Aminosäure Methionin zu oxidieren. Diese Molekulardynamik, die zum Ergrauen führt, wurde erst jüngst wissenschaftlich ergründet. Mich würde mehr interessieren, warum man als Mann offenbar eher zur Glatze neigt, wenn man nicht ergraut; und warum Frauen weniger zur Glatze neigen als Männer. Aber auch das nur ganz am Rande. Da meine Haare – ich sagte es schon – mich noch nie glücklich gemacht haben, kann ihr Verlust mich auch nicht sonderlich unglücklich machen.
Posted in Memento, Würfelwürfe | 4 Comments »
Thursday, 05. March 2009
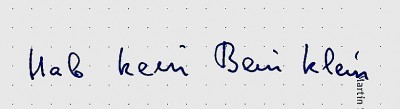
Neulich wurde mir aus Pädagogenkreisen folgendes Rätsel zugetragen, dem offenbar eine wahre Begebenheit zu Grunde liegt.
Ein Schüler der achten Klasse hat zum wiederholten Male beim Aufsatz vollkommen versagt. Der Deutschlehrer bittet ihn, seiner Mutter zu bestellen, dass sie doch einmal in seine Sprechstunde kommen möge, damit man gemeinsam auf Abhilfe sinnen könne.
Die Mutter erscheint nicht. – Nach einer Weile spricht der Lehrer den Schüler wieder an, ob er vergessen habe, seiner Mutter die Einladung auszurichten.
Keineswegs, so beteuert der Schüler. Die Mutter habe ihm, jetzt falle es ihm wieder ein, sogar eine Entschuldigung mit auf den Weg gegeben. Und er kramt aus seiner Schultasche den oben abgebildeten Zettel hervor.
Frage: Wodurch war die Mutter verhindert, in die Schule zu kommen?
Posted in Babel, Würfelwürfe | 6 Comments »
Wednesday, 04. March 2009

Im vergangenen Monat erschien mal wieder eins jener „humorvollen und zugleich informativen” Taschenbücher, die sich so wunderbar als Mitbringsel zur Geburtstagsparty einer nicht ganz so nahen Bekannten eignen, über deren speziellere Neigungen, literarische Vorlieben oder Freizeitinteressen man noch nicht viel herausgefunden hat und der man dennoch kein völlig nichtssagendes Allerweltsgeschenkbuch à la Wortstoffhof von Axel Hacke überreichen will. Vielleicht hat sie ja gar keinen Humor, wer weiß?
Immerhin kann man sich auf eins verlassen: Einerlei, ob sie nun sportlich ist oder Figurprobleme hat oder beides, ob sie ihre Brötchen als Kassiererin bei Hennes & Mauritz oder als Lektorin bei Kiepenheuer & Witsch verdient, ob sie sechzehn oder sechsundsechzig Jahre alt ist, in Essen lebt oder in Funabashi, ob sie jeden sauer verdienten Cent dreimal umdreht, bevor sie ihn ausgibt, oder vielmehr gerade die Erbschaft dreier fleißiger Generationen zum Fester rauswirft – ganz sicher war sie irgendwann schon mal bei Ikea und hat in dem „unmöglichen Möbelhaus aus Schweden” den einen oder anderen nützlichen oder unnützen oder zunächst nützlich scheinenden und sich später als unnütz erweisenden Gegenstand gekauft. „Weltweit schleppen Menschen Möbel in flachen Kartons zu ihren Autos, drehen zu Hause mit einem Inbusschlüssel [s. Titelbild] Schrauben in Pressspan und richten sich mit Möbeln ein, die auch in französischen, amerikanischen, britischen, deutschen, italienischen, finnischen, japanischen oder russischen Wohnungen und in den Häusern Dutzender anderer Nationalitäten stehen.” (Sebastian Herrmann: Wir Ikeaner. Unsere verhängnisvolle Affäre mit einem kleinen schwedischen Möbelhaus. München: Knaur Taschenbuch Verlag, 2009, S. 16.)
Man muss kein samstäglicher Ikea-Dauerkunde sein wie der SZ-Redakteur Sebastian Herrmann (*1974), der gewiss schon längst nicht mehr wohnt, sondern lebt, um die meisten seiner Witzchen über das globale Einrichtungsimperium zu verstehen und seine zahllosen Ikea-Anekdoten, allesamt von hohem Wiedererkennungswert, mit Schmunzeln quittieren zu können. (Die Einbandoberfläche des Taschenbuchs fühlt sich übrigens an wie eine jener blauen Einkaufstüten, die man beim Verlassen des Ikea-Markts kaufen kann, wenn man sich auf dem Weg durch das Einkaufslabyrinth – gegen den Uhrzeigersinn! – in die gelbe Einkaufstüte verliebt hat, die einem nur leihweise überlassen wurde. Haptische Effekte sind als originelle Dreingaben zu Taschenbüchern gerade der letze Schrei.)
Der Inhalt dieser Buchtüte aus der Droemerschen Verlagsanstalt ist leider weniger profiliert als der Umschlag. Hätte sich der Autor damit begnügt, aus seinem Thema einen gepfefferten Artikel für seinen Arbeitgeber zu machen, etwa für den Wochenend-Teil der Süddeutschen, es wäre zweifellos ein journalistisches Bravourstück daraus geworden. Bestimmt hätte das Material zum Thema Ikea auch zu einer etwas ausführlicheren Darstellung gereicht, etwa in NZZ Folio, da gab es ja tatsächlich mal ein Themen-Heft Shopping. Aber die 238 Seiten, die gefüllt werden mussten, um mir ruhigen Gewissens 8,95 Euro abknöpfen zu können, hat erkennbar schon Sebastian Herrmann als Zumutung empfunden. Wie sollte es da einem vielbeschäftigten Leser anders gehen?
Hinzu kommt, dass das Buch nicht weiß, wohin mit sich. Will es mit bitterböser Miene unseren kompensatorischen Konsumismus als Zwangsneurose entlarven? Will es die Produkte des Handelsunternehmens als ökologisch verwerflich anprangern? Oder die subtilen Manipulationstechniken des Konzerns brandmarken? Vielleicht will es ja auch bloß den typischen Ikea-Kunden charakterisieren, der mit etwas Glück zugleich der typische Ikea-Buch-Leser sein könnte und mit noch etwas Glück Gefallen daran findet, sich selbst in seiner albernen Konformität bloßgestellt zu sehen, womit das Buch es allein in Deutschland auf eine Millionenauflage bringen könnte. Eins sollten sich aber leidende Ikeaner ebenso wie meidende Non-Ikeaner von vornherein abschminken: dass dieses Büchlein etwa Ingvar Kamprads Einrichtungsimperium auch nur im Mindesten schaden könnte. Ikea ist nämlich – auch Herrmann hat dies erkannt – gegen Kritik jeder Art perfekt imprägniert, ganz gleich von wo sie kommt und wohin sie zielt. Ja, mehr noch: Ikea verwandelt jeden Vorwurf, den man Ikea machen kann, postwendend in ein Argument für Ikea. Nur Stehen ist billiger!
Posted in Dingwelt, Würfelwürfe | 2 Comments »
Tuesday, 03. March 2009

Die Wahrheit blüht besonders üppig im Verborgenen, wenngleich sich diese Blüten meist nicht zu Dekorationszwecken auf bürgerlichen Fensterbänken eignen. Im vorletzten Sommer erschnüffelte unsere Hündin den provisorischen Unterschlupf eines Obdachlosen, neben einem Trafohäuschen ganz in der Nähe unserer Wohnung, den Blicken vorbeieilender Passanten durch wild wucherndes Gebüsch gnädig entzogen.
Im Winter 2007 auf 2008, da das Schlafen unter freiem Himmel noch ungemütlicher wurde, als es selbst in der wärmeren Jahreszeit sein mag, inspizierte ich den wilden Ort erneut und traf zwar den ohne Dach dort Hausenden nicht an, gewahrte aber eine neue Möblierung, die den Minustemperaturen das Wenige entgegensetzte, was ohne Geld zu haben ist, was von den Sperrmüllbergen einer modernen Großstadt fortgetragen werden kann. Ich berichtete kurz vor Weihnachten 2007, noch unter anderer Adresse, über meine Entdeckung.
Der Anwohner des Trafohäuschens kreuzte seither gelegentlich meinen Weg. Es war ein Mann schwer bestimmbaren Alters, zwischen 40 und 60, von ungesundem, aber nicht ganz ungepflegtem Äußeren, schlank und groß gewachsen, langhaarig und bärtig. Auffallend war, dass er beim Schreiten mit den Armen schlenkerte. Er wechselte offenbar häufig die Kleidung, nie sah ich ihn zweimal in den gleichen Sachen. Ekel vor angebrochenen, halb verzehrten, dann weggeworfenen Lebensmitteln, die er wohl aus Mülltonnen oder -containern klaubte, schien er nicht zu haben: Ich beobachtete ihn mehrfach, wie er dergleichen lustvoll verzehrte. Ob er Alkoholiker war, vermag ich nicht zu sagen. Er torkelte nicht, trug nie eine Bier- oder Schnapsflasche mit sich.
Als er mir zuletzt Anfang 2009 begegnete, sprach ich ihn an, zückte mein Portemonnaie und schenkte ihm, mit einem Glückwunsch zum neuen Jahr, einen mittelgroßen Geldschein, wofür er sich bedankte. Danach sah ich ihn nicht mehr und werde ihn vermutlich auch niemals wiedersehen.
Vor wenigen Tagen hat nämlich das Grünflächenamt meiner Vaterstadt den kleinen Park, an dessen Rand das Trafohäuschen steht, radikal von wildwachsendem Gebüsch gereinigt. Das „Mobiliar” des Obdachlosen wurde bei dieser Gelegenheit offensichtlich entsorgt [s. Titelbild]. Und die Wahrheit? Sie lautet: Obdachlosigkeit erspart dem Staat die Räumungsklage, Fristen sind nicht zu beachten.
Posted in Oikos, Würfelwürfe, Xenographien | Comments Off on Fristlos
Monday, 02. March 2009

„In jeder Diskussion darüber, warum die USA in einen Krieg eintreten sollten oder nicht, das heißt: In allen gefährlichen politischen Situationen seit 1945, wird der Zweite Weltkrieg als Beispiel vor allen anderen angerufen. In diesem Fall scheint es völlig klar zu sein, wie gut und böse verteilt sind. Hitler war ein dämonischer Wahnsinniger, der Urheber eines gigantischen Massenmords, von Hässlichkeit, Zerstörung und Untergang. Ebenso klar scheint zu sein, dass man in einem solchen Krieg nicht Pazifist sein konnte – in diesem Land zählen die Pazifisten jener Zeit noch immer zu den verkappten Faschisten. Dieser Krieg war der gute Krieg, der alle anderen Kriege rechtfertigte, bis hin zum gegenwärtigen Krieg im Irak.” (Thomas Steinfeld: „Man kann die Menschen nicht zum Guten bombardieren.” Nicholson Baker im Interview; in: sueddeutsche.de v. 13. März 2008.) So erklärte Nicholson Baker vor einem Jahr beim Erscheinen seines letzten Buches Human Smoke, warum er sich darin ausgerechnet mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigte – und nicht mit irgendeinem anderen Krieg der an Kriegen doch so reichen Menschheitsgeschichte.
In diesen Tagen liefert der Rowohlt-Verlag die deutsche Übersetzung aus. Mein Buchhändler hatte sie am heutigen Montag noch nicht, obwohl sie gestern von Volker Weidermann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung besprochen wurde. – Neulich gab es ja ein arges Lamento um Daniel Kehlmanns ebenfalls bei Rowohlt erschienenen Roman Ruhm, den Volker Hage unter Missachtung der Sperrfrist („Keine Rezensionen vor dem 16. Januar!)” im Spiegel vom 5. Januar rezensiert hatte. Bakers Buch – nicht Roman, nicht Sachbuch – ist für den 6. März angekündigt. Bis dahin werden die FAS-Leser Weidermanns nette Worte wohl hoffentlich noch nicht ganz vergessen haben.
(Doch warum schweife ich von der Kriegsschuldfrage im Allgemeinen und den Schuldigen am Zweiten Weltkrieg im Besondern zu einem dermaßen trivialen Thema wie den Sperrfristen im Buchhandel ab? Vielleicht damit ich diesen Artikel nicht nur in die „Zentrifuge” stopfen kann, sondern er auch noch leidlich in die Kategorie „Langsamkeit” passt. Denn es ist doch schließlich ein weiteres, Besorgnis erregendes Indiz für die fortschreitende Zersetzung unserer Urteilskraft, wenn der Beschluss, nach der Lektüre einer Buchempfehlung im Feuilleton unserer Tageszeitung in den nächsten Tagen eine Buchhandlung aufzusuchen und dieses Buch zu erwerben, allein deshalb oft genug verworfen wird, weil dieses Buch noch nicht erschienen ist. Das Sperrfeuer der auf uns einprasselnden Novitäten macht es uns offenbar unmöglich, eine Kaufentscheidung länger als ein, zwei Tage aufrechtzuerhalten.)
Nicholson Baker hat ein Buch geschrieben, das bei seinem Erscheinen am 11. März vorigen Jahres in den USA und in Großbritannien heftige Kontroversen auslöste. Wenn es in den nächsten Tagen auch die deutschen Leser erreicht, besteht womöglich die Gefahr, dass es Applaus von der falschen Seite bekommt. Formal wurde es schon mehrfach mit Walter Kempowskis Echolot verglichen, denn auch Menschenrauch ist eine groß angelegte Textmontage aus Originalzitaten, beginnend mit einer Bemerkung von Alfred Nobel aus dem Jahr 1892, zitiert nach den Memoiren Bertha von Suttners, und endend mit einem Tagebucheintrag des rumänischen Schriftstellers Mihail Sebastian vom 31. Dezember 1941. Im Unterschied zu Kempowski erlaubt sich Baker aber, gelegentlich sardonische Kommentare aus eigener Feder einzustreuen. Auch seine Auswahl ist nicht um ein möglichst weites Panorama bemüht, sondern auf einen Brennpunkt der Erkenntnis hin fokussiert. So meinte der Rezensent der Welt nach dem Erscheinen des Originals, Baker wolle „nicht die Bandbreite dessen vorführen, was damals geschah, sondern eine These beweisen.” (Hannes Stein: Churchill soll Hitler zum Krieg angestachelt haben; in: Welt online v. 13. März 2008.)
Von den immerhin 634 Seiten dieser Beweisführung sollte man sich übrigens nicht allzu sehr einschüchtern lassen, denn der Autor hat zwischen den einzelnen Zitaten viel Platz zum Nachdenken gelassen. Baker erklärte dies im Interview so: „Zwischen den Fragmenten gibt es viel leeren Raum auf den Buchseiten. Mit diesem Raum können Sie als Leser anstellen, was Sie wollen. Sie können Ideen hinzufügen, Sie können widersprechen, weinen oder auch Partei ergreifen. Auf jeden Fall aber werden Sie zum aktiven Teilnehmer, denn ich gebe Ihnen nicht einmal eine Einführung vor. Ich schicke Sie nur los, und dann müssen Sie sich selbst im Wust der widersprüchlichen, komplizierten Ereignisse zurechtfinden.” (Susanne Weingarten: „Dieses Gefühl der inneren Qual”; Interview mit Nicholson Baker in Boston; in: Spiegel online v. 5. Mai 2008.) – Die teils vernichtenden Kritiken aus dem englischsprachigen Raum bestreiten eben diese vorgebliche Neutralität von Bakers Textauswahl in Human Smoke. Vielleicht könnte man die weißen Flächen ja dazu nutzen, gezielt solche Zitate einzufügen, die seiner These zuwiderlaufen? Aber jetzt warte ich zunächst einmal aufs Eintreffen des Buches. – Nicholson Baker: Menschenrauch. Wie der Zweite Weltkrieg begann und die Zivilisation endete. A. d. Am. v. Sabine Hedinger und Christiane Bergfeld. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 2009.
Posted in Langsamkeit, Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Krieg dem Kriege (II)
Sunday, 01. March 2009
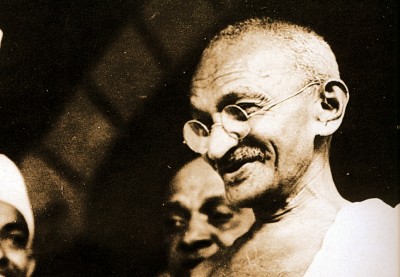
Es ist immer der gleiche Streit. „Nie wieder Krieg!” So fordern die absoluten Pazifisten und erklären jede Art von Bewaffnung, auch für die Selbstverteidigung, zu Teufelswerk. Ihnen treten die pragmatischen Pazifisten entgegen, die dergleichen Rigorismus für passiven Selbstmord halten und die Inkonsequenz für unvermeidlich, einen inhumanen Aggressor mit Waffengewalt entwaffnen zu müssen – natürlich so human wie eben möglich.
Der Musterfall einer vermeintlich legitimen Befriedung der Welt mit kriegerischen Mitteln ist der zweite Weltkrieg. Nach dem Sieg der lauteren Westmächte über die hitlersche Barbarei suchten alle hinfort Krieg führenden Parteien, die etwas auf sich hielten, zu ihren jeweiligen Kontrahenten ein ähnlich überzeugendes moralisches Gefälle zu behaupten. Bis in die allerjüngste Gegenwart werden bewaffnete Konflikte zugleich als ideologische Medienfeldzüge ausgetragen, so wenn Palästinenser von israelischen Geschossen zerfetzte Kinder durch die Straßen von Gaza tragen und Israelis Beweise vorlegen, dass diese Kinder von der Hamas bewusst als menschliche Schutzschilde ihrer Waffenlager missbraucht und somit kaltblütig geopfert wurden.
Der Krieg der Alliierten gegen die Achsenstaaten ist dabei das unerreichte Vorbild eines über jeden Zweifel erhabenen, gerechten Krieges. Der Holocaust in all seiner nachträglich offenbar gewordenen, unvergleichlichen Infamie bringt jeden Einwand gegen die Berechtigung dieser Schlächterei zum Verstummen. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis die Leiden der Zivilbevölkerung im Deutschen Reich unter den Flächenbombardements der Briten und Amerikaner überhaupt nur angemessen dargestellt werden durften. Dass der glorreiche Sieg der Alliierten über Hitler nur durch die Teilnahme eines Verbündeten möglich war, der diesem an Menschenverachtung und rücksichtslosem Vernichtungswillen kaum nachstand, musste zudem als leider unvermeidbarer Schönheitsfehler hingenommen werden. Man kann eben nicht alles haben, zumindest nicht auf einmal.
Als all dies noch nicht entschieden war, schrieb Klaus Mann am 15. Juli 1940 in Los Angeles: „Heute nachmittag lange Unterhaltung mit Christopher Isherwood. Er ist mir so lieb, so brüderlich vertraut, und doch bringe ich für seine neue Entwicklung kein rechtes Verständnis auf. Zusammen mit Aldous Huxley und dem Philosophen Gerald Heard – oder unter ihrem Einfluß? – gerät er immer tiefer in den Bann einer indischen Mystik, zu deren ethischen Prinzipien die unbedingte Ablehnung der Gewalt gehört: eben jener absolute Pazifismus also, gegen den Masaryk sich in seiner Debatte mit Tolstoi wendet. Nicht, als ob ich die Anwendung von Gewalt weniger verwerflich fände als irgendein Isherwood, Huxley oder Heard! Und nun gar der moderne Krieg! Wem graute nicht vor seinem mörderischen Stumpfsinn, seiner apokalyptischen Idiotie? Man muß ein hysterischer Romantiker wie Ernst Jünger sein, um an den öden Schrecken der ,Materialschlacht‘ Gefallen zu finden. Als gesitteter Mensch ist man natürlich Pazifist, was denn sonst? – Fragt sich nur, ob wir im vorigen Herbst noch die Wahl zwischen Krieg und Frieden hatten oder ob nicht damals die Entscheidung längst gefallen war. Ein Krieg, der unvermeidlich geworden ist, läßt sich nicht mehr ,ablehnen‘, sondern nur noch gewinnen. Warum wurde der Krieg unvermeidlich? Als ob wir es nicht wüßten! Weil die Demokratien dem Fascismus Vorschub leisteten, sei es aus mißverstandenem ,Pazifismus‘, sei es aus weniger vornehmen Motiven … Indem man Hitler tolerierte, finanzierte und protegierte, verscherzte man sich den Frieden. Nun fehlte nur noch, daß man ihn siegen ließe! Dann wäre der Krieg permanent. – Willst du das, Christopher Isherwood? Nein, natürlich nicht! – Und bestehst doch darauf, daß der Krieg ,das schlimmste aller Übel‘ sei? Es gibt ein schlimmeres, my dear friend. Stelle dir die ,Neue Ordnung‘ vor, die ein siegreicher Hitler etablieren würde, und du weißt, was ich meine. – Der Sieg der Demokratie aber könnte den Frieden bringen. (Ich wage nicht zu sagen: wird …)” (Klaus Mann: Der Wendepunkt. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1953, S. 431.)
Es war höchste Zeit, die Glorifizierung der alliierten Motive zu Beginn des Zweiten Weltkriegs einer kritischen Revision zu unterziehen – und sei es nur, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass auch nach gründlicher Prüfung aller Quellen kein anderer Schluss als der bisherige möglich ist, der da lautet: Großbritannien und Frankreich haben am 3. September 1939 richtig gehandelt, als sie Deutschland den Krieg erklärten. Nun hat sich ein US-amerikanischer Romancier genau an diese überfällige Aufgabe gemacht und ist zu einem überraschend anderen Ergebnis gelangt.
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | 2 Comments »
Friday, 27. February 2009

Als eine westliche Literaturwissenschaftlerin den chinesischen Romancier Qian Zhongshu (1919-1998) besuchen wollte, riet dieser ihr am Telefon dringend davon ab, mit der Begründung, „wenn einem ein Ei geschmeckt habe, müsse man nicht unbedingt die Henne besuchen.” (Monika Motsch im Nachwort zu Qian Zhongshu: Die umzingelte Festung. A. d. Chin. v. Monika Motsch u. Jerome Shih. Insel: Frankfurt am Main, 1988; hier zit. nach Christoph Bartmann: Die Freude des begnadigten Verbrechers; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 47 v. 26. Februar 2009, S. 14.)
Dieses schlitzäugige Understatement! Diese asiatische Bescheidenheit! Bewundernswert. Und dabei sehr geschäftstüchtig, denn kein Werbetext für das Buch und keine Rezension kommt ohne die Anekdote mit dem Henne-Ei-Autor-Buch-Vergleich aus.
Aber was will uns Qian Zhongshu hier weismachen? Dass die „Geschmacksvielfalt” von Romanen ähnlich begrenzt ist wie die von Eiern, nämlich auf die zwei Geschmacksrichtungen „wohlschmeckend” und „nicht wohlschmeckend”? Nun gut, es gibt verschiedene Arten, Eier zuzubereiten. Aber wenn mir ein mit ungewöhnlichem Geschick besonders appetitlich zubereitetes Ei gut schmecken würde, dann käme ich nicht auf die Idee, die Henne kennenlernen zu wollen, sondern wenn schon dann den Koch.
Ein Ei gleicht dem anderen, die Ähnlichkeit von Eiern ist nicht umsonst sprichwörtlich. Aber niemandem fiele wohl ein, von zwei Romanen, egal welchen, zu sagen, dass sie sich glichen wie ein Ei dem anderen.
Der Autor wollte keine Auskunft über sich geben. Das kann viele Gründe gehabt haben und ist wahrlich kein Einzelfall. Autoren, die zu wenig von sich preisgeben, sind mir aber allemal lieber als solche, die es damit übertreiben. Auch wenn das Gleichnis vom Ei und der Henne etwas schief hängt, ist mir solche Zurückhaltung unbedingt sympathischer als der abgestandene Bericht vom Unterwegssein eines eitlen und selbstgerechten Deutschen von Deutschland nach Deutschland. Insofern wäre Qian Zhongshu der Literaturnobelpreis des Jahres 1999 zu gönnen gewesen. Den hat wohl nur deshalb ein anderer erhalten, weil der Chinese im Jahr zuvor verstarb.
Posted in Unica, Würfelwürfe | Comments Off on Henne oder Ei
Thursday, 26. February 2009

Unsere Vorfahren im Jungpaläolithikum, also etwa um 35.000 bis 10.000 v. Chr., fertigten säuberlich gemeißelte Messer [s. Titelbild], die bis zu 26 Zentimeter lang, aber nur einen Zentimeter dick sind und sich mit den modernsten industriellen Verfahren nicht nachbilden lassen. (Marvin Harris: Kannibalen und Könige. Aufstieg und Niedergang der Menschheitskulturen. A. d. Am. v. Volker Bradke u. a. Frankfurt am Main: Umschau Verlag, 1978, S. 19 f.)
Unsere Fortschrittsvergötzung täuscht uns darüber hinweg, dass jede unserer Errungenschaften mit einem Verlust erkauft wird. Was wir verlernt und vergessen haben, wissen wir naturgemäß nicht mehr, spüren wir nicht, entbehren wir nicht. Darum wähnen wir uns jederzeit „auf der Höhe” unseres Könnens. Wie naiv!
Und dabei sind die verlorenen Künste, die durch solche steinernen Zeugen ahnbar gemacht werden, ja nur ein Kinkerlitzchen vom verschollenen Großen und Ganzen. Welche Gesten mögen spurlos verschwunden sein in den vergangenen dreißig Jahrtausenden, welche Gefühle, welche Fertigkeiten des Verstehens und Genießens?
Auch eine Stradivari oder Guarneri können wir nicht mehr bauen. Die Handwerkskunst ihrer Herstellung ist gerade einmal 300 Jahre alt und dennoch längst schon ausgestorben. Nie wieder erreicht ein Jongleur die Geschicklichkeit des legendären Enrico Rastelli (1896-1931), der ein Dutzend Bälle gleichzeitig auf verschiedenen Stellen seines Körpers balancierte, sie die Plätze tauschen ließ, dabei Pirouetten und Überschläge vollführte, vom Kopfstand in den einarmigen Handstand wechselte – und all dies ohne jede Verkrampfung, mit unendlicher Leichtigkeit und Grazilität.
Auch die Kunst des Gedankenlesens ist vom Aussterben bedroht, wie das Heilen durch Handauflegen und das Übermitteln von Nachrichten mittels Morseapparat.
Posted in Unica, Würfelwürfe | 4 Comments »
Monday, 23. February 2009

Neulich sah ich wieder mal Buster Keatons Kurzfilm One Week von 1920. Mir fällt zu dem Häuschen, das der handwerklich unbegabte Bräutigam seiner Braut errichtet, stets das Oxymoron vom “genialen Dilettanten” ein.
Komischer Zufall, dass 1981 beim Festival Genialer Dilletanten im Berliner Tempodrom auch Blixa Bargeld und seine Einstürzenden Neubauten auftraten, die sich seit dem Einsturz der Kongresshalle so nannten.
Dieses Gebäude hieß bekanntlich im Volksmund “Schwangere Auster”. Am Tag, als ich zum ersten Mal Vater geworden war, verließ ich den Kreißsaal und kaufte eine Zeitung. Auf der Titelseite wurde der Einsturz der “Schwangeren Auster” gemeldet.
Franz Schuh stellt die unfreiwillige Komik des Ungeschickten in den schiefen Rahmen eines Lobs der Nutzlosigkeit: “In einem Film baut Buster Keaton ein Haus für sich und die frisch Angetraute. Die Komik beim Hausbauen mag daran erinnern, daß es nicht immer leicht ist, ein Heim zu errichten, in dem man – auf der Grundlage des einander gegebenen Ja-Wortes – bis auf weiteres geborgen west. Man macht einen Plan, und für den Zuschauer ist es lustig, wenn er auf spektakuläre Art nicht funktioniert – auch weil in Keatons Film ein Feind dazwischengefunkt hat. Der Feind trägt den schönen Namen: Rivale. Der Rivale hat die Bestandteile des Hauses umnumeriert – Keaton wird zum freien Architekten jenseits seiner eigenen Pläne. Er baut ein in alle Richtungen hin windschiefes Haus.” (Franz Schuh: Schwere Vorwürfe, schmutzige Wäsche. Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2006, S. 85.)
Mein Weblog ist auch ohne dazwischenfunkende, umnummerierende Rivalen durcheinander, windschief, schwanger. Ob’s dilettantisch ist? Ob’s genial ist? Ich selbst wohne ganz gemütlich drin, bald schon ein Jahr. Wenn Gäste kommen, zeige ich auf das Schild neben der Haustür: “Betreten auf eigene Gefahr!”
Posted in Nonsens, Würfelwürfe | Comments Off on Windschief
Monday, 16. February 2009

Das war der Teufel. Morgen geht’s weiter in alter Frische.
Posted in Würfelwürfe | 4 Comments »
Sunday, 15. February 2009

Heute keine Christ-Birne wegen teuflischer Zahnschmerzen.
[Titelbild von Wilhelm Busch aus: Der hohle Zahn.]
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Tuesday, 10. February 2009

[Wahnsitz von April 1988 bis September 1991.]
Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Wohnsinn (VIII)
Monday, 09. February 2009

[Wahnsitz von Mai 1984 bis März 1988.]
Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Wohnsinn (VII)
Sunday, 08. February 2009

[Wahnsitz von Januar 1980 bis April 1984.]
Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Wohnsinn (VI)
Thursday, 05. February 2009

[Wahnsitz von Juli 1977 bis August 1978.]
Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Wohnsinn (IV)
Wednesday, 04. February 2009

[Wahnsitz von Oktober 1975 bis Juli 1977.]
Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Wohnsinn (III)
Wednesday, 04. February 2009

[Wahnsitz von Dezember 1956 bis Mitte Oktober 1975.]
Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Wohnsinn (II)
Wednesday, 04. February 2009

[Wahnsitz von Juli bis Dezember 1956.]
Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Wohnsinn (I)
Monday, 02. February 2009

Was bleibt, nachdem nun diese 77 Jahre und 35 Tage gezählt sind? Ein Rechteck von 54 Quadratzentimetern, den einen Millimeter breiten schwarzen Rand mitgerechnet. Darin, rechtsbündig über dem Namen des Verstorbenen, seinen Lebensdaten und den Namen seiner engsten Angehörigen sowie dem Termin und Ort der Beerdigung, ein vieldeutiger Satz nach Michel de Montaigne: „Die Natur versteht ihre Sache besser als wir.”
Was noch? Bei einem seiner – nicht allzu zahlreichen – Leser wie mir: das Bedauern, dass hier wieder einmal jemand aus dem mächtigen Schatten eines Verwandten nie hat heraustreten können. Diesmal war’s der große Bruder, der wie zum Hohn seine Größe gleich mit im Namen führte. Und immer muss da ja im Hinterkopf der schmachvolle Verdacht schwelen, dass der geringere Erfolg sich teilweise auch noch von der strahlenden Prominenz des Namens herleitet, die der Bruder ihm verschafft hat. Gar Fälle von Verwechslung sind einzukalkulieren!
Aber dann bleiben vorzüglich seine Übersetzungen aus dem Englischen, insbesondere der Carroll’schen Alice-Romane, und hier wiederum an erster Stelle seine geniale deutsche Übertragung des Jabberwocky, den er Zipferlake nannte. Darauf muss man erst mal kommen!
Und schließlich bleibt sein letztes Buch, Was ist Was, das ich mir bei seinem ersten Erscheinen 1987 in der „Anderen Bibliothek” von Franz Greno in Nördlingen ausnahmsweise in der schon fast dekadent auf bibliophil getrimmten Vorzugsausgabe gegönnt habe: „Das Handbütten à Fleur mit eingeschöpften Blüten und Blättern der Auvergne lieferte Richard de Bas in Ambert d’Auvergne.” [s. Titelbild]
Und darin klingen jetzt die letzten Zeilen (S. 602) wie ein Epitaph (auf das Buch? oder die Menschennatur? oder auf sich selbst als Autor?): „Und noch nicht genug: denn jeder von uns hat ein solches kleines Buch in dem großen, ob geschrieben oder nicht, und jeder ein anderes – aber ein Buch jedesmal, und immer sagt es dasselbe: die Welt kann zu allem werden, was von ihr gewollt wird, wir müssen uns nur weitererfinden, erst so endlich bekommt das Schöne sein Recht übers Wahre, amen, das ist der Schluß, jetzt bin ich fertig.” (Und dann folgen doch noch zwei Wörter, die ich aber verschweige.)
Posted in Jabberwocky, Memento, Würfelwürfe | 3 Comments »
Saturday, 31. January 2009

Heute, am Monatsletzten, beende ich die Bettlektüre eines Buches, die ich am Neujahrstag begonnen habe: Uwe Tellkamps Der Turm (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2008). Der Roman bringt es auf knapp tausend Seiten und ist insofern eigentlich als literarisches Betthupferl aufgrund rein orthopädischer Bedenken eher ungeeignet. Dass ich dennoch vorm Einschlafen im Tagesdurchschnitt rund dreißig Seiten „geschafft” habe, obwohl mir gelegentlich ein bleiernes Gefühl in die Arme schlich, spricht immerhin für den Unterhaltungswert dieses, um die Verlagswerbung zu zitieren, „monumentalen Panoramas der untergehenden DDR”.
Die Kritik war sich einig, dass der Bachmann-Preisträger des Jahres 2004 damit wenn nicht sein Meisterwerk, so doch sein respektables Gesellenstück abgeliefert hat. Sie hat aber nach meinem Urteil nicht deutlich genug gemacht, dass Tellkamp mit diesem opulenten Buch den Versuch gewagt hat, die ehrwürdige Tradition des bürgerlichen Familienromans à la Buddenbrooks und die seit James Joyce florierende Erzähltechnik der Montage gänzlich disparater Stilmittel zum stimmigen Bild eines untergegangenen realsozialistischen Deutschen Reichs zu legieren. (Sabine Franke zählt in ihrer Rezension für die Frankfurter Rundschau „Briefe, Träume, Rückblenden, Fakten und konventionelle Erzählpassagen” auf; dabei sind es doch noch weitaus mehr.) Und diese vom vergleichsweise hohen Rang des Romans faszinierte Kritik vergisst leider zu erwähnen, dass der ebenso fleißige wie belesene Autor sich bei diesem Spagat letztlich die Beine ausreißt.
Dass Der Turm zudem noch als ein Schlüsselroman daherkommt, nimmt mich eher gegen ihn ein – denn neben meiner täglichen Pynchon-Lektüre möchte ich zu nachtschlafender Zeit eigentlich nicht mehr den Rechner anschmeißen, um dahinterzukommen, dass sich hinter Baron Arbogast kein Geringerer als Manfred von Ardenne verbirgt, Jochen und Philipp Londoner Vater und Sohn Kuczynski zum Vorbild haben und mit dem RA Sperber des Romans nur der mittlerweile verstorbene Manfred Vogel gemeint sein kann, der im Agentenschacher des Kalten Krieges eine unvergesslich-zwielichtige Rolle spielte.
Tellkamps mit langem Atem geschriebenes magnum opus ist, bei allen Einwänden gegen seine möglicherweise anbiedernde, effekthascherische Schreibe, nur selten langatmig. Ich bin immerhin gespannt, ob dieses bemerkenswerte Talent sich noch zu einem opus summum aufschwingen wird; hoffentlich ganz anders als Thomas Mann mit seiner Joseph-Tetralogie, die im bitteren Geschehen der fernen Völkerschlacht – meine Heimatstadt Essen wurde dem Erdboden gleichgemacht – keine andere Heimstatt finden konnte als in den Geborgenheiten schimmelnder Traditionen. Während dies geschah, löffelte der geistheilige Thomas Mann zitronensaftgewürzte Austern in seiner Villa in Pacific Palisades.
Auch wir intellektuellen Überflieger – wie Goebbels sagte: die „Intelligenzbestien” – müssen uns doch nicht bis zum Jüngsten Gericht gedulden, an dem wir das Scherbengericht zusammentragen. Da warten wir stattdessen lieber auf eine Erleuchtung, die sich von Traditionen gleich welcher Art freigemacht hat – noch im Diesseits.
Posted in Babel, Würfelwürfe | 7 Comments »
Friday, 30. January 2009

Meinem ersten „Einschwörer” begegnete ich, heute auf den Tag genau, vor 45 Jahren. Er hieß Henning H. und war mein Klassenkamerad und Sitznachbar auf der Albert-Schweitzer-Volksschule – so hießen die Grundschulen damals noch – in Essen-Rüttenscheid. Henning war in Sorge, dass ich eine seiner Missetaten unserem Lehrer, Herrn Brandstetter, petzen könnte. Ich beteuerte meine Loyalität und Verschwiegenheit, denn Henning war stärker als ich. „Schwör!” – so lautete sein erbarmungsloses Kommando. Ich hob Daumen, Zeige- und Mittelfinger: „Ich schwör!” – „Du musst dran lecken, sonst gilt es nicht.” So verlief meine Einweisung in den Ritus der Schwörerei, der mir ahnungslosem Tropf, von Haus aus ein atheistisches Kind, zuvor nahezu völlig fremd gewesen war. (Den Trick, beim Schwur Zeige- und Mittelfinger der anderen Hand hinterm Rücken zu kreuzen, was den Schwur ungültig macht – den kannte ich damals auch noch nicht.)
Seither bin ich nicht mehr in die Verlegenheit gekommen, meine Schwurfinger mit Speichel zu benetzen. Ich entging dem Fahneneid der Bundeswehr als fußkranker, zum Dienst an der Waffe untauglicher Schwerbehinderter und dem Beamteneid durch Tätigkeiten in der freien Wirtschaft. Lediglich vorm Standesamt hatte ich ein Treuegelöbnis zu leisten, „in guten und in schlechten Tagen”, aber dazu war nicht erforderlich, die rechte Hand zu heben. Mir scheint diese Schwörerei noch immer ein sehr zweifelhaftes Brauchtum zu sein, als stünde jedes üblicherweise ohne diese Geste gegebene Wort unterm Anfangsverdacht der Lüge – und würde erst durch den Eid in den Adelsstand heiliger Wahrheit erhoben. Leckt mich!
Und jetzt, da seit ein paar Monaten die globale Hütte brennt, sehe ich mich umstellt von Einschwörern verschiedenster Provenienz, die mich – ganz ähnlich wie Henning H. auf dem Schulhof vor 45 Jahren – dazu auffordern, die Finger zum heiligen Eid zu erheben, beleckt oder unbeleckt. Unsere Kanzlerin Angela Merkel will mich auf eine harte Konjunktur-Kur einschwören, nachdem sie eine Woche zuvor ihre hessischen Parteigenossen bereits auf den Wahlkampf eingeschworen hat. Na, ich bin ja glücklicherweise kein Hesse – und auch kein Franzose, sonst hätte mich Sarkozys Einschwörerei schon im Sommer 2007 in Rage gebracht. Fairness? Dafür bin ich immer zu haben. Aber wenn ein Mann wie der britische Premierminister Gordon Brown sie von seinen Untertanen per Eid fordert, balle ich dennoch aus Solidarität die Faust in der Tasche. Und auch sein Widersacher David Cameron kann mich nicht zum kontinentalen Mit-Schwur verleiten, wenn er seine Landsleute auf harte Zeiten einschwört.
Gibt’s die Schwörerei eigentlich auch bei den Juden? Offenbar schon, wenn man den doch so schwurerprobten Schweizern glauben darf. Und neuerdings haben wir noch einen weiteren Einschwörer zu ertragen, den Hoffnungsträger unserer hoffnungslos verrotteten Spezies, der man nicht viel mehr noch zu wünschen vermag, als dass sie ihren Abgang vom Globus mit möglichst geringen Folgeschäden für dessen restliche Biosphäre bewerkstelligt: Barack Obama. Seinen Eid hat der neue Präsident der USA zwar im ersten Anlauf nicht hingekriegt, und beim zweiten Versuch war die gelbe Lincoln-Bibel leider schon auf Reisen – aber darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an.
Insofern ist die Finanzkrise, die zu Produktionsrückgang, zum Beispiel in der Autoindustrie, und damit zu gedrosseltem CO2-Ausstoß führt, eigentlich doch ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und die Billionen-Verschuldung der Staaten zur Rettung der Not leidenden Banken, die künftige Generationen zurückzahlen sollen, muss uns auch kein Kopfzerbrechen bereiten, wenn es solche Generationen gar nicht mehr gibt. Angesichts solcher Zukunftsperspektiven sind mir der Zusammenbruch des Kapitalismus und die Sorgen der Anleger jedenfalls herzlich egal – ich schwör!
Posted in Oikos, Würfelwürfe | 3 Comments »
Thursday, 29. January 2009

Die Vorgeschichte ist schnell erzählt. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die katholischen Messen in lateinischer Sprache zelebriert. Die Gemeinde plapperte ein unverständliches Kauderwelsch nach, ritualisierte Formeln einer längst ausgestorbenen Sprache, die ihr wie die Zaubersprüche animistischer Religionen vorgekommen sein mögen – und sie vielleicht gerade deshalb beeindruckten. Dann sprang Martin Luthers für seine Zeit revolutionärer Gedanke, dass das gemeine Volk verstehen solle, was es zu glauben genötigt werde, wenngleich mit mehr als vierhundert Jahren Verspätung, von Wittenberg nach Rom über. Das von Papst Johannes XXIII. einberufene Zweite Vatikanische Konzil leitete eine Liturgiereform ein, die unter seinem Nachfolger Paul VI. zum Abschluss kam und die Einführung der Volkssprachen in den katholischen Gottesdienst ausdrücklich billigte.
Gegen diesen Bruch mit altehrwürdigen Traditionen begehrte der französische Erzbischof Marcel Lefebvre (1905-1991) auf, der die Ansicht vertrat, Paul VI. habe mit seinen „katastrophalen Neuerungen” der katholischen Kirche mehr Schaden zugefügt als die Französische Revolution. Er verweigerte dem Stellvertreter Christi auf Erden im Vatikan seinen Gehorsam, wurde von Paul VI. suspendiert und schließlich gar von Johannes Paul II. exkommuniziert, nachdem er gegen die ausdrückliche Weisung des polnischen Papstes am 30. Juni 1988 an vier seiner treuen Jünger – Bernard Tissier de Mallerais, Alfonso de Galarreta, Bernard Fellay und Richard Williamson – die Bischofsweihe vollzogen hatte.
Gut zwanzig Jahre später hat nun die Verständlichmachung der katholischen Glaubensinhalte Früchte getragen, die dem aktuellen Nachfolger auf dem Stuhl Petri, dem jetzt amtierenden Papst Benedikt XVI., vulgo Joseph Alois Ratzinger, nicht gefallen wollen. Ihm laufen in seinem Heimatland Deutschland und auch anderswo die Schäfchen von der Weide, weshalb er vor zwei Jahren zunächst die nach altem Römischen Ritus übliche „Tridentinische Messe” wieder erlaubte – und zudem vor ein paar Tagen die Exkommunikation der vier von Lefebvre geweihten Bischöfe aufhob. Dabei ist ihm allerdings ein kleiner Schönheitsfehler unterlaufen, denn einer dieser Herren, Richard Williamson, erwies sich bei näherer Betrachtung als „persona non grata”, gar als Obergangster vor jedem christlichen und weltlichen Richterstuhl: als Holocaust-Leugner und verbohrter Antisemit. (Was dieser offenbar völlig durchgeknallte Bischof sonst noch von sich gegeben hat, harrt noch der Entdeckung durch die hoffentlich um Aufklärung bemühten laizistischen Medien einer freien Welt. So vertrat Williamson etwa 2001 die Ansicht, dass Mädchen und Frauen nicht an Universitäten studieren sollten, und reihte sich in die paranoide Gemeinschaft jener Verschwörungstheoretiker ein, die ernsthaft glauben, 9/11 sei von der amerikanischen Regierung unter George W. Bush initiiert worden.)
Die Flurschäden, die der jetzt amtierende Papst alle paar Monate anrichtet, sind beträchtlich. Die Aussöhnung der Christen mit dem Judentum, so heißt es allenthalben, sei um hundert Jahre zurückgeworfen, die fleißigen Bemühungen seiner Vorgänger um eine Verständigung zwischen diesen beiden Weltreligionen habe Benedikt XVI. mit seiner unbedachten Rehabilitation eines offenkundig Verrückten zunichte gemacht.
Als hätte die Menschheit nicht andere Sorgen! Noch immer klebt ihr der Dreck am Schuh, in den sie vor Jahrtausenden getreten ist, da sie es noch nicht besser wissen konnte: dass nämlich kein jenseitiger Gott ist und keine ebenso finstere wie heiße Hölle droht als allein die auf Erden, in unserem zeitlich begrenzten Diesseits. – „Der Atheismus beruht auf der Erklärung der Menschenrechte. Die Staaten, die sich seither zu diesem offiziellen [?] Atheismus bekennen, befinden sich in einem Zustand dauernder Todsünde.” Diese Sätze stammen wohlgemerkt nicht von dem aktuell zum Stein des Anstoßes gewordenen Bischof Williamson, wohnhaft im argentinischen La Reja, sondern aus einer der letzten Predigten seines Lehrmeisters, des Erzbischofs Lefebvre, gehalten am 1. November 1990 in Ecône im Schweizer Kanton Wallis. (Ist es bloß ein dummer Zufall, dass Lefebvre die argentinische Militärjunta, wie übrigens auch das faschistische Regime in Chile unter Augusto Pinochet, als vorbildliche Regierung gepriesen hat?) – Ich bekenne mich zu den Menschenrechten – und nehme dafür den „Zustand dauernder Todsünde” gern in Kauf.
[Titelbild: Por una navaja von Francisco de Goya, aus seinen Desastres de la Guerra (1810-1814).]
Posted in Godzilla, Würfelwürfe | 5 Comments »
Wednesday, 28. January 2009

Hans Siemsen, der in seinem Reisebericht aus dem Sowjetstaat mit mildem Spott anmerkt, dass der Taylorismus und die Ford’sche Fließbandproduktion, nach dem allbeherrschenden Prinzip „Tempotempo!”, im Kommunismus keineswegs abgeschafft sind, sondern durch die gnadenlosen Vorgaben des ersten Fünf-Jahres-Planes eher noch eine Verschärfung erfahren haben, relativiert diese Diagnose an anderer Stelle durch seine Beobachtung, dass jeder russische Industriearbeiter in einer deutschen Fabrik unweigerlich auffallen würde: „Vor allem durch Langsamkeit.” (Rußland – ja und nein. Berlin: Ernst Rowohlt Verlag, 1931, S. 164.) Gegen das Phlegma der russischen Volksseele kehrt offenbar selbst Stalins „harter Besen” vergebens.
Und in den klimatisch milderen Regionen, am Asowschen und Schwarzen Meer, registriert er gar mit erkennbarem Wohlbehagen eine „Kultur der Langsamkeit”, die ihn fast an mediterrane Lässigkeit erinnert: „Vom Balkon des Hotels [in Rostow am Don] sehen wir hinunter auf die Straße. Es ist Ende September [1930]. Ein schöner, warmer Abend, wie in Berlin ein Sommerabend. In Moskau hatten wir schon gefroren. In Moskau habe ich nie einen Menschen ,spazieren gehen‘ sehen, alle waren immer so ernsthaft eilig. In Rostow ,flaniert‘ man. Liebespaare flirten langsam die Schaufenster entlang. Es gibt Läden mit Wein und Obst und schrecklichen Nippsachen. Die ganze Straße ist voll von Menschen, die, da es Abend ist, spazieren gehen. – Die ausländischen Journalisten auf dem Balkon sind ganz erstaunt. Sie kommen aus Moskau. Sie haben sowas noch gar nicht gesehen in Rußland. ,Das ist ja wie in Paris!‘, sagt einer zum andern. Der weiß es besser. ,Wie in Marseille!‘ sagt er. Und ein Dritter weiß es am besten: ,Ein Arbeiterviertel in Paris oder Marseille.‘ Aber alle sind sich darin einig, daß Rostow ganz was anderes ist als Moskau, hübscher, leichter, nicht so ernsthaft und streng. Verwegene sprechen von ,Eleganz‘. ,Sehen sie bloß! Da geht einer mit einem weißen Leinenanzug und einer knallbunten Krawatte.‘” (Ebd., S. 190.)
Müsste uns nicht längst schon die traurige Erkenntnis dämmern, dass die drei großen Ideale der Französischen Revolution – „Liberté, égalité, fraternité” – von vornherein zum Scheitern verurteilt waren, weil sie die naturgegebenen klimatischen Unterschiede zwischen den Weltregionen nicht in Rechnung stellten? Sind nicht alle hehren Versöhnungswünsche, von Christus bis zum jüngsten Shootingstar eines trotzigen Optimismus, Barack Obama, allein schon deshalb ins Leere gesprochen, weil es etwa in Sibirien unerträglich kalt und in weiten Teilen Afrikas unerträglich heiß ist? Die Staatsgrenzen, machen wir uns nichts vor, sind doch bei aller vorgeblichen Globalisierung vor allem Abwehrzäune der klimatisch bessergestellten Bevölkerungen, die ihr natürliches Privileg nicht mit den hungernden, frierenden und dürstenden Artgenossen teilen wollen.
Als komplizierende Faktoren kommen noch hinzu die ungleiche, gänzlich „ungerechte” Verteilung der Bodenschätze, die unabsehbaren Folgen des Klimawandels und das nach wie vor exponentielle Wachstum der Weltbevölkerung. Schlechte Aussichten für Homo sapiens.
Flanieren wir Happy Few doch ganz gelassen dem Untergang entgegen! Eile ist nicht geboten. Wir kommen schon noch früh genug ans Ziel.
Posted in Flanerie, Langsamkeit, Siemsen, Würfelwürfe | 2 Comments »
Tuesday, 27. January 2009

Die große Zeit des Varietés wird Ende dieses Monats wohl endgültig zu Grabe getragen, wenn im „neuen” Wintergarten in der Potsdamer Straße in Berlin der letzte Vorhang fällt. Schaut man zurück, so war die Renaissance der Varieté-Theater seit den 1980er-Jahren wohl nicht viel mehr als das letzte Aufflackern eines in der ersten Jahrhunderthälfte so überaus erfolgreichen Unterhaltungsangebots in den Großstädten der westlichen Welt. Nostalgie und das atemberaubende Erlebnis unmittelbarer Erfahrung artistischer Glanzleistungen allein erweisen sich spätestens angesichts der aktuellen Weltfinanzkrise für das zahlende Publikum der bürgerlichen Mittelschicht als zu schwache Motive, sich für einen Abend im Varieté aus dem Fernsehsessel hochzuschwingen.
Um 1900 gab es in der Reichshauptstadt Berlin nahezu 80 Varieté-Theater, unter denen der Wintergarten am Bahnhof Friedrichstraße seit 1889, neben dem benachbarten Apollo-Theater, als „erste Adresse” galt. Solche Vergnügungsstätten eröffneten zunächst den Zirkuskünstlern – Clowns, Jongleuren, Zauberern, Pantomimen, Dresseuren und Trapezartisten – die willkommene Gelegenheit, in der kalten Jahreszeit zu überwintern. Bald bot sich diesen Reisenden in Sachen Amüsement hier aber zudem die Chance, sich vor einem anspruchsvolleren Publikum als die jeweils Besten ihres Genres bekannt zu machen und damit den Sprung aus dem Sägemehl der Zeltarena aufs noblere, blitzblank polierte Parkett einer weltstädtischen Bühne zu schaffen. So gelten die Clowns Charlie Rivel und Grock, der Wunderjongleur Enrico Rastelli [s. Titelbild] und der Entfesselungskünstler Harry Houdini, die alle auch im Wintergarten auftraten, selbst heute noch als bekannte Meister ihres Fachs, während ungezählte weniger virtuose Zirkuskünstler jener Zeit längst vergessen sind.
Es ist wohl eine tragische Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet im Berliner Wintergarten am 1. November 1895 eine brandneue Volksbelustigung ihre Premiere feierte, die diesem und allen ähnlichen Etablissements, rückblickend betrachtet, den Todesstoß versetzen sollte. An jenem denkwürdigen Tag führten die Brüder Max und Emil Skladanowsky dort als „Schlussnummer” zum konventionellen Varieté-Programm mit ihrem „Bioscop”, erstmals in Deutschland und mit großem Erfolg, acht Kurzfilme vor. Die Berliner Filmpioniere blieben in der Konkurrenz zu den Pariser Gebrüdern Lumière und deren „Cinématographe” schon bald auf der Strecke, wohl auch deshalb, weil sich im Deutschen Reich kein gut betuchter Förderer für ihre zukunftsweisende Erfindung fand.
Und jetzt haben wir den Salat. Nachdem im „alten” Wintergarten am 21. Juni 1944 – Stauffenberg, der neue Kinoheld unserer Tage, bereitete gerade sein gescheitertes Attentat vor – das letzte Varieté-Programm über die Bühne gegangen war und bald darauf „Bomber Harris” diesen Kulturtempel in Schutt und Asche gelegt hatte, war es eine Großtat ambitionierter Freunde der Kleinkunst wie André Heller und Bernhard Paul, dass der Wintergarten 1992 an neuer Stelle seine Wiederauferstehung erleben durfte.
Damit ist nun in wenigen Tagen auch wieder Schluss. Achtundsechzig feste Arbeitsplätze bleiben auf der Strecke, von der Platzanweiserin bis zum Impresario. Ein großer Name, der Wintergarten, geht damit wohl endgültig unter. Und Baggesen, der in diesem Etablissement seine größten Triumphe feierte, ein langsamer Leisetreter unter den blitzschnellen Jongleuren seiner Zunft? Der ist ohnehin schon längst vergessen.
Posted in Eccentrics, Würfelwürfe | Comments Off on Wintergarten
Monday, 26. January 2009

Die besagte Esche hinterm Haus ist längst nicht mehr schneebestäubt, der Himmel wieder blau – und die Sonne lässt das winterfeste Gewächs im Vordergrund und das Nadelgehölz ringsum grün aufleuchten.
Die Esche, „meine” Esche, steht aber nackt da und wird noch für viele Wochen so sein. Wie überstehen die entlaubten Bäume dieser Art bloß die kalte Jahreszeit? Wenn sie es mir verraten könnten, hätte ich wohl einiges von ihnen zu lernen.
Aber auch als stummes Monument der Winterschläfrigkeit ist Yggdrasils täglicher Anblick für mich mehr als ein unlösbares Rätsel. Umso mehr, als es, das Bäumchen, nun seine Hoffnung auf einen neuen Blattaustrieb richten kann.
Sind Bäume männlich oder weiblich? Ich bin überzeugt, dass „der Baum” ein grammatischer Missgriff der deutschen Sprache ist. Selbstredend müsste es „die Bäumin” heißen, oder gar „die Baum”. Der Kaktus, ja, das mag hingehen.
Bei den spezielleren Namen der einzelnen Baumarten ist die Sprache klüger: die Pappel, die Birke, die Tanne, die Buche, die Fichte, die Zeder, die Eiche, die Kastanie, die Linde, die Ulme, die Eibe, die Erle, die Kiefer – und eben auch die Esche. (Lediglich der Ahorn tanzt aus der Reihe, als bemerkenswerter Sonderfall.)
Posted in Würfelwürfe, Yggdrasil | 5 Comments »
Sunday, 25. January 2009

Den getreuen, zuverlässig bruchsicheren Hebel anzusetzen hieße heute, / unzeitgemäße Verachtung zu zeigen: welch animalische Gebärde, / ein wildes Zucken um die unvermessenen Mundwinkel spielen zu lassen, / kaum bedenkenswert. Unverstanden.
Drum hülle ich mich lieber in sonntägliches Schweigen. / Einstweilen, vom blaugebläuten Himmel geleckt. / Bin ich denn noch ganz bei Trost? / Grins du nur in den fettfleckigen Spiegel, du Ausgeburt / fremdstämmiger Selbstkritik. Gehe in dich und verkümmre.
Kein Weg, so holzig er auch sei, / führt aus diesem Gestrüpp in die Ewigkeit. / Schade.
Wohin immer du zurückblickst, nirgends und überall / leuchtet eine verheißungsvolle Finsternis. / Stattdessen: Mickymäuse, die Purzelbäume schlagen. Tarzans Lianen. / Die speziellen Ausformungen mehr oder weniger geglückter / Wirbeltiere.
Ist doch wirklich ein Elend: dass / gerade wir, die Krone der Schöpfung / deren traurigen, ausrottbaren Rest aus verständnislosen Augen anglotzen, / auf den ölschluckenden Schnellstraßen / im Steakhaus / hinter den sprachlosen Fibeln der Verdammnis.
Posted in Babel, Würfelwürfe | Comments Off on Kannitverstan
Saturday, 24. January 2009

„Unkaputtbar” – mit diesem Neologismus bewarb Coca-Cola in Deutschland 1990 die Einführung der PET-Pfandflaschen. Zwar hat es das neue Adjektiv noch nicht in den Duden geschafft, aber im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich‘s längst durchgesetzt, was über hunderttausend Belegstellen bei Google bezeugen. Ein Konsum- bzw. Gebrauchsartikel, der angeblich nicht kaputtgehen kann, scheint also damit in neuerer Zeit wieder einen hohen Kaufanreiz zu bieten. Das ist nur zu verständlich, denn bis dahin hatten sich in der kapitalistischen Warenproduktion dem ganz entgegengesetzte „Werte” durchgesetzt, die nun zunehmend in Verruf gerieten. Es herrschte zuvor eine Ex-und-hopp-Mentalität. Wenngleich möglichst billige, jedoch entsprechend kurzlebige Erzeugnisse fanden reißenden Absatz. Die Ergebnisse soliden Handwerks fristeten neben den Wegwerfprodukten der Massenproduktion nur noch ein Nischendasein für Besserverdienende.
Als wir vor vier Jahren wieder mal umzogen, leisteten wir uns einen neuen Staubsauger. In unserer aktuellen Mietwohnung liegt, noch vom Vormieter, eine dunkelblaue „Auslegeware”, Loriot lässt grüßen. Unsere Hündin Lola ist blond. Mindestens zweimal pro Jahr kommt sie in die Mauser, das sieht man auf dem blauen Teppich dann sehr. Folglich entschieden wir uns für einen Sauger, dem wir zutrauen, diesem wiederkehrenden Problem mit speziellen Düsen begegnen zu können. Unsere Wahl fiel auf den AEG Electrolux Twinclean, einen Bodenstaubsauger, der ohne die unsäglichen Tüten auskommt, also auf ein Stiefkind der genialen Erfindung von Sir James Dyson. Diesen Staub- und Haarfresser ließen wir uns damals rund 350 Euro kosten. Was tut man nicht alles für seinen Hund!
Bis vor ein paar Tagen leistete uns der Sauger gute Dienste, wenngleich er immer mal wieder kurzfristig streikte. Eine rote Warnleuchte blinkte dann auf, Twinclean war außer Atem gekommen und bat um eine Verschnaufpause. Auch die rotierenden Bürsten blockierten gelegentlich, wenn sich allzu viele blonde Hundehaare in ihnen verfangen hatten. Aber mit solchen Arbeitsunterbrechungen lernt man als geprüfter Hausmann zu leben. Zwischenzeitlich las ich dann in Peter Moslers Die vielen Dinge machen arm.
Als wirklich praktisch erwies sich auch, dass wir unser staubsaugendes „Haustier” an der langen Leine führen konnten. Dafür sorgte ein Kabelaufroller. Nach dem Druck auf eine besondere Taste schnurrte die viele Meter lange Schnur zurück in seinen dicken Bauch. Bis vor ein paar Tagen. Dann versagte dieser devote Service plötzlich und ohne erkennbaren Grund seine satt schnackende Gefälligkeit. – Ulla schraubte das dienstbare Gerät auf und kämpfte sich tapfer bis zum Auslöser seiner hoffentlich nur vorübergehenden Betriebsstörung vor. Der zauberhafte Rückwickelmechanismus wurde von einer gespannten Metallfeder [s. Titelbild] bewirkt, die sich – warum auch immer – verheddert hatte. Der tief im Plastikbauch unseres Saugers versteckte Aufroller erwies sich beim besten Willen als absolut irreparabel. Reklamationsfristen sind nach vier Jahren selbstverständlich längst abgelaufen. Wenn ich nun an dieser Stelle von einer böswillig beabsichtigten „Sollbruchstelle” des Herstellers sprechen würde, zöge er mich vielleicht vor den Kadi, wegen geschäftsschädigender übler Nachrede.
Nun tröste ich mich erstens mit dem kreativen Einfall, dass vielleicht der defekte Kabelrückspul-Mechanismus des Saugers durch einen externen Kabelaufwickler ersetzt werden kann. Zweitens rede ich mir ein, dass dieser ganz außergewöhnliche Unglücksfall keinerlei Rückschlüsse auf die Fertigungsqualität moderner Industrieprodukte zulässt: Honi soit qui mal y pense! Drittens unterstelle ich meiner Frau, dass sie durch unsachgemäße Handhabung unseres sonst doch bisher so treuen Staubsaugers dessen Versagen selbst ausgelöst hat. Und viertens frage ich mich, warum denn bloß der brave Staub, Niederschlag einer unbekümmerten Endzeitlichkeit, sub specie aeternitatis in dermaßen schlechtem Ansehen steht.
Posted in Dingwelt, Würfelwürfe | 1 Comment »
Friday, 23. January 2009

Da hat nun also der Mann aus Honolulu zu seinem Amtsantritt eine tatsächlich jeden denkenden und zugleich empfindsamen Menschen bewegende Rede gehalten, die man im vollständigen Wortlaut überall auf der Welt nachlesen kann – und die mir vorgestern in deutscher Übersetzung von meiner Tageszeitung zum Frühstück serviert wurde. (Süddeutsche Zeitung Nr. 16 v. 21. Januar 2009, S. 2.)
“We Have Chosen Hope Over Fear”. – „Wir haben die Hoffnung über die Furcht gestellt”. Unter diesem Titel kündigt der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika einen Systemwandel, einen politischen Wetterwechsel, eine Rückkehr zu alten Tugenden, eine moralische Erneuerung der Weltmacht Nr. 1 an, die man nach den schier endlos scheinenden, bitter missglückten acht Amtsjahren seines Vorgängers kaum mehr für möglich gehalten hätte.
Ich bin meiner Tageszeitung noch heute dafür dankbar, dass sie mich früher als alle anderen Medien hierzulande darüber unterrichtete, welch vielversprechenden Kandidaten die Democratic Party da ins Rennen um die Präsidentschafts-Kandidatur geschickt hatte. Das dürfte wohl nun schon fast zwei Jahre her sein. Meinem Arbeitskollegen am gegenüberliegenden Schreibtisch – ich war da noch „in Arbeit” – rief ich damals zu: „Merken Sie sich mal den Namen Barack Obama. Das ist der nächste Präsident der USA.” Und später hoffte und bangte ich monatelang im kräftezehrenden Vorwahlkampf „meines” Kandidaten gegen seine Parteigenossin Hillary Clinton, gegen jene Frau, die ihrem Ehegatten, dem 42. Präsidenten der Weltmacht, den Blowjob mit seiner Praktikantin verziehen hatte, dass Barack Obama trotzdem und obwohl sein Name so fatal an den des Staatsfeinds Nr. 1, Osama bin Laden, erinnerte, schließlich den Sieg davontragen würde. Das ist nun alles Vergangenheit.
Was ich meiner Tageszeitung, der Süddeutschen, allerdings nie verzeihen werde, das ist ein Fauxpas, der außer mir vermutlich keinem ihrer Leser aufgefallen sein dürfte. Im Text der Obama-Rede hebt die SZ einige Passagen rot hervor, um ihre besondere Bedeutung in Marginalien zu kommentieren. Dass Barack Obama sein Land als „eine Nation von Christen und Muslimen, Juden und Hindus – und von Atheisten” bezeichnet, wertet die SZ-Redaktion, wohl zu Recht, als „Novum in einer Inaugurationsrede. Obama zählt auch die Muslime, Juden, Hindus und Atheisten zu den Bürgern, welche die Grundlage der amerikanischen Nation bilden.”
Mal abgesehen davon, dass Obama die fünfte Weltreligion, den Buddhismus, in seine Aufzählung nicht aufnahm und somit auch den Dalai Lama brüskiert haben dürfte, befremdet mich, dass meine Frühstückszeitung die believer in fettem Rot hervorhebt, die non-believer hingegen in tristem Schwarz belässt [s. Titelbild]. Da war offenbar in der Schlussredaktion der SZ ein Praktikant zugange, der sonntäglich den Klingelbeutel durch St. Peter trägt.
Posted in Godzilla, Würfelwürfe | 10 Comments »
Wednesday, 21. January 2009

Schon von Weitem sehe ich, dass mit meiner Bank etwas nicht stimmen kann. Vor dem monumentalen Gebäude im Palazzo-Stil erhebt sich ein Baugerüst. Arbeiter in blauen Overalls sind damit beschäftigt, die Fassadenverkleidung aus weißem Carrara-Marmor abzuschälen und auf einen Lastwagen zu verladen. Auf meine Frage, was das denn zu bedeuten habe, erwidert ein breit grinsender Türke mit einem $$-Tattoo auf dem rechten Handrücken: „Das wird jetzt zu Geld gemacht.”
Beim Betreten der Schalterhalle trifft mich fast der Schlag. Dort, wo noch gestern imposante Kristalllüster hingen und diese Kathedrale des Geldverkehrs in gleißendem Licht erstrahlen ließen, baumeln nun nur noch ein paar vereinzelte Energiesparleuchten von der Decke herab, in deren zwielichtigem Schein sich mir ein Bild des Jammers darbietet. Unwillkürlich muss ich an die Kirche in Soylent Green denken, wo Lincoln Kilpatrick als farbiger Priester den Mühseligen und Beladenen im New York des Jahres 2022 eine dürftige Bleibe geschaffen hat [s. Titelbild]. Überall verstellen Notbetten den Weg zu den Kassenschaltern, bedecken Luftmatratzen und Schlafsäcke das bis vorgestern noch stets spiegelblank polierte Parkett, auf dem jetzt stöhnende, sabbernde, wimmernde Elendsgestalten sich zur letzten Ruhe gebettet haben. Etliche dieser traurigen Kreaturen strecken ihre flehenden Hände nach mir aus, betteln mich um ein paar Cent an, während ich mir mühsam einen Weg zu jenem „Infopoint” erkämpfe, an dem ich in den letzten dreißig Jahren Terminabsprachen mit den Sachbearbeitern der oberen Etagen vereinbarte.
„Was ist denn hier los?” Meine Frage, die ich an „Miss Moneypenny” gerichtet habe – ich nenne die dienstälteste Beschäftigte des Kreditinstituts meiner Wahl insgeheim schon seit Urzeiten so, weil sie tatsächlich verblüffende Ähnlichkeit mit Lois Maxwell in den frühen James-Bond-Filmen hat -, meine entsetzte Frage trifft auf völliges Unverständnis. „Aber haben Sie es denn noch nicht mitbekommen, Herr H.? Wir sind durch die Finanzkrise völlig verarmt. Die komplette Belegschaft musste entlassen werden. Ich bin die Letzte, die hier noch die Stellung hält, um unsere treuen Kunden zu ver-, äh, zu trösten. Wir mussten auf Anordnung der Stadtverwaltung unsere Räumlichkeiten zum Notasyl für Obdachlose umrüsten.” Flüsternd fügt sie hinzu: „Einige meiner ehemaligen Kollegen liegen auch auf den Pritschen.” Und mit nahezu ersterbender Stimme: „Dort hinten, der alte Mann mit dem hässlichen Hungerödem neben der Nase, das ist der ehemalige Vorstandschef der Bank. Und dabei hatte er doch immer so einen guten Riecher!” Verschämt stecke ich Moneypenny einen Zehn-Euro-Schein zu, den sie augenblicklich im Ärmel ihrer nicht mehr ganz sauberen Bluse verschwinden lässt: „Ich schäme mich so! Das ist alles soo furchtbar – sooo erbärmlich!” – Dicke Tränen perlen auf dunkle Augenringe …
Nachdem ich eben aus diesem Albtraum an meinen bescheidenen Schreibtisch zurückgekehrt bin, lese ich mit Verwunderung, dass die Jury der Sprachkritischen Aktion Unwort des Jahres das Wort von den „Not leidenden Banken” zum „Unwort des Jahres 2008″ gekürt hat. Unworte, so hatte ich bisher angenommen, seien solche sprachlichen Neubildungen, die in einem krassen, geradezu zynischen Widerspruch zu den politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Tatsachen in Deutschland stehen. Der durch diese verfehlte Jury-Entscheidung inkriminierte Begriff beschreibt aber doch die aktuelle Situation sehr zutreffend, wovon ich mich durch persönliche Inaugenscheinnahme soeben überzeugen musste.
Geld ist ja eigentlich nicht meine Welt. Und so war mein Hauptmotiv, warum ich mich hier zu diesem für mich nahezu bedeutungslosen Thema zu Wort gemeldet habe, ein ganz anderes. Ist es denn etwa nicht erschreckend, dass mittlerweile selbst die publicityträchtige Bekanntgabe eines solchen „Unworts”, auf der breiten Front der offenbar Ahnungslosen, in der zwar nicht falschen, aber doch veralteten Schreibweise „notleidende Banken” erfolgt? Wo doch der aktuelle Duden (24. Auflage, S. 735) seit 2006 ausdrücklich „Not leidend”, in getrennter Schreibung, als bevorzugte Variante empfiehlt? – Meine Sorgen möchte ich haben.
Posted in Rêverie, Würfelwürfe | 2 Comments »
Monday, 19. January 2009

Die Arbeitswoche lässt sich nicht gut an. Nachdem ich gegen Mitternacht noch in Raymond Martins Ich bin gut gelesen habe und dabei feststellen musste, dass mein Eccentrics-Beitrag nicht nur vor sachlichen Fehlern strotzt, sondern vermutlich auch in seinem Fazit ungerecht ist, schlief ich mit dem unerträglichen Gefühl ein, mich als Verräter geriert zu haben.
In einem Albtraum, aus dem ich gegen drei Uhr nachts schweißgebadet erwachte, hatte ich an Händen und Füßen gefesselt und nackt auf einem Thron gesessen, an dem die lange Reihe meiner Feinde vorbeidefilierte, um mir durch einen Metalltrichter allerlei eklige, giftige und unverdauliche Scheußlichkeiten einzuflößen. (Vermutlich verdankte ich diese unerträgliche Reminiszenz dem Auburtin-Feuilleton Gold, das ich gestern zum zweiten Mal las und in dem es heißt: „Der zweite Grad war jener berühmte Schwedentrunk. Zwei Soldaten gossen dem Liegenden durch einen Schlauch die Mistjauche in den Mund und drückten dann auf den Magen, daß die ekle Brühe hoch herausspritzte. Dreimal taten sie es, und nach jedem Mal fragten sie nach seinem Gold […].”) Diese Foltermethode erinnerte mich selbst im Traum noch vermutlich an den Film Cartouche, der Bandit, mit Jean-Paul Belmondo und Claudia Cardinale in den Hauptrollen, den ich im Vormittagsprogramm des ZDF sah, zerlegt in einen Zwei- oder Dreiteiler, Anfang der 1970er Jahre bei einem Freund aus dem Süthers Garten, dessen Mutter sich erfreulicherweise alltäglich zum Mittagsschlaf zurückzog und uns die Herrschaft über die Traumfabrik aus der Flimmerkiste überließ. Auch in diesem Film von Philippe de Broca (1962) wurde einem gefesselten Kampfgefährten des französischen Schinderhannes-Pendants ein solcher Trunk eingeflößt, was meine masochistischen Pubertätsphantasien heftig stimulierte.
Kein ganz unpassender Eintritt in einen Tag, an dem man Edgar Allan Poe zu seinem runden Geburtstag gratulieren möchte. In „irgendeiner kleinen Pension in der Haskins[-] oder Hollis Street im südlichen Teil von Boston” (Frank T. Zumbach: E. A. Poe. Eine Biographie. München: Winkler Verlag, 1986, S. 22) erblickte, heute auf den Tag genau vor zweihundert Jahren, der Sohn eines nicht gerade überaus erfolgreichen Schauspieler-Ehepaares das Licht dieser immerzu untergehenden Menschenwelt – Grund genug, diesem Großmeister des schwarzen Humors erneut meine Reverenz zu erweisen, nachdem ich seiner unbezweifelbaren Genialität ja schon mit meiner XXVII. Literarischen Soiree am 1. August 1991 den nötigen Respekt gezollt habe.
Allein, ich konnte in meinem Bücherdurcheinander weder die Poe’sche Werkausgabe aus dem Walter-Verlag in Olten und Freiburg im Breisgau finden, übersetzt von Arno Schmidt und Hans Wollschläger, noch die Sammlung seiner Meistererzählungen im Manesse-Verlag. Ich konnte noch nicht einmal den Schlüssel zu meinen Bücherkatakomben finden, wo sich vielleicht diese beiden Preziosen versteckt halten. Erfolgloses Suchen – das hätte vielleicht auch noch ein traumatisches Thema für eine weitere „Short Story” des vermutlich im Delirium tremens verendeten Dichters abgeben können. Oder starb er, wie andere meinen, an einem tollwütigen Katzenbiss? Gar an der Cholera?
Ursprünglich wollte ich heute über Raymond Roussels geniales Patentrezept für das Matt mit Läufer und Springer berichten. Auch das ist ja eine Art Albtraum: wenn es im Endspiel nicht gelingt, innerhalb der vorgeschriebenen Höchstzahl von 50 Zügen mit zwei Leichtfiguren und dem König den Sieg zu erzwingen! Roussel wird warten müssen. Alles geht nun mal nicht, an einem solchen trüben Tag – und nach solch finsterer Nacht.
[Titelbild: Alfred Kubins Schlussvignette zu Poes Novelle Lebendig begraben, zuerst erschienen in der Sammlung König Pest und andere Novellen. A. d. Am. v. Gisela Etzel. München u. Leipzig: Verlag Georg Müller, 1911, S. 97.]
Posted in Rêverie, Würfelwürfe | 6 Comments »
Sunday, 18. January 2009

Das Angebot von Schach-Periodika in deutscher Sprache hat sich im Zuge der Pressekonzentration deutlich reduziert. Heute gibt es vor allem noch Schach – Deutsche Schachzeitung aus dem Berliner ExzeLsior-Verlag, deren Anfänge bis 1947 zurückreichen; das Schach-Magazin 64 vom Schünemann-Verlag in Bremen; und Rochade Europa aus dem thüringischen Sömmerda. Während einstmals renommierte Blätter (wie Schach-Echo, Deutsche Schachblätter, Deutsche Schachzeitung, Der Schachspiegel und die Wiener Schachzeitung) auf der Strecke geblieben sind bzw. von den vorgenannten Schachorganen „geschluckt” wurden, gab es aber seither auch einige wenige Neugründungen, die abseits der üblichen Themen – Turnierberichterstattung, Meldungen aus dem Vereinsleben, Abdruck kommentierter Partien und von Schachkompositionen – inhaltlich nach neuen Wegen suchten.
Das Prunkstück unter diesen Newcomern ist zweifellos KARL – Das kulturelle Schachmagazin, das seit 2001 viermal jährlich in Frankfurt am Main erscheint. Jedes Heft, reich bebildert und auf Hochglanzpapier gedruckt, widmet sich einem Schwerpunktthema, das in mehreren ausführlichen Beiträgen von verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Mal werden reizvolle historische Gegenstände beleuchtet, wie das berühmte Café de la Régence als Mittelpunkt der Schachszene im Paris des 18. und 19. Jahrhunderts, oder die Geschichte des Blindschachs. Andere Hefte stellen einen der großen Meister der Vergangenheit in den Fokus, so Emanuel Lasker oder Aaron Nimzowitsch. Aber auch zentrale Themen der Schachtheorie, wie das Tempo, das Spiel aus der Defensive oder die Rolle des Zufalls im Schachspiel wurden schon eingehend gewürdigt.
Ich kann ein Abonnement dieses ebenso vielseitigen, anregenden wie kompetenten Schachmagazins nahezu ohne Einschränkung jedem Schachbegeisterten, ob Laie oder Vereinsspieler, nur wärmstens ans Herz legen, so er sich denn nicht bloß für die neuesten Erkenntnisse der Eröffnungstheorie interessiert und über den Rand des Brettes mit den 64 Feldern hinausblicken möchte. Eine kleine Mäkelei kann ich mir leider dennoch nicht verkneifen: KARL bedarf dringend eines gründlichen Korrektors. Die sprachlichen Schludrigkeiten unterbrechen den Lesegenuss auf nahezu jeder Seite. Ein Beispiel nur! In einer Bildunterschrift lese ich den Titel zu einer doch so schönen Tuschezeichnung von Helmut Toischer: „Schwarzer König kann Umwandlung des Bauers [!] nicht verhindern” (Heft 4/2006, S. 5). Es darf doch nicht sein, dass ein Schachmagazin, das sich sonst mit vollem Recht „kulturell” nennt, nicht weiß, wie man den Bauern dekliniert. Dieser Bauer war vergiftet – und „des Bauers” falscher Genitiv macht mich giftig.
Bevor ich durch den Wikipedia-Artikel über KARL eines Besseren belehrt wurde, fragte ich mich, woher dieses Magazin denn eigentlich seinen Namen hat. War er gedacht als Analogon zu Fritz, dem prominentesten Schach-Computerprogramm unserer Zeit? Diese Erklärung schien mir etwas dürftig, und so kam mir ein Gedankenblitz. Vielleicht ist KARL ein Akronym für die Instruktion: „König am rechten Läufer!”. Bekanntlich haben Anfänger ja beim Aufstellen der Figuren oft das Problem, auf welche Felder sie König und Dame stellen sollen. Dem Weißen könnte diese Eselsbrücke bei der Positionierung seiner beiden zentralen Figuren hilfreich sein – und der Schwarze müsste dann nur noch wissen, dass er seinen König und seine Dame vis-à-vis aufzustellen hat. Stattdessen teilt Herausgeber und Chefredakteur Harry Schaack mit, dass KARL vielmehr ein Akronym für „Kommunikation, Ansichten, Realitäten und Lorbeerkränze” sei – und zudem der Vorname eines Klubmitglieds der Schachfreunde Schöneck, aus deren Vereinszeitschrift dieses Magazin ursprünglich hervorging.
Ein Jahresabonnement von KARL, das es neuerdings auch in einer englischsprachigen Parallelausgabe gibt, kostet inkl. Porto 20,00 €, das Einzelheft am Kiosk 5,50 €. – Alle alten Hefte (bis auf drei) sind beim Verlag noch lieferbar.
[© Titelbild: Alltagsszene im Régence; aus: KARL 4/2006, S. 19.]
Posted in Caissa, Würfelwürfe | 6 Comments »
Friday, 16. January 2009
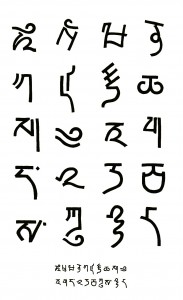
Die Zeitschrift SIGNA – Beiträge zur Signographie, deren erstes Heft im Herbst 2000 in der Edition Wæchterpappel im Verlag der Denkmalschmiede Höfgen im sächsischen Grimma erschienen ist, hat kaum ihresgleichen unter den Periodika zum Thema „graphische Zeichen”, soweit ich das internationale Angebot überblicke, und schon erst recht nicht in Deutschland. Die mittlerweile zehn schmalen Hefte (plus ein Sonderheft „anläßlich der Kodierung des großen ß”), im schlichten ziegelroten Umschlag und im Format 16,5 x 24,0 cm erschienen, bestechen durch ihre ebenso zurückhaltende wie konsequente Gestaltung, vor allem aber durch ihre ganz außergewöhnliche, originelle Themenwahl.
So beschäftigte sich etwa Heft 2, in der Tradition des großen Kalli- und Typographen Jan Tschichold, mit den „Formenwandlungen der Et-Zeichen”; Heft 4 mit dem „Punkt in der Musik”; Heft 5 mit den „Publikzeichen im realen und medialen öffentlichen Raum”; und Heft 7 war der „Verschriftung der Gebärdensprache” gewidmet. Jedem dieser nur auf den ersten Blick abgelegenen Gegenstände gewinnen die Autoren unter der Herausgeberschaft von Andreas Stötzner und Dr. Uwe Andrich einen überraschenden Erkenntniswert ab. Zudem ist es aber ein besonderes Vergnügen, dass dies auf so unaufdringliche Weise, so unprätentiös und insbesondere höchst anschaulich geschieht.
Mein persönliches Lieblingsheft ist das achte, „Zeichen schreiben”, das die Ergebnisse eines Kurses im Grundstudium Schrift an der Burg Giebichenstein in Halle unter Leitung von Hannelore Heise dokumentiert. „Die Aufgabe bestand im Erarbeiten eines kohärenten und doch in sich spannungsvollen Zeichensatzes – allein aus dem Schreiben heraus, entbunden von allen sonstigen Bezügen wie Tradition, Stilistik, Bedeutung und Konvention.” (Andreas Stötzner: Vorwort zu SIGNA, Heft 8, S. 5.) Hauptsächlich bildet dieses Heft die so unterschiedlichen Ergebnisse des Experiments ab, eins schöner als das andere, allesamt nicht lesbar, nicht entzifferbar, nicht dechiffrierbar im üblichen Sinne einer allgemein verbindlichen Bedeutungskonvention – und gerade deshalb sehr aussagekräftig zu der Frage, in welchen Urgründen denn eigentlich unser graphisches Bezeichnen der Welt und Wirklichkeit wurzelt.
Das (hoffentlich nur vorläufig) letzte Heft der Reihe ist 2006 erschienen, mithin vor nun schon drei Jahren – was zu der Befürchtung Anlass geben muss, dass dieses so hoffnungsvoll begonnene, in jedem einzelnen seiner Ergebnisse beachtenswerte Projekt einer tatsächlich erstaunlichen, zum Sehen und Verstehen einladenden Zeitschrift vor der Zeit auf der Strecke bleibt. Dies würde ich sehr bedauern, denn an noch unbehandelten Themen zur „Signographie” mangelt es ja wahrlich nicht. So erträume ich mir beispielsweise ein SIGNA-Heft über die „Tags” der spraydosenbewaffneten Graffiti-Maler unserer Tage, oder eins über die Gaunerzinken des fahrenden Volkes der Vergangenheit.
Darum hier ausnahmsweise mal Reklame. Bestellen Sie SIGNA, liebe Leser meines Weblogs. Fast alle alten Nummern sind noch lieferbar. Setzen Sie ein Zeichen gegen den Trend, Zeichen zwar tagtäglich zu entziffern, ihr tiefstes Wesen aber nicht verstehen zu wollen!
[Titelbild: Schriftbild von Lei Song; aus: SIGNA 8: Zeichen schreiben, S. 19. – © Verlag Denkmalschmiede Höfgen gGmbH, Edition Wæchterpappel, Grimma 2005.]
Posted in Würfelwürfe, Xenographien | 5 Comments »
Tuesday, 06. January 2009

Gestern besuchte mich mein guter alter Freund Heinrich, mit dem sich immer trefflich über Gott, das Wort streiten lässt. „Streiten” heißt hier zwar in der Regel „aneinander vorbeireden”, aber in dieser beiderseitigen Verfehlung liegen meist mehr Erkenntnismöglichkeiten als im nur vermeintlichen gegenseitigen „Verständnis” jener, die sich, gleich auf welcher Seite des Zauns, mit einem freundlich-toleranten Lächeln auf den Lippen zunicken, wie zum Beispiel im Gespräch über Religion und Vernunft, das Professor Jürgen Habermas und Kardinal Joseph Ratzinger 2004 geführt haben.
Heinrich machte mir ein sehr liebenswürdiges Geschenk, den Kleinen Atheismus-Katechismus, den Gerd Haffmans im vorigen Jahr zusammengestellt und herausgegeben hat (Frankfurt am Main: Haffmans bei Zweitausendeins, 2008). Auf gerade einmal 170 Seiten versammelt Haffmans einige der schärfsten literarischen Gewürze, mit denen sich das gelegentlich eher fade schmeckende Eintopfgericht nüchternen Unglaubens abschmecken lässt. Neben den Klassikern wie Ludwig Feuerbach, Arthur Schopenhauer, Karl Marx und Charles Darwin – dem Jubilar dieses neuen Jahres – sind auch meine speziellen Hausunheiligen Fritz Mauthner, Theodor Lessing und Arno Schmidt mit ihren besten Ketzereien vertreten. Das proper fadengeheftete Bändchen kostet reelle 12,90 €, beschert den mitdenkenden Leser überreich mit bitteren Einsichten, sauren Erkenntnissen und scharfen Witzen und verdirbt ihm womöglich auf Lebenszeit den Geschmack für die süßlichen Versprechungen einer besseren Jenseitigkeit via Gottesglaube, Beichte und Frömmelei.
Besonders erfreut haben mich die Aphorismen zur Gotteswissenschaft (S. 101-109) von Ludger Lütkehaus (* 1943), der mir zuerst durch sein handliches Buch über die Onanie („O Wollust, o Hölle”. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag) und dann erneut mit seinem gewichtigen Buch über das Nichts (Frankfurt am Main: Haffmans bei Zweitausendeins, 2000) angenehm aufgefallen war: als sowohl schamlos Fragender wie geistreich Antwortender.
Zwei Kostproben. „Warum erfreut sich das Recycling so großen Zuspruchs? Weil es die realistischere Form der Unsterblichkeit ist. Sublimation der irdischen Abfallwirtschaft mit hinausgeschobenem Verfalldatum.” (Recycling, S. 103.) – Und dann dies hier: „,Siehe, es war alles sehr gut.‘ Der Schöpfer, der sich am Ende seiner Sechstagewoche selber zu seinem Schöpfungswerk gratuliert, liefert nicht nur ein beklagenswertes Beispiel für den Mangel an Realismus. Er ist auch der bei weitem Eitelste in der Gemeinde der Selbstgefälligen. Den Realismus liefert er zwar mit den Folgen des Sündenfalls nach. Sein Schöpfer-Narzissmus aber bleibt ungetrübt. Er rettet sein Bild aus dem Desaster, indem er die Schuld nie bei sich selber sucht. Unter allen Uneinsichtigen ist er der Unbelehrbarste.” (Sehr gut, S. 108.)
Ein passendes Geschenk zu allen christlichen Feiertagen – sowie zur Taufe, Kommunion und Letzten Ölung!
Posted in Godzilla, Würfelwürfe | 8 Comments »
Monday, 05. January 2009

[Heimlich, still und leise, über Nacht.]
Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Deckchair
Sunday, 04. January 2009

Bei uns zu Hause stand seit den 1950er-Jahren immer die gute Bärenmarke – „Allgäuer Alpenmilch · ungezuckerte Kondensmilch” – auf dem Frühstückstisch. Bemerkenswert, dass die erste Wortmarke, mit der ich nähere Bekanntschaft schloss, das Wort „Marke” expressis verbis mit sich führte. Die Melodie zum Slogan dieser Büchsenmilch, „Nichts geht über Bärenmarke – Bärenmarke zum Kaffee”, könnte ich noch immer singen, wenn ich denn singen könnte. Der darin behauptete Alleinstellungsanspruch allerdings war, wie meist in solchen Fällen, reichlich verwegen, denn es gab ja auch noch Glücksklee. 1925 gründete der Kaufmann Otto Lagerfeld (1881-1967) in Hamburg die Glücksklee-Milchgesellschaft zum Vetrieb von Dosenmilch, die rasch expandierte und den Milch-Industriellen zu einem reichen Mann machte, nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil das Firmenlogo, ein vierblättriges grünes Kleeblatt auf rot-weißem Grund, sich als Bildmarke mit hohem Wiedererkennungswert erwies und ihm jenseits allen Aberglaubens jenes Glück bescherte, das am Ende nur der Tüchtige hat. Aus dem Glückskleeblatt ließen sich bis in die späten 1970er-Jahre manch zugkräftige Werbesprüche ableiten: „Hauptsache Glücksklee: Milch von glücklichen Kühen” (1961), „Ein Schuß Glück” (1971) und „Jeder braucht ein kleines bißchen Glück” (1978).
Glück hatte auch Ottos Sohn Karl (* 1933), wenngleich zunächst nur dank seiner noblen Abstammung. Außer dem komfortablen Portefeuille scheint Karl aber auch Vater Ottos Instinkt für die Durchschlagskraft von Markenzeichen geerbt zu haben: Fächer, Pferdeschwanz und Sonnenbrille machten den weltberühmten Modeschöpfer und seine Kollektionen für Valentino, Krizia, Chloé, Chanel und Fendi zu einer überaus erfolgreichen, unverwechselbaren Marke. Das ist für einen wie mich, der seinen Kaffee seit vielen Jahren schon schwarz trinkt, kein Grund, neidisch zu werden auf des Schlossherrn 300.000 Bücher und ihn gar zu fragen: „Haben Sie die alle gelesen?” Bärbeißig werde ich aber, wenn ein solcher Schnittmustervirtuose, statt bei Nadel und Faden zu bleiben, zu allem Überfluss und meinem Überdruss den Mund aufmacht und meint, er dürfe ungestraft seine Lebensweisheiten zum Besten geben.
Schon im letzten Stern des vergangenen Jahres hatte die Marke KL bekannt: „Solange wir Fleisch essen, können wir uns nicht über Pelze beschweren.” (Nr. 52 v. 17. Dezember 2008, S. 127; dort wohl aber zit. nach dem Daily Telegraph, der wiederum Radio 4 Today zitierte.) Und gestern stellte der Spiegel diesen markigen Satz des Beinahe-Vegetariers („Ich kann es [Tierfleisch] kaum essen, weil es nicht mehr wie das aussieht, was es war, als es lebte.”) in einen markanten Kontext: „Der deutsche Designer verwies auf die Jäger im Norden, ‚die davon leben und sonst nichts gelernt haben außer der Jagd […] und jene Bestien töten, die uns töten würden, wenn sie es könnten.‘” Solange wir uns mit Strom aus der Steckdose rasieren, können wir uns nicht über Atomkraftwerke beschweren. Solange der überwiegende Teil unserer Wohlstandsbevölkerung an Adipositas krepiert, darf die Anorexie meiner Models kein Thema sein. – Mensch Karlchen, du bist mir mal ‘ne Marke!
Übrigens bereitet dem wohlbestallten Kondensmilcherben auch die Weltwirtschaftskrise keinen sonderlichen Kummer. „Das ganze System sei ,ohnehin verrottet‘ gewesen. Die Rezession sei eine Art Großreinemachen.” Und zudem sei seine Branche, die Luxusindustrie, „von der Finanzkrise wenig betroffen: ,Zum Glück gibt es heute Vermögen auf der Welt, die es bei der Weltwirtschaftskrise von 1929 noch nicht gab – chinesische, indische, arabische, russische. Wenn die Krise vorbei ist, werden Europa und Amerika endgültig die schöne alte Welt sein, und die neue Welt wird repräsentiert von Indien, China und den Golfstaaten‘, so Lagerfeld.” Das ist doch mal ein gänzlich unsentimentaler Businessman im sonst oft so nostalgischen Modegeschäft! Wenn er zurückblickt, dann im Zorn. Warum hat er sein Haus an der Hamburger Elbchaussee verkauft? „Ich hatte das Gefühl, die Elbe schneidet mich ab von meinem eigenen Wesen und versetzt mich zurück an meinen Ausgangspunkt, und das will ich nicht.” Geschichtslosigkeit als Lebensprinzip.
Die Bärenmarke hat kürzlich den Bären, der seinen Nachwuchs in sanften Schlummer wiegt [siehe Titelbild], aus seiner gut eingeführten Bildmarke entfernt. Solche marketing-strategischen Anbiederungen an die aktuelle political correctness und an schmusige Massenhysterien à la „Braunbär Bruno” und „Eisbär Knut” sind mir durchaus suspekt. Aber ein labernder Kondensmilcherbe, der uns seine bestialischen Werbesprüche für seine aktuelle Fendi-Kollektion damit schmackhaft machen will, dass doch schließlich jeder lieber einen toten Pelz trägt, als von seinem lebendigen Inhalt gefressen zu werden – der ist einfach nur degoutant.
Posted in Homo laber, Würfelwürfe | 4 Comments »
Thursday, 01. January 2009

Als ich in den Zeitungen las, dass die Israelis ihre Militäroffensive gegen die Hamas im Gazastreifen „Gegossenes Blei” genannt haben, da dachte ich zunächst an den uralten Sylvesterbrauch des Bleigießens. Dabei wird bekanntlich Blei auf einem Löffel erhitzt und dann flüssig in kaltes Wasser geschüttet, sodass es zu einer vom Zufall oder vom Schicksal betimmten Form erstarrt. Die Gestalt dieses Bleiklümpchens wird anschließend gedeutet. Sieht es etwa aus wie ein Dolch? Dann bedeutet das: „Du wirst siegreich sein.” Oder erinnert es eher an eine Pfeife? „Achtung! Gefahr zieht auf.”
Ich wollte es aber genauer wissen und habe darum ein wenig recherchiert. Es verhält sich anders als von mir vermutet. Der Name der Offensive bezieht sich nicht aufs Bleigießen, sondern auf eine Verszeile des israelischen Nationaldichters Hayyim Nahman Bialik (1873-1934) aus seinem Gedicht Für Chanukka, in dem sich ein Kind über die vier Geschenke freut, die es der Tradition gemäß zum jüdischen Lichterfest erhalten hat. Der Vater zündete ihm die Kerzen (am neunarmigen Chanukka-Leuchter) an, der Schamasch (die “Dienerkerze”, mit der die übrigen acht Kerzen entzündet werden) leuchtete wie eine Fackel; die Mutter buk ihm Pfannkuchen, heiß und süß und mit Zucker bestreut; der Onkel schenkte ihm einen alten Penny; und der Lehrer hatte einen großen, allerfeinsten Dreidel für das Kind gekauft, aus gediegenem (gegossenem) Blei.
Ein Dreidel [siehe Titelbild] ist ein Kreisel mit vier Seiten, auf denen die vier hebräischen Buchstaben נ (Nun), ג (Gimel), ה (He), ש (Schin) zu lesen sind. Sie stehen für die Worte Nes gadol haja scham, die soviel bedeuten wie „Ein großes Wunder ist dort geschehen.” Dies bezieht sich auf den Sieg der gläubigen Juden im Makkabäeraufstand (164 v. Chr.) über makedonische Syrer und hellenisierte Juden und die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem. Das Dreidelspiel der jüdischen Kinder zu Chanukka ist aber wesentlich jüngeren Ursprungs und stammt ursprünglich aus Deutschland. Je nachdem, welchen der vier Buchstaben der kleine Kreisel zeigt, wenn er umgefallen ist, gewinnt der Spieler nichts, den ganzen oder halben Einsatz im Pott, oder er muss zwei Stücke, meist Süßigkeiten, hineintun. Wer das nicht kann, fliegt raus.
Chanukka ist ein bewegliches Fest und dauert acht Tage. In diesem Jahr begann es am Vorabend des 22. Dezember. Vielleicht gehörte es zur Strategie des israelischen Militärs, dass das Ende der Feierlichkeiten nicht abgewartet wurde, um den Feind zu überraschen – jedenfalls begann die Offensive bereits am 27. Dezember. Doch auch ein solcher „Tabubruch” folgt ja einer alten Tradition. Sowohl in den beiden „christlichen” Weltkriegen als auch im „islamischen” Krieg zwischen Iran und Irak wurde die gebotene und vom Feind eingehaltene Waffenruhe zu Weihnachten bzw. im Ramadan für Überraschungsangriffe missbraucht.
Der Dreidel kreist, die Bomben fallen. Kein gutes Omen zu Neujahr. Wann fällt der Dreidel auf die Seite? Auf welche Seite wird er fallen? Wir Menschen sind schon sonderbar. (Konrad Döbling)
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Dreidel
Wednesday, 31. December 2008
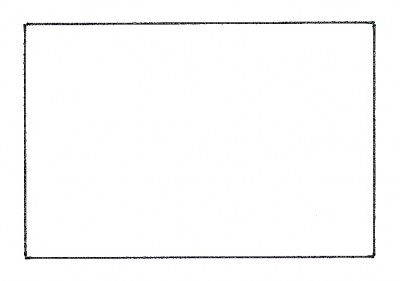
[The white flag. – Vgl. auch hier.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Das Letzte
Tuesday, 30. December 2008

Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurden ungezählte Deutsche, die sich leichtsinnigerweise Anfang August noch in Frankreich aufhielten, unter dem Vorwand der feindlichen Spionage verhaftet. Ich vermute, dass mit den Franzosen im Deutschen Reich nicht viel anders verfahren wurde. Krieg folgt ja im Großen und Ganzen, aber auch in allen Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten der alttestamentarischen Regel: „Auge um Auge, Zahn um Zahn” (Ex 21, 24) – und bedeutet somit den sündhaften Verstoß gegen die radikale Forderung des Mannes aus Nazareth (Mt 5, 39), stattdessen die andere Wange hinzuhalten.
Einer dieser harmlosen Zivilisten, die es zu Kriegsbeginn eiskalt erwischt, ist der begnadete Feuilletonist Victor Auburtin (1870-1928), der als Auslandskorrespondent des Berliner Tageblatts von September 1911 bis Ende Juli 1914 in Paris weilt. Dem genussfreudigen Bonvivant wird zum Verhängnis, dass er sich bei der Flucht in die Schweiz auf der Zwischenstation in Dijon von einer herrlichen Aalpastete, einem prachtvollen Rehrücken und zwei Flaschen moussierenden Burgunderweines zum Bleiben verführen lässt – „denn so unvernünftig die Welt auch geworden sein mag, bleibe ich doch besonnen genug, um mich zu erinnern, daß man in Dijon gut ißt.” (Zit. nach Victor Auburtin: Was ich in Frankreich erlebte und die Literarischen Korrespondenzen aus Paris 1911-1914. Werkausgabe, Bd. 3. Berlin: Verlag Das Arsenal, 1995, S. 369.)
Zwei Tage später sitzt der allzu optimistische Gourmet als politischer Häftling in Zelle 11 des Gefängnisses von Besançon, das er erst am 21. Januar 1915 wieder verlassen wird – aber nur, um für die kommenden zwei Jahre, sieben Monate und 18 Tage mit hunderten deutscher Leidensgefährten in einem Internierungslager auf Korsika „verwahrt” zu werden. Über die nutzlos verschwendeten Jahre seiner Gefangenschaft hat Auburtin in seinem bereits Anfang 1918 in Genf erschienenen Carnet d’un boche en France berichtet, das noch im gleichen Jahr in der deutschsprachigen Originalfassung unter dem Titel Was ich in Frankreich erlebte im Verlag Mosse in Berlin erschien und in der erwähnten Werkausgabe (S. 355-441) erfreulicherweise wieder – oder soll man schon sagen und warnen: „noch”? – greifbar ist.
Über die Traumwelt des Gefangenen schreibt der Traumtänzer Auburtin: „Ich bedenke die Träume, die man als Gefangener hat. Sie sind bedeutend und eindringlich und ganz anders als die Träume der Menschen in der Freiheit. Oft träume ich – und meine Mitgefangenen ebenso – von den toten Freunden und Verwandten, an die ich jahrelang nicht mehr gedacht habe; sie erscheinen mir freundlich, sehen mich gütig an, und ich wohne mit ihnen in engen, traulich erhellten Zimmern. Seitdem mein Vater während meiner Gefangenschaft gestorben ist, träume ich stets von ihm, und sein besorgter Geist kommt zu mir durch die öde Sturmnacht des entlegenen Meeres. Neben diesen düsteren Totenträumen sind Phantasmen von leuchtender Helligkeit: weiße Pferde, sattellose, galoppieren marmorgepflasterte Straßen entlang; ein unermeßlich breiter Strom fließt spiegelnd; ich sitze im strahlend hellen Theater in der Tiefe einer Loge und sehe ein Gewühl wunderbarer Frauen, die schwere Perlenketten um die Schultern tragen.” (S. 444 f.)
Wenn das wache Leben zum öden Albtraum wird, treibt die Traumwelt umso farbigere Blüten.
[Titelbild: Ausschnitt aus Le rêve von Henri Rousseau, 1910.]
Posted in Auburtin, Eccentrics, Rêverie, Würfelwürfe | 2 Comments »
Monday, 29. December 2008

“A four-year-old girl died on Christmas Day following an accident at her home, it has been disclosed. It is understood she was injured when a television fell on her at home in Coedpoeth, Wrexham, on Christmas Eve. North Wales Police were called at 1820 GMT, but doctors at Liverpool’s Alder Hey Children’s Hospital were unable to save her and she died the next day. Police said the family of the little girl, whose name has not been released, were ‘distraught’. A spokeswoman for North Wales Police said: ‘[…] The family are understandably very distraught by this tragic accident and police are making a plea for the privacy of the family to be respected at this incredibly difficult time.’ She added that the North East Wales coroner’s office has taken over the investigation.” (BBC News online v. 28. Dezember 2008.)
In der Tat ein tragisches Missgeschick, dazu noch an Heiligabend! Um dies vorsorglich vorauszuschicken: Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt den unglücklichen Eltern des kleinen Mädchens, die sich nun für den Rest ihres Lebens den Vorwurf machen müssen, dass sie für keinen sicheren Stand des schwergewichtigen Flimmerkastens gesorgt haben. Vermutlich war’s ein 37-Zoll-Gerät. Dabei hatten doch noch vor wenigen Wochen offizielle Stellen in Großbritannien vor Unfällen dieser Art gewarnt, nachdem der gerade mal ein Jahr alte Riyaz Ghaazi Mohamed im walisischen Swansea von einem 33 Kilo schweren Fernseher erschlagen worden war: “I would urge parents of young children to check the stability of furniture in their home, especially when heavy objects are placed on lightweight furniture, because this is a tragedy which could easily happen again.” So der ermittelnde Coroner Philip Rogers.
Gleich anschließend muss ich allerdings zu bedenken geben, dass selbst diese merkwürdige Duplizität zweier tragischer Todesfälle durch TV-Absturz in keinem Verhältnis zu dem Schaden steht, den abermillionen standsicher platzierte Fernsehgeräte in den Seelen von Kindern aller Altersstufen tagtäglich anrichten, ohne dass vor diesem Zerstörungswerk auf den Panorama-Seiten unserer Tageszeitungen jemals gewarnt würde.
Die permanente „Verkleisterung der Gehirne” (Oswald Wiener) vollzieht sich eben ganz unblutig, wenig spektakulär, aber ungleich wirkungsvoller und folgenreicher als der Schädelbasisbruch durch die mechanische Einwirkung einer umstürzenden Glotze.
Wenn zwei kleine Kinder von wacklig aufgestellten Fernsehgeräten erschlagen werden, dann weckt dies unser Mitleid. Wenn aber Millionen Kinder in aller Welt tagtäglich von dem Höllenbrodem aus tausend Kanälen „erschlagen” werden, dann nehmen wir dies als eine Selbstverständlichkeit klag- und mitleidslos hin.
Posted in Kistenflimmer, Würfelwürfe | Comments Off on TV mortal
Sunday, 28. December 2008

Ulrich Holbein (* 1953), der Eremit im Knüllgebirge, hat in den vergangenen zwanzig Jahren gut zwei Dutzend Bücher geschrieben, die allesamt auf ebenso eigenwillige wie eindringliche Weise Zeugnis von seiner exzentrischen Belesenheit ablegen. Nun hat er uns zu Weihnachten mit einem fast zwei Kilo wiegenden Personenlexikon besch(w)ert: Narratorium. Abenteurer · Blödelbarden · Clowns · Diven · Einsiedler · Fischprediger · Gottessöhne · Huren · Ikonen · Joker · Kratzbürsten · Lustmolche · Menschenfischer · Nobody · Oberbonzen · Psychonauten · Querulanten · Rattenfänger · Scharlatane · Theosophinnen · Urmütter · Verlierer · Wortführer · Yogis · Zuchthäusler. (Zürich: Ammann Verlag, 2008.)
Fast jedes dieser „255 Lebensbilder” folgt einem strengen lexikalischen Muster. Auf den Namen des Narren (z. B. Jiddu Krishnamurti) folgen: eine Aufzählung seiner Spezifikationen resp. Qualifikationen resp. Professionen (hier: „Quasimessias, Weisheitsdozent, Weltlehrer, Vortragsdenker, Seelenretter, Guruismuskritiker, Edelguru”), die Lebensdaten (in diesem Falle 1895-1986); eine sehr ausführliche und sehr subjektive Nacherzählung von allem, was im Lebenslauf, in den Taten und Lehren des Porträtierten vom Mittelmaß und gesunden Menschenverstand abweicht; Worte des jeweiligen Narren (hier beispielsweise: „Meiner Ansicht nach haben Glaubensinhalte, Religionen, Dogmen und Überzeugungen nichts mit Leben zu tun und somit auch nichts mit Wahrheit”); Worte des Narren über sich selbst („Ich bin wie die Blume, die ihren Duft der Morgenluft weiht”); und schließlich Worte anderer über ihn: „Die Unbeteiligten spotteten darüber, daß der neue Weltheiland in einem Hotel ersten Ranges wohne, moderne Anzüge trage und Tennis spiele.” Das soll ein Rudolf Olten 1932 gesagt haben, auf genauere Quellenangaben und Zitatnachweise verzichtet das bequemerweise (aus Sicht des Autors und seines Verlages), unbequemerweise (aus Sicht des Lesers) bei allem Fleiß reichlich hemdsärmelig daherkommende Nachschlagewerk leider ganz. So muss man dann schon zufällig wissen und kombinieren können, dass hier wohl Rudolf Olden (1885-1940) gemeint und das Zitat offenbar aus dessen Sammlung Propheten in deutscher Krise (Berlin: Ernst Rowohlt Verlag, 1932) entnommen ist.
Als ich vor ein paar Wochen auf diese Schwarte aufmerksam gemacht wurde, schwankte ich für kurze Zeit zwischen Hoffen und Bangen, ob sie mein gerade erst gestartetes Projekt „Eccentrics” durch zahlreiche Übereinstimmungen bestätigen oder ihm gar den Rang abgelaufen haben könnte. Mitnichten! Weder Siemsen noch Baggesen, weder der liquidierte Dodo noch der selbsttrepanierte Bart Huges, weder der Essener Pferde- noch der ebendort zwitschernde Leierkastenmann, von Franz Gsellmann, Oskar Panizza, Alexandre „Marius” Jacob oder Helmut Salzinger ganz zu schweigen, kommen bei Holbein vor. Einzig den „Auswanderer, Sonnenanbeter, Gemüseverneiner, Extrem-Vegetarier, Kokosnußprediger, Kokovorist, Welterlöser” August Engelhardt (S. 284 f.) haben wir bislang gemeinsam auf unserer Liste. (Zugegeben: Ich las diesen Artikel mit höchstem Vergnügen!)
Der Grund liegt auf der Hand. Ulrich Holbein erntet hauptsächlich die verzückten Gottgläubigen ab, während ich deren sehr spezielles Spinnertum, Godzillas abstruse Geisteskindschaften, keiner eingehenderen Betrachtung für würdig erachte. Irritiert hat mich allerdings, dass er auch Günther Anders (S. 38 ff.) in seinem chaotischen Heiligenlexikon kanonisiert. Aber da dort auch (S. 151 f.) ein mir bisher gänzlich unbekannter Dieter Bohlen auftaucht, schreibe ich diesen Ausreißer gnädig einer willkürlich waltenden Beliebigkeit zu.
Abschließend sei immerhin, als eine Art Versöhnungsangebot, noch angemerkt, dass das dicke Buch von Ulrich Holbein mit allerlei beeindruckenden Bildcollagen des Autors verziert ist, von denen mir die im Titelbild gezeigte, Theodor Lessing hinter Truthahn und Silbermops, besonders gut gefallen hat.
[Mit Dank an Bernd Berke für den Hinweis auf Holbeins Buch.]
Posted in Godzilla, Würfelwürfe | 4 Comments »
Saturday, 27. December 2008

Kann man ein Unsinnswort („Quirkel“) von einer Sprache in eine andere übersetzen? Man kann es immerhin versuchen. Das Quirkel „Supercalifragilisticexpialidocious” aus dem Musicalfilm Mary Poppins (1964), nach dem dreißig Jahre zuvor erschienenen, gleichnamigen Roman der Australierin P. L Travers (1899-1996), wurde in der deutschen Synchronisation zu dem nicht minder quirkeligen Wort „Superkalifragilistischexpialigetisch”.
Der englische Schlagersänger Chris Howland, der es hierzulande als „Mr. Pumpernickel” in den 1950er-Jahren zu beträchtlicher Popularität gebracht hatte, erfreute seine Fans im gleichen Jahr 1964 mit einer Single unter dem Titel Superkalifragilistisch Expiallegorisch, was bis heute unter den radebrechenden Nachplapperern dieses bandwurmlangen Zauberspruchs zu Verwirrung und heftigen Diskussionen führt. Wie heißt es denn nun richtig: „-getisch” oder „-gorisch”?
So marschierte Hugo Balls Karawane aus dem Jahr 1917 munter weiter – und der Dadaismus der Zürcher Avantgarde feierte in den gagaphonen Refrains biederster Singspiele ein wunderliches Comeback.
Je länger die Phantasiewörter, desto vielfältiger ihre Anagramme. So kann man aus dem Quirkel „Superkalifragilistischexpialigetisch” per Mausklick wunderbarerweise bequem 151.300 mehr oder weniger sinnvolle Sätze formen lassen, wie z. B. „Fix lag Pipi: Gitarre – Ausschliesslichkeit!”
Die grandiose Asketin Unica Zürn, die ihr großes Talent über solchen Buchstabenumstellungsspielen verschliss, wird schon gewusst haben, warum sie sich am 19. Oktober 1970, lange vor der Mechanisierung der anagrammatischen Poeterei, aus dem Fenster schmiss. Die damals wohl schon vorhersehbare Niederlage des charmant aus Menschengrips gefertigten Changierens der 26 Lettern, zwischen Sinn und Unsinn, angesichts der unmittelbar bevorstehenden, gnadenlos-unausweichlichen Perfektion der Computer, wollte sie sich wohl ersparen.
Posted in Jabberwocky, Würfelwürfe | Comments Off on Superkali… usw.
Friday, 26. December 2008
Posted in Nonsens, Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Thursday, 25. December 2008

In den Wochen vor dem Übergang zum Jahr 2009 grassiert in der Berichterstattung über die Statements von hochrangigen Politikern und Topleuten der Wirtschaft zur globalen Finanzkrise eine neue Redewendung, die aufhorchen lässt: Die Krisenmanager beschwören unseren Durchhaltewillen, appellieren an unsere Leidensfähigkeit, bereiten uns rhetorisch auf ein hartes Jahr vor; kurz: sie „schwören uns ein”. Und offenbar haben sich alle Kommentatoren dieses erpressten Treuegelübdes verschworen, gerade diese – wie ich zeigen werde – vollkommen unsinnige Phrase zu gebrauchen.
Den Anfang machte am 18. Dezember 2008 Volkswagen-Chef Martin Winterkorn, der seinen Konzern, will sagen: dessen Topmanagement, auf harte Zeiten für die Autobranche einschwor. Noch am selben Tag schwor dann die Bundeskanzlerin Angela Merkel die Ministerpräsidenten der Bundesländer auf das zweite Konjunkturpaket ein, um zwei Tage später dann gleich das ganze deutsche Volk auf ein schwieriges neues Jahr einzuschwören. Bereits zu Heiligabend wird die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Horst Köhler bekannt, der die Deutschen auf einen Kraftakt einschwört. Und selbst der designierte US-Präsident Barack Obama schwört zum Fest der Liebe seine Landsleute auf einen harten Kampf gegen die Wirtschaftskrise ein.
Leider bleibt bei dieser inflationären Einschwörerei völlig unklar, welchen Eid die Leidtragenden des vorhersehbaren Zusammenbruchs unseres Weltfinanzluftschlosses denn nun eigentlich leisten sollen. Etwa diesen? „Ich schwöre, dass ich mich nicht beschweren werde, wenn ich im kommenden Jahr 2009 meinen Arbeitsplatz verliere. Ich schwöre, dass ich Einbußen in meinem Lebensstandard klaglos hinnehme. Ich schwöre, dass ich die Schuld an diesem Desaster bei niemandem suchen werde, und am allerwenigsten bei den Spekulanten, den Börsenzockern, Konzernchefs und Bankern, denn diese armen Irren haben ja längst schon den Überblick verloren und können auch nichts dafür. Ich schwöre, dass ich mich angesichts dieser trüben Zukunftsaussichten bescheiden in mein kaltes Kämmerlein zurückziehen werde und dem Herrgott danke, dass ich überhaupt noch ein Kämmerlein habe. Ich schwöre, auch weiterhin keinen Anstoß daran zu nehmen, dass eine immer kleiner werdende Zahl von Supermilliardären ihren Reichtum auf Kosten des immer größer werdenden Rests der Menschheit schamlos weiter vermehrt. Ich schwöre, dass ich nicht aufmucke, wenn die entfesselte Raffgier dieser anscheinend unersättlichen Oligarchie ihre Allmacht mit Krediten und Zukunftshypotheken festigt, unter denen noch die Kindeskinder meiner Kindeskinder zu leiden haben werden.”
Als der Reichspropagandaminister Joseph Goebbels [siehe Titelbild] am 18. Februar 1943, nach der verlorenen Schlacht von Stalingrad, das deutsche Volk, repräsentiert durch eine handverlesene Schar fanatisierter Parteigenossen, auf den weiter zu beschreitenden Weg in den Abgrund einschwor, stellte er immerhin noch eine Frage: „Wollt ihr den totalen Krieg?” Und aus dem Berliner Sportpalast scholl ihm ein begeistertes „Ja!” der verblendeten Meute entgegen.
Die leidenschaftslosen Einschwörer von heute stellen aber erst gar keine Fragen mehr, weil sie es offenbar nicht mehr nötig haben. Die normative Kraft des Faktischen macht ihnen ihr trauriges Geschäft sehr leicht. Wir Deutschen sind die Eingeschworenen von Mikronesien und müssen uns mit unserer Marginaliserung wohl oder übel abfinden. – Frohe Weihnachten!
[Fortsetzung hier.]
Posted in Oikos, Würfelwürfe | 5 Comments »
Wednesday, 24. December 2008

[Ohne Worte.]
Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Heiliger Zylinder!
Tuesday, 23. December 2008

Seit frühester Kindheit litt ich unter zwei körperlichen Beeinträchtigungen: unter Migräneanfällen und deformierten Füßen. Ich war sozusagen von Kopf bis Fuß auf Leiden eingestellt. Seit meinem virilen Klimakterium haben sich die Kopfschmerzattacken verabschiedet, die Füße hingegen belästigen mich nach wie vor auf Schritt und Tritt. Weil die Orthopädie in den 1960er-Jahren gegen Hohlfüße kein anderes Mittel als das Messer des Chirurgen kannte, wurde ich im Essener Klinikum zwei wenig erfolgreichen Operationen unterzogen. Seither trage ich orthopädische Maßschuhe, in denen ich mich leidlich schmerzfrei durch die hart gepflasterte Stadtlandschaft meiner Heimat bewegen kann.
Am 20. Februar des nun zu Ende gehenden Jahres erkühnte ich mich, das Foto eines meiner nackten Füße als stummes Merkmal über einen Beitrag zu stellen, den ich damals noch im Kulturblog der WAZ-Mediengruppe, bei Westropolis, veröffentlichte. Shocking! Die empörten Kommentare zu diesem Tabubruch in einer geleckten und geschniegelten Öffentlichkeit, in der die traurige Wahrheit kranker Füße keine Chance hat gegen den falschen Schein adretter Hutmoden – diese Kommentare lassen noch heute mein Herz hüpfen und machen mich stolz, hier offenbar eine Grenze überschritten zu haben.
„Schuster, bleib bei deinen Leisten!” – Im Internet gibt es einen Streit darüber, ob es nun „deinen” oder „deinem” heißen muss. So kann nur fragen, wer nicht weiß, was ein Leisten eigentlich ist. Schusterleisten sind Formstücke aus Holz, Kunststoff oder Metall, die zum Bau eines Schuhpaars verwendet werden, mithin möglichst originalgetreue Nachbildungen der beiden Füße, für die und um die die zwei Schuhe gebaut werden sollen. Da aber gewöhnliche Menschen üblicherweise zwei Füße haben und somit zwei Schuhe benötigen, kann nur der Plural richtig sein. Ich habe meinem orthopädischen Schuhmacher seit nun mehr als fünfunddreißig Jahren die Treue gehalten, weil er „meine” Leisten, die Abbilder meiner verkrüppelten Füße, in seinem Leistenlager aufbewahrt.
Was es für einen Fußkranken wie mich jeweils bedeutet, aus den ausgelatschten Schuhen der vergangenen Jahre, links im Bild, in die neu gebauten zu wechseln, rechts im Bild – diesen überaus schmerzvollen Vorgang kann vermutlich nur ein Leidensgefährte nachvollziehen, so es denn einen solchen hier überhaupt gibt. Und was diese körperliche Beeinträchtigung im Laufe einer jugendlichen Biographie bedeutet, wenn man beim Hundertmeterlauf regelmäßig als Letzter auf der Strecke bleibt, das steht ohnehin in den Sternen. Aber ich will mich ja nicht beklagen.
Meine vermeintlichen Defizite sind schon immer meine tatsächlichen Vorzüge gewesen.
Posted in Dingwelt, Würfelwürfe | 11 Comments »
Monday, 22. December 2008
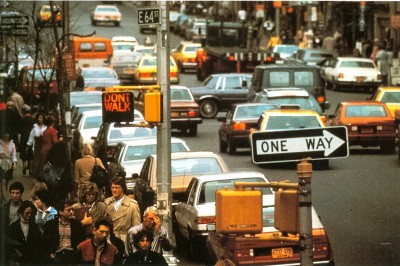
Wohin die Autolosigkeit im Land der unbegrenzten Automobilität schlimmstenfalls bisher führen konnte, das hat uns wohl zuerst Günther Anders (1902-1992) in einer Tagebuchnotiz aus dem Jahr 1941 nahezubringen versucht, die er in den ersten Band seines Hauptwerks Die Antiquiertheit des Menschen aufnahm (München: C. H. Beck, 1956). Anders erzählt dort (S. 172 ff.), was ihm widerfuhr, als er weit außerhalb von Los Angeles einen Highway entlangwanderte und als verdächtiges Subjekt von einem motorisierten Cop gestoppt wurde. Dieser pflichtbewusste Polizist findet in seinem Weltbild nur zwei plausible Erklärungen für die befremdliche Tatsache, dass ein menschliches Wesen sich am Rande der Schnellstraße statt auf ihr und auf andere als die übliche Weise fortbewegt, nämlich vorsintflutlich per pedes. Entweder muss dieser „Sunnyboy”, wie der Polizist den Philosophen gönnerhaft nennt, sein Auto verkauft und noch kein neues erworben haben; oder das Auto dieses spät geborenen Peripatetikers muss sich in Reparatur befinden. Als Anders bekennt, er habe nie ein Auto besessen, fällt dem misstrauischen Gesetzeshüter die Kinnlade runter: „Sie haben nie?”
Gerade einmal 67 Jahre später haben wir nun den globalen Schlamassel namens „Finanzkrise” – und es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis die ewiggestrigen „Sunnyboys” sich zu Pionieren einer lange verschmähten Fortbewegungsart mausern werden. Zwar ist, verstehe es wer kann, das Benzin vorübergehend noch mal billig wie nie geworden, aber den Autobauern in Detroit, Stuttgart, Wolfsburg, Chūō (Tokio), Toyota und anderswo steht das Wasser bis zum Hals wie sonst nur noch den Banken.
Heute berichtet meine Tageszeitung, dass die Amerikaner neuerdings gern wieder zu Fuß gehen und sich aus den Suburbs zurück in die Zentren ihrer Städte sehnen. (Viola Schenz: Das Gute liegt so nah; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 297 v. 22. Dezember 2008, S. 9.) Dort kann man nachlesen, was man immer schon befürchtete: dass 41 Prozent aller Autofahrten in den USA unter zwei Meilen liegen und dass sich gerade einmal fünf bis zehn Prozent der amerikanischen Wohngebäude in einer städtischen Umgebung befinden, die sich „walkable” nennen kann: für ihre Bewohner in Nähe zu ihren Arbeitsplätzen, Einkaufszentren, Kulturstätten und Erholungsgebieten, die sie auf sicheren Verkehrswegen fußläufig erreichen können.
Der unvermeidlich bevorstehende Mangel, nicht die bessere Einsicht vor der Zeit, bringt schließlich den Fortschritt in Gang. So war es vermutlich schon immer. Es musste erst ganz schlimm mit uns kommen, damit es wieder besser werden konnte mit uns. Dabei war doch nur zu offenkundig, dass dieser Weg, so komfortabel er immer gewesen sein mochte, notwendig in eine Sackgasse münden musste. Oder?
Jetzt bleibt bloß noch zu hoffen, dass wir es nicht längst zu weit getrieben haben und der Autofriedhof des 20. Jahrhunderts uns im 21. nicht mit sich und unter sich begraben wird.
Posted in Flanerie, Würfelwürfe | 4 Comments »
Sunday, 21. December 2008

Ich erinnere mich noch so gut, als wäre es gestern gewesen, an jenen Augenblick, da mir, im Alter von vielleicht drei oder vier Jahren, plötzlich bewusst wurde, dass auch ich nicht ewig leben würde. Ich lag in meinem Bett im Kinderzimmer und konnte nicht einschlafen, weil mich dieser Gedanke völlig aus der Fassung brachte. Als mein Vater den Kopf zur Tür hereinsteckte, um mir eine gute Nacht zu wünschen, fragte ich ihn rundheraus, ob ich denn tatsächlich unbedingt irgendwann einmal sterben müsse. Gab es da wirklich keine Ausnahme? Der liebe Mann war offenbar erschrocken über diese direkte Frage seines kleinen Sohnes, gab sich aber redlich Mühe, mich in meiner tiefen Verstörung zu besänftigen, indem er mich mit dem Versprechen zu trösten suchte, dass es bis dahin ja noch eine sehr, sehr lange Zeit sei. Ich erinnere mich auch daran, dass dieser Trost mein Entsetzen nicht mildern konnte und ich bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal von meinem Vater enttäuscht wurde, den ich doch bis dahin als einen allmächtigen Beschützer erlebt hatte, stark genug, alles Übel von mir fernzuhalten. An diesem Abend versagte er und ließ mich mit meiner Angst allein.
Das Trostpflästerchen, das mein Vater auf die Wunde geklebt hatte, die mir diese frühe Einsicht in meine Vergänglichkeit schlug, erwies sich als wenig beständig. Die Folge einer Fernsehserie von Prof. Heinz Haber in den 1960er-Jahren war dem Thema „Zeit” gewidmet. Dort lernte ich, dass für das subjektive Zeitempfinden des Menschen seine innere Uhr mit 18 Jahren bereits zur Hälfte abgelaufen ist, selbst wenn er ein gesegnetes Lebensalter von 80 Jahren erreicht.
Trost spendete mir später schon eher das bekannte Wort von Bazon Brock, in der Tradition des schwarzen Humors der Surrealisten: „Der Tod muss abgeschafft werden, diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter an der Solidarität aller Menschen gegen den Tod. Wer sich hinreißen lässt aus noch so verständlichen Gründen, aus Anlass des Todes […] ein rührendes Wort zu sprechen, eine Erklärung anzubieten, die Taten aufzuwiegen, die Existenz als erfüllte zu beschreiben, der entehrt ihn, lässt ihn nicht besser als die Mörder in die Kadaververwertungsanstalt abschleppen. Wer den Firlefanz, die Verschleierungen, die Riten der Feierlichkeit an Grabstätten mitmacht, ohne die Schamanen zu ohrfeigen, dürfte ohne Erinnerungen leben und sich gleich mit einpacken lassen. […] Der Tod ist ein Skandal, eine viehische Schweinerei! […] Lasst euch nicht darauf ein, versteht: Der Tod [ist] ein ungeheuerlicher Skandal, gegen den ich protestiere.” (Bazon Brock / Karla Fohrbeck: Ästhetik als Vermittlung. Arbeitsbiographie eines Generalisten. Köln: DuMont Verlag, 1977, S. 796 f.)
Und dann gab es da noch die plausible Einsicht, schon bei den Vorsokratikern, dass ich mich doch wohl nicht um ein posthumes Nichtsein bekümmern muss, da mich mein pränatales Nichtsein ebensowenig je beunruhigt hat.
Schließlich und letzten Endes, als Fußnote zur Kopffrage, lauert der populäre Einwand, dass die Angst vorm Tod bei genauerer Betrachtung vielleicht bloß eine Angst vorm Sterben sein könnte: die Qualen des Übergangs, die doch angesichts der Ewigkeit eine gertenschlanke Nichtigkeit ausmachen. Immerhin ist das Thema Tod wohl wert, in den täglichen Notaten eines Sterblichen seinen vergänglichen Platz zu bestreiten.
Posted in Memento | 4 Comments »
Friday, 19. December 2008

„Es lebte ein Mann, der war ein sehr tätiger Mann und konnte es nicht übers Herz bringen, eine Minute seines wichtigen Lebens ungenützt verstreichen zu lassen.
Wenn er in der Stadt war, so plante er, in welchen Badeort er reisen werde. War er im Badeort, so beschloß er einen Ausflug nach Marienruh, wo man die berühmte Aussicht hat. Saß er dann auf Marienruh, so nahm er den Fahrplan her, um nachzusehen, wie man am schnellsten wieder zurückfahren könnte.
Wenn er im Gasthof einen Hammelbraten verzehrte, studierte er während des Essens die Karte, was man nachher nehmen könne. Und während er den langsamen Wein des Gottes Dionysos hastig hinuntergoß, dachte er, daß bei dieser Hitze ein Glas Bier wohl besser gewesen wäre.
So hat er niemals etwas getan, sondern immer nur ein nächstes vorbereitet. Er war nie einer ganzen und gesunden Minute Herr, und das war gewiß ein merkwürdiger Mann, wie du, lieber Leser, nie einen gesehen hast.
Und als er auf dem Sterbebette lag, wunderte er sich sehr, wie leer und zwecklos doch eigentlich dieses Leben gewissermaßen gewesen sei.”
[Ausnahmsweise in hektischen Zeiten mal „nur” ein Zitat. Das Feuilleton Das Leben von Victor Auburtin (1870-1928) erschien 1911 in der Sammlung Die Onyxschale im Verlag von Albert Langen in München. – In neuerer Zeit hat sich der Berliner Verleger Peter Moses-Krause um die Wiederentdeckung dieses vergessenen Meisters der Kleinen Form verdient gemacht. In seinem Verlag Das Arsenal erscheint seit 1994 eine auf sechs Bände angelegte Werkausgabe Auburtins, mustergültig ediert und in herzerfrischend schöner Ausstattung. Deren zweitem Band, Die Onyxschale und Die goldene Kette sowie andere Kleine Prosa aus dem Simplicissimus bis 1911, entnehme ich (von Seite 149) frecherweise diesen wundersamen Text und auch das Titelbild, in der Hoffnung, den einen oder anderen kennerischen Leser so auf ein verkanntes Genie der Kurzprosa aufmerksam machen zu können.]
Posted in Auburtin, Eccentrics, Langsamkeit, Würfelwürfe | 6 Comments »
Friday, 19. December 2008

Mein Rechner hat vor ein paar Tagen Psilocybin eingeworfen und ist seither völlig von der Rolle.
Ich selbst bin infolgedessen, obwohl absolut nüchtern, ebenfalls neben der Spur. Wenn durch das Versagen eines solchen unentbehrlich gewordenen Arbeitsmittels die tägliche Routine außer Tritt gerät, dann spürt man schmerzhaft, wie abhängig man von dieser komplizierten und hochsensiblen Technik geworden ist.
Hinzu kommt die Panik, dass totaler Datenverlust dräuen könnte. Gerade noch rechtzeitig habe ich alle wichtigen Dateien auf meiner externen Festplatte sichern können. Aber auch die Perspektive, den Rechner komplett neu „aufsetzen” zu müssen, ist wenig angenehm – dazu noch vor den Weihnachtstagen, an denen meine Helfer sicher andere Pläne für ihre Freizeitgestaltung haben.
Diese kurze Schadensmeldung kommt mit einem Tag Verspätung, denn gestern ließ sich der berauschte Rechner überhaupt nicht mehr hochfahren. Dank der Intervention meines jüngsten Sohnes, der einen kleinen Trick erfolgreich zur Anwendung brachte, kann ich jetzt immerhin das Versäumte noch im vertretbaren Zeitrahmen nachholen. Schließlich habe ich im Impressum versprochen: „Täglich erscheint ein Beitrag mit jeweils fünf Absätzen, in seltenen Fällen erfolgt die Publikation eines Beitrags mit einem Tag Verzögerung.” Bislang konnte ich zu meinem Wort stehen. Dass nun eine Sendepause von zwei oder mehr Tagen drohte, hat mich an den Rand der Verzweiflung gebracht.
Nachdem nun immerhin eine provisorische Überbrückung das Schlimmste verhindert hat, kann ich dennoch der Frage nicht ausweichen: Was mache ich hier eigentlich? Vielleicht sollte ich doch besser zu Papier und Bleistift zurückkehren.
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Wednesday, 17. December 2008

Meine Urgroßmutter Anna Maria Heßling, geb. Kappen (* 16. November 1858 in Niederzissen / Kreis Ahrweiler) soll dem Vernehmen nach eine sehr strenge Frau gewesen sein. Mit meinem Großvater, dem Dentisten Johannes Heinrich Heßling (* 23. März 1894 in Essen), einem ihrer sechs Kinder, zerstritt sie sich heillos. Ihr Sohn Wilhelm galt als verschollen, nachdem er in jungen Jahren bei Nacht und Nebel das elterliche Haus im Streit verlassen hatte und nie mehr gesehen ward. Aus dem Nachlass meiner Großmutter väterlicherseits ist Wilhelms Abschiedsbrief [siehe Titelbild] auf mich gekommen. Wilhelm schreibt:
„Ich muß Euch nur mitteilen dass ich | mich in Emmerich in den Rhein | gestürzt habe; den[n] ich war es | endlich müde[,] so braucht Ihr nicht | mehr für mich zu sorgen. | Mit den paar Zeilen Ende ich. | So lebt den[n] wohl auch[,] Wilhelm [?]. || Freut Euch des Lebens. | Grüße an Alle! | Wilhelm. || † + †. || Ärgert Euch nicht um meinet|wegen. Denn jetzt braucht Ihr mich | keinen Anzug zu kaufen. | Grüßt mich Auch Emma Sauer | denn die trägt die Schuld.”
Bilde ich’s mir nur ein, oder hat mir meine Großmutter Katharina Heßling, geb. Kamps (* 9. Juni 1895 in Essen) tatsächlich zu diesem Brief die Geschichte erzählt, dass ihr verschollener Schwager sich beim nächtlichen Einstieg ins Zimmer seiner Geliebten Emma die nagelneue Hose zerrissen und deshalb einen verhängnisvollen Familienstreit vom Zaun gebrochen habe?
Ganz sicher bin ich mir aber, dass die Pessimisten der Familie befürchteten, Wilhelm könnte eins der Opfer des Massenmörders Fritz Haarmann geworden sein, der zwischen 1918 und 1924 in Hannover sein Unwesen trieb.
Die Optimisten hingegen waren sich sicher, dass Wilhelm sich weder im Rhein ertränkt habe noch Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, sondern stattdessen nach Amerika ausgewandert sei, wo er es gewiss vom Tellerwäscher zum Millionär gebracht haben müsste. Doch auf den unverhofften Geldsegen von Seiten meines verschollenen Großonkels warte ich leider noch immer vergeblich.
Posted in Time Machine, Würfelwürfe | 2 Comments »
Monday, 15. December 2008
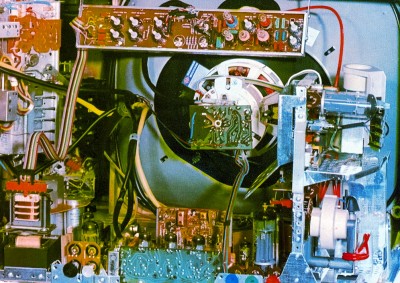
Wenn ich die Leute frage, wie sie’s so mit dem Fernsehen halten, dann bekomme ich regelmäßig Antworten wie diese: „Ach, ich stelle die Kiste immer seltener an. Das Programm hat ja in letzter Zeit auch sehr nachgelassen. Und die viele Werbung! Die Tagesschau, das schon. Man muss ja schließlich auf dem Laufenden bleiben. Und den Tatort am Sonntag im Ersten, den lasse ich mir selten entgehen. Hin und wieder mal ein schöner alter Hollywood-Film. Aber sonst? – Na ja, manchmal bin ich nach dem Stress im Büro so geschafft, dann lasse ich mich einfach berieseln und zappe von Sender zu Sender. Muss auch mal sein. Aber im Urlaub, da kann ich problemlos drei Wochen ganz auf die Glotze verzichten.”
Offenbar kenne ich nur Leute, deren Konsumverhalten ausgesprochen untypisch für den Durchschnitt der Bevölkerung ist, denn die regelmäßig von Demoskopen ermittelten Zahlen zum Fernsehverhalten der Deutschen zeichnen ein anderes Bild: „Die durchschnittliche Fernsehdauer der Personen ab 14 Jahren ist im Zeitraum von 1988 bis 2002 um eine Stunde gestiegen. So lag sie 1988 noch bei 2,5 Stunden, bis 2002 stieg der tägliche Fernsehkonsum kontinuierlich auf durchschnittlich 3,5 Stunden. […] Ein Drittel der Fernsehzuschauer gehört mit einer durchschnittlichen täglichen Fernsehdauer von 6,5 Stunden zu der Gruppe der Vielseher, die hauptsächlich aus Personen über 50 besteht.” (Informationsdienst Wissenschaft; zit. nach www.uniprotokolle.de v. 21. November 2005.)
Die Umfrageergebnisse legen auch nahe, dass es ein Nord-Süd- und ein Ost-West-Gefälle bei der täglichen Fernsehnutzungsdauer gibt. Je größer der Wohlstand und die Bildung der Menschen ist, desto weniger Zeit verbringen sie vor ihrem Apparat. „In Sachsen-Anhalt, wo die Arbeitslosenquote 2004 im Schnitt bei 20,3 Prozent lag, saßen die Bürger […] 275 Minuten lang vor flimmernden Bildschirmen. 275 Minuten – das bedeutet 1673 Stunden im Jahr oder 70 Tage oder rund 2,3 Monate Fernsehen nonstop.” (Melanie Mühl: Siebzig Tage im Jahr vor dem Schirm; in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 16 v. 20. Januar 2005, S. 38.)
Und die willfährigsten Opfer dieser Zeitvernichtungsmaschine sind neben den Arbeitslosen und Alten die Kinder: In Deutschland sitzen um 22:00 Uhr noch 800.000 Kinder im Vorschulalter vor dem Fernseher, um 23:00 Uhr sind es noch immer 200.000. (Vgl. Christian Thiel: Fernsehkonsum bestimmt den späteren Bildungsgrad; in: Die Welt v. 3. November 2005; zit. nach www.geburtskanal.de.) Was will man auch anderes erwarten, wenn selbst die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, Kinder von 0 bis 2 Jahren täglich 20 Minuten vor den Fernseher zu setzen – oder wohl richtiger: bäuchlings davorzulegen.
Aber es gibt auch eine gute Nachricht, und die ist brandaktuell. Dank dem seit Jahren zunehmenden Internetkonsum „sinkt nach Jahren des Anstiegs erstmals die Zeit, die vor dem Fernseher verbracht wird. Schalteten die Deutschen im Jahr 2006 ihre TV-Geräte jeden Tag für durchschnittlich 212 Minuten an, waren es 2007 nur noch 208 Minuten.” (Presseinformation des Bundesverbandes Informationswirtschaft Telekommunikation und neue Medien v. 12. Oktober 2008.) Die Frage bleibt allerdings, was meine Landsleute mit den so gewonnenen vier Minuten anfangen. Meine Vermutung: Rechner runterfahren, Fernseher einschalten!
Posted in Questionnaire, Würfelwürfe | Comments Off on Gläserne Glotzer?
Sunday, 14. December 2008

Den entscheidenden Hinweis auf diesen Schach-Roman erhielt ich auf denkwürdige Weise. Ich kam unter Umständen, die hier nichts zur Sache tun, mit einem mir völlig fremden Berufs-Schachspieler ins Gespräch, der seine Jugend in der DDR verbracht hatte. Er vertrat die interessante Auffassung, die Überlegenheit der Schachspieler aus den Staaten des ehemaligen Ostblocks rühre daher, dass dieser Denksport dort lange Zeit eines der wenigen politisch unverdächtigen Betätigungsfelder für einen freiheitsdurstigen Geist gewesen sei. In dem Roman des Italieners Paolo Maurensig (* 1943) geht es um genau dieses Thema: das Schachspiel als Freiraum des Denkens in ideologisch verkrusteten Zwangssystemen – und zugleich als Modellfall für den erbarmungslosen Kampf ums Überleben.
Die beiden Antagonisten: Dieter Fritsch, ein ehemaliger SS-Mann und Aufseher im Konzentrationslager Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide, der nach dem Krieg seiner Bestrafung entging und danach als Unternehmer zu Reichtum und Ansehen gelangte; und der jüdische KZ-Häftling Tabori, der dem Tod im Lager nur mit knapper Not entging. Was diese beiden extrem gegensätzlichen Menschen eint, ist ihre obsessive Liebe zum Schachspiel. Um seinen früheren Foltermeister Fritsch vierzig Jahre nach den infernalischen Ereignissen in Bergen-Belsen seiner gerechten Strafe zuzuführen, bildet Tabori einen begabten Schüler, Hans Mayer, auf den 64 Feldern zum Werkzeug seines Racheplans aus.
Dieses Motiv erinnert auf den ersten Blick vielleicht etwas zu aufdringlich an Stefan Zweigs berühmte Schachnovelle (1942), seine Ausführung auf den zweiten Blick, und mit größerer Berechtigung, an Dürrenmatts Kurzroman Der Verdacht (1951), in dem es freilich nicht ums Schachspiel geht. Dass einige Großmeister des königlichen Spiels, wie Savielly Tartakower und Efim Bogoljubow, in den 1920er-Jahren als Gäste in Taboris Münchener Elternhaus verkehrten und im Roman treffend charakterisiert werden, wird die schachkundigen Leser freuen – und mich persönlich hat das Porträt entzückt, das Maurensig von meinem Lieblingsspieler Akiba Rubinstein zeichnet. Dennoch taugen diese womöglich gut recherchierten Details nicht zur ästhetischen Beurteilung eines solchen Romans.
Was das angeht, muss ich – der Wahrheit die Ehre zu geben – diese Lüneburg-Variante bedauerlicherweise mit einem Doppelschach und anschließendem Damenverlust beantworten. Es hapert dem Roman zugleich an emotionaler Einfühlung in seine Protagonisten und an Glaubwürdigkeit, was den ganz äußerlichen Verlauf des Geschehens angeht. Und dass diese Variante so ganz ohne Damen auskommt, die bekanntlich stärksten Figuren auf dem Brett, macht sie für mich endgültig zu einem eher ephemeren Werk der neueren Romanliteratur mit diesem Sujet.
Einen starken Satz habe ich mir dennoch angestrichen: „Denn auch jenseits dieser Zäune würden wir immer noch in ihrer Gewalt bleiben, und selbst angenommen, wir wären über diese Grenzen gekommen und noch einmal tausend Jahre am Leben geblieben, niemand, weder wir noch unsere Henker, würde sich aus dieser Niedrigkeit, in die das Menschengeschlecht gestürzt war, je wieder erheben können.” (Paolo Maurensig: Die Lüneburg-Variante. A. d. Ital. v. Irmela Arnsperger. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1994, S. 176.)
Posted in Caissa, Würfelwürfe | Comments Off on Die Lüneburg-Variante
Saturday, 13. December 2008
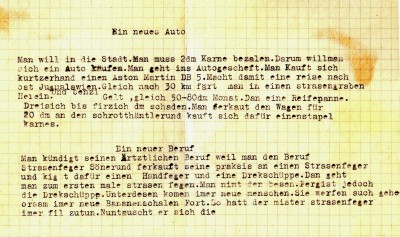
Buchstaben lernte ich lange vor Beginn der Schulzeit kennen, lesen und schreiben. Mein Vater hatte mir eine Tabelle gemalt, in der das Abece durch kleine Piktogramme erklärt war: ein Apfel für das A, eine Banane für das B, eine Citrone für das C usw. Als ich fünf Jahre alt war, überraschte uns ein Herr Kroll aus dem Parterre des Hauses, in dem wir damals wohnten, mit einem großzügigen Geschenk: einer Schreibmaschine, die in seiner Firma ausrangiert worden war. Ich lernte, wie man ein Blatt einspannt, und begriff bald die Funktion der Hochstelltaste. Im Jahr 1961 schrieb ich diese vier Texte humoristischer Kurzprosa. Wann immer ich sie wieder lese, schwanke ich zwischen Bewunderung und blankem Entsetzen. Was muss ich damals schon für ein Enfant terrible gewesen sein!
[1] Im Uhrlaub – Im Urlaub ist es sehr schön. Man kann schwimen. Man kann sich erholen. Man kann Braun werden. Ja Uhrlaub ist ein fergnügen, oder? Für manche nicht! Zumbeischpiel, für die die drei oder vier Kinder haben. Die Frauen, Morgens erger, Vormitags erger, Mitags erger, nachmittags erger, abents erger. Nachts erholung. Die Mäner, morgens bedinung, bis Abents bedinung,
[2] Im Wintersport – Man setzt sich auf eine Bank. Man ziet sich Schier an, und kracks, Die Sier brechen durch. Man hat einen schnupfen. man get in eine wirtschaft. Man bestelt sich ein bir, und noch eins und noch eins Und man ist besübelt. Man get nach hause. man wiert ausgeschimft.
[3] Ein neues Auto – Man will in die Stadt. Man muss 2dm Karne bezalen. Darum willman sich ein Auto kaufen. Man geht ins Autogescheft. Man Kauft sich kurtzerhand einen Aston Martin DB 5. Macht damit eine reise nach Juguslawien. Gleich nach 30 km färt man in einen strasengraben Herein. Und benzi Gelt, gleich 50-80dm Monat. Dan eine Reife[n]panne. Dreisich bis firzich dm schaden. Man ferkaut den Wagen für 20 dm an den schrotthäntlerund kauft sich dafür einenstapel karnes.
[4] Ein neuer Beruf – Man kündigt seinen Ärtztlichen Beruf weil man den Beruf Strasenfeger Sönerund ferkauft seine praksis an einen Strasenfeger und kigt dafür einen Handfeger und eine Drekschüppe. Dan geht man zum ersten male strasen fegen. Man nimt den besen. Fergist jedoch die Drekschüppe. Unterdesen komen immer neue menschen. Sie werfen auch gehorsam immer neue Bananenschalen Fort. So hatt der mister strasenfeger immer fil zutun. Nuntauscht er sich die
Posted in Werke, Würfelwürfe | 4 Comments »
Friday, 12. December 2008
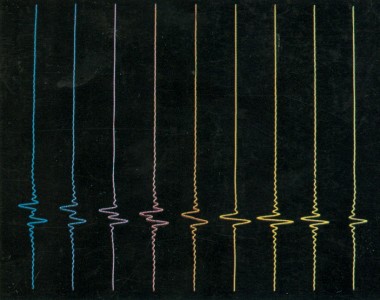
48 Zeichentasten hat meine Tastatur. Davon entfallen 29 auf die 26 Buchstaben des Alphabets und die drei Umlaute in Klein- und Großschreibung. Drei Tasten sind Interpunktionszeichen vorbehalten. Die verbleibenden 16 Tasten, genau ein Drittel, sind mit Zahl- und sonstigen Zeichen belegt: für die Ziffern von 0 bis 9, für acht weitere Satzzeichen, häufig benötigte Sonderzeichen wie §, %, & oder # und das Eszett, meinen Lieblingsbuchstaben. – Auch die Evolution der Tastaturbelegung seit Erfindung der Skrivekugle lässt Rückschlüsse auf den Bewusstseinswandel in den seither vergangenen 143 Jahren zu. Meine erste mechanische Schreibmaschine hatte noch das Zeichen für die englische Währungseinheit Pfund im Angebot; heute muss ich mir das ₤ umständlich aus dem Sonderzeichen-Vorrat heraussuchen, während der $ nach wie vor auf der Tastatur präsent ist und dort längst auch der € seinen festen Platz neben dem E gefunden hat. Die zackigen SS-Runen hingegen, die auf den Tastaturen der Fabrikate reichsdeutscher Schreibmaschinen-Hersteller – wie Adler, Olympia oder Triumph – zwischen 1933 und 1945 obligatorisch waren, sind heute selbst in den entlegensten Zeichensätzen nicht mehr aufzufinden. Hin und wieder, wenngleich nicht eben häufig, zeigt der Fortschritt doch auch einmal ein freundliches Gesicht, und sei’s durch eine „Leerstelle”.
Ich bin ein ausgesprochener Buchstaben- und alles andere als ein Zahlenmensch. Das würde ein Sherlock Holmes unserer Tage mit seinem wachen Blick und seiner Kombinationsgabe vermutlich schon von meiner Computer-Tastatur ablesen können, sind dort doch die Ziffern-Tasten die schmutzigsten, weil der Staub auf ihnen ausreichend Gelegenheit findet, sich dauerhaft niederzulassen und festzusetzen. Schon zu Schulzeiten sprach mich Deutsch mehr an als Mathe – mit einer Ausnahme: Den Geometrie-Unterricht habe ich geliebt und war dort vorübergehend sogar Klassenbester. Aber sobald es darum ging, die euklidischen Dreiecksbeweise – nur mit Zirkel und Lineal! – in trigonometrische Zahlenverhältnisse umzusetzen und Kosinus und Tangens auf den Plan traten, war ich abgemeldet. Und dass ich es in meinem späteren Lehrberuf als Buchhändler überhaupt so weit gebracht habe, erscheint mir im Rückblick noch immer als ein kleines Wunder, da ich doch den rechnerischen Fächern wie Buchhaltung, Kalkulation oder Betriebswirtschaft so gar nichts abgewinnen konnte. Deshalb verbindet mich mit der Welt der Zahlen seit jeher eine innige Hassliebe. Aber auch solche „gemischten Gefühle” entwickeln ja oftmals staunenswerte Produktivkräfte, weshalb mich das hier vorgestellte Lexikon der Zahlen noch immer gelegentlich in seinen Bann zieht.
Die Zahlen also, von 0 bis 3↑↑3 usw. usw. Dies ist ein Nachschlagewerk der besonderen Art, schon allein durch die Anordnung seiner Artikel, die nicht, wie bei Wörterbüchern üblich, alphabetisch von A bis Z erfolgt, sondern numerisch aufsteigend. Was David Wells darin aus Hunderten von Büchern und Zeitschriften über ihre merkwürdigen und interessanten Eigenschaften zusammengetragen hat, kann selbst einen arithmetisch Minderbemittelten wie mich stets aufs Neue in Verzückung versetzen. Ob es sich nun um natürliche, ganze, irrationale, imaginäre oder hyperreelle Zahlen handelt – immer wieder stellt sich die spannende Frage, welche geheimen Gesetzmäßigkeiten diesem abstrakten Ordnungssystem zugrunde liegen. Und immer wieder bin ich erstaunt, auf wie viele Fragen der menschliche Geist bis heute noch keine Antwort gefunden hat und vielleicht (z. B. in Fragen der Primzahlenverteilung) niemals finden wird. Dies mag zu einem Teil daran liegen, dass uns der metaphysische Begriff der Unendlichkeit auf diesem Feld in so konkreter und streng logischer Gestalt begegnet, ohne uns auf diesem Wege seinem Verständnis wirklich näher zu bringen. Mir als ungeübtem Laien auf allen Gebieten der höheren Mathematik ist jedenfalls der Ausspruch des Mathematikers Leopold Kronecker (1823-91) sehr sympathisch, der bei einem Vortrag 1886 in Berlin gesagt hat: „Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk.”
Wann immer ich dieses Buch aufschlage, entdecke ich in den unermesslichen Tiefen des Zahlen-Ozeans neue Wunder, die sich oft genug in ganz unscheinbare Sätze kleiden. So lese ich im Artikel unter 0,5 bzw. ½: „Es gibt zwölf Möglichkeiten, mit allen Zahlen zwischen 1 und 9 einen Bruch zu bilden, dessen Wert gerade gleich ½ ist.” (David Wells: Das Lexikon der Zahlen. A. d. Engl. v. Klaus Völkert. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1990, S. 25.) Warum aber, in drei Teufels Namen, sind es genau zwölf? „So ist es eben”, erwidert der gewöhnliche Faktenhuber, der keinen Blick hat für die Abgründe, die sich unter der Oberfläche des Selbstverständlichen, Allzuselbstverständlichen allenthalben auftun für jeden, der das naive Fragen des Kindes noch nicht ganz verlernt hat.
Auch Faktenhuber mögen an diesem Zahlen-Verzeichnis durchaus Gefallen finden. Sein eigentlicher Zauber jedoch erschließt sich vermutlich nur Menschen wie mir, die immer noch die Neunerreihe im kleinen Einmaleins durchbuchstabieren müssen, bis sie auf das Ergebnis 72 kommen. (72 ist übrigens die kleinste Zahl, deren fünfte Potenz sich als Summe von fünf fünften Potenzen schreiben lässt.)
Posted in Verzeichnisse, Würfelwürfe | 1 Comment »
Thursday, 11. December 2008
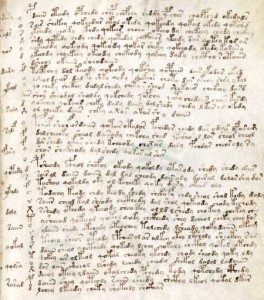
Kennedy und Churchill haben gemeinsam ein Buch darüber geschrieben; ein Dutzend ehrgeiziger Kryptoanalytiker ist in den vergangenen hundert Jahren an dem Versuch gescheitert, es zu entschlüsseln; seine Provenienz ist nur lückenhaft rekonstruierbar; und bis heute streiten sich die Gelehrten, ob es sich um das Werk eines Wahnsinnigen, eines Fälschers oder eines genialen Geistes handelt – das Voynich-Manuskript, eines der rätselhaftesten Schriftstücke der Literaturgeschichte, das heute unter der Katalognummer MS 408 in der „Beinecke Rare Book and Manuscript Library” der Yale University in New Haven (CT) aufbewahrt wird.
Als der Londoner Antiquar Wilfrid Michael Voynich (1865-1930) dieses äußerlich unscheinbare Buch 1912 in einer Sammlung kostbar illuminierter Handschriften in der Villa Mondragone bei Rom entdeckte, hatte er nach eigenem Bekenntnis spontan den Eindruck, auf etwas ganz Außergewöhnliches gestoßen zu sein: „Es war ein so hässliches Entlein, verglichen mit den anderen, mit Gold und Farben reich verzierten Manuskripten, dass meine Neugier sogleich erregt war.” (A Preliminary Sketch of the History of the Roger Bacon Cipher Manuscript; in: Transactions of the College of Physicians of Philadelphia. Serie 3. Baltimore 43.1916, S. 415; dt. Übers. nach Wikipedia.)
Das in Pergament eingebundene Werk trägt weder einen Titel noch einen Autorenvermerk. Auf über hundert Seiten sind kolorierte Federzeichnungen von Pflanzen, Tieren, Menschen und astronomischen Konstellationen zu sehen, kommentiert in einer völlig unbekannten und bis heute nicht entzifferten, nirgends sonst woher vertrauten Schrift [siehe Titelbild].
Selbst die Entstehungszeit des Manuskripts ist nach wie vor umstritten. Während ein Expertenteam das Konvolut jüngst aufgrund von Material und Schreibstil auf etwa 1500 n. Chr. datierte, trauen andere Forscher dem namengebenden „Entdecker” Voynich zu, das nur vorgeblich uralte Dokument höchstpersönlich gefälscht zu haben. Unwillkürlich musste ich bei solchen weitgespannten Spekulationen an Arno Schmidts Radio-Essay über Das Buch Mormon (1961) denken.
Spätestens seit der lange unmöglich scheinenden – und schließlich doch dem Franzosen Jean-François Champollion (1790-1828) dank dem „Stein von Rosetta” 1822 geglückten – Entzifferung der altägyptischen Hieroglyphen üben unverständliche Schriftzeichen eine magische Wirkung auf uns aus. Je länger die geheimnisvollen Symbole unserer forschenden Neugier widerstehen, desto mehr ziehen sie uns in ihren Bann. – Leider ist das umfassendste Buch zum Voynich-Manuskript in deutscher Sprache zurzeit weder regulär noch antiquarisch lieferbar. (Gerry Kennedy und Rob Churchill: Der Voynich-Code. Das Buch, das niemand lesen kann. A. d. Engl. v. Hainer Kober. Berlin: Rogner und Bernhard bei Zweitausendeins, 2005.)
Posted in Würfelwürfe, Xenographien | 6 Comments »
Wednesday, 10. December 2008

Ich bin geboren und lebe an einem Ort, der seinen Namen von der Esche (Fraxinus) herleitet. Auf dem langen Weg von Astnithi über Astnide, Astnidum, Astanidum, Asbidi, Asnid, Assinde, Asnida, Assindia, Essendia, Esnede, Essende und Essend entstand im Verlaufe von 1150 Jahren der heutige Stadtname: Essen.
Der Zufall will es, dass hinter dem Haus, in dem ich seit vier Jahren wohne, zwischen anderen Bäumen auch eine Esche wächst [siehe Titelbild]. Von meinem Arbeitsplatz aus, an dem ich dies schreibe, sehe ich sie täglich. Die Beobachtung der langsamen Veränderungen ihres Erscheinungsbildes im Wechsel der Jahreszeiten hat eine beruhigende Wirkung auf mich.
Zweimal im Jahr beschleunigen sich diese Veränderungen: im späten Frühjahr, wenn sie als letzte unter ihren Nachbarn ihr Laub austreibt; und im Herbst, wenn der Blattfall einsetzt. Extreme Wetterverhältnisse wie der Orkan Kyrill, der am 18. und 19. Januar vorigen Jahres in Mitteleuropa große Verwüstungen anrichtete, hat auch „meiner” Esche arg zugesetzt und einige kräftige Äste abgebrochen, deren Stümpfe noch heute an dieses Ereignis erinnern.
Dass der Baum Yggdrasil der nordischen Mythologie, der in seiner Riesenhaftigkeit das gesamte Weltgebäude darstellen soll, ebenfalls eine Esche war, könnte meiner nüchternen Kontemplation bei Betrachtung dieses Baumes noch ein spirituelles Element hinzufügen, wenn ich für dergleichen aufgeschlossen wäre. Immerhin berührt mich aber die symbolische Dreigliederung der Weltenesche, deren Baumkrone, Stamm und Wurzeln Himmel, Erde und Unterwelt darstellen.
Regelmäßig fotografiere ich die Esche hinterm Haus, immer vom gleichen Standort aus. Wenn ich die vielen hundert Fotos per Mausklick über meinen Monitor rauschen lasse, dann ergibt sich daraus eine Art Film, der den Lebenswandel des Baums im Zeitraffer erfahrbar macht. Ein Stummfilm übrigens, was dem Baum gerecht wird, denn die Geräusche, die von ihm ausgehen, das Rauschen der Blätter und das Knarzen der Äste, sind ja nicht eigentlich seine, sondern die des Windes, der sie hervorruft; und zumal der Baum sie selbst ja nicht hören kann.
[This posting is dedicated to Stan Brakhage (1933-2003), ingenious master of independence film.]
Posted in Würfelwürfe, Yggdrasil | 5 Comments »
Tuesday, 09. December 2008

Aus dem Weißen Rauschen, mit dem die Massenmedien uns Tag für Tag taub machen für die wirklich wichtigen Nachrichten, habe ich auf weitläufigen Umwegen eine schwache Andeutung auf das herausgefiltert, was uns binnen Kurzem bevorstehen könnte. Als sich Mitte Oktober abzuzeichnen begann, dass sich der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Barack Obama gegen seinen Widersacher John McCain bei der Wahl am 4. November durchsetzen würde, hielt sein designierter Vize Joe Biden – im Schatten der spektakulären Blamagen seines republikanischen Pendants Sarah Palin – vor einem exklusiven Kreis renommierter Zuhörer in Seattle anlässlich einer Spenden-Gala eine aufschlussreiche Rede. Biden, dessen bekanntermaßen „loses Mundwerk” ihn schon früher gelegentlich in arge Bedrängnis gebracht hatte, erkannte auch an jenem 19. Oktober zu spät, dass die Intimität dieser Veranstaltung durch die Anwesenheit einiger Pressevertreter in dem kleinen Versammlungsraum verletzt wurde: “I probably shouldn’t have said all this because it dawned on me that the press is here.”
Tags drauf konnte man bei ABC News den Bericht von Matthew Jaffe über Bidens prophetische Brandrede nachlesen, gespickt mit Originalzitaten: „Merken Sie sich meine Worte. In nicht einmal sechs Monaten wird die Welt Barack Obama auf eine harte Probe stellen, genauso wie damals John Kennedy. […] Seien Sie auf der Hut, wir werden eine internationale Krise erleben, eine künstlich geschaffene Krise, in der getestet wird, was in diesem Kerl steckt. Ich kann Ihnen mindestens vier oder fünf Szenarios nennen, wo diese Krise ihren Anfang nehmen könnte. […] Gürtet Eure Lenden! Wir werden mit Eurer Hilfe gewinnen, so Gott will, wir werden gewinnen – aber es wird nicht leicht. Dieser Präsident, der nächste Präsident, wird vor der wichtigsten Aufgabe stehen. Mann, das ist wie das Ausmisten des Augiasstalls. Dies ist mehr als nur, dies ist mehr als – denken Sie darüber nach, wirklich, denken Sie darüber nach – dies ist mehr als nur eine Finanzkrise, es geht um mehr als nur um Märkte. Es ist ein systemisches Problem, das wir hier mit unserer Wirtschaft haben. […] Aber dieser Kerl [Obama] hat’s in sich. Doch er wird Ihre Hilfe brauchen. Denn ich verspreche Ihnen, Sie alle werden in einem Jahr dasitzen und sich fragen: ,O Gott, warum steht die Regierung in den Umfragen so weit unten? Warum steht sie so schlecht da? Warum ist das alles so schwer?‘ Wir werden in den ersten zwei Jahren einige unglaublich harte Entscheidungen fällen müssen. Also bitte ich Sie schon jetzt – ich bitte sie schon jetzt: Halten Sie zu uns! Vergessen Sie nicht, dass Sie jetzt an uns geglaubt haben, denn Sie werden uns stärken müssen. Viele von Ihnen werden dann nämlich eher geneigt sein zu sagen: ,Hey Mann, halt mal die Luft an, hey, hey, also diese Entscheidung – ich weiß nicht.‘ [Im Original: ‘Whoa, wait a minute, yo, whoa, whoa, I don’t know about that decision.’] Denn wenn Sie denken, die Entscheidungen seien fundiert, wenn sie gefällt werden – und davon gehe ich aus, dass Sie so denken, wenn diese Entscheidungen getroffen werden -, dann sind sie wahrscheinlich nicht so populär, wie sie vernünftig sind. Denn wenn sie populär sind, dann sind sie wahrscheinlich nicht vernünftig.” [Kursivsetzungen von mir.]
Wie „damals John F. Kennedy”? Wer dächte da nicht an die Kuba-Krise von 1962, als die Welt 13 Tage lang am Rande des atomaren Overkills schwebte und um ein Haar noch einmal davongekommen ist? Und so ist es nicht weiter verwunderlich, wenn Hans Rühle in einem Essay in der Welt spekuliert, mit diesen orakelnden Worten des Senators von Delaware könne eigentlich nur ein militärisches Eingreifen gegen die schon sehr weit gediehenen Vorbereitungen des Iran gemeint sein, als zweiter islamischer Staat (nach Pakistan) in die Liga der Atommächte vorzustoßen. Wie weit der iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad, als Satrap des Mullah-Regimes unter Seyyed Ali Chamenei, bereits gelangt ist, trotz der hilflosen Bemühungen der IAEA unter Mohammed el-Baradei, das kann man in Rühles glaubwürdigem Essay nachlesen. Insofern ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die schlimmsten Prophezeiungen des endzeitlichen Philosophen Günther Anders Wirklichkeit werden.
Ende September fand in Irans Hauptstadt Teheran zur Erinnerung an den Krieg gegen den benachbarten Irak (1980 bis 1988) eine Militärparade statt, bei der eine Shihab-3-Rakete mit dem Schlachtruf bemalt war: “Israel must be wiped off the map.” Whoa, whoa! Auf solch große Sprüche folgen nach aller historischen Erfahrung schreckliche Taten. Beim Lesen von Bidens Rede musste ich unwillkürlich an die bekannten Churchill-Worte in seiner ebenso knappen wie prägnanten „Blood, toil, tears and sweat”-Ansprache aus dem Kriegsjahr 1940 denken – in deren Folge ein zivilisiertes, aber ideologisch verblendetes Land, mein Vaterland, durch die „fliegenden Festungen” von „Bomber” Arthur Harris in Schutt und Asche gelegt wurde.
Der Stall des Augias wird also demnächst, spätestens in einem halben Jahr, mit allen zur Verfügung stehenden Kräften modernster Waffentechnik ausgefegt? Dann können wir nur noch hoffen, dass immerhin ein paar Insekten dieses Großreinemachen überstehen – und in geschätzten zwanzig Millionen Jahren eine Kultur begründen, die größere Ergebnisse hervorbringt als die Musik von Bach, die Philosophie von Platon, die Kunst von Leonardo, Akiba Rubinsteins beste Schachpartien und die Geistesblitze eines Lichtenberg.
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Whoa, whoa!
Monday, 08. December 2008
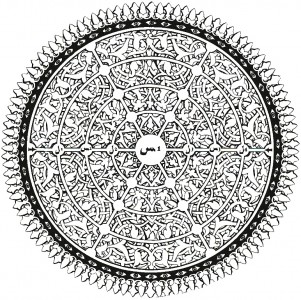
Die tägliche Nachrichtenflut aus den Massenmedien ist Segen und Fluch zugleich. Einerseits gibt es kaum noch „weiße Flecken” auf der aktuellen Landkarte des politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sportlichen Tagesgeschehens. Durch die globale Vernetzung der Informationskanäle bleibt kein noch so unbedeutendes „Ereignis” dem, der es zur Kenntnis nehmen will, verborgen. Wenn mich beispielsweise interessiert, wie ein spezielles Cricket-Match in Neuseeland ausgegangen ist, dann bin ich darüber via Internet binnen kürzester Zeit auf dem Laufenden. So weit, so gut.
Andererseits führt diese permanente Überflutung unserer Sinne mit Informationen in Bild, Ton und Text aber dazu, dass sich die Nachrichten in unserem Bewusstsein gegenseitig neutralisieren. Was wirklich wichtig ist für mich als freies Individuum und wesentlich für die Spezies, der ich angehöre, geht im reißenden Strom der Banalitäten unter. Hinzu kommt, dass in den Medien – und insbesondere im TV, das trotz Internet immer noch das weltweit meistgenutzte Informationsmittel ist – die Grenzen zwischen Fiktion und Realität ebenso verwischt sind wie die zwischen Nachricht und Werbung. Wenn man Augen und Ohren ohne Zwischenschaltung eines sehr feinen Filters aufsperrt, dann bleibt von der Message der Medien nicht mehr als ein Weißes Rauschen. Aber wer schafft es schon, die wenigen Weizenkörner aus den Bergen von Spreu auszusieben?
Und noch eine dritte Wahrnehmungstrübung verhindert, dass wir trotz der Unbegrenztheit, Zeitnähe und Totalität der uns zur Verfügung stehenden Informationen zu keinem zutreffenden Bild von der gegenwärtigen Welt gelangen: Wir wollen nicht wahrhaben, wie schlecht es uns tatsächlich geht. Der Atheist Günther Anders (1902-1992) hat diese Verweigerung schmerzvoller Erkenntnis „Apokalypse-Blindheit” genannt – und dabei ist ihm noch erspart geblieben, die jüngsten Verblendungen religiöser Eiferer zur Kenntnis nehmen und kommentieren zu müssen, die offenbar ihren Ergeiz darein gesetzt haben, den mittelfristig drohenden Zusammenbrüchen der globalen Ökosphäre und der Weltwirtschaft mit einer bellizistischen Apokalypse zuvorzukommen.
Gestern brachte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ein Interview mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer (*1958), der am Essener Kulturwissenschaftlichen Institut (KWI) eine Forschungsgruppe „Erinnerung und Gedächtnis” leitet und sich zuletzt mit der Klimakatastrophe und den daraus notwendig folgenden kriegerischen Konflikten in einem zu wenig beachteten Buch auseinandergesetzt hat. Anlass des Gesprächs, das Nils Minkmar mit dem klarsichtigen Professor führte, war die aktuelle weltweite Finanzkrise. Welzer bringt die aussichtslose Lage, in der wir uns befinden, unverblümt auf den Punkt. Sowohl das vom Menschen blindlings aus der Balance gebrachte Klimageschehen auf unserem Planeten als auch die nach der Globalisierung vollkommen unberechenbar gewordene, nicht mehr zu steuernde Weltwirtschaft überfordern die besten Fachleute in Ökologie und Ökonomie so offenkundig, dass jede „Heilung” dieser beiden tödlichen Wunden durch rationale Entscheidungen, selbst auf „höchster Ebene”, ausgeschlossen ist. Hier haben sich zwei hyperkomplexe Prozesse so weit verselbstständigt, dass sie durch kein noch so hochgelahrtes Spezialistentum mehr umzukehren, aufzuhalten oder auch nur zu bremsen sind. Die Aufgabe, unsere Zukunft und die unserer Kinder und Kindeskinder zu sichern, ist uns endgültig über den Kopf gewachsen.
Solch unfrohe Botschaft muss dem Interviewer natürlich als unzumutbar erscheinen, weshalb er auf geradezu rührende Weise seinen Gesprächspartner um hoffnungsvolle Zugeständnisse an den Geschmack der Leser seiner Sonntagszeitung anbettelt: „Herr Welzer, wo bleibt denn das Positive? […] Nicht noch mehr Pessimismus bitte.” (Nils Minkmar: Warum keiner mehr durchblickt; in: FAS Nr. 49 v. 7. Dezember 2008, S. 29.) Da beißt sich Kassandra auf die Zunge und quält sich ein Zugeständnis an eine immer noch mögliche Zukunft ab, die es schon längst nicht mehr gibt, auf dass dem – trotz aller Turbulenzen an den Börsen noch immer auf ein einigermaßen reguläres Geschäftsleben vertrauenden und dank dem unspektakulären Wetterbericht den Schlaf des Gerechten schlafenden – Sonntagszeitungsleser das Frühstücksei nicht im Hals stecken bleibe.
Posted in Oikos, Würfelwürfe | 5 Comments »
Monday, 24. November 2008

Das Schach hat, als Grenzfall zwischen Sport, Kunst, Spiel und Wissenschaft, Schriftsteller immer wieder dazu angeregt, es zum wesentlichen Motiv ihrer poetischen Werke, von Romanen und Novellen, Gedichten und Dramen zu erwählen. Als Spiegelbild der wirklichen Menschenwelt mit ihren unversöhnlichen Gegensätzen eignet es sich offensichtlich besonders gut, die Tragödie unseres Scheiterns en miniature abzubilden. Dennoch scheint die Schnittmenge zwischen schachspielerischem und literarischem Genie enttäuschend gering zu sein – und der Roman, der sowohl auf der ästhetischen Höhe seiner Gattung steht als auch der gedanklichen Tiefe des Schachspiels gerecht wird, wartet nach manchen respektablen und etlichen erbärmlichen Versuchen noch immer auf seinen großmeisterlichen Autor. – In lockerer Folge werde ich hier, als halbgebildeter Laie beider Hemisphären, einen groben Überblick wagen.
2006 erschien als Vorabdruck, mit Illustrationen von Marc Quinn versehen, im Londoner Observer der Roman Zugzwang von Ronan Bennett (* 1956), der mittlerweile auch als Buch in deutscher Übersetzung vorliegt. (Ronan Bennett: Zugzwang. A. d. Engl. v. Stefanie Röder. Berlin: Bloomsbury im Berlin Verlag, 2007.) Ort und Zeit der Handlung: St. Petersburg im März 1914. Der Ich-Erzähler, ein Psychoanalytiker namens Dr. Otto Spethmann, wird von seinem Freund, dem polnischen Geigenvirtuosen R. M. Kopelzon, um seelische Unterstützung für einen polnischen Schachmeister gebeten. Dieser (fiktive) Awrom Chilowicz Rozental, für den vielleicht Akiba Rubinstein Modell gestanden hat, hätte gute Aussichten, das Petersburger Schachturnier zu gewinnen, an dem neben dem amtierenden Weltmeister Emanuel Lasker unter anderen auch der Kubaner José Raúl Capablanca, Siegbert Tarrasch aus dem Deutschen Reich, die Russen Alexander Aljechin und Ossip Bernstein, der Brite Isidor Gunsberg und der US-Amerikaner Frank Marshall teilnehmen. Allerdings wird Rozental von einer (fiktiven) Fliege belästigt, und sein Sieg bei diesem damals größten Schachwettkampf aller Zeiten scheint gefährdet. Hier soll Spethmann in Kopelzons Auftrag Abhilfe schaffen, indem er den psychisch angeschlagenen Polen vor Beginn des Meisterturniers von seiner „Fliege” befreit. Kopelzon handelt aber, wie sich bald herausstellt, nicht etwa aus lauteren, rein schachlichen Motiven, sondern weil der verwirrte Pole, so er denn den Sieg in diesem Turnier davonträgt, seine Trophäe aus der Hand des Zaren Nikolaus II. persönlich entgegennehmen wird – und dabei die seltene Gelegenheit erhält, als Kopelzons Marionette ein Attentat auf den despotischen Monarchen zu verüben.
Die Romanhandlung schreitet zügig voran und ist zudem, wie ein saftiger (und vielleicht etwas überwürzter) Braten, gespickt mit mancherlei Nebenthemen. Der lange verwitwete Psychoanalytiker hat Erziehungsprobleme mit seiner widerspenstigen Tochter Catherine. Er verliebt sich knapp vor seinem 50. Geburtstag in seine Patientin Anna Petrowna Siatdinow, Tochter des reichsten Industriellen der Stadt, des herrschsüchtigen Peter Arsenjewitsch Sinnurow, mit dem Spethmann bald schon unliebsame Bekanntschaft schließen wird. Hat der allmächtige Geldmogul seiner Tochter Gewalt angetan, als sie ein 13-jähriges, ahnungsloses Mädchen war? Oder hat er gar, vor Annas unschuldigen Augen, damals seine eigene Mutter ermordet? Die Ereignisse überschlagen sich, Spethmann findet kaum Zeit zum Atemschöpfen, er ist ständig in Zugzwang.
Und zu alledem spielt der Ich-Erzähler nebenher noch eine Schachpartie gegen seinen Freund Kopelzon, deren Fortschritte der Leser auf zahlreichen in den Text eingestreuten Diagrammen mitverfolgen kann. Der Autor verrät uns im Anhang, dass er diese Partie von seinem Freund und fachlichen Berater übernommen hat, dem englischen Großmeister Daniel King (ELO 2514), der als Weißer bei der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft 2000 den überlegenen Russen Andrej Sokolow (ELO 2565) besiegte, indem er ihn im Endspiel geschickt in Zugzwang brachte. Das Wort „Zugzwang” wurde ursprünglich von dem Verleger und Schachmeister Max Lange 1858 in der von ihm herausgegebenen Berliner Schachzeitung geprägt und vier Jahre später in seinem Handbuch der Schachaufgaben etwas umständlich so definiert: „Der Zugzwang besteht in einer solchen Combination, welche der handelnden Partei aus dem Umstande, dass die Gegenpartei der Anforderung des Zuges genügen muss, entscheidende Vortheile erwachsen. Diese Erscheinung, dass die Erfüllung der Zugpflicht an sich die Stellung compromittiert, entspringt entweder aus Mittellosigkeit der Gegenpartei, welche bei geringer Auswahl an Zügen durch deren gezwungene Ausführung den Stand verschlechtert, oder sie ergiebt sich aus einer so ungünstigen Postirung aller Stücke, dass diese bei jeder nur möglichen Bewegung ihre Wirksamkeit gegenseitig behindern und hierdurch wesentlich den Angriffsplan der handelnden Partei fördern.” (Max Lange: Handbuch der Schachaufgaben. Leipzig: Verlag von Veit & Comp., 1862, S. 315.) Das Wort Zugzwang, das das Grimmsche Wörterbuch (Bd. 16, 3. Lfg. v. 1924) noch nicht verzeichnet, ist ins Englische und Russische als fachsprachlicher Germanismus übernommen worden und im Deutschen sehr bald auch in den nicht-fachlichen Sprachgebrauch eingegangen. Umgangssprachlich bedeutet „Zugzwang” allgemeiner, dass jemand durch eine Bedrohung zu einer bestimmten Handlung oder zumindest zu einer Reaktion gezwungen wird.
Mit dieser doppelten Wortbedeutung spielt Bennett, indem er seinen Helden Otto Spethmann in den sich überschlagenden, dramatischen Ereignissen der Handlung ständig unter Zugzwang (im allgemeinsprachlichen Sinn) setzt, ihm in der parallel laufenden Schachpartie aber die seltene Gelegenheit gibt, über seinen Kontrahenten zu triumphieren, indem er ihn auf dem Brett in Zugzwang (in des Wortes ursprünglicher Bedeutung) bringt. Das Verständnis der gewiss für Schachkundige interessanten Partie ist aber durchaus entbehrlich, um der verwickelten Romanhandlung zu folgen – und es bleibt sogar fraglich, ob es zu deren Deutung einen wesentlichen Beitrag leistet. Es drängt sich der Verdacht auf, dass Bennett mit dieser Zugabe, die insofern wie „aufgepfropft” erscheint, nicht lediglich den Kreis seiner Leser um die nicht unbeträchtliche Zahl der Schachbegeisterten erweitern wollte. Mein Fazit: Das spannende Buch bietet unterhaltendes Lesevergnügen vor historisch gut recherchiertem Hintergrund und mit psychologisch glaubwürdig entwickelten Protagonisten. Das Verhältnis des Schachpiels zur gelebten Wirklichkeit hingegen lässt Ronan Bennetts Roman kaum in einem neuen Licht erscheinen.
[Titelbild: Bengt Ekerot als Tod und Max von Sydow als Kreuzritter Antonius Blok in Ingmar Bergmans Film Det sjunde inseglet von 1957.]
Posted in Caissa, Würfelwürfe | 4 Comments »
Saturday, 22. November 2008

Als ich noch schlecht bezahlter Gast-Blogger bei Westropolis war, vom 5. April 2007 bis zum 31. August 2008, da dachte ich von Zeit zu Zeit laut über meine persönlichen Erfahrungen mit diesem neuen Medium nach, in insgesamt sieben Rückspiegeleien. Diese Serie setze ich hier fort, in meinem eigenen Haus, das ich am 24. März 2008 bezog und in dem mir niemand mehr den Mund verbieten kann. Der Preis für diese Unabhängigkeit ist schnell ausgerechnet. Das alltägliche Veröffentlichen meiner Kurzprosa wird jetzt nicht einmal mehr mit einem Hungerlohn honoriert. Und die Aufmerksamkeit, die diesen „Gedanken zum Tag in fünf Absätzen” widerfährt, hat sich ebenfalls deutlich reduziert: auf zwei Kommentatoren, die mir von Westropolis her unverdrossen die Treue halten (Matta Schimanski und Günter Landsberger).
Dass ich den faulen Kompromiss aufkündigte, unterm Dach eines Medienkonzerns zu bloggen, dessen im Revier seit Jahrzehnten ihre Monopolstellung behauptenden Printprodukte (Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Neue Ruhr Zeitung, Westfälische Rundschau und Westfalenpost) mir in ihrer billigen Mache seit jeher ein Dorn im Auge waren, habe ich trotzdem nie bereut. Die ungefährdete, absolute Dominanz eines solchen Meinungsmachers schien mir immer schon obskur – und das nicht einmal, weil ich vom konkurrenzlosen Einfluss dieses Alleinherrschers eine Manipulation der Stimmung im Revier befürchtet hätte, sondern wegen seiner alle strittigen Fragen unserer endzeitlichen Gegenwart neutralisierenden Gleichgültigkeit. (Im Nachhinein kann man die gescheiterten Versuche der Süddeutschen Zeitung und der taz, wenigstens im Kulturressort in diesem verteufelt wichtigen und höllisch verkommenen Revier einen Fuß in die Tür zu zwängen, gar nicht laut genug loben, haben sie uns doch immerhin gezeigt, dass hier Hopf und Malz verloren sind.)
Warum habe ich mich dann aber für 17 lange Monate auf dieses WAZ-Abenteuer Westropolis eingelassen und dort im Laufe dieser Zeit 362 meist ausführliche, akribisch recherchierte, stets mit eigenen Bildern versehene, gründlich verlinkte Beiträge veröffentlicht? Weil ich der naiven Hoffung aufgesessen bin, einem solchen Konzern könnte wirklich daran gelegen sein, sein journalistisches Selbstverständnis aus Anlass der radikal neuen Publikationsform Internet und via Weblog zu reformieren. Zudem imponierte mir, dass die WAZ Mediengruppe ihren Mitte Februar 2007 gestarteten Versuchsballon ausgerechnet vom Kulturressort aus aufsteigen ließ, bekanntlich nicht gerade ein Schmuckstück ihrer Printmedien. Erst als dann am 29. Oktober 2007 DerWesten online ging, wurde auch mir klar, dass die Kultur gerade deshalb als Experimentierfeld herhalten musste, weil dort inhaltlich wenig anbrennen konnte. Viel schlechter als das, was der Zeitungsleser im Revier aus diesem Haus geboten bekommt, konnten auch die Texte der bei Westropolis versammelten Laienspielschar, größtenteils ohne journalistische Vorbildung, kaum sein.
Dass Westropolis heute immer noch im Netz steht, ist nur damit zu erklären, dass diese Spielwiese kaum Kosten verursacht, gemessen am Zwei-Milliarden-Euro-Umsatz der WAZ Mediengruppe und bei einer Rendite im zweistelligen Bereich. Dass die Investitions-Philosophie der Brost- und Funke-Clans, die das Unternehmen groß gemacht hat, nach wie vor die Geschäftspolitik bestimmt, wird auch bei einer Petitesse wie Westropolis deutlich. Alle Macken und Mucken dieses Portals, von der willkürlichen thematischen Struktur bis zur nie richtig funktionierenden Suchfunktion, wurden nie einer Revision unterzogen. Diese totale Gleichgültigkeit gegenüber allen inhaltlichen und formalen Qualitätsansprüchen kann man sich eben leisten, wenn keinerlei Konkurrenz zu fürchten ist. Den bekannten Satz „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich’s gänzlich ungeniert!” kann man in diesem traurigen Fall leider noch toppen: „Im Land der Blinden gelten selbst Hühneraugen als sehend.”
Aber ich will nicht undankbar sein, schließlich sind alle meine Westropolis-Beiträge unverändert und mit allen Kommentaren unter der bekannten Adresse nach wie vor online. Dort findet man auch noch meine ersten sieben Rückspiegeleien: (I) Wer seid ihr? Wo bin ich? vom 7. Mai 2007; (II) Blogophilie vom 11. August 2007; (III) No Comments vom 7. Oktober 2007; (IV) Im Garten Eden vom 25. Dezember 2007; (V) Constant Message vom 28. Januar 2008; (VI) Eine nette Spielwiese vom 20. Februar 2008; und schließlich (VII) Exitus gem. §§ 186 und 187 StGB vom 28. Februar 2008. – Dass bei der Suche unterm Stichwort „Rückspiegelei” lediglich die Beiträge IV, V und VII angezeigt werden, ist eins der vielen ungelösten Rätsel, die dieser peinliche Weblog-Friedhof seinen Lesern aufgibt – wie ein orakelnd-paradoxer Grabspruch, in Stein gehauen, à la Timm Ulrichs: „DENKEN SIE IMMER DARAN MICH ZU VERGESSEN.”
Posted in Würfelwürfe | 4 Comments »
Friday, 21. November 2008
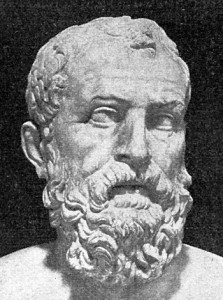
Mein Bekenntnis zur Genauigkeit warf die Frage (eines ehemaligen Lehrers) auf, wann diese Arbeitseinstellung in Pedanterie übergeht und somit eine eigentlich doch bewunderungswürdige Tugend zur Zwanghaftigkeit degeneriert, die unseren Spott verdient. Die Bezeichnung Pedant ist schließlich im heutigen, spätestens seit dem 17. Jahrhundert üblichen Sprachgebrauch stets abfällig gemeint, während ein genau, sorgfältig und gründlich arbeitender Meister, gleich welchen Fachs, kaum einen Vorwurf zu fürchten hat.
Μηδέν άγαν – Nichts zu sehr! Dies riet schon Solon [siehe Titelbild], einer der sieben Weisen im antiken Griechenland, seinen athenischen Mitbürgern. Einen verlässlichen Maßstab, wann denn aber des Guten zu viel getan wird, hat er freilich nicht mitgeliefert und solch ein allgemeingültiges Maß ward bis heute nicht gefunden. Wann schlägt tugendsame Sparsamkeit in lasterhaften Geiz um? Was ist noch heldenhafter Mut und was schon sträflicher Leichtsinn? Wer darf sich seiner Großzügigkeit rühmen und wer muss sich schämen, ein haltloser Verschwender zu sein? Zu bald jeder erstrebenswerten Charaktereigenschaft lässt sich eine Übertreibung finden, die aus ihr eine charakterliche Deformation macht, mag man sie nun in der biblischen Tradition als Laster, nach Charles Baudelaire als Spleen oder nach Sigmund Freud als Zwangsneurose bezeichnen. (Als großartige Kenner und Gestalter dieser allzu menschlichen Verstiegenheiten fallen mir noch ein: der Dramatiker Molière und William Hogarth, der Graphiker, vom kongenialen Georg Christoph Lichtenberg interpretiert.)
Bevor ich mich mit der Etymologie des Wortes Pedant beschäftigte, fragte ich mich, was es mit dem Fuß zu tun haben könnte, denn ich leitete es irrtümlich aus dem Lateinischen von pēs, pedis ab. Nun bin ich klüger und weiß, dass es vor vierhundert Jahren auf dem Umweg über das französische pédant und italienische pedante (für „Schulmeister; engstirniger Kleinigkeitskrämer”) vom griechischen Verb παιδεύειν („erziehen, unterrichten”) stammend ins Deutsche gelangte und insofern mit „Pädagoge” eng verwandt ist. (Vgl. Duden Band 7: Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim / Wien / Zürich: Bibliographisches Institut, 1963, S. 499; und Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1975, S. 536.) Dazu passt ja vortrefflich, dass heute jeder, der sich über die zunehmende Nachlässigkeit des Sprach- und Schriftgebrauchs im Internet beschwert, umgehend mit dem Vorwurf abgewatscht wird, er wolle sich bloß mit seiner oberlehrerhaften Arroganz wichtigtun.
Ich stelle mir vor, dass es die faulen Schüler waren, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts dem Wort Pedant (ursprünglich ganz neutral für „Lehrer”) seine bis heute gültige, negative Konnotation verliehen haben, als Racheakt nach den Rutenstreichen, die sie von ihren erbosten Vätern nach jedem vor Fehlern nur so strotzenden Diktat empfingen. Und gerade so bringen unsere heutigen nachlässigen Blogger, weil sie schlicht zu faul sind, Genauigkeit, Sorgfalt und Gründlichkeit walten zu lassen, dieses Tadelwort in Anschlag.
Ach, wie froh wäre ich doch, wenn man mich als einen Pedanten im ursprünglichen Sinn dieses Wortes annehmen wollte – und somit als Vorbild, dem zu folgen zwar Fleiß erfordert und den einen Schreibenden viel Zeit kostet, seinen möglicherweise zahlreichen Lesern jedoch ein Vielfaches an Zeit und Verdruss erspart, die sie, wie mittlerweile üblich und allseits akzeptiert, beim stammelnden Entziffern fehlerhafter Texte vergeuden müssen.
Posted in Langsamkeit, Würfelwürfe | 1 Comment »
Thursday, 20. November 2008

Das Phänomen ist bekannt und wird hie und da in Weblogs beschrieben: Nach einem hoffnungsvollen Start mit befriedigenden Ergebnissen stellt sich plötzlich völlige Leere ein. Der Blogger schaut ratlos aufs leere weiße „Blatt” auf seinem Monitor und sucht krampfhaft nach einem Thema. Das kann doch wohl nicht wahr sein! Wo ist nur die Inspiration geblieben, die in den vergangenen Wochen und Monaten in zuverlässiger Regelmäßigkeit für die konkreten Anlässe zum Schreiben sorgte? Soll ich tatsächlich heute über die Nominierung von Johannes Bultmann als Kaufmann-Nachfolger in der Intendantur der Essener Philharmonie schreiben? Und wo bleibt der notwendige Drive, daraus einen lesbaren Text zu zaubern?
Die meisten Kolleginnen und Kollegen überwinden diese Schrecksekunde sehr bald und fahren achselzuckend ihren Rechner runter. Ganz cool bleiben! Ein paar Tage später fällt ihnen dann wieder was ein, worüber sie schreiben können. Sie haben den heldenhaften Mut zur Lücke, schließlich zwingt sie kein Mensch, täglich ihre Geistesprodukte im Internet abzuliefern. Oft lässt sich in der Folge eines solchen ersten Zugeständnisses an den inneren Schweinehund beobachten, dass die Lücken immer größer werden, bis der Elan der frühen Tage völlig versiegt ist. Ich habe schon Weblogs entdeckt, deren jüngstes Posting bereits ein paar Jährchen auf dem Buckel hat.
Die diszipliniertere Minorität scheut die Unterbrechung wie der Teufel das Weihwasser und wringt sich an schwachen Tagen lieber irgendeinen unausgegorenen Stuss aus dem ermatteten Hirn, notfalls eine Meditation über die Schreibblockade selbst. Für diese zum täglichen Schreiben verdammten Blogger ist das ursprünglich so unschuldige Vergnügen zur Sucht geworden, sie leiden unter Schreibzwang. Ein Tag ohne Blogbeitrag ist für sie ein verlorener Tag. Ich gehöre offenbar zu dieser zweiten Sorte.
Aber machen wir uns nichts vor: Diese Symptome und Syndrome sind ja nicht erst im Webspace entstanden. (Allenfalls sind sie hier unmittelbarer zu diagnostizieren.) Die bekanntesten Beispiele für eine akute, dann chronisch werdende Schreibhemmung aus der neueren deutschen Literaturgeschichte, Wolfgang Koeppen und Uwe Johnson, will ich nicht aufwärmen, von Hölderlin und Nietzsche ganz zu schweigen. Stattdessen serviere ich ein Zitat von einem unverdientermaßen nahezu vergessenen Zwangsschreiber, dem gebürtigen Essener und ungebärdigen Kiffer Helmut Salzinger [Titelbild, mit Fernglas im Kreis seiner Freunde, 1986]:
„Ein Joint. Zeitweise habe ich einen fürchterlichen Produktionsdruck, aber nichts zu produzieren. Es fällt mir einfach nichts ein und rein, das ich sagen wollte, raus. Also muß ein Joint her, ders lockert. – Es ist die Zwanghaftigkeit, was mich daran stört. Nicht bloß am Joint. Auch am Produzieren. […] Das gewonnene Terrain ist längst wieder verloren. Daß ich in meinem Geschriebenen alles, mich ganz, geben müsse, diese Anstrengung übersteigt alles. Daneben bleibt nichts. Ich kann nicht mehr im Garten arbeiten, keine Wanderungen machen, wenn ich darüber schreiben will, auch das krieg ich nicht mehr hin. – Als es nicht ums schreiben ging, da konnte ich machen, was mir einfiel, und sei es schreiben, und konnte es tun. – Jetzt ist mir da wieder ein regelrechter Leistungszwang angewachsen.” (Helmut Salzinger: Nackter Wahnsinn. Die Wirklichkeit und die Suche nach ihr zwischen Konsens und Nonsens. Hamburg: Verlag Michael Kellner, 1984, S. 154.) Das Schreiben ist, wenn es mit Ernst betrieben wird, ein lebensgefährlicher Beruf.
Posted in Eccentrics, Nonsens, Würfelwürfe | 5 Comments »
Tuesday, 18. November 2008

In diesem Weblog kommt es auf jedes i-Tüpfelchen an. Das mag manchem lässigen Zeitgenossen wie Pedanterie erscheinen, ich halte es dennoch für meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, einwandfreie Arbeit abzuliefern, wenn ich auf diesem Wege schon vor die Weltöffentlichkeit trete. Die verbreitete Schluderei, die einem in diesem neuen Medium allenthalben ins Auge springt, empfinde ich als einen üblen Missbrauch von Möglichkeiten der unbeschränkten Mitteilung, nach denen sich unsere sorgfältigeren Ahnen die Finger geleckt hätten.
An einem konkreten Beispiel will ich verdeutlichen, wie weit meine Fürsorge für die Richtigkeit meiner hier veröffentlichten Texte geht. In meinem Artikel AtD II.8 stand bis heute der Satz: „Der Arzt Leslie E. Keeley (1834[?]-1900) gründete 1879 in Dwight (Illinois), 110 Kilometer südwestlich von Chicago, ein Sanatorium für Suchtkranke.” Das Fragezeichen in eckigen Klammern war nötig, weil die Internetquellen zu besagtem Dr. Keeley unterschiedliche Geburtsjahre angaben: 1832, 1834 und 1836. Ich entschied mich vorläufig für den Mittelwert, wenngleich mir bewusst blieb, dass dies ein fauler Kompromiss war.
Da Keeleys Sanatorium in Dwight, die Keimzelle seines Gesundheits-Imperiums, noch immer existiert, schrieb ich mit Unterstützung meiner Lektorin dorthin einen Brief: “Dear Sir or Madam, A friend of mine and I are doing some research concerning certain facts in Thomas Pynchon’s novel Against the Day, and we have also come across Dr. Leslie E. Keeley and his cure. – We do know that he opened his first sanatorium at Dwight in 1879, we do know that he died in 1900, and we do know several more facts – but we do not know when he was born. Different internet sources give different dates of birth: some tell us it was in 1832, others say it was in 1834, still others claim it was in 1836. It seems that Dr. Keeley died in L. A. but was buried in Dwight. This leads to our request: Could it be possible to get a photograph of his tombstone (if there is one still) proving his date of birth? – We would very much like to thank you in advance for answering our letter! – Yours sincerely, M. H.”
Die Antwort folgte wenige Tage später per E-Mail: “Manuel, I was given your letter on Monday by the Dwight Village Administrator. I am the one who takes care of genealogy requests that come to Dwight. This evening we went over to the Dwight Historical Society Museum to look on the newspaper microfilm records for Dr. Keeley’s obituary. This states that he was born in 1832. I made a copy of the whole page obituary to send to you via US postal service mail. I also copied the article that appeared in the newspaper the following week about his funeral to send to you. Yes, he is buried in Dwight. We will go out to the cemetery within the next few days and photograph the Keeley tomb for you. It is a big one. He was a very important person in Dwight. I assume the address on the top of your letter is the correct one to send the articles to. Please email us to make sure you wish to have these mailed to you. For this service, we would appreciate a small donation to the historical society. Marylin Thorsen”. Ich schickte einen Zehn-Dollar-Schein per Post nach Dwight und erhielt gestern die Todesnachricht und den Nachruf auf Leslie E. Keeley (Dwight Star and Herald, Vol. XXXV, 24. Februar und 4. März 1900).
Dort heißt es klipp und klar: “Leslie E. Keeley was born in Potsdam, N. Y., in 1832.” Da diese Jahreszahl aus einer zeit- und ortsnahen Quelle stammt, ist ihr wohl am ehesten zu trauen, weshalb ich sie für meinen Beitrag nun als gesichert übernehme. – Ich habe an diesem Einzelfall zeigen wollen, wie sehr mir an der sachlichen Richtigkeit und Genauigkeit aller meiner Veröffentlichungen in diesem Weblog gelegen ist. Dies scheint mir auch deshalb kein müßiges Unterfangen, weil sich gerade in Internet-Publikationen eine allgemeine Schlampigkeit epidemisch ausbreitet, die in wenigen Jahren zu einer erschreckenden Degression journalistischer Qualitätsstandards geführt hat. Es steht allerdings zu befürchten, dass eine stetig wachsende Zahl von Lesern die Einhaltung solcher Standards in Zukunft gar nicht mehr zu schätzen wissen wird.
[Titelbild: Leslie E. Keeley, LL. D.; aus: Dwight Star and Herald.]
Posted in Würfelwürfe | 11 Comments »
Monday, 17. November 2008

Ob das Zauberwort nun „Segne, heilger Wunderspruch” (aus dem Hebräischen von bracha und dabar) bedeutet, sich von der arabischen Beschwörungsformel abreq ad habra, dem „Donner, der tötet” ableitet oder, was mir am liebsten wäre, auf das aramäische Avrah KaDabra zurückgeht, zu Deutsch: „Ich werde erschaffen, während ich spreche” – seit Urzeiten gilt Abrakadabra als geheimnisvoller Bannfluch gegen das Böse, gegen Blitzschlag, Krankheit und finstere Mächte. Ich kenne es seit meiner frühesten Kindheit von der Kasperl-Bühne her, wo es der Zauberer, seinen schwarzen Stab schwingend, zu einem blechernen Donnergrollen aussprach: „Abrakadabra – dreimal schwarzer Kater!”
In neuerer Zeit, von Aleister Crowley bis Joanne K. Rowling, stehen diese elf Buchstaben für die magische Wirksamkeit des Unverständlichen, Rätselhaften, für die irrationale Heilkraft scheinbar bedeutungsloser Glossolalie. Im Grimmschen Wörterbuch kommt das Wort nicht vor, aber in meinem Großen Brockhaus von 1953, schon auf Seite 26 des ersten Bandes, wo es „allgemein” als Synonym für „verworrenes Gerede oder Geschreibsel” steht. Und dann gibt es da noch den „Nigger Vojan, der mal in Chicago bei einem Würfelspiel 175.000 Dollar gewonnen und an drei Stellen Abrakadabra eintätowiert hatte”, in Dashiell Hammetts Story The Big Knockover. (Dt. in Raubmord. A. d. Am. v. Renate Steinbach. Frankfurt am Main / Berlin: Ullstein, 1969, S. 56.)
Abrakadabra ist, sei es wie es will, eine gute Überschrift für die geheime, geheimnisvolle, irrationale Struktur, die diesem Weblog zugrunde liegt und die unablässig wächst und wuchert, in alle Richtungen, nicht als ein von Anfang an vorgegebenes Prinzip, sondern als ein organisch sich anpassendes System, ebenso buchstabengetreu wie unberechenbar, mir selbst als seinem Schöpfer ein ewiges Rätsel, der ich mich alltäglich von den Winkelzügen des Schicksals überraschen lasse.
Dass alles mit allem zusammenhänge, ist nur eine dumme Redensart. Dass aber manches mit diesem und jenem in Verbindung zu bringen ist, mag schon eher mit Fug und Recht zu behaupten sein.
Zusammenhänge sind in diesem Weblog nicht beabsichtigt, können aber beim besten Willen nicht ganz vermieden werden. Und wie sonst allüberall steckt auch hier der Teufel im Detail.
Posted in Würfelwürfe, Xenographien | 2 Comments »
Sunday, 16. November 2008

Meine achte Essener Wohnung (1. April 1988 bis 18. September 1991) war ein Schnäppchen: ein Altbau im Stadtwald mit einem riesigen Wohnzimmer, parkettiertem Fußboden, vielen Fenstern, hohen Decken, einer endlos langen Wand für meine ständig wachsende Bibliothek – wie geschaffen, um dort gelegentlich Feste zu feiern oder auch Gäste zu Veranstaltungen einzuladen. Ich packte die Gelegenheit beim Schopfe und lud vom 1. April 1989 regelmäßig zum Ersten eines jeden Monats meine an Literatur interessierten Freunde zu abendlichen Vorlesungen ein, die ich Literarische Soireen nannte und bei denen ich zu Gehör brachte, was mich selbst gerade begeisterte:
1989 I Eröffnungsprogramm 1. April – II Geschlecht & Gute Sitte 1. Mai – III Erleuchtungen 1. Juli – IV Totentanz 1. August – V Walter Serner: Hirngeschwuere 1. September – VI Der schwarze Fleck: Melancholie 1. Oktober – VII Das große Treffen 1. November – VIII Tolstoj: Die Kreuzersonate 1. Dezember 1990 IX Romane des Jahres 1989 1. Januar – X Gemeinheiten Reime Ungereimtheiten 1. Februar – XI Rendezvous im Zoo 1. März – XII Oskar Panizzas Urwald 1. April – XIII Der weiße Fleck: Arctica 1. Mai – XIV S/M 1. Juni – XV Sechs Beispiele für sechs Gattungen 1. August – XVI Spannungen 1. September – XVII Ziegeuner 1. Oktober – XVIII Frauen 1. November – XIX Vier Rosen für Gertrude Stein 1. Dezember 1991 XX Romane des Jahres 1990 1. Januar – XXI Männlein oder Weiblein? (mit Susanne Peter-Stierle) 1. Februar – XXII Streitigkeiten 1. März – XXIII Melville: Bartleby 1. April – XXIV Zwanzig Roman-Anfänge aus hundert Büchern 1. Mai – XXV Rückblick auf vierundzwanzig Soireen 1. Juni – XXVI Kafka: Ein Hungerkünstler 1. Juli – XXVII Poe: In schlimmer Klemme & Grube und Pendel 1. August – XXVIII/XXIX Puschkin: Dubrowskij 1. September / 1. November – XXX Rimbaud: Das trunkene Schiff 1. Dezember 1992 XXXI Romane des Jahres 1991 1. Januar – XXXII Liliput 1. Februar – XXXIII David Carkeet: Die ganze Katastrophe 1. März – XXXIV/XXXV Lawrence: Der Zigeuner und die Jungfrau 1. April / 1. Mai – XXXVI Das Floß der Medusa 1. Juli – XXXVII SOS 1. August – XXXVIII Ein schiefes Bild von Thomas Mann 1. September – XXXIX Lichtenberg: Sudeleien 1. Oktober – XL Oscar Wilde: Der eigensüchtige Riese & Die Nachtigall und die Rose 1. November – XLI Kalendergeschichten 1. Dezember 1993 XLII Romane des Jahres 1992 1. Januar – XLIII Die Blinden 1. Februar – XLIV-XLVII Nabokov: König Dame Bube 1. März bis 1. Juni – XLVIII In Sachen Felsch ./. Schmidt 1. Juli – IL Das zwanzigste Jahrhundert in Tagebuchblättern vom ersten August 1. August – L Hunger auf Hamsun 1. Oktober – LI Buchstabensuppe 1. November – LII Häppchen 1. Dezember 1994 LIII Roman des Jahres 1993 1. Januar – LIV Echolot 1. Februar – LV Pfennigfuchsereien und markige Wörter 1. März – LVI Suchsogsüchte 1. April – LVII Menschen-Esser 1. Mai – LVIII Der verlorene Hain: Früheste Kindheiten 1. Juli – LIX Geburt 11. Juli – LX Die Elemente (Folge 1 / Blei): Hans Henny Jahnn 1. August – LXI Träume 1. September – LXII/LXIII Nerval: Aurelia 1. Oktober / 1. November – LXIV Alfred Hitchcocks Vorlagen 1. Dezember 1995 LXV Bücher des Jahres 1994 1. Januar – LXVI Von den Neffen & Nichten 1. Februar – LXVII Die Jungfernfahrt der Titanic 1. März – LXVIII Wasserwerfer unterm Regenbogen 1. Mai – LXIX Vom Gehen 1. Juni – LXX Nachrichten aus Nord und Süd 1. Juli – LXXI Künstliche Paradiese I: Bhang 1. August – LXXII Alfred Döblin: Ein weiteres Feld in achtzehn Krumen 1. September – LXXIII Klemperer / Rühmkorf: Zwei Tagebücher 1. Oktober – LXXIV Cechov: Die Reise nach Sachalin 1. November – LXXV Wilhelm Busch 1. Dezember 1996 LXXVI Reisemärchen und Märchenreißer der Brüder Grimm 1. Juni – LXXVII Rausch der Sprache: Gedichte von Kurt Schwitters 11. Juli – LXXVIII Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 1. September – LXXIX Brecht: Gedichte 2. Oktober – LXXX Der Kuss in Theorie & Praxis 1. November – LXXXI Falsch verbunden! 1. Dezember 1997 LXXXII Helden in Not. Ein Romanfeuerwerk 1. Januar – LXXXIII-LXXXVI Gombrowicz: Die Besessenen 1. Februar bis 1. Mai – LXXXVII Max Kommerell: Das verbesserte Biribi & Was ist der Mensch? 1. Juni – LXXXVIII Hundert Jahre Wilhelm Reich 1. Juli – LXXXIX Künstliche Paradiese II: Opium & Psychotomimetica 1. August – XC Vom Glück 1. Oktober – XCI Über Bücher 1. November 1998 XCII Todesarten 1. Februar – XCIII Mord & Totschlag 1. März 1999 XCIV Peinlichkeiten 1. Januar – XCV Die Wiener Gruppe 1. Februar – XCVI Schluss! 1. April 2002 XCVII Fünf Grotesken 1. November 2003 XCVIII Krieg 1. Mai – IC Inger Christensen: Das 1. November 2004 C Zwei Erzählungen aus tausendundeiner Nacht 1. Mai 2005 CI Hans Christian Andersen zum 200. Geburtstag 1. April 2008 CII Ein Interview / Alice Schwarzer und André Müller (mit Michaela Coerdt) 1. Mai CIII Alfred Polgar 1. August CIV Zwei Orgasmen 1. November.
Als wir im September 1991 leider wieder einmal umziehen mussten, suchten wir uns eine Wohnung aus, zu der ein großes Souterrain gehörte. Die Literarischen Soireen waren gerettet! Eintrittsgeld habe ich nie genommen – ich war vielmehr meinen Gästen dankbar, dass sie diese sehr „anspruchsvollen” Rezitationsabende über sich ergehen ließen und manche von ihnen mir viele Jahre lang die Treue hielten, ganz gleich, auf welchen Wochentag der Erste zufällig fiel. – Hier die alphabetische Liste dieser vielen Heldinnen und Helden des aufmerksamen Zuhörens:
STEPHANIE ABTMEYER CHRISTOPH ALBRECHT KLAUS APPEL CHRISTIANE ARNDT ANNE-KATHRIN BALSCHEIT THOMAS BÄRMANN KARL BAUER IRENA BAYER STEFAN BAYER MATTHIAS BEITSCH ELKE BEYER HANNELORE BOBE ANDREAS BÖGEL DAGMAR BOHNENKAMP EVA BRANDECKER GEB. GLUNZ GESA BRASTER RITA BRAUN SUSANNE BRAUN THOMAS BRAUN ANNETTE BREITHAUPT TOM BREITHAUPT KARIN BREITHAUPT GÜNTER BREITHAUPT EVA BRESLEIN TOM BRIELE CHRISTOPH BUHL ELISABETH BUHL NORBERT BUHL BOŻENA CHOŁUJ LUDGER CLAßEN MICHAELA COERDT ROBERTA CORRENTI WOLFGANG CZIESLA DÉDÉ ULRICH DEUTER PETRA DIEHL MARTIN DISTELKAMP KAMILLUS DREIMÜLLER ARMIN EICHENHART SABINE ELBERT ANNE EL-HASSAN BUSCHE ERIK ELKE FASTENRATH CHRISTIANE FELDMANN CORNELIA FISCHER TOM FORGER CHRISTINA FRANKENBACH SUSANNE FREESE AMELIE FREYTAG SHIRLEY FÜLLBRUNN EDZARD FÜLLBRUNN HEINRICH FUNKE MICHAEL FUNKE MONIKA FUNKE EVA GABRIEL HERBERT GALLE GERDA GEBAUER-FUNKE TANJA GEBHART HARTMUT GEERKEN SANDRA GELLINGS BRIGITTE VAN GEMMEREN CHRISTOF GERVINK MAITE GERVINK ROYHIEH GHORBAN PAULI GIRARDET GERD GOCKEL-FELDMANN SABINE GÖDERSMANN-HINSENKAMP PETER GOERTZ BEATE GOLLNOW ECKHARD GOLLNOW ELKE GREVEL ULRIKE GÜHNEMANN REINHILD GUSY THOMAS HAMANN MONIKA HANISCH THOMAS HANNAPPEL WERNER HANNAPPEL KAREN HANNAPPEL UTA HANSEN BEATRIX HANSON-WEIß WOLF HAUG ELISABETH HEEG-RASCHE ANDREAS HEITMANN SIBYLLE HEITMANN DIETMAR HEMMERDEN GUDRUN HILTERHAUS GERD HINSENKAMP SASCHA HÖHNE-MÜLLER ASTRID HORST HANS-DIRK HOTZEL EMANUELA HOUMOUDA MICHAEL HUHN ERIKA JAENSCH MARIANNE JAKOBS IMAN JAUER RITA JURGENS-KRÜSSMANN STEFANIE JUNCKER MATEJ KELC THOMAS KERKEWITZ BIRGIT KERNEBECK HANNELORE KESSEL KLAUS KIEFER HERBERT KLEIN JOHANNES KLINGEN ANDREAS KLODT ANJA KNECHT RALF KOBER-SONDERFELD BARBARA KÖHLER GABI KOHN CLAUDIA KÖRNER DIETRICH KOSKA CHRISTOPH KRONE HOLGER KRÜSSMANN ANNETTE KUHLMANN CARSTEN KÜMPERS ANGELA KUNERT-PFISTERER ANDREAS KUNZE GÜNTER LANDSBERGER & GATTIN GRETE LAVIER ROLF-DIETER LAVIER JÜRGEN LECHTRECK HOLGER LEISTNER GEORG LÜMMEN BEATE LÜTTENBERG-BAUER SANDRA MAROTTA FRIEDHELM MARX CLAUDIA MERKEL MECHTHILD MERZNICH-SCHÖNEWEIS ANTJE MEYER KLAUS MEYER HEINER MEYER AUF DER HEYDE RUTH MEYERING GABRIELE MÜLLER HELMUT MÜLLER MARTINA MÜLLER THOMAS NEUHAUS HEIDE NIEMANN DIRK NOTTEBAUM KLAUS OERTERS ARZUM ÖZDEMIR EMIN ÖZYURT JALE ÖZYURT CHRISTIAN PAULSEN BEATRIX PESCHKE SUSANNE PETER-STIERLE DETLEF PEUSER-BRAUN JÜRGEN PFISTERER KAREN PIENE ILSE PIETRASS REINHARD PIETRASS DAVID PORSCH RENATE PORSCH IRINA PORZLER VIOLETTA POSSÉL EVA POSPISIL GEB. REIMANN SABINE PREUß SIMONA PROTTI RUPRECHT PÜLZ MICHAEL RASCHE HEIKO RATH ROLF REXHAUSEN STEFANIE REXHAUSEN FRANZ WILHELM ROHDE JUTTA ROHDE SILVIA RÜHL-HAUG JULIA RÜTHER VALERIA SASS SYLVIA SCHACHOW RAPHAELA SCHEIDMANN BEATE SCHERZER REINER SCHIEFLER CHRISTINA SCHLEGEL KATHARINA SCHLIMMGEN-EHMKE EVA SCHMIDT SUSANNE SCHMITZ BETTINA SCHNEIDER KLAUS SCHROER SABINE SCHWIETERT ANNE SILKENAT-GRAHE REGINE SOLIBAKKE ROSE SOMMER SUSANNE SONDERFELD GUDRUN STEMPELMANN-BLANKENHAUS TILL SUPAN MICHEL TAFFIN GITTA TAPPERT MAGDA TARONI MICHAEL THOMAS JOCHEN THORANT WOLFGANG TIETZE HAKKI TOKER BIRGIT TOKER EDITH TOKER TIMI TOPUZI EVA TRÖSTRUM TANIA VOLLMER MANFRED VOLLMER VALENTIN VOLLMER EVA WEBER NORBERT WEHR HARTMUT WEYH SABINE WIENERT GABRIELE WILPERS KERSTIN ZIMMERMANN SABINE ZIX & DIE VIELEN VERGESSENEN UND UNENTZIFFERBAREN
Seit dem 1. Januar 2005 wohnen wir nun in meiner zehnten Behausung. Literarische Soireen finden nur noch sporadisch statt, wenn nämlich der Erste des Monats auf einen Freitag oder Samstag fällt. Doch wenn der Zufall mich wieder einmal begünstigt, dann findet diese Veranstaltungsreihe vielleicht schon bald eine neue Heimat. Mein Repertoire ist ja reichhaltig genug – und über einen Mangel an Projekten und Ideen für zukünftige Vorleseabende kann ich nicht klagen.
Posted in Werke | 2 Comments »
Friday, 14. November 2008

Sieben Wochen nach seiner fristlosen Kündigung als Intendant der Essener Philharmonie hat Michael Kaufmann vorgestern zu den gegen ihn in einem dezidierten Fragen- und Antwortkatalog der Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP) erhobenen Vorwürfen Stellung bezogen. Sich bei einer öffentlichen Pressekonferenz den Medienvertretern zu stellen, dazu reichte offenbar die Courage nicht. Stattdessen vermittelte der wirtschaftlich gescheiterte Konzerthaus-Chef seine Sicht der Dinge vor einem kleinen Kreis handverlesener Medienvertreter, sekundiert von seinem Anwalt, denn schließlich muss Kaufmann fürchten, dass jedes falsche Wort in dem nun bevorstehenden Arbeitsgerichtsverfahren gegen ihn verwendet wird.
Letzteres kann ich ihm nicht verübeln, schließlich hat auch die TuP ihren Katalog mit dem Vorbehalt versehen, „dass es sich bei diesem Papier nicht um eine juristische, sondern um eine rein informatorische Zusammenstellung handelt.” Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, und Scherben hat es in dieser unseligen Affäre ja nun wahrlich schon genug gegeben. Außerdem kennen beide Seiten wohl das alte Sprichwort: Coram iudice et in alto mare in manu dei soli sumus. Bei aller gebotenen Neutralität des vorurteilsfreien Beobachters einer solchen Posse komme ich aber auch nach Kenntnisnahme von Kaufmanns Gegendarstellung zu keinem neuen Ergebnis. Im Vergleich zu den detailliert nachgewiesenen Pflichtversäumnissen des Intendanten, mit Zahlen, Daten und Fakten, nimmt sich seine Selbstverteidigung sehr dürftig aus. Wenn ihm nicht mehr einfällt, als die Hauptschuld an seinen eklatanten Etatüberschreitungen dem vermutlich nicht mehr haftbar zu machenden TuP-Geschäftsführer Otmar Herren in die Schuhe zu schieben, der im Sommer dieses Jahres in den Ruhestand ging, dann kann Kaufmann mir fast schon wieder leidtun. Und dass er gar die ausgewiesenen und mittlerweile auch von der Düsseldorfer Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft Warth und Klein testierten Zahlen, die unterm Strich für die beiden letzten Spielzeiten eine Etatüberschreitung von 1.700.000 € ausweisen, achselzuckend hinnimmt, mit Kommentaren wie „im Wesentlichen nicht in meiner Verantwortung” und „kenne ich im Einzelnen gar nicht” – dann ist das doch mindestens für den gut dotierten Kaufmann Kaufmann ein Armutszeugnis.
Dass die Wogen nun überhaupt so hoch schlagen, hat zweifellos seinen Grund darin, dass Michael Kaufmann andererseits ein großartiger Impresario dieser Kulturinstitution gewesen ist. Der international renommierte Dirigent Kurt Masur meint zum Beispiel, Kaufmann sei „der fähigste und wertvollste Intendant, den es in Deutschland gibt”. Und auch das feinnervige und hochgebildete Publikum der Essener Philharmonie steht treu zu seinem Ex-Intendanten und versammelt sich zu einer „Solidaritätsbekundung” anlässlich des besagten Pressegesprächs vorm Sheraton-Hotel neben der Philharmonie, um mit einem kleinen Ständchen dem Wunsch Ausdruck zu verleihen, dass Kaufmann seine Arbeit fortsetzen solle. Einerseits rührt diese fromme Hoffnung unser kunstsinniges Herz zu Tränen, andererseits zählt uns der Verstand in Heller und Pfennig vor, dass ein solcher Wunsch kaum realisierbar sein dürfte.
Halbwegs realistisch ist hingegen das Fazit, das der Essener Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Reiniger zur „Episode Kaufmann” an der Essener Philharmonie jüngst gezogen hat: „Das Problem des Michael Kaufmann besteht darin, dass dieser im persönlichen Umgang so gewinnende Mensch nicht willens und bereit war, finanzielle Vorgaben zu akzeptieren und sowohl das Programm der Philharmonie als auch sein persönliches Ausgabeverhalten hieran auszurichten. Es ist die intellektuelle Arroganz des Künstlers, der glaubt, sich über alles hinwegsetzen zu können.” (Leider nur halbwegs realistisch, lieber Herr Oberbürgermeister, denn statt „des Künstlers” hätte es richtiger wohl „des Kunstmanagers” heißen müssen. Ansonsten kann ich Ihrem Statement aus meiner jetzigen Sicht auf die Dinge, wie sie nun mal liegen, durchaus zustimmen.)
Wie weit sich aber bornierte Hochkultur-Fanatiker in ihrem Feuereifer zu geschmacklosen Vergleichen versteigen konnten, das hat mich anlässlich dieser Provinzposse dann doch überrascht – als ich nämlich lesen musste, mit welchen Worten der Verleger und Herausgeber Theo Geißler (*1947) in seinem Hausorgan Neue Musikzeitung – nmz diese Stellungnahme des Essener Oberbürgermeisters kommentierte: „Das Vokabular wird langsam gespenstisch, mit dem sich Essens Stadt-Obere vom gefeuerten Philharmonie-Intendanten Michael Kaufmann zu distanzieren suchen. Mit Formulierungen aus dem Repertoire der Reichs-Kulturkammer mischt sich jetzt Essens OB Wolfgang Reiniger in die Diskussion. Nach Rückkehr von einer Reise mit einer städtischen Delegation nach Tunis (zu viel Sonne?) erklärte Oberbürgermeister Wolfgang Reiniger zur Diskussion um den ehemaligen Philharmonie-Intendanten Michael Kaufmann … [es folgt das besagte Reiniger-Zitat]. Mit dem Vorwurf ,intellektueller Künstler-Arroganz‘ begründeten seinerzeit unter anderem die Nazis Bücherverbrennungen, Aufführungsverbote, Vertreibungen. Wie weit ist es in Essen gekommen, dass die Verantwortlichen für die Ausrichtung der Kulturhauptstadt 2010 vermutlich auch noch unbewusst in den Argumentations-Dreckkübel der kulturlosesten Zeit unserer jüngeren Geschichte greifen müssen? Sind in der Administration unserer ,Kulturhauptstadt 2010‘ nur noch geschichtslose Dilettanten und Erbsenzähler am Werk? Hart wie Kruppstahl[,] aber ein wenig weich in der Birne?” Um zum Reiniger-Kommentar anlässlich der Entlassung eines Philharmonie-Intendanten die Hetzreden der Goebbels-Meute bei der Bücherverbrennung in der Nazi-Zeit zu assoziieren, dazu bedarf es wohl schon eines gerüttelten Maßes an historischer Verblendung. Unwillkürlich musste ich bei diesem maßlosen Vergleich an den Fauxpas des Präsidenten des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung Hans-Werner Sinn (*1948) denken, der neulich die in die Kritik geratenenen Manager des Spätkapitalismus mit den verfolgten Juden im Dritten Reich gleichsetzte. – Gewährt die „Gnade der späten Geburt” (Helmut Kohl) eine Generalabsolution für Geschmacklosigkeit? Dann will ich sie jedenfalls nicht für mich reklamieren, obwohl noch ein paar Jahre jünger als die beiden hier erwähnten Herren.
Posted in Provinzglossen, Würfelwürfe | 1 Comment »
Thursday, 13. November 2008

Anfang 1966 erschien in einer Londoner Tageszeitung ein Interview, das der Beatle John Lennon der Reporterin Maureen Cleave, einer guten Freundin, gegeben hatte. Nach seinen Ansichten zum Thema Religion befragt, schwang sich der damals bereits weltberühmte Popstar zum Propheten auf: “Christianity will go. It will vanish and shrink. I needn’t argue about that; I’m right and I will be proved right. We’re more popular than Jesus now; I don’t know which will go first – rock’n’roll or Christianity. Jesus was all right but his disciples were thick and ordinary. It’s them twisting it that ruins it for me.” (Maureen Cleave: How Does a Beatle Live? John Lennon Lives Like This; in: Evening Standard v. 4. März 1966; Hervorhebung von mir.)
Ob Lennons Behauptung, die Beatles seien populärer als Jesus, für das Jahr 1966 zutraf, lässt sich nicht überprüfen, doch seit es Google gibt, kann man immerhin sehr einfach per Suchabfrage ermitteln, wieviele Belegstellen zu „Beatles” und zu „Jesus” im weltweiten Internet heute zu finden sind. Die Band aus Liverpool bringt es dort auf 59,9 Millionen Treffer, der Nazarener auf mehr als das Dreifache (183 Mio.). Ein solcher „Googlefight” ist übrigens auch auf einer kleinen animierten Website gleichen Namens im Internet verfügbar.
Dieser Popularitätstest ist aufschlussreich und je nach Gemütslage erheiternd oder deprimierend. Nachfolgend ein paar Beispiele, wie der Kampf „Hochkultur der Weltgeschichte vs. Trivialmythen der neueren Zeit” ausgeht (alle Zahlen in Mio.):
Sokrates vs. James Bond 3,0 : 37,3
Leonardo da Vinci vs. Ronaldinho 9,7 : 23,1
Shakespeare vs. Madonna 41,3 : 92,9
Philosophen vs. Rapper 3,8 : 21,6
Askese vs. Shoppen 0,5 : 14,0
Karl Marx vs. Karl May 6,4 : 10,1
Hamlet vs. Harry Potter 18,7 : 79,2
Orgel vs. Percussion 5,3 : 25,7
Julius Caesar vs. Barack Obama 3,1 : 94,2
Pyramiden vs. World Trade Center 1,4 : 31,1
Ich überlasse den geneigten Leser für ein paar Tage seinen eigenen Erwägungen und melde mich dann wieder zum gleichen Thema, wenn meine Melancholie verflogen ist und ich fähig bin, diesen Abstimmungsergebnissen der Web-Community mit wieder erstarktem Geist vielleicht ein paar nüchterne Erkenntnisse abzugewinnen.
[Fortsetzung: Popularität (II).]
Posted in Godzilla, Würfelwürfe | 4 Comments »
Wednesday, 12. November 2008

Der erste Exzentriker, mit dem ich mich vor nunmehr dreißig Jahren eingehend beschäftigte, war Oskar Panizza (1853-1921): ein glühender Antipapist, der (1895-1896) für sein satirisches, „gotteslästerliches” Drama Das Liebeskonzil ein Jahr Gefängnisstrafe in Amberg abbüßen musste, dann nach Zürich ins Exil ging, wo er ab 1897 seine kuriosen Zürcher Diskußjonen im Selbstverlag herausgab, um nach einer Anzeige wegen Unzucht mit einer minderjährigen Prostituierten mit seiner 10.000 Bände umfassenden Privatbibliothek weiter nach Paris zu fliehen. Halbwegs bekannt geworden war Panizza bei seinen zeitgenössischen Lesern durch seine düsteren Erzählungen in der Tradition von E. T. A. Hoffmann und Edgar Allan Poe, durch seine Dämmerungsstücke (1890) und Visionen (1893).
Was mich damals an Panizza entzückte, das waren sein radikales Einzelgänger- und Außenseitertum, der mutige Trotz, mit dem er allen weltlichen und himmlischen Mächten die Stirn bot, seine bis in die „Ortografie” hinein eigenwillige Schreibweise, die imposante, offenbar autodidaktisch erworbene Vielbelesenheit und schließlich sein sarkastischer Fürwitz. Dass André Breton diesen Meister des schwarzen Humors in seiner Anthologie de l’humour noir (1940, dt. 1971) nicht berücksichtigt hat, scheint mir noch heute unverzeihlich.
Oskar Panizzas nicht ganz schmales literarisches Œuvre – Wilpert-Gühring I verzeichnet immerhin 22 Erstausgaben – galt damals in den Antiquariaten als „selten und gesucht” und war somit für einen arbeitslosen Schulabbrecher wie mich völlig unerschwinglich. Wie groß war daher meine Freude, als ich entdeckte, dass die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf nahezu alle Werke des verehrten Autors im Bestand führte und auch auslieh. Und wie groß war mein Entsetzen, als ich dort in einer halbledergebundenen Kompilation der drei frühen Gedichtbände von Oskar Panizza – Düstre Lieder (1886), Londoner Lieder (1887) und Legendäres und Fabelhaftes (1889) – auf dem Vorsatzblatt den Stempel entdeckte: „Eigentum Reichsleiter Bormann”; und darunter in Bleistift dessen eigenhändige Unterschrift.
Diese Irritation hielt mich aber nicht davon ab, wenig später nach Berlin zu reisen und in der „Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz” weiterhin dem verehrten Exzentriker nachzuforschen. In deren Handschriftenabteilung ließ ich mir Panizzas lange verschollen geglaubten Spätling Imperjalja vorlegen, darin der im Pariser Exil immer tiefer in geistige Umnachtung versinkende Schriftsteller 1903 bis 1904 seinen persönlichen Hass und seine paranoiden Spekulationen gegen Kaiser Wilhelm II. zu Papier gebracht hat. Eine freundliche Bibliothekarin, die vermutlich von dem Feuereifer dieses ganz unakademischen jugendlichen Forschers gerührt war, schickte mir wenig später per Post eine Kopie der Mikroverfilmung dieses Manuskripts. Da ich natürlich nicht über ein Lesegerät für einen solchen Film verfügte, zerschnitt ich ihn in Einzelbilder und klemmte sie in Dia-Rähmchen, um anschließend via Projektor das Spätwerk meines Herrn und Meisters Wort für Wort von der Leinwand herab zu dechiffrieren.
Wie so viele Projekte aus dieser Zeit meines jugendlichen Überschwangs blieb auch dieses in den Anfängen stecken. Jürgen Müller hat zwei Jahrzehnte später diese mühevolle Arbeit, an der ich scheiterte, zu einem sehr erfreulichen Ende gebracht und das „Manuskript Germ. Qu. 1838″ mustergültig transkribiert und editiert. Das letzte Buch von Oskar Panizza, bevor er endgültig verrückt wurde, erschien 1993 im Guido Pressler Verlag in Hürtgenwald in der Reihe „Schriften zu Psychopathologie, Kunst und Literatur” – und wurde vor ein paar Jahren beim Bärendienst Buchversand für nur 14,00 Euro verramscht.
Posted in Eccentrics, Godzilla, Würfelwürfe | 3 Comments »
Tuesday, 11. November 2008

Uwe Johnson erzählt in seinem Hauptwerk Jahrestage die Geschichte von der Ermordung Robert Kennedys vor vierzig Jahren auf seine ihm sehr eigene Weise. Aus der Perspektive seiner Heldin Gesine Cresspahl. Unter anderem in der Form von Notizen ihrer Tochter Marie zu einem Aufsatzthema der Klasse 6b. (Uwe Johnson: Jahrestage. Band 3. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1973, S. 1281 ff.)
Das habe ich eben noch mal nachgelesen, in dem mir vom Autor am 14. März 1982 gewidmeten Exemplar dieses Buches. Johnson hält die Biographien von Robert Francis Kennedy (1925-1968) und Sirhan Bishara Sirhan (* 1944) gegeneinander, die verschiedener nicht sein könnten und sich dennoch an einigen Stellen berühren. „Nicht geraucht, nicht getrunken, kaum mit Mädchen gegangen” heißt es dort (S. 1302) über den 21-jährigen Robert. Und vom zwanzig Jahre jüngeren Sirhan liest man zur Zeit kurz vor seiner Tat: „Raucht nicht, trinkt nicht. Kann keinen Befehl ertragen.” (S. 1305)
Die Urne mit der Asche von Robert liegt seit vierzig Jahren auf dem Nationalfriedhof Arlington im US-Bundesstaat Virginia. Der verurteilte Mörder Sirhan lebt seit ebenfalls vierzig Jahren in einer Zelle des Hochsicherheitstrakts der Strafvollzugsanstalt Corcoran im US-Bundesstaat Kalifornien – sozusagen Zelle an Zelle mit Charles Manson.
„Auf dem Wege zur Pressekonferenz, in einem Küchenkorridor wurde er von hinten in den Kopf geschossen. […] Lag auf dem Boden, die Frau kniete neben ihm. Die Sache mit dem Rosenkranz.” (Johnson, a. a. O., S. 1299) – Doch hier irrt der Dichter. Neben dem sterbenden Robert Kennedy kniete keine Frau, sondern der mexikanische Hoteldiener Juan Romero (17); und er war es, der seinen Rosenkranz aus der Tasche zog, um ihn in die Hand des tödlich verletzten Präsidentschaftskandidaten zu legen.
Vermutlich wurde das Bild, das Uwe Johnson sich ein paar Jahre später von diesem Ereignis machte, von einem anderen, fast auf den Tag genau ein Jahr älteren überblendet [siehe Titelbild]. So fließt eins ins andere. Und es ist nicht mehr zu trennen, was gut und böse, was wahr und falsch ist; wer im Recht und wer ein Sünder war; wer Verderben säte und wer die Rettung hätte bringen können. Je genauer wir auf die Vergangenheit schauen, desto verwirrender erscheint sie uns. Nur jene Zeitgenossen, die getrübten Blicks nach einer Erklärung für das Gewesene suchen, finden schnell ihren Seelenfrieden. Die kleine Minderheit der gründlicheren Zuschauer, der ich mich verbunden fühle, quält sich tagtäglich damit ab, mehr zu finden als eine billige Lösung vom ideologischen Patentamt. Aber welche?
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Durcheinander
Monday, 10. November 2008

In § 6, Abs. 8c der Laws of Chess des Weltschachbundes FIDE (Fédération Internationale des Échecs) in der letzten, gegenwärtig gültigen Fassung vom 1. Juli 2005 heißt es: “The players must handle the chess clock properly. It is forbidden to punch it forcibly, to pick it up or to knock it over.” Unfreiwillig komisch lautet die offizielle deutschsprachige Version dieses Passus: „Die Spieler müssen die Schachuhr angemessen behandeln. Es ist verboten, auf sie draufzuhauen, sie hochzuheben oder umzuwerfen.” Offenbar kommen solche handgreiflichen Wutausbrüche gegen die gnadenlos davonlaufende Zeit und ihr unschuldig objektives Messgerät bei Schachturnieren in aller Welt häufig vor, sonst bedürfte es im Regelwerk ja nicht eines solchen drohenden Fingerzeigs.
Nachdem die FIDE vor acht Jahren beschlossen hatte, die Bedenkzeit der Schachspieler zu verkürzen, denen seither in Turnierpartien für die ersten 40 Züge nur noch 75 Minuten zur Verfügung stehen, plus 30 zusätzliche Sekunden pro Zug und 15 Minuten für den Rest der Partie, nahm der Schachhistoriker Ernst Strouhal dieses Zugeständnis an die medialen und organisatorischen Forderungen der Gegenwart zum Anlass, in dem „kulturellen Schachmagazin” KARL einen geistreichen Artikel zum Thema „Schach und Zeit” zu veröffentlichen. Sein Titel: Schach im Zeitalter der Ungeduld.
Strouhal erinnert daran, dass Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Eisenbahnen in England schon pünktlich auf die Minute verkehrten, Schachpartien noch keinerlei zeitlicher Begrenzung unterworfen waren und gelegentlich bis zu 20 Stunden dauern konnten. Lange Zeit hinkte das Schachspiel den fortwährenden Tempoverschärfungen unterm Zwang der industriellen Massenproduktion hinterher. Schließlich galt das Spiel ganz allgemein ja traditionell als ein mußevoller Ausgleich zur Arbeit und der Unrast des Erwerbslebens, als ein freier Spielraum unbeschwerten Vergnügens, wo die drückende Last der schmerzlich erkannten Vergänglichkeit und das drohende Unheil der Endlichkeit – wenngleich auch diesmal nur vorübergehend und für kurze Zeit – beiseitegeschoben werden konnte.
Dass nun, 150 Jahre später, das allmächtige Postulat der Zeitökonomie auch das Spiel unter seine Kontrolle gebracht hat, mag man beklagen, doch ist diese Entwicklung wohl unaufhaltsam und kaum umkehrbar. „Eine Geschichte der Zeit im Schachspiel könnte zeigen, dass das Spiel nicht nur ein Ort der Freiheit und Kontrast zur Welt der Arbeit ist,” so Strouhal, „sondern bei aller Autonomie auch ihr getreuliches Echo. Wenn heute gelebt und gearbeitet werden soll wie in einer Blitzpartie, warum sollte dann das Schachspiel anders aussehen?”
Als Motto für seinen Aufsatz hat Ernst Strouhal die Tempoangabe Robert Schumanns zu einem seiner Klavierstücke gewählt: „Schnell, noch schneller, so schnell wie möglich.” – Als anachronistisches Gegenstück zu diesem zeitgemäßen Kommando und trotzige Antwort darauf fällt mir der Titel eines Feuilletons von Hans Siemsen aus dem Jahr 1930 ein: „Nein – langsam! Langsam!” Uhr aus.
Posted in Caissa, Langsamkeit, Würfelwürfe | 1 Comment »
Sunday, 09. November 2008

Am kommenden Mittwoch, dem 12. November, wird in Dresden die 38. Schacholympiade eröffnet, das größte Schachturnier der Welt, das seit 1927 im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgetragen wird. Diesmal kämpfen über 2.000 Spielerinnen und Spieler aus 152 Nationen um die begehrten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Einer der stärksten Spieler der zwanzigköpfigen deutschen Nationalmannschaft ist der 29 Jahre alte Großmeister Jan Gustafsson (ELO 2620), der aus diesem Anlass ein ausführliches Interview gegeben hat. (Michael Eder: „Im Pokern ist mehr zu holen als im Schach”; in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Nr. 45 v. 9. November 2008, S. 24.)
Nahezu alles, was Gustafsson über das Schachspiel sagt, mehr aber noch, wie er es sagt, erregt meinen leidenschaftlichen Widerspruch. Schon das Motiv, sich für eine Karriere als Schachprofi und gegen sein Jurastudium zu entscheiden, ist mir suspekt: „[…] wenn man faul ist und irgendwann merkt, da kannst du sogar ein bisschen Geld damit verdienen, dann ist das ganz verlockend. Es ist ein angenehmer Lebensstil, man kann ausschlafen, reisen.” (Konsequenterweise hat Gustafsson sich nebenher auch dem professionellen Pokerspiel zugewandt und 2007 gemeinsam mit dem niederländischen Zocker Marcel „The Flying Dutchman” Luskey [auch Lüske] ein Buch zu diesem Spiel veröffentlicht: Poker für Gewinner.)
Mit beeindruckender Offenheit bekennt Gustafsson: „[…] vom Spielstil her neige ich eher zur Feigheit, das ist ein negatives Wort, sagen wir: zur Vorsicht. Im Schach gibt es ja die Möglichkeit des Remis. Es gibt zwei Typen von Schachspielern, es gibt die, die gern gewinnen, und die, die nicht gern verlieren. Es gibt spekulative Spieler, die versuchen, das Gleichgewicht zu stören. Ich gehöre zu den anderen, den Korrekten, den Risikovermeidern. […] Mir machen Niederlagen immer sehr zu schaffen, vielleicht bin ich deshalb auch übervorsichtig. Ich fand schon immer Verlieren viel schlimmer als Nicht-Gewinnen.” Wie schrecklich! Wenn alle Schachspieler mit der gleichen Einstellung am Brett säßen wie Gustafsson, dann gäbe es bald nur noch Remis-Partien – und das Schach wäre ein totes Rennen ohne jede Spannung, ohne jeden Reiz.
Dazu passt, was der junge Mann auf die Frage antwortet, welches seine schönste Partie gewesen sei: „Ich habe im Schach nicht so den Zugang zu Schönheit. Ich freue mich über jeden Sieg, und wenn ich gewonnen habe, bin ich zufrieden. Mir ist es eigentlich egal, ob das ästhetisch war oder nicht, ob das ein Fallrückzieher war oder ein Abstauber, das ist mir wurscht. Ich berausche mich nicht an schönen Kombinationen.” Solche lässigen Bekenntnisse machen mich tatsächlich sprachlos.
Wie kann man dieser edlen Kunst sein Leben widmen – ohne eine Spur von Leidenschaft? Und es offenbar auf diesem Weg, mit solch einer furztrockenen Grundeinstellung zum „königlichen Spiel”, langfristig bis an die Weltspitze der Großmeister schaffen? Dieses Interview stimmt mich einerseits traurig, bestätigt mich aber andererseits in meiner Auffassung, dass die interessanten, aufregenden und ästhetisch reizvollen Schachpartien längst nicht mehr zwischen den mit allen Wassern der Eröffnungstheorie gewaschenen Profispielern geboren werden, sondern – wenngleich auch dort nur äußerst selten – im Mittelspiel der Dilettanten.
Posted in Caissa, Würfelwürfe | 3 Comments »
Saturday, 08. November 2008

Einer der wesentlichsten Gründe, warum ich Schach spiele: Weil ich hoffe, dabei etwas über mich selbst herausfinden zu können. Eine vermeidbare Verlustpartie ist zwar immer schmerzhaft, doch werden die eingebüßten ELO-Punkte oft von dem Erkenntnisgewinn mehr als aufgewogen. Vorgestern spielte ich in der „Schacharena” als Schwarzer gegen den schwächeren Mike Lariah (ELO 1362) – und verlor. Hier der für mich sehr lehrreiche Verlauf dieser vor Fehlern auf beiden Seiten strotzenden Partie.
1. d2-d4 d7-d5 2. e2-e4. – Ich bin, was die Eröffnungstheorie angeht, vollkommen unbeleckt. Was ich bereits in meinem zweiten Zug ausprobiere, muss wohl gänzlich wertlos sein, denn es kommt in der ECO-Liste der gebräuchlichen Spielweisen gar nicht erst vor: 2. … e7-e6. (Stattdessen wird laut ECO-Code D00 hier grundsätzlich 2. … d5xe4 gespielt, das Blackmar-Gambit.) 3. Sb1-c3 Sg8-e7 4. Sg1-f3 d5xe4 5. Sc3xe4 Se7-d5 6. Lf1-b5† Lc8-d7 7. Lb5-c4 h7-h6 8. Se4-c5.
Kaum hatte die Partie begonnen, schon befand ich mich in arger Bedrängnis. Die Bedrohung meiner Dame durch 9. Sc5xb7 wollte ich nicht hinnehmen und zog darum 8. … Lf8xc5 9. d4xc5 0-0 10. b2-b4. – Jetzt schon 10. … Sd5xb4 zu spielen, schien mir zu riskant, stattdessen sicherte ich zunächst erst mit 10. … a7-a6 11. Lc1-b2 Sd5xb4 und stand doch jetzt eigentlich mit einem Mehrbauern nicht schlecht da.
12. Dd1-d4? – Hier sah ich nun nur noch das drohende Matt durch 13. Dd4xg7 – und übersah fatalerweise die einzig richtige Antwort 12. … b4xc2†, durch die ich zu dem weiteren Bauern auch die Dame hätte kassieren und damit die Mattdrohung aus der Welt schaffen können. Zwar hätte ich nach 13. Ke1-d2 Sc2xd4 14. Sf3xd4 einen Springer verloren, aber bei diesem Stand wäre die Partie für mich wohl so gut wie gewonnen gewesen. Stattdessen ging es nun weiter abwärts, weil mich die Panik blind gemacht hatte: 12. … f7-f6 13. 0-0-0 c7-c6 14. Sf3-e5.
Ich war durch den verpassten Damengewinn völlig aus dem Gleichgewicht gebracht und übersah, dass ich hier ohne Gefahr 14. … f6xe5 hätte spielen können, denn 15. Dd4xe5 hätte mich nach Tf8-f6 vorläufig nicht in Bedrängnis gebracht. Weiter diktierten Frustration und Panik mein Spiel: 14. … Tf8-e8? 15. Dd4-g4 Dd8-a5?? (Was mache ich da nur? Besser gewesen wäre doch beispielsweise 15. … g2-g4. Aber offenbar trauerte ich noch immer dem verpassten 12. Zug nach, statt mich mit der längst nicht aussichtslosen Situation abzufinden und meine Chancen zu nutzen.) 16. Se5xd7 Sb8xd7 17. Td1xd7 Da5xc5?? 18. Dg4xg7 matt. – Danach war ich für mindestens eine Stunde sehr schlecht gelaunt. Übrigens stand ich überhaupt nicht unter Zeitdruck. Das Spiel dauerte gerade mal 16 Minuten, bei 30 Minuten Bedenkzeit für jeden Spieler. Mein spielentscheidendes Defizit wurde dabei offenkundig: Was mir fehlt, nicht nur auf dem Schachbrett, ist Gelassenheit.
Posted in Caissa, Würfelwürfe | 5 Comments »
Friday, 07. November 2008

Leider viel zu spät veröffentlicht jetzt die Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP) einen „Fragen- und Antwortkatalog” zur fristlosen Entlassung des Intendanten der Philharmonie Essen, Michael Kaufmann, die deren 13-köpfiger Aufsichtsrat am 23. September mehrheitlich (mit fünf Stimmenthaltungen) beschlossen hat. Wer die ausführlichen Antworten auf die dort gestellten 17 Fragen vorurteilsfrei zur Kenntnis nimmt, kann kaum zu einem anderen Ergebnis kommen: Die Kündigung von Kaufmann war nicht nur berechtigt, sondern auch hoch an der Zeit. Und selbst gegen den Vorwurf, dass sie zu spät erfolgt sei, muss man die Befürworter des Antrags, die sich mit ihrem Votum glücklicherweise durchgesetzt haben, in Schutz nehmen. Sie haben damit Courage bewiesen und einen allerdings schmerzlichen und unpopulären Schritt vollzogen, was ihnen nachträglich gar nicht hoch genug anzurechnen ist. (Und ich habe ihnen in meinem ersten Beitrag zu diesem Thema wohl in einigen Punkten Unrecht getan, was sie durch ihre behäbige Informationspolitik allerdings selbst verschuldet haben.)
Der Vorwurf des „Provinzialismus”, der sich gegen diese einzig richtige Entscheidung erhob, fällt nach Veröffentlichung dieses Katalogs auf die unsachlichen Lamentierer zurück, die in den folgenden Tagen unisono in einen empörten Krakeel verfielen, allen voran auf unser meinungsführendes Provinzblättchen mit Millionenauflage, die WAZ, mit ihrem der deutschen Sprache nur für den Hausgebrauch seines Arbeitgebers mächtigen Zampano Wulf Mämpel, der mit seinen wetterwendischen Meinungsäußerungen als „Schaf im Wolfspelz” unter dem Pseudonym Lupus tagtäglich bei seinen treuen Lesern, den Wertschätzern unfreiwilliger Komik, für Erheiterung sorgt.
Den Leserbriefschreibern und Blogkommentierern, die sich zu diesem „peinlichen Eklat” äußerten, dürfen wir ihre unbedarften Stellungnahmen nicht verübeln, denn sie wissen es ja nicht besser, da sie schließlich in ihrer meinungsbildenden Grundversorgung auf besagtes Krawallblatt und seine gleich tönenden Ableger angewiesen sind.
Dass unser aller Boulevard-Berthold vom hohen Hügel herab über den Entscheid der „Wilden Dreizehn” die Nase rümpfte und dem verantwortungsvoll handelnden Gremium der TuP postwendend einen Tritt in den Hintern verpasste, das ist wiederum provinziell und weit eher mit der Gattungsbezeichnung „Schmierenkomödie” zu versehen als der gut begründete Kaufmann-Rausschmiss, der mehrfach so genannt wurde. Doch für Beitz gilt ja längst unumschränkte Narrenfreiheit, er schwebt als „Guter Gott von Ruhropolis” über den unruhigen Wassern der Kulturhauptstadt – und niemand außer einem Enfant terrible wie mir, das nichts mehr zu verlieren hat, traut sich – auch eine Art von Narrenfreiheit – ihm auf seine alten Tage dies zu sagen. „Sancta senilitas!”
Die tiefste Niederung der Provinzialität wurde aber schon zuvor durchschritten, als sich der prominenteste Mann des TuP-Aufsichtsrats, der Kulturdezernent der Stadt Essen und Geschäftsführer der RUHR.2010 GmbH, Oliver Scheytt, bei der Abstimmung am 23. September seiner Stimme enthielt (vgl. WAZ Nr. 236 v. 9. Oktober 2008). Das ist nicht mehr nur provinziell, diese Feigheit hat schon dörflichen Charakter: „Was sollen bloß die Nachbarn denken?” Ich bin, durchaus im wörtlichen Sinn, Nachbar dieses stimmlosen Entscheiders. So steh ich hier und kann nicht anders, als zu sagen und zu bekennen: „Du bist ne Kneifbüx, Olli!”
Posted in Provinzglossen, Würfelwürfe | 5 Comments »
Thursday, 06. November 2008

So sehr ich den „Internetmarktplatz für antiquarische Bücher” in den vergangenen zehn Jahren schätzen gelernt habe – das Stöbern in den nicht-virtuellen Angeboten möchte ich dennoch nicht missen. Während ich dort, bei ZVAB und anderen Anbietern, in aller Regel finde, was ich gezielt suche, entdecke ich in den Regalen der Antiquariate, auf den Büchertischen der Trödelmärkte und in den Ramschkisten der Buchhandlungen gelegentlich Schmankerl, die mir auf meinen gründlich geplanten Wegen durch die Literatur niemals begegnet wären. – So zieht mich seit ein paar Tagen ein Buch in seinen Bann, das ich vor der Tür eines hiesigen Großbuchhändlers zum Spottpreis von nur 3,95 € aus dem Kasten vor der Tür fischte: Stunde Null. Deutschland unter den Besatzungsmächten. Berlin: Matthes & Seitz, 2004.
Die Namen der beiden Autoren, Tüngel und Berndorff, sagten mir nichts – und vermutlich aus gutem Grund, gehörten sie seit den 1960er-Jahren, als sich mein politisches Bewusstsein zu entwickeln begann, doch keineswegs zur damals tonangebenden intellektuellen Elite der Linken. Richard Tüngel (1893-1970) war zwar von den Nazis 1933 aus seinem Amt als Baudirektor in Hamburg gedrängt worden, musste aber als Mitbegründer und späterer zweiter Chefredakteur der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit nach der von ihm veranlassten Veröffentlichung eines Artikels des NS-Staatsrechtlers Carl Schmitt und nach seinem Veto gegen einen kritischen Beitrag über den amerikanischen „Kommunistenjäger” Joseph McCarthy dort seinen Hut nehmen. Und auch sein Freund Hans Rudolf Berndorff (1895-1963), der unter dem Pseudonym Rudolf van Wehrt national-heroische Bücher über die Schlacht bei Tannenberg (Wie Hindenburg die Russen schlug, 1922) und über den siegreichen „Blitzkrieg im Westen” (Frankreich auf der Flucht, 1941) geschrieben hatte, konnte sich nach der deutschen Niederlage nicht damit legitimieren, in der Zeit der Verblendung zum „inneren Widerstand” gehört zu haben. Beide überstanden offenbar die langen zwölf Jahre des kurzen Tausendjährigen Reichs zwischen Hoffen und Bangen, wie Millionen betrogener „Volksgenossen” mit ihnen – und fanden sich wieder in einem Scherbenhaufen. Auf die nationale Megalomanie folgte ein Absturz ins Nichts, in die totale Ohnmacht, in Not und Armut.
In ihrem gemeinsamen Buch, das zuerst 1958 unter dem Titel Auf dem Bauche sollst du kriechen im Christian Wegner Verlag in Hamburg erschienen ist und in der Neuauflage um ein Nachwort des ungarischen Essayisten und Literaturkritikers László F. Földényi ergänzt wurde, schildern die beiden Verfasser, Kapitel für Kapitel abwechselnd, ihre Erlebnisse und Erfahrungen als Journalisten im besetzten Deutschland der Jahre von 1945 bis 1949. Berndorff erlebt von September bis November 1945 als Prozessbeobachter in Lüneburg das erste große Gerichtsverfahren gegen die KZ-Verbrecher und anschließend den Nürnberger Prozess (ab November 1945). Tüngel kämpft währenddessen in Hamburg um Publikationsmöglichkeiten und um eine unabhängige deutsche Presse. Die erbärmlichen materiellen Bedingungen, unter denen sie ihrem Beruf nachgehen, werden in aller Drastik deutlich – aber auch die geradezu sklavische Abhängigkeit von den Besatzern, ohne deren Goodwill gar nichts geht.
Einiges war dabei für mich auch in der Sache durchaus neu und erhellend. So hatte ich mir zum Beispiel nie recht klargemacht, mit welch düsteren Erwartungen die Generation meiner Eltern und Großeltern in den späten 1940er-Jahren in die Zukunft blickte. Die Besiegten waren offenbar mehrheitlich davon überzeugt, dass die Besatzungszeit und ihre Entmündigung als Bürger eines selbstbestimmten Volkes viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte andauern würde. Sie gingen außerdem fest davon aus, dass es mindestens ebenso lange dauern würde, bis die deutsche Wirtschaft und Industrie wenigstens wieder den Stand der Vorkriegszeit erreichen würde. Sie waren vollkommen entmutigt, ohne jede Perspektive, bar jeder Hoffung auf ein menschenwürdiges Leben. Und selbst intelligente Menschen wie Berndorff und Tüngel, mit relativ unbehindertem Zugang zu den Informationsquellen der „Siegermächte”, teilten diese pessimistische Ansicht. Erst vor dem Hintergrund dieser deprimierenden kollektiven Gemütslage wird das Wunderbare am „Wirtschaftswunder” der 1950er-Jahre so recht verständlich.
Berndorff zitiert die Aussage des SS-Hauptsturmführers Dieter Wisliceny vor dem Tribunal in Nürnberg, die ich ebenfalls noch nicht kannte. Ende Februar 1945 war Wisliceny seinem Vorgesetzten Adolf Eichmann zum letzten Mal in Berlin begegnet. Er wurde gefragt, ob Eichmann damals irgendetwas über die Zahl der getöteten Juden gesagt habe. Wisliceny: „Ja, er drückte das in einer besonders zynischen Weise aus. Er sagte, er würde lachend in die Grube springen, denn das Gefühl, daß er fünf Millionen Menschen auf dem Gewissen hätte, wäre für ihn außerordentlich befriedigend.” (S. 150) Und gerade vor dem Hintergrund, dass in dieser Woche der Spiegel groß mit einer Titelstory über Heinrich Himmler aufmacht, der dort dämonisierend als „Hitlers Vollstrecker” verkauft wird, ist sehr lesenswert, was Berndorff über die Vernehmung von Ernst Kaltenbrunner, Chef des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA), in Nürnberg schreibt (S. 195-204). „,Heydrich war viel intelligenter und noch entschlossener als Himmler‘, sagte Kaltenbrunner im Zeugenstand.” Nicht Himmler, diese „kleine Leuchte”, sondern der musisch begabte Intellektuelle Reinhard Heydrich war das Zentralgestirn des Bösen am faschistischen Firmament. Aber dessen „Biografie eines Dämons” hat ja der Stern schon vor sechs Jahren ausgeschlachtet.
[Titelbild vom Schutzumschlag des besprochenen Buches: Der Goetheforscher Ernst Beutler mit seinem Sohn in der Ruine des Frankfurter Goethe-Hauses, Sommer 1945.]
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | 2 Comments »
Wednesday, 05. November 2008

Der „personifizierte Durchblick” (Isolde Schaad 1999) hat dem Spiegel wieder einmal ein Interview gegeben, „über die aus der Finanzkrise geborenen Schreckensszenarien, die Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus an unterschiedliche Staatsformen und die Langeweile von Spielcasinos”, wie es im dreizeiligen Untertitel heißt. Der Spiegel zahlt vermutlich gut. Anders wäre kaum zu erklären, warum sich ein längst pensionierter „Vordenker der Linken” wie Hans Magnus Enzensberger (78) zu einem solchen Plauderstündchen hergibt. (Matthias Matussek und Markus Brauck: „Phantastischer Gedächtnisverlust”; in: Der Spiegel Nr. 45 v. 3. November 2008, S. 76-78.)
Zur Weltwirtschaftskrise, die spätestens seit dem Crash der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers Inc. am 15. September 2008 Realität geworden ist und die die „Bewusstseins-Industrie” (Enzensberger 1970) euphemistisch eine Finanzkrise zu nennen sich mittlerweile angewöhnt hat – zu diesem Thema fallen HME, dem einstmaligen „Wasserzeichen für geistige Erstklassigkeit” (Schaad), zwar allerlei flotte Sprüche, provokante Aperçus und naseweise Eulenspiegeleien ein. Aber unterm Strich bleibt dem Leser seiner schadenfrohen Sticheleien nur der fade Nachgeschmack eines selbstzufriedenen Grandseigneurs, dessen Gleichgültigkeit gegenüber der Zukunft sich noch einen pikanten Akzent verleiht: Ich hab’s doch schon immer gewusst!
Enzensberger konstatiert „Zyklen von Boom und Crash, von Größenwahn und Panik” und hält diesen beständigen Wetterwechsel der ökonomischen Verhältnisse für ein Naturgesetz des Kapitalismus: „Das war schon immer so.” Und er streut, posierend im knallroten Pullunder [siehe Titelbild], hier eine „Prise Marxismus” und dort „die eine oder andere Brechstange aus der Werkstatt des Herrn Marx” in seine pessimistischen Verzichtserklärungen auf jede positive Utopie ein. Offenbar hat sich HME damit arrangiert, dass die Welt und mit ihr seine erlesene Andere Bibliothek zu Grunde gehen muss. Kinder hat er ja wohl keine, insofern ist solche Abstinenz kein Kunststück. Dass Enzensberger nun aber auf seine alten Tage ausgerechnet an einem Filmprojekt (von Peter Sehr) über das Leben von Georg Christoph Lichtenberg mitwirkt, lässt mich schaudern. Wäre Schopenhauers Vita nicht ein geeigneteres Sujet gewesen?
Ich hätte ja aber schon längst gewarnt sein müssen, als rechtschaffener Großaktionär mit spekulativen Optionen auf zukünftige Werte. In seinem Gedicht Paxe finden sich die Zeilen: „Mühselige sind es und Beladene / aus Wuppertal und Chicago. / Weiß der Himmel, warum / sie vergessene Götter verehren, / wofür sie Vergebung suchen / und wundertätige Heilung.” (Zit. nach du. Die Zeitschrift der Kultur; Heft Nr. 699 v. September 1999, S. 50.)
Nein, der Himmel weiß es nicht. Schon damals war Enzensberger offenbar ratlos und überfordert. Dieses Versagen kann man sich nur leisten, wenn man mit dem Leben abgeschlossen hat. Und dann sollte man besser schweigen. So groß kann das Spiegel-Honorar doch wahrlich auch wieder nicht gewesen sein.
Posted in Oikos, Würfelwürfe | Comments Off on Pullunder
Tuesday, 04. November 2008

Für diesen Nonsens, der den imponierenden Namen Degree Confluence Project trägt, bedurfte es zweier geodätischer Errungenschaften der Neuzeit: erstens der Einführung eines verlässlichen Koordinatensystems aus Breiten- und Längengraden, das jedem Punkt auf dem Globus eine eindeutige, zweiteilige Zahl aus Grad, Minuten und Sekunden zuweist; und zweitens der technischen Entwicklung eines weltweit funktionierenden Messsystems mittels künstlicher Satelliten und erschwinglicher Empfangsgeräte der von ihnen ausgesandten Signale, das eine präzise, auf die Gradsekunde genaue Ortung ohne großen Aufwand und besondere Fähigkeiten erlaubt.
Die erste Voraussetzung war im Wesentlichen 1884 erfüllt, als sich der Null-Meridian durch Greenwich als willkürlich festgesetzte Bezugsgröße für die Längengrade gegen bis dahin konkurrierende Koordinaten durchsetzte. Nach der Inbetriebnahme des Global Positioning Systems (GPS), das im April 1995 seine volle Funktionsbereitschaft erreichte, sollte nur noch ein knappes Jahr vergehen, bis der Amerikaner Alex Jarrett das Degree Confluence Project aus der Taufe hob. Am 20. Februar 1996 begab er sich mit seinem Freund Peter Cline an den Schnittpunkt des 43. nördlichen Breiten- und des 72. westlichen Längengrads und hielt die Lokalität und das Ereignis dieser Eroberung in ein paar Fotos fest. Damit war der erste Konfluenzpunkt „im Kasten” und der Startschuss zu einem weltweiten Wettrennen abgefeuert, dessen Ende vorläufig noch in den Sternen steht.
Schließlich gibt es auf der Erdkugel exakt 64.442 Konfluenzpunkte, von denen 21.543 an Land, 38.409 auf Meeresflächen und 4.490 im Bereich der Polkappen liegen. Ein Konfluenzpunkt ist per definitionem der Schnittpunkt eines ganzzahligen Längen- und eines ebensolchen Breitengrades. Die Aufgabe, die sich den Teilnehmern an diesem Projekt stellt, lautet in wenigen Worten: „Suche einen bislang noch nicht dokumentierten Konfluenzpunkt auf, fotografiere von diesem Punkt aus in alle vier Himmelsrichtungen die umgebende Landschaft, stelle die Authentizität deiner Eroberung durch ein Foto von der Digitalanzeige deines GPS-Geräts unter Beweis und veröffentliche diese Fotos, wenn möglich ergänzt durch einen Erfahrungsbericht, im Internet.”
Dieser Einladung folgten in den vergangenen zwölf Jahren zahlreiche Konfluenzpunkt-Jäger in aller Welt. Mittlerweile kann man sich schon Umgebungsbilder von über 6.000 ganzzahligen Koordinaten-Schnittpunkten ansehen. Das auf den ersten Blick erstaunlichste Ergebnis einer solchen Weltbetrachtung ist, dass nur auf einer verschwindend kleinen Teilmenge dieser Bilder Spuren menschlicher Existenz auszumachen sind. So ist der erst vor zehn Tagen „eroberte” Punkt 32° N und 36° O in der Stadt Marka [siehe Titelbild, Blickrichtung gen Norden], nur wenige Kilometer von der jordanischen Hauptstadt Amman entfernt, eine seltene Ausnahme. Meist sieht man auf den Bildern nichts als unberührte Natur: Wald, Steppe, Wüste – und Wasser.
Bei der Betrachtung dieser vielen menschenlosen Bilder wurde mir so deutlich wie nie zuvor, dass wir an grenzenloser Selbstüberschätzung leiden. So gravierend uns selbst die Spuren erscheinen mögen, die wir in unserer gerade einmal 6.000 Jahre währenden Karriere als Spezies mit einem im Verhältnis zu unserem Körpergewicht beeindruckend schweren Gehirn auf der Oberfläche „unseres” Planeten hinterlassen haben, so marginal sind doch diese Zeichen unserer vorübergehenden Dominanz der belebten Natur auf Terra. Und so erteilt uns in unserer Hybris Befangenen dieses Nonsens-Projekt nebenbei eine wertvolle Lektion. Wenn das nicht tröstlich ist …
[Einen früheren Blogbeitrag zum gleichen Thema veröffentlichte ich bei Westropolis, er ist dort Anfang 2011 der Komplettlöschung zum Opfer gefallen. Eine überarbeitete Fassung dieses Artikels findet der interessierte Leser hier.]
Posted in Nonsens, Verzeichnisse, Würfelwürfe | Comments Off on Konfluenz
Monday, 03. November 2008

[1] In der Flanerie kehrt der Mensch, am Ausgang des inhumanen Zeitalters grenzenloser Beschleunigung, zu seiner ihm gemäßen Bewegungsform zurück. Der Flaneur, die Flaneuse von heute sind Pioniere bei der Erprobung jener natürlichen Fortbewegung, die nach dem unausweichlichen Zusammenbruch der automatisierten Mobilitätsgesellschaft allein noch übrig bleiben wird. Zugleich sind sie die ersten Wiederentdecker jener archaischen Erfahrungsmöglichkeiten vor Erfindung des Rades, als noch der Schritt und nicht die Umdrehungszahl den Rhythmus menschlichen Lebens und Erlebens bestimmte.
[2] Mit der Heimkehr zum Gehen und der Abkehr vom Fahren und Fliegen leisten Flaneur und Flaneuse bewussten Verzicht auf eine Bequemlichkeit, die von Anbeginn ihrer Entwicklung auf Kosten der natürlichen Umwelt ging. Neben dem Raubbau an der Natur nahmen die Passagiere der immer schneller werdenden Fahrzeuge aber auch eine schleichende Zerstörung ihrer Sinnlichkeit hin. Der vermeintliche Komfort des Ortswechsels stahl den durch die Landschaft katapultierten Körpern einen großen Teil ihres unmittelbaren Empfindens. Die Flanerie ist das Projekt der Rückeroberung dieser verlorenen Welt.
[3] Die Erfahrung der Langsamkeit ist die ursprünglichste Passion des Flanierenden, seine Leidenschaft und zugleich sein bewusst gelebtes Leiden. Unsere allein auf Schnelligkeit zugerichtete Umwelt erlebt er von außen, als Außenseiter und Anachronist, spürt unmittelbar ihre morbide Hässlichkeit, Schmutzigkeit, Verkommenheit. So gewinnt er eine unverstellte Einsicht in den Zustand dieser menschgemachten Wirklichkeit, die den vorbeirasenden Gefangenen in ihren Fahrgastzellen lebenslänglich fremd bleiben muss. Flanieren ist somit in einer hierfür nicht ausgelegten Realität das Beschreiten, Beschreiben eines Passionswegs.
[4] Flaneur und Flaneuse der urbanisierten Welt zu Beginn des dritten Jahrtausends sind keine Romantiker mehr wie ihre Vorgänger seit Charles Baudelaire. Zwar mag sich der gebildetere Teil von ihnen mit Sympathie auf die großen Vorbilder besinnen: auf die Spaziergänger Johann Gottfried Seume und Robert Walser, auf die großstädtischen Flaneure der 1920er-Jahre wie Walter Benjamin, Franz Hessel, Victor Auburtin, Siegfried Kracauer, Hans Siemsen und Walther Kiaulehn – oder gar auf einen nahezu völlig unbeachteten Tippelbruder im Geiste wie Hans Jürgen von der Wense. Doch die Zukunft des Flanierens sieht notgedrungen anders aus.
[5] Nebenbei hält auch eine philosophische Avantgarde den schützenden Schirm übers Haupt des modernen Flaneurs. Hierzu zählen nicht erst die französischen Situationisten um Guy Debord und Raoul Vaneigem, sondern viel früher schon die Peripatetiker der Antike und der Wandersmann Giordano Bruno. In neuester Zeit haben sich Denker wie Günther Anders, Paul Virilio, Joseph Weizenbaum und Neil Postman um die erkenntnistheoretische Durchleuchtung des „rasenden Stillstands” und der zunehmenden Virtualisierung unserer Lebenswelt verdient gemacht. Doch das Lesen ist nur eine Entspannungsübung nach der Arbeit: dem Flanieren.
[Fortsetzung: Pedifest (II).]
Posted in Flanerie, Würfelwürfe | 3 Comments »
Tuesday, 28. October 2008

Dies sind die beiden Gegenstände, die als allererste in meinen Besitz gelangten und noch immer zu meinem Eigentum an beweglichen Sachen gehören: Der Löffel und die Gabel aus Silber mit meinem eingravierten Vornamen waren ein Geschenk meiner Großeltern väterlicherseits zu meiner Geburt.
Messer, Gabel, Schere, Licht /sind für kleine Kinder nicht! Dieser „Zuchtreim” unbekannter Herkunft, der für den Beginn des 20. Jahrhunderts nachgewiesen, aber vermutlich bedeutend älter ist und noch ganz in der Tradition der „Schwarzen Pädagogik” (Katharina Rutschky 1977) steht; dieser Spruch, der auch gut in Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter (1844) stehen könnte, fällt mir ein, wenn ich die Gabel betrachte. Ihre stumpfen Zinken lassen den Warnhinweis in diesem Punkt obsolet erscheinen, nachdem schon das Wort „Licht” als Synonym für „offenes Feuer, Flamme” längst antiquiert und kaum einem Kind mehr verständlich war. (Erstaunlich übrigens, dass der altertümliche Reim 1965 durch den gleichnamigen Schlager von Vicky Leandros, ihren allerersten Hit, eine Wiederauferstehung erleben durfte – als Metapher für die Gefahren vorehelichen Geschlechtsverkehrs.)
Nicht mehr in meinem Besitz befindet sich eine kleine Kinderschere, an die ich mich noch sehr gut erinnere, weil sie eins meiner Lieblingsspielzeuge war. Auch sie hatte abgerundete Spitzen, was mich allerdings nicht hinderte, eines Sonntagmorgens – meine Eltern schliefen noch – mit dem Scherchen mein blond gelocktes Kopfhaar, meine Augenbrauen und sogar meine Wimpern zurechtzustutzen.
Das silberne Löffelchen wäre mir vor etlichen Jahren um ein Haar abhandengekommen. Bei einer nächtlichen Fete in meiner Wohnung hatte sich eine Besucherin, die ich nur flüchtig kannte, so sehr in diesen Löffel verliebt, dass sie mir allerlei verlockende Angebote machte, wollte ich ihn ihr überlassen. Der Ausgang dieses Kampfes mit meinem inneren Schweinehund ist offenkundig [siehe Titelbild], das Schicksal der erfolglosen Sirene hingegen war wohl unausweichlich. Sie starb bald darauf am „Goldenen Schuss”.
Das silberne Gäbelchen hingegen ist auf seine alten Tage neuerdings wieder in Gebrauch und findet eine vergleichsweise ganz unschuldige Verwendung. Wenn mein Enkel, gut ein Jahr alt, gelegentlich über Nacht bei uns zu Gast ist, dann jauchzt er wie ein Schneekönig, sich mittels solch noblen Bestecks an seinem Gemüsebrei delektieren zu dürfen.
Posted in Dingwelt, Würfelwürfe | 1 Comment »
Monday, 27. October 2008
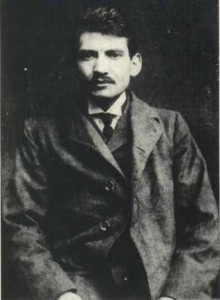
In gewissen Kreisen des individualistischen Anarchismus wird er in seinem Heimatland Frankreich noch heute als Held verehrt, hierzulande ist er hingegen nahezu unbekannt: Alexandre „Marius” Jacob (1879-1954), der „anarchistische Meisterdieb”, der angeblich Maurice Leblanc als Vorbild für seinen berühmten Gentleman-Einbrecher Arsène Lupin gedient haben soll.
Als der 17-jährige Alexandre Jacob, an einem rätselhaften Virus erkrankt, seine erste Berufstätigkeit als Matrose aufgeben muss, hat er schon viel von der Welt gesehen. Im zarten Alter von elf Jahren hatte er als Schiffsjunge angeheuert, überquerte mehrmals den Atlantik, lernte die Südsee kennen – und die rauen Sitten an Bord, wo er sich den sexuellen Nachstellungen älterer Seefahrer ausgesetzt sah und schließlich auf einem Piratenschiff landete. Angewidert von den Metzeleien auf den gekaperten Handelsschiffen, an denen sich zu beteiligen er gezwungen wurde, desertierte er und wurde bei seiner Rückkehr in Frankreich wegen dieses Vergehens vor Gericht gestellt, allerdings freigesprochen. Seine Bilanz dieser frühen Jahre als Abenteurer auf den Weltmeeren offenbart seine Ernüchterung und sollte sein weiteres Leben bestimmen: „Ich habe die Welt gesehen, sie war nicht schön. Überall eine Handvoll Verbrecher, die Millionen Unglückliche ausbeuten.”
Durch einen zufälligen Bekannten wird er in die Gedankenwelt des Anarchismus eingeführt, liest die theoretischen Schriften von Michail Bakunin, Pjotr Alexejewitsch Kropotkin – und nimmt sich besonders den berühmten Satz von Pierre Joseph Proudhon zu Herzen: « La propriété c’est le vol! » – Eigentum ist Diebstahl!
Nun beginnt eine große Karriere als illegalistischer Streiter für soziale Gerechtigkeit, als Robin Hood der Moderne, bei der Jacob bemerkenswertes handwerkliches Geschick, Organisationstalent, Kaltblütigkeit und eine geradezu geniale Erfindungsgabe an den Tag legt. Er umgibt sich mit einer Bande hochspezialisierter „Fachleute” und betreibt das Einbruchsgeschäft in die Villen der Reichen in schon fast „industriell” zu nennendem Maßstab. Bis zu tausend Diebeszüge werden allein für die Zeit von 1901 bis 1903 auf das Konto dieser politisch motivierten „Expropriateure der Expropriateure” gerechnet, wobei ein fester Anteil der Beute stets der anarchistischen Bewegung und den Armen zufließt.
Doch hat dieses Handwerk, bei aller Perfektion, nur vorübergehend goldenen Boden, und bald bewahrheitet sich die andere Redensart, dass sich Verbrechen am Ende nicht lohne. Jacob wird mit seinen Komplizen verhaftet, vor Gericht gestellt und zu lebenslänglicher Zwangsarbeit in der „Hölle von Guyana” verurteilt. Die Jahre von 1905 bis 1925 verbringt Jacob auf der berüchtigten Sträflingsinsel Île Saint-Joseph – und unternimmt in dieser Zeit 17 Fluchtversuche, die allesamt scheitern. Auch nach seiner Rückkehr nach Frankreich muss er noch zwei Jahre Zuchthaus absitzen, erst am 30. Dezember 1928 wird er endlich in die Freiheit entlassen. Ohne seine anarchistischen Überzeugungen aufzugeben, tritt „Marius”, wie er sich nun nennt, doch etwas kürzer. Zwar versucht er zur Zeit des Spanischen Bürgerkriegs (1936-39) noch, die anarchistischen Truppen von Buenaventura Durruti mit Maschinengewehren zu beliefern, doch als dies scheitert, zieht er sich endgültig aufs Altenteil zurück. Er fährt als fliegender Händler in Konfektionswaren mit einem Wohnwagen über Land und setzt sich schließlich in einem kleinen Häuschen in Reuilly (Indre) zur Ruhe. Nachdem seine körperlichen Gebrechen, Folgen der langen Haftzeit, ihm das Leben zur Qual machen, beendet er sein Dasein durch eine Überdosis Morphium, nachdem er zuvor eine Reihe von Abschiedsbriefen an seine zahlreichen Freunde zur Post gebracht hat. Bevor ihm die Sinne schwinden, kritzelt er noch auf einen Zettel: „Wäsche gewaschen, gespült, getrocknet, aber nicht gebügelt. War zu faul. Tut mir leid. Ihr findet zwei Liter Rosé neben dem Brotschrank. Auf euer Wohl!”
[Viele Informationen zu diesem Beitrag verdanke ich der kleinen Broschüre von Michael Halfbrodt: Alexandré Marius Jacob – Die Lebensgeschichte eines anarchistischen Diebes. Moers: Syndikat-A Medienvertrieb, 1994 – und deren schwierige Beschaffung meiner Freundin Michaela.]
Posted in Eccentrics, Würfelwürfe | 7 Comments »