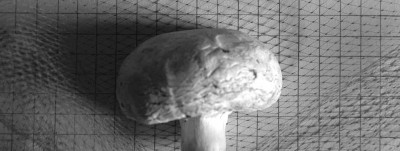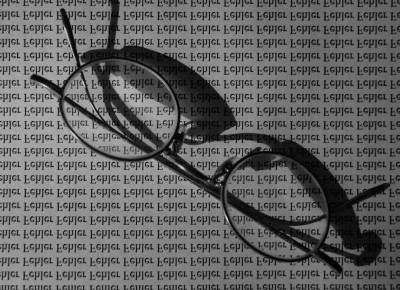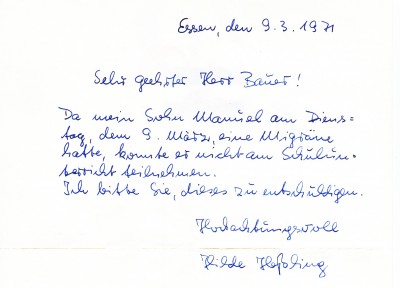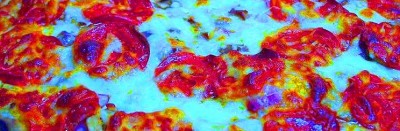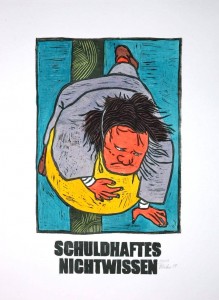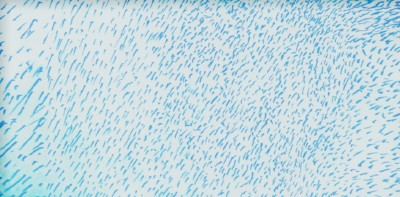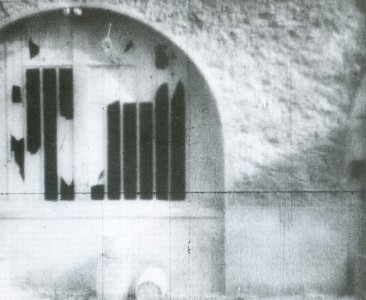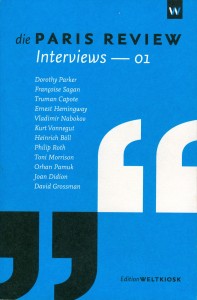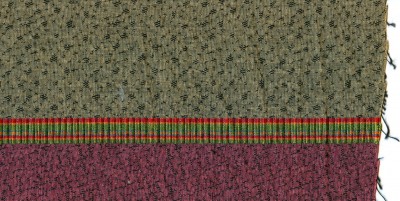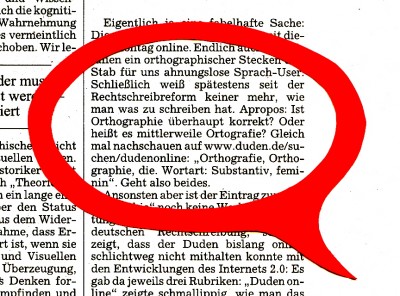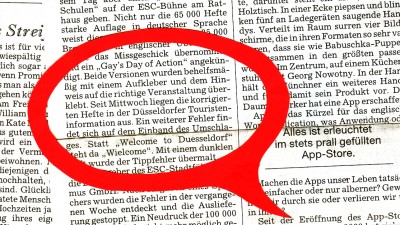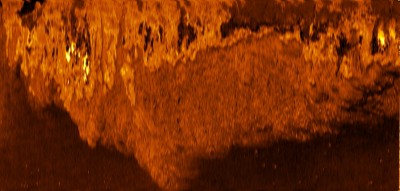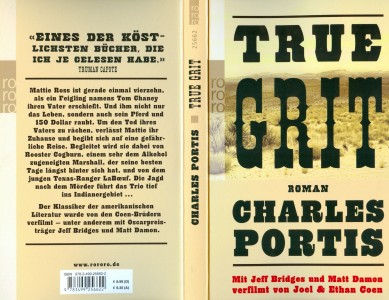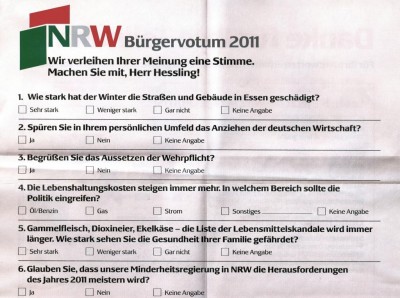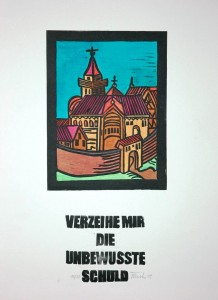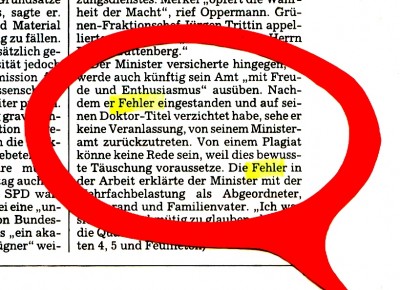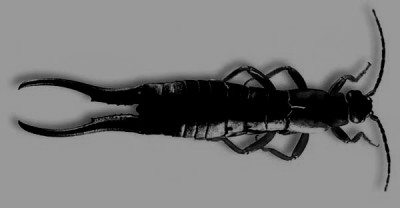Author Archive
Saturday, 06. August 2011
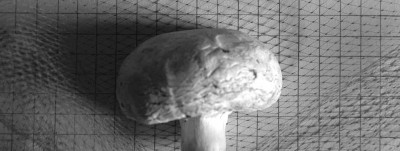
Heute auf den Tag genau vor zwanzig Jahren wurde das Netz ausgeworfen, das mittlerweile anderthalb Milliarden Menschen per Personalcomputer miteinander verbindet. Ursprünglich sollte es nicht Netz (engl. web), sondern Geflecht oder Gitter heißen (engl. mesh), doch weil dieser Name leicht mit dem Wort für Unordnung (engl. mess) verwechselt werden kann, kam man davon wieder ab. Dabei ist es doch gar nicht so verkehrt, das World Wide Web mit Unordnung und Chaos in Verbindung zu bringen, wenn man die ungeheuren Datenvorräte als Ganzes betrachtet, die dort zur Verfügung gestellt werden.
Heute auf den Tag genau vor 66 Jahren ereignete sich eine menschgemachte Katastrophe, die mindestens ebenso folgenreich für unsere Zukunft war wie die Erfindung von Tim Berners-Lee, der mit seinem Hypertext-System das WWW ermöglichte. Auf die japanische Hafenstadt Hiroshima fiel die erste Atombombe. Sie tötete auf einen Schlag annähernd 80.000 Menschen; fast die gleiche Zahl starb, teils noch Jahrzehnte später, an den Folgen radioaktiver Verstrahlung. Der Einsatz von Little Boy, wie die Bombe euphemistisch genannt wurde, beendete den Zweiten Weltkrieg und eröffnete ein Jahrzehnte währendes Wettrüsten zwischen den Weltmächten USA und UdSSR.
Diese kalendarische Koinzidenz ist natürlich reiner Zufall. Naiv muss man jeden nennen, der daraus eine Bedeutung ableiten oder gar einen „geheimen Zusammenhang“ herstellen wollte!
Nun haben wir Menschen es uns seit Einführung des Kalenders zur Gewohnheit gemacht, Jahrestage zu begehen, an denen sich das Datum eines uns bedeutsam erscheinenden Ereignisses wiederholt, wie etwa unser Geburtstag oder die religiösen Festtage, der Jahreswechsel oder die Sommer- und Wintersonnenwende. Handelt es sich um ein erfreuliches Ereignis, wird ein solches Jubiläum üblicherweise mit einem Fest begangen. Haben wir hingegen einer finsteren Schandtat zu gedenken, wie an Karfreitag oder am heutigen Hiroshimatag, so scheinen uns innere Einkehr, Schweigen und der Verzicht auf Geschäftigkeit und Unterhaltung angemessene Formen der Erinnerung zu sein. An den Atombombenabwurf auf Hiroshima erinnerte die Süddeutsche heute nicht. Es ist ja heuer auch kein „runder“ Jahrestag zu betrauern. An die heimliche Großtat im Europäischen Forschungszentrum CERN erinnert sich dort Patrick Illinger, der als einer von rund achttausend Wissenschaftlern damals hautnah dabei war – und trotzdem wie alle anderen Zeitzeugen nicht bemerkte, welch folgenreicher Durchbruch dem damals 36-jährigen Physiker und Informatiker an diesem Tag gelungen war.
Ich profitiere, indem ich dies schreibe, ob ich will oder nicht, von beiden Innovationen. Die elektrische Energie, die es ermöglicht, kommt zu einem guten Teil aus Kernkraftwerken, deren Entwicklung ja erst als eine Art friedlicher Ableger der Atombombe möglich wurde. Und dass ich meinen Text veröffentlichen kann, erlaubt jenes weltweite Geflecht, dessen Struktur Tim Berners-Lee vor zwanzig Jahren seinen Kollegen zur Verfügung stellte. Die erste Erfindung begann mit einem großen Knall, die zweite geräuschlos und unauffällig. Von beiden ist noch nicht erwiesen, ob sie uns mehr Schaden oder Nutzen bringen. Nur eines steht fest: Wir werden sie nicht mehr los.
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Koinzidenz
Monday, 01. August 2011
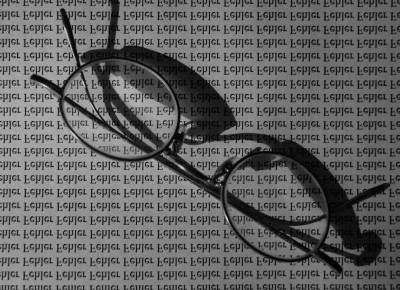
Wo ein Fortschritt ist, da lauern stets auch neue Gefahren. Wer geglaubt hat, dass durch Textverarbeitungsprogramme und die dort eingesetzten Prüfroutinen alle Schreibfehler bald der Vergangenheit angehören würden, der musste erfahren, dass davon längst noch keine Rede sein kann. Zwar spürt die automatische Fehlersuche falsch geschriebene Wörter auf, zum Beispiel bei einem „Bucshtabenderher“. Aber schon wenn man sich bei „versehen“ vertippt und „vergehen“ schreibt, entgeht dem Programm dieses Versehen, denn das Wort ist an sich kein falsches, sondern nur im Zusammenhang deplatziert.
Bei manchem Laienschreiber hat nun das grenzenlose Vertrauen ins Korrekturprogramm dazu geführt, dass er im Zweifelsfall nicht mehr nachschlägt, nicht einmal mehr nachdenkt, sondern die erstbeste Variante in die Tasten hackt, darauf vertrauend, dass sein nur vermeintlich allwissender Spürhund schon anschlagen wird, wenn sein Herrchen irgendwo falschlag. Schlimmer noch! Die gute alte Übung, grundsätzlich jeden fertigen Text erst einmal aufmerksam und gründlich durchzulesen, bevor man ihn aus der Hand gibt oder gar veröffentlicht, gilt den meisten Schreibern mittlerweile als unnötige Zeitverschwendung.
So hat die neue Technik in den vergangenen zwei Jahrzehnten zwar dafür gesorgt, dass mancherlei Fehlschreibungen in Texten rasend schnell und mühelos aufgespürt und berichtigt werden können. Gleichzeitig sind aber neue Fehlertypen entstanden, nämlich durch das Schreiben per PC. Einen sehr verbreiteten Typ stelle ich hier an einem schönen Beispiel vor. Ulrike Putz vom Spiegel berichtet heute über Morde an iranischen Atomphysikern: „Nach westlicher Einschätzung gehörte Mohammadi Teil zur Elite der iranischen Nuklearforscher.“ (Israels mörderische Sabotage-Strategie; in: SpOn v. 1. August 2011.)
Das Wort „Teil“ ist überflüssig. Wie kam es hierher? Offensichtlich sollte der Satz ursprünglich lauten: „Nach westlicher Einschätzung war Mohammadi Teil der Elite der iranischen Nuklearforscher.“ Vermutlich missfiel der Autorin das doppelte „der“ („… Teil der Elite der …“). Außerdem ist es selten passend, einen Menschen als Teil von etwas zu bezeichnen. (Mein Großonkel war als Akrobat mal Teil einer menschlichen Pyramide; das ginge allenfalls noch.) Also beschloss sie, den Satz umzuformulieren. Sie setzte ein neues Verb – „gehörte“ – an die Stelle von „war“, indem sie „war“ markierte und mit „gehörte“ überschrieb. Dann markierte sie „von“ und überschrieb es mit „zur“. Dabei übersah sie aber, dass auch „Teil“ hätte eliminiert werden müssen, und so entging diese Altlast der Entsorgung. Damit war ein Fehler entstanden, den nun keine gängige Rechtschreibprüfung mehr aufspüren kann.
Einerseits sind diese neuen Fehler, die mir gerade in Magazin- und Zeitungstexten dauernd begegnen, für uns Leser nervend, weil sie den Lesefluss unterbrechen und das inhaltliche Verständnis bremsen. Andererseits ergibt sich aus Fehlern wie diesem eine reizvolle Denksportaufgabe, wenn man den Ehrgeiz hat, ihre Entstehung zu rekonstruieren. So können selbst neuen Risiken des Fortschritts wieder einen Wert mit sich bringen – und sei ’s bloß der Unterhaltungswert.
[Nachbemerkung: Zur Ehrenrettung des Spiegel darf hier angemerkt werden, dass der Fehler bereits wenige Stunden nach der ersten Veröffentlichung des Beitrags bei SpOn berichtigt war: Das überzählige „Teil“ wurde entsorgt.]
Posted in Babel, Würfelwürfe | 1 Comment »
Friday, 29. July 2011

Manche Menschen sind befremdet über die an Schamlosigkeit grenzende Bereitschaft vieler Blogger, ihr Privatestes öffentlich zu machen, ihr Innerstes nach außen zu kehren. Sie unterstellen ihnen Narzissmus, Starallüren oder mindestens eine egomanische Weltsicht. Gleichzeitig wundern sie sich über die Arglosigkeit, mit welcher diese eitlen Menschen sich vor aller Welt offenbaren, wo man doch heute vielmehr auf der Hut sein sollte, dass man nicht von Marktforschern, Staatsbeamten, Arbeitgebern oder dem Nachbarn um die Ecke virtuell ausspioniert wird; und zwar selbst dann, wenn man sich bemüht, die Schotten dicht zu halten und so wenig wie möglich von sich preiszugeben. Die an Exhibitionismus grenzende Selbstpreisgabe der Blogger scheint in einem schwer verständlichen Widerspruch zu stehen zu den Warnrufen der Datenschützer. (Hagen Rether hat vor Jahren schon diesen Widerspruch unterhaltsam auf die Bühne gebracht.)
Thomas Assheuer erinnerte jüngst in der ZEIT an eine Prophezeihung des Futurologen und Kommunikations-Theoretikers Marshall McLuhan, der genau diese Paradoxie prophezeit hat. Den Einfall der Medienöffentlichkeit ins Wohnzimmer, die sich in den 1950er-Jahren vollzog, würden die Menschen bald einmal damit beantworten, dass sie sich selbst veröffentlichten. Sie würden dann sein wie Reptilien, die sich auf links drehen, den Panzer nach innen wenden, während die seelischen Weichteile nach außen gekehrt würden. Assheuer erkennt in unserer heutigen Medienwirklichkeit das Eintreffen dieser Vorhersage, wenn „der Handybenutzer von heute […] einen voll besetzten Bus ungefragt über seinen Liebeskummer unterrichtet.“ (Thomas Assheuer: Der Magier; in: Die ZEIT Nr. 30 v. 21. Juli 2011.)
Oder wenn ich meine Nierensteine öffentlich mache, die heute früh von meinem Hausarzt diagnostiziert worden sind [s. Titelbild]. Welche Blöße gebe ich mir denn damit? Und wie kann eine solche Information schlimmstenfalls gegen mich verwandt werden?
Die Intimsphäre ist ein in mehrfacher Hinsicht zwielichtiger Raum. Wer Anspruch auf ihren Schutz erhebt, bekennt sich damit indirekt zu einem Verhalten, das das Licht der Öffentlichkeit scheuen muss; oder zu einem Zustand, der das Empfinden seiner Mitmenschen verletzt. Andererseits verliert bekanntlich manches Vergnügen seinen Reiz, wenn es aus dem Halbdunkel des Privaten ins gleißende Licht der Öffentlichkeit gezerrt wird. Und es war schon immer eine ureigenste Herausforderung der Kunst, genau diese Ambivalenz des Verbergens deutlich zu machen. (So könnte die abendländische Kunstgeschichte als ein immerwährender Schleiertanz interpretiert werden, bei dem ja der Reiz darin liegt, das Verhüllte zu entblößen und die Blößen zu verhüllen.)
Nichts anderes spielt sich in den Weblogs ab. Man erfährt hier Dinge, die man sich nicht hätte träumen lassen. Ob man sie wissen will, steht auf einem anderen Blatt. Und wieder eine Frage ist, ob sie wahr sind oder bloß gut erfunden. So kann die Ultraschallaufnahme von meiner Niere sehr gut auch eine plumpe Fälschung sein. Aber was ist im Zweifelsfall belastender? Dass ich gesundheitlich beeinträchtigt – oder dass ich ein Schwindler bin?
Posted in Memento, Würfelwürfe | 1 Comment »
Thursday, 28. July 2011

Ich habe mir eben noch mal alle 21 bisher interpretierten Linolschnitte angeschaut, weil ich zweierlei wissen wollte: Welche Tiere kamen bisher vor? Und: Tauchte das Wort „Religion“ schon mal auf? Das Schwein von XXI war tatsächlich bislang das einzige Tier; und von Religion war expressis verbis bisher noch nicht die Rede. Wohl mehrfach von Gott. Aber da wir in der Begegnung und Auseinandersetzung mit diesem Testament ja schon wiederholt die Erfahrung machen durften, dass Begriffe in einem unüblichen Sinn gebraucht oder sogar provokanterweise geradezu in ihr Gegenteil verkehrt wurden, sollten wir nicht voreilig unterstellen, dass die Verwendung des Wortes Gott in den Bildunterschriften auf einen religiösen Inhalt schließen lässt. Gibt es Religionen ohne Gott? Und gibt es Götter außerhalb von Religionen? Über beide Fragen könnte ich trefflich streiten und gute Argumente anbringen, und zwar sowohl zu ihrer Bejahung als auch zu ihrer Verneinung.
Doch heute soll es ja nicht um die Religion im Verhältnis zu Gott, sondern im Verhältnis zur Moral gehen. Es ist die Rede von einem Verderben. Neulich las ich die traurige Geschichte des Elefanten von Murten, der aus unbekanntem Grund verrückt spielte und schließlich mit einer Kanone zur Strecke gebracht werden musste. Sein Fleisch wurde an die Bürger der Stadt zum Verzehr verkauft. Die Kleinstadt in der Schweiz ist noch heute ein Kaff. Man darf also bezweifeln, ob die Murtener Mitte des 19. Jahrhunderts das Fleisch des toten Elefanten restlos verspeist haben. In Afrika wird es geräuchert, um es haltbar zu machen. Aber ob die Murtener wussten, wie man Elefantenfleisch räuchert? Ich vermute, dass es wenige Tage nach dem Tod des Elefanten in Murten ganz schön zu stinken begann. Schließlich geschah das Unglück im Sommer. Das verdorbene Elefantenfleisch haben die guten Leute dann vermutlich irgendwo ganz tief vergraben oder auf dem Schindanger verbrannt.
Was fangen wir aber bloß mit unseren vielen müffelnden Religionen an? Denn wenn es nach unserem Testament geht, dann sind doch die meisten Glaubenslehren weit übers Haltbarkeitsdatum und stinken ganz pestilenzialisch nach Moral! Ich will nicht so weit gehen und behaupten, dass etwa unser Christentum nun rückstandslos zur Moral geworden ist, wie es ja wörtlich in der Bildunterschrift heißt. Aber eine Stellungnahme zu der Frage, was gut ist und was böse, und wie dies von jenem zu unterscheiden wäre, ist doch nach meiner unbeteiligten Beobachtung von ein paar Religionen, mit denen ich mich mal aus der Ferne beschäftigt habe, ein sehr wesentliches Anliegen dieser Denkvorrichtungen. Dies scheint mir so evident, dass ich beinahe andersherum fragen möchte: Was bleibt denn von den meisten Religionen übrig, wenn man ihnen ihre Aussagen über ein rechtes Leben nimmt, also ihre Gebote, Regeln, Gesetze? Und damit uns ihre Vorbildhaftigkeit und die Utopie einer befriedeten Schöpfung? Vielleicht nur ein Haufen Kitschdekor und altmodischer Zeitvertreib – wobei das natürlich Geschmacksache ist.
Der Elefant gilt als weise, stark und keusch – aber auch als nachtragend. Das sprichwörtliche gute Gedächtnis des Elefanten ist von Zoologen vielfach belegt. Der Elefant im Bild dort oben scheint mir übrigens zu tanzen. Oder bilde ich mir das bloß ein? Dass ich hier gezwungen bin, ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, macht jedenfalls die Situation unleugbar etwas ungemütlich.
Aber bevor er mich auf die Hörner nimmt, ergreife ich lieber selbst die Initiative, indem ich rundheraus bekenne: Religionen ohne Moral fände ich noch langweiliger! Da nehme ich den strengen Hautgout gern in Kauf.
Posted in Heinrichs Testament | Comments Off on Heinrich Funke: Das Testament (XXII)
Wednesday, 27. July 2011
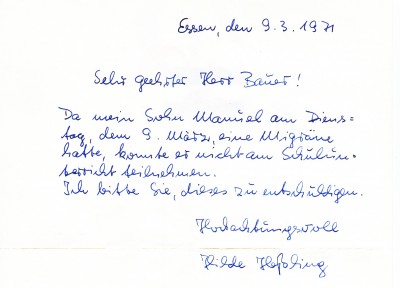
Für ein Fernbleiben vom Unterricht mussten wir eine Entschuldigung der Eltern beibringen. Ich fehlte relativ häufig, aber fast immer nur für einen Tag und dann stets aus dem gleichen Grund: Migräne. Dieser Entschuldigungsgrund entsprach manchmal den Tatsachen, war aber häufig auch vorgeschoben, weil ich mich vor einer Klassenarbeit drücken wollte, für die ich nicht gelernt hatte; oder weil ich einen langweiligen Schultag lieber gegen einen viel unterhaltsameren im Bett tauschen wollte, lesend und phantasierend.
Nach dem frühen Tod meines Vaters im Sommer 1969 war es Aufgabe meiner Mutter, die Entschuldigungsbriefe zu verfassen. Wenn ich mich nicht täusche, hatten sie immer den gleichen Wortlaut – und den hatte sie buchstabengetreu von meinem Vater übernommen.
Ich erinnere mich, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Aber das starke Analgetikum, das ich vom Arzt verschrieben bekam und dessen euphorisierende Wirkung ich bald schätzen lernte, vertrieb nicht nur den Schmerz, sondern auch die Schuldgefühle, die mich heimsuchten, wenn ich den Unterricht schwänzte. Es rief wahre Allmachtsphantasien in meinem sehr kreativen Gefühlsleben hervor, lustvolle Illusionen einer Karriere jenseits der schnöden Schulbildung, die mir auf diesem kleinkarierten Gymnasium zuteilwurde.
Der Lehrer, an den diese Entschuldigung adressiert ist, war nach meiner Erinnerung ein freundlicher Naturwissenschaftler, keiner von den alten Säcken, die uns mit ihrer Griesgrämlichkeit und ihren wüsten Drohungen bis in unsere Albträume verfolgten.
Um den Schein zu wahren, musste ich meiner Mutter die Kopfschmerzen möglichst glaubwürdig vorspielen, damit sie mir die Entschuldigung ohne schlechtes Gewissen ausstellen konnte, und ohne sich mir gegenüber als Betrügerin zu erkennen geben zu müssen. Allerdings kam es mir manchmal so vor, als hätte sie mich längst durchschaut und gönnte es mir stillschweigend, wenn ich mir gelegentlich eine kleine Auszeit gönnte. Vielleicht genoss sie auch die Abhängigkeit, in die ich mich ihr gegenüber damit begab.
Posted in Korrespondenz, Werke, Würfelwürfe | 3 Comments »
Sunday, 24. July 2011
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Schmerzhafte Genauigkeit
Saturday, 23. July 2011

Falsch- und Schlechtschreiber haben allerlei Scherznamen auf Lager, um jene lächerlich zu machen, die es genauer nehmen als sie: Pedanten, Kleinigkeitskrämer, Pingel, Erbsenzähler, Federfuchser, Haarspalter, Rechthaber, Schulmeister, Besserwisser, Neunmalkluge, Kritikaster, Silbenstecher und dergleichen mehr. Nun mag zwar Genauigkeit eine Frage des Ermessens sein, nicht hingegen Richtigkeit. Und meist suchen die Schlamperten mit ihren humorigen, augenzwinkernden Verweisen an die Adresse der Richtig- und Gutschreiber bloß ihre lückenhafte Kenntnis der Schreibregeln oder ihre Trägheit zu vertuschen.
Mit Aufkommen der Massenpresse wurden der Dilettantismus und die Flüchtigkeit der Schreiber alltägliche Normalität, an welcher nur noch ein Sonderling wie Karl Kraus dezidiert Anstoß nahm. Und mit der Schaffung einer jedem zugänglichen Publikationsfläche im World Wide Web, deren Geburtsstunde sich demnächst zum zwanzigsten Mal jährt, hat dieser Niedergang der Schreibkultur einen weiteren Schub erfahren. Einige Gründe hierfür sind banal und offensichtlich. So äußern sich hier plötzlich zahllose Menschen ausführlich schriftlich, die seit ihrer Schulzeit offenbar nur noch zum Stift gegriffen haben, um den Lottozettel auszufüllen: nämlich in den Kommentar-Foren der Zeitungen und Zeitschriften, beispielsweise bei Spiegel online. Da traut sich nun jeder, denn er sieht, dass die meisten anderen ja ebenfalls schreiben, wie ihnen die krumme Feder gewachsen ist. Diese gegenseitige Schreibenthemmung hat zu einem unbegrenzten Laissez-faire in allen Fragen der Orthografie, Grammatik, Semantik, Syntax und Interpunktion geführt, von Stil und Anstand ganz zu schweigen! Hinzu kommt, dass das menschliche Auge offenbar auf der Monitorfläche weniger genau sieht als auf dem Papier; und dass die blitzschnelle Publikation per Mausklick dazu verführt, notwendige Korrekturphasen zu überspringen.
Und wie sieht es bei den Blogs aus? Ich darf hier mal aus dem aktuellen Beitrag in einem der drei Dutzend von mir mehr oder weniger regelmäßig inspizierten Weblogs zitieren: „Ach, wenn man auf der Webseite einer Drehbuchautorin sieht, daß sie den Titel ihres eigenen Films nicht richtig schreibt. Gut, aber Webseiten, ich spreche aus Erfahrung, enden eh wie ein während einer Killervirenepidemie frisch untergepflügtes Kraut- und Rübenfeld. Man fängt irgendwie an, vielleicht mit einem Storyboard oder wenigstens einer kleinen Skizze, und am Ende hat man keine Zeit, haut man irgendwas da rein und schaut auch nie wieder drauf. Im Zeitalter des Flüchtigen sind statische Rechtschreibfehler von einst [abgebr.]“ (kid37: Merz/Bow #28; in: Das hermetische Café; Posting v. 21. Juli 2011.)
Da wäre sie also wieder, die ja keineswegs neue Schnelllebigkeit der Massenmedien als Generalabsolution für den Dauertiefstand journalistischer Sorgfalt! Da ja laut Volksmund nichts so alt ist wie die Zeitung von gestern, scheren ihre Macher nicht die Kommafehler in diesem durch die Zeitung von morgen bald überholten Blatt, das bereits übermorgen im Altpapier landet. – Aber wer etwas genauer hinschaut, dem müsste doch gerade hier der entscheidende Unterschied zwischen Printmedien und Onlinemedien auffallen. Zwar rutscht auch mein heutiges Posting Tag für Tag tiefer in den Keller meines Weblogs. Nach einer Woche ist es schon nicht mehr auf der Startseite präsent. Dann findet man es erst wieder, wenn man ganz nach unten scrollt und auf „Ältere Einträge“ klickt. Wer sich bei mir gut auskennt, der ahnt möglicherweise, dass der Artikel unter der Kategorie „Langsamkeit“ abgelegt sein könnte und findet ihn auf diesem systematischen Wege wieder. Ein anderer hat sich vielleicht gemerkt, dass Karl Kraus darin vorkommt, und gibt diesen Namen ins Suchfenster ein, um den Text zu finden. Aber das Versteck dieses wie jedes anderen Beitrags in meinem Blog mag noch so entlegen sein – sie alle sind immerhin noch da und landen nicht im Reißwolf! Sie bleiben auffindbar, abrufbar, lesbar, kopierbar, druckbar und versendbar. Und dies gar von jedem Online-Arbeitsplatz aus, überall auf der Welt!
Muss es da nicht mein Ziel sein, mit größtmöglicher Sorgfalt alle meine Texte so richtig und so gut herzustellen, wie es mir eben möglich ist? Und auch alle älteren Texte laufend zu verbessern, wenn ich nachträglich Fehler oder Schwächen in ihnen entdecke? (A work in infinite and slow progress.)
Posted in Langsamkeit, Würfelwürfe | 4 Comments »
Friday, 22. July 2011

Nun habe ich Michael Holzachs letztes Buch ausgelesen. Es hielt zugleich weniger und mehr, als ich mir von ihm versprochen hatte. Ich will mit den Defiziten beginnen.
Für einen Fußmarsch von fast einem halben Jahr fällt die Ausbeute an Erlebnissen, Beobachtungen, Gedanken und Gefühlen eher mager aus, und dies erst recht, wenn man noch die reinen Phantasiebilder abzieht, die der Autor gelegentlich einstreut, und außerdem jene Passagen, in denen er Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend mitteilt, aufgerührt durch den Besuch von Ortschaften, in denen er früher einmal gelebt hat. Es entsteht der Eindruck, dass Holzach eigentlich verschiedene Bücher hat schreiben wollen. Der Versuch, gleich mehrere Konzepte zwischen nur zwei Deckel zu pressen, ist gründlich missraten. Die Verarbeitung einer teils als traumatisch erlebten Vergangenheit, die Erkundung sozialer Missstände in einem Wohlfahrtsstaat der 1980er-Jahre, das Abenteuer eines Gewaltmarsches unter Verzicht auf Geld und Beförderungsmittel, die Erkundung der eigenen psychischen und physischen Grenzen – daraus hätte man gut vier Bücher machen können; und vermutlich vier bessere Bücher als dieses, das von allem etwas bringt, aber von allem zu wenig.
Wenn dennoch mache Episoden haften bleiben, als Momentaufnahmen ohne Ansehen ihrer Bedeutung im Gesamtzusammenhang der Geschichte, dann spricht dies für die gelegentlich scharfe, fast mikroskopische Beobachtungsgabe und Darstellungssorgfalt des Autors. Als vielleicht besonders treffendes Beispiel für diese Qualität fällt mir die Einlösung einer „Durchreisebeihilfe“ in Form eines „Lebensmittelgutscheins“ ein, bei der es darum geht, die großzügig gewährten acht Mark („in Worten, acht, Spirituosen- und Tabakwaren ausgenommen“) möglichst auf den Pfennig genau auszuschöpfen. (Holzach, a.a.O., S. 88 f.) Auch sind die meisten der zahllosen knappen Porträts von Weggefährten, Obdach- und Arbeitgebern und Obrigkeitsvertretern markant, glaubwürdig und einprägsam. Dass der Autor Humor hat, zeigt sich am deutlichsten an diesen Karikaturen.
Ein lustiges Buch ist dies aber nicht. Dafür sorgt von der ersten bis zur letzten Seite ein melancholischer Grundton. Die Tristesse der Unbehaustheit ist stellenweise so bedrückend, dass man versucht ist, Deutschland umsonst vorzeitig aus der Hand zu legen. Alkoholismus wird vielfach als eine Hauptursache für Obdachlosigkeit angeführt. Wenn man dieses Buch gelesen hat, begreift man, dass andersrum auch ein Schuh draus wird: Obdachlosigkeit ist nämlich ohne Alkohol auf längere Sicht kaum zu ertragen.
Bleibt die Frage, um die es ja in dieser Serie über Trendbücher vordergründig geht: Was hat Michael Holzachs Reisebeschreibung durch ein Wohlstandsland für mehr als zwei Jahrzehnte zu einem solchen Dauerbrenner gemacht? Einmal steht das Buch in enger Verwandtschaft zum Werk von Günter Wallraff, der ja mit seinen „unerwünschten Reportagen“ seit 1969 vorgemacht hat, wie man durch das Ausprobieren von riskanten Lebensumständen zu aufschlussreichen Erfahrungen kommt und mit den abenteuerlichen Berichten darüber viele Leser findet. Zweitens macht der genial-knappe Titel neugierig auf eine Erfahrung, die niemand freiwillig machen möchte, die jeden mindetens theoretisch bedroht und auf die man sich darum gern einmal in der Phantasie einlässt – in der Erwartung schauriger Details, aber vielleicht auch in der Hoffnung auf praktische Ratschläge, die einem notfalls nützlich sein könnten: Man weiß ja nie! Und drittens hat vermutlich das tragische Ende des Autors dazu beigetragen, dass er nun von einer Aureole der Lauterkeit umgeben ist: Der Mensch, der sein Leben für einen Hund opferte. (Die Verfilmung als vierteilige TV-Serie unter dem Titel Zu Fuß und ohne Geld aus dem Jahre 1995 setzte vermutlich einen weiteren Kaufimpuls, indem viele vorherige Leser sie damit kommentierten, das Buch sei aber besser.)
Posted in Dingwelt, Trendbücher, Würfelwürfe | Comments Off on Deutschland umsonst (II)
Thursday, 07. July 2011

„Wer nicht leiden will muss hassen“? Kommt uns dieses Warnschema in der Form einer logischen Schlussfolgerung nicht irgendwie bekannt vor? Na klar! Da gibt es doch zum Beispiel diese bedrohliche Lebensweisheit, mit der wir alle in der Pubertät gepiesackt wurden, wenn wir für die gut gemeinten Ermahnungen unserer Erzieher nicht mehr übrig hatten als ein Achselzucken: ,Wer nicht hören will, muss fühlen!‘ Die Herrschaft der schwarzen Pädagogik war da aber bereits gebrochen und jene grausamen Zeiten gehörten endgültig der Vergangenheit an, als auf diesen Spruch unmittelbar der Gesang der Rute folgte. Das schmerzhafte Gefühl, das uns in Aussicht gestellt wurde, kam nicht mehr von der Hand des pädagogischen Zuchtmeisters. Vielmehr würde das harte Leben uns jene Nachilfe-Lektionen erteilen, deren Schlussfolgerungen wir uns verweigerten, als sie uns in wohlmeinenden Ratschlägen nahegebracht wurden.
Wie lässt sich dieses Interpretationsmuster nun auf unsere heutige Tageslosung übertragen?
Zunächst überrascht sie damit, dass augenscheinlich der Hass als eine Strafe gewertet wird. Wäre er eine solche, dann müsste der Hassende bemitleidet werden, es sei denn, er hätte die Strafe verdient. Wie stehen wir denn üblicherweise zu einem Menschen, der offenkundig von blindem Hass getrieben ist? Wenn wir selbst es sind, auf die dieser Hass zielt, dann sehen wir zunächst zu, dass dieser üblicherweise ja destruktive Affekt für uns keine schädlichen Folgen hat. Wir wappnen uns gegen mögliche Angriffe oder suchen das Weite. Sind wir jedoch unbeteiligte Beobachter eines Menschen, dessen Hass sich gegen andere richtet, dann mag es wohl sein, dass wir uns im Stillen sagen: ,Der kann einem ja nur leid tun.‘ Da ein hassender Mensch sich nicht im Griff hat, ähnlich übrigens wie ein haltlos liebender, ist er seinen Gefühlen ohnmächtig ausgeliefert und insofern bemitleidenswert. Aber unser Bedauern für den Hassenden wie für den Liebenden ist doch nicht ganz ehrlich. Den Liebenden beneiden wir im Grunde unseres Herzens, während wir den Hassenden verachten.
Und wofür steht das Schwein im Bild? Für ein Schlachtvieh, zum Leid verurteilt? Für ein unreines Lebewesen – das es bekanntlich ja gerade nicht ist? Für ein harmloses Tier, dem Hass am wenigsten zuzutrauen ist? Oder für einen Glücksbringer? Diesmal habe ich nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung.
Angesprochen ist jeder, der nicht leiden will – also doch fast alle. Denn wer will schon freiwillig leiden? Allenfalls ein Masochist. Wieder einmal werden wir hier mit dem Mittel der „Verdutzung“ zur Nachdenklichkeit erpresst. Der Masochist kann nach dem vierten Wort den Satz zuschlagen. Wenn er dennoch weiterliest, mag sich ihm die Frage aufdrängen, ob er denn aber trotzdem hassen darf, obwohl er doch leiden will. Eigentlich schon, denn von einem Hassverbot ist ja hier nicht die Rede. Man kann den Satz übrigens auch umkehren, ohne ihm Gewalt anzutun: ,Wer nicht hassen will, muss leiden.‘ Aber wie ich ’s drehe und wende, komme ich auch diesmal nicht an meinem stärksten Einwand vorbei, dass die Begriffe nicht scharf genug sind, um aus ihrem Arrangement eine Einsicht ableiten zu können. Hass, Wille, Notwendigkeit, Leid – aus diesen vier diffusen Begriffswolken ist die Sentenz zusammengebastelt. Anfangs ist da eine Verblüffung – die dann aber sehr bald verpufft.
Posted in Heinrichs Testament | Comments Off on Heinrich Funke: Das Testament (XXI)
Wednesday, 06. July 2011

Der Perlentaucher eröffnet seinen täglichen Newsletter bekanntlich stets mit einem „Zitat des Tages“. Liegt es nun daran, dass seinen Machern, die ja schließlich ihre Brötchen zu einem guten Teil mit Buchrezensionen verdienen, der Arsch auf Grundeis geht angesichts der vielstimmigen Untergangschoräle auf das Buch, dem das E-Book den Garaus machen soll, wenn die Taucher dieser Tage gleich zwei aphoristische Elogen auf das ehrwürdige Buch vom Grunde heraufholen?
Gestern durfte Gerhart Hauptmann dran glauben, dass der Mensch ohne das Buch wohl ein Nichts oder mindestens doch ein nichtswürdiges Etwas sei, indem er verlauten ließ: „Die Kultur der Menschheit besitzt nichts Ehrwürdigeres als das Buch, nichts Wunderbareres und nichts, das wichtiger wäre.“
Kann man sich vorstellen, dass Steve Jobs bei einer seiner legendären Präsentations-Veranstaltungen behaupten würde, die Kultur der Menschheit besitze nichts Ehrwürdigeres als das iPad, nichts Wunderbareres und nichts, das wichtiger wäre? Wohl kaum, denn eine solche Aussage schiene ihm gar nicht wünschenswert, trägt doch jede Innovation von Apple in sich schon den Keim zu einer weiteren, die sie überflügeln wird. Diese permanente Selbstüberflügelung mag etwas Wunderbares an sich haben, aber ehrwürdig ist sie sicher nicht.
Heute ist beim Perlentaucher Cicero dran mit dem Ausspruch: „Einem Haus eine Bibliothek hinzuzufügen heißt, dem Haus eine Seele zu geben.“ Das mag wohl mal im alten Rom ein erstrebenswertes Einrichtungsideal gewesen sein. Wie das Haus der Zukunft aussehen wird, hat uns Bill Gates erstmals 1994 in einer kühnen Utopie ausgemalt. Es ähnelt einer Rundum-Maschine, die zuallererst unserer Bequemlichkeit dienen soll. Nun ist das Bücherlesen, wie neulich noch Ruth Klüger überzeugend dargelegt hat, alles andere als eine bequeme Angelegenheit. Vergleicht man es mit den Lieblingsbeschäftigungen der Generation Couch-Potatoe, dann kommt es nahezu einem Hochleistungssport gleich.
Und die gute Seele im Hause moderner Leute ist vorläufig noch eine steuerfrei beschäftigte Putzfrau aus Rumänien oder Thailand, der man zu ihren zahlreichen Reinigungsaufgaben nicht auch noch zumuten will, sinnlos herumstehende Bücherregale abzustauben. Zudem würde sie ein solcher Job am Ende noch dazu verführen, einen Blick zwischen Buchseiten zu tun, um dort solch aufrührerischen Unsinn zu lesen, wie dass die Würde des Menschen unantastbar sei und alle Menschen gleich geboren. Beim iPad gibt es gegen unbefugten Zugriff ein schlichtes Password. Allein schon deshalb muss es sich mittelfristig durchsetzen!
Posted in Babel, Würfelwürfe | Comments Off on Bücherdämmerung (IV)
Tuesday, 05. July 2011

Seit etwa einem Jahr denke ich gelegentlich immer mal wieder über ein SciFi-Buch nach, das in der Form eines Interviews einen Blick aus ferner Zukunft auf die Geschichte der Menschheit auf diesem Planeten wirft. Wie ich die Menschheit kenne und wie mich der Leser dieses Blogs inzwischen kennen müsste, wird diese Geschichte auf eine bitterböse Dystopie hinauslaufen. Seit ein paar Wochen mache ich mir erste Notizen zu diesem Buch. Hier teile ich zunächst den Grundgedanken mit. Ich gehe übrigens davon aus, dass es ähnliche Geschichten in der unüberschaubaren Vielfalt des SciFi-Genres längst schon gibt, was mich aber nicht daran hindern soll, dieses Sujet zu meiner ganz persönlichen Ausgestaltung der künftigen Apokalypse zu nutzen.
Mein Interviewer könnte ein intelligenter Besucher aus einer fernen Galaxie sein, eine Art rasender Reporter im interstellaren Raum. Er sammelt für seinen Heimatplaneten Erfolgs- und Misserfolgsgeschichten intelligenter Zivilisationen aus dem ganzen All, wobei er an letzteren besonders interessiert ist. Seine Auftraggeber daheim, die ihn auf diese lange Reise geschickt haben, erhoffen sich nämlich von Auskünften über die diversen Apokalypsen, die sich in den Weiten des Weltraum in den vergangenen Jahrmilliarden ereignet haben, wertvolle Aufschlüsse zur Bewahrung ihrer eigenen Spezies. Allerdings sind solche Katastrophenberichte sehr selten, da der Untergang der meisten Zivilisationen so gründlich vonstattenging, dass nichts und niemand mehr zu dessen Ursachen befragt werden kann.
So traurig auch das Schicksal der Späthominiden auf Terra gewesen sein mag, haben sich auf diesem blauen Planeten doch immerhin ein paar hunderttausend Exemplare bis ins 14. Jahrtausend nach der lokalen Zeitrechnung hinübergerettet. Größtenteils vegetieren sie noch immer von der „Resteverwertung“ der versunkenen Großreiche. Bei seiner ersten Begegnung mit Überlebenden zweifelte der Interviewer, ob überhaupt eine Verständigung mit ihnen möglich sein würde. Immerhin deutete die geschickte Verwendung verschiedener Jagdwerkzeuge darauf hin, dass wenigstens die klügsten unter ihnen vielleicht über eine ausreichend differenzierte Mitteilungsform verfügen mochten, um Auskünfte über die Vergangenheit ihres Stammes geben zu können. Allerdings beschränkten sich die akustischen Lebensäußerungen der meisten Exemplare auf starke Gefühlsregungen, wie Schreien, Weinen, Jammern, Zetern und Kichern.
Dann begegnete der Interviewer einem Exemplar, das sich sowohl durch seine kraftvolle körperliche Erscheinung als auch durch ein feines Lächeln wohltuend von seinen Stammesgenossen abhob. Dass die Wesen auf diesem Planeten in zwei Hauptgruppen in Erscheinung traten, war augenfällig, denn sie waren unbekleidet und ihre diesbezüglichen Unterscheidungsmerkmale leicht erkennbar. Später erfuhr der Interviewer, dass es sich bei seinem Gesprächspartner der folgenden Wochen um ein weibliches, d. h. gebärfähiges Exemplar handelte.
Doris, wie es sich nannte, erwies sich als ein ausgesprochener Glücksgriff für unseren Reporter. Sie war nämlich die letzte ihrer Art, die noch in der Lage war, die zahllosen Informationskonserven auf dem Planeten, die den Weltenbrand unversehrt überstanden hatten, zu dechiffrieren. Und so konnte sie ihrem Gesprächspartner eine Fülle unschätzbar wertvoller Auskünfte darüber geben, wie es in knapp zehntausend Jahren zum rasanten Aufstieg und schließlich zum abrupten Untergang der Zivilisation ihrer Ahnen gekommen war.
Posted in Interviews, Questionnaire, Würfelwürfe | 2 Comments »
Monday, 04. July 2011

Dieses Buch werde ich wohl damals stapelweise verkauft haben, im Jahr 1982, als es erschien. Die gebundene Ausgabe im Verlag Hoffmann und Campe in Hamburg ging drei Jahre lang weg wie geschnitten Brot, zehn Auflagen und fast hunderttausend Exemplare wurden zum Stückpreis von 28 Mark abgesetzt, und dann noch einmal so viel als Ullstein-Taschenbuch für 7,80 Mark. Üblicherweise ist ein Bestseller dann vom Tisch. Aber bei Michael Holzachs Reisebericht Deutschland umsonst wagte HoCa 1993 gar noch einen weiteren Aufguss, diesmal als Paperback für 18 Mark; und auch der war immerhin noch so erfolgreich, dass er es bis 2006 auf solze 13 Auflagen brachte! Was ist bloß dran an diesem Buch? Ich wollte es wissen und lese es gerade.
Den Anstoß zu meiner Erinnerung an den Bericht eines jungen Mannes, der „zu Fuß und ohne Geld durch ein Wohlstandsland“ wandert – so die bündige Zusammenfassung des Themas im Untertitel –, gab mir indirekt dessen ehemaliger Weggefährte, der Essener Fotograf Timm Rautert, der regelmäßig bei proust ausstellt und auftritt. Als ich mich in der Wikipedia über Rautert informierte, las ich über ihn, er habe seit 1974 für das ZEITmagazin „in enger Kooperation mit dem Journalisten Michael Holzach überwiegend sozialkritische Themen“ fotografiert. Ein Klick auf Michael Holzach und es machte Klick! Ich erinnerte mich augenblicklich wieder an dessen Dauerbrenner von vor nahezu dreißig Jahren. Dass der Autor 1983 auf so tragische Weise ums Leben gekommen war, wusste ich nicht – oder hatte es jedenfalls längst vergessen.
Die Erstausgabe von Deutschland umsonst bekam ich antiquarisch über ZVAB zum Preis von 10,40 €, zwar leicht schiefgelesen und, dem Geruch nach zu urteilen, aus einem Raucherhaushalt, aber ansonsten sauber und mit tadellosem Schutzumschlag – an den ich mich prompt erinnerte, als ich das Buch in Händen hielt. Das Titelfoto stammt von Rautert und zeigt den Autor mit seinem Hund Feldmann, einem Boxermischling aus dem Hamburger Tierasyl, der ihn auf seiner Wanderschaft begleitete und schließlich Holzachs Tod verursachte.
Wie es dazu kam, dass Holzach sich 1980 für ein halbes Jahr ohne einen Pfennig Geld auf den Weg machte und die Bundesrepublik von Nord nach Süd und wieder zurück durchwanderte, das beschreibt er ziemlich genau in der Mitte seines Buches, unmittelbar bevor er sich mit Timm Rautert an der Kanalbrücke in Altenessen trifft. Er empfand damals sein Leben als „sozial engagierter Journalist“ auf die Dauer als pure Heuchelei. Die ging ihm schließlich so sehr an die Nieren, dass er seinen guten Job bei der ZEIT an den Nagel hängte. Für ein Jahr lebte er bei der deutschstämmigen Wiedertäufersekte der Hutterer in Kanada, die einen urchristlichen Kommunismus praktiziert. (Auch über dieses Abenteuer schrieb er ein Buch, Das vergessene Volk.) Und dann, so Holzach, „grub ich meinen alten Plan wieder aus, eine autobiographische Wanderung durch Deutschland zu machen“ – autobiographisch insofern, als er all jene Orte aufsuchte, die in seinem Leben irgendwann eine besondere Rolle gespielt hatten, wie Holzminden, Heppenheim oder Bergisch-Gladbach.
Was Holzach unterwegs erlebt, lässt sich keineswegs auf einen einfachen Nenner bringen, obwohl das Buch sich damals vielleicht mittels solcher Vereinfachungen vermarkten ließ: ,Mitten im Wohlstandsland BRD herrscht das bitterste Elend und hält jene grausam umklammert, die einmal schuldlos aus der bürgerlichen Ordnung gefallen sind.‘ Das ist aber keineswegs die Botschaft, die das Buch vermittelt. Eher geht es um die Selbsterfahrung des Autors, der wissen möchte, was mit ihm geschieht, wenn er sich ohne Geld durchschlagen muss. Aber erklärt die Neugier am Verlauf eines solchen Experiments allein schon den sensationellen Verkaufserfolg dieses Buches? Das kann ich nicht recht glauben.
[Fortsetzung folgt. – Titelbild © Timm Rautert & Verlag Hoffmann und Campe.]
Posted in Dingwelt, Trendbücher, Würfelwürfe | Comments Off on Deutschland umsonst (I)
Sunday, 03. July 2011

Vielleicht bin ich durch meine Hollandreise auf den Geschmack gekommen, vielleicht will ich aber auch zur Abwechslung mal nicht den Spielverderber geben, indem ich wie sonst alle Vorschläge zu Wochenendabenteuern vonseiten meiner nächsten Angehörigen empört von mir weise. Wie dem auch sei, ich willigte heute ein, meine Gefährtin samt Sohn, Schwiegertochter und Enkelkind bei einem kulturellen Sonntagsausflug im Revier zu begleiten. Ursprünglich war der Besuch der Ausstellung Krupp. Fotografien aus zwei Jahrhunderten geplant, die vor zwei Wochen in der Villa Hügel eröffnet wurde. Es stellte sich aber heraus, dass just an diesem Wochenende die Villa geschlossen bleibt. Den Grund erfährt man nicht. So disponierten wir kurzfristig um und beschlossen, unserer Schwiegertochter das Haldenereignis Emscherblick in Bottrop zu zeigen, kurz „Tetraeder“ genannt.
Wir fuhren mit der Straßenbahn Linie 105 bis zum Essener Hauptbahnhof und von dort mit S-Bahn Linie 9 bis nach Bottrop-Boy. Der Fußmarsch bis zur Halde an der Beckstraße, die mit 60 Metern Höhe einer der höchsten im gesamten Ruhrgebiet ist, erwies sich doch als weiter denn gedacht. Bald kam zwar der Tetraeder in Sicht und schien gar zum Greifen nah. Aber da der Weg hinauf in langgezogenen Serpentinen zu erklimmen ist, benötigten wir per pedes immer noch eine halbe Stunde, bis wir endlich auf dem Gipfel standen.
Ich war kurz nach der Eröffnung dieser Landmarke Mitte der 1990er Jahre schon einmal hier gewesen, erinnerte mich aber nicht mehr daran, dass man ja von hier oben aus tatsächlich einen Panoramablick weit hinaus ins Land hat. Seither hat die Natur die Industriebrache wieder in Besitz genommen. Ringsum ist alles grün, eine bunte Vielfalt von Bäumen und Buschwerk führt vor, dass die industriellen Verwüstungen glücklicherweise doch längst nicht immer so unumkehrbar sein müssen, wie man meinen sollte.
Ich habe mich schon bei der Errichtung des Bauwerks von Wolfgang Christ gefragt, warum ausgerechnet ein Tetraeder als Form für diesen „Aussichtsturm“ gewählt wurde. Ich dachte, dass es vielleicht einen Zusammenhang zur atomaren Struktur des Kohlenstoffs gäbe. Dass sich, wie es heißt, das „ebenmäßige Schüttungsprinzip der Halde“ in der Addition und Schichtung der Stahlrohrelemente zu Tetraedern wiederhole, scheint mir nicht unmittelbar einleuchtend. Immerhin habe ich heute gelernt, dass der innere Aufbau des Tetraeders aus dem Sierpinski-Dreieck abgeleitet ist – aber auch das hat wohl kaum einen inneren Bezug zur Region. Einen starken Eindruck machte bei meinem zweiten Besuch die linsenförmige Vertiefung aus künstlichem Berggestein, ohne dass ich mir so recht erklären konnte, was nun eigentlich in mir zum Klingen gebracht wurde, als ich diesen flachen Krater durchschritt.
Der Aufbruch vom Gipfel erfolgte dann etwas überstürzt, weil sich herausstellte, dass hier auch ein Elektrobus bis zum ZOB Bottrop verkehrt und wir diese Gelegenheit zu einer bequemen Rückfahrt nicht versäumen wollten. (Der nächste Bus wäre erst eine Stunde später abgefahren.) Auf dem Heimweg kreuz und quer durch Bottrop wurde uns wieder einmal bewusst, wie deprimierend manche Wohngegenden in unserer Heimatregion doch sind. Von Nahem sieht manches eben weit weniger erfreulich aus als aus der Distanz eines erhabenen Panoramablicks.
Posted in Flanerie, Kulturflanerie, Würfelwürfe | 1 Comment »
Saturday, 02. July 2011

Der Antrieb zum Schreiben bleibt in der letzten Zeit immer häufiger weg. Dann sitze ich für eine unbestimmte Zeit an meinem Schreibtisch, schaue abwechselnd auf den weißen Monitor und knapp über ihn hinweg durchs Fenster auf die gegenüberliegende Hausfassade mit der Hausnummer 41, frage mich, ob ich nicht vielleicht mal wieder eine längere Schaffenspause einlegen sollte, wundere mich, dass ich mich gedanklich in eine solche Versuchung bringe, da ich doch weiß, wie leicht sich ein kleiner Schlendrian zu einer hartnäckigen Schreibhemmung auswachsen kann und zwinge mich zuletzt dazu, wenigstens über meine Schwierigkeiten zu schreiben, wenn ich sie schon nicht beheben, mir noch nicht einmal erklären kann.
Ernest Hemingway, der sich heute vor 50 Jahren den Gnadenschuss gab, musste dem Vernehmen nach bis zuletzt seine 700 Wörter täglich aufs Papier bringen, sonst konnte er nicht schlafen, ob mit oder ohne Alkohol. (Vgl. Willi Winkler: Das verriegelte Paradies; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 150 v. 2./3. Juli 2011, S. 17.) Das ist zufällig auch etwa mein Mittelmaß für meine täglichen Postings in diesem Blog. Möglicherweise bin ich Anfang Mai in eine Falle gegangen, als ich mir versprach, hier keinen Tag mehr auszulassen, koste es was es wolle. Möglicherweise habe ich damit meine Schreiberseele dem Teufel verkauft, der mich holt, wenn ich dieser Verabredung mit mir selbst auch nur ein einziges Mal untreu werde. Und wohin wird er mich dann verschleppen? In die Hölle der Sprachlosigkeit? Aber was ich früher nicht für möglich gehalten hätte, das beobachte ich seither doch mit einigem Erstaunen, dass nämlich sture Disziplin tatsächlich ein taugliches Mittel ist, der Kreativität Beine zu machen; und dass das Gerede von der unberechenbaren Inspiration, auf die man nur warten könne und die sich nicht erzwingen lasse, dummes Gewäsch ist von Leuten, die keine Ahnung haben oder bloß eine Ausrede für ihre Faulheit suchen.
Was freilich die Qualität des Geschreibsels betrifft, das auf diese erpresserische Weise zustande kommt, so mögen sie andere beurteilen, mir steht es nicht zu. Das hindert mich zwar nicht, eine Meinung davon zu haben, doch die ist sehr wechselhaft, was mir gelegentlich die Laune verdirbt. Ich glaube, ich wiederhole mich, indem ich bekenne, dass mir manche meiner älteren Beiträge in diesem Blog so sehr viel besser gefallen als die aktuellen. Gründe dafür weiß ich keine, tröste mich aber immerhin damit, dass es mir andersherum auch nicht gefiele, denn dann geriete ich vermutlich in die Versuchung, ältere Beiträge zu löschen.
Gelegentlich hadere ich mit den Grundgegebenheiten dieser Publikationsform „Weblog“: dass bloß die letzten sieben Artikel ohne Umstände sichtbar sind, und nur der allerneueste auf Anhieb. Und selbst den kann der Leser nur bis zu Ende lesen, wenn er abwärts scrollt, das heißt: die Bildschirmdarstellung gleitend verschiebt. Für die übrigen 860 Artikel muss er Schritt für Schritt auf „Ältere Einträge“ klicken. Ein mühsames Geschäft! Wer macht das schon? Zwar kann er sich thematisch verwandte Artikel durch einen Klick auf die passende Kategorie zusammenstellen. Aber ich bin da ganz der nüchterne Skeptiker: Das große, noch immer im Wachsen begriffene „Gesamtwerk“ meiner Blog-Artikel nimmt kein Mensch zur Kenntnis. Vielleicht gibt es eine winzig kleine Schar von treuen Lesern, die von Anfang an einigermaßen regelmäßig bzw. gelegentlich immer mal wieder hier vorbeischauen; aber dann wohl hauptsächlich, weil sie mich persönlich aus dem „realen Leben“ kennen. Von einer echten literarischen Wirkung über diesen engen Bekanntenkreis und über den Tag hinaus kann jedenfalls sicher keine Rede sein. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, dann ich habe nicht vor, meine Lieferungen auf die Kundenwünsche auszurichten, wie ich es in meiner Zeit bei Westropolis vorübergehend getan habe.
(Bis hierher waren es genau 600 Wörter. Doch es wäre ja wohl gelacht, wenn ich das letzte Siebtel zum vollen Hemingway-Pensum nicht auch noch hinbekäme! Dabei soll mein Kopf- und Handwerk aber keinesfalls zur plumpen Zeilenschinderei ausarten. Mein Ehrgeiz zwingt mich vielmehr dazu, die verbleibende Zeit meines Lesers so sinnvoll wie eben möglich zu nutzen. Er soll den Eindruck mitnehmen, es habe sich gelohnt, auch diesen letzten, fünften Absatz zu lesen; und das, obwohl er doch in Klammern steht und daher der Verdacht nahelag, dass er nicht ganz so wichtig wäre wie die vorangegangenen vier. – Jetzt fehlen mir die Worte!)
Posted in Nonsens, Würfelwürfe | Comments Off on Zeilenschindereiverweigerung
Thursday, 30. June 2011

Da konnte der Kleine sich nun noch so sehr abmühen, seine Schatzkugel in Sicherheit zu bringen, da mochte er sie vor seinem Bauch umklammern oder hinter seinem Rücken verstecken – am Ende musste er sie offensichtlich doch preisgeben. Und zu allem Überfluss ist sie noch zerbrochen.
Ein großes Loch klafft in ihrer Schale, von dem aus sich Risse in alle Richtungen ziehen, fast wie bei einem aufgepickten Hühnerei. Was dort von innen herauskommt, ist aber nicht der Schnabel eines schlüpfenden Kükens. Vielmehr zieht eine blutrote Flüssigkeit wurmgleiche Bahnen auf der gelben Außenhaut.
Was mag das sein?
Jetzt – da endlich das ominöse Oval ganz unsere ungeteilte Aufmerksamkeit findet und sogar etwas mehr von sich preisgibt, als nur seine nach allen Seiten gleiche unversehrte Gelbheit – jetzt sind wir auch nicht klüger als zuvor. Ist hier etwas entwichen, das sich beim Verlassen seiner Behausung an den scharfen Kanten der Bruchstelle verletzt hat? Und wo ist das fliehende Kerlchen mit der Maske verblieben? Lebt es noch? Diesmal bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als der Unterschrift zu folgen:
„Das Geheimnis aushalten“. (Aber so schwer ist das auch wieder nicht. Und schließlich: Gibt es überhaupt ein Geheimnis?)
Posted in Heinrichs Testament | Comments Off on Heinrich Funke: Das Testament (XX)
Wednesday, 29. June 2011

Vor drei Jahren wurde ich von meiner Ansprechpartnerin bei Westropolis mal gebeten, einen „Beitrag über die Literatur der 1980er Jahre“ zu schreiben. Auf meine Nachfrage, was genau damit denn gemeint sei, stellte sich heraus, dass es um die in Deutschland damals erfolgreichsten Bücher gehen sollte, und unter diesen dann möglichst um solche, die den „Geist des Jahrzehnts“ besonders gut zum Ausdruck brächten. Das dürften Romane so gut wie Sachbücher sein! Die anderen freien Autoren des Kulturblogs der WAZ-Mediengruppe sollten parallel dazu die Musik, die Kunst, den Film und die Mode der 80er in Erinnerung bringen.
Wenn ich mich nicht sehr irre, war ich dann schließlich der einzige Gastautor, der den Auftrag ernst nahm und sein Soll erfüllte; kein Wunder, denn es stellte sich bald heraus, dass die Aufgabe mit einigem Aufwand verbunden war. Dabei hatte ich noch einen berufsbedingten Startvorteil, war ich doch im fraglichen Jahrzehnt ohne Unterbrechung als Buchhändler mit allen damals aktuellen literarischen Trends hautnah in Berührung gekommen. Und dennoch erswies sich ein erstes Brainstorming noch nicht als sehr ergiebig, zumal ich bei jedem zweiten Titel, der mir spontan einfiel, nicht hundertprozentig sicher war, ob er denn nun wirklich in diesem Jahrzehnt das Licht der Welt erblickt hatte. Ich hatte also einiges zu recherchieren und musste zudem die Spiegel-Bestsellerlisten der Jahre 1981 bis 1990 durchsehen, um meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen.
Was dabei herauskam, waren zwei Folgen Literatur der Achtziger, eine über Sachbücher und eine über die Belletristik dieses Dezenniums. In diesem Falle glaube ich nicht, dass es sich lohnt, meine alten Texte für Ostropolis zu überarbeiten. Sehr wohl aber scheint mir ihr Thema noch immer reizvoll, wenngleich nicht mit der willkürlichen Limitierung auf ein Jahrzehnt. Dass jedoch der Erfolg von Büchern etwas aussagt über das Denken und Empfinden der Menschen in der Zeit, in der diese Bücher – zur Freude ihrer Verleger und der Buchhändler – jene als Leser in großer Zahl für sich gewinnen, das erscheint mir immer noch evident und einer eingehenderen Betrachtung würdig.
Wenn von Erfolgsbüchern die Rede ist, dann meint man damit entweder Bestseller oder Kultbücher. Beide Begriffe möchte ich mit jeweils guten Gründen für mein Projekt vermeiden. Die reine Auflagen- bzw. Absatzzahl erscheint mir als Maßstab für die Wirkung eines Buches fragwürdig, sagt sie doch noch nichts darüber aus, ob der reißend verkaufte Schmöker auch gelesen wurde. Bestes Beispiel ist für mich hier immer Das Foucaultsche Pendel von Umberto Eco, das sich als Nachfolger seines populären Meisterwerks Der Name der Rose verkaufte wie geschnittenes Brot, aber die meisten Leser maßlos enttäuschte. (Ich persönlich kenne nur zwei Menschen, die von dem 750 Seiten starken Buch mehr gelesen haben als die ersten fünfzig.) Viele Erfolgsautoren sind da ja zugleich anspruchsloser und geschickter als Eco. Wenn sie einmal ein literarisches Erfolgsrezept gefunden haben, dann kochen sie daraus Jahr für Jahr ihr immergleiches Süppchen und haben ausgesorgt. Auch diese Art Serien-Bestseller von Leuten wie Johannes Mario Simmel, Heinz G. Konsalik, Donna Leon oder Georges Simenon sagen mindestens eins über ihre Leser aus: dass sie die Wiederholung des Immergleichen, längst Vertrauten lieben. Hohe Verkaufszahlen täuschen also starke Wirkung oft nur vor. Und das imposante Wort vom Kultbuch scheint mir ebenfalls für meine Absichten ungeeignet, da irreführend. So werden nach meiner Beobachtung nicht selten Bücher genannt, deren Titel jeder kennt, bei deren Nennung auch jeder ein mehr oder weniger deutliches Bild vor Augen hat – und die doch kaum jemand wirklich gelesen hat. Der Name sagt es ja schon deutlich: Kultobjekte werden aus der Distanz verehrt, vor allzu unmittelbarer Begegnung schützt sie ein stillschweigendes Berührungsverbot. Auch eilt ihnen meist der Ruf voraus, dass sie schwer zugänglich sind. Die Wirkungsgeschichte von Kultbüchern gibt indirekt zwar auch Auskunft über den Zeitgeist, doch soll dieser Aspekt hier nicht mein Thema sein.
Mir geht es vielmehr ganz banal um gesellschaftliche Trends, die sich im meist kurzlebigen Erfolg einzelner Bücher spiegeln. Die Frage, die sich mir in jedem einzelnen Fall stellen wird, lautet deshalb zunächst: Woher rührt das Interesse für gerade dieses spezielle Thema, das im vorliegenden Buch erstmals, oder doch erstmals auf diese Weise, abgehandelt wird? Und anschließend denke ich darüber nach, welchen der bekannten Grundrichtungen langfristiger sozialer Entwicklung dieses Interesse entspringt. Vielleicht komme ich aber auch zu dem Ergebnis, dass Bücher gerade deshalb erfolgreich sind, weil sie sich den vorherrschenden Trends verweigern und einen völlig neuen Ton anschlagen, der Neugier weckt. Insofern will ich das Ergebnis meiner Untersuchung offen halten. Ich beschränke mich bei meiner Studie auf die Zeit von 1955 bis 2005 und auf Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum.
Posted in Dingwelt, Trendbücher, Würfelwürfe | Comments Off on Plan einer Trendbuch-Analyse (1955-2005)
Monday, 27. June 2011

Es kommt vor, dass ich nicht weiß, was ich schreiben soll. Alle gewöhnlichen Mittel gegen diese Einfallslosigkeit versagen. Die Buchrücken schauen wie blöde Schafe auf mich herab, und ich schaue mutmaßlich ebenso blöd zurück. Ich denke darüber nach, was mir jüngst widerfahren ist, und gähne. Ich schaue aus dem Fenster auf die Schaufenster des seit Jahrzehnten geschlossenen Haushaltswarenladens gegenüber. Siebenschläfer. Es müsste leise nieseln, damit wenigstens das Wetter zur Leere in meinem Schädel passte. Aber höhnisch brät die Sonne die toten Fliegen auf meinem Fensterbrett gar.
Radiohören! Eben wird der 38-jährige Timm Klotzek zu seinem Wechsel von Neon und Nido zum SZ-Magazin befragt; ob ihm die Trennung schwer falle. Wörtlich sagt der Chefredakteur: „Ich glaube, der Wehmut wird erst später kommen.“ Habe ich richtig gehört? Ich habe richtig gehört. Vielleicht ist heute der Wermut zu früh gekommen. Na, das kann ja heiter werden. Aber einen eigenen Beitrag weiß ich aus diesem Lapsus nicht zu machen.
Ich könnte ja mit der Kamera vor die Tür treten und den nächstbesten Schnappschuss zum Anlass eines Textes machen, zur Kategorie Snapshot, oder Flanerie, oder Rêverie. Eine nicht gestellte Momentaufnahme, die mich vor die Aufgabe stellt herauszufinden, was der tiefere Sinn dieses Zufallsarrangements sein könnte. Die Welt ist doch so rätselhaft, so bizarr, so erklärungsbedürftig. Oder? Ich gähne schon wieder. Und außerdem kann ich gar nicht vor die Tür treten, denn ich warte auf einen Klempner, der im Keller ein leckes Rohr flicken soll.
Vielleicht sollte ich heute einfach mal wieder pausieren. Es ist doch keine Schande, wenn einem mal die Puste wegbleibt, oder? Was war das am 1. Mai – Tag der Arbeit! – bloß für ein dummer Einfall, mir beim Schreiben für mein Blog ab sofort keinen einzigen Tag Pause mehr zu gönnen? Dieser Ehrgeiz ist ja schon nahezu krankhaft!
Was sagt übrigens das Dienstpersonal zu meinen Nöten? „Gespräch meines Zimmerkellners mit dem Küchenmädchen über meine letzten Aphorismen. Er: ,Wenn man nur wüßte, wo der Mensch diese Einfälle alle hernimmt!?‘ Sie: ,Er hat doch den ganzen lieben Tag nix anderes zu tun!‘“ (aus Peter Altenberg: Fechsung; hier zit. nach Das Buch der Bücher von Peter Altenberg. Göttingen, Wallstein Verlag, 2009, Bd. 2, S. 475.) Und schon ist wieder ein Posting fertig. Etwas zerstreut ist es zugegebenermaßen geworden, aber doch drall und rund. Geh jetzt unter die Leut’; geh spielen!
Posted in Langsamkeit, Würfelwürfe | 2 Comments »
Saturday, 25. June 2011
Posted in Babel, Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Friday, 24. June 2011

Erstmals gegen sechs Uhr im Dienstmädchenbett aufgewacht. Dann der verabredeten Frühstückszeit um acht Uhr entgegengeschlummert. Den Sohn hält es länger in den Federn. Die Kinder machen sich auf den Schulweg, gebeutelt von einer Prüfungswoche mit vielen Klassenarbeiten hintereinanderweg, offenbar eine Spezialität des niederländischen Schulsystems. Tom fährt zum Jachthaven in Stavoren, wo seine Leihboote liegen. Zum Wochenende kommen die Boote vom Meer zurück und müssen an neue Mieter übergeben werden.
Annette zeigt uns nun Workum. Der Sohn kennt das Städtchen schon aus Kindertagen, hat er doch hier mit seinen Geschwistern und der Mutter mehrere Ferienaufenthalte erlebt und nach glaubhaftem Bekunden in bester Erinnerung behalten. Ich hingegen betrete Neuland. (Schon damals war mir die seltene Ruhe daheim an meinem Arbeitsplatz wertvoller als der bei den meisten Mitmenschen so beliebte Tapetenwechsel.) Als uns durch eine schmale Gracht ein Segler mit dem Namen Tijdgeest entgegenkommt, verschlägt ’s mir fast die Sprache. Wie das Boot so ruhig dahingleitet, kommt es mir vor wie ein Gleichnis auf die mir oft so unbegreifliche Paniklosigkeit meiner Zeitgenossen.
Nun ist uns doch noch unser Museumsbesuch vergönnt, und was für einer! Das Werk des malenden Lumpensammlers Jopie Huisman beeindruckt durch seine planvolle Entwicklung. Offenbar ist der Mann sehr überlegt an seine selbstgestellte Aufgabe herangegangen und hat seit den frühen 1960ern zunächst maltechnisch allerlei ausprobiert, bevor er schließlich nach Jahren seine persönliche Handschrift und seinen Blick auf die Dinge fand. Diese Dinge waren vor allem die verachlässigten, abgenutzen Gegenstände, die seine Mitbürger fortwarfen und die auf seinem Karren landeten. Viel Fleiß und Sorgfalt steckt in seiner Malerei und Zeichenkunst. (Imposant auch Huismans Kollektion von Gewichtskästen und Waagen, mit der er die lange Geschichte des Betrugs zu dokumentieren trachtete, denn viele Gewichte sind durch unscheinbare „Abnutzungen“ offenbar leichter, als ihr Nennwert vorgibt.)
Anschließend besichtigen wir Toms Arbeitsplatz und seine Boote, deren Namen mit C beginnen und auf A enden, wie Carolina, Caba oder Camilla. So heißt das komfortabelste Schiff dieser Reihe zufällig wie meine Enkelin. Ungeschickt wie ich bin, reiße ich in einem anderen Boot, das wir uns von innen anschauen, die Klinke einer Schlafkojentür aus der Verankerung, was mir für eine unanständig lange Zeit die Stimmung verdirbt. Dabei ist der Schaden, den ich damit angerichtet zu haben fürchte, doch viel geringfügiger und leichter behebbar, als ich mir einrede und man mich im Scherz wohl auch glauben machen will. Ich ahne den Schabernack und mime nun so lange den arglos leidenden Übeltäter, bis Tom mich aus meinem Verdruss erlöst, indem er mir offenbart, wie geringfügig der Aufwand einer Reparatur doch eigentlich sei.
Mein Sohn und ich gönnen uns schließlich einen frischen Kabeljau aus der besten Bratküche von Stavoren. Einen so köstlichen Fisch habe ich lange nicht mehr gegessen. Mein Sohn hatte beschlossen, von hier aus per Fähre übers IJsselmeer nach Enkhuizen und von dort mit der Bahn zurück nach Amsterdam zu fahren. So nehmen wir am Steg Abschied von ihm und winken, bis das Schiff außer Sicht ist. Annette packt in Workum ihre sieben Sachen und wir fahren gemeinsam mit dem Automobil in unser beider Heimatstadt. Unterwegs nutzen wir die Gelegenheit zum Austausch über Themen, die nur uns beide interessieren. Die wenigen Gesprächspausen stopfen wir mit ein paar Liedern von Hindi Zhara. Um fünf Uhr nachmittags bin ich wieder daheim.
Posted in Fernflanerien, Flanerie, Würfelwürfe | Comments Off on Memogramm der Hollandreise (Tag II)
Thursday, 23. June 2011

Wecker 5:25 Uhr. Eine Tasse Kaffee, zwei Brote mit Kochschinken. Fußweg zum Rathaus Rellinghausen bei trockenem Wetter, angenehm kühl, klare Luft, Vogelgezwitscher. Mit dem Nachtexpress-Bus, den ich noch nie genutzt habe, zum Hauptbahnhof Essen, von dort mit einem weiteren Nachtexpress-Bus zum Oberhausener Hauptbahnhof. Von dort mit dem ICE über Duisburg, Arnhem, Utrecht nach Amsterdam. Ankunft pünktlich um halb zehn, wo der älteste Sohn und seine friesische Freundin Gerda mich gut gelaunt erwarten. Zum Harnabschlagen und auf einen Weckkaffee in ein rummeliges Restaurant mit überforderten Kellnern noch im Centraal-Bahnhof.
Per Straßenbahn dann in Gerdas Wohnung in der Marco Polostraat. Nach kurzem Aufenthalt zu dritt großer Spaziergang, unter andrem durch den schönen Vondelpark bis ins Museumsviertel. Nach Abwägung von Kosten und Nutzen werden aber Ausstellungsbesuche, ob im Van Gogh Museum oder im Rijksmuseum, einstimmig verworfen. Einkehr auf Bierbänken vor einer kleinen Gaststätte. (Kann man dann eigentlich von „Einkehr“ sprechen?) Aß eine sehr fruchtige Tomatensuppe mit bestem Appetit, aber glücklicherweise vor Inaugenscheinnahme der sanitären Anlagen, die mir diesen möglicherweise verdorben hätte.
Unterdessen stets angeregte Unterhaltung über disparate Gegenstände, wie sie uns die durchwanderten Stadtkulissen gerade zutrugen. Eindrücklich etwa Gerdas Schilderung vom wilden Leben und tragischen Tod des niederländischen Musikers, Küstlers und Enfant terribles Herman Brood, der sich vom Dach des Amsterdamer Hilton-Hotels herabstürzte, weil ihm seine Drogensucht übern Kopf wuchs. (Dass dieses traurige Ereignis sich zufällig an meinem bevorstehenden Geburtstag zum zehnten Mal jährt, erfahre ich gerade erst beim Nachlesen des Wikipedia-Artikels über Brood.) Auf dem Rückweg Einkauf bei Albert Heijn, einer Ladenkette, bei der die muslimischen Kassiererinnen allesamt schwarze Kopftücher trugen.
Rechtzeitig zurück in Gerdas Wohnung, um den für fünf Uhr nachmittags verabredeten Besuch Annette B.s aus Workum abzuwarten, die uns nach dorthin mit ihrem Automobil abholt. (Leider kann Gerda nicht mitkommen, weil sie am nächsten Tag beruflichen Verpflichtungen nachzukommen hat. Oder waren es Verpflichtungen im Zusammenhang mit der überaus problematischen Wohnungssuche? Es ist nahezu unmöglich, in dieser Stadt eine akzeptablie Mietwohnung zu finden, wenn man sich hierum nicht entweder schon vor vielen Jahren angemeldet hat oder doch mindestens das Einommen eines Chefarztes oder die Beziehungen eines Immobilienmaklers hat.) So gehen wir zu dritt ohne Gerda auf die Suche nach einer italienischen Gaststätte oder einer holländischen Pommesbude und finden kurz vorm Verhungern in der Jan van Galenstraat tatsächlich die kleine Pizzeria Martini mit originellem Ambiente und freundlicher Bedienung durch den Inhaber. Anschließend fahren wir über den fast dreißig Kilometer langen Afsluitdijk durchs IJsselmeer nach Workum.
Tom und die Kinder begrüßen uns. Hausbesichtigung und Tagesausklang. Zu Bett im „Dienstmädchen-Zimmer“. Fülle der Eindrücke hindert mich zunächst am Einschlafen. Lese darum noch in einem beliebig aus dem Bücherregal gegriffenen Suhrkamp-Bändchen aus dem Bestand von Annettes verstorbener Schwester Karin: Edmund Wilsons Auf dem Weg zum Finnischen Bahnhof. Bedrückende Schilderungen des Lebens der arbeitenden Bevölkerung im Manchester des XIX. Jahrhunderts. – Traum von einem gefluteten Keller, in dem quietschend die Ratten ertrinken.
Posted in Fernflanerien, Flanerie, Würfelwürfe | Comments Off on Memogramm der Hollandreise (Tag I)
Tuesday, 21. June 2011

Was sind die beiden beherrschenden Themen in den dominierenden (d. h. bestverkäuflichen) Massenmedien (Boulevardpresse und Privatfernsehen)? Ganz einfach: „stars and strokes“, Prominente und Katastrophen. Das ist natürlich nicht etwa so, weil die Medienmacher keine anderen Einfälle hätten, sondern weil ihre Kunden keine anderen Bedürfnisse haben als eben diese beiden: Identifikationslust und Sensationsgier. Welcher Mann möchte nicht so cool wie Humphrey Bogart, so stark wie Arnold Schwarzenegger und so smart wie Tom Cruise sein? (Da darf man schon mal darüber hinwegsehen, dass Bogie ein schwächlicher Kettenraucher war, Arni ein Befürworter der Todesstrafe ist und Tommy sich als Aushängeschild für eine obskure Sekte hergibt.) Und welche Frau möchte nicht sexy wie Marilyn Monroe sein, klug wie Jodie Foster und erfolgreich wie Angela Merkel? (Macht ja nichts, dass Norma Jeane Baker an ihrer Anziehungskraft auf Männer schließlich elend zu Grunde ging, Jodie den Reagan-Attentäter Hinckley zu seinen sechs Schüssen auf den Präsidenten inspirierte und Angie, man mag es drehen und wenden wie man will, in ihrem öffentlichen Erscheinungsbild doch eine sehr fade und langweilige Person bleibt.)
Entscheidend fürs Image der Promis sind stets rein quantitativ messbare Werte: die Höhe der Gage, die Zahl der Fans, Einschaltquoten in der Glotze und Besucherzahlen in den Kinos, ausverkaufte Stadien und beeindruckend viele Klicks auf ihre „persönlichen“ Websites, möglichst hohe Positionen in Rankings („5 Oscars“, „über 90 Zentimeter Brustumfang“) und undurchdringliche Trauben von Fotografen vor den Entrees sündhaft teurer Hotels, Torschussstatistiken und ununterbrochene Serien von K.-o.-Siegen. Das Guinness-Buch der Rekorde ist zu einem guten Teil auch ein Almanach des Starkults unserer Tage. Eine immer ärmer werdende Menschenwelt lechzt zunehmend nach dem Weltrekord, bis in die letzten vernetzten Winkel von Hintertupfingen und der mongolischen Wüste. Und der armselige Star – verfolgt von Stalkern, Paparazzi und seinen eigenen Süchten – ist Täter und Opfer zugleich. Er zieht einen Schweif von Fans hinter sich her, der seiner Eitelkeit schmeichelt; und ist doch zugleich nur ein „Mensch wie jeder andere“: zwei Arme, zwei Beine und ein von diesem Spektakel überfordertes Hirn.
So, knapp charakterisiert, funktioniert die Maschinerie der Identifikationslust, die 99 Hundertstel von uns in ihren Bann zieht. Suche nach einem Menschen, der nicht weiß, wer Diana oder Elvis waren – dann kannst du vielleicht noch ein ursprüngliches Gespräch mit ihm führen. Wir sind alle verseucht von diesem Kult profaner Götter. Der vergängliche Ruhm dieser Götzen hat längst schon unser freies Denken paralysiert. Und nun tritt uns noch unsere unausrottbare Sensationslust in die Kniekehlen und besorgt den Rest, dass wir, täppische Affen, kaum noch eine Chance haben dürften, unseren Fortbestand aus diesem Jahrhundert ins nächste zu retten.
Was zwingt denn Millionen Fernsehzuschauer bei den alljährlichen Formel-I-Rennen vor den Bildschirm? Ich behaupte keck und frech: die Hoffnung auf einen katastrophalen Unfall. Wenn Michael Schumacher auf dem Nürburgring aus der Bahn getragen worden wäre, trotz aller Sicherungsmaßnahmen, und am Rande der Strecke zu einem Häuflein Asche verkohlt – dann, ja genau dann wären endlich die heimlichen Hoffnungen der sensationslüsternen Zuschauer erfüllt worden. Und in den folgenden Tagen wären die Einschaltquoten so hoch gewesen wie nie zuvor. Und da es doch letztlich immer ums Geld geht, wäre dieses traurige Ereignis das Optimum gewesen für den wirtschaftlichen Erfolg seiner Vermarkter. Insofern ist auch der Doping-Skandal bei der Tour de France ein Erfolg für die medialen Ausbeuter dieses Großevents. Die sportliche Konkurrenz als sauberer Vergleich ehrlicher Athleten passt doch längst nicht mehr in unsere nach persönlichen Tragödien und steilen Abstürzen gierende Welt des Starkults. Je maßloser wir unsere Stars in den Himmel der Unerreichbarkeit heben, desto tiefer wollen wir sie fallen sehen. Das ist nun einmal Gesetz in diesem schmutzigen Geschäft, in dem nur jene Vergötterung des Menschlich-Allzumenschlichen Bestand für die Ewigkeit haben kann, die noch zu Lebzeiten in den Abgrund völligen Versagens stürzt. Allein dieses Spektakel macht uns unser eigenes, schmalspuriges, blasses Alltagsleben noch einigermaßen erträglich. Und wenn dann beides gar zusammenfindet: die Gier nach der katastrophalen Sensation und die Lust an der Identifikation. Dann kocht das Star-System über und der Rubel rollt. Wie schön wäre es doch für den Moloch, wenn er solche Meldungen wie diese in die mediale Schein-Welt hinausschleudern dürfte: Kate Moss (aktueller Body-Mass-Index 16,9) erschießt ihren Ex-Geliebten Pete Doherty in der Empfangshalle des Berliner Hotels Adlon; Königin Elisabeth II. von England gibt zu, den Mord an ihrer Ex-Schwiegertochter Diana in Auftrag gegeben zu haben, weil sie diese beim inzestuösen Geschlechtsverkehr mit Enkel William im Buckingham-Palast ertappt hatte; die Pariser Zeitschrift Paris Match veröffentlicht das Faksimile eines Vertrags von Zinédine Zidane mit dem italienischen Fußball-Dachverband Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), aus dem hervorgeht, dass sein legendärer Kopfstoß gegen Marco Materazzi kurz vor Schluss des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Berlin verabredet und mit sieben Millionen Euro honoriert wurde.
Das wollt ihr doch hören, oder? Auf Sensationsnachrichten dieses Formats müsst ihr lüstern-lechzenden Fans wohl noch ein Weilchen warten. Aber sie werden kommen – so oder so ähnlich. Wartet ’s nur ab! Und dann? Was habt ihr davon? Ich würde euch so gern verstehen. Aber ich bin wohl zu dumm dazu.
[Dieses Posting erschien zuerst am 30. August 2008 bei Westropolis unter gleichem Titel. Es erscheint hier ungekürzt und wurde für die Neuaufnahme in mein Revierflaneur-Blog nur geringfügig überarbeitet. Das Titelfoto stammt vom Revierflaneur.]
Posted in Ostropolis, Werke, Würfelwürfe | Comments Off on Star-Dreck
Friday, 17. June 2011

Als ich vor drei Wochen mit großem Vergnügen die Schriftsteller-Interviews aus der Paris Review in der soeben erschienenen deutschen Übersetzung las, da fragte ich mich, warum es in Deutschland kein ähnlich ambitioniertes Unternehmen gab und gibt: Autoren nicht nur en passant zu befragen, wie es regelmäßig in unseren Zeitungs-Feuilletons geschieht, meist anlässlich des Erscheinens eines neuen Buches; sondern grundsätzlicher, zu ihrer Arbeitsweise, ihren Schreibtechniken, ihren innersten Anliegen, ihren Vorbildern und so weiter. Als einziges ungefähr dem amerikanischen Vorbild angenähertes deutsches Beispiel fielen mir spontan die Werkstattgespräche mit Schriftstellern ein, die Horst Bienek Anfang der 1960er-Jahre mit 15 zeitgenössischen deutschsprachigen Schriftstellern geführt hat (München: Carl Hanser Verlag, 1962).
Dieses Buch war für mich eine wichtige Orienierungshilfe, als ich mir als lesehungriger 15-Jähriger einen Überblick über die damals modernen Autoren verschaffen wollte. Das Wörtchen „modern“ bezeichnete für mich die conditio sine qua non bei der Auswahl meines Lesestoffs in der Stadtbibliothek. Aus einem naiven Vorurteil heraus lehnte ich alle ältere Literatur ab. Ich war überzeugt, dass mir nur lebende Autoren etwas über die gegenwärtige Welt würden sagen können, am besten noch junge lebende Autoren. Warum sollte für Bücher nicht gelten, was doch auch für alle anderen Industrieprodukte galt? (Dass nämlich nur das jeweils Neueste, Modernste für den Zeitgenossen das Beste und Brauchbarste sein konnte.)
Es überforderte mich allerdings, Romane von allen 15 Autoren zu lesen, die Bienek interviewt hatte. Darum nahm ich einige in die engere Wahl, die mir den Gesprächen nach zu urteilen am meisten zusagten. Wenn ich mich recht erinnere, gefielen mir Alfred Andersch und Martin Walser besonders gut, während mir Robert Neumann, Hermann Kesten und Friedrich Sieburg vorkamen, als gehörten sie eigentlich schon nicht mehr in die Gegenwart. Zu unmodern! Ich kann nicht einmal verhehlen, dass ich mich auch von den Porträtfotos beeinflussen ließ, die dem Band beigegeben sind. In diesem Alter ist es wohl verzeihlich, dass man noch sehr auf Äußerlichkeiten achtet. Von Walser lieh ich ein Buch aus – um es schon nach ein paar Seiten wieder aus der Hand zu legen. Was war das denn? Als ich auch im zweiten Anlauf überhaupt nicht mit diesem sonderbaren Büchlein zurechtkam, entdeckte ich, dass ich irrtümlich Prosatexte eines Robert Walser gegriffen hatte, der ja schon längst tot war! Angewidert brachte ich das Bändchen aus der Bibliothek Suhrkamp zurück und entlieh stattdessen Ehen in Philippsburg vom „richtigen“ Walser, ohne indes damit wesentlich mehr anfangen zu können.
Heute nahm ich Bieneks Buch, das ich mir vor ein paar Jahren antiquarisch beschafft hatte, wieder einmal zur Hand. Und was erfahren wir gleich zu Beginn des Vorworts über den „Anlaß“, der den Herausgeber zu seinem Vorhaben angeregt hatte? „Vor Jahren las ich in der amerikanischen Zeitschrift Paris Review ein Interview mit William Faulkner; ein junger Autor, Jean Stein, hatte den amerikanischen Romancier besucht und mit ihm über ,Werkstattprobleme‘ eines Schriftstellers gesprochen. Die Antworten Faulkners haben mir ein tieferes Verstehen seiner Yoknapatawpha-Welt ermöglicht, sie waren für mich ein Schlüssel, eine Art authentischen Kommentars zur Struktur seiner Romane: Ich erfuhr mehr daraus als aus allen Essays über ihn.“ (Bienek, a. a. O., S. 7.)
Ich habe das Faulkner-Interview soeben gelesen. Es hat mich in meinem Vorurteil bestärkt, dass Faulkner kein Autor ist, der mich interessieren könnte. Schon die Unverrückbarkeit seiner Standpunkte stößt mich ab, seine maskuline Selbstsicherheit. Dazu passt, dass er voreilig schlussfolgert und sich zu Gegenständen äußert, von denen er offenbar nicht die geringste Ahnung hat. Jean Stein bittet ihn, sich zur Zukunft des Romans zu äußern. “I imagine as long as people will continue to read novels, people will continue to write them, or vice versa; unless of course the pictorial magazines and comic strips finally atrophy man’s capacity to read, and literature really is on its way back to the picture writing in the Neanderthal cave.” (Paris Review No. 12 / Spring 1956.) – Wo ein Bedarf ist, finden sich Leute, die sich dafür bezahlen lassen, ihn zu decken? Das geht noch hin. Aber dass sich, „vice versa“, auch immer Leute finden, die ein Produkt abnehmen, bloß weil es in die Welt gesetzt wird, ist schlicht Blödsinn! Und mit seiner kulturpessimistischen Unkerei, dass die zeitgenössische Menschheit zum Neanderthaler regrediert, wenn sie ihre Kinder Comics lesen lässt, kommt mir Mr. Faulkner vor wie ein bornierter Spießer aus den miefigen 1950er-Jahren.
Posted in Interviews, Questionnaire, Würfelwürfe | Comments Off on Zwiegespräche mit Schriftwerkern
Thursday, 16. June 2011

Wir werden Zeugen eines Angriffs auf unser Maskenmännchen. Wie aus dem Nichts erhebt sich eine gewaltige Faust, die sich um einen noch gewaltigeren Hammerstiel schließt, an dessen Ende ein noch gewaltigerer runder Kopf ohne Finne droht. Diese Art Hammer nennt man wohl auch Fäustel. Der Treffer mit einem solchen Mordwerkzeug muss jedenfalls verheerend für den Getroffenen sein, selbst wenn er ein ausgewachsenes Mannsbild wäre, von unserem mickrigen Zwerg ganz zu schweigen.
Der Angriff dürfte das Männlein überrascht haben, denn allzu hilflos wirkt seine Abwehrgeste. Es hält die Händchen nicht einmal schützend vor sein maskiertes Gesichtlein, spreizt vielmehr die Ärmchen ganz nutzlos, als wollte es den Hammer zur freudigen Begrüßung empfangen. Zugleich scheint es nach hinten zu fallen.
Wie so plötzlich der gelbe Ball, den der Kleine doch zuletzt vor seinem Bauche getragen hatte, nun urplötzlich hinter seinem Rücken verschwinden konnte, bleibt rätselhaft. Immerhin scheint in diesem Arrangement die Kugel bessere Aussichten als ihr Besitzer zu haben, mit heiler Haut davonzukommen.
Die Frage drängt sich auf: Warum tut der große Unbekannte das? Was veranlasst diesen anonymen Hammerschwinger zu solch brachialer Strafaktion? Hat sich der Kleine etwas zuschulden kommen lassen, dass er solch grausame Bestrafung verdient? Bedenken wir die Vorgeschichte, so mag es scheinen, als habe er die goldene Kugel gestohlen und werde nun, auf frischer Tat ertappt, am Vollzug seines Diebstahls gehindert. Bevor er seine Beute endgültig in Sicherheit bringen kann, wird er erledigt.
Wie dem auch sei: Die Bildunterschrift denunziert das gewalttätige Strafgericht, mit dem wir hier konfrontiert werden, als Ausdruck von Schwäche. Auf das schlimme Kapitalverbrechen schweren Diebstahls folgt ein noch schlimmeres Kapitalverbrechen: Mord. Die Eskalation gehorcht einem Automatismus. Und automatisches Handeln ist schwach.
Posted in Heinrichs Testament | Comments Off on Heinrich Funke: Das Testament (XVIII)
Wednesday, 15. June 2011

Der Blick ins genau zehn Jahre alte Flourit-Kapitel des Zufall förderte keine neuen Erkenntnisse, sondern bloß ein paar Erinnerungen zutage. Man schreibt das erste Jahr des noch unschuldigen neuen Jahrtausends. Ich erscheine mir im Rückblick wie eine gefangene Motte, die zwischen verschiedenen gefährlichen Flammen hin- und herflattert. Es war noch nicht lange her, dass ich mein Souterrain zugunsten meines Ältesten aufgegeben hatte und in die obere Wohnung gezogen war. Dort schlief und schrieb ich eine Zeit lang im hinteren, zur Terrasse gelegenen Zimmer. Meine Brotarbeit empfand ich fast nur noch als lästige Routine, bei der die einzige Herausforderung darin bestand, eine möglichst heitere Miene zum faden Spiel zu machen. Und über diesem Szenario, das vielleicht tatsächlich bei allem Wohlstand eine Hölle war, lag Tag für Tag der dichte Nebel einer schweren Betäubung. Ich war wohl eine jener bemitleidenswerten Existenzen, von denen man spöttisch sagt, es gehe ihnen zu gut.
Immerhin hatte ich meine Freude an Wortspielen, Witzen und Rätseln noch nicht ganz eingebüßt. Und mein makaberer Humor lag immer auf der Lauer nach einem Bonmot, mit dem ich schlichtere Gemüter aus der Fassung bringen konnte. Um nicht zu versauern redete ich mir ein, dass ich nebenher meine hochtrabenden Projekte vorantrieb. Was war es doch gleich damals noch für eines? Richtig! Vor zehn Jahren wollte ich meine ganz persönliche Bibliothek der Weltliteratur zusammenstellen, bestehend aus tausend Bänden aller Zeiten und Länder, Dichtung so gut wie Philosophie und Wissenschaften umfassend. Und jedes dieser Werke wollte ich überaus gründlich lesen, um im Anschluss einen brillianten Essay zu schreiben, in dem seine Vorzüge, seine Einzigartigkeit und sein Wert für die Zukunft ausgemessen würden.
Vor zehn Jahren hatte ich gerade Theodor W. Adornos Gedankenbuch Minima Moralia aus der Hand gelegt und begann mit der Lektüre von Joseph Roths Roman Radetzkymarsch. Und was wurde daraus? Natürlich nichts Gescheites! Warum sollte auch gerade ich der Mann sein, dem zu jedem der großen Bücher der Weltliteratur etwas einfiele, worauf noch kein anderer gekommen war? Wenn ich mir die zahllosen Projekte vor Augen führe, die ich im Laufe von Jahrzehnten entworfen, eine Weile verfolgt und dann wieder verworfen habe, dann erscheine ich mir wie jemand, der sich selbst unablässig den großen Weltenrichter vorgespielt hat und dabei doch nur ein alberner Hanswurst war, Opfer einer größenwahnsinnigen Selbsttäuschung. Andererseits war ich immerhin nie ganz untätig. Die Pläneschmiederei hielt mich auf Trab. Ich schrieb unentwegt, ich las ein Buch nach dem anderen. Geschadet hat mir das kaum.
Zum Schluss dieses 166. Kapitels schrieb ich, wieder einmal voller Hoffnung auf eine Besserung meines Zustands: „Immerhin habe ich meinen blauen Ohrensessel nun so gestellt, dass ich den Blick frei habe in den Garten; daneben den Schachtisch, den ich allerdings bei nächster Gelegenheit einmal gründlich restaurieren muss. Zu sorgen ist nun vor allem noch für eine optimale Beleuchtung (von oben, von der Konstruktion des Hochbetts herab). Neben den Bleistiften und Karteikärtchen zum Exzerpieren von Zitaten und Gedanken sollen ein Stövchen mit Teekanne, eine Teetasse und eine große Kerze auf dem Schachtischchen Platz finden. – So gerüstet müsste ich das Lesen zu einem Hochgenuss kultivieren können, zum ersehnten Zielpunkt meines Alltags, zur eigentlichen Freude meines Daseins […].“ (Zufall, S. 2656.)
Diese eingeschränkte, trotzige kleine Hoffnung, die ich mit dem Adverb immerhin zum Ausdruck bringe, muss mir wohl reichen: für die Bewertung meiner Vergangenheit ebenso wie für die Einschätzung meiner Zukunftsaussichten. Immerhin lebe ich noch.
Posted in Werke, Würfelwürfe, Zufall | Comments Off on Immerhin
Tuesday, 14. June 2011

Träfe mich der Schlag und mir wäre, den Blick gen Himmel gerichtet, noch ein letzter heller Gedanke vergönnt, so dürfte er die Genugtuung zum Gegenstand haben, auf ein überreiches, geglücktes Leben zurückschauen zu können. Denn das war’s schon längst – und so erlebe ich heute jeden Tag als unverdiente Dreingabe.
Den sprichwörtlichen Baum hab ich bereits als Vorschulkind gepflanzt: eine Birke. Der Wunsch ein Haus zu bauen, dieser Selbstbetrug ewig beständiger Sesshaftigkeit, beschlich mich nie. Kinder sind da, für jeden Finger der Linken eins; und Werke für meine Rechte schon erst recht. Mein Hauptwerk, der Zufall, überraschte mich mit dem unerwarteten Geschenk, sich von mir vollenden zu lassen. Nun schwebt es als blauer Strich dicht unter der Decke meines Arbeitszimmers und wartet auf den neugierigen Nachlassverwalter, der das Monstrum nichtsahnend herab auf den Boden der Tatsachen holt [s. Titelbild]. Seit mir dieser Stein vom Herzen gefallen ist, fabriziere und fabuliere ich munter weiter drauf los.
Gelegentlich juckte es mir in den Fingern, einen Blick in eine dieser 32 blauen Schachteln mit ihren jeweils 160 einseitig beschriebenen Blättern zu werfen. Aber bei einem solchen Eindringen völlig willkürlich vorzugehen, das schien mir doch so, als wollte ich den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Ich vermisste das Inhaltsverzeichnis, denn dann hätte ich mir planvoll Zutritt verschaffen können.
Nun fiel mir dieses Verzeichnis jüngst beim Aufräumen unverhofft in die Hände. Es verzeichnet für jedes der 16-seitigen Kapitel den Titel, die Zahl seiner Absätze, die Nummern der Abbildungen und Fußnoten und schließlich – sehr wichtig! – das Datum des Beginns und das der Beendigung seiner Niederschrift. (Der Zufall entstand vom 23. März 1994 bis zum 18. Dezember 2005.)
Nun könnte ich also einen Rückblick exakt aus der Distanz eines Dezenniums wagen, wenn ich denn wollte. Am 15. Juni 2001 begann ich mit der Niederschrift des 166. Kapitels, Fluorit (S. 2641-2656). Es enthält die Absätze 4470 bis 4503, eine Abbildung und eine Fußnote. Beendet habe ich es am 30. Juni. Ob ich mich auf dieses Abenteuer einlasse, werde ich erst morgen entscheiden. Möglicherweise bin ich entsetzt? Vielleicht habe ich mich seit Jahren über die Qualität dieses vermeintlichen Haupt- und Meisterwerks getäuscht?
Posted in Werke, Würfelwürfe, Zufall | Comments Off on Inhaltsverzeichnis zum Zufall
Monday, 13. June 2011
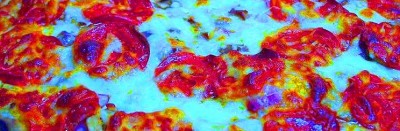
[6] Hunde, die wie die Karikaturen ihrer Halter aussehen, sich wie diese bewegen, benehmen und sogar ganz ähnlich bellen wie die jeweiligen Frauchen bzw. Herrchen sprechen. (Dies kommt sehr häufig vor, ist vielleicht sogar die Regel, was man bemerken wird, sobald man sich erst mal angewöhnt hat, darauf zu achten. Dann aber wird man diesen Vergleichszwang nach meiner Erfahrung nicht mehr los.)
[7] Unentschiedene Witterungen, sowohl in klimatischen als auch in sozialen Zusammenhängen. Eine Gewitterneigung, die ums Verrecken nicht zum Donnerwetter führen will; ein Konflikt, der in der Luft liegt, aber nicht zur Sprache kommt.
[8] Die Frage „Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen?“ (Besonders nervend als Einleitung zu einer Frage, die sich als völlig banal und jedenfalls harmlos entpuppt, schlimmstenfalls noch mit dem Zusatz: „Aber Sie nehmen es mir auch ganz bestimmt nicht übel?“)
[9] Hundegebell. Je länger anhaltend, desto.
[10] Eklige Postwurfsendungen zu Reklamezwecken. (In letzter Zeit beonders unerträglich knatschbunte Werbung von Vorbeibringpizzerias mit schlechten Fotos von Pizza con Cozze [s. Titelbild].)
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Meine kleinen Idiosynkrasien (II)
Sunday, 12. June 2011

[1] Etwas unterm Schuh, das noch zu leben scheint. Quietscht es nicht gar? Ich trete fest auf, nun quietscht es noch lauter. (Allerlei Bilder von schwer verletzten Küken drängen sich mir auf.)
[2] Kirchenglocken in der Großstadt, die glaubwürdig so klingen, als würden sie noch von Hand geläutet. Von schwieligen, schrundigen Händen.
[3] Handgemachte Kitschartikel mit okzidentaler Symbolik (Nikoläuslein, Osterhäschen u. dgl.), gefertigt in Fernost mit maschineller Gefühllosigkeit.
[4] Touristische Hobbyfotografien von schneebedeckten Bergen, azurblauen Seen; von äsenden Rehkitzlein auf sonnenbeschienenen Lichtungen, imposanten Konzernzentralen und pittoresken Elendsvierteln; von einander zuprostenden Reisebekanntschaften, urigen Straßenmusikanten und anderem fröhlichen Gesindel – kurz: Beweisfotos der fatalen Gemütsverzerrungen ihrer Hersteller.
[5] Blüten-, Schmetterlings- u. ä. Naturmuster auf Klopapier [s. Titelbild].
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Meine kleinen Idiosynkrasien (I)
Saturday, 11. June 2011

„Ich höre Geräusche, die andere nicht hören, die mir die Musik der Sphären stören, die andere auch nicht hören.“ (A 1250) – So oder ähnlich empfinde auch ich meine einsame Extravaganz. Gehe ich in Gesellschaft wo andere lachen, graust es mich. Wenn ich dort von meinen Ängsten erzähle, ernte ich Gelächter. Ich fliehe in den Wald, wo mir alle paar Meter austauschbare Menschen begegnen, die sich per Handy mit ihren fernen Nächsten austauschen. Noch wenn ich einsam in meiner Stube grüble, bebrüte ich die Erinnerung an diese Karikaturen der Geselligkeit und Naturverbundenheit. Wo diese alles zu sein bemüht sind, sind sie nichts; während ich nichts hermachen möchte, kommt mich alles an.
„Wenn ich mir die Haare schneiden lasse, so bin ich besorgt, daß der Friseur mir einen Gedanken durchschneide.“ (A 1975) – Es sind aber nicht bloß die Friseure, die durch ihr Geklapper und Geschnatter Zusammenhänge vernichten, verzweigte Gedankengebäude zu Kleingedrucktem zerlegen und Tabula rasa mit Denksystemen machen, als wären sie bloß Wasserdampf überm Herd. Die Alltäglichkeit der Alltäglichen tötet alles Erhabene wirksamer denn jeder Bildersturm.
„Die deutsche Bildung sollte nicht geleugnet werden. Nur muß man auch wissen, daß die kein Inhalt ist, sondern ein Schmückedeinheim.“ (A 500) – Das war einmal. Auch heute schmückt der Mann von Welt sein Heim, aber nicht mehr mit hohler Bildung, sondern mit prallen Abzeichen seiner Zeitgemäßheit, zu Deutsch: Design.
„Sexuelle Aufklärung ist jenes Verfahren, wodurch es der Jugend aus hygienischen Gründen versagt wird, ihre Neugierde selbst zu befriedigen.“ (A 1730) – Neugierde gilt immer noch als staatsgefährdend, aber die totale Aufklärung hat mittlerweile alle reizvollen Geheimnisse so vollständig eliminiert, dass die jugendlichen Abenteurer nicht den geringsten Anlass mehr finden, sich in Gefahr zu bringen.
„In keiner Sprache kann man sich so schwer verständigen wie in der Sprache.“ (A 1390) – Das verstünde ich wohl nur, wenn es in einer anderen Sprache gesagt worden wäre.
[Karl Kraus zu Ehren, dessen Todestag sich morgen zum 75sten Mal jährt.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Zu fünf Aphorismen von Karl Kraus
Friday, 10. June 2011

Über Auschwitz habe ich viel gelesen; vermutlich mehr, als einem Menschen verträglich ist, wenn er sich einen unbefangenen Blick auf seine Mitmenschen erhalten will. Was in der Vergangenheit geschah, ist ja niemals vorbei. Und was Menschen einander einmal angetan haben, das kann sich jederzeit wiederholen, ganz gleich, mit welchen Nie-wieder-Mantras wir uns unterdessen in den Schlaf wiegen mögen. Die einmal ausgemessenen Dimensionen des Schrecklichen kann keine Macht der Welt wieder zurechtstutzen auf ein erträglicheres Maß. „Bewältigen“ kann man das Geschehene nicht, ebensowenig den Tätern verzeihen; schon gar nicht, wenn man zu den Opfern gehörte wie Rudolf Vrba, dessen zuerst 1963 in englischer Sprache erschienene Erinnerungen I Cannot Forgive der Verlag Schöffling & Co. im vorigen Jahr in einer kommentierten Neuübersetzung herausgegeben hat.
Dieses Buch gesellt sich zu den Berichten beredter Augenzeugen wie Imre Kertész (15 Jahre alt bei der Ankunft in Auschwitz), Primo Levi (24), Wieslaw Kielar, Tadeusz Borowski oder Shlomo Venezia (alle 20), die jeder auf eigene Weise versucht haben, das Grauen dieses Un-Ortes in veröffentlichten Erinnerungen begreifbar zu machen. Der gebürtige Slowake Rudolf Vrba (eig. Walter Rosenberg) kam als 17-Jähriger über das Vernichtungslager Maidanek nach Auschwitz und überlebte dort in verschiedenen Teilen des Lagers und in unterschiedlichen Positionen nahezu zwei Jahre, bevor ihm als einem der ganz wenigen Menschen überhaupt am 10. April 1944 mit seinem Mithäftling Alfréd Wetzler die Flucht gelang.
Die meisten konkreten Details seiner Erzählung waren mir aus den vielen Berichten und Beschreibungen des größten Menschenvernichtungslagers der Geschichte bekannt. Dennoch hat mich die Lektüre dieses Buches noch einmal auf eine Weise berührt und verstört, wie ich es nicht erwartet hätte und auch nicht leicht erklären kann. Gewiss trägt hierzu bei, dass Vrba seine Leidens- und Kampfgeschichte so lebendig und in allen grauenhaften Einzelheiten so nachfühlbar erzählt, dass man ihm nur atemlos folgen kann. Obwohl man weiß, dass es für ihn gut ausgehen wird, zittert man doch mit ihm bei den Vorbereitungen seines Ausbruchs und fühlt intensiv die ständige Bedrohung, der er sich damit aussetzt. Aber dies allein kann es nicht gewesen sein, was das Buch für mich von ähnlichen Zeugnissen unterscheidet. Es klingt vielleicht makaber, wenn ich es so sage, aber ich weiß keinen passenderen Ausdruck. Der Liebe zum Detail ist es vermutlich zu verdanken, wenn ich als Leser meine Zuflucht nicht in einem panoramatischen Blick aufs Ganze dieses Höllenschlunds nehmen konnte. Die Sinnlichkeit, mit der Vrba konkrete Dinge Gestalt annehmen lässt, macht es uns unmöglich, Distanz zu den Ereignissen zu beziehen, die sich dort zutrugen. [Das Titelbild zeigt eine Armbinde für Oberkapos in den Lagern. Auch ein solch konkreter Gegenstand vermag mich ähnlich zu berühren, wenn ich mir vorstelle, wie weibliche Häftlinge eingesetzt wurden, diese Binden in der Näherei anzufertigen. Vermutlich hing ihr Leben davon ab, dass dies mit tadelloser Sorgfalt geschah.]
Ein Rätsel, das das Buch aufgibt, ist das absolut außergewöhnliche, nahezu unmögliche Schicksal seines Autors. Auschwitz zu überleben war schon eine schier unlösbare Aufgabe. Eine gelungene Flucht hingegen war so selten, dass die Frage sich aufdrängt, wodurch der Glückliche, dem sie gelang, hierzu prädestiniert war. Rudolf Vrba stellt sich selbst diese Frage immer wieder – und findet darauf mehrere Antworten. Alles andere wäre vermutlich auch unseriös, denn eine einzelne Erklärung reicht nicht aus, um so viel Glück glaubhaft zu machen. Der junge Mann hatte tatsächlich unglaublich viel Dusel, indem er etwa zahllose lebensgefährliche Situationen mit knapper Not hinter sich brachte, oder indem er immer wieder zufällig an die richtigen Leute geriet, die ihm weiterhelfen konnten und wollten, statt ihn zu verraten. Zugleich hatte er aber auch einen unbeugsamen Optimismus und Überlebenswillen. Er ließ sich von Rückschlägen nicht entmutigen und verfolgte sein Ziel mit größter Beharrlichkeit. Für sein Alter war er erstaunlich besonnen, ein hervorragender Beobachter und guter Menschenkenner. Zudem sprach er mehrere Sprachen und konnte sich damit bei Mitgefangenen nützlich machen, die ihm so Dank schuldeten und ihn im Gegenzug unterstützten. Vielleicht war aber der entscheidende Kraftspender zur Verwirklichung seines Vorhabens Vrbas Motiv. Es ging ihm nämlich nicht darum, durch die Flucht sein eigenes Leben zu retten. Wenn ihm daran gelegen gewesen wäre, dann hätte er sich besser darauf verlegt, ein weiteres Jahr im Schutz der Unauffälligkeit, die er sich antrainiert hatte, im Lager zu überdauern. Die realistische Hoffnung, dass Hitler den Krieg verlieren könnte und die Konzentrationslager von seinen Gegnern irgendwann befreit würden, teilte er mit den politisch organisierten Häftlingen, die besser über das Kriegsgeschehen draußen informiert waren, als ihren allmählich nervös werdenden Bewachern recht sein konnten. Der Fluchtversuch hingegen war ein hochriskantes Vabanquespiel! Darauf ließen sich Vrba und Wetzler nur deshalb ein, weil sie die Weltöffentlichkeit über Auschwitz informieren wollten und hofften, zugleich hunderttausende ungarischer Juden, deren Vernichtung als nächstes auf Himmlers und Eichmanns Programm stand, zum Aufstand gegen ihre bevorstehende Deportation anzustacheln. Dass dies nicht gelang und insofern die Flucht der beiden gemessen an ihrer Absicht vergeblich war, ist die bittere Pointe des Buches. So wie Vrba nicht von Vergebung sprechen kann, ist es vielleicht auch nicht angebracht, es einen Trost zu nennen, dass wir seiner Flucht immerhin dieses außergewöhnliche Buch verdanken. Dankbar sein dürfen wir dem Schicksal hierfür aber immerhin.
Und auch dem Verlag gebührt Dank, dass er dem Buch viel editorische Sorgfalt hat angedeihen lassen. Augenzeugenberichte aus Konzentrationslagern werden ja nicht nur von Holocaust-Leugnern einer besonders kritischen Prüfung unterzogen, was ihre Faktentreue und Objektivität angeht. Auch politisch neutrale Historiker müssen Zeugenberichte von Opfern auf ihre Glaubwürdigkeit hin gründlich prüfen, denn seelische Traumatisierung kann das Gedächtnis auch ohne bewusste Absicht in die Irre führen. So korrigieren Fußnoten der Herausgeber manche Zahlenangaben oder Daten des Autors, ohne dass daraus gegen ihn der Vorwurf ableitbar wäre, er hätte bewusst übertrieben oder Ereignisse verfälscht. Auch die Abbildungen bereichern den Band. Besonders hat mich gefreut, Rudolf Vrba auf Fotos der 1960er-Jahre und danach als einen fröhlichen, selbstbewussten Ehemann und Familienvater zu sehen, dem selbst die Hölle von Auschwitz nicht den Lebensmut hat rauben können.
[Rudolf Vrba: Ich kann nicht vergeben. Meine Flucht aus Auschwitz. A. d. Engl. v. Sigrid Ruschmeier u. Brigitte Walitzek. M. e. Vorw. v. Beate Klarsfeld. Hrsg. u. m. e. Nachw. v. Dagi Knellessen u. Werner Renz. Mit zahlr. Abb. Frankfurt am Main: Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung, 2000. – ISBN 978-3-89561-416-3 – 28,00 €.]
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Die vergebliche Flucht
Thursday, 09. June 2011
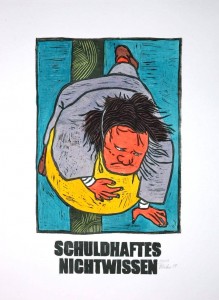
Nun hat sich also das pummlige Maskenmännchen durch den schmalen Spalt geschoben. Fällt es? Oder ist der Spalt ein Riss im Boden, und wir sehen auf es hinab?
Ganz unmöglich – oder immerhin doch unerklärlich – scheint, wie die große gelbe Kugel ihren Weg durch den Spalt gefunden haben soll. Aber wir wissen ja nicht, was sich zwischen den Bildern zugetragen hat. Vielleicht hat sich ja der Spalt wie bei einer Schiebetür verbreitert.
Es kann uns im Grunde gleichgültig sein. Jedenfalls ist das Maskenmännlein mit dem grimmigen Antlitz jetzt draußen, an der Oberfläche. Seinen Schatz trägt es vor sich her wie die Hochschwangere ihren Bauch. Allerdings schaut es nicht so besorgt oder beseelt drein, wie werdende Mütter es zu tun pflegen, sondern eher kummervoll. Es trägt seine Last nicht mit Stolz und nicht in froher Erwartung, sondern wie der Dieb auf der Flucht vor den Häschern, die ihm schon dicht auf den Fersen folgen mögen.
Wen mag der Pummlige bestohlen haben? Was verbirgt sich in dem sonnengelben Ball? Wo will er damit hin? Wir wissen es nicht. Da wir es nicht wissen können, ist unser Nichtwissen nicht unsere Schuld. Der Künstler zeigt nicht genug, um uns auf solche Fragen eindeutige Antworten zu ermöglichen. Unser Nichtwissen in diesem Falle ist jedenfalls schuldlos.
„Schuldhaftes Nichtwissen“ wäre ein solches, bei dem der Ignorante die Erweiterung seines Wissens aus reiner Faulheit verpasst; oder vielleicht auch aus Angst vor der Wahrheit.
Posted in Heinrichs Testament | Comments Off on Heinrich Funke: Das Testament (XVII)
Wednesday, 08. June 2011

Heute geht es mir dreckig. Krampfartige Schmerzen im Unterbauch, vorwiegend rechts. Blinddarm? Ein heißes Bad bringt vorübergehend Linderung. Der Schmerz kehrt aber bald zurück, und mit doppelter Wucht.
Ich werde in die Notfallambulanz des nächsten Krankenhauses fahren müssen. Dort wird mich ein Dr. (RUS) mit den Worten empfangen, da käme ich ja gerade noch rechtzeitig. Er habe nämlich schon so gut wie Feierabend. Hingelegt, Bein gestreckt, hier gedrückt, da gezogen: „Der Blinddarm ist es nicht!“
Er wird mir dann Novaminsulfon gegen die Schmerzen und weitere Tropfen gegen Motilitäts-Störungen im Magen-Darm-Bereich aufschreiben. Beim Gehen werde ich nach meiner scharzen Tasche greifen, die ich in aller Eile mit dem Nötigsten vollgestopft hatte. Irritiert und amüsiert wird er mich fragen, was ich denn da mit seiner Tasche wolle. Und es wird sich herausstellen, dass wir tatsächlich ganz gleiche Taschen besitzen, von Gardini. Ob ich die vielleicht in der Türkei gekauft habe, will er wissen.
Liegt es nun an der schmerzverschärften Wahrnehmung? Oder begegnen mir in solch inwendig außergewöhnlichen Verfassungen immer die extremsten Abstrusitäten? Die Apotheke mit Nachtdienst, zu der wir den Taxifahrer dirigieren werden, wird jedenfalls eher an eine Zwingburg als an eine Versorgungseinrichtung erinnern. Die Apothekerin wird eine halbe Ewigkeit benötigen, bis sie endlich mit den beiden Medikamenten anrückt. Und sie wird anschließend große Mühe haben, die Tüte mit den Packungen durch die engen Sprossen des Gitters zu quetschen, das sie vorm AIDS-Biss zähnefletschender Rauschgiftsüchtiger bewahren soll.
Tags drauf, also übermorgen, wird es mir nicht wesentlich besser gehen. Immerhin werde ich mich in mein Bücherlager schleppen, um eine Bestellung – Jules Vernes Geheimnisvolle Insel in der Übersetzung von Lothar Baier – ausliefern zu können. Wieder zurück in meinem Arbeitszimmer werde ich feststellen müssen, dass sich in der Mitte meines Gesichtsfelds dauerhaft eine hell leuchtende kreisförmige Erscheinung festgesetzt hat, die bei geschlossenen Augen so aussieht wie im Titelbild skizziert. Ich werde in Panik geraten und mit meinem Hausarzt tefelfonieren, der mir raten wird, einen Augenarzt aufzusuchen. Noch während des Gesprächs wird die Furcht einflößende Aureole sich verflüchtigen. Besonders bemerkenswert werde ich im Nachhinein finden, dass sie, wie in meiner Skizze angedeutet, nicht ganz regelmäßig gewesen sein wird.
Posted in Memento, Würfelwürfe | Comments Off on Zukünftige Aureole im Rückblick
Tuesday, 07. June 2011

Schon die üblichen Klassentreffen zu runden Abi-Jubiläen habe ich immer gemieden, weil ich die Mehrzahl der Knaben, mit denen ich die Schulbank drückte, nicht wiedersehen möchte. Also bestand für mich auch nie Veranlassung dazu, auf Internet-Plattformen wie StayFriends & Co. nach gründlich vergessenen Jahrgangsgefährten vom Essener Helmholtz-Gymnasium zu fahnden.
Anders verhält es sich mit den wenigen Freunden, die mich in meiner unglücklichen Schulzeit positiv beeindruckt und mich – was noch seltener der Fall war – ein wenig verstanden haben. Einer von ihnen war Dieter Schnack, drei Klassen über mir, Gründer und Chefredakteur der Schülerzeitung Holtzwurm. Bis dahin hatte es an diesem Jungengymnasium nur eine „Schulzeitung“ gegeben, in der kritische Beiträge zum Schulalltag keinen Platz hatten. Nun ließ Direktor Hugo Vollmerhaus gleich die erste Ausgabe des großformatigen Heftes – es erschien 1970 oder 1971 – beschlagnahmen. Der Grund? Eine Karikatur, die die Frage aufwarf, ob wohl ein Mitglied des Kollegiums neuerdings ein Halbperücke trüge. Die Bildunterschrift lautete: “Toupet or not toupet, that’s the question?” Die Antwort war zwar ohnehin längst allgemein bekannt, nachdem der Englisch- und Sportlehrer mit dem Haarersatz beim Kopfsprung vom Zehnmeterbrett einmal seine Bedeckung eingebüßt hatte. Aber zum Thema machen durften es die Schüler nicht, das erfüllte eindeutig den Tatbestand der Beleidigung und Untergrabung der Autorität. Mein bester Freund und ich waren die jüngsten Redaktionsmitglieder der ersten Stunde. Ich steuerte einen Beitrag zum Thema „mens sana in corpere sano“ bei, bestehend aus einer langen Liste von Genies, die alles andere als gesund gewesen waren, weder körperlich noch geistig – und etliche Rauschgiftsüchtige waren auch darunter. (Ich bediente mich dafür großzügig aus einem Essay von Gottfried Benn über Genie und Wahnsinn, aber das merkte einer.) Von Dieters Beiträgen erinnere ich mich noch an einen, indem er sein Befremden zum Ausdruck brachte, dass seine Altersgenossen in der Tanzschule zu dem Anti-Vietnamkriegs-Song Purple Haze von Jimi-Hendrix „ausgelassen herumhopsten“. Diese Ernsthaftigkeit imponierte mir damals sehr.
Nachdem ich die Schule vorzeitig verlassen hatte, verlor ich Dieter Schnack für viele Jahre aus den Augen. Er machte Abitur, studierte Pädagogik bis zum Diplom, schrieb zusammen mit Rainer Neutzling das erfolgreiche Buch Kleine Helden in Not (1990). Ich war unterdessen Buchhändler geworden und leitete die Rüttenscheider Filiale von G. D. Baedeker in Essen. 1993 wurde mir vom Rowohlt-Verlagsvertreter eine Autorenlesung mit Schnack und Neutzling aus ihrem neuen Buch Die Prinzenrolle angeboten. So kam es am 22. Oktober jenes Jahres zu einem Wiedersehen nach gut zwei Jahrzehnten. Wie es so geht, wenn man einen älteren Freund in der Erinnerung idealisiert, konnte dieses Treffen nur enttäuschen. Dieter hatte kaum noch eine Erinnerung an mich, und meine Erinnerungen an ihn schienen ihm nicht zu gefallen. Er glaubte gar, ich müsste ihn mit jemandem verwechseln, denn meine Erzählungen passten so gar nicht auf ihn. In sein Buch schrieb er mir die belanglose Widmung: „Mit den besten Wünschen für Dich und die Deinen!“
Nachdem nun weitere 18 Jahre ins Land gegangen sind, fiel mir unlängst ein drittes Buch in die Hände, dass er wieder gemeinsam mit Rainer Neutzling verfasst hatte: „Der Alte kann mich mal gern haben!“ Es erschien 1997 als rororo-Taschenbuch. Ich wollte wissen, ob inzwischen die Liste seiner Veröffntlichungen noch länger geworden sei, und gab seinen Namen in den Online-Katalog der Deutschen Nationalbibliothek ein. Dort findet man neben den bibliographischen Angaben auch einen knappen „Steckbrief“ zu jedem Autor: „Schnack, Dieter | auch Schnack-Jürgens, Dieter | Diplom-Pädagoge und Journalist | 1953-2000.“ Dass Schnack verheiratet war, wusste ich. Aber dass er nicht mehr lebt, weiß ich erst seit eben. Gerade mal 47 Jahre alt ist er also geworden. Sein Ko-Autor erwähnt in irgendeinem Vortrag, den man auch im Internet findet, dass Dieter Schnack nach langem Kampf an Krebs gestorben ist.
Die Prinzenrolle ist ein außergewöhnlich offenes und ehrliches Buch über die männliche Sexualität, gerade auch des männlichen Kindes. Natürlich beschränkt es sich lokal auf die mitteleuropäische Zivilisationssphäre und temporär auf die Lebenszeit meiner Generation, wobei die Generation unserer Eltern und die unserer Kinder natürlich mit in den Blick genommen wird. Im Rückblick auf die eigene Erziehung suchen die Autoren nach Erklärung, im Hinblick auf die Erziehung unserer Kinder nach Möglichkeiten der Befreiung. Insofern ist Die Prinzenrolle eine späte und reife Frucht jener sexuellen Revolution, die mit Volkmar Sigusch, Gunther Schmidt, Ernest Bornemann und dem jüngst tragisch verunglückten Günther Amendt mit den 68ern ihren Anfang nahm. Es bleibt im Bestand meiner via „Antiquariat Revierflaneur“ ständig schrumpfenden Bibliothek.
[Titelbild: Dieter Schnack, Rainer Neutzling und der Revierflaneur (v. l.) am 22. Oktober 1993 in der Stadtbibliothek Essen.]
Posted in Memento, Würfelwürfe | Comments Off on Jugendfreundschaft
Sunday, 05. June 2011
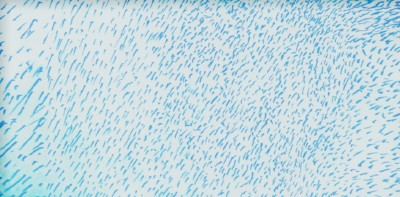
Fast in jedem 23sten meiner bisherigen Artikel dieses Weblogs kommt das Wetter vor. Und das sind bloß die Präsenzen expressis verbis. Wenn ich noch die Postings zählen wollte, bei denen meine Stimmung indirekt durch das Wetter eingetrübt wurde, dann käme ich vielleicht gar auf fünfzig Prozent!
Nicht, dass man mich falsch versteht: Ich bin keineswegs wetterfühlig. Zwar habe ich gelegentlich vor aufziehenden Gewittern gegen Migräneattacken zu kämpfen, aber die können ebensogut durch den Geruch von faulen Kartoffeln, Schlagermusik, Karnevalsjecken, erzwungenes Beisammensein mit langweiligen Menschen und noch tausenderlei andere Umstände mehr verursacht werden.
Was mich je nach Tagesform belustigt oder in Rage versetzt, das ist keineswegs das unschuldige Wetter selbst. Das arme Wetter kann ja schließlich nichts dafür, dass es so ist wie es gerade nun mal ist. Vielmehr ist ’s das öffentliche Gerede meiner Mitmenschen über das Wetter, dass mich zuverlässig jedesmal aus dem Gleichgewicht bringt, wenn ich zum unfreiwilligen Ohrenzeuge dieser Jammerarien werde. Insofern ahne ich schon, was in den kommenden Tagen auf mich zukommt.
Ende Mai waren die Warnungen der Meterologen nicht mehr zu überhören: Deutschland sei nach einem relativ harten Winter und einem außergewöhnlich trockenen Frühjahr einer echten Dürregefahr ausgesetzt, die nicht nur der Landwirtschaft schwerste Schäden zufügen, sondern sogar das Wasser zum Kühlen der Kernkraftwerke knapp werden lassen könnte.
Nun könnten wir seit ein paar Tagen eigentlich aufatmen, denn für die kommende Woche werden für weite Teile Deutschlands Gewitter mit ergiebigen Niederschlägen vorausgesagt, die hoffentlich für die ausgedörrten Böden mehr bringen werden als den sprichwörtlichen Tropfen auf den heißen Stein. Ich weiß aber jetzt schon, dass gleichzeitig mit den ersten Regentropfen, die vom Himmel fallen, das große Lamentieren unter den Schirmen wieder anheben wird, was das den für ein Sommer sei? Dieses Wetter könne einen ja geradezu schwermütig werden lassen. Jetzt sei es mal ein paar Tage sonnig gewesen – und nun das! Was sich der Petrus wohl dabei wieder gedacht habe? (Diese Ignoranz gilt mir als weitere Bestätigung für meine alte Überzeugung, dass die tagesaktuelle Informationsflut aus Medien wie Radio oder Fernsehen keineswegs geeignet ist, bei den Empfängern eine halbwegs vernünftige, reflektierte Einstellung zu den schlichtesten Zusammenhängen ihres alltäglichen Lebens zu fördern. Durch die tägliche Dauerflutung des Bewusstseins mit Fakten, Fakten, Fakten geht jedes Denken in Zusammmenhängen und über den Tag hinaus den Bach runter.)
[Regenzeichnung: Revierflaneur.]
Posted in Nonsens, Trivia, Würfelwürfe | Comments Off on Und heute: das Wetter!
Saturday, 04. June 2011

Das könnte tatsächlich die Rückseite des Tores aus dem vorigen Bild sein; die Innenseite des geheimnisvollen Gebäudes. Leider wird mir kein Blick hinein in den Raum oder eher Saal gewährt, sondern ein Blick in die Gegenrichtung, auf den Eingang, durch dessen glaslose Fensterschlitze das grelle Tageslicht hineindringt und mich beinahe blendet.
Ein großer schlanker junger Mann hat die Tür in der Mitte einen Spalt weit geöffnet. Noch hält er wohl die Klinke in der Hand. Er steht auf der Schwelle und späht hinein.
Auch hier sind wieder Fässer zu sehen, verschiedener Größe, nebeneinander und aufeinandergestapelt. Links lehnt ein großes Brett oder eine schmale Kiste an der Wand, wenn es dort eine Wand gibt. Woran lehnt das Ding aber sonst? Das bleibt ein Rätsel, aber ein vermutlich unbedeutendes, an dessen Auflösung niemandem gelegen sein kann. Auf einigen Fässern stehen Flaschen unterschiedlicher Größe und Form. Sie mögen leer sein oder verschiedene Flüssigkeiten enthalten, das geht uns nichts an. Immerhin mag das kleinste Fläschchen ein konzentriertes Gift enthalten. Na, und? Niemand zwingt den Mann, davon zu trinken. Dumm ist er nicht, er würde daran schnuppern, bevor er einen Schluck nähme. Dann käme ihm der stechende Geruch, den es doch wohl ausströmte, gewiss verdächtig vor, und er würde es beiseitestellen oder gar an die rückwärtige Wand schleudern, knapp über meinen Kopf hinweg, wo es zerschellte. Aber mich schert das Fläschchen erst recht nicht, ob es nun Gift enthält oder nicht, ob es an seinen Platz zurückgestellt wird oder in meine Richtung geschleudert. Ja, nicht einmal das kann mich erschrecken. Es ist ja nur ein Bild, oder?
Der Mann trägt einen dunklen Anzug. An seinem erschreckend schlanken Hals zeichnet sich ein feiner weißer Hemdkragen ab. Ich möchte sagen: ,Aber kommen Sie doch herein, Herr Baron! Nur keine Scheu! Treten Sie näher!‘ Ich höre geradezu meine leicht meckernde, leicht drohende Stimme.
Der Herr zögert. Er scheint etwas zu fürchten. Vielleicht ist es nur, dass er nicht sicher ist, ob er mit seinem Eindringen eine Indiskretion begehen würde. Vielleicht ist es seine Vornehmheit, die ihm eigentlich verbietet, fremde Räume uneingeladen zu betreten. Aber warum hat er dann die Tür überhaupt geöffnet? Vielleicht war es Neugier. Neugier gilt ja längst nicht immer als lauteres Motiv für eine Handlung. Wer ungebeten ein fremdes Geheimnis lüftet, muss damit rechnen, dass sich ihm etwas offenbart, wovon er lieber keine Kenntnis erhalten hätte. Leider können wir den Gesichtsausdruck des Mannes nicht entschlüsseln. Das Bild ist zu unscharf, zudem liegt sein Antlitz im Halbschatten.
Posted in Bilddeutungen, Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Bilddeutung (II)
Friday, 03. June 2011
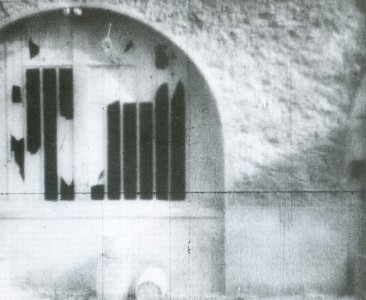
Vielleicht hat mich die Interpretation von Heinrichs Testament auf den Geschmack gebracht? Neuerdings kann ich jedenfalls oft der Versuchung nicht widerstehen, mir einen vielleicht spinnerten, vielleicht bezwingenden Reim auf Bilder zu machen, die mir hier und da zu Gesicht kommen. Es handelt sich dabei um ganz unterschiedliche Bilder, Fotos so gut wie Gemaltes, Kunstwerke neben Trivialem. Ich sage mittlerweile schon zu mir selbst: ,Das ist wieder eins!‘ (Nämlich ein Bild, das sich wünscht, von mir gedeutet zu werden.) Also fange ich heute einfach mal damit an.
Dieses Tor hat offenbar seine besten Zeiten schon gesehen. Die zum größeren Teil zerdepperten Scheiben lassen vermuten, dass der Raum dahinter nicht mehr zur Lagerung von Dingen genutzt wird, die keine Feuchtigkeit vertragen. Um welche Art Raum mag es sich handeln? Vielleicht um eine Scheune? Eine Lagerhalle? Vielleicht um einen Stall?
Am rechten Bildrand erkennt man gerade noch, dass es dort wohl ein genau gleich großes Tor gibt. Bilde ich es mir nur ein, dass wir uns hier einem landwirtschaftlich genutzten Gebäude gegenübersehen? Schließlich könnte es ja auch eine industrielle Lager- oder Produktionshalle sein. Oder doch immerhin um eine handwerkliche Arbeitsstätte, etwa eine Schmiede oder Küferei? Vor dem rechten Torflügel liegt immerhin etwas, das aussieht wie ein Fass. Was es enthält, kann ich nicht einmal erraten, denn ich weiß nicht, welche Art Fass das ist. Und links daneben scheint ein weiteres Fass zu stehen, auf dem ich noch ein weiteres Fässchen gewahre. Das könnte aber auch ein Eimer sein. Jedenfalls ist das Gemäuer alt. Heute würde man Eingangstore kaum mehr mit einem solchen Rundbogen bauen. Ich bin kein Fachmann für Architekturgeschichte, aber doch ziemlich sicher, dass dieses Bauwerk mindestens hundert Jahre alt ist.
Waagerecht läuft ein schwarzer Strich durchs Bild. Da er sich über das Mauerwerk ebenso erstreckt wie über das Holz des Tores, handelt es sich vermutlich um einen Strich auf dem Foto, nicht in der Wirklichkeit. Oder doch? Vielleicht ist ja dort in einigem Abstand zum Hintergrund ein schwarzes Seil gespannt. Aber warum? Außerdem gibt es zahlreiche, feinere vertikale Striche, in unregelmäßigen Abständen und von verschiedener Länge und Stärke. Es könnte sich also um ein Foto aus einem Film handeln. Das wäre doch was! Kintopp auf dem Bauernhof.
Den Anblick des Gemäuers mit dem ramponierte Zugang zu einem ungewissen Innenraum empfinde ich als unangenehm. Ich wüsste gern und doch wieder nicht, was sich hinter diesem Tor verbirgt. Ich weiß nicht, ob ich das Tor öffen würde, wenn es mir im wirklichen Leben und nicht bloß auf einem Bild begegnete. Vielleicht würde ich sogar der Versuchung widerstehen, wenigstens einmal einen kurzen Blick durch einen der zerborstenen Fensterschlitze zu werfen. Offenbar möchte ich mir nicht vorstellen, welcher Anblick sich mir hinter diesem Tor böte.
Posted in Bilddeutungen, Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Bilddeutung (I)
Thursday, 02. June 2011

Offenbar erschließt sich die Bedeutung der sieben Blätter XIV bis XX aus Heinrich Funkes Testament wenn überhaupt dann erst aus ihrem Zusammenhang. Schon die große gelbe Kugel in den letzten sechs dieser Bilder legt ja nahe, dass sie zusammengehören. Ich beschränke mich darum hier einmal auf Fragen, in der Hoffnung, dass sich die Antworten schließlich aus der Gesamtschau der Serie ergeben werden.
„Die Welt wird euch hassen“ – das lässt sich je nach Tonfall als nüchterne Ankündigung, prophetische Vorhersage oder flammende Warnung, ja gar als Drohung lesen. Wie ist es gemeint? Und wer ist der Verkünder dieser Information oder Botschaft? Und wer ist mit „die Wel“ gemeint? Vermutlich die Menschheit. Aber warum heißt es dann nicht: „Die Menschen“ oder „Alle anderen Menschen“ oder „Die Mehrheit der Menschen werden Euch hassen“?
Andererseits sind die Adressaten der Botschaft ebenso fragwürdig. Offenbar sind sie zugleich das Ziel dieses künftigen Hasses. Aber um welche Gruppe von Personen handelt es sich dabei? Und durch welche Eigenschaft oder Verhaltensweise ziehen sie sich den Hass zu, von dem hier gesprochen wird?
Schließlich stellt sich noch die Frage, wie sich dieser Hass äußern wird, welche Konsequenzen er für die Gehassten hat und wie sie sich zu ihm verhalten können, doch das führt vielleicht schon zu weit über dieses Bild und seine Aussage hinaus.
Eine letzte Frage muss aber noch hinzukommen – und sollte vielleicht prinzipiell bei allen Bildern des gesamten Werkes noch deutlicher in den Vordergrund gestellt werden: Was ist die Intention der Fragen, Aussagen, Behauptungen unter den Bildern?
Posted in Heinrichs Testament | Comments Off on Heinrich Funke: Das Testament (XVI)
Wednesday, 01. June 2011

Die schmalen Streifen Restnatur, die sich in der Großstadt gegen die Totalherrschaft menschlicher Artefakte so gerade noch behaupten können, verbergen mitunter unerwartete Geheimnisse, Rätsel und Gefahren.
So beobachtete ich heute einen dunklen Vogel mittlerer Größe, der mit einem Sträußlein dünner Zweige im Schnabel in einem Buschwerk verschwand, das über einen Zaun am Rande eines Fußwegs herabquillt. Diesen Ort suche ich nahezu täglich auf, wenn ich mit unserer Hündin Gassi gehe.
Leider bin ich ornithologisch zu wenig bewandert, um mit Gewissheit sagen zu können, um welche Art Vogel es sich handelte. Er hatte etwa die Größe einer Schwarzdrossel, allerdings keinen gelben Schnabel, auch war sein Gefieder nicht tiefschwarz, sondern eher dunkelgraubraun. Und zudem schien er mir etwas schlanker, als Drosseln gewöhnlich sind. Immerhin begriff ich auf den ersten Blick, dass dieser Vogel mit seinem Nestbau beschäftigt war. Und da er aus dem Gebüsch nicht wieder auftauchte, folgerte ich, dass das Nest sich offenbar dort verbarg.
Mein nächster Gedanke war, dass dem zu erwartenden Nachwuchs des Vogels vielleicht Gefahr drohen könnte, wenn sich der Zaunbesitzer einfallen ließe, demnächst besagtes Gebüsch zu stutzen. Sollte ich den Mann, den ich vom Sehen kenne und der mich entfernt an Pettersson erinnert, warnen? Dann fragte ich mich, wie lange eigentlich ein solcher Vogel für den Bau seines Nestes benötigt, wie lange er brütet und wie lange es schließlich dauert, bis die Brut ihr Nest verlässt? Insgesamt drei Wochen? Oder eher drei Monate? Ich stellte wieder einmal fest, dass ich in solchen Dingen nicht die Spur einer Ahnung habe. Warum auch? Für mich hing ja tatsächlich in meinem bisherigen Leben nichts davon ab. Jetzt aber stand im schlimmsten Fall das Leben einiger gerade erst geborener Vögel auf dem Spiel!
Also sah ich bei Wikipedia nach, mangels zuverlässiger Klassifizierung unter Schwarzdrossel. (Dass dieser Vogel mit der Amsel identisch ist, war mir auch noch nicht klar.) Was ich dort über Neststandort und Nestbau dieser Vögel erfuhr, fand ich ausgesprochen interessant, so die Vorliebe für runde Buchstaben und die Abneigung gegen die Farbe Rot. Jetzt weiß ich, dass das Weibchen zwei bis fünf Tage für den Nestbau benötigt, ein bis drei Tage vergehen bis zur Eiablage. Die einzelnen Eier, vier bis fünf an der Zahl, werden im Abstand von 24 Stunden gelegt. Die Brutdauer liegt zwischen 10 und 19 Tagen, im Mittel bei 13 Tagen. Die Nestlinge sind etwa 13 bis 15 Tage nach dem Schlüpfen in der Lage, das Nest zu verlassen. Angenommen, „mein“ Vogel hätte gerade heute erst mit dem Nestbau begonnen, dann müsste ich sicherheitshalber dafür Sorgen, dass diese hängende Hecke sieben Wochen lang nicht beschnitten wird, also frühestens am 20. Juli. Ich werde mit Pettersson reden müssen.
Posted in Alltäglichkeiten, Flanerie, Würfelwürfe | Comments Off on Nistgewohnheiten von Stadtvögeln
Tuesday, 31. May 2011
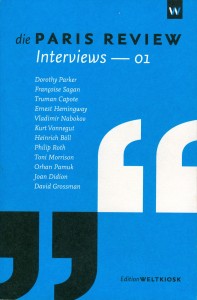
Die Interviews der New Yorker Literaturzeitschrift Paris Review können mit Fug und Recht als stilbildend für die ganze noch junge Gattung gelten. Dass man den Befragten nicht mit den üblichen Allerweltsfragen à la FAZ-Fragebogen abwärts kommen kann, mit denen die sonstige Prominenz aus Politik, Sport und Showbiz gelöchert wird, liegt auf der Hand. Schließlich sind Literaten Leute, die immerhin schreiben können. Hierunter verstehe ich selbstredend nicht jene Dauersekretion von Banalitäten als Tagesgeschäft, die schon immer 99,9 Prozent aller Papierwaren beschleimte. Schreiben im eigentlichen Sinn jedoch setzt Verstand voraus, Selbstbewusstsein, Weltkritik und ein gerüttelt Maß Verzweiflung. Menschen, die unter solchen schweren Handicaps leiden, darf man nicht mit Fragen nach ihrem Lieblingsbuch und ihrer schönsten Kindheitserinnerung in Lebensgefahr bringen. Das wissen die einfühlsamen Interviewer der Paris Review, und sie beherrschen ihr Mundwerk. In den vergangenen 57 Jahren seit Gründung der Vierteljahreszeitschrift sind dort fast 350 Interviews erschienen, von denen nun die Edition Weltkiosk im C. W. Leske Verlag ein Dutzend ausgewählt und in deutscher Übersetzung vorgelegt hat. (Ich muss das so unpersönlich formulieren, denn einen Herausgeber im eigentlichen Sinn scheint diese Sammlung nicht zu haben. Die Übersetzer heißen Henning Hoff, Judith und Alexandra Steffes; letztere hat auch ein knappes Vorwort geschrieben. Leider verrät sie dem Leser nicht, welche Kriterien gerade diese Auswahl bestimmten.)
Ohne Einschränkung darf ich zunächst den Vorsatz preisen, dem deutschen Leser diese Meisterwerke der Befragungskunst nahezubringen. Selbst von jenen Autorinnen und Autoren, die mir bisher fremd waren und auch durch ihre Antworten mein Interesse an ihrem Werk nicht so stark wecken konnten, dass ich in nächster Zeit eins ihrer Werke lesen müsste, habe ich nun doch immerhin eine recht deutliche Vorstellung. Köstlich amüsiert hat mich Dorothy Parker, zu deren Short Storys ich vor vielen Jahren trotz mehrfacher Versuche keinen rechten Zugang finden konnte, was möglicherweise damit zu erklären ist, dass ich seinerzeit eine Verehrerin ihrer Prosa kannte, die mir mit ihrem humorlosen Suffragetten-Appeal ganz schrecklich auf die Nerven ging. Von Françoise Sagan kannte ich außer den Titeln ihrer Bücher nur die Verfilmung ihres Debutromans Bonjour tristess, die ich mir in einer Periode heftigster Leidenschaft für Jean Seberg zugemutet habe und nahezu unerträglich fand. Als das Mädchen aus gutem Hause in meinem Geburtsjahr befragt wurde, zählte sie gerade einmal 21 Jahre und gab Antworten wie eine abgebrühte Existenzialistin. Insofern habe ich sie bisher wohl unterschätzt. Da ich nun weiß, dass sie keineswegs das naive Hühnchen war, für das ich sie hielt, weil ich sie vermutlich mit der Bardot und mit Mireille Mathieu in einen Topf warf, glaube ich stattdessen erkannt zu haben, dass sie ein viel zu früh gereiftes, altkluges Wesen war, größenwahnsinnig und ohne stabile Orientierung. Truman Capote erscheint mir im Interview ganz so, wie ich ihn bisher wahrgenommen habe. Er schwindelt auf eine Weise, dass er damit mehr über sich sagt, als wenn er streng bei der Wahrheit bliebe; und er übertreibt, doch wenn er es nicht täte, hätte man das Gefühl, er würde untertreiben. Eine wirkliche Überraschung in zweifacher Hinsicht bot mir das Interview mit Ernest Hemingway, das der Chefredakteur der Paris-Review, George Plimpton führte. Erstens sind die Auskünfte des bulligen Mannes über seine Schreibtechnik außergewöhnlich präzise, feinsinnig und gewissenhaft. Er erinnert mich darin an Joseph Roth, mit dem er eigentlich doch nur eines gemeinsam hatte: den exzessiven Alkoholismus. Und zweitens verzückt mich geradezu seine gnadenlose Aufrichtigkeit im Umgang mit schwachen Fragen. Ein Beispiel? Plimton fragt: „Was würden Sie als bestes intellektuelles Training für einen angehenden Schriftsteller ansehen?“ Und Hemingway antwortet: „Sagen wir, er sollte rausgehen und sich aufhängen, weil er feststellt, dass Schreiben, nun, unvorstellbar schwer ist. Dann sollte er ohne Gnade heruntergeschnitten werden und gezwungen, für sich alleine so gut zu schreiben, wie er es kann, bis zum Ende seines Lebens. Immerhin wird er mit der Geschichte des Erhängens anfangen können.“ (S. 65.) Während ich bei Hemingway ein negatives Vorurteil hatte, sah ich Vladimir Nabokovs Auskünften mit gelassener Vorfreude entgegen – und wurde bitter enttäuscht! Dabei hätte ich darauf gefasst sein können, denn in der Vorbemerkung erfahren wir, dass der große Meister sich die Fragen vorab nach Montreux schicken ließ und seine Antworten von A bis Zett vorformulierte, um sie dem Interviewer beim vereinbarten Gesprächstermin schwarz auf weiß auszuhändigen. Wie soll ich das denn finden? Welche kleinliche Angst steckt dahinter, auch nur ein falsches oder nur missverständliches Wort von sich zu geben? Dabei hätte Nabokov wie alle anderen Befragten auch ohnehin die Gelegenheit erhalten, seine Antworten vor der Drucklegung zu überarbeiten oder zu streichen. Ist es Zufall, dass diese Enttäuschung in eine Zeit fällt, da meine Begeisterung für das Werk Nabokovs sich spürbar abschwächt? Zu den drei nächsten Autoren – Kurt Vonnegut, Heinrich Böll und Philip Roth – kann ich summarisch bekennen, dass ich ihre Aufnahme in diese Sammlung bedaure, stehlen sie doch den Platz für solch ungleich interessantere Geister wie Julio Cortazar, Raymond Carver oder Primo Levi. Die letzten vier – Toni Morrison, Orhan Pamuk, Joan Didion und David Grossman – kannte ich bislang nur ganz oberflächlich. Jeden einzelnen von ihnen würde ich gern näher kennenlernen, wenn ich nicht zu viel Zeit mit meinem eigenen Schreiben verschwenden müsste. So reicht es nur für eine knappe Sympathiebekundung. Ich entdeckte bei ihnen einen Ernst, eine Weite und eine Leidenschaft, die sicher hervorragende Voraussetzungen sind, um große Werke zu schaffen. (Allerdings muss ich, was die Leidenschaft betrifft, bei Joan Didion gewisse Abstriche machen. Sie erschien mir – vielleicht insofern ein direktes Gegenstück zu Toni Morrisson – in vielen ihrer Antworten eher unterkühlt.)
Ich habe das 350 Seiten starke Buch auf einen Rutsch in drei Tagen gelesen, auf ,meiner‘ sonnigen Bank am Blücherturm und nachts in meinem blauen Ohrensessel vorm Zubettgehen. Es war eine streckenweise unterhaltsame und gelegentlich sogar lehrreiche Lektüre, besonders dann, wenn es um die ganz profanen technischen Fragen und Probleme des Schreibens ging. Mit großem Interesse habe ich auch die wenigen Passagen zur Kenntnis genommen, in denen einzelne Autoren auf ihr Verhältnis zu ihrem Lektor zu sprechen kommen – verständlich, da ich selbst in jüngster Zeit diese Tätigkeit als professionelle Nebenbeschäftigung betreibe. Toni Morrison schwärmt von ihrem Lektor Bob Gottlieb: „Was ihn so gut machte für mich waren mehrere Dinge – zu wissen, was man nicht anrührt; all die Fragen zu stellen, die man wahrscheinlich sich selbst gestellt hätte, hätte man die Zeit gehabt. Gute Lektoren sind wirklich das dritte Auge: sachlich, leidenschaftslos. Sie lieben nicht dich oder dein Werk; das ist für mich das Wertvolle – nicht Komplimente. Das ist für mich hilfreich. Manchmal ist es unheimlich. Der Lektor legt seinen Finger genau auf die Stelle, die schwach ist; der Autor weiß es, war aber zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage, sie besser hinzubekommen. Oder vielleicht dachte der Autor, es könnte funktionieren, war sich aber nicht sicher. Gute Lektoren identifizieren die Stelle und machen manchmal Vorschläge. Manche Vorschläge sind nicht hilfreich, da man einem Lektor nicht alles erklären kann, was man da zu tun versucht. Ich könnte unmöglich all diese Sachen einem Lektor erklären, da das, was ich mache, auf so vielen Ebenen zu funktionieren hat. Aber wenn in dieser Beziehung etwas Vertrauen steckt, etwas Wille zuzuhören, können außergewöhnliche Dinge passieren. Ich lese dauernd Bücher, von denen ich weiß, dass sie nicht von einem Korrekturleser profitiert hätten, sondern von jemandem, der das Buch schlicht durchgesprochen hätte.“ (S. 214.)
Da beneide ich Toni Morrison allerdings, denn ich lese vielmehr dauernd Texte aller Art, die zuallererst einmal eines gründlichen Korrekturlesers bedurft hätten. Und leider macht auch das hier zu würdigende Buch da keine Ausnahme, hätte es doch einen scharfsichtigen „letzten Leser“ vor der Drucklegung so sehr verdient! Immer wieder stolpert der Leser über kleine Fehlerchen, nicht weltbewegend, aber eben doch den Lesefluss störend, beispielsweise gehäuft fehlende Buchstaben am Ende eines Wortes. In einem Absatz stand gleich zweimal „and“ statt „und“. Das passiert einem Übersetzer aus dem Englischen eben; aber liest denn keiner noch mal drüber? Vermutlich gab es wie so oft ganz zum Ende des langen Produktionswegs zeitlichen Druck, der den letzten Schliff unmöglich machte. Das ist schade – und umso mehr, da ja heutzutage bei einer zweiten Auflage in aller Regel die Ausmerzung dieser Fehler nicht finanzierbar ist. (Auch ein Vorteil, nebenbei bemerkt, von Weblogs wie diesem. Ich korrigiere dauernd an meinen älteren Texten herum, bis sie endlich – hoffentlich! – perfekt sind.)
Eine letzte Bemerkung noch zum Verlag. Die Edition Weltkiosk im C. W. Leske Verlag mit Sitz in London ist ein Imprint des Düsseldorfer Lilienfeld-Verlags, dessen kleines und feines Programm ich seit seiner Gründung vor vier Jahren mit Wohlwollen und wachsender Neugier beobachtet und gelegentlich in meinen Blogs kommentiert habe. Zu dem neuen Engagement schreiben die Lilienfeld-Verleger Viola Eckelt und Axel von Ernst in ihrer Frühjahrsvorschau: „Durch die Übernahme des traditionsreichen C. W. Leske Verlages als Imprint werden wir im nächsten Jahr gleich 190 Jahre alt!“ Bald wollen die beiden unter diesem Namen ein Sachbuchprogramm starten. Nun ist das mit dem Reichtum der Traditionen ja manchmal eine vertrackte Sache. In diesem Fall ergibt die Recherche, dass der 1821 in Darmstadt gegründete C. W. Leske Verlag ursprünglich ein Sprachrohr des Vormärz war, im Laufe seiner langen Geschichte aber weit in die rechte, nationalistische Ecke hinüberwanderte. Bedeutende Sortimentsschwerpunkte waren über viele Jahre hinweg Kriegsgeschichte und Militärkunde. Was der Verlag in der Zeit des Nationalsozialismus getrieben hat, weiß ich nicht. Sehr interessant ist jedenfalls die rege Betriebsamkeit, die er in den 1950er-Jahren entfaltete, als er sich mit nationalkonservativen politischen Sachbüchern von Autoren wie Horst Mahnke aus der Deckung traute, jenes vormaligen SS-Hauptsturmführers, der es im Nachkriegsdeutschland der Adenauer-Ära bis zum Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger schaffte. Was wundert es, dass Mahnke sein gemeinsam mit dem ehemaligen SS-Hauptsturmführer Georg Wolff verfasstes Buch 1954 – Der Frieden hat eine Chance just bei C. W. Leske erscheinen ließ, war dessen Verlagsleiter seit 1953 doch kein geringerer als Franz-Alfred Six, SS-Brigadeführer und Amtsleiter im berüchtigten Reichssicherheitshauptamt von Reinhard Heydrich und Heinrich Himmler. (Letzterer kommt übrigens auch in Jonathan Littells Roman Les Bienveillantes vor, deutsch erschienen unter dem Titel Die Wohlgesinnten.) Dieser Clique gelang es in der Nachkriegszeit sogar, Augsteins Spiegel als Medium für antisemitische und den Faschismus exkulpierende Artikel zu nutzen, wie erst jüngst Peter-Ferdinand Koch in einer verdienstvollen Monographie noch einmal in allen für das Hamburger Magazin nicht eben schmeichelhaften Details nachgewiesen hat. Ich will damit nur sagen, dass die 190 Jahre adoptierte Verlagsgeschichte offenbar mehr hergeben als die nobel schimmernde Patina einer nicht weiter hinterfragten „Tradition“. Es stünde dem Lilienfeld-Verlag gut zu Gesicht, wenn er diesen Stier bei den Hörnern packte und einen investigativen Historiker beauftragte, die Geschichte des Darmstädter Verlags C. W. Leske einmal bis in die letzten finsteren Falten auszuleuchten. Vielleicht gelingt das ja bis zur 200-Jahr-Feier?
[die PARIS REVIEW Interviews – 01. A. d. Engl. v. Alexandra Steffes, Judith Steffes u. Henning Hoff. London / Berlin: Edition Weltkiosk im C. W. Leske Verlag, 2011. – ISBN 978-3-942377-01-0. – 19,90 €.]
Posted in Interviews, Questionnaire, Würfelwürfe | Comments Off on Paris-Review-Interviews
Monday, 30. May 2011

Und warum gerade heute? Warum stehen in Online-Tagebüchern (Weblogs) oben auf der ersten Seite die jüngsten, in Print-Tagebüchern dort hingegen die ältesten Einträge? Warum werden Einträge in Weblogs, die älter als eine Woche sind, so gut wie niemals mehr gelesen und dennoch für alle Zeiten aufbewahrt?
Warum gibt es eine Vergangenheit? Warum hat der Mensch ein Gedächtnis? Warum bewahrt man Dinge auf, die man nicht ständig im Gebrauch hat? Warum hängt man sich für viele Jahre Bilder an die Stubenwand, die man nach wenigen Tagen nicht mehr ansieht? Warum erzählt man neuen Freunden irgendwann einmal die Lebensgeschichte? Warum manchen alten Freunden nie? Warum kann man allerlei unangenehme Erinnerungen nicht einfach bzw. einfach nicht auslöschen?
Warum fragt er? Warum fragt sie nicht? Warum fragt er sich manchmal, warum er ihr diese oder jene Frage nicht gestellt hat? Warum meint sie mindestens einmal im Leben, dass sie ihm in einem bestimmten Augenblick bloß die eine entscheidende Frage hätte stellen müssen, und ihr restliches Leben wäre völlig anders verlaufen? Warum kommst du nicht darüber hinweg, dass du vor ewigen Zeiten auf eine einfache Frage keine Antwort von mir erhalten hast? Warum weiß ich jetzt die Antwort nicht mehr?
Warum setzen wir uns nicht einfach hin und schreiben unser ganzes bisheriges Leben auf, alles was wichtig war, wichtig schien oder wichtig hätte sein können? Warum lassen wir uns immer wieder von diesem Plan abbringen, sei es durch Zweifel an der Bedeutung unseres Lebens, sei es durch Skrupel gegenüber unseren Weggefährten, wenn sie sich in unserer Erinnerung nicht wiedererkennen oder gar wiedererkennen, sei ’s aus Angst, unser Leben als eine einzige Verfehlung zu enttarnen? Warum erkennen wir nicht, dass es keinen Sinn hat, auf ein zweites Leben zu warten, das die Beschreibung eher wert wäre?
Warum finde ich nicht die Quadratur des Kreises, eine neue Struktur im Rahmen des Weblogs, die es möglich macht, die Leserin zu verführen, mich gleichzeitig als den Gewordenen des heutigen Tages und den Werdenden der vergangenen fünf Jahrzehnte zu erleben?
Posted in Questionnaire, Würfelwürfe | 1 Comment »
Sunday, 29. May 2011

Als ich noch bei Westropolis bloggte, ließ ich mich vorübergehend von der unmittelbaren Resonanz auf meine Postings mitreißen. Ich schielte zu den Kollegen hinüber und freute mich, wenn ich mehr Kommentare einsammeln konnte als sie. Angeblich waren die Zugriffszahlen zu den einzelnen Beiträgen oder der Trafficanteil pro Autor nicht ermittelbar, weshalb man sich nur an der Zahl der Kommentare orientieren konnte, wenn man wissen wollte, wie man ankam. Ich ertappte mich dabei, meine Inhalte so zu modulieren und meine Thesen so zuzuspitzen, dass ich stärkere Resonanz erwarten durfte. Außerdem griff ich selbst gezielt in die Diskussion ein, indem ich auf einzelne Kommetare mit Zuspruch oder Widerspruch entgegnete. Das machte eine Weile sehr viel Spaß, schmeichelte meiner Eitelkeit und führte mich in Versuchung, nicht mehr um eine Sache, sondern nur noch um Aufmerksamkeit zu kämpfen. Der Spaß ließ nach, als sich einige Trolle und dumpfe Nervensägen auf mich fixierten. Zudem stellte ich fest, dass sich mein vermeintlich großes Publikum bei genauerer Betrachtung auf vielleicht zehn, zwölf Stammleser und -kommentierer reduzieren ließ, zuzüglich regelmäßig auf- und wieder abtauchender Eintagsfliegen. Diese Einsicht war anfangs schmerzvoll, erleichterte aber wenig später den Ausstieg aus diesem Kasperlthater mit Suchtgefahr.
Seither bin ich immun gegen die Versuchung, mein Selbstwertgefühl als Blogger aus den Zugriffzahlen oder der Resonanz in den Kommentaren herzuleiten. Ich habe meine festen Qualitätsstandards für meine Texte und Bilder. Ich strebe an, täglich einen meiner Fünfabsätzer zu veröffentlichen. Ich bemühe mich nach Kräften, den großen runden Rahmen des Gesamtvorhabens Kleine Schritte weg von der Mitte nicht aus den Augen zu verlieren, wenngleich das selbst regelmäßige Leser vorläufig kaum werden nachvollziehen können. Und ansonsten kümmere ich mich nicht darum, die Zahl meiner Leser, die Qualität meiner Leser oder die Beteiligung meiner Leser zu maximieren. Hätte ich statt 25 regelmäßigen Besuchern 2.500 Dauergäste zu verzeichnen, dann fiele es mir vermutlich leichter, bei Verlagen Rezensionsexemplare zu erbetteln. Das wäre aber auch der einzige Vorteil, den mir diese Popularität brächte. Die Vorstellung scheint mir wenig verlockend, dass auf jeden meiner Beiträge 25 Kommentare eingehen: ein Drittel unangebrachte Komplimente, ein Drittel unbegründete Widersprüche, ein Drittel vermeidbare Missverständnisse – und nur der verbleibende Rest von gerade mal einem Kommentar wäre eine sinnvolle Reaktion auf meinen Text. Und ich müsste mich tagtäglich mit dieser Dampfplauderei herumschlagen. Da ziehe ich die himmlische Ruhe unbedingt vor, die hier herrscht.
Peter Zschunke, Chef-Korrespondent für Online-Themen bei der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, hat „Expertentipps“ zu der offenbar meine Kollegen bedrängenden Frage gesammelt: Wie werden Sie zum Alpha-Blogger (vgl. SPON v. 28. Mai 2011). Blog-Experte Oliver Gassner aus Steißlingen nennt folgende Grundvoraussetzungen fürs Bloggen: „Man sollte zu seiner Meinung stehen, etwas zu sagen haben und der Ansicht sein, dass man die Kommentierung von Politik und Alltag, Kultur und Leben nicht zwingend den Medien überlassen muss.“ Das ist eine ziemlich genaue Beschreibung des deutschen Stammtisch-Polemikers, dem es zur Verbreitung seiner Ansichten über den Dunstkreis seiner Stammkneipe hinaus bloß an den nötigen technischen Kenntnissen gebricht. (Passenderweise liefert Zschunke in den Absätzen 4 bis 8 seines Artikels für diese Klientel einen Schnellkurs zum Einrichten eines Weblogs.) Schockwellenreiter Jörg Kantel bietet alternativ diese fünf Befähigungsnachweise des erfolgreichen Bloggers an: „Spaß am Schreiben, Spaß an der Recherche, eine Message, ein dickes Fell und einen unstillbaren Veröffentlichkeitsdrang.“ Besser könnte man mir nicht erklären, warum ich ein dermaßen erfolgloser Blogger bin. Das Schreiben bereitet mir unsägliche Mühen, von den Recherchen ganz zu schweigen; mit einer Message kann ich nicht dienen, allenfalls mit der eindringlichen Warnung vor frohen Botschaften aller Art; meine Dünnhäutigkeit habe ich bisher immer als besonderes Qualifikationsmerkmal für meine Tätigkeit angesehen; und einen Veröffentlichungsdrang um seiner selbst willen würde ich mir als schieren Exhibitionsimus ankreiden und als Motiv für diese Tätigkeit nicht durchgehen lassen.
Gehe ich der Reihe nach die Liste der 25 beliebtesten Blog-Themen durch – Internet, Musik, Politik, Blog, Web 2.0, News, Fotografie, Medien, Design, Technik, Webdesign, Sport, Leben, Gesellschaft, SEO, Marketing, Computer, WordPress, Lifestyle, Kultur, Apple, Kunst, Software, Berlin, iPhone – dann finde ich bestätigt, was ich ohnehin schon wusste: Ich bin ein extraordinary eccentric. Meine bevorzugten Themen wie Literatur, Philosophie, Alltag, Psychologie, Geschichte, Gesellschaft, Kritik, Selbstanalyse, Sprache oder Zufall kommen überhaupt nicht vor.
Was muss ich tun, um der wundervollen Einsamkeit auf meinem Robinsonblog ein Ende zu bereiten und endlich lukrativen Massentraffic zu generieren? Christiane Schulzki-Haddouti von KoopTech weiß Rat: „Das Blog sollte eine klare inhaltliche Ausrichtung haben und für die gedachte Zielgruppe relevante Themen zuverlässig aufgreifen.“ Meine Zielgruppe sind alle Menschen. Mein Thema ist die Zukunft der Menschheit. Ich zweifle allerdings mittlerweile daran, ob dieses Thema für meine stark an Lifestyle oder Suchmaschinenoptimierung interessierte Zielgruppe relevant ist. Zudem sei es gut, über Twitter oder Facebook immer wieder auf die eigenen Beiträge hinzuweisen und sich dort an Diskussionen zu beteiligen. Die berühmten „sozialen Netzwerke“ also, denen ich mich konsequent verweigere. Wenn ich schon „Netzwerk“ höre! Ich bin doch kein Fisch! Und ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt noch etwas anderes werden will, als ich nun mal bin – ein Alpha-Blogger jedenfalls nicht!
Posted in Oikos, Würfelwürfe | 4 Comments »
Saturday, 28. May 2011
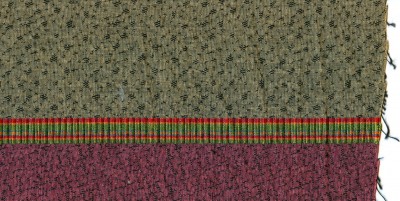
Welch große Bereicherung für mein Schreiben bedeutet es doch, dass hier in meinem Blog ohne mein Zutun immer ein tagesaktuelles Gesamtregister aller meiner Hinterlassenschaften erstellt wird! Ich gebe das Stichwort meines heutigen Beitrags ins Suchfester ein, und schon weiß ich, dass ich bisher an vier Stellen über Migräne geschrieben habe. Im Juni 2008 notierte ich, wie sehr mich die hässliche Tristesse der städtischen Umwelt doch bisweilen peinige, und dass mein armer Kopf dann gelegentlich keinen anderen Ausweg finde als die Flucht in einen Migräneanfall. Im Dezember 2008 bekannte ich mich zu den beiden körperlichen Beeinträchtigungen, die mich seit frühester Kindheit bis heute begleiten: ein zu Migräneattacken neigender Kopf und zwei deformierte Füße. Damals frohlockte ich, das erste dieser Leiden habe mir nach den maskulinen Wechseljahren offenbar endgültig Lebewohl gesagt. Zu früh gefreut! Mittlerweile habe ich eine neue Serie von Anfällen hinter mich gebracht. Im März 2010 nannte ich als einen von tausend Fällen, in denen mich meine Migräne daran hinderte, Pläne in die Tat umzusetzen, den verpassten Besuch einer Diskussionsveranstaltung mit Timm Ulrichs im Essener Folkwangmuseum. Und schließlich nannte ich den heftigsten Migräneschmerz, den ich je ertragen musste, neben einem Ohrenschmerz der Kindheit und dem Knochenschmerz nach der Operation meines rechten Fußes, in meiner Antwort auf eine der letzten Fragen von Max Frisch im Juli 2010 als Beispiel für einen Schmerz, den auszuhalten ich immerhin dem Tod vorgezogen hatte.
Welch große Bereicherung war doch für mich, und ist noch immer für mich die regelmäßige Erfahrung des Schmerzes, in seiner zivilisierten, domestizierten Form, als Migräne! Ja, ich weiß, das bedarf einer Erklärung.
Wer wünscht sich schon, von Schmerzen heimgesucht zu werden? Wann immer sich ein neuer Anfall bei mir angekündigt hat, im Übergang von einem zunächst noch kaum wahrgenommenen Kribbeln irgendwo zwischen Stirn und Hinterhaupt und der Gewissheit, dass ich nun wieder einmal das Steuer über mein Selbstempfinden werde abgeben müssen an eine fremde Macht namens Schmerz, stellte sich ein Gefühlschaos aus Wut, Enttäuschung, Hilflosigkeit und Angst bei mir ein. Einerseits weiß ich zwar, was kommt; andererseits ist das Ereignis durch diese Vertrautheit kein wenig erträglicher. Wenn ich das Glück habe, mich jeglicher Verantwortung gegenüber der Außenwelt für die Dauer des Anfalls entziehen zu können, konkret: wenn ich mich in ein stilles, kühles, abgedunkeltes Zimmer zurückziehen kann und Störungen jeder Art nicht einmal mit geringer Wahrscheinlichkeit befürchten muss, dann kann ich mich immerhin dem Schmerz stellen, ihm meine ganze Aufmerksamkeit schenken, ihn in Schach halten. Das mildert ihn zwar nicht, aber ich wahre ihm gegenüber immerhin noch einen Rest von Würde. Wenn ich aber, um das andere Extrem auszumalen, mit einer verantwortungsvollen Verpflichtung mitten unter Menschen geworfen bin, mir nichts anmerken lassen darf, kein Ende dieser Höllenveranstaltung abzusehen ist, dazu noch ein Gewitter in der Luft liegt, schwüle Luft und schlechte Gerüche, schrille Klänge und primitives Gelächter, wenn von verachtenswerten Individuen dumme Fragen an mich gerichtet werden – dann erzeugt das ohnehin schon unerträgliche Ereignis in meinem migränekranken Kopf ein Schmerzinferno, das mit Worten nicht zu beschreiben ist.
Und genau diese Unbeschreiblichkeit ist die Erfahrung, die mein Inderweltsein um eine unentbehrliche Dimension erweitert hat. Erst durch sie erkannte ich, dass das Beschreibenkönnen mein Dispositiv für alle Fälle ist. Und wo dieses Können seine Grenze findet, bin ich ein anderer, das Nicht-Ich, zum Tier entmachtet.
Gehupft wie gesprungen sind diese Zustände zueinander. Das man diesen schmerzvolle Krankheit nennt und jenen gesundes Wohlbefinden, ist eine verständliche Wertung. Wer hat schon gern Schmerzen. Und doch gibt es eine absolute Gleichwertigkeit zwischen Migräne und Migränefreiheit, was den Blick von hier nach dort und den von dort nach hier betrifft. Wenn ich Migräne habe, kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie es ohne diesen Schmerz ist, denn ich bin überzeugt, dass die Vorstellung von der Schmerzfreiheit diese sogleich herbeiführen müsste, was meiner Imagination hingegen niemals gelingt. Aber warum nicht? Schließlich spielt sich doch beides, der Schmerz und die Vorstellung von Schmerzfreiheit, am gleichen Ort ab: in meinem Kopf. – Und wenn ich frei von Migräneschmerzen bin, verstehe ich nicht, wie ich dort überhaupt jemals hineingeraten konnte. Und noch weniger verstehe ich, dass ich diesen Schmerz im Kopf nicht mit größerer Gelassenheit ertragen kann, da ich doch tausende Male erlebt habe, dass der Schmerz von allein weicht, nachdem er mich kaum jemals länger als einen Tag behelligt hat. Für die Grenzen zwischen wachem Normalbewusstsein und Zuständen wie Traum, Wahn oder Rausch führte der amerikanische Psychologe Roland Fischer den Terminus state boundaries ein. Ich finde sein Schema eines halbkreisförmigen Wahrnehmungs-Halluzinations- bzw. Wahrnehmungs-Meditations-Kontinuums sehr plausibel. Allerdings störte mich immer schon, dass die doch so existenzielle menschliche Erfahrung von Schmerz in diesem Modell keinen Platz fand. (Vielleicht sollte Fischers Modell um eine dritte Dimension ergänzt, also zur Halbkugel erweitert werden?)
Posted in Memento, Würfelwürfe | Comments Off on Meine Migräne und ich
Friday, 27. May 2011

Heute war ’s endlich mal wieder so weit. Die neue Folge der Schwarzen Serie von Schröder erzählt lag vor der Tür. Wenn das passiert, lasse ich augenblicklich alles stehen und liegen, suche mir ein ruhiges Plätzchen und versinke für eine gute Stunde in den Untiefen dieser endlosen Erzählung von Neid und Stolz, Armen und Reichen, Politik und Business, Verrat und Liebesglück, Heimtücke und Heimathass, Dumpfbackigkeit und Grandezza, Geilheit und Spießertum, Neurosen und Almosen, Protzerei und Pfennigfuchserei, verkannten Genies und verbrannten Talenten, Drogensucht und Hodenkrebs – obwohl, ich weiß nicht, ob ein solches Unterkörperkarzinom überhaupt vorkommt. Mir ist aber so. Ein Sachregister gibt es ja bisher noch nicht, bloß eine Synopsis samt Personenregister der ersten 40 Hefte, erschienen vor nun auch schon wieder einem Dezennium als Treuegabe für unverdrossene Abonnenten wie mich zum Abschluss der Weißen Serie.
Jörg Schröder und Barbara Kalender sind als kreatives Paar, das kann man wohl sagen, eine seltene Ausnahmeerscheinung in der Literaturgeschichte. Es gibt ja durchaus etliche schreibende Paare, die sich gegenseitig angeregt haben mögen, oder durch Konkrrenz angespornt. Jane und Paul Bowles fallen mir ein, Elsa Triolet und Louis Aragon, Ernst Weiss und Rahel Sanzara, Emmy Hennings und Hugo Ball, aus neuerer Zeit Siri Hustvedt und Paul Auster. Aber in allen diesen Fällen bleibt das Schreiben dennoch ein monologisches Medium, führt jede Hälfte des Paares ihren eigenen Stift. Beim Tandem Schröder / Kalender ist das anders.
Ich hatte das Glück, vor vielen Jahren einmal Zeuge einer solchen Erzähl-Session zu werden. Damals setzten mir Jörg Schröder und Barbara Kalender in ihrem Haus in Herbstein-Schlechtenwege am Vogelsberg haarklein auseinander, wie es zu jener einstweiligen Verfügung des Verlags der Autoren als Sachwalter der Rechte am Werk von Rainer Werner Faßbinder gegen den März-Verlag gekommen war, weil Schröder sich erdreistete, bei einer Neuauflage des Romans von Gerhard Zwerenz, Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond, im Anhang erstmals das gleichnamige Drehbuch zu veröffentlichen, das der Autor gemeinsam mit Faßbinder geschrieben hatte. Jörg Schröder umging die EV, indem er kurzerhand einen April-April-Verlag gründete und das fertig gedruckte Buch dort mit neuem Impressum als „Einmalige Notausgabe“ erscheinen ließ. Ich hatte beide Kontrahenten, Schröder für März und Karlheinz Braun für den Verlag der Autoren, zu einer Podiumsdiskussion ins Essener Grillo-Theater eingeladen, dazu noch Gerhard Zwerenz als Moderator und zugleich Hauptbetroffenen – schließlich war es sein Buch, dem der Zugang zum Markt verwehrt worden war. Im letzten Augenblick sagte Braun ab. Ich war sehr enttäuscht – und erhielt zum Trost die Einladung nach Herbstein.
Ich weiß nicht, ob das Tape von dieser Session noch exisitiert. Bisher wurde der ziemlich interessante und in mehrfacher Hinsicht für die politische Kultur in den 1980er-Jahren aufschlussreiche Fall in Schröder erzählt noch nicht aufgearbeitet. Die Arbeitsweise, die ich bei dieser Gelegenheit kennenlernte, war aber mindestens schon eine reife Vorstufe jener dialogischen Technik, die Barbara Kalender und Jörg Schröder seither zur Vollendung gebracht haben. Auf dem niedrigen Couchtisch lagen ausgebreitet wie die Karten einer Patience Zettel mit stichwortgebenden Notizen. Sie gaben eine Grundstruktur des Erzählgangs vor, ließen aber dabei noch genug Spielraum für Abschweifungen, Umwege, spontane Kurswechsel. Ich durfte Fragen stellen, wenn ich etwas nicht verstand. Und Barbara Kalender korrigierte oder ergänzte laufend, wenn sie Ereignisse anders in Erinnerung hatte oder ihre Bedeutung anders interpretierte. (Was ich naturgemäß nicht mitbekommen habe, sondern nur aus den Erzählungen der beiden kenne, ist der Vorgang der Verschriftlichung, bei dem Barbara Kalender einen sehr entscheidenden Anteil hat.)
Wenn ich heute die aktuelle Folge genieße, die Funkloch heißt, auf dem Titelblatt Friedrich den Großen mit seinem Rappen zeigt und rechts oben auf den Textseiten wie immer mit einer Vignette geschmückt ist, diesmal ein explodierendes Bömbchen im Warndreieck – dann genieße ich jede witzige Wortwahl und stelle mir dabei vor, wie das Paar den Text Satz für Satz durchgesprochen hat, immer unzufrieden, wenn er zu eingängig durch die Köpfe flutscht, nach überraschenden, hintersinnigen, doppeldeutigen Alternativen sucht und sie auch immer wieder findet. Was dabei herauskommt ist ein großes Werk der Inspiration, aber sicher ebensosehr hartnäckige Fleißarbeit. Ich lese mit Spannung, neugierig nicht nur auf die Auflösung von Preußenkönig und Funkloch, sondern auf jeden neuen Abschweif und darauf, wie sie schließlich diesmal die Kurve wieder kriegen. Manchmal stelle ich mir vor: Bekäme ich die tödliche ärztliche Prognose, noch ein halbes Jahr und dann ist Schluss, ich würde wohl das ganze Mammutwerk der (bislang) 56 Hefte noch einmal von Anfang bis Ende lesen. Aber da fällt mir gerade ein: Selbst diese Idee taucht ja irgendwo in Schröder erzählt schon auf. Ein reicher Abonnent gönnt sich auf seinem Sterbelager diesen Genuss, wenn ich mich richtig erinnere. Egal! Ich sterbe vermutlich ohnehin von jetzt auf gleich.
Posted in Eccentrics, Würfelwürfe | Comments Off on Schröder erzählt: Funkloch
Thursday, 26. May 2011

Nachdem diese Serie vorübergehend in eine Krise geraten war, setze ich sie heute mit frischem Elan fort.
Der Künstler bedauerte gelegentlich, dass ich im Verhältnis wenig zu seinen Bildern zu sagen habe und mich stattdessen hauptsächlich mit den darunter stehenden Sentenzen, Sprüchen, Zitaten, Denkwürdigkeiten befasse. Als Vielleser und Manchesschreiber fühle ich mich tatsächlich mit Buchstaben ohne Bilder wohler als mit bebilderten Buchstaben. Und wenn ich doch einmal Bilderlesebüchern begegne, dann prüfe ich eher die Bilder auf Stimmigkeit zu den Worten und Sätzen, als dass ich die Wörter und Sätze als unpassende Bildunterschriften empfände. (Vielleicht ist es manchmal auch anders, speziell bei Fotografien in Zeitungen; aber um solche geht es hier ja nicht.)
Bei vielen von Heinrich Funkes Bildern stutze ich und frage mich: Was hat nun dieser Satz unter jenem Bild verloren? Wo besteht da ein Zusammenhang? Im heutigen Beispiel fällt es relativ leicht, eine Erklärung zu finden, wenn man die große Kugel, die der maskierte Mensch vor seinen dicken Bauch hält, als Goldklumpen deutet, und ebenso die weiteren drei Klumpen, die vor ihm liegen, am unteren Bildrand, als massive und schwere Batzen aus diesem Edelmetall identifiziert. Aber schon bin ich wieder vom Text ausgegangen. Es ist ja mehr als fraglich, ob ich zu dieser Interpretation gelangt wäre, wenn das Bild keine Unterschrift trüge. Schließlich könnten das ja auch gelbe Kürbisse sein. Oder gelbe Medizinbälle. Notfalls auch gelbe Luftballons, obwohl die üblicherweise etwas kleiner sind. Aber hier kann man einer Täuschung aufgesessen sein, wenn sich nämlich hinter der Maske der Person ein kleines Kind verbirgt. Die schwarzgrünen pflanzenfaserartigen Gebilde im Hintergrund helfen auch nicht weiter, auf dem Weg zu einer abschließenden Deutung der Bildinhalte. Die Person ist dick. Wieder bin ich versucht, eingedenk des Untertitels, diese Beleibtheit als Folge von Wohlgenährtheit zu erklären und diese wiederum mit Wohlhabenheit in Verbindung zu bringen. Dabei wissen wir, dass in unserer Wohlstandsgesellschaft Fettleibigkeit ja viel eher ein Ergebnis von billiger Fehlernährung und insofern in den ärmeren Gesellschaftsschichten weiter verbreitet ist, als bei den Reichen.
Bei genauerer Betrachtung der Person und einer kritischeren Bewertung ihrer Akzidenzien zweifle ich zudem: Ist die Person wirklich dick? Oder erwecken bloß die bauschigen Ärmel und der lockere Fall ihres violetten Gewandes im Verein mit der mondgesichtigen Maske diesen Eindruck? Ihre linke, vom Betrachter aus gesehen rechte Hand ist jedenfalls feingliedrig; und wenn die Finger der anderen Hand etwas plumper erschienen, dann liegt das an ihrer perspektivischen Verkürzung.
Wir haben es also mit einem Bild der Täuschung, Maskierung, Irreführung, Camouflage zu tun. Also müssen wir auch nicht unterstellen, dass der Satz „Wohlstand ist sinntötend“ allen Ernstes behaupten will, was er sagt. Es gibt nahezu keine generalisierenden Aussagen über individuelle Menschen. Dass bei manchen Menschen Wohlhabenheit, zumal anstrengunslos erworbene, zu Leere und Lebensunlust führen kann, ist eine triviale Vorstellung – die nach meinem Eindruck hauptsächlich dazu taugen soll, den anstrengend beschäftigten Armen Trost zu spenden. Insofern würde mich nicht wundern, wenn sich hinter der grimmigen Maske des Wohlhabenden ein lachendes Gesicht verbirgt, das frohe Antlitz eines Menschen, der sich seines Reichtums erfreuen kann, indem er ihn sinnvoll nutzt.
Posted in Heinrichs Testament | Comments Off on Heinrich Funke: Das Testament (XV)
Wednesday, 25. May 2011

Vorgestern saßen wir mal wieder mit meinem ältesten Freund und seiner jüngsten Freundin beisammen, nebenbei bemerkt in einem Restaurant, für das ich ganz gegen meine Gewohnheit einmal Reklame machen möchte, denn es hat mir dort – im Kulturforum Steele in der Dreiringstraße – nun schon zum wiederholten Male ganz außergewöhnlich gut geschmeckt. (Zander.)
Dass ich immer wieder gern hier einkehre, hat seinen Grund auch in der außergewöhnlichen Atmosphäre des alten Ratssaals im ehemaligen Bürgermeisterhaus, denn dort wird man tatsächlich nicht mit Hintergrundmusik dauerbeschallt. Wo gibt es das noch? Dann stehen die hohen Wände kreativen Menschen zur Präsentation ihrer Bilder zur Verfügung, nicht unbedingt etablierte Künstler sind das, aber es berührt meist doch durch eine stille Leidenschaftlichkeit, was man dort zu sehen bekommt, und rührt gar manchmal durch einen verzweifelten Ehrgeiz. Und schließlich ist die Bedienung bezaubernd.
Dieses Raumklima fördert meine Lust am Gespräch zuverlässig ungemein. Und selbst das Zuhören, nicht unbedingt mein größtes Talent, fällt mir hier leichter als anderswo. Es ergab sich, dass ich nun schon zum wiederholten Male den Eindruck gewann, hier dem einzigen regelmäßigen Leser meines Blogs gegenüberzusitzen. Mein Freund, der nicht nur mein ältester, sondern auch mein bester ist, wie mir wieder einmal recht deutlich wurde, tippt bei solchen Gelegenheiten dies und jenes zart an, was ich in jeweils jüngster Zeit hier von mir gegeben habe. Dann zucke ich zusammen, denn ich weiß, wie mich selbst die blassesten Andeutungen einer Kritik aus der Fassung bringen und oft tagelang beschäftigen können. Blitzschnell überwinde ich meine Neugier und lenke dann ab, suche mit einem Überraschungscoup, einer kecken Frage oder einem provozierenden Witz das Thema zu wechseln. Diesmal jedoch kam ich zu spät – und schon war es passiert.
Das seien ja schon merkwürdige Typen, die ich da immer wieder kennen lernen würde. (Gemeint war damit offenbar Noxo.) Aber das mit den Fotos, mit der Anarchie, das habe er nicht verstanden.
Ich murmelte mir verschämt etwas in den Bart, er möge jetzt aber doch bitte nicht darauf bestehen, dass ich meine eigenen Texte, gar meine Ohne-Worte-Beiträge interpretiere. Aber das Kind war in den Brunnen gefallen und strampelt dort noch immer im faulen Schlick. Soll ich bekennen, dass es mir tatsächlich nicht bei allen Postings darum zu tun ist, verstanden zu werden? Noch schlimmer, dass ich manche meiner hier abgelegten Lebens- und Sterbensäußerungen selbst nicht begreife? Nein, das darf man nicht von mir verlangen. Und mein Freund am allerwenigsten. Das Foto oben zeigt ihn, wie er vor knapp 40 Jahren eine Reihe Zuckerwürfel im Abstand von exakt 10 Zentimetern quer über den Süthers Garten in Essen-Rüttenscheid legt. Sein Gesicht verbarg er dabei hinter einer Gasmaske. Für dieses Happening, das wir Suro Art Aktion No. 2 nannten, gab es auch keine vernünftige Erklärung. Es stimmte aber, in einem außerrationalen Sinn. Diesem Sinn bin ich treu geblieben. Und jetzt pssst!
Posted in Unica, Würfelwürfe | Comments Off on Suro Art 1972
Tuesday, 24. May 2011

Wieder mal ein wertvoller Hinweis von Nerdcore. Es fehlt nicht mehr viel und ich setze den Link auf meine Blogroll. (Aber zuerst muss ich mal den Link auf Glumm begründen.)
Im Chicago Cultural Center wird zurzeit eine extraordinäre Sammlung von handgemalten Filmplakaten aus Ghana gezeigt – im doppelten Sinn, denn nicht nur die Zahl der Exponate, sondern auch ihre Motivik sprengt alle Grenzen des Gewöhnlichen.
Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, angesichts der Überwältigung der althergebrachten Vorstellungswelten des Landes durch fremde Phantasmen aus aller Herren Ländern – und zugleich des trotzigen Festhaltens an offenbar sehr resistenten Lieblingsbildern aus eigenem Bestand, wie den aus menschlichen Körpern sich windenden, mit ihnen verbundenen oder in sie eindringenden Schlangen.
Mich persönlich irritieren besonders die fernöstlichen Ninjaposter in der Brechung afrikanischer Optik, wenn eine Exotik noch durch eine weitere potenziert wird und seltsamerweise hierdurch nicht weiter steigerbar ist, sondern eher neutalisiert wird.
Der Gesamteindruck überrascht hingegen nicht. Es war zu erwarten, dass in diesem Erdteil die „niederen Instinkte“ auch nicht nach anderen Genüssen und wohligen Schrecknissen auf der Leinwand lechzen als in Europa oder Nordamerika. Das kann nur jemanden enttäuschen, der hier eine überzivilisierte Dekadenz als Grund des vermeintlichen Übels annahm und den „unschuldigen Wilden“ idealisierte, der von sich aus auf solch „perverse Bilder“ gar nicht verfiele. Insofern wirkt der Anblick der Horrorplakate auf mich sehr beruhigend, geradezu versöhnlich. Liebliches Afrika!
Posted in Ghana, Oikos, Würfelwürfe | Comments Off on Ghanas geheime Abenteuer
Monday, 23. May 2011

Ich führerscheinloser Fußkranker bin infolgedessen gewohnheitsmäßiger Vielnutzer von öffentlichen Omnibussen und Straßenbahnen. Wie jede andere Fortbewegungsweise, und wie vielleicht überhaupt alle Handlungsoptionen im Leben hat auch diese ihre Vorzüge und Nachteile. Heute widerfuhr mir ein Ereignis, das mich noch nach Stunden schwanken lässt, ob ich es als Ärgernis oder Glücksmoment werten soll.
Als gebürtigen Rüttenscheider mit Wohnsitz in Rellinghausen zieht es mich zum Einkaufen alle paar Tage an meinen Herkunftsort, den ich wahlweise „untenrum“ mit der Straßenbahnlinie 105 über den Moltkeplatz oder „obenrum“ mit der Buslinie 142 über die Martinstraße erreichen kann. Letztere Variante bevorzuge ich, weil sie zeitsparender ist und durchs Grüne führt. Zudem fährt der Bus fast vor unserer Haustür ab, während ich zur Tramhaltestelle fünf Minuten laufen muss. Heute hatte ich meine paar Einkäufe auf der Rü schnell erledigt und stand frühzeitig an der Bushaltestelle Martinstraße, von der außer dem 142er auch der 160er in Richtung Stoppenberg abfährt. Hier wurde vor einem knappen Jahr versuchsweise eine digitale Anzeigetafel montiert, auf der die aktuellen Abfahrtzeiten der jeweils nächsten Busse abzulesen sind. Diese Zeiten kann der Fahrgast zwar auch den an allen Haltestellen aushängenden Plänen entnehmen, aber vermutlich soll diese elektronische Anzeige es ermöglichen, auch über gelegentliche Verspätungen zu informieren. Heute wurde ich nun Zeuge, wie zwei Elektriker unter der Anzeigetafel eine Leiter aufklappten, hinaufstiegen, einen Kasten öffneten und sich an den labyrinthischen Verdrahtungen mit Schraubendrehern zu schaffen machten. Ihren großen Werkstattwagen hatten sie auf der Bushaltespur geparkt, sodass diese nicht mehr in voller länge frei war. Nun näherte sich „mein“ 142er und hielt in einigem Abstand hinter dem Werkstattwagen, was mir sofort plausibel war, denn um an der Kreuzing plangemäß rechts abbiegen zu können, musste der 142er sich noch einigen Spielraum zum Manövrieren lassen. Ich stieg ein und setzte mich gleich auf den ersten Platz rechts neben dem Fahrer, da der von mir sonst bevorzugte Platz links, direkt hinter dem Fahrer, von einer Dame mittleren Alters besetzt war. Nachdem offenbar alle wartenden Fahrgäste eingestiegen waren, lenkte der Fahrer sein Gefährt an dem parkenden Werkstattwagen links vorbei auf die rechte der beiden „normalen“ Fahrspuren. Die Ampel stand noch auf Rot, musste aber gleich auf Grün schalten. – Nun ereignete sich etwas Ungewöhnliches.
Von hinten aus dem Bus machte sich lautstark ein junger Mann bemerkbar, der den Busfahrer aufforderte, gefälligst noch zu warten. Hinter uns nähere sich der 160er, vielleicht wollten ja Fahrgäste aus diesem Bus in „unseren“ 142er umsteigen? Und außerdem sei der Fahrer sowieso wieder mal anderthalb Minuten zu früh abgefahren. – Ganz abgesehen davon, dass es jetzt definitiv zu spät war, um die Forderungen des Mannes im Hintergrund zu erfüllen, selbst wenn sie berechtigt gewesen wären, machte nun der Busfahrer seinerseits mit vollem Recht darauf aufmerksam, dass es wegen des außerplanmäßig parkenden Werkstattwagens für den 160er gar nicht möglich gewesen wäre, in die Bushaltespur einzufahren, solange sie noch von unserem 142er besetzt war. Und übrigens sei er auch nicht 90 Sekunden zu früh, sondern bloß 30 Sekunden zu früh abgefahren. Der Fahrgast möge sich also mäßigen und im übrigen das Busfahren ihm, dem Busfahrer überlassen. Seine Argumente trug der Fahrer in wohltuendem Unterschied zu dem Beschwerdeführer sehr sachlich vor. Dieser musste nun allerdings erst recht auf seinem Standpunkt beharren und stimmte ein langes Lamento darüber an, wie ärgerlich es doch immer wieder sei, dass Busse und Bahnen sich nicht an die Fahrpläne hielten, die Fahrer offenbar gar nicht schnell genug nach Hause kommen könnten, es insofern ja kein Wunder wäre, dass die öffentlichen Verkehrsmittel einen so schlechten Ruf hätten – und überhaupt gehe die Uhr des Fahrers wohl eine Minute vor! Dem Gemurmel, das sich seitens einiger älterer Leute rings um diesen Querulanten erhob, war eine verhaltene Zustimmung zu entnehmen, aber von der feigen Sorte, die sich nicht wirklich Farbe zu bekennen traut, sondern ganz schnell wieder verstummt, wenn eine gegenteilige Meinung sich noch lauter und respektgebietender vernehmen lässt. Der Fahrer hatte übrigens offenbar beschlossen, dem Krakeeler kein Paroli mehr zu bieten und sich auf den Verkehr zu konzentrieren, was von großer Besonnenheit zeugte und mich vollends auf seine Seite brachte. – Da geschah die zweite Überraschung!
Völlig unvermittelt, aus dem sprichwörtlichen heiteren Himmel erhob die Dame mittleren Alters links neben mir ihre Stimme und trug nun mit flammender Leidenschaft ihr Anliegen und ihre Sicht der Dinge vor: „Jetzt reicht es! Bevor sie hier den Fahrer weiter belästigen, sollten Sie sich vielleicht zunächst einmal die Beförderungsbedingungen durchlesen. Dort heißt es nämlich, dass Fahrgäste zwei Minuten vor dem fahrplanmäßigen Abfahrttermin an den Haltestellen eintreffen sollen, da es nicht in allen Verkehrssituationen gewährleistet werden kann, dass die Fahrzeuge bis zur letzten Sekunde mit der Abfahrt warten. Ich bin selbst seit 18 Jahren mit einem Busfahrer verheiratet, der nach mancher Schicht nach Hause kommt und mit den Nerven völlig am Ende ist, wegen solch unverschämter Fahrgäste wie Sie einer sind! Ich bin mir sicher, dass ein einziger Tag hinter dem Steuer eines Busses oder einer Straßenbahn ausreichen würde, um Sie nie wieder auf den Gedanken kommen zu lassen, solch ein unbegründetes Urteil über die Tauglichkeit und Redlichkeit dieser Fahrer zu fällen, wie Sie es hier getan haben.“ Punktum.
Der Querulant murmelte noch bis zur nächsten Haltestelle vor sich hin, es sei ja klar, dass die Frau von solch einem Fahrer keine objektive Meinung haben könne, befangen wie sie sei. Er bleibe bei seinem Standpunkt. Dann stieg er aus. Die opportunistischen Claqueure aber hatten sich schon vorher geräuschlos in Luft aufgelöst.
Posted in Alltäglichkeiten, Flanerie, Würfelwürfe | Comments Off on Außerfahrplanmäßig
Sunday, 22. May 2011

Das Programm von Family Radio war am Tag Null der abgelaufenen Menschheitsgeschichte kopflos. Die sonore Stimme seines 89-jährigen Gründers, des evangelikalen Propheten Harold Camping, war verstummt. Vom Band lief stattdessen Kirchenmusik, unterbrochen von allerlei Lebensweisheiten und frommen Sprüchen. Die Uhr tickte und das Ende kam näher und näher.
Beginnen sollte es nach der festen Überzeugung von Camping in Asien, wo die Sonne ja wesentlich früher auf- und wieder untergeht als in der Neuen Welt. Als nun aber in Tokio und Peking der 21. Mai 2011 sich dem Ende näherte, ohne dass auch nur die geringste seismische Erschütterung spürbar gewesen wäre, schließlich Mitternacht vorbei war und ein ruhiger 22. Mai 2011 anbrach, da musste wohl der mindestens einige zehntausend Menschen zählenden Anhängerschaft des Apokalyptikers dämmern, dass sie einem Irrtum aufgesessen war. Was mag zum Beispiel Robert Fitzpatrick (60) gedacht haben, der mehr als 140.000 US$ gespendet hatte, damit auf Plakaten in der U-Bahn und an Bushaltestellen vor dem Weltuntergang gewarnt werden konnte?
Gabrielle Saveri von der Agentur Reuters berichtete, dass niemand an die Tür kam, als ein Reporter Campings Haus in Alameda (Kalifornien) aufsuchte, um ihn zu den Ereignissen zu befragen, oder richtiger: zum Ausbleiben der Ereignisse. Sheila Dorn (65), die seit vierzig Jahren im Nachbarhaus der Campings wohnt und nichts Schlechtes über das alte Ehepaar sagen kann, macht sich etwas Sorgen wegen der großen Aufmerksamkeit, die diese Prophezeihung in den vergangenen Wochen im ganzen Land gefunden hat. In dieser verrückten Welt könne man ja nie wissen, zu welchen Dummheiten sich jemand hinreißen lasse, der vielleicht zu sehr auf die Vorhersage vertraut habe und sich nun schadlos halten wolle bei dem falschen Propheten.
Großen Spaß hatten offenbar atheistische Gruppen, die bei Zusammenkünften im ganzen Land das Ausbleiben des Weltuntergangs feierten, so etwa bei einer Versammlung der Freimaurer-Loge von Oakland, wobei die Redner es sich nicht verkneifen konnten, scherzhaft Bezug auf den Judgement Day zu nehmen.
Stuart Bechman von den American Atheists erinnerte aber auch daran, dass es bei dergleichen obskuranten Verkündigungen doch auch einen sehr ernsten Aspekt gebe, den man nicht aus dem Blick verlieren sollte. Eine Vielzahl törichter und unbegründeter Überzeugungen würden von Leuten wie Camping in Umlauf gebracht, die bei leichtgläubigen Menschen durchaus auch großen Schaden anrichten könnten.
Posted in Godzilla, Würfelwürfe | Comments Off on Das Jüngste Gericht, gestern
Sunday, 22. May 2011

(Wegen Weltuntergang am 21. Mai 2011 geschlossen.)
Posted in Godzilla, Würfelwürfe | Comments Off on Apocalypse Now
Friday, 20. May 2011

Wenn es nach Harold Camping geht, dem Chef des amerikanischen Radioprogramms Familiy Radio, dann ist dies hier leider schon mein letzter Blog-Beitrag, wenigstens in dieser Welt. Der 89-jährige US-Amerikaner hat nämlich den morgigen Samstag zum Judgement Day ausgerufen, also zum Tag des Jüngsten Gerichts. Seine evangelikale Anhängerschaft zieht seit Wochen mit Transparenten durch die Straßen des Landes und ruft zur inneren Einkehr auf, wo nötig auch zur Umkehr. Denn das Ende sei nah.
Camping hat nicht etwa zu tief ins Glas geschaut, sondern vielmehr ganz tief in The Holy Bible. Und dort hat er allerlei äußerst bemerkenswerte Zusammenhänge entdeckt, Zahlen mit magischer Bedeutung, den Schlüssel zu einer bezwingenden Verheißung eben. Heraus kam nach solchen ausgefuchsten numerologischen Kalkulationen just das morgige Datum, May 21, 2011. Also wieder einmal ein Weltuntergang, na schön. Ich bin drauf gefasst.
Merkwürdig finde ich aber doch, dass diese apokalyptischen Prophezeiungen immer unter dem vollmundigen Namen Welt-Untergang laufen. Als ginge mit der Menschheit gleich die Welt unter. Welche Anmaßung! Was nach einer kurzen Regentschaft von vielleicht gerade einmal 10.000 Jahren den Bach runter ginge, wäre doch gerade mal eine durchgeknallte und aus dem Ruder gelaufene Affenart, die sich für den Rest der Schöpfung hauptsächlich als epidemisch sich ausbreitender Schädling bemerkbar machte.
Und zweitens ist sonderbar, dass diese Vorhersagen einer neuen Sintflut sich immer und immer wieder auf einen einzigen Tag kaprizieren. Der Horizont dieser selbsternannten Hiobs und Kassandras ist offenbar nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit ausgesprochen beschränkt. Sie nehmen nicht wahr, dass der Untergang nicht der Welt, aber doch der Menschheit seit vielen Jahren längst, und zwar ununterbrochen stattfindet.
Harold Camping beglaubigt seinen festen Glauben an die Richtigkeit seiner Berechnungen damit, dass er für die Zeit nach morgen keine Termine mehr gemacht hat. Ach, der alte Herr aus Colorado tut mir richtig leid. Wie wird er sich fühlen, wenn ihm der liebe Gott den Gefallen nicht tut und der Welt noch einen kleinen Aufschub gewährt? Aber vermutlich gibt es dann für ihn doch noch einen spekulativen Ausweg: Er muss sich irgendwo verrechnet haben!
Posted in Godzilla, Würfelwürfe | Comments Off on Das Jüngste Gericht, morgen
Wednesday, 18. May 2011

(Ohne Worte.)
Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Chaos chétif
Tuesday, 17. May 2011

(Ohne Worte.)
Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Anarchie désolé
Monday, 16. May 2011

Ich lernte ihn neulich als Zuschauer bei einem Squash-Turnier in D. kennen. Noxo verkaufte vor der Halle selbstbespielte Musik-Cassetten. Ich hätte gar nicht gewusst, dass es für diese archaische Tonaufzeichnungs- und -wiedergabetechnik heute noch Trägermedien und Apparate im Handel gibt. (Vielleicht hat Noxo Restbestände aufgekauft. Ich muss ihn bei Gelegenheit mal fragen.) „Was ist denn da drauf?“ Ich war neugierig geworden, als ich entdeckte, dass jeder einzelnen Cassette liebevoll selbstgebastelte Booklets beigegeben waren, akribisch vollgetextet mit einer gestochen scharfen, winzig kleinen Handschrift. Und offensichtlich war jedes Stück ein Original! „Was da drauf ist? Och, ganz verschieden.“ So seine vage Antwort. „Musik, jede Menge Geräusche von drinnen und draußen, Hauptsache aber meine Gedanken. Also gesprochen natürlich, von mir persönlich.“ Er hatte tatsächlich eine bemerkenswerte Stimme. Wenn ich mal einen guten Tag habe, werde ich versuchen, sie zu beschreiben. Ich griff blindlings in den Koffer und zückte mein Portemonnaie. „Macht siebenfünfzig.“ Ich gab ihm zehn Euro und winkte ab. Eigentlich will ich mir meinen Hang zu solchen Spendabilitäten ja abgewöhnen, aber in diesem Fall konnte ich nicht widerstehen, so meine Begeisterung über den exzentrischen Einfall einer Ein-Mann-Tonproduktions-Fabrik zum Ausdruck zu bringen. Meine Großzügigkeit sollte sich lohnen, denn statt des Wechselgelds steckte mir Noxo nun seine Visitenkarte zu. Darauf war er selbst mit einem monströsen Kopfhörer unter einem Schild mit der Aufschrift Empfang abgebildet, dazu sein Name, seine E-Mail-Adresse und Handynummer. „Wenn es dir gefallen hat und du mehr willst.“ Dass er mich geduzt hatte, fiel mir erst viel später auf.
Ich musste eine Weile suchen, bis ich ganz hinten in unserer Abstellkammer einen alten Ghettoblaster gefunden hatte, mit dem ich Noxos Cassette abspielen konnte. Sie trägt den Titel Das Kalifat des Hohen Tapezierers und ist mit silbernem Glimmer beklebt. Zunächst hört man Straßenlärm, undeutliche Stimmen schwellen an und wieder ab. Wohl vorbeieilende Passanten. Gelegentlich vernimmt man Satzfragmente, dazu Schritte auf Straßenpflaster, mal schneller, mal langsamer. Dann ändert sich plötzlich die Geräuschkulisse, es wird ruhiger. Jemand begrüßt offenbar Noxo, dessen unverwechselbare Stimme mit einem etwas bemühten Scherz antwortet. Dann folgt die Musikeinlage einer englischsprachigen Sängerin, die mir unbekannt ist. Im Refrain ihres Songs ist von einem blue-coloured poncho die Rede.
Und dann geht ’s los! Noxo sagt: „Herzlich willkommen bei Noxos Nachtwachen. Wir verabschieden den zehnten und begrüßen den elften Dezember 2009. Alle Schlüssel sind ausgegeben, die Gäste schlummern in ihren Bettchen. Was liegt an?“ Und dann plaudert Noxo munter drauflos. Ich frage mich, ob er sich vorher Notizen gemacht hat, denn er arbeitet eine ganze Reihe von Fragen ab, die ihm offenbar am Tag durch den Kopf gegangen sind. Manchmal nimmt er auf aktuelle Ereignisse Bezug. Oft erwähnt er einen seiner sehr zahlreichen Freunde und Bekannten. Einmal erinnert er sich an seine Kindheit. Und immer wieder spinnt er sich auch einfach was zusammen; dann hört es sich so an, als spräche er im Halbschlaf. Die einzelnen Episoden einer Nachtwache sind durch Musikstücke voneinander getrennt. Einen speziellen Geschmack scheint Noxo nicht zu haben. Seine Auswahl reicht von gregorianischen Chorgesängen bis zu Freejazz. Selbst ein Karnevalsschlager wird mir zugemutet. Einen direkten Zusammenhang zu Noxos benachbarten Monologen könnte ich nicht feststellen. Vielleicht habe ich aber hierfür bloß noch nicht den passenden Schlüssel gefunden.
Immerhin fand ich einige der Episoden doch so interessant, dass ich beschloss, mit Noxo in Kontakt zu treten, allein schon deshalb, um weitere Cassetten zu bestellen. Ich hatte aber außerdem den Plan ins Auge gefasst, Auszüge seiner nächtlichen Monologe in meinem Blog zu veröffentlichen, wozu ich natürlich sein Einverständnis einholen musste. Noxo fühlte sich sehr geschmeichelt. Leider käme zu spät, da bereits ein Freund, „so ein Computergenie“, einen eigenen Podcast für ihn vorbereite. Ich beeilte mich klarzustellen, dass ich ja gar nicht seine Original-Tondokumente ins Netzt stellen wollte, sondern nur die reinen Texte, vom Band abgeschrieben. „Ja klar, das kannst du natürlich gern machen! Meinst du denn, das liest einer? Schick mir mal den Link, Alter.“ Ob ich denn auch meine eigenen Gedanken dazu veröffentlichen dürfe? „Ja super! Dass du auch denken kannst, hätte ich nicht gedacht. Da bin ich aber mal gespannt!“
Ein paar Tage später lag ein Päckchen mit fünf Cassetten neueren Datums in meinem Briefkasten. Den größten Teil habe ich in den letzten Wochen angehört. Es gibt große Qualitätsschwankungen. Auch eigenen sich längst nicht alle Episoden zur Verschriftlichung. Manche leben hauptsächlich von Wortspielen und Betonungen. Noxo ist ein guter Stimmenimitator und beherrscht etliche Dia- und Soziolekte. Aber mit einigen dieser Monologe will ich doch den Versuch einer Publikation in meinem Blog wagen. In den nächsten Tagen starte ich hier also eine neue Serie. Noxos Gastauftritt ehrt mich und mein Weblog.
[Meine eigenen Kommentare zu seinem O-Ton setze ich in eckige Klammern.]
Posted in Noxos Nachtwachen | Comments Off on Noxos Cassetten
Saturday, 14. May 2011

Neulich brachte die FAZ ein langes Gespräch, das Frank Rieger vom Chaos Computer Club mit Daniel Suarez führte, einem US-amerikanischen Thriller-Autor, dessen Romane Daemon (2006) und Darknet (2010) die ebenso bedrückende wie gut begründete Vision einer menschlichen Gesellschaft entwerfen, die ihre Freiheit endgültig an ihre eigenen Apparate verliert.
An einer Stelle sagt Suarez: „Meine Sorge ist, dass Außenseiter am Ende möglicherweise als ,verdächtig‘ gelten, weil sie nicht ins Schema passen – statt dass es gerade umgekehrt wäre.“ (Frank Rieger: Wir werden mit System erobert: Ein Gespräch mit Daniel Suarez. A. d. Engl. v. Michael Bischoff; in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 100 v. 30. April 2011, S. 34 f.) – Der letzte Teilsatz klingt leider etwas hemdsärmelig oder schief geknöpft, was möglicherweise an einer unglücklichen Übersetzung liegt. Ich verstehe Suarez jedenfalls so, dass er eine Lanze für Außenseiter brechen will, deren Beitrag für die Entwicklung der Menschheit immer unverzichtbar war und deren Verschwinden einer Katastrophe für unser aller Zukunft bedeuten würde.
Zufällig las ich fast gleichzeitig anderswo folgenden Satz: „In Auschwitz, das wusste ich, starben die, die anders waren, während die Gesichtslosen, die Anonymen überlebten.“ Er stammt von Rudolf Vrba, einem der wenigen Überlebenden des Vernichtungslagers. (Rudolf Vrba: Ich kann nicht vergeben. Frankfurt am Main: Schöffling & Co., 2010, S. 248.) Die Ausmerzung des Abweichenden und die Anpassung der Verbleibenden an eine ideale Durchschnittlichkeit könnte das Rezept sein, nach dem sich diese Spezies endgültig eliminiert, denn schließlich ist Varietät das vitale Moment jeder Evolution.
Vielleicht komme ich aber nur zu diesem Ergebnis, weil ich mich selbst immer als einen Abweichling empfunden habe, als den Ausnahmefall für alle möglichen Regelmäßigkeiten, den aus der Rolle fallenden, aus der Reihe scherenden Störer. Und nichts ließ mich mehr leiden als die Langweiligkeit des Normalen. (Gleichzeitig war ich mir immer der Gefahren bewusst, denen ich mich damit aussetzte.)
Darum „weg von der Mitte“. (Und darum in „kleinen Schritten“.)
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Alles gleich
Friday, 13. May 2011

Freitag, der 13. Mai 2011. Vor einem Datum wie heute zittern nicht nur strenge Irrationalisten, zumal dessen Ziffernfolge – 1 + 3 + 5 + 2 + 1 + 1 – als Quersumme diesmal auch noch 13 ergibt. Selbst mich beschlich gelegentlich ein leichtes Unwohlsein, wenn mir ausgerechnet an einem solchen Dreizehnten freitags ein unwahrscheinliches Missgeschick widerfuhr. Ausgerechnet hat jetzt ein Aachener Physikprofessor, dass tatsächlich mathematisch betrachtet an 13er-Freitagen mehr Unglücke geschehen als an jenen 13ten, die auf die sechs anderen Wochentage fallen. (Vgl. Christopher Schrader: Schicksalstag; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 110 v. 13. Mai 2011, S. 18.) Seine Grundannahme ist dabei natürlich, dass sich Unglücksfälle rein stochsatisch auf lange Sicht völlig gleichmäßig auf alle Tage des Jahres verteilen. Schaut man sich die Ereignisse an, die in den 366 Datums-Artikeln der Wikipedia gelistet sind, so sind die dort unter den zwölf 13ten aufgelisteten Katastrophen jedenfalls nicht zahlreicher als die unter den anderen Tagen genannten – wobei man nun noch prüfen müsste, welche von diesen insgesamt 42 Katastrophen-13ten auf einen Freitag fielen. Erst für den Fall, dass es signifikant mehr als der Durchschnitt von 3,5 waren, könnte man ins Grübeln kommen. (Ich werde das gelegentlich vielleicht einmal überprüfen.)
Aber all diese Berechnungen bewegen sich ohnehin auf schwankem Boden. Wer legt denn fest, welche Ereignisse als Katastrophe gewertet werden und Eingang in die Geschichtsbücher und Enzyklopädien finden? Überdies gibt zu denken, dass sich die Katastrophen scheinbar in letzter Zeit häufen. Glaubt man der Wikipedia, dann haben sich die meisten Katastrophen der dokumentierten Menschheitsgeschichte, also der vergangenen 4500 Jahre seit Aufkommen der ersten Hochkulturen, in den letzten 500 Jahren ereignet. Das könnte nun aber zu einem guten Teil auch daher rühren, dass in dieser Zeit die Kommunikations- und Dokumentations-Techniken große Fortschritte machten und weltweite Verbreitung fanden. Und überhaupt: Bezieht sich der Aberglaube um Freitag den Dreizehnten als Tag des Unglücks nicht ohnehin eher auf die Privatsphäre, auf die kleinen Missgeschicke des Alltags?
Hier kommt nun ein weiterer „Störfaktor“ ins Spiel, der die Betrachtung des Themas um einen zusätzlichen, reizvollen Aspekt erweitert. Ist es nicht eine Frage der inneren Einstellung, der zufälligen Tageslaune und der äußeren Umstände, ob man ein Missgeschick als Unglück empfinden muss – oder im Gegenteil in eine glückliche Wegweisung des Schicksals umzudeuten vermag?
Ich jedenfalls bin zu der Einsicht gelangt, dass das Missgeschick wesentlich besser ist als sein Ruf. Es kommt allein darauf an, wie man zu ihm steht und was man daraus macht. Wenn mir zum Beispiel wieder einmal der Bus vor der Nase wegfährt, dann vergeude ich meine Zeit nicht damit, den offenkundig entweder sehschwachen oder gehässigen Fahrer zu verfluchen, sondern ich nutze die unverhoffte Wartezeit für sinnvolle Beschäftigungen: Beobachtung der neben mir wartenden Mitmenschen, stille Teilnahme an ihren Gesprächen, Selbstversenkung, konzentrierte Verfolgung eines jüngst unterbrochenen Gedankengangs und dergleichen mehr. Oder ich mache mich auf den Weg zur nächsten, gar übernächsten Haltestelle, um mir etwas Bewegung zu verschaffen und mich überraschen zu lassen, was mir wohl unterwegs begegnen wird. Meist geschieht in dieser Zeit nichts Außergewöhnliches. Aber außergewöhnlich wären vermutlich auch nicht die anderswo verbrachten Minuten gewesen, die ich früher an meinem Zielort einträfe, wäre der Busfahrer gnädiger oder aufmerksamer gewesen. Hingegen kam es gelegentlich schon vor, dass mir in einer solchen aufgenötigten Wartezeit ein großes Glück beschieden war, dass ich mit dem rechtzeitigen Erreichen des Busses verpasst hätte.
Dies war bloß ein triviales Beispiel. Es reicht aber aus, um ein Lebensprinzip deutlich werden zu lassen, dass sich noch auf die dramatischsten Schicksalsschläge anwenden lässt. Man könnte auch von einer „Hans-im-Glück-Mentalität“ sprechen, die den von ihr beseelten unter einem undurchdringlichen Schutzschild durchs Leben führt. Allerdings muss ich gestehen, dass ich von einer solch fugendichten Gemütspanzerung noch sehr weit entfernt bin. (Nicht zu verwechseln ist diese übrigens mit einer Abstumpfung der Empfindsamkeit.) Immerhin habe ich gerade in jüngster Zeit offenbar einen Punkt erreicht, da ich Rückfällen in die Verzweiflung nach als ungerecht empfundenen Schicksalsschägen mit der Frage begegnen kann: Was will mir der Zufall damit sagen? Eine Frage aber führt immer weg vom Jammern und hin zum Denken. Das ist doch immerhin schon ein kleiner Fortschritt. – Fast wäre ich jetzt enttäuscht, wenn mir der heutige Freitag als Dreizehnter keine solche Frage stellte. Man soll das Unglück nicht beschwören? Ach was, ich bin doch schließlich strenger kritischer Rationalist Feyerabendscher Couleur und tanze unbekümmert auf dem Kraterrand. An allen Tagen des Jahres.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Lob des Missgeschicks
Thursday, 12. May 2011

(Ohne Worte.)
Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Magendarm (Forts.)
Wednesday, 11. May 2011

(Ohne Worte.)
Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Magendarm
Tuesday, 10. May 2011

Meine Tante ist, wie sich nun herausgestellt hat, mit mir weder verwandt noch verschwägert. Der Schwager meiner Tante hat hierfür auf seine unnachahmlich ledige Weise den täuschend echten Kanadiernachweis erbracht. Da er sich vor ein paar Wochen auf dem Fischmarkt beim Segnen des Zeitlichen die Hakennase ausgekugelt hat, gilt aber sein Zeugnis vor höherer Instanz als inkohärent.
Sei’s drum. Immerhin ist meine Tante als Erbschnitte kein billiges Flittchen. Gerade vor vier Tagen hat sie mir ihren Kühlpark gezeigt, der es mit jeder besseren Gefrierschleuder im Handumdrehen aufnehmen könnte. Aber wer will das denn wissen? Ich jedenfalls bin voll und ganz zufrieden, wenn ich etwas von dem frischgemolkenen Käsekonfekt abstauben kann, den Äffi unter ihrem blaustichigen Busen birgt.
Äffi war der Hauptname meiner Tante, bevor sie diesen sturztrunkenen Philatelisten ehelichte, den sie auf der Schiffschaukel im Bunapark kennengelernt hatte. Seither schimpft sie sich Girondell und tut so, als wäre sie klar. Dabei strauchelt sie beim Kreuzworten nach wie vor, wenn nach einem Tranquilizer mit siebzehn Buchstaben gefragt wird. Ich aber tausche meinen Monaco-Vierer bei meinem Nennonkel gegen einen Wimpel für mein Dreirad.
Damit fahre ich die Bunaallee hinunter, dass der Auguststaub nur so gegen die Schaufensterscheiben der Heißmangeleien und Hautabziehereien wabert. Eine Freude ist das, weil mir so der scharfe Blick auf die drinnen stattfindenden Blutbäder und Hitzschläge erspart bleibt. Ich träume nämlich ungern unschön! „Nicht so presto, Idioto!“ Das schreit mir der Nennonkel nach und setzt sich augenblicklich wieder die Kodeinpulle an den Hals.
Wenn ich in die Schule komme, werde ich meine Tante verpetzen. Ich werde dem Fräulein erzählen, dass ich beobachtet hab, wie sie mit ihrer rechten Hand geradewegs über meiner linken Schulter usw. Auch die Geschichte mit dem kleinen Naduweißtschon kriegt das Fräulein von mir zu hören, als mir nichts andres übrig blieb, als kurzerhand, ähemm! Dann kommt der Schulpedell bestimmt in Tantchens Gelass und sorgt für Morgenrot. Oder?
[Aus den Märchenbüchern, Bd. IV. – Mai 1986.]
Posted in Werke, Würfelwürfe | Comments Off on Tante Äffi. Eine Groteske
Monday, 09. May 2011

Vor gut zwei Jahren schrieb ich hier und da mal über den armen US-amerikanischen Romancier Philip Roth, der wenig Glück mit den Frauen hat, unter Schreibzwang leidet, dem der Nobelpreis für Literatur verweigert wird und der zu allem Überfluss auch noch von Interviewern heimgesucht wird, die er bei all dem dann doch nicht verdient. – Dieser Tage musste ich leider feststellen, dass sich Roths traurige Lage in keiner Hinsicht gebessert hat.
Diesmal ist Willi Winkler von der SZ aufgebrochen, dem 78-Jährigen in seiner New Yorker Stadtwohnung auf den Pelz zu rücken. Womit? Mit Fragen? Schon im Untertitel zu Winklers Artikel lese ich, dass Philip Roth Interviews hasse. Warum gibt er sie dann? Müsste er verhungern, wenn er konsequent absagte, wie etwa zu Lebzeiten Salinger, oder heute noch Pynchon? Und warum bedrängt ihn der Journalist mit der Bitte um ein Interview, wenn der Gesprächspartner sich doch selbst alle Fragen längst schon gestellt und in seinen mehr als zwei Dutzend Büchern beantwortet hat. Winkler gesteht gleich eingangs, schon zweimal vergeblich versucht zu haben, Roth zum Interview zu treffen, 2002 und 2009. Aber er ließ nicht locker – und nun hat er ’s endlich geschafft. (Kann es sein, dass manche Zeitungsschreiber prominente Interview-Partner sammeln wie noch unbedarftere Leute Autogramme?)
Zwar können uns Lesern die Motive ja piepegal sein, aus denen ein solcher Interviewer um den halben Erdball fliegt, um einen berühmten Autor zu befragen, der nicht befragt zu werden wünscht – wenn, ja wenn dabei ein interessanter Artikel herauskommt, mit sonst nirgends zuvor veröffentlichten Einsichten in die Motive, Arbeitsmethoden oder Stimmungen der befragten Person. Das ist nun aber im hier zu beklagenden Hohltöner aus Winklers Feder mitnichten der Fall. Damit er diese Seite drei überhaupt voll bekommt, muss er langatmig und -weilig berichten, warum er sich verspätet hat zu diesem so lang ersehnten Gespräch. Dann gibt es eine lieblose Nacherzählung von Roths Ehetragödie mit Claire Bloom und ein paar knappe Bemerkungen zu einigen seiner bekannteren Romane. (Vielleicht sind es jene, die Winkler gelesen hat?) Zweimal klingelt das Telefon. Wieder erfahren wir etwas über die gesundheitlichen Probleme des Autors. Und die wenigen Auskünfte, die er über sein Leben, Denken und Schreiben gibt, sind dermaßen zusammenhanglos und beliebig hingetupft, dass man sich wirklich verarscht fühlen muss, ob man nun Roth-Fan ist oder nicht. (Willi Winkler: Lebenslänglich; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 94 v. 23./24./25. April 2011, S. 3.)
Ich habe Philip Roth zeitweise durchaus gern gelesen. Zur Entspannung war er in einer nun aber auch schon lange zurückliegenden Lebensphase für mich tauglich. Dass Willi Winkler uns nun aber nahelegen will, er sei der einzige für den Nobelpreis in Frage kommende Autor unserer Tage, das halte ich doch für einen schlechten Scherz. Nicht, dass Roth ihn nicht bekommen könnte. Das Stockholmer Komitee hat schließlich schon ganz andere Fehlentscheidungen getroffen. Aber was Winkler hier fabuliert, ist wegen seiner Albernheit einmal wörtlich zitierenswert. Roth, so Winkler, sei ein Schriftsteller, „der jedes Jahr, wenn der Sommer zu Ende geht und die Nobelpreisverleihung näher rückt, als bester, als idealer, als einzig möglicher Kandidat genannt wird. Aber weil das Nobelpreiskomitee hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen wohnt, wird es dann wieder nur Elfriede Jelinek. Oder Herta Müller. Oder, wirklich très chic: Le Clézio.“
Man mag dem Komitee ja manches vorwerfen, mag möglicherweise auch alle drei zuletzt genannten Personen der höchsten Literaturauszeichnung der Welt für unwürdig halten. Aber ein Vorwurf trifft die Mitglieder des Komitees nicht: dass sie in den vergangenen Jahrzehnten bei ihren Entscheidungen darauf geschielt hätten, was alle Welt den „den besten, idealen, gar einzig möglichen Kandidaten“ nennt. Wo, bitte schön, gibt es ein solches Votum? Und kann es einen solchen Kandidaten auf unserem globalisierten Globus auch nur theoretisch noch geben? Wer sind die Leute, die laut Winkler als einen solchen Kandidaten Jahr für Jahr den US-Amerikaner Philip Roth benennen? Und zwar übereinstimmend in China, Indien, den USA, Indonesien, Brasilien, Pakistan, Bangladesch, Nigeria, Russland und Japan gleichermaßen, um nur die zehn bevölkerungsreichsten Länder der Erde zu nennen? Quatsch! Und übrigens ist doch vermutlich das Warten auf den Preis das einzige Motiv, das den Autor Philip Roth noch bei der Stange hält und zum Schreiben motiviert. Warum sollte man ihm dann den Nobelpreis verleihen? Damit er anschließend verstummt, weil die Luft endgültig raus ist? Nein, es ist schon in Ordnung, diese Auszeichnung an Autoren zu geben, von denen man hoffen darf, dass Preis samt Preisgeld ihnen und ihrem Werk noch nützlich sein kann.
Posted in Langsamkeit, Würfelwürfe | Comments Off on Kopfnote [2]
Sunday, 08. May 2011

Als Fußkranker liebe ich Fußnoten. Das mag eine Kompensation sein, vielleicht macht mir aber auch bloß das Kleingedruckte so viel Freude, weil es mir immer wieder die Nahsichtschärfe meiner Augen beweist. Ich kann noch Sätze entziffern, wo andere nichts als Striche sehen. Seit ich mein Blog betreibe, habe ich eine mögliche Liaison mit der Fußnote auch in dieser neuen Behausung nie ganz aufgeben können. Aber ich wusste nicht so recht, wie das formal zu bewerkstelligen wäre. Schließlich rücken alle Postings hier automatisch nach unten. Die Artikel fallen tiefer und tiefer, je älter sie werden, bald schon tiefer, als eine Fußnote je sinken kann, der gedruckt auf Papier noch immerhin die untere Blattkante letzten Halt gibt. (Es sei denn, sie wird ans Ende des Buches verbannt, aber das halte ich für eine Unsitte und Zumutung für den Leser obendrein.)
Nun ist mir, weil sich ein konkretes Problem stellte, der Gedanke gekommen, meinen Fußnoten hier autonome Artikel zuzugestehen. Zwar ist die Verweisrichtung dabei notgedrungen auf den Kopf gestellt, indem die Fußnote auf den kommentierten oder ergänzten Passus im Haupttext verlinkt, in diesem Fall auf das Wort Tiere im Artikel Heinrich Funke: Das Testament (XII) vom 18. Feruar 2011. Immerhin kann ich aber nachträglich dort auch noch einen Verweis auf die hier folgenden Ausführungen anbringen. Da es sich nun bei dieser von mir erfundenen Praxis im wörtlichen Sinn ja weniger um Fuß-, als vielmehr um Kopfnoten handelt, insofern sie nämlich zumindest bei ihrem ersten Erscheinen im Werk ganz oben am Haupt-Platz stehen, entschied ich mich für diesen Namen: Kopfnote – wobei mir auch alle übrigen Nebenbedeutungen, die er dem Leser in den Sinn rufen mag, durchaus willkommen sind.
Folgende Kopfnot plagte mich also in den vergangenen sieben Wochen. Der Künstler der Linolschnittfolge, die ich hier regelmäßig kommentiere, gab gesprächsweise zu bedenken, ich hätte den Satz des Pseudo-Aristoteles – „post coitum omne animal triste praeter gallum, qui cantat“ – falsch aus dem Lateinischen übersetzt, indem ich animal mit Tier eindeutschte. Vielmehr müsse es Lebewesen heißen. Und ein Lebewesen sei ja auch der Mensch, der somit hier hinzuzurechnen sei, als ein nach dem Koitus trauerndes Wesen. Dieser Einwand brachte mich völlig aus dem Konzept, obwohl ich in meinem Stowasser beide Möglichkeiten (und noch eine dritte) fand: „animal, alis, n Lebewesen, Geschöpf; Tier.“ (Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch. München: Oldenbourg Schulbuchverlag, 1993, S. 36.)
Das harmlose Semikolon an dieser Stelle gibt zu denken. Ist die letztgenannte Wortbedeutung Tier nun eine schwächere, seltenere oder spätere? Und da ich mich nun schon einmal etwas gründlicher mit den Übersetzungsmöglichkeiten des Zitats befasste, fiel mir plötzlich auf, dass ich immer gedacht und wohl auch gesagt hatte: „[…] außer dem Hahn, der schreit.“ Ich hatte vermutlich das im Deutschen gängige Kompositum Hahnenschrei im Ohr und wusste natürlich außerdem, dass man die wenig musikalischen Laute dieses Haustiers als Krähen bezeichnet. Nun steht ja aber bei Pseudo-Aristoteles ausdrücklich cantat, und cantare bedeutet nun einmal „singen“, keineswegs „schreien“ oder „krähen“. In der Sprachbar der Deutschen Welle gab es mal einen eigenen Beitrag über das deutsche Wort „Hahnenschrei“. Dort heißt es: „Seit Menschengedenken gilt er als ein Verkünder der Zeit, genauer gesagt: des Tagesbeginns. Vielleicht haben Sie ihn ja gehört gegen Morgen, als er Sie in einer stillen Gegend fernab von den Städten unsanft aus dem Schlummer gerissen hat. Den ersten Hahnenschrei – oder besser noch Hahnengesang. Ob man das Krähen wirklich als wohlklingenden Gesang bezeichnen kann, wenn man davon frühmorgens aus dem Bett geworfen wird, lassen wir einmal dahingestellt. Aber der Name Hahn weist ihn eindeutig als Sänger aus. Denn das lateinische galli-cinium bedeutete Hahnengesang und bei den Griechen nannte man den Hahn spöttisch ēïkanós – Frühsinger. Auch im Französischen singt der Hahn: Dort heißt es: Le coq chante. In einer Fabel, die über die Niederlande nach Deutschland gekommen ist, wird der Hahn chantecler genannt, was so viel wie Singehell bedeutet.“
Nun riskiere ich mal, was man neuerdings eine „steile These“ nennt. Vielleicht haben die Hähne vor ein paar Jahrhunderten tatsächlich noch gesungen? Beweisen kann ich dies natürlich nicht, aber die zitierten alten Texte legen es doch nahe. Und der Gegenbeweis dürfte ebenfalls unmöglich sein, schon allein deshalb, weil die technische Möglichkeit zur Tonaufzeichnung erst ab 1860 entwickelt wurde. Zudem würden wir einen Hahnengesang auf einer Schallplatte aus dem antiken Rom vermutlich gar nicht als solchen erkennen, weil wir ja nicht wissen, wie er geklungen hat: der singende Hahn. Diese kleine Geschichte von den Tücken des richtigen Übersetzens und Verstehens alter Weisheiten gilt mir nur als neuerliche Bestätigung, dass Skepsis ihnen gegenüber sehr angebracht ist.
Posted in Langsamkeit, Würfelwürfe | Comments Off on Kopfnote [1]
Saturday, 07. May 2011

Umstände, die hier nicht hergehören, brachten es mit sich, dass ich in relativ kurzer Zeit gleich dreifach meinem Vorsatz untreu wurde, meine Heimatstadt nicht zu verlassen. Nun ist die Reise nach Köln ja keine Ochsentour. Und mein Ökologischer Fußabdruck wird durch die ein oder andere Exkursion dorthin auch nicht wesentlich größer, zumal ich heute mit der S-Bahn reiste. Dennoch spüre ich, wie sehr mich diese rapiden Ortswechsel aus der Balance bringen. Prompt vergaß ich gestern vorm Schlafengehen, meinen Betablocker zu schlucken, und heute früh in der Hektik des Aufbruchs den ACE-Hemmer noch dazu! Bei der Rückfahrt traf ich im Zug Kölner Fans von Bayer Leverkusen auf dem Weg zum Spiel gegen den HSV. Es wurde eng und laut und heiß!
Am rettenden Ufer, in meiner Arbeitsklause zeigte mein Blutdruckmessgerät 154 zu 101, bei einem Puls von 99. Zieht man den Panikeffekt ab, den eine solche Messung beim typischen Hypochonder auslöst, bleibt immer noch ein Ergebnis, das der Hypertoniker nicht alle Tage riskieren sollte. Doch diesmal war die Erfahrung es immerhin wert, dass ich mein Leben aufs Spiel setzte.
Ich war in der Kölner Philharmonie verabredet. Wenn ich mich richtig erinnere, bin ich in den vergangenen dreißig Jahren mindestens fünfmal per Bahn nach Köln gefahren. Jeder andere würde sich an meiner statt vermutlich schämen, dies zuzugeben: Ich wusste trotzdem bis heute nicht, wie nah der Dom am Bahnhof und wie nah beides am Rhein liegt. Ich versuche, mich zu erinnern. Ein Grund könnte sein, dass ich als Atheist und kaltblütiger Verächter aller religiösen Symbolik, erst recht wenn sie mir in Gestalt solch eines steinernen Riesen in den Weg trat, den Blick vor dergleichen ,Einschüchterungs-Architektur‘ reflexhaft niederschlug. Zudem war wohl der kurze Weg vom Dom zum Rhein, den ich heute beschritt, früher durch einen Busbahnhof geradezu verbarrikadiert und wurde erst durch den Neubau von Philharmonie und Museum Ludwig eröffnet.
Beim Aufstieg über eine wundervolle Treppe hinauf zu diesem imposanten Ensemble, mit Dani Karavans geradezu magisch wirkendem Ma’alot als stillem Mittelpunkt, passierten wir eine Gruppe Touristen, die sich auf den Stufen zum Gruppenfoto drapierte – ganz ähnlich wie es täglich tausendmal auf der berühmten Scalinata di Trinità dei Monti geschieht, die wir Deutschen die Spanische Treppe nennen. „Sie waren doch sicher einmal in Rom?“ Nein, da muss ich meinen Begleiter enttäuschen. Im Vorbeigehen schnappen wir noch eine andere Gedankenverbindung auf, von einem der posierenden Sehenswürdigkeiten-Sammler: „Das ist ja hier wie beim Hermannsdenkmal!“
Die Treppe und ihre Stufen – das war das beherrschende Thema des heutigen Köln-Besuchs. Nun bedaure ich, dass ich die Lange Nacht des Deutschlandfunks gelöscht habe, in der es ausschließlich um dieses Thema ging. Mir fiel der Name der zuständigen Wissenschaft leider nicht mehr ein. Sie heißt Scalalogie. (Und die deutsche Koryphäe auf diesem Gebiet ist Friedrich Mielke.)
Posted in Flanerie, Würfelwürfe | Comments Off on Am Herzen von Köln
Friday, 06. May 2011

Beim Anblick dieses lädierten Quintapeds überwältigt mich wieder einmal mein Mitleid mit den Dingen. Was hat er denn da, an seinen beiden bandagierten Rollfüßchen? Ist er am Ende gar ausrangiert? Erwartet ihn das traurige Schicksal jedes Menschenmöbels: die Reise nach Wegdamit?
Wie alt mag das rückenfreundliche Bürostühlchen wohl sein? Es sollte mich nicht wundern, wenn es gerade mal fünf schlappe Jährchen auf der buckligen Rückenlehne hat. In dem Alter ist unsereins ja nicht mal eingeschult. Und nun schon auf den Friedhof für Sachen?
Dann scheint ein böser Zufall den Stuhl dazu verurteilt zu haben, ausgerechnet vor einer Kulisse seiner Entsorgung harren müssen, die gerade in ihrer porösen Abgenutztheit die Dauerhaftigkeit menschgemachter Gegenstände demonstriert: Das Fachwerk-Gemäuer im Hintergrund bringt es gut und gern auf 187 Jahre!
Der mittig gescheitelte Herr Stencil blickt jedenfalls mit indignierter Herablassung vom Putz herab auf die Szenerie, wenngleich er vermutlich noch jünger ist als die fußkranke Sitzgelegenheit.
Aber vielleicht interpretiere ich das Ensemble am Straßenrand auch völlig falsch! Vielleicht wurden die beiden Rollen nur deshalb mit Schaumgummituch bandagiert, damit der Stuhl sich nicht selbstständig machen und davonrollen … resp. davongerollt werden kann? Schade. Ich war in Gedanke schon damit beschäftigt, das gute Stück zu retten. Es sieht doch wirklich noch ganz passabel aus. – Ochmööönsch!
Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Ochmööönsch (II)
Thursday, 05. May 2011

Neulich sagte eine meinem Blog gewogene Freundin: „Da hast Du ja wieder gegeifert! Ätzend.“ Das saß, weil es stimmte; auch das ,wieder‘. Ich verrate jetzt nicht, welchen Beitrag sie meinte, das ist ja ganz gleich. Es gibt genug von der Sorte in meinem Blog.
Ich ging in mich. Haderte mit mir. Wozu so viel Bitterkeit? Na ja, es ist schließlich nicht viel Süßes zu vermelden aus diesen Endzeittagen, oder? Es sei denn, ich wollte Knall auf Fall blöd, blind oder falsch werden, wie ein guter Teil jener Schönwetter-Onlinetexter, die Optimismus versprühen wie ein giftiges Gas, mit Veilchenduft zur Tarnung. Gute Laune zu mimen in Zeiten größter Not, das ist doch infam, oder? Nicht mit mir.
Jetzt gerade lese ich, dass Helmut Schmidt sein neuestes Buch veröffentlicht, natürlich mit Erfolgsgarantie. Schon Titel und Thema rennen alle offenen Türen ein: Religion in der Verantwortung – Gefährdung des Friedens im Zeitalter der Globalisierung. Der Rezensent weiß, warum das weggehen wird wie geschnitten Brot: „Die globalisierte Moderne ist von ungeheuerlicher Komplexität. Da ist es gut, wenn zumindest einer die Wirren der Welt durchschaut, historisch herleitet und strukturell analysiert.“ (Johann Hinrich Claussen: Der alte König; in: SZ Nr. 103 v. 5. Mai 2011, S. 11.) – Fazit: Die Menschen wollen Trost!
Tut mir leid, da sind sie bei mir an der falschen Adresse! Ich bin ja im Gegenteil darauf spezialisiert, falsche Trostversprechen zu entlarven; Schönfärbereien so gründlich zu entmischen, dass ein tristes Grau in Grau dabei rauskommt; Spaßmacher ernst zu nehmen, bis Tränen fließen. Aber jetzt ist doch Frühling! Da verspürt selbst jemand wie ich die Neigung, nach einem Hoffnungsschimmer Ausschau zu halten.
Da fielen mir die vielen kleinen Momente ein, die ich auf meinen täglichen Flanerien durch die Straßen meiner Vaterstadt mit dem stillen Kommentar Ochmööönsch! versehe. Die will ich künftig fotografieren und hier in einer neuen Rubrik sammeln. Ganz ohne Bitterkeit.
[Photographie: Manuel Hessling.]
Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Ochmööönsch! (I)
Wednesday, 04. May 2011

Ein geduldiger, teilnehmender, verstehender Zuhörer. Das sind drei für einen begeisterten Erzähler wie mich bedeutende menschliche Vorzüge. Geduld zwingt mich nicht zur Kümmerlichkeit der Kurzfassung, Teilnahme signalisiert mir die Ankuft meiner Botschaften und Verständnis beweist jene intellektuellen und kulturellen Voraussetzungen, die es erst erlauben, meinen Erzählungen den ihnen innewohnenden tieferen Sinn zu entnehmen.
Diese für mich so angenehme Eigenschaft korrespondiert mit einem feinen Gespür für sprachliche Nuancen. So beklagt er sich gestern darüber, fälschlicherweise oft als Perfektionist oder gar Pedant bezeichnet zu werden. Dabei wolle er sich doch gerade nicht jenen zeitgenössischen Künstlern zugesellen, die ein Konzept mit ermündendem Verbesserungszwang immer und immer noch ein Schrittchen weiter dem unerreichbaren Ideal anzunähern suchen. Dem stehe schon seine große Neugier auf neue Experimente und sein unerschöpflicher Ideenreichtum entgegen.
Wie kommen die oberflächlichen Betrachter seines Schaffens und seiner Ergebnisse dann zu einem solchen Fehlschluss? Fast möchte ich annehmen, dass es bloß der Hintergrund all jener schludrig, hastig oder faul gemachten Kunst von heute ist, vor der sich seine sorgfältig geplanten und ordentlich ausgeführten Werke so wohltuend abheben.
Indem ich diesen Satz niederschreibe, der leicht als Kompliment missverstanden werden kann, stelle ich mir die Reaktion des Belobigten, eine wegwerfende Handbewegung und eine relativierende Äußerung vor, gefolgt vielleicht noch von der Aufzählung einiger älterer Kollegen, die seine Wertmaßstäbe nicht bloß erfüllen, sondern vorbildhaft weit übertreffen. Diese Bescheidenheit erfüllt mich manchmal mit etwas Sorge. Muss sie nicht im lauten Jahrmarktstreiben des Kunstmarkts unserer Tage dazu führen, dass er in den entscheidenden Augenblicken, die oft zum großen Durchbruch führen, übersehen wird? Die Gefahr besteht immerhin. Und der trotzige Satz, dass sich wahre Qualität am Ende immer durchsetze, ist erstens schon deshalb nicht beweisbar, weil sein Gegenteil nicht widerlegt werden kann. (Ob es wahre Qualität gab, die sich nicht durchgesetzt hat, können wir ja nicht wissen, eben weil sie nie an die Öffentlichkeit gelangte.) Und zweitens gibt es nachweislich sehr viele Beispiele von wahrer Qualität, deren Durchbruch erst posthum erfolgte. In diesem Fall sollte man übrigens nicht wie üblich von einer späten, sondern richtiger von einer verspäteten Gerechtigkeit sprechen. – Andererseits sind die Beispiele Legion, bei denen sich früher Erfolg nachteilig auf die Schöpfungskräfte ausgewirkt, sie gar völlig hat versiegen lassen.
Zum Steckbrief noch ein paar Äußerlichkeiten in Stichworten. Beim Suchen nach Begriffen wandert der Blick nach rechts unten und eine leichte Spannung spielt um die Lippen. Das Lächeln ist am bezwingendsten in den äußeren Augenwinkeln, was viel von seinem Charme ausmacht. Bereitschaft zur Empörung, die aber stets ein ziviles Maß einhält. Ob dies auch für die Verachtung gilt, die er gelegentlich, wenngleich eher selten zu erkennen gibt, vermag ich noch nicht abschließend zu sagen. Sie tut sich durch ein Aufblitzen der Augen kund, was sonst zu seiner Mimik nicht recht passen will. (Jedes Menschenbild ist notwendig immer ein work in progress.)
Posted in Portraits, Werke, Würfelwürfe | Comments Off on Portrait Robert Sch.
Tuesday, 03. May 2011
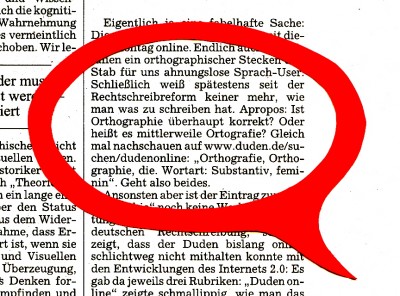
Die Verführungskraft der Patzer in der Süddeutschen ist in letzter Zeit wieder besonders groß. Erneut gelingt es einem ihrer Redakteure, in einem Artikel zum Thema richtiges Deutsch einen bösen Fehler unterzubringen. Ja, es kommt sogar noch dicker. SZ-Mitarbeiter alex macht seinen Schnitzer ausgerechnet in einem Satz über die (nach der neuen Rechtschreibung) korrekte Schreibweise des (aus dem Altgriechischen hergeleiteten) Fachworts für Rechtschreibung: Orthographie; und zwar, peinlicher geht ‘s nimmer, in diesem Wort selbst!
Worum geht es in dem Feuilleton-Beitrag? Seit gestern ist die neue Website des Duden online: „Endlich auch in Digitalien ein orthographischer Stecken und Stab für ahnungslose Sprach-User.“ So locker-flockig, mit gleich zwei kreativen Neologismen, die man auch in der aktuellsten Print-Version des Duden vergeblich suchen würde, führt uns alex ans Thema heran, um dann fortzufahren: „Apropos: Ist Orthographie überhaupt korrekt? Oder heißt es mittlerweile Ortografie? Gleich mal nachschauen auf www.duden.de/suchen/dudenonline: ,Orthografie, Orthographie, die. Wortart: Substantiv, feminin‘. Geht also beides.“ (alex: Aus Sprechern sollen User werden; in: SZ Nr. 101, S. 11. – Nebenbei: Auch der Titel dieser Glosse ist völlig danebengeraten. Nachschlagewerke zur Rechtschreibung, gleich ob traditionell als Buch oder digitalisiert und online, wurden und werden in erster Linie nicht von Sprechern, sondern von Schreibern genutzt. Und zudem sollen auch diese nicht ihr Verhalten als Schreibende ändern, sondern ihr Verhalten beim Nachschlagen. Allenfalls könnte die Headline also lauten: Aus nachschlagenden Schreibern sollen tippende und klickende User werden. Das wäre wohl als Überschrift viel zu lang, aber vermutlich die kürzeste korrekte Formulierung für den gemeinten Sinn. Was dort nun stattdessen als Titel steht, ist jedenfalls kompletter Blödsinn!)
Es geht also beides? Offenbar kann der Verfasser nicht einmal bis drei zählen, denn so viele Varianten des Wortes hat er doch selbst soeben gebracht: [1] Orthographie; [2] Ortografie; [3] Orthografie. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann sollten wir auch die letzte nicht unterschlagen: [4] Ortographie. Um es vorwegzunehmen: [1] und [3] gehen, [2] und [4] nicht, aber nach [1] und [2] hatte alex gefragt, [1] und [3] gefunden – und geantwortet: „Geht also beides.“
Und sonst? Ansonsten verfehlt der flapsige Artikel sein Thema. Denn worum es bei der Kurzvorstellung eines neuen Online-Werkzeugs zuallererst gehen müsste, wäre doch dessen Funktionsweise. Was passiert, wenn ich ein Wort, dessen korrekte Schreibweise ich nicht kenne, ins Suchfeld eingebe? Dabei wäre besonders interessant zu erfahren, wie das Verzeichnis reagiert, wenn ich ein falsch geschriebenes Wort eingebe. Im konkreten Beispiel hätte alex vielleicht mal seine für möglich gehaltene Variante [2] Ortografie prüfen können. Ich habe genau das getan und erhielt unter der Überschrift Suchergebnisse folgende Antwort: „Die Suche nach ,ortografie‘ lieferte 0 Treffer | Oder meinten Sie: Kartografie, Fotografie, Areografie“.
Hier könnte nun ein Kritiker, der diesen Namen verdient, berechtigte Bedenken anmelden. Wenn ich als „User“ des neuen Duden-Onlinewörterbuchs den Begriff nur vom Hörensagen kenne, dann wüsste ich doch gern, wie das Wort sich richtig schreibt. Vielleicht würde ich in einem nächsten Versuch [4] Ortographie eingeben. Ich erhielte dann exakt das gleiche Ergebnis, wieder mit den kaum hilfreichen, geradezu unsinnigen Verweisen auf die Wörter Kartografie, Fotografie und Areografie. Außerdem würde mich gewiss interessieren, warum man den Wortteil „Ortho-“ nicht ohne „h“ schreiben darf, den Wortteil „-graphie“ hingegen sehr wohl mit „f“ statt „ph“. Richtige Schreibweisen von falschen zu unterscheiden fällt ja schließlich viel leichter, wenn man die Regeln kennt, die dem zugrunde liegen. Hier versagt Dudenonline völlig – und sein „Kritiker“ ebenfalls.
Posted in Homo laber, Sprechblasen, Würfelwürfe | Comments Off on Ort(h)ografie? Ort(h)ographie?
Monday, 02. May 2011

Über den mir bis dahin völlig unbekannten serbischen Poeten Brana Crnčević las ich neulich aus Anlass seines Todes, dass er Alkoholiker gewesen sei „und auch deshalb zur kurzen Form neigte.“ (tens in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 82 v. 7. April 2011, S. 35.) Dies scheint mir eine merkwürdige Begründung zu sein, die ich mir allenfalls auf Umwegen plausibel zu machen vermöchte. Oder soll ich annehmen, dass sich der Serbe an seinen Schreibtisch setzte, um ein Epos zu schreiben oder mindestens eine Ballade, mit der Rechten zur Feder griff und gleichzeitig mit der Linken zum Schnapsglas, sich einen hinter die Binde kippte und ein paar Worte zu Papier brachte – um dann alsbald mit dem Poetenhaupt aufs Pult zu knallen? Fertig ist der Aphorismus, und der Dichter ebenso? (Ebensowenig hielte der Umkehrschluss stand, dass die großen Meister der kleinen Form, die Lichtenberg, Kraus & Lec, eine Neigung zur Flasche gehabt und die hochprozentige Weisheit ihrer Sprüche in der Neige des Glases gesucht oder gar gefunden hätten.)
Hieraus könnte man nun folgern, die Umkehrung einer unsinnigen Behauptung müsste stets neuen Unsinn hervorbringen. Würde mir etwa jemand unterstellen, dass ich auch deshalb blogge, weil ich die Um- und Widerstände scheue, die mit der Einreichung eines Textes bei einem ordentlichen Verlag verbunden sind, so wäre dies insofern eine unsinnige Behauptung, als ich mit einem überaus ordentlichen Verlag längst schon in Verbindung stehe, dort meine Texte – wenngleich nicht alle meine Blogtexte, dafür aber zahlreiche andere, die nicht in meinem Blog erscheinen – aufmerksam durchgesehen werden, mit dem gemeinsamen Ziel einer konventionellen Veröffentlichung zwischen Einbanddeckeln.
Nur zu wahr ist in diesem Fall aber leider der Umkehrschluss: dass heute jeder Stammler, der sich von kompetenten Lektorinnen und Lektoren seriöser Verlage hat sagen lassen müssen, mangels Kenntnissen und Talenten niemals einen publikationswürdigen Text hinzubekommen, wütend die Absageschreiben in den Schredder schob und – statt nun Imker, Call-Center-Agent oder Popstar zu werden – ungefragt ein eigenes Weblog aufgemacht hat, getreu dem Motto aller Trotzköpfchen: Jetzt erst recht!
Das ist nicht schlimm? Es müssen ja für dieses Gestammel keine Bäume dran glauben? Mag sein. Aber einerseits funktioniert bekanntlich auch das Internet keineswegs CO2-neutral. (Vor Jahren schon wurde ausgerechnet, dass jede Google-Suche soviel Energie verbraucht wie eine 11-Watt-Sparlampe in einer Stunde.)
Und andererseits wirkt sich diese Schlammlawine, dieser stinkende Abfallhaufen unlesbaren, geschweige denn genießbaren Gebrabbels verheerend fürs Image von Weblogs aus. Dabei gibt es doch in diesem Spreu-Himalaya durchaus das eine oder andere Weizenkorn! Blogs, die Beachtung verdienten – und vielleicht sogar Achtung. (Der Grund, warum ich mich gegen meine hartnäckigen Bedenken nun doch durchgerungen und eine Blogroll aufgemacht habe.)
Posted in Babel, Würfelwürfe | Comments Off on Et vice versa?
Sunday, 01. May 2011

Was heute in der Luft fliegt. Freiheitstriebtaten ohne Zahl. Meine Anspielungen gehen über die Bande. Bitte nach Ihnen, ohne Blutvergießen. Haben Sie heute schon gehört? Es soll Unverwundete gegeben haben. Die Gerüchte kommen aus der Hinterküche. Dort müsste mal dringend jemand nach dem Kleingemachten sehen.
Putz dir die Ohren, der Hund hat Durst! Wenn man das auch freundlicher sagen könnte, dann bräuchte ich meinen Sprenggürtel nicht. Hinter den sieben Zwergen tut sich ein großes Loch auf. Und wer zahlt? Eine Runde für meine tote Base und mich!
Er hat sich beim Lesen des Kleingedruckten die Blase verkühlt. Halten Sie mal eben diese Flasche hier – und wenn ich jetzt sage, dann schmeißen Sie sie einfach in dieses Loch. Danke!
Sonntagsruhe. Wir gehen angeln ohne Schein. Wader hat zwar eine Lizenz fürs Pilzesammeln, aber die gilt nicht fürs Tiefseefischen. Wenn er sich nicht mit seinen Tiraden zurückhält, steige ich aus. Meine Mutter hat ihm zu Ostern mal den Sack rasiert.
Der Kleingemachte hat heute wieder seine violetten fünf Minuten. Putz das weg! Wenn Du fair bist, musst Du zugeben, dass ich schon Ende April wusste: Da kommt noch was nach! Überraschend immerhin auch für mich, dass G. jetzt selbst am Kleingeld spart. Aber was ist das nun? Verfluchtes Blattgemüse! Ich krich keine Luft mehr. Ich …
[Aus meinen Notizheften. Heft 14 v. Mai 1976, S. 3.]
Posted in Werke, Würfelwürfe | Comments Off on Gespannte Ruhe
Thursday, 28. April 2011
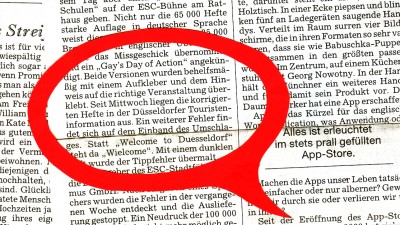
Sollte sich trotz meines längeren Schweigens gelegentlich noch der eine oder andere Leser auf dieses Blog verirren, und sollte sich unter diesen paar Versprengten gar einer tummeln, der mit langem Atem mein treuer Gast ist, dann könnte ihm aufgefallen sein, dass unter anderen Rubriken auch diese, Sprechblasen genannte, sanft entschlummerte, vor ziemlich genau zwei Monaten. Mir schien es nämlich nach nur 13 Folgen nicht mehr der Mühe wert, mich auf die alltägliche „Schnitzerjagd“ zu begeben. Das war zu leicht, das wurde bald fad! Zudem verspürte ich bei meiner hämischen Kritikasterei stets ein leichtes Unbehagen, da ich doch hier ausgerechnet eine jener wenigen Tageszeitungen deutscher Sprache aufs Korn nahm, die bei allen angekreideten Fehlern immer noch den Anspruch zu haben scheint, richtig und gut zu schreiben.
So ließ ich ’s also bleiben. Und wenn ich jetzt einmal rückfällig werde, dann nur deshalb, weil der Süddeutschen in ihrer heutigen Ausgabe ein Patzer unterlaufen ist, der mir gleich in zweifacher Hinsicht bemerkenswert erscheint, handelt es sich hier doch um einen Fall von Steinewerfen im Glashaus und zugleich um einen Fall von kulturellem Banausentum.
Erstens geht es in dem fraglichen Artikel gerade um „peinliche Fehler“, nämlich im Begleitheft zum Finale des Eurovision Song Contest, das am 14. Mai 2011 in Düsseldorf ausgetragen wird. Das in einer Auflage von 65.000 Exemplaren gedruckte Heft kündigt einen gleichtags stattfindenden „Aktionstag der Schwulen“ an. Und in den 35.000 Exemplaren der Broschüre in englischer Sprache ist analog von einem „Gay’s Day of Action“ die Rede. Dumm nur, dass es sich um einen „Aktionstag der Schulen“ handelt. Das ist verständlicherweise ein Fall für die Panorama-Seite der SZ, denn dort will sich der gebildete Leser dieses Blattes schließlich für alles entschädigen, was ihm durch seinen BILD-Boykott entgeht.
Was aber dem Fass den Boden ausschlägt: dass nun just in diesem Oberlehrer-Artikel dem anonymen Autor ebenfalls ein Lapsus widerfährt, und zwar einer, der nicht bloß auf Flüchtigkeit beruht wie in den von ihm monierten Fällen, sondern noch ganz andere Defizite offenbart. Er schreibt: „Ein weiterer Fehler findet sich auf dem Einband des Umschlages.“ (SZ Nr. 97 v. 28. April 2011, S. 9.) So etwas gibt es nicht und kann es nicht geben! Vielleicht hat der Leser dieser Zeilen im Unterschied zu dem zitierten SZ-Redakteur einmal ein Buch in der Hand gehalten und erinnert sich von daher, dass das viele Papier im Inneren äußerlich von zwei meist etwas stabileren Deckeln eingefasst war, einer vorn und einer hinten. Dies nennt man „Einband“. Viele Bücher hüllen sich nun zusätzlich noch in eine Schutzschicht, damit die Einbanddeckel beim Lesen am Früstücks- oder Abendbrottisch nicht so leicht bekleckert werden können. Diese Schicht nennt man „Umschlag“.
So wird auch dem Buchunkundigen hoffentlich klar, dass man notfalls von einem „Umschlag des Einbandes“ sprechen kann, mitnichten jedoch, wie in dem Artikel geschehen, von einem „Einband des Umschlages“. (Der lässliche Flüchtigkeitsfehler auf dem Umschlag des Einbands sei immerhin noch nachgetragen: „Statt ,Welcome to Duesseldorf‘ steht da ‚Wielcome‘.“ Geschenkt!)
Posted in Homo laber, Sprechblasen, Würfelwürfe | 2 Comments »
Saturday, 16. April 2011

„Der Vorwurf, meine Doktorarbeit sei ein Plagiat, ist abstrus“, teilte Guttenberg unmittelbar nach Bekanntwerden des Plagiatsverdachts gegen seine Doktorarbeit vor Medienvertretern in Berlin mit. (Spiegel online v. 16. Februar 2011.) Nun bedeutet abstrus im eigentlichen Wortsinn soviel wie „tief verborgen, dunkel, schwer verständlich oder geradezu unverständlich“ (nach Adolf Genius: Neues großes Fremdwörterbuch. Regensburg 1933, S. 9) oder auch „versteckt, verborgen […] (abwertend) absonderlich, töricht […] schwer verständlich, verworren, ohne gedankliche Ordnung“ (nach dem Duden Fremdwörterbuch. Mannheim: Bibliographisches Institut, S. 8). Das Wort passte nicht zur Sache – und der Fehler bei der Wortwahl erscheint nachträglich wie ein erster versteckter Hinweis darauf, dass der strahlende Politstar vielleicht doch ein Problem mit dem Verhältnis von Schein und Sein haben mochte.
Noch am gleichen Tag meldete sich Guttenbergs weltberühmter und über jeden Zweifel erhabener Doktorvater, der brave Professor Peter Häberle aus Bayreuth zu Wort und wies die Vorwürfe gegen seinen Ex-Doktoranden im empörten Brustton lauterster Überzeugung zurück: „Das ist absurd“, sagte er der Münchner Abendzeitung. „Die Arbeit ist kein Plagiat.“ (AZ online v. 16. Februar 2011.) Auch dieses Wort passt nicht so recht in den Zusammenhang, heißt es doch ursprünglich soviel wie „mißtönend“, dann auch „ungereimt, abgeschmackt, einen Widerspruch enthaltend“ (Genius, a. a. O.) bzw. „widersinnig, dem gesunden Menschenverstand entsprechend, sinnwidrig“ (Duden Fremdwörterbuch, a. a. O.). Einzig das vom Duden zuletzt noch angeführte Synonym „abwegig“ könnte passen, wenn Häberle unterstellen will, dass der Beweisführer für einen solchen Vorwurf die Argumente für seine Behauptung nur abseits von Logik, Vernunft und Realität finden könnte.
Neuerdings gibt es deutliche Anzeichen, dass das Gaddafi-Regime im Bürgerkrieg in Libyen Streubomben verwendet. Die libysche Führung bestreitet den Einsatz dieser international geächteten Munition. „Wir tun das nie“, wies Regierungssprecher M[o]ussa Ibrahim in der Hauptstadt Tripolis entsprechende Vorwürfe von Human Rights Watch zurück. Die Berichte seien „surreal“. (sueddeutsche.de v. 16. April 2011.) Dieses Adjektiv kommt bei Genius noch gar nicht vor; das Duden Fremdwörterbuch übersetzt: „traumhaft, unwirklich“ (a. a. O., S. 704). Könnten die Augenzeugen in Misrata den nächtlichen Hagelschlag tausender tödlicher Geschosse in den engen Straßen ihrer Stadt nur geträumt haben?
Interessant ist dabei ja, wie der libysche Regierungssprecher auf solch ein Wort überhaupt kommt. Zufällig stieß ich auf einen Bericht über eine Pressekonferenz des Gaddafi-Regimes Ende März, an der auch M[o]ussa Ibrahim teilgenommen hat. Die Autorin Lourdes Garcia-Navarro zitiert darin ihren Landsmann Don Macintyre, der Zeuge dieser unwirklich anmutenden Veranstaltung wurde: “There is something very surreal about sitting in Tripoli and hearing people talking about things that we actually know to be untrue, but having no access to the outside world […] That is a very surreal experience.” (In Libyan Capital, Reporters Encounter The Surreal; nach npr National Public Radio v. 30. März 2011.)
Vielleicht hat M[o]ussa Ibrahim diesen Radiobericht gehört und zahlt nun mit gleicher Münze heim, wie wir Kinder damals im Sandkasten: „Wer ’s sagt, der isses selber!“
Posted in Homo laber, Würfelwürfe | Comments Off on Wortgefechte im Sandkasten
Thursday, 14. April 2011

Geburtstag feiert man üblicherweise einmal im Jahr, wenn sich das kalendarische Datum der Geburt wiederholt – es sei denn, man gehört zu den traurigen Schaltjahrskindern vom 29. Februar, die sich damit trösten können, erst mit 72 volljährig zu werden.
Ich fragte mich jüngst, wieviele Tage ich eigentlich genau auf dem Buckel habe. Dies zu ermitteln ist nun etwas umständlich, muss man doch erstens wissen, wieviele Tage vom Jahr noch am eigenen Geburtstag übrig blieben und wieviele Tage bis heute vom laufenden Jahr bereits verflossen sind. Sodann muss man die Zahl der dazwischenliegenden Jahre mit 365 malnehmen. Und schließlich gilt es noch, die Schalttage dieser Jahre nicht zu vergessen.
Man kann sich solche Rechnereien erheblich vereinfachen, wenn man einen der zahlreichen Ewigen Kalender im Internet nutzt und mit diesem praktischen Hilfsmittel für alle fraglichen Tage das Julianische Datum ermittelt. Diese Zahl gibt die Anzahl der Tage an, die seit dem 1. Januar 4713 v. Chr. vergangen sind.
Das Julianische Datum von heute ist zum Beispiel 2.455.666 und das Julianische Datum meiner Geburt war 2.435.666 – zwischen beiden Daten gibt es also eine Differenz von exakt 20.000 Tagen. (Natürlich bin ich genau andersherum vorgegangen und habe vor ein paar Monaten errechnet, dass der 20.000ste Tag meines Lebens auf den heutigen 14. April 2011 fällt.)
Bei dieser Gelegenheit wurde mir bewusst, dass jeder Mensch höchstens drei solcher runden Julianischen Geburtstage erleben kann: in seinem 28., im 55. und zuletzt im 83. Lebensjahr. Ob mir letzteres vergönnt sein wird und ich den 30.000sten Tag meines Lebens noch erlebe? Immerhin weiß ich schon, auf welches Datum er fällt, nämlich auf den 30. August 2038, einen Montag. (Wer mir dazu gratulieren möchte, sollte sich dieses Datum schon einmal vormerken.)
Posted in Time Machine, Würfelwürfe | 2 Comments »
Friday, 08. April 2011

Die bittere Wahrheit über den Menschen ist unter den Menschen verständlicherweise wenig angesehen. Sie wenden sich ab von den Miesmachern, den Pessimisten, den Zynikern und verbuchen deren ätzendes Genöle unter Misanthropie, also als Krankheit. Dass vielleicht die Menschheit selbst die für den Rest der irdischen Schöpfung schlimmste Krankheit sein könnte, die Errettung dieser Restnatur nur durch die Ausrottung des ,Untiers‘ (Ulrich Horstmann) vielleicht noch möglich – diese naheliegenden Einsichten passen nicht in die Zeit. Haben wir nicht wahrlich schon genug Probleme mit unserer Existenzsicherung, als dass wir uns noch weitere aufhalsen könnten durch die Infragestellung unserer Existenzberechtigung?
Wir optimistischen Misanthropen müssen bescheidener sein: „Wer auch immer, aus Zerstreutheit oder aus Unzulänglichkeit, die Menschheit […] nur ein klein wenig in ihrem Vormarsch aufhält, ist ihr Wohltäter.“ Ein klitzekleinwinzig wenig tut man dies ja schon, wenn man sich selbst bremst, vom Marschschritt ins Schleichen verfällt, gar stehen bleibt und zurückschaut. (Ungefähr das ist es ja, was ich hier probiere.)
Doch ob dies Wenige und immer weniger Werdende genügt? Wohl kaum.
Der Philosoph Emile M. Cioran, den ich soeben zitiert habe und der heute vor hundert Jahren im siebenbürgischen Reschinar nahe Hermannstadt geboren wurde, faszinierte den jungen Mann, der ich 1979 war, durch seinen radical chic am Rande des Abgrunds. Spätestens seit seinem natürlichen Tod am 20. Juni 1995 scheinen mir die gebetsmühlenhaften Insinuationen von Ciorans Selbstmordabsichten entwertet, wie Spiegelfechtereien eines narzisstischen Poseurs.
Immerhin möchte ich seine Bücher in meinen wenigen verbliebenen Regalen (noch) nicht missen; am wenigsten seine Syllogismen der Bitterkeit, denen ich für heute einen weiteren Aphorismus entnehme: „Die Würde der Liebe liegt in der ernüchterten Zuneigung, die einen schleimigen Moment überlebt.“ (A. d. Frz. v. Kurt Leonhard. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1969, S. 54 & S. 89.) – um allerdings hinzuzufügen: … und deren Sinn im gleißenden Augenblick vor diesem Moment.
Posted in Memento, Würfelwürfe | Comments Off on Abgrund mit Schleimrand
Friday, 01. April 2011

Der reflektierte Egotrop von heute ist ein aufmerksamer Selbstprofiler. Was tue ich, was lasse ich? So setzt sich ein Autoporträt zusammen, das mal wie ein Scherbenhaufen, mal wie ein Wolkenwürfel anmutet.
Wie sehr ich abweiche, fast außerhalb nicht nur der Norm, sondern des Maßstabs der Normierung stehe, das wird mir immer dann bewusst, wenn wieder einmal der Mann von der Gebühreneinzugszentrale vor der Tür steht. „Sie haben ein Rundfunkgerät angemeldet.“ – „Ganz richtig, ein Gerät zum Empfang von Radioprogrammen. Aber kein Fernsehgerät. Wie ja Ihren Unterlagen da zu entnehmen ist.“ Aus diesen Papieren schaut er nun auf und mich an mit einem mimischen Mix aus Ironie, Trotz und Verbitterung: „Und einen Fernseher haben Sie natürlich keinen!?“ – „Ja und nein.“ Er ist für ein Momentchen irritiert, bis ich das Rätsel löse. „Ich habe tatsächlich kein Fernsehempfangsgerät. Aber nicht ,natürlich‘! Denn dieses Nichthaben ist ja, im heutigen Sinne von ,natürlich‘ als Synonym von ,normal‘, ganz im Gegenteil eher äußerst unnatürlich. Allerdings habe ich einen Personal Computer mit Zugang zum World Wide Web. Aber dessen Nutzung ist, wie Sie wissen, bisher noch durch meine Radiogebühr abgegolten.“ Zerknirscht zieht der freiberufliche Schnüffler von dannen.
Ich habe auch kein Auto, nicht mal eine Fahrerlaubnis. Dennoch bin ich mobil in einem für mein Wohlbefinden erforderlichen Radius, weil ich die öffentlichen Verkehrsmittel als Schwerbehinderter mit Gehbehinderung zum Tarif von fünf Euro monatlich nutzen kann. Fernreisen möchte ich nicht mehr unternehmen. Vielleicht werde ich einmal alle meine Reisen der vergangenen fünfzig Jahre hererzählen, dann wird man verstehen, warum ich diese Scheinabwechslung nicht entbehre. Reisen bildet? Die Reiseberichte, die ich von meinen Mitmenschen gelegentlich zu hören bekomme, zwingen mich ein ums andere Mal zu anderen Schlussfolgerungen. Auch sonst leiste ich mir einen beneidenswerten Luxus, was Unabhängigkeit von Apparaten betrifft. Ein Handy zum Beispiel habe ich schon deshalb nicht, weil meine Aufmerksamkeit beim Flanieren ganz meiner unmittelbaren Umgebung gelten muss und ich beim sinnlichen Genuss dieser Sphäre keine Störung vertrage.
Daheim erreicht mich wer immer will per Festnetz oder E-Mail. Beide Formen des Austauschs sind mir angenehm. Ich vermisse übrigens auch die klassische Korrespondenz auf Briefpapier durchaus nicht, denn ich verfasse meine elektronischen Mitteilungen mit der gleichen, von Jugend auf gewohnten Gründlichkeit. Dies betone ich an die Adresse jener, die mich für einen verschrobenen Romantiker halten. Es geht mir stattdessen immer nur um Zweckmäßigkeit.
Das Internet nutze ich intensiv. Mein Lesezeichen-Menü bei Firefox ist überaus reichhaltig und wohl strukturiert. Diese Navigationshilfe wird kontinuierlich ergänzt und in regelmäßigen Intervallen bereinigt, eine Routine, die für mich längst zum Handwerk des Schreibens gehört wie die Lektüre der Tageszeitung, das Buchlesen, Gespräche mit Vertrauten, Film- und Museumsbesuche, Spaziergänge in der Natur, Nichtstun. Worauf ich wiederum bewusst verzichte, das ist die Teilnahme an sozialen Netzwerke à la Facebook & Co. Das sind nach meiner Beobachtung reine Zeitfresser und Illusionsfabriken für einsame Seelchen. Ich habe nicht nötig, Reklame für mich zu machen. Ich bin, was ich bin, mehr nicht und nicht weniger. Wer mich sucht, wird mich finden.
Posted in Unica, Würfelwürfe | Comments Off on Selbstprofiling
Tuesday, 29. March 2011

Sonnenaufgang bei klarem Himmel. Es war ein Tag wie jeder andere. Ein eher freundlicher Märztag mit Temperaturen zwischen 2 °C und 11 °C. Um kurz nach sechs Uhr Ortszeit ging die Sonne auf. Die Erwachsenen fuhren zur Arbeit, die Kinder machten sich auf den Weg zur Schule. Nichts deutete darauf hin, dass eine Katastrophe unmittelbar bevorstand, die tausende Bewohner des Landes das Leben kosten, zehntausende obdachlos machen und eine noch unbekannte Zahl von Menschen, möglicherweise auch weit außerhalb der Grenzen des Landes, dem Risiko lebensbedrohlicher Gesundheitsgefährdungen aussetzen würde.
Aber noch ist es nicht soweit. Noch ahnt kein Mensch das kommende Unheil. Noch gehen alle beflissen ihren gewohnten Alltagstätigkeiten nach. Es ist ein Freitag, das Wochenende steht bevor. So sind die Menschen vielleicht etwas entspannter als an den anderen Tagen der Arbeitswoche. Es kann angenommen werden, dass viele eine zarte, wohlige Vorfreude auf die Ruhepause empfinden, die sie erwartet, aller Wahrscheinlichkeit nach, sofern denn nichts Unvorhersehbares dazwischenkommt. Doch in wenigen Stunden wird genau dies geschehen.
Das Magazin der Süddeutschen zeigt zwei Wochen später genau 50 Fotos, die in den acht Stunden zwischen Sonnenaufgang und ,Weltuntergang‘ entstanden sind. Es sind die Bilder einer alltäglichen Normalität, die durch das Wissen um diese ,Pointe‘ nicht mehr mit unschuldigem Blick wahrgenommen werden können. Genau dieser gruselige Schauder ist es ja, worauf die Magazinredaktion abzielt. Man kann geteilter Meinung sein, ob diese Bildstrecke eine zwar provozierende, aber doch zum Nachdenken anregende journalistische Meisterleistung ist; oder ob wir es hier mit einem geschmacklosen Tabubruch zu tun haben, mit dem riskanten Vorstoß in eine ethische No-go-Area.
Ich stelle mir vor, dass das Heft einem japanischen Opfer in die Hände fällt, vielleicht noch unter dem unmittelbaren Eindruck der Verheerungen. Unmöglich ist das ja keinesfalls. Vielleicht sind Menschen aus den vom Tsunami betroffenen Gebieten nach Tokio geflohen. In großen Zeitschriftenläden der Hauptstadt wird man vielleicht die Süddeutsche kaufen können. Wie mag es auf einen solchen Betroffenen wirken, wenn er sieht, mit welchen eleganten Gedankenspielen sich die deutschen Zeitgenossen unterhalten, die sich im viele tausend Kilometer entfernten Europa halbwegs sicher fühlen? Ich bemühe mal einen Vergleich, wohl wissend, dass ich damit über Unvergleichliches spekuliere: Wie ist jemandem zumute, dem man das Foto eines fröhlich lachenden Angehörigen zeigt, aufgenommen unmittelbar vor dessen unvorhersehbarem Unfall mit tödlichem Ausgang?
Gestern wurde ich unfreiwilliger Zeuge eines Gesprächs zwischen zwei Damen meines Alters im Bus. Sie unterhielten sich über die Kernschmelze im Kraftwerk Fukushima-Daiichi. Die Wortführerin sagte aber immer ,Fukujama‘ statt ,Fukushima‘. Das ist verzeihlich, schließlich ist der Ortsname ja erst neuerdings Präsent in allen Medien. Der Versprecher erinnerte mich aber an folgende Geschichte von Günther Anders: „Die Existenz gewisser Städte wird uns erst dann bekannt, wenn diese durch ein Erdbeben zerstört worden sind. ,Nicht anders‘, heißt es in den Molussischen Theologoumena, ,wird es auch unserer Welt gehen. Erst dann werden die Götter etwas von uns erfahren, wenn sie im Himmlischen Morgenblatt die Notiz über unseren Untergang finden werden. ,Wie hieß der Platz?‘ wird der Gott Bamba beim Frühstück seine ihm aus der Zeitung vorlesende Frau fragen. – ,Welt oder so, glaube ich.‘ – ,Namen gibt es!‘ wird Bamba dann ausrufen. – Und außer in diesem sofort wieder vergessenen Gespräch wird unser niemals gedacht worden sein.“ (Namen gibt es; aus: Der Blick vom Turm; hier zit. nach: Das Günther Anders Lesebuch. Hrsg. v. Bernhard Lassahn. Zürich: Diogenes Verlag, 1984, S.87.)
[Titelbild: Ausschnitt aus einer Abbildung im hier besprochenen Süddeutsche Zeitung Magazin Nr. 12 v. 25. März 2011, S. 48/49.]
Posted in Time Machine, Würfelwürfe | Comments Off on 38°19′19″ N 142°22′8″ O 14:46:23 Uhr
Friday, 25. March 2011

Das Heftchen vom Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk habe ich mir bisher noch nie von innen angesehen. Da wir den Stromanbieter nach einem halben Jahrhundert konkurrenzlosem RWE-Zwangsbezug vor einiger Zeit gewechselt haben, interessiert mich herzlich wenig, was der heimische Energie-Gigant zur Pflege seines Images auf bunte Seiten druckt. So wanderte das 20 Seiten starke RWE MAGAZIN, das seit 2008 dreimal jährlich erscheint, in unserem Haushalt bislang regelmäßig zum Altpapier.
Nun habe ich aber diese Rubrik aufgemacht und beschlossen, vor der Entsorgung wenigstens einen kritischen Blick in jede unverlangte Postwurfsendung zu riskieren. Und zudem wollte ich wissen, ob denn wohl die RWE AG, einer der vier Betreiber von Kernkraftwerken in Deutschland, nach der Katastrophe in Fukushima ihren Kunden zu diesem heiklen Thema etwas mitzuteilen hat. So blätterte ich das Heftchen zunächst durch, um mir einen oberflächlichen Eindruck zu verschaffen. Da geht es nun also um Anregungen zum Energiesparen in privaten Immobilien, um neue Podukte aus dem Energieeffizienz-Shop von RWE, um die tollen Vorteile beim Shoppen mit der RWE-Card und die ersten E-Autos von Mitsubishi und Citroën, von denen sich RWE ein exklusives Kontingent für seine Stromkunden gesichert hat. Ein paar beruhigende Worte zur Gefahr eines Super-GAUs in Deutschland? Fehlanzeige.
Ich wollte meine Suche nach einer Stellungnahme zu den denkbaren Risiken der „sauberen“ Energie aus dem Hause RWE schon aufgeben, als mein Blick auf der letzten Seite plötzlich auf das Bild einer Welle im kitschigen Goldrahmen fiel [s. Titelbild © RWE Vertrieb AG]. Ganz richtig, das ist der berühmte Farbholzschnitt des japanischen Künstlers Hokusai, der im Zusammenhang mit dem katastrophalen Tsunami an der japanischen Ostküste schon in manch anderen Presseartikeln reproduziert wurde. Hier jedoch steht das Bild in einem völlig anderen Zusammenhang.
Wissenswertes über Wellen heißt die Folge der Reihe „Schlau in 30 Sekunden“, die uns die Redaktion des RWE MAGAZINs in aller Unschuld zumutet. Auf dieser Seite erzählen uns die pfiffigen Blattmacher allerlei Wissenswertes über die Neue Deutsche Welle, die La-Ola-Welle, die Dauer-, die Mikro- und die Sinuswelle – um schließlich auf den Punkt zu kommen und uns einen weiteren Trumpf im umweltschonenden Energiegewinnungs-Spiel ihres Arbeitgebers vorzustellen: das Wellenkraftwerk.
Wer empört sich da über eine vermeintliche Geschmacklosigkeit? Honi soit qui mal i pense! Das Heft war am 11. März, als die Riesenwelle das todsichere Atomkraftwerk in Japan zerdepperte, längst fertig layoutet und auf den Weg gebracht, womöglich bereits gedruckt. Und überhaupt: Das zeichnet ja gerade einen innovativen Energiekonzern aus, schon heute in die Stromerzeugungsutopien von übermorgen zu investieren. Der Tsunami vor Japan hat uns doch vorgeführt, was für eine Power in solchen Wellen stecken kann. Man muss sie nur zu bändigen wissen. Und für dieses Know-how haben wir ja unsere Spezialisten beim RWE.
Posted in Oikos, Würfelwürfe | Comments Off on Briefkastenmüll (III)
Wednesday, 23. March 2011

Ich staune immer wieder über die Reaktionen meiner Mitmenschen in kurzfristig brenzligen globalen Krisenmomenten wie dem jüngsten Doppelknall in Japan und Libyen: Ist das denn nicht seit einem guten Jahrhundert jedem wachen Geist längst deutlich geworden, dass wir auf einen Untergang zusteuern? Offenbar nicht – oder es gibt nur sehr wenige wache Geister.
Ein Blick zurück über ein halbes Jahrhundert. Am 25. Mai 1960 schrieb Jean Améry aus Brüssel an seinen Freund Ernst Mayer, in einem historischen Moment, als man kurz aufatmen durfte, weil der Stalinismus überwunden schien: „Nein, Krieg, den grossen ,shooting war‘, den A- und H-Bombenkrieg wird es wohl nicht geben, so lange China nicht in der Lage ist, ihn vom Zaune zu brechen. Nicht die SU [Sowjetunion] ist die Gefahr – sie war es auch 1948 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges nicht! – sondern das östliche Riesenreich mit seinen 700 Millionen Menschen und seinem entsetzlichen weltrevolutionären und neuerdings auch industriellen Elan. In China sehe ich – ich, der ich nie an den Krieg glaubte! – eine echte Drohung.“ (Jean Améry: Ausgewählte Briefe 1945-1978. Stuttgart: Klett-Cotta, 2007, S. 91.)
Der wache Geist lässt sich eben auch von einer Tauwetter-Periode nicht einschläfern und sieht am Horizont noch ganz andere Gefahren aufdämmern. In den vergangenen fünfzig Jahren hat sich die damals schon bedrohliche Zahl von 700 Millionen übrigens fast verdoppelt! Heute schicken sich 1.350 Millionen Chinesen an, die Maslowsche Bedürfnispyramide zu erklimmen, und beanspruchen ihr gleiches Recht auf Ernährung, Gesundheit, Wohlstand, Fortschritt, Wachstum, Sicherheit, Unterhaltung, Bildung und Selbstverwirklichung. (Interessant übrigens, dass Améry schon damals einen ,industriellen Elan‘ im Reich der Mitte bemerkte, wo es uns doch heute so erscheint, als habe diese Entwicklung dort erst in neuerer Zeit begonnen.)
Wie wäre es wohl um China und den Rest der Welt bestellt, wäre dort nicht Anfang der 1980er-Jahre die Ein-Kind-Politik eingeführt worden? Diese Frage sollte man sich aber tunlichst verkneifen, will man nicht einen beflissenen Vortrag über die katastrophalen sozialen Folgen dieser fatalen Restriktion zu hören bekommen. Überhaupt kommt das globale Wachstum der Bevölkerung im Spektrum der diversen Untergangsszenarien von ,Atomkrieg‘ über ,Globale Erwärmung‘ bis hin zu ,Wasserverknappung‘ merkwürdigerweise gar nicht mehr vor, obwohl es doch nahe liegt, hierin wenn nicht die Ursache, so doch das entscheidende Treibmittel für alle übrigen Probleme der Menschheit zu sehen. Ein Denktabu?
Das Wort von der ,Bevölkerungsexplosion‘ ist jedenfalls völlig aus der Mode gekommen, was aber nicht weiter schlimm ist, denn inzwischen ist es ohnehin eher angebracht, von einer ,Bevölkerungsimplosion‘ zu sprechen. Zur Erklärung: Bei einer Explosion verbreitet sich die Druckwelle von innen nach außen, bei der Implosion hingegen umgekehrt, von außen nach innen. Und wenn man die weltweite Bevölkerungsentwicklung im vergangenen Jahrhundert betrachtet, so wird sie ja begleitet von einer zunehmenden Urbanisierung, also einer rasanten Zunahme der Siedlungsdichte des Menschen. Wir erleben also einen gleich in zweifacher Hinsicht logarithmisch wachsenden Bevölkerungsdruck. Wie sollte das nicht in eine globale Katastrophe münden?
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Aus dem Zusammenhang gerissen (I)
Sunday, 20. March 2011
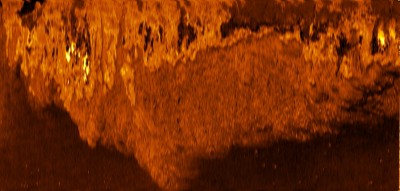
Ich war in der vergangenen Woche verstimmt. Manchmal ist es besser, zu schweigen. Das sieht man nachträglich an jenen, die die Klappe einfach nicht halten können. Um mich vorsichtig wieder ans Bloggen heranzutasten, beginne ich mit zwei Zitaten zu diesem Thema.
Das eine stand in der WAZ in der Rubrik „Zitate des Tages“ und fiel mir beim Erfassen meiner Bücher fürs Versandantiquariat entgegen, auf einem undatierten Zeitungsausschnitt, viereinhalb mal fünfeinhalb Zentimeter groß, wohl ziemlich genau 30 Jahre alt. Es spricht der Vorstandsvorsitzende der VEBA AG, Rudolf von Bennigsen-Foerder: „Der weitaus überwiegende Teil der Bevölkerung dürfte kein Verständnis dafür haben, wenn die Maschinenstürmer unserer Zeit aus ideologischen oder weltfremden Motiven alles, was wir bisher erreicht haben – unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung, unsere Wirtschaftsordnung – aufs Spiel setzen.“
Bennigsen-Foerder ist seit gut zwei Jahrzehnten tot. Sonst könnte man ihn fragen, ob er nicht jetzt erkenne, dass er durch seine Energiepolitik weit mehr aufs Spiel gesetzt hat als nur die von ihm hier angeführten Werte? Und ob er nicht einsehen müsse, dass wir es vor allem jenen von ihm verhöhnten ,Maschinenstürmern‘ zu verdanken haben, wenn in Deutschland immerhin vergleichsweise strenge Sicherheitsnormen für AKWs durchgesetzt wurden? Aber man darf ja nicht daran erinnern, dass man ,es‘ schon immer wusste. Vornehm geht die Welt zugrunde!
Das andere Zitat entnehme ich dem Interview, das Christa Wolf der ZEIT gewährt hat, aus gegebenem Anlass und trotz ihrer anfänglichen Unlust. Denn gleich eingangs bekennt sie, dass ihre Hoffnung geschwunden sei, mit dem, was man nach so einer Katastrophe sagen könne, irgendetwas zu bewirken. Leider verrät sie uns Lesern, deren Zeit sie ja nun in Anspruch nimmt, die Beweggründe nicht, warum sie dann doch Rede und Antwort stand. (Ich hätte da so ein kleines mickeriges Motiv im Angebot. Aber was soll ’s?) Viel schlimmer ist das hilflose Gefasel, das die „Expertin für den Weltuntergang“ von sich gibt (So nennt die ZEIT sie tatsächlich im Untertitel; ob allen Ernstes oder mit respektloser Ironie, das bleibe dahingestellt.)
Eine Kostprobe. Auf die Frage, wie einer Menschheit zu helfen wäre, die aus ihren Fehlern nichts lernt, antwortet Christa Wolf: „In Japan scheinen die Menschen unendlich technikgläubig zu sein. Man müsste sie fragen: Was ist eigentlich das Ziel unseres Daseins? Momentan wohl Profit, den wir in einem tödlichen Wettkampf zu erlangen versuchen. Die Utopien unserer Zeit treiben Monstren hervor. Aber das ist den meisten Menschen nicht bewusst, denn sie leben ja mitten in ihrer Zeit und können sich aus dem Hamsterrad des Fortschritts nicht lösen. Vielleicht kann ein Unglück wie dieses doch ein Nachdenken über andere mögliche Wege anstoßen. Aber wie soll man all die Menschen in eine andere Richtung lenken? Dafür reicht meine Fantasie nicht aus. Der Forscherdrang hat sich immer weiter in diese eine Richtung entwickelt: Was machbar ist, wird gemacht. Und wenn ein Land aus moralischen Gründen etwas nicht macht, macht es das andere. Und weil beide das voneinander wissen, machen sie weiter. Wir schaffen es einfach nicht, diese Entwicklung, die wir ,Fortschritt‘ nennen, zu bremsen.“ („Bücher helfen uns auch nicht weiter“; in: DIE ZEIT Nr. 12 v. 17. März 2011, S. 53.) Hat die bürgerliche Presse in diesem Land denn jede Ehrfurcht vor dem Alter verloren, dass sie es zulässt, wenn sich eine einst hoch angesehene Autorin mit solchen faden Gemeinplätzen, unausgegorenen Halbwahrheiten und albernen Stoßseufzern blamiert? – Dann doch lieber weiße Seiten, Leere und Schweigen.
Posted in Homo laber, Würfelwürfe | Comments Off on Zwei Zitate
Monday, 14. March 2011

Besondere Umstände verlangen nach ungewöhnlichen Maßnahmen! Ausnahmsweise halte ich mich einmal nicht an die vom Künstler vorgegebene Reihenfolge. Der Zufall will es nämlich, dass dieses Bild (und vielleicht sogar der zugehörige Text) zur aktuellen Weltlage zu passen scheint. Jedenfalls drängt sich mir diese Parallele auf. Da ist ein dubioses Behältnis geborsten, groß und gelb und vielleicht heiß wie die Sonne. Vor dem Unfallreaktor liegt ein menschliches Opfer, wie vom Schlag getroffen. Die Person, die einen silbergrauen Overall trägt, vermutlich einen Schutzanzug gegen gefährliche Strahlung, hat ihre Maske verloren. Oder gar ihr Gesicht? Ein Rinnsal läuft ihr über die Brust und vereint sich mit einem ebensolchen Blutsturz, der dem Leck im Mantel des Kugelturms entweicht.
Nun weiß ich, da ich die gesamte Linolschnitt-Sammlung kenne, dass die sieben Bilder XIV bis XX einen geschlossenen Zyklus bilden, in dem maskierte Asiaten (oder jedenfalls Menschen mit asiatisch anmutenden Masken) vorkommen. Und vielleicht hat diese Übereinstimmung – ich spreche von der Krise in Fukushima – meine Gedankenverbindung befördert. Dieser Zufall ist aber insofern lehrreich, als er uns daran erinnert, dass wir immer, bei der Interpretation von Kunst so gut wie bei der Interpreatation der Wirklichkeit, von unserem augenblicklichen Erleben abhängig sind.
Deutlicher gesagt: Auf einer Bank an der Seepromenade sieht man einen Sonnenuntergang mit anderen Augen als ohne Schwimmweste mitten im Atlantik nach einem Schiffsuntergang.
„Keine Reifung ohne Krise“. – Das ist so ein rechter Trost-Spruch, wie man ihn sich gern bei schwerem Seegang an den Mast heftet. Es gibt noch ein paar ähnliche vom gleichen Kaliber: „Was mich nicht umbringt, macht mich nur desto stärker.“ – „Ohne Fleiß kein Preis.“ – „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.“ – „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern.“ – „Augen zu und durch.“ Man könnte solche Sentenzen auch als Durchhalteparolen bezeichnen. Aber der hier zur Diskussion stehende Satz geht noch ein Schrittchen weiter.
Keine Reifung ohne Krise? Dieser Satz tröstet den Hoffnungslosen, der in der Krise steckt und kein Land mehr sieht, mit der versöhnlichen Aussicht, dass diese kritische Zeit nicht nur irgendwann ein Ende findet, sondern dass der Geprüfte auch gewandelt, geläutert, gebessert, eben: gereift daraus hervorgehen wird. Und mehr als das! Der Satz behauptet, dass sich dieser Erfolg nur auf dem Weg durch die Prüfungen der Krise erreichen lässt. (Allerdings wirkt auf mich das Bild diesmal wie ein höhnischer Kommentar zu diesem munteren Satz, denn die niedergestreckte Person sieht so gar nicht danach aus, als könnte sie sich noch einmal berappeln und sogar gestärkt aus dem Unfall hervorgehen. – Aber warten wir ab, wie die übrigen vier Bilder dieses Zyklus aussehen.)
Posted in Heinrichs Testament | Comments Off on Heinrich Funke: Das Testament (XIX)
Sunday, 13. March 2011

Neben meinem Sonntagsfrühstücksei liegt die Süddeutsche. Mein Blick fällt auf ein großes Bild im Wirtschaftsteil. Lacht die Kanzlerin? Angesichts dieser grauenhaften Katastrophe in Japan, mit noch unabsehbaren Folgen für die ganze Erde? Was gibt es denn da zu lachen? Möglicherweise irgendwelche Vorteile, die der deutschen Wirtschaft … Ach, was! Die Zeitung ist ja von gestern, das Foto (© Reuters) gar von vorgestern. Es entstand auf dem Sondergipfel der 17 Euro-Länder in Brüssel, bei dem sich Angela Merkel in „Jubelpose“ zeigen durfte, so die Financial Times. Das war einmal. Jetzt ist wieder Betroffenheitspose angesagt. Das Mienenspiel unserer Politiker hat die Authentizität von Verkehrsampeln.
Neulich habe ich die Bundeskanzlerin schon einmal beim Lachen beobachten können. Da saß sie auf ihrem Stuhl im Deutschen Bundestag und hörte sich die Rede von Sigmar Gabriel an, der den noch amtierenden Verteidigungsminister zu Guttenberg unter Beschuss nahm. Dann machte Gabriel seiner Rivalin ein paar Komplimente. „Ich habe Sie als jemanden kennengelernt,“ so der Parteivorsitzende der SPD, „der, na klar, machtbewusst ist. Das ist keine Frage. Aber ich habe Sie nie als machtvergessen und auch nie als machtversessen erlebt.“ Merkel rutschte unruhig auf ihrem Stuhl hin und her, aber sie machte gute Miene zu bösem Spiel. Oder wie soll ich ihr Lachen bezeichnen? Sie lacht wie eine Debütantin auf dem Wiener Opernball, die der alte Richard „Mörtel“ Lugner mit seinem Küss-die-Hand bedrängt. Aber zugleich wird klar, dass sie Gabriel kein Wort glaubt. Dass sie nicht anders kann, als dessen Vortrag für ein machiavellistisches Schauspiel zu halten. Und noch eine Schicht tiefer unter dieser fingerdicken Camouflage gibt es vielleicht einen kleinen Zweifel, ob Gabriel es nicht etwa doch ausnahmsweise einmal ernst meinen könnte. Aber die Maske hält dicht.
Gestern sind Merkel und Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) vor die Presse getreten und haben Statements zum Erdbeben in Japan abgegeben. Je fürchterlicher die Ereignisse sind, die es in solchen Statements zu kommentieren gilt, desto unglaubwürdiger werden die Betroffenheitsbezeugungen, die vom Stapel gelassen werden. Welcher fleißige Sprachkritiker untersucht einmal Katastrophen-Statements von Politikern speziell im Hinblick auf die Frage, mit welchen Mitteln darin Betroffenheit geheuchelt wird? Ich wage die Behauptung, dass das Repertoire, auch im internationalen Vergleich, beschränkt ist auf ein knappes Dutzend der immer wieder gleichen Versatzstücke.
Ein wesentliches Element des Betroffenheits-Baukastens betrifft den Punkt, ob auch Landsleute unter den Opfern sind. Dieses Bauklötzchen stellte gestern Westerwelle auf den Konferenztisch: „Ich kann Ihnen sagen, dass wir bisher glücklicherweise keine Hinweise darauf haben, dass sich auch deutsche Staatsangehörige unter den Opfern befinden. Ausschließen kann ich das aber nicht, denn wir konnten noch nicht mit allen den Kontakt aufnehmen. Wir hoffen natürlich das Beste, aber wir können leider auch das nicht ausschließen.“ Wenn das eine Nachricht an die Adresse deutscher Angehöriger sein soll, die noch kein Lebenszeichen von ihren Verwandten in Japan erhalten haben, dann wäre sie besser unterblieben. Und wenn man mir unterstellt, dass mir ein deutsches Opfer in Japan mehr zu Herzen geht als ein japanisches, dann frage ich mich, was für ein bornierter, überlebter Nationalismus sich da kundtut. Ich dachte, wir leben in einer globalisierten Welt?
Zudem sind es natürlich zwei ganz andere Sorgen, die die deutsche Bevölkerung beunruhigen. Erstens: Kann die radioaktive Strahlung aus den undichten Kernreaktoren bis nach Deutschland gelangen, über eine Distanz von 9.300 Kilometern Luftlinie? (Zum Vergleich: Tschernobyl war „bloß“ 1.600 Kilometer weit weg.) Dazu die studierte Physikerin Merkel: „Ich habe mich darüber mit den Experten des Bundesumweltministeriums natürlich genau unterhalten und mich informieren lassen. Ich darf Ihnen sagen: Es ist nach menschlichem Ermessen nicht vorstellbar, dass Deutschland von den Auswirkungen des Unglücks in Japan betroffen sein könnte. Wir sind zu weit davon entfernt. Aber ich will dennoch sagen: Natürlich ist Japan uns nahe.“ Welch feinsinniges Wortspiel! – Zweitens: Kann deutschen Kernkraftwerken ein ähnlich folgenreiches Unglück zustoßen? Dazu Merkel: „Wir wissen, wie sicher unsere Kraftwerke sind. Wir wissen, dass wir weder von derart schweren Erdbeben noch von derart gewaltigen Flutwellen bedroht sind. […] Ich finde, an einem solchen Tag darf man nicht einfach sagen: Unsere Kraftwerke sind sicher. Sie sind sicher, aber trotzdem muss man nachfragen: Was ist aus einem solchen Ereignis zu lernen? Auch wenn wir keine Anhaltspunkte dafür haben, dass unsere Kraftwerke nicht sicher wären, können wir trotzdem immer noch dazulernen.“ Man könnte zum Beispiel aus den aktuellen Ereignissen in Japan lernen, dass man immer vom Schlimmsten möglichen Ereignis ausgehen sollte, wenn man sich domestizierte Atombomben in die Landschaft stellt. Beispielsweise von der Möglichkeit, dass morgen ein paar islamistische Fanatiker in ganz Europa mehrere Passagierflugzeuge entführen und jene AKWs ansteuern, von denen bekannt ist, dass ihre Hülle dem Aufprall eines Jumbojets nicht standhält. Auf dieses konkrete Risiko-Szenario sind nämlich die Verantwortlichen in Politik und Energiewirtschaft bis heute jede Antwort schuldig geblieben. Aber Guido Westerwelle drischt jetzt Aktivismus-Phrasen und hat vor allem eine Sorge: „Jetzt muss gehandelt werden, jetzt muss geholfen werden, und jetzt sollten keine parteipolitischen Debatten im Vordergrund stehen.“ Man müsste lachen, wenn es nicht so tragisch wäre, diesen deutschen Außenminister an seinen Herausforderungen nicht wachsen, sondern vielmehr immer noch kümmerlicher werden zu sehen. Immerhin rutscht der Kanzlerin unter all den Betroffenheitsbekundungen und Handlungsbeteuerungen ein wahrer Nebensatz raus, aber der ist hier natürlich aus dem Zusammenhang gerissen und war ganz anders gemeint: „[…] wir sind auch nicht ganz dicht dabei, […].“
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Nicht ganz dicht
Saturday, 12. March 2011
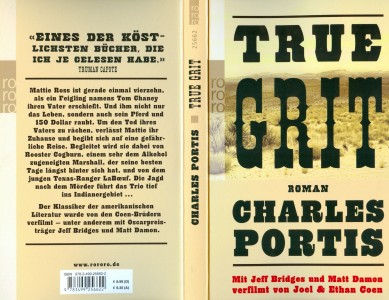
Gestern habe ich die soeben erschienene Taschenbuchausgabe von True Grit gekauft. Dabei verstieß ich gleich mehrfach gegen meine Grundsätze. Eigentlich will ich nämlich keine neuen Bücher mehr kaufen, wenn es ältere Ausgaben von ihnen auf dem Antiquariatsmarkt gibt, denn die sind in aller Regel billiger und dazu noch solider gefertigt. Sodann will ich, wenn eben möglich, kein gelumbecktes Taschenbuch von einem Titel kaufen, den es auch in einer ordentlich gebundenen, fadengehefteten Edition gibt. Und zudem will ich keine Bücher mehr in den Filialen der Buchhandelsketten wie Thalia oder Mayersche kaufen, sondern die ambitionierten kleinen Buchhandlungen wie proust unterstützen. In diesem Fall machte ich eine Ausnahme, weil ich das Buch an diesem Wochenende lesen wollte, solange nämlich der Eindruck der beiden Verfilmungen (von Henry Hathaway bzw. Joel und Ethan Coen) noch frisch ist.
Das Buch, das ich nun in Händen halte, nennt sich im Impressum ,überarbeitete Neuausgabe‘, basierend auf der ersten deutschen Übersetzung Die mutige Mattie, die 1969 erschien; die Redaktion lag in den Händen von Isabell Trommer. Nun wüsste ich ja doch gern, welche Änderungen bei dieser Überarbeitung für nötig gehalten wurden. So heißt es etwa gleich zu Beginn des Buches: „Ehe Papa nach Fort Smith aufbrach, sorgte er dafür, dass ein Schwarzer namens Yarnell Poindexter jeden Tag das Vieh fütterte […].“ (Charles Portis: True Grit. A. d. Am. v. Richard K. Flesch. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2011, S. 9.) Streng genommen wäre die politisch korrekte Bezeichnung dunkelhäutiger Personen ja heute „ein Farbiger“ gewesen. Aber vielleicht lautete es in der Erstausgabe der Flesch-Übersetzung ja, noch schlimmer: „ein Neger“? Dann hätte sich Isabell Trommer mit „ein Schwarzer“ gewissermaßen für eine Kompromiss-Version entschieden. (Mich würde nicht einmal wundern, wenn es im amerikanischen Original von Portis an dieser Stelle gar „a nigger“ heißt, denn die Geschichte wird Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts von einer Greisin erzählt, für die die Bezeichnung Nigger für einen Mann schwarzer Hautfarbe noch ganz selbstverständlich und nicht diskriminierend gemeint war. Zudem erhält der Leser wenig später (ebd., S. 52) Einblick in die menschenkundlichen Auffassungen der Erzählerin, wenn sie zum Beispiel sagt: „Es heißt, Creek-Indianer seien gute Indianer, aber Creek-Blut mit weißem Blut gemischt oder auch mit Negerblut – das sei etwas anderes.“ Ein solcher Mischling ist der Gangster, angesichts dessen Mattie Ross urteilt: „Wenn es je einen Mann gab, dem Mord und Totschlag ins Gesicht geschrieben waren, dann war es Odus Wharton.“)
Woraus ich nicht schlau wurde, nachdem ich beide Filme gesehen hatte, das war der Name des Texas-Rangers. In den Synchronisations-Fassungen klingt er wie ,La Bief‘, aber in den Besetzungslisten bei Wikipedia steht ,La Boeuf‘ (und in der französischen Wikipedia gar ,LaBœuf‘). Wie passte das zusammen? Im Roman gibt der Namensträger selbst hierüber folgenden Aufschluss: „,Mein Name ist LaBœuf‘, sagte er. Er sprach es aus wie LaBief, aber dann buchstabierte er es.“ (Ebd., S. 65.) Solche Feinheiten bleiben eben selbst bei der treuesten Verfilmung auf der Strecke.
Dass sich die Coens aber das folgende Detail haben entgehen lassen, begreife ich nicht. In einer langen, kalten Nacht in der Wildnis hält Rooster Cogburn die völlig erschöpfte Mattie mit seiner Lebensgeschichte bei Laune, gespickt mit pittoresken Kapriolen wie dieser: „Er sagte, er kenne eine Frau in Sedalia, Missouri, die sich als Mädchen eine Nadel in den Fuß getreten habe, und neun Jahre später sei sie aus dem Oberschenkel ihres dritten Kindes wieder herausgekommen. Die Ärzte seien sehr erstaunt gewesen.“ (Ebd., S. 141.) Das sind doch Geschichten von der Art, wie sie einem noch Jahrzehnte später wieder einfallen, wenn das Gespräch auf ein Buch kommt, von dem man den ganzen Rest vergessen hat. Aber in einem Film finden sie eben keinen Paltz. Einwandfrei haben aber die Coens wesentlich mehr Einzelheiten aus dem Roman in ihren 110 Filmminuten untergebracht als Hathaway seinerzeit, obwohl Der Marshal noch 18 Minuten länger ist. Allerdings nehmen sie es mit der Wahrhaftigkeit gegenüber der Vorlage auch nicht immer sehr genau. Ein Beispiel für viele: Scheinbar völlig mutwillig tritt Rooster im Film die beiden Indianerjungen vor Bagbys Laden gleich zweimal von der Verandabrüstung in den Dreck. Bei Charles Portis ist dies aber die gerechte Strafe für die Gehässigkeit der beiden, die sich an den Qualen eines Maultieres weiden, das von einem Strick um den Hals stranguliert wird (vgl. ebd., S. 107). Ganz unbedeutend ist diese Kleinigkeit ja nicht, denn ich erinnere mich noch gut, dass ich dem Film-Marshall für sein Verhalten in dieser Szene einen Minuspunkt verpasste, während nun der Buch-Marshall im Gegenteil einen Pluspunkt bekommt. [Nachsatz vom 16. März 2011: Hier irrte ich. Mein Sohn V. und dessen Freund D., die beide die Coen-Verfilmung vor wenigen Tagen gesehen haben, erklärten unabhängig voneinander auf meine Frage, warum Rooster die beiden Indianerjungen von der Verandabrüstung schmeiße: „Weil sie das Pferd geärgert haben.“ Offenbar muss ich für einen Augenblick abgelenkt gewesen sein, wie übrigens auch meine sonst sehr aufmerksame Gefährtin, die sich ebenfalls an kein Pferd (resp. Maultier) vor der Veranda erinnern kann. Dies ist ein neuerlicher Beweis, wie trügerisch unsere Wahrnehmung allgemeinist, und speziell auch unsere Kunstwahrnehmung – und wie zweifelhaft damit unser Urteil.]
Noch ein Wort zur aufgewandten Zeit für Film- bzw. Buchgenuss. Der Unterschied ist doch geringer, als allgemein angenommen. Zwei Sunden kosteten mich jeweils die beiden Verfilmungen, Fahrtzeit zum Kino und zurück nicht gerechnet. Das Buch habe ich in gut vier Stunden gelesen. – Meine Empfehlung lautet: Es lohnt sich unbedingt, nach einem Kinobesuch zur Buchvorlage zu greifen, so es denn eine gibt. Der Vergleich ist interessant, schärft die Aufmerksamkeit sowohl für zukünftige Filmbetrachtung als auch fürs Lesen und schult das Urteilsvermögen für beide Kunstformen.
[Titelbild: Umschlag des bespochenen Taschenbuchs von Cathrin Günther.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Buch zum Film (I)
Friday, 11. March 2011

Wenn ich schon mal ins Kino gehe, dann bemühe ich mich, dies mit ,gehobenem Bewusstsein‘ zu tun. Ich will versuchen zu erklären, was ich damit meine, und das heutige Beispiel eignet sich besonders gut dazu. – Der neueste Film der Coen-Brüder, True Grit, stand zunächst nicht auf meiner Wunschliste, so sehr ich das Regie-Duo seit Blood Simple schätze. Aber grundsätzlich sind Western, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht gerade meine große Leidenschaft, und die meiner Gefährtin erst recht nicht. Doch ohne diese wählerische Begleitperson gehe ich prinzipiell nicht ins Kino. Zudem werde ich immer skeptisch, wenn ein Film sich zum Blockbuster mausert, und erst recht, wenn er die Oscar-Nominierungen einsammelt wie Konfetti auf der Sombrerokrempe. Dass wir uns den jüngsten Film von Joel und Ethan Coen trotz dieser Bedenken am Karnevalsdienstag anschauten, hatte zwei gute Gründe.
Erstens machte mich ein Interview neugierig, das Tobias Kniebe mit den Regisseuren geführt hat („Hat die Inspiration schon jemals zugeschlagen?“; in: SZ v. 9. Februar 2011.) Auf die skeptische Frage, wie sie an diesen alten Stoff herangegangen seien, aus dem vor über vierzig Jahren John Hathaway einen überaus geradlinigen Western gemacht habe, antwortet Ethan: „Wenn man die Story genau betrachtet, ist es ein ziemlich gradliniger Western über Vergeltung. Unser Idee dazu war sehr simpel: Wir wollten dem Roman, der allem zugrunde liegt, möglichst treu bleiben. Wir lieben dieses Buch.“ Ein solches Bekenntnis lässt mich immer aufhorchen. Die Herren Regisseure lieben ein Buch! Und sie gehen zurück zu den Wurzeln, wenn sie ein Remake zu einem alten, seinerzeit erfolgreichen Film wagen!
Dann sahen wir uns zunächst Der Marshal an, jenen Westernklassiker, der am 21. August 1969 Deutschland-Premiere hatte. (Zufällig ein Datum, das für mich tragische Bedeutung hat, aber das ist irrationaler Schnickschnack.) Bei allen Vorbehalten gegen die fragwürdigen Fortschritte der Unterhaltungstechnik ist hier doch einmal zu loben, wie bewuem es heute ist, beinahe jeden älteren Film von einiger Bedeutung auf DVD zu beschaffen und am heimischen PC anzuschauen. John Wayne als Rooster Cogburn, mit Augenklappe und Schnapsflasche, gibt in der Rolle des Titelhelden noch einmal sein Bestes und wurde dafür mit seinem zweiten Oscar als bester männlicher Hauptdarsteller belohnt. Die rachedürstende Mattie Ross wird von der bei Drehbeginn bereits 21-jährigen Kim Darby dargestellt, die den 14-jährigen Trotzkopf dennoch glaubwürdig hinbekommt. Der Film ist unterhaltsam von der ersten bis zur letzten Minute. Auch kleinere Nebenrollen sind trefflich besetzt. So hat mir Cogburns chinesischer Hauswirt Chen Lee (Hom Wing Gim) gut gefallen. Der Darsteller des tödlich angeschossenen Gangsters Moon macht ebenfalls seine Sache sehr gut. Dass es sich bei ihm um keinen Geringeren als Dennis Hopper handelte, kurz vor seinem großen Durchbruch mit Easy Rider im gleichen Jahr, das wurde mir erst beim Studieren der Cast-Liste klar. Der einzige Totalausfall in Der Marshal ist fraglos Glen Campbell als Texas-Ranger La Boeuf. Zu dieser anspruchsvollen Filmrolle, seiner ersten und letzten, ist er gewiss nur gekommen, weil er als berühmter Country-Sänger gut für die Kinokasse war. Er singt den Titelsong und eroberte mit dieser Schnulze vermutlich das Herz der weiblichen Kinofans: “One day, little girl, the sadness will leave your face | As soon as you’ve won the fight to get justice done | Someday little girl you’ll wonder what life’s about | But other’s have known few battles are won alone | So, you’ll look around to find | Someone who’s kind, someone who is fearless like you | The pain of it will ease a bit | When you find a man with true grit || One day you will rise and you won’t believe your eyes | You’ll wake up and see a world that is fine and free | Though summer seems far away | You will find the sun one day.” Nachdem wir das hinter uns gebracht hatten, waren wir nun doch sehr gespannt, wie die Coen-Brüder jene Szenen bringen würden, die uns in ihrem Vorgängerfilm beeindruckt hatten: Mattie am offenen Sarg ihres Vaters, das Henken der drei Ganoven in Fort Smith, die Zeugenvernehmung von Cogburn vorm dortigen Gericht, Matties Ritt durch den Fluss und wie ihr La Boeuf den Hintern versohlt, Moons Verrat und Tod und schließlich Matties Sturz in die Schlangengrube und wunderbare Errettung.
Wir hatten das Glück, die Neuverfilmung in der Essener Lichtburg sehen zu dürfen. Nun könnte ich ellenlang über die Übereinstimmungen und Unterschiede beider Filme referieren, aber damit wäre nichts gewonnen und der Genuss, den ich beim Vergleich der Versionen hatte, ist dadurch ohnehin nicht zu vermitteln. So viel nur: Ich habe beschlossen, mir noch eine dritte ,Verfilmung‘ des Stoffs zu gönnen, nämlich jene, die beim Lesen der Romanvorlage in meinem Kopf entsteht. Sie stammt von Charles Portis und erschien zuerst 1969 unter dem Titel Die mutige Mattie bei Rowohlt in deutscher Übersetzung. (Anlässlich der Coen-Verfilmung ist soeben eine überarbeitete Neuauflage im Taschenbuch erschienen.)
Es geht übrigens, im Buch und in den Filmen, um Rache. Voraussetzung für Rachlust ist vermutlich Hass. Kann aber eine 14-Jährige hassen? Und kann man diesen Hass plausibel machen, wenn man seinen Ursprung, die Liebe zum ermordeten Vater, mit diesem selbst ausblendet? Bei Hathaway hat der lebende Frank Ross wenigstens noch einen kleinen Auftritt zu Beginn des Films. Die Coens zeigen ihn nurmehr als erstarrte Kontur einer Leiche im Schneegestöber. Welche Rolle spielt Matties Vater bei Portis?
Posted in Flanerie, Kulturflanerie, Würfelwürfe | Comments Off on Filmkritik (III)
Thursday, 10. March 2011

Die ,Abschaffung‘ des gedruckten Buches bedeutet jedenfalls einen folgenschweren Bruch in der Kulturgeschichte des Menschen, auch wenn die unüberschaubar große Zahl der vorhandenen Bücher hiervon zunächst nicht betroffen sein wird und diese künftigen Antiquariatswaren jenen Generationen, die mit Büchern aus Papier aufgewachsen sind, vorübergehend Trost spenden mögen. Wenn aber, wie zu erwarten, die Leser ,echter‘ Bücher älter werden und schließlich aussterben, während zugleich auch keine neuen Bücher mehr hergestellt werden und die alten schließlich einen musealen Appeal annehmen, dann entsteht zwischen den Menschen der Zukunft und den Büchern der Vergangenheit unvermeidlich eine nie dagewesene Distanz, mit noch unabsehbaren Folgen für die Bildung unserer Nachkommen. Angesichts eines dermaßen einschneidenden Systemwechsels kann eine persönliche Stellungnahme, wie ich sie hier versuchen will, keinesfalls mehr beisteuern als ein paar sehr persönliche, von starken Gefühlen beeinflusste Gedanken.
Ich habe seit meiner Alphabetisierung vor einem knappen halben Jahrhundert wohl einige tausend Bücher gelesen. Ein paar von ihnen haben mich so stark beeindruckt, dass ich ohne sie sicher ein anderer Mensch geworden wäre. Etliche haben immerhin mein Bild von der Welt bereichert und meine Fähigkeit, mich sprachlich auszudrücken, entwickelt. Und schließlich gibt es noch eine große Menge von Büchern, die mir lediglich auf genussvolle Weise die Zeit vertrieben haben. Von deren Inhalt weiß ich heute kaum mehr etwas. Allenfalls wecken ihre Titel vage Empfindungen. Woran ich mich aber in jedem Falle noch erinnere, dass ist das äußere Erscheinungsbild dieser Bücher. Gegenwärtig ist meine Bibliothek, bedingt durch den letzten Umzug in eine wesentlich kleinere Wohnung, in ziemlicher Unordnung. Dennoch finde ich nahezu jedes gesuchte Buch relativ schnell, weil ich seine Größe, seine Dicke, die Farbe seines Einbands oder Schutzumschlags sehr genau im Gedächtnis habe. Solche erfolgreichen Buchfahndungen gelingen mir sogar dann, wenn ich weder den Namen des Autors noch den Titel parat habe.
Wenn ich eins meiner Buch lange Zeit nicht mehr zur Hand genommen habe, dann ist deshalb meine einst sehr innige Beziehung zu ihm keinesfalls erloschen. Sie bedarf lediglich einer Auffrischung. Und dies geschieht eben dadurch, dass ich es ganz körperlich, gegenständlich angreife und darin blättere, sein Gewicht empfinde, meine Besitzvermerke studiere, womöglich von mir selbst oder von anderen Lesern hineingelegte Zettel mit Notizen aufspüre, den Ursachen von Schadspuren nachsinne und durch die Vielfalt dieser sinnlichen Empfindungen ein starkes Band zu jener fernen Zeit knüpfe, als eben dieses Buch meine ungeteilte Aufmerksamkeit fand, Partner meines Denkens und Empfindens war für einen Tag, eine Woche oder einen Monat.
Manche Bücher gelten mir in einem ganz schlichten Sinne als unersetzlich, obwohl doch nahezu jedes Buch heutzutage dank der Internet-Antiquariate über kurz oder lang beschaffbar ist, soweit der Kaufpreis keine Rolle spielt. Wie kann das sein? Hier versagt meine Argumentationskraft und ich muss eingestehen, dass ich mich jenen Menschen, die Bücher für reproduzierbare Gegenstände ohne echte Individualität halten, vermutlich kaum werde erklären können. Nur so viel: Jene spezielle Ausgabe des Tristram Shandy, in der ich Sternes Meisterwerk zum ersten Mal las [s. Titelbild], ist weder schön, noch selten, noch handelt es sich um eine besonders gute Übersetzung. Dennoch würde ich sie für kein Geld der Welt hergeben. Da ich aber weiß, dass dies nur so dahingesagt ist und ich mich in einer schweren Notlage vermutlich doch von diesem Büchlein trennen würde, füge ich hinzu, dass ich einen solchen Verlust gewiss niemals verwinden würde.
Nun höre ich in Gedanken den allerdings nicht eben abwegigen Einwand, dass ich hier nichts anderes beschrieben habe als eine vielleicht günstigenfalls besonders erlesene Form von Fetischismus, also eines krankhaften Hingezogenseins zu einer bestimmten Art von toten Gegenständen. Das mag sein, ich will dies gar nicht in Abrede stellen, allerdings unter der Voraussetzung, dass mein Kritiker den edlen Nutzen dieser Leidenschaft recht zu würdigen weiß und gebührend in Betracht zieht. Immerhin behaupte ich, dass keine andere Sammelleidenschaft als eben die von Büchern durch ihren Gegenstand eine solche Weitung des Bewusstseins ermöglicht – vorausgesetzt natürlich, dass die Bibliophilie sich nicht darin erschöpft, die schönen Dinge Rücken an Rücken in den Schrank zu stellen, sondern ihre wahre Erfüllung erst findet, wenn sie die Objekte ihres Begehrens ihrer eigentlichen Bestimmung zuführt: dem Lesen.
[Wird fortgesetzt.]
Posted in Babel, Würfelwürfe | 1 Comment »
Wednesday, 09. March 2011
Posted in Oikos, Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Briefkastenmüll (II)
Wednesday, 09. March 2011

Wir zwar nicht; ich aber schon.
Zur Erklärung. Der Satz stimmt insofern, als jeder Verständigungsversuch darüber, was jeweils uns einzelnen Menschen Gott bedeutet, entweder zu einem Konsens über Begriffsbestimmungen führt, die eben nicht Gott, sondern schlichte weltliche Obliegenheiten betreffen, auch wenn sie sich mit noch so großem Aufwand mit ,transzendentalem‘ Kunsthandwerk ausstaffieren. Oder aber die Mühe des Ausdrucks von dem, was Gott sei, führt geradenwegs ins Gelalle, in wirre Glossolalie oder meditatives Schweigen, kurz: ins Unverständliche und damit zurück in die Vereinzelung. (Um zum Bilde zu kommen. Wenn sechs Milliarden Menschen gebeten würden, Gott zu malen, dann würden wohl manche Bilder einander ähneln; und zwar am ehesten jene, die sehr gegenständlich sind. Je abstrakter hingegen die Gottesbilder würden, desto unwahrscheinlicher wäre die Übereinstimmung. Wolken und einen blauen Himmel mit Gott zu verbinden ist eine verbreitete Idee. Ein übermenschengroßes Gesicht ist auch nicht abwegig. Diese wie Dominosteine umklappenden Türen hingegen zeigen vielleicht eine Doppelbödigkeit an, die sich bei jedem Annäherungsversuch an den Gottesbegriff einstellt.)
Ich weiß also zwar, was Gott mir ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass jeder Versuch der Mitteilung darüber zu Missverständnissen führt, und schließlich erkannt, dass dies notwendig so sein muss. Schon solche scheinbar grundsätzlichen Fragen wie: ob es einen Gotte gebe, ob ich an einen Gott glaube, ob Gott allmächtig sei usw., kann ich nicht beantworten, ohne falsch verstanden zu werden.
(Vielleicht gründet in diesem Unvermögen meine Sympathie mit solchen Bemerkungen des frühen Wittgenstein, wie: „Es gibt allerdings Unaussprechliches: Dies zeigt sich, es ist das Mystische.“ Aber ich glaube nicht, Wittgenstein hinreichend verstanden zu haben, um beurteilen zu können, ob er ,das Mystische‘ und ,Gott‘ in eins setzt; oder in welcher Beziehung beide in seiner Begriffswelt zueinander stehen.)
Was man noch sagen könnte über das vermeintliche, vermeintlich gemeinsame, als für alle verbindlich ersehnte Wissen der Menschen über Gott und die versuchte Verständigung hierüber, so fällt auf, dass über keinen abstrakten Gegenstand mehr gestritten wurde, und beileibe nicht nur mit den Waffen des Intellekts. Wenn die Tiere lachen könnten, so würden sie wohl in ein homerisches, nie endendes Gelächter ausbrechen beim Anblick der sich selbst um einer Wortbedeutung willen bekriegenden Menschheit.
Posted in Heinrichs Testament | Comments Off on Heinrich Funke: Das Testament (XIV)
Tuesday, 08. March 2011

In den USA verkauft der Medienversandhändler Amazon mittlerweile mehr E-Books für sein Kindle als gedruckte Bücher. Auch hierzulande lautet die Prognose, dass die Tage des traditionellen Buchhandels damit gezählt sind. Wenn schon in den letzten fünfzehn Jahren immer mehr Lesestoff vom heimischen PC aus zur Lieferung frei Haus bestellt wurde, so wird es erst recht für die Kindle-Leser von morgen keine Veranlassung mehr geben, die Daten für ihre Lesegeräte in einem stationären Geschäft abzuholen. Es ist reinste Tränenvergeudung, deswegen nun ein kulturpessimistisches Wehklagen anzustimmen. Immerhin kann es aber sinnvoll sein darüber nachzudenken, welche Konsequenzen dieses Umsatteln auf den neuen Datenträger für unseren Umgang mit schriftlichen Informationen künftig haben kann.
Wenn die beiden konkreten Gegenstände – das möglicherweise dicke Buch aus Papier im Einband zum Blättern einerseits, die möglichst dünne Metallscheibe mit Bildfläche, Stromversorgung und Datenanschluss andererseits – miteinander verglichen werden, dann klingen die Vorzüge, die fürs Buch genannt werden, meist nach kauziger Liebhaberei, die mit den eigentlichen Gründen, die uns zum Lesen treiben, wenig zu tun haben. So ist etwa immer wieder vom ,Haptischen‘ die Rede, das angeblich nur ein ,richtiges‘ Buch vermitteln könne und das doch so wesentlich sei für den wahren Buchgenuss. Kommt es mir so vor, oder ist dieses Fremdwort für Tasteindrücke erst unters Volk gekommen, seit es dem Buch ans Leder geht? Welcher Verlust genau wird denn da beschworen und schon vorab bedauert? Die Schwierigkeit, ihn konkret zu benennen, führt zu komischen Verrenkungen, wenn etwa der Direktor der Universitäts-Bibliothek Leipzig, Ulrich Johannes Schneider, in einem Interview Wesentliche des Buches so erklärt: „Also, in der Tat, denke ich, ist die dreidimensionale Form des Buches, dass man da mit den Fingern mitten rein greifen kann, dass man sofort im Gefühl hat, wenn man auf Seite 30 ist, weiß man, ob es noch 300 Seiten sind, die folgen, oder 10. Also diese Art zu navigieren, gleichzeitig mit den Händen, mit den Augen, mit dem Kopf, das ist nicht reproduzierbar, in diesen elektronischen Geräten.“ (Dieter Kassel: Elektronische Bücher verändern das Lesen; Interview im deutschlandradio kultur v. 23. Juli 2008.)
Wenn es nicht mehr wäre, auf das wir nach dem Verschwinden der Bücher verzichten müssten, als das ,Reingreifen mit den Fingern in die Seiten‘, eine ja schon fast obszön anmutende Beschreibung des doch so keuschen Blätterns in Büchern, dann wäre uns ja dieser wohl unabwendbare Verlust kaum ein Schulterzucken wert.
Stirbt das Buch bald aus? Diese Frage wird in den letzten Jahren immer mal wieder gestellt, um ein, zwei Seiten der Wochenendbeilagen überregionaler Tageszeitungen zu füllen, wie zuletzt wieder am vergangenen Wochenende in der Süddeutschen. (Rebecca Casati / Gabriela Herpell: Es muss krachen; in: SZ Nr. 53 v. 5./6. März 2011, S. V2/1.) Die Antworten, die die Spezialisten geben – und wer fühlt sich nicht alles berufen zum Spezialisten in Sachen ,Zukunft des Buches‘! –, sind erschreckend eintönig, laufen sie doch allesamt auf die immer gleiche Prognose hinaus: Die Ablösung des traditionellen Buches durch das E-Book ist nur eine Frage der Zeit; das Buch aus Papier wird aber sicher noch ein respektables Nischendasein führen dürfen. Der Umgang mit Texten und das Lesen werden sich dadurch gewiss wandeln, aber die Folgen dieser Umwälzungen sind noch nicht abzusehen.
Wieviele Bücher mag es wohl in diesem Augenblick auf der Erde geben? Google hat im Sommer 2010 die Zahl aller Buchtitel ermittelt und gibt sie mit 129.864.880 an. Wenn wir erstens vorsichtig unterstellen, dass die durchschnittliche Auflagenhöhe eines Buchtitels 2.000 Exemplare beträgt, und zweitens davon ausgehen, dass die Hälfte aller Bücher im Laufe der Jahre und Jahrhunderte zerstört wurden, dann gibt es heute ziemlich genau 65 Milliarden Bücher weltweit, knapp zehn Bücher für jeden Menschen. Seit Johannes Gutenbergs Geniestreich ist die Zahl der Bücher ununterbrochen gestiegen. Wenn die Vorhersagen zutreffen, dann wird dies in wenigen Jahren erstmals nicht mehr der Fall sein. Zwar werden weiterhin Texte entstehen, wie sie bisher in Buchform verbreitet wurden. Doch ihr Dasein wird an eine andere Materialität geknüpft sein als bisher. Es ist wohl angebracht, angesichts eines solchen gigantischen Umbruchs etwas hartnäckiger nach den Konseuqnzen zu fragen, die das womöglich für uns Lesende hat.
[Wird fortgesetzt.]
Posted in Babel, Würfelwürfe | 1 Comment »
Friday, 04. March 2011

Auch unsere Gedankenlosigkeit, die Leere in unserem Hirn schlägt irgendwo auf, an einem entlegenen Ort außerhalb unserer Wahrnehmung, und dieser Ort hat einen buchstabierbaren Namen. Sogar noch unsere absichtslosesten Taten hinterlassen eine Spur und treffen einen Zielpunkt. Was wir dort anrichten, erfahren wir gewöhnlich nicht. Es ist zu weit weg. In der Mülltonne vor unserem Haus, allenfalls noch auf der Sondermülldeponie am Stadtrand endet die Wahrnehmung der von uns verbrauchten Dinge. Den schmutzigen und stinkenden Kometenschweif unserer auf Konsum gegründeten Zivilisation verlieren wir nur zu bald aus den Augen.
Nachdem europäische Kaufleute in den letzten fünf Jahrhunderten die meisten außereuropäischen Länder kolonialisiert und ausgeplündert haben, missbrauchen wir sie nun noch für ein Weilchen als Schrottplätze und billige Recycling-Höfe. Gesetzliche Regelungen zum Schutz der dort beschäftigten Arbeiter und der Natur gibt es kaum. Darum kann man das Verdienst von kritischen Photographen nicht genug loben, die solche verdrängten Orte und verschwiegenen Geschehnisse in unsere gemütliche Wohlstandswelt holen und uns an die schmutzige Kehrseite unseres hygienisch-sauberen Lebens erinnern.
Der südafrikanische Photograph Pieter Hugo war mir zuerst durch seine Hyänenbilder im Essener Folkwang-Museum aufgefallen, vor einem Jahr habe ich hier darüber berichtet. Nun ist ein beeindruckender Bildband mit Aufnahmen von ihm erschienen, die in Agbogbloshie, auf einer gigantischen Müllhalde in Ghana entstanden sind. Dort sind junge Männer damit beschäftigt, den Elektroschrott aus Europa auszuschlachten und daraus Kupfer, Eisen und Aluminium zu gewinnen, das sich wieder zu Geld machen lässt. Monat für Monat treffen 400 große Schiffscontainer im Hafen von Tema nahe der Hauptstadt ein. Jeder von ihnen enthält rund 600 PCs oder Monitore. Was noch halbwegs funktioniert oder reapariert werden kann, wird nach Akkra gebracht und dort verkauft. Der Rest wird auf der abgelegenen Deponie auseinandergerupft, sortiert und eingeschmolzen. Dass sich dabei giftige Gase entwickeln, dass die Luft, der Boden und das Grundwasser verseucht werden, interessiert niemanden.
Pieter Hugo hat in einem Interview mit Leonie March die Frage ausdrücklich verneint, ob er sich als politischer Fotograf verstehe. Tatsächlich haben die Farbfotos in dem jetzt erschienenen Bildband vor allem einen starken ästhetischen Reiz. Man muss sich bei der Betrachtung immer wieder in Erinnerung rufen, hier mit einem stinkenden Inferno konfrontiert zu sein.
Ich bin wahrlich ein Freund schöner Bücher. Und dieser auf seine Weise prachtvolle Halbleinenband – mit eingelegtem, montiertem Titelbild, fadengeheftet, in exquisiter Druckqualität – kann in seiner gelungenen äußeren Erscheinung und soliden Fertigung nicht hoch genug gelobt werden. Und doch ist mir etwas mulmig dabei, wenn ich mir vorstelle, dass das Buch schon wegen des Preises von 39,95 € am ehesten seinen Platz als Coffeetable-Book in den Häusern der Upper Class finden wird. Ob die Bilder dort immerhin eine kritische Nachdenklichkeit erzeugen können oder bloß einen grusligen Schauder, das wage ich nicht zu entscheiden.
[Titelbild © Prestel Verlag & Pieter Hugo. – Aus: Permanent Error. Mit einem Vorwort v. Federica Angelucci u. einem Nachwort v. Jim Puckett (beide in Engl.). München / London / New York: Prestel Verlag, 2011, S. 51. – Sehr sympathisch finde ich, dass die Personen auf den Fotos hinten im Buch S. 105 ff. unter Captions mit ihren vollständigen Namen benannt werden. So heißt der Mann im Vordergrund David Akore.]
Posted in Ghana, Oikos, Würfelwürfe | Comments Off on Ghana (VI) – Wegdamit heißt Agbogbloshie
Friday, 04. March 2011
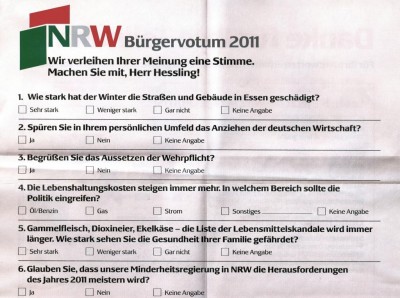
Der private Briefkasten vor dem Haus ist in den letzten Jahren zunehmend zu einem alltäglichen Unmutspender geworden, enthält er doch neben der Tageszeitung hauptsächlich Einwurfsendungen zu Werbezwecken unterschiedlicher Couleur. Vielleicht charakterisiert eine gründliche Autopsie des Inhalts eines Jahres unsere Zeit und ihre Verirrungen besser als manch anderes Diagnoseverfahren. Ich werde also ab sofort die bisher immer unbesehen zum Altpapier beförderten Drucksachen einer genaueren Betrachtung unterziehen und hier regelmäßig vorstellen.
Heute fragt mich der Chefredakteur der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, Ulrich Reitz, ob ich glaube, „dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen und die Minderheitsregierung in Düsseldorf die anstehenden Herausforderungen zu unser aller Zufriedenheit lösen“ werden. Meinen Standpunkt möge ich bitte der WAZ auf dem beigefügten Fragebogen NRW Bürgervotum 2011 übermitteln. Zur „Belohnung“ erhalte ich völlig kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang die WAZ und nehme an der Verlosung eines Reisegutscheins im Wert von 1.000 Euro teil. Ein Rückumschlag liegt ebenfalls bei, das Porto zahlt die WAZ für mich!
Nun steht der Ausdruck Votum, vom lateinischen votum ‚Gelübde, Gebet, Wunsch‘, üblicherweise für eine Stimmabgabe zur Wahl oder Beschlussfassung. Aus dem Brief des Redakteurs ist aber nicht ersichtlich, welche Wirkung meine sechs Kreuzchen auf dem Fragebogen haben werden. „Wir verleihen Ihrer Meinung eine Stimme.“ So lautet die vollmundige Überschrift. Aber eine Stimme, nämlich meine eigene in Wort und Schrift, hat meine Meinung doch bereits. Auf den ersten Blick handelt es sich hier um eine ganz simple Meinungsumfrage. Vermutlich denken die Marketingprofis bei der WAZ, dass sie die Adressaten ihrer Umfrage in Zeiten des Wutbürgertums mit dem Aufruf zu einem „Bürgervotum“ eher zur Teilnahme motivieren können. Bei mir verfängt der Trick ebensowenig wie die beiden Lockvögel: Ich reise nie und habe schon eine Tageszeitung im Abo.
Nun also zu den sechs Fragen, zu deren Beantwortung ich natürlich nicht schreiben können muss; lesen und Kreuzchen machen reicht völlig aus. – „1. Wie stark hat der Winter die Straßen und Gebäude in Essen geschädigt?“ Hier muss ich gleich zugeben, dass ich das nicht so genau weiß. Ich habe mehrfach vernommen, wie sich Autofahrer über die Vielzahl neuer Schlaglöcher beklagten, die ihre Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Fahrzeuge gefährden könnten. Als Autoverweigerer fühle ich mich hier inkomepent. Ich kann nur sagen, dass die von mir genutzten öffentlichen Verkehrsmittel durch den Winter und dessen Folgen nicht stärker beeinträchtigt waren als in früheren Jahren. Gebäudeschäden habe ich nicht bemerkt. Reichlich merkwürdig finde ich nun aber die vier möglichen Antworten, die mir angeboten werden: ,Sehr stark‘, ,Weniger stark‘, ,Gar nicht‘ und ,Keine Angabe‘. Hier drängt sich mir der Verdacht auf, dass die Stimmabgabe für die erste Alternative forciert werden soll, indem die Variante ,Stark‘ gar nicht erst angeboten wird; und bei ,Weniger stark‘ denken viele sicher: ,Weniger stark als in vergangenen Jahren‘, und schütteln ebenfalls den Kopf. ,Gar nicht‘ schließlich kommt kaum in Frage, denn irgendwelche Schäden verursacht ja jeder Winter. Wer schließlich ‚Keine Angaben‘ ankreuzt, fällt bei der Auswertung nicht ins Gewicht. – „2. Spüren Sie in Ihrem persönlichen Umfeld das Anziehen der deutschen Wirtschaft?“ Ich rufe mir zunächst mein persönliches Umfeld vor mein inneres Auge. Darunter verstehe ich im Sinne der Frage jetzt mal die paar Dutzend Menschen meines Bekanntenkreises, deren Lebensumstände ich immerhin so gut kenne, dass ich ihre berufliche und wirtschaftliche Situation halbwegs einschätzen kann. Von einer (verhaltenen) Konjunktur kann in Deutschland allenfalls seit einem knappen Jahr die Rede sein. In diesem Zeitraum hat sich der Lebensstandard der meisten meiner Bekannten nicht auffällig verbessert oder verschlechtert. Einige wenige hatten viel Glück, ein paar andere Pech. Das war auch früher nicht anders. Hier wird mir nur die Alternative ,Ja‘ oder ,Nein‘ zum Ankreuzen angeboten, neben der bei allen Fragen möglichen Stimmenthaltung. ,Nein‘ wäre zwar für mich die korrekte Antwort, aber ich habe doch ein schlechtes Gefühl gabei, denn ich sehe schon die Headline, die die Zeitungsmacher daraus ableiten können: „,Aufschwung‘ kommt bei den Menschen nicht an!“ – „3. Begrüßen Sie das Aussetzen der Wehrpflicht?“ Nein, denn ich hätte die Abschaffung richtig gefunden. Wenn ich aber hier ,Nein‘ ankreuze, könnte man daraus fälschlich den Schluss ziehen, dass mir lieber gewesen wäre, man hätte die Wehrpflicht gar nicht angetastet. – „4. Die Lebenshaltungskosten steigen immer mehr. In welchem Bereich sollte die Politik eingreifen?“ Die angebotenen Sparschweine tragen folgende Aufschriften: ,Öl/Benzin‘, ,Gas‘, ,Strom‘. Drosselung des Konsums, besonders wenn es sich um den Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen handelt, wie jedenfalls in den ersten beiden Fällen und zu einem guten Teil auch bei der Elektrizität, findet immer meine Zustimmung. Insofern bin ich gegen jeden staatlichen Protektionismus im Dienste privater Verschwendung. Auch ,Sonstiges‘, wonach ich hier ausnahmsweise mal gefragt werde, möchte ich nicht benennen. Nach meiner laienhaften Kenntnis wirtschafts- und finanzpolitischer Zusammenhänge kann Inflation nicht durch staatliche Subventionierung von Konsumgütern behoben werden. – „5. Gammelfleisch, Dioxineier, Ekelkäse – die Liste der Lebensmittelskandale wird immer länger. Wie stark sehen Sie die Gesundheit ihrer Familie gefährdet?“ Endlich kann ich mein Kreuzchen ohne Bedenken setzen: ,Gar nicht‘. Denn unsere Familie ernährt sich relativ gesund. Zudem bin ich der Überzeugung, dass die durch die genannten ,Lebensmittelskandale‘ tatsächlich verursachten gesundheitlichen Schäden bei der Bevölkerung verschwindend gering sind im Vergleich zu den Schäden durch Fast- und Junk-Food, durch falsche Ernährungsweise und Bewegungsmangel, durch Tabak- und Alkoholsucht. – „6. Glauben Sie, dass unsere Minderheitsregierung in NRW die Herausforderungen des Jahres 2011 meistern wird?“ Welche Herausforderungen sind gemeint? In den vorangegangenen fünf Fragen wird nur eine Herausforderung genannt, die sich (neben den Kommunen) auch der Landesregierung stellt: die Behebung witterungsbedingter Straßen- und Gebäudeschäden.
Zum Altpapier befördere ich 2 Blatt im Format DIN-A4, 1 Fensterumschlag im Format DIN-C6/5 und 1 Rückumschlag im Format 104×210 mm; Gesamtgewicht: 20 Gramm.
Posted in Oikos, Würfelwürfe | 5 Comments »
Wednesday, 02. March 2011

Als ich diesen allerersten Brief erhielt, war ich gerade mal 16 Wochen alt. Mein Vater klebte ihn in das Photoalbum, das er für seinen erstgeborenen Sohn angelegt hatte. Einen Gefallen hat er mir damit insofern getan, als ich aus seinem Inhalt schlussfolgern kann, dass ich offenbar schon sehr früh abgestillt wurde.
So beginnt meine Korrespondenz gleich mit einem Politikum: Ein Lebensmittelkonzern propagiert seine Produkte in Konkurrenz zu der natürlichsten Säuglingsnahrung, die es geben kann, der Muttermilch. Denn die ist ja kostenlos und niemand profitiert davon – außer dem Säugling, dessen Abwehrkräfte gestärkt werden und der durch die körperliche Nähe zur Mutter eine Bindung aufbaut, die ihn für sein ganzes Leben stärkt.
Als meine eigenen Kinder geboren wurden, gab es eine weltweite Bewegung für das Stillen. „Nestlé und andere Unternehmen [wurden] für ihre Vermarktung von Säuglingsnahrung in Entwicklungsländern heftig kritisiert. Ihnen wurde vorgeworfen, aggressive Verkaufsmethoden anzuwenden, etwa Verkaufspersonal als Krankenschwestern zu verkleiden und Gratismuster zu verteilen, deren Verwendung bei damit einhergehender Einstellung des Stillens zum Versiegen der Muttermilch führt. Damit würden Mütter dauerhaft von den teuren Produkten abhängig gemacht, die aber gerade in Entwicklungsländern für Teile der Bevölkerung unerschwinglich sind, zudem würden gesundheitliche Schäden und [der] Tod von Säuglingen durch Zubereitung mit verschmutztem Wasser in Kauf genommen.“ (Wikipedia.)
Meine Gefährtin engagierte sich mit anderen Müttern für die Propagierung des Stillens, war Mitbegründerin der ersten Stillgruppe in Essen und bemühte sich, auch bei Kinderärzten ein Bewusstsein für die Problematik zu schaffen.
Liest man den Brief aus heutiger Sicht, dann staunt man über die Schamlosigkeit und Raffinesse, mit der schon damals Konsumenten rekrutiert wurden, die noch in den Windeln lagen. Die erwähnten gerahmten Bilder hingen tatsächlich jahrelang in meinem Zimmerchen. Natürlich sollte nicht ich mich dadurch immer an Nestlé erinnern, sondern meine Mutter, die damit in der Schuld des Konzerns stand und für die es sich darum nicht gehörte, andere Babynahrung als die des spendablen Schenkers zu kaufen.
Posted in Korrespondenz, Werke, Würfelwürfe | Comments Off on Von Nestlé, 2. November 1956
Tuesday, 01. March 2011
Posted in Märchen | Comments Off on Protected: Timeless Flight
Tuesday, 01. March 2011
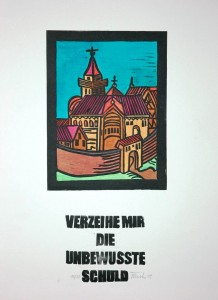
Über das Unbewusste kann man ja seit Sigmund Freud kaum mehr ohne Bezug auf ihn sprechen. Der Alleinherrschaftsanspruch über bestimmte Begriffe, die der Begründer der Psychoanalyse durchgesetzt hat, macht es nicht leicht, sie unbefangen zu verwenden oder zu verstehen. (Ähnlich verhält es sich etwa mit „Verdrängung“ und „Trieb“.)
Ich war bis eben sogar im Zweifel, ob nicht etwa das Wort unbewusst eine Neuschöpfung vom Beginn des vorigen Jahrhunderts oder aber älteren Ursprungs sei. Nun weiß ich, dass es sogar sehr alt ist. Schon Luther kannte es und verwendete es überdies in ganz ähnlichem Zusammenhang wie in der Bildunterschrift, als er eine „vorgessne und unbewuste sund“ für entschuldigt oder immerhin entschuldbar hielt. (Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, Bd. 24, Sp. 382.)
Wie kommt mir aber jemand vor, der mich um Verzeihung einer (ihm) unbewussten Schuld bittet? Zur Entschuldigung gibt es für solche Fälle ja auch die Redewendung: „Ich bin mir keiner Schuld bewusst.“ Wenn jemand mit einer Tat gegen eine Regel verstößt, so muss dies nicht willentlich und wissentlich geschehen. Er kann entschuldigt sein, weil er die Regel gar nicht kannte; oder weil ihm nicht bewusst war, dass seine Tat gegen eine allgemeine Regel verstoßen würde. Für diese Fälle darf er auf mildernde Umstände, gar auf Freispruch hoffen. Weiß jeder, dass die Wegnahme fremden Eigentums als Diebstahl verboten und darum strafbar ist? Kleine Kinder und demente Greise zum Beispiel wissen dies noch nicht bzw. nicht mehr und gelten genau darum ja auch als nur begrenzt schuldfähig. Wenn ich von einem Baum einen Apfel pflücke, der frei zugänglich in der Landschaft steht, dann glaubte ich mich hierzu berechtigt, weil ich keinen Eigentumsanspruch irgendeines Landbesitzers erkennen konnte. Kommt nun doch der Gärtner gerannt und will mich verklagen, dann frage ich, wo denn der Zaun sei oder das Schild, durch die ich hätte erkennen können, dass der Apfelbaum kein herrenloses Gut ist. So leicht, möchte man meinen, kann man sich also unbewusst in Schuld verstricken.
Allerdings ist der Verweis auf das mangelnde Schuldbewusstsein auch eine der beliebtesten Ausreden ertappter Übeltäter. „Ach so! Das war ein Zaun? Ich hatte es für ein Kunstwerk gehalten.“ – „Freilich habe ich ein paar Bierchen getrunken. Aber ich hatte ausdrücklich alkoholfreie bestellt!“ – „Ja, ich habe auf den Kopf des Verstorbenen gezielt und auch abgedrückt. Aber ich konnte doch nicht davon ausgehen, dass er einen geladenen und entsicherten Revolver in seiner Schreibtischschublade verwahrte.“ Es gibt sogar, wie wir jüngst staunend erfuhren, intelligente Menschen in höchsten Ämtern, die uns weismachen wollen, über viele Jahre und auf hunderten von Seiten fremdes Gedankengut entwendet zu haben, ohne dies selbst gemerkt zu haben!
Die sagen dann: „Verzeih mir die unbewusste Schuld“. – Genau betrachtet reiten sie sich aber so noch tiefer in den Dreck, indem sie einen entlarvenden Widerspruch erzeugen. Unbewusste Schuld kann es nach unserem Verständnis doch gar nicht geben. Um schuldig werden zu können, muss man sich eines Verbots und der Anwendbarkeit des Verbots auf die fragliche Tat bewusst werden. Ist man sich dessen nicht bewusst, so macht die Tat auch nicht schuldig. Und die Tat eines seiner Schuld unbewussten Täters kann somit auch nicht entschuldigt werden.
Posted in Heinrichs Testament | Comments Off on Heinrich Funke: Das Testament (XIII)
Monday, 28. February 2011

Vor auf den Tag genau dreieinhalb Jahren schrieb ich erstmals bei Westropolis über das „Konfluenzpunkt-Projekt“ von Alex Jarrett: Seit dem Jahr 1884, als in Washington die Internationale Meridian-Konferenz tagte, gilt ein einheitliches System von zweimal 180 Längengraden – westlich oder östlich des Nullmeridians, der durch Greenwich bei London verläuft. Ihm entspricht der größte Breitenkreis der Erde, der Äquator, der mit 0 Grad festgelegt wurde. Die Polpunkte sind mit 90 Grad nördlicher bzw. südlicher Breite beziffert. Die Rechnung ist also ganz einfach: Es gibt nach diesem Koordiantensystem exakt 360 x 179 = 64.440 Schnittpunkte ganzzahliger Längen- und Breitengrade, die beiden Pole ausgenommen. Den Nord- oder Südpol (90° nördlicher bzw. südlicher Breite, ohne Länegnangabe) zu erreichen, das war eins der letzten großen geografischen Entdeckerabenteuer des vorigen Jahrhunderts, neben der Ersteigung des Mount Everest im Himalaya und der Auslotung des Marianengrabens im Pazifik. Die Erfolgsjahre dieser Vorstöße in die örtlichen Extreme unseres Globus sind 1909 (Robert E. Peary), 1911 (Roald Amundsen und Sir Walter F. Scott), 1953 (Sir Edmund Hilary und Sherpa Tenzing Norgay) und schließlich 1960 (Jacques Piccard). Danach, so sollte man meinen, gab es keine attraktiven Ziele für Entdeckungsreisende auf der Erde mehr. Im Jahre 1969 machte sich die entdeckungslüsterne Menschheit auf den Weg zum Mond.
Im Februar 1996 blies aber ein gewisser Alex Jarrett zu einer neuen, zeitgemäßen Jagd. Nachdem im Jahr zuvor das satellitengestützte Global Positioning System (GPS) in Betrieb genommen worden war, kam Jarrett auf die Idee, die geographisch eindeutig bestimmbaren Schnittpunkte der Längen- und Breitengrade, Konfluenzpunkte genannt, weltweit von Abenteurern unserer Tage verorten und registrieren zu lassen, per photographischer Dokumentation. Wer als „Konfluenz-Pionier“ einen solchen Schnittpunkt als erster erreicht und vier Fotos in alle Himmelsrichtungen von diesem Punkt aus ins Internet stellt, sodann noch als Beweis seiner „Eroberung“ ein Foto von der Anzeige seines GPS-Geräts, dass er auch wirklich dagewesen ist, macht sich damit unsterblich.
Die Ergebnisse kann man beim „Degree Confluence Project“ bestaunen. Von den rechnerisch 64.442 Konfluenzpunkten befinden sich 21.543 an Land, 38.409 auf Meeresflächen und 4.490 im Bereich der Polkappen. Ziel des Projekts ist es, dass jeder sogenannte primäre Konfluenzpunkt besucht und fotografiert wird. Konfluenzpunkte, die auf dem Wasser liegen und von denen aus kein Land sichtbar ist oder die sich auf den Polkappen sehr nahe beieinander befinden, werden als sekundäre bezeichnet. Auf den ersten Blick kommt manchem dieses Vorhaben vielleicht reichlich abgedreht vor, denn schließlich erfolgt die Auswahl der Punkte ja nach einem ganz abstrakten System. Befasst man sich aber etwas gründlicher mit den Ergebnissen dieses Experiments, dann ist man verblüfft, wie verschwindend klein die Zahl jener Fotos ist, auf denen Spuren der menschlichen Zivilisation zu erkennen sind. Das gibt zu denken, da das Koordinatengitter mit seinen Schnittpunkten ja schließlich einen objektiven Durchschnitt aller Orte auf dieser Welt abbildet.
Das „Degree Confluence Project“ belehrt uns folglich darüber, dass wir längst keine so große Rolle auf unserem Heimatplaneten spielen, wie wir uns selbst gern einreden wollen. Neben manch anderem leiden wir offensichtlich auch unter maßloser Selbstüberschätzung. Ein Außerirdischer, der Terra nach den ganzzahligen Koordinatenschnittpunkten „scannen“ würde, nähme uns als „wesentliches Phänomen“ kaum wahr. Ist das nun eine eher verstörende oder vielmehr eine beruhigende Erkenntnis? – Beruhigend jedenfalls insofern, als es wohl tatsächlich sehr unwahrscheinlich ist, von einem künstlichen Satelliten getroffen zu werden, der nach Ablauf seiner „Lebenszeit“ vom Himmel fällt. Dieses Ereignis steht uns nämlich Ende des Jahres 2011 bevor. Der zweieinhalb Tonnen schwere deutsche Forschungssatellit Rosat, der im Juni 1990 auf eine Umlaufbahn in 550 Kilometern Höhe geschossen wurde, ist nämlich schon seit Jahren im Sinkflut und wird unweigerlich bald in die Atmosphäre eintauchen, wie dpa meldet. Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sieht allerdings keinen Grund zur Besorgnis: „Die Wahrscheinlichkeit, dass die Trümmer bewohntes Gebiet treffen, sei […] äußerst gering.“ (Dickes Ding; in: SZ Nr. 48 v. 28. Februar 2011, S. 10.) – Die Erde ist, auch wenn wir Stadtbewohner es manchmal vergessen, nach wie vor ein von Menschen extrem dünn besiedelter Planet.
(Der im Kartenausschnitt oben abgebildete Punkt – 80° westlicher Länge, 20° nördlicher Breite –, den ich auch schon in meinem Originalbeitrag bei Westropolis abgebildet hatte, wurde übrigens immer noch nicht „erobert“. Damals vermutete ich, dass erst Fidel Castro ins Gras beißen müsse, damit dort ein GPS-bewaffneter Konfluenz-Jäger seinen Triumph feiern könne. Groß wird dessen Triumph allerdings ohnehin nicht sein, denn der Ort befindet sich 32 Kilometer entfernt vom Land im Wasser und ist somit nur ein sekundärer Konfluenzpunkt.)
[Dieses Posting erschien zuerst am 31. August 2007 bei Westropolis unter dem Titel confluence.org als VIII. Folge der Serie „Meine 100 liebsten Nachschlagewerke“. Es wurde für die Neuaufnahme in mein Revierflaneur-Blog aktualisiert, überarbeitet und erweitert. – Einen zweiten Beitrag zum Thema veröffentlichte ich am 4. November 2008 hier.]
Posted in Ostropolis, Verzeichnisse, Werke, Würfelwürfe | Comments Off on Dünn besiedelt
Saturday, 26. February 2011

Ich hatte das Glück, in einer ruhigen kleinen Straße aufzuwachsen. Der Süthers Garten im Essener Stadtteil Rüttenscheid, eine Seitenstraße der Rüttenscheider am ,Stern‘, ist ziemlich genau hundert Meter lang und mündet in ein ebenfalls eher unbedeutendes Sträßchen, den Dohmanns Kamp. Parkstreifen gab es in meiner Kindheit Ende der 1950er-, Anfang der 1960er-Jahre hier noch nicht, wozu auch? Lediglich zwei Autobesitzer wohnten im Süthers Garten. Der eine war ein Lumpensammler mit seinem kleinen, dreirädrigen Lastwagen, der andere ein Lampenfabrikbesitzer mit hellblauem Citroën DS: hydropneumatische Federung!
Folglich war die Fahrbahn schön breit und eignete sich hervorragend zum Spielen. Eins unserer Lieblingsspiele hieß ,Deutschland erklärt den Krieg‘. Dazu wurde mit Kreide ein großer Kreis aufs Pflaster gemalt, in ebenso viele gleiche Segmente eingeteilt, wie Spieler teilnahmen, und mit Ländernamen versehen. Dann stellten sich alle Spieler außerhalb des Kreises an ihr jeweiliges Land, lediglich die Fußspitzen berührten die Peripherie so gerade noch. Der Spieler, der Deutschland repräsentierte, eröffnete das Spiel, indem er deklamierte: ,Deutschland erklärt den Krieg …‘ – und wenn er zum Beispiel ,… Frankreich!‘ gerufen hatte, dann rannten alle weg vom Kreis. Nur der ,Franzose‘ durfte nicht wegrennen, sondern musste mit dem Fuß in die Kreismitte treten und laut ;Stopp!‘ rufen.
Wie es dann genau weiterging, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch, dass mit weiteren Kreisstrichen Teile der verschiedenen ,Land‘-Sektoren abgetrennt wurden. Mitspieler, die ihr ganzes Land verloren hatten, schieden schließlich aus. Und wer zuerst ausschied, hatte den Auftrag, am Eingang vom Süthers Garten auf der Lauer zu liegen, ob ein Auto in die Straße einbog. War das der Fall, rief er oder sie laut: „Achtung, Auto!“ Dann wurde das Spiel unterbrochen, bis das Auto vorbei war. Dies kam eher selten vor.
Ich erinnere mich, dass es irgendwann Ärger mit einem älteren Herrn gab, der in der Straße wohnte und nur noch einen Arm hatte. Er hatte uns einmal bei unserem Spiel beobachtet und war kopfschüttelnd von dannen gezogen. Uns schwante schon, dass ihm irgendetwas gegen den Strich ging. Wir vermuteten, dass er sich beschweren wollte, weil wir die Straße mit Kreide beschmierten. Aber ein paar Tage später steuerte er auf uns zu und hielt uns eine kleine Rede, dass wir uns schämen sollten, ein solches Kriegsspiel zu spielen. Der Krieg sei grausam und wir sollten froh sein, dass wir im Frieden aufwachsen dürften. Und Deutschland dürfe nie wieder einem Land den Krieg erklären. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir von da an ersatzweise ,Wer hat Angst vorm Schwarzen Manne?‘ spielten, aber ich bin nicht sicher, ob es wegen der Friedenspredigt des Einarmigen war, oder weil wir bloß mal was anderes spielen wollten.
Heute ist der Süthers Garten rund um die Uhr mit Autos vollgeparkt und zur Einbahnstraße deklariert. Die Fahrbahn ist nur noch halb so breit wie früher. Und Kinder spielen dort schon lange nicht mehr.
Posted in Erinnerungen, Werke, Würfelwürfe | 1 Comment »
Thursday, 24. February 2011
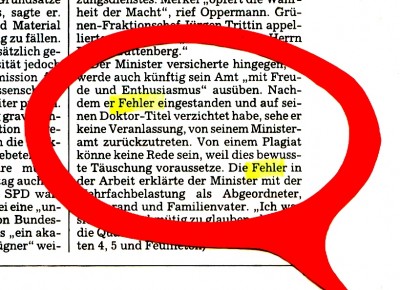
Ich komme einfach nicht hinweg über diese „Causa Guttenberg“. Eigentlich widerstrebt es mir ja, mich an Mainstream-Diskussionen der Bundespolitik zu beteiligen, weil die jeweils aktuellen Aufregungen bloß von den tatsächlichen, viel grundsätzlicheren Problemen und Skandalen ablenken. Das Dioxin in den Eiern ist mir egal. Dass die Konsumenten mal für ein paar Wochen die Regale mit den Bioeiern leerkaufen, um dann wieder zu den billigeren Varianten zurückzukehren, und dass sich dieses Spielchen nun alle Jahre wiederholt, worauf jedesmal wieder ein großes Geschrei anhebt, das ist eigentlich nur noch komisch. Da lachen ja die Hühner! Und ob ein Minister seine Doktorarbeit selbst geschrieben hat oder hat schreiben lassen, ist mir insofern völlig egal, weil ich längst begriffen habe, dass prinzipiell alle Ehrentitel und Würdezeichen in unserer Welt käuflich sind. Nun hat er sich erwischen lassen, weil er so dermaßen plump zu Werke gegangen ist bei seiner Fälschung, dass man es fast nicht glauben möchte. Das ist peinlich für ihn, aber im Grunde noch peinlicher für jene, die es nicht gemerkt haben, weil sie sich vermutlich von seinem politischen Amt haben blenden lassen. Und um dem Fass den Boden auszuschlagen, haben sie noch summa cum laude druntergeschrieben. Ist das nun ein Thema für mich? Nein, es ist doch nur der uralte Klassiker vom tragischen Höllensturz des vermeintlich engelsgleichen Lieblings der Massen, der sich nun als Übeltäter entpuppt. Ich weiß noch, ich wurde gerade elf Jahre alt, wie meine Oma sich ein Tränchen verdrückte, als ihr Traummann aus der Glotze, Lou van Burg, sich als Seitenspringer entpuppte. Über solche Schmierenkomödien muss ich doch hier nicht schreiben.
Und doch gibt es etwas an diesem speziellen Fall von ,Fall eines Helden‘, das ihn wertvoll macht. Ich will versuchen, genau das herauszustellen.
Heute berichtet die Süddeutsche auf ihrer Titelseite über den Auftritt Guttenbergs vor dem Bundestag am gestrigen Mittwoch: „Nachdem er Fehler eingestanden und auf seinen Doktor-Titel verzichtet habe, sehe er keine Veranlassung, von seinem Ministeramt zurückzutreten. Von einem Plagiat könne keine Rede sein, weil dies bewusste Täuschung voraussetze. Die Fehler in der Arbeit erklärte der Minister mit der Mehrfachbelastung als Abgeordneter, Doktorand und Familienvater.“ (Der Doktor-Titel ist weg; in: SZ Nr. 45 v. 24. Februar 2011, S. 1.) Hier bleibt die Zeitung, die doch ursprünglich den Stein ins Rollen gebracht hat, hinter ihren eigenen Erkenntnissen zurück, indem sie das Wort „Fehler“ zweimal nicht in Anführungszeichen setzt. Genau dies ist ja der Taschenspielertrick des Ministers, bei seinem groß angelegten Betrugsversuch als von „Fehlern“ zu sprechen, die ihm unterlaufen seien. Als wären das Flüchtigkeitsfehler, entschuldbar durch den großen Stress in diesen sieben Jahren, in denen er mit seinem Plagiat zugange war! Und Guttenberg hat gar die Kaltschnäuzigkeit, in der besagten Befragung im Bundestag jeden mit einer Anzeige wegen übler Nachrede zu bedrohen, der ihm etwa unterstellen wollte, er habe absichtsvoll getäuscht und die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens schuldhaft verletzt. Wenn man den Verteidigungsminister hier ernst nehmen wollte, dann belegten die im GuttenPlag Wiki mittlerweile dokumentierten zahllosen Fälle von Abschreiberei, dass Guttenberg beim Verfassen seiner Arbeit, also während sieben langen Jahren, unter einer schweren Bewusstseinstrübung gelitten haben muss. So etwas mag ja tatsächlich vorkommen, wie etwa auch Kleptomanen sich fallweise an ihre Diebstähle gar nicht erinnern können, verwundert das Diebesgut in ihren Taschen vorfinden und nicht wissen, wie es dort hineingekommen ist.
Genau diesen Weg beschreitet Guttenberg in seiner Argumentation, um sein Amt zu retten. Bei einer Rede vor unverdrossen ihm treu ergebenen Anhängern am Montag im hessischen Kelkheim schüttete er gleich sackweise Asche über seinem Haupt aus, um sich zu exkulpieren: „Ich habe in der – wenn man so will – in der Affäre um ,Plagiat: ja oder nein?‘ an diesem […] Wochenende mir auch die Zeit nehmen dürfen, […] mich auch noch einmal mit meiner Doktorarbeit zu beschäftigen. Und ich glaube, das war auch geboten und richtig, das zu tun. Und nach dieser Beschäftigung […] habe ich auch festgestellt, wie richtig es war, dass ich am Freitag gesagt habe, dass ich den Doktortitel nicht führen werde. Ich sage das ganz bewusst, weil ich am Wochenende – auch, nachdem ich diese Arbeit mir intensiv noch einmal angesehen habe – feststellen musste, dass ich gravierende Fehler gemacht habe; gravierende Fehler, die den wissenschaftlichen Kodex, den man so ansetzt, nicht erfüllen. Ich habe diese Fehler nicht bewusst gemacht. Ich habe auch nicht bewusst oder absichtlich in irgendeiner Form getäuscht und musste mich natürlich auch selbst fragen […]: Wie konnte das geschehen,? Wie konnte das passieren? […] Und das sind selbstverständlich Fehler. Und ich bin selbst auch ein Mensch mit Fehlern und Schwächen. Und deshalb stehe ich auch zu diesen Fehlern. Und zwar öffentlich zu diesen Fehlern, meine Damen und Herren, und bin auch ganz gerne bereit, dies in die hier stehenden Kameras zu sagen, […].“ (Zit. nach Hans Hütt: Guttenbergs Wettertannenrede; auf CARTA.) Die Professionalität, mit der Guttenberg vorgeht, wäre bewundernswert, wenn der Schaden, den er seinem Amt und dem Ansehen der Demokratie damit zufügt, nicht so beklagenswert wäre. All diese nachweisbaren wörtlichen oder – noch schlimmer! – geringfügig abgewandelten Textstellen, von denen mindestens eine auf drei Vierteln aller Seiten seiner über 400 Seiten umfassenden Schrift vorkommt, sind also von ihm unbemerkt dorthin geraten? Und das müssen wir ihm glauben, andernfalls er uns mit einer Anzeige wegen übler Nachrede bedroht? Vielleicht gar – Majestätsbeleidigung?
Ach, was schreibe ich mich hier in Rage? Was ich nur festhalten wollte, ist dies: Wenn der Noch-Verteidigungsminister und Ex-Dr. Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Freiherr von und zu Guttenberg einen Fehler gemacht hat, dann war es der darauf zu vertrauen, der Glanz seiner Herkunft und seiner Stellung könnte ausreichen, jegliche Zweifel an seiner Rechtschaffenheit dauerhaft zu überblenden und so seine plumpe Fälschung dem Zugriff kritischer Nachprüfung zu entziehen.
Posted in Homo laber, Sprechblasen, Würfelwürfe | Comments Off on Fehler?
Tuesday, 22. February 2011

In einem großen Artikel auf der Literatur-Seite stellt Thomas Senne heute in der Süddeutschen ein neues Büchlein über Samuel Becketts Deutschlandreisen der Jahre 1936 und 1937 vor. Natürlich schreibt der Rezensent den Namen des Nobelpreisträgers richtig, mit „ck“ und einem doppelten „t“ am Ende. (Thomas Senne: Unspeakable Eintopf; in: SZ Nr. 43 v. 22. Februar 2011, S. 14.)
Beckett hat während seiner Exkursion ins Reich der Finsternis Tagebuch geführt. Sein Neffe Edward Beckett untersagte „unverständlicherweise“, wie Senne findet, die Veröffentlichung dieser German Diaries seines 1989 verstorbenen Onkels. Nun hat der Musikkritiker Steffen Radlmaier, Feuilletonchef der Nürnberger Nachrichten, dieses Verbot immerhin teilweise unterlaufen, indem er in seiner jüngst erschienenen Studie Beckett in Bayern ausgiebig aus den Tagebüchern zitiert. (Bamberg: Kleebaum Verlag, 2011.) Auch den Namen Radlmaier schreibt Thomas Senne richtig.
Warum aber bringt er es nicht fertig, den Namen des vielleicht berühmtesten Reiseführers der Welt, der sich seit Jahrzehnten auch international als Eponym für diese spezielle Art von Nachschlegewerken durchgesetzt hat, korrekt mit einfachem „k“ zu schreiben?
Allerdings kann ich den Rezensenten damit trösten, dass er sich mit diesem Schreibfehler zwar nicht in gute, aber doch in große Gesellschaft begeben hat. Ich habe 17 Jahre lang in der gleichnamigen Buchhandlung in meiner Vaterstadt gearbeitet, deren Gründer Gottschalk Diederich Baedeker ein Vorfahre des Reiseführer-Verfassers Karl Baedeker war. Damals habe ich hunderte von Dokumenten aller Art gesammelt, vom Brief über den Zeitungsartikel bis hin zum Buchzitat, in denen mit sturer Ignoranz immer wieder „Baedecker“ geschrieben wurde.
Übrigens wissen wir ja nicht, ob Senne für den Fehler selbst verantwortlich ist, oder ob er ihn bei Radlmaier vorgefunden und bloß unhinterfragt abgeschrieben hat. Und selbst die schlimmste Befürchtung, dass der Patzer auf Samuel Beckett höchstpersönlich zurückgehen könnte, darf ich nach meinen traurigen Erfahrungen nicht mit letzter Gewissheit ausschließen, solange ich mich nicht vom Gegenteil überzeugt habe. Es ist doch ein rechtes Elend mit der Hudelei der Schreiber in unserer Zeit!
Posted in Homo laber, Sprechblasen, Würfelwürfe | Comments Off on Baedecker?
Tuesday, 22. February 2011
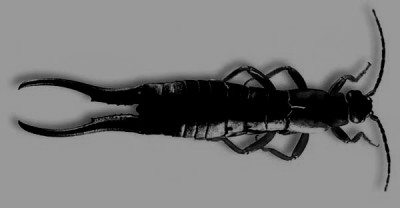
Im Mai 2007 startete ich bei Westropolis eine kleine Serie über lästige Phrasen, die manche Zeitgenossen gern in ihre mündliche Rede einfließen lassen und damit feinnervigen Zuhörern wie mir, zugegeben wohl einer verschwindend kleinen Minderheit, schrecklich an die Nerven gehen. Diese von mir unter der Gattungsbezeichnung „Ohrenkneifer“ vorgestellten Schädlinge im Volksmund sind hochinfektiös, in einem Maße, dass ich selbst immer wieder einmal davon angesteckt wurde, wenn mir tatsächlich selbst wieder bessere Einsicht gelegentlich der ein oder andere „Ohrenkneifer“ über die Lippen kroch. Autsch!
Ein Dutzend „Ohrenkneifer“ spießte ich seinerzeit auf, und um einige von ihnen wäre es schade, ganz in Vergessenheit zu geraten. Beispielsweise sozusagen. Ich entlarvte das penetrant in die mündliche oder gar schriftliche Rede deutschsprachiger Mitmenschen eingeflochtene Wörtchen als ein unbewusst eingebautes Hintertürchen, durch das der Sprecher bzw. Schreiber Reißaus zu nehmen plant, sollte das, was er da gerade von sich gibt, bei näherer Prüfung wortwörtlich doch nicht standhalten. Das Deutsche Wörterbuch von Wahrig macht mit seiner Worterklärung viel deutlicher als der Duden, um was für einen fauligen Wechselbalg es sich hier handelt: „gewissermaßen, wenn man es so ausdrücken will, obgleich es nicht ganz richtig ist“. (Gütersloh / München: Bertelsmann Lexikon Verlag, 2000, S. 1172.)
Aber warum muss man es denn so ausdrücken, obwohl es offenkundig nicht ganz richtig, klarer gesagt: obwohl es falsch ist? Weil einem die treffenderen Worte fehlen. Und warum fehlen einem die treffenden Worte? Weil man zu faul ist, nach ihnen zu suchen. Und was ist die Folge dieser um sich greifenden kollektiven Wortfindungsstörung, geboren aus lethargischer Gleichgültigkeit? Eine progressive Degeneration des Wortschatzes, eine daraus resultierende Verarmung der Sprache und des Denkens.
Dem Grimm’schen Wörterbuch ist das Wort „sozusagen“ übrigens noch gänzlich unbekannt, während „gewissermaßen“ dort gerade mal als eine modische Innovation aufgeführt wird. Auch auf dieses Füllsel hätten wir zur fragwürdigen Bereicherung unseres Wortschatzes besser verzichten sollen, denn heute wird es nach meiner Erfahrung vorzüglich dann eingesetzt, wenn eben gerade nicht gewiss ist, was der Sprecher oder Schreiber mit dem so Eingeläuteten eigentlich meint. „Gewissermaßen“ wird vielmehr und paradoxerweise als Warnhinweis für eine ungewisse Unbestimmtheit missbraucht – und damit seinem ursprünglichen Sinn entfremdet.
Nachsatz im Februar 2011. Neulich hörte ich einen Podcast bei Küchenradio von den Protesten beim letzten Castor-Transport im November vorigen Jahres. DocPhil interviewt im Unterholz einen der Organisatoren von der Aktion „Castor schottern“, der nahezu in jedem dritten Satz „sozusagen“ sagt. Das Wörtchen ist zu einem dermaßen sinnfreien Füllsel seiner Sprechweise geworden, dass er es mitunter bis zur völligen Unverständlichkeit verschleift. In neun Minuten bringt dieser Aktivist es tatsächlich fertig, 29 mal „sozusagen“ zu sagen! Und wenn man schön aufpasst, entdeckt man, dass das Virus nach einer Weile auf den Interviewer überspringt. Sehr schön und hörenswert! (Das Interview findet der Hörer zwischen Min. 12:00 und Min. 21:00.)
[Dieses Posting erschien zuerst am 2. Februar 2008 bei Westropolis unter dem Titel sozusagen als XII. Folge der Serie „Ohrenkneifer“. Es wurde für die Neuaufnahme in mein Revierflaneur-Blog überarbeitet und erweitert.]
Posted in Ostropolis, Werke, Würfelwürfe | Comments Off on Sozusagen
Sunday, 20. February 2011

Mubarak? War da nicht mal was? Hatte der ägyptische Despot nicht vor Jahr und Tag schon einmal meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen? – Das fragte ich mich, als seit dem 25. Januar das Volk zunächst in Kairo und bald auch in anderen Großstädten des bevölkerungsreichsten afrikanischen Staates auf die Straßen ging und den Rücktritt seines Präsidenten forderte. Ich half meinem Gedächtnis mit der Suchfunktion in meinem Blog auf die Sprünge und erinnerte mich nun gut an jenes grausame orientalische Märchen, das mich von Ende August bis Anfang September 2008 in seinen Bann gezogen hatte.
Die Geschichte vom brutalen Mord an der prominenten libanesischen Sängerin Suzan Tamim, von der Jagd nach ihrem Killer Mohsen al-Sukkari (oder Mahmoud el-Sukkary) und dessen steinreichem Auftraggeber, dem gehörnten Ex-Geliebten der Sängerin, war gleich in mehrfacher Hinsicht interessant. Einerseits offenbarte sich hieran das Ausmaß der Korruption und der Machtmissbrauch der herrschenden Klasse unter Husni Mubaraks Regime. Andererseits verwunderte aber auch die Zurückhaltung der westlichen Medien bei der Berichterstattung über den Fall, die sich auffallend lange zierten, auch nur den Namen des ägyptischen Auftraggebers preiszugeben. Als dann schließlich doch durchsickerte, dass es sich um den Hotelkettenbesitzer und Immobilientycoon Hesham Talaat Moustafa (oder Hischam Talaat Mustafa) handelte, da war der Fall in Deutschland längst aus den Schlagzeilen.
Damals bildete ich mir was darauf ein, immerhin nach längerer Suche ein unscharfes Bild von diesem vor Eifersucht wahnsinnig gewordenen Hesham Talaat Moustafa gefunden zu haben, und gar noch eins, das ihn beim Shakehands mit George W. Bush zeigte. Heute gibt es Bilder von Moustafa zur Genüge, hinter Gittern und ohne Gitter [s. Titelbild]. Der Mann war am 21. Mai 2009 von einem Gericht in Kairo zum Tod durch den Strang verurteilt worden. Menschenrechtsaktivisten und Kritiker der Regierung von Präsident Mubarak, dessen Sohn Gamal ein guter Freund von Moustafa war, hatten das Urteil insofern begrüßt, als es ausnahmsweise einmal das Recht ohne Rücksicht auf solche guten Beziehungen eines steinreichen Schwerverbrechers zur Anwendung brachte. Bei allem Verständnis für diese Genugtuung muss ich mich als prinzipieller Gegner der Todesstrafe hiervon natürlich dennoch klar distanzieren.
Allerdings sollte es bei diesem ersten Urteilsspruch ohnehin nicht lange bleiben. Am 4. Februar 2010 stellten Moustafas Anwälte für ihren Mandanten, der nach wie vor seine Unschuld beteuerte, Antrag auf Revision des Strafverfahrens. Am 4. März wurden die Urteile aufgehoben, zugleich wurde ein neuer Prozess angeordnet. Am 28. September 2010 wandelte das Gericht die Todesstrafe für Moustafa in 15 Jahre Haft um. Mubaraks langer Arm hatte wieder einmal für „Gerechtigkeit“ in seinem Sinne gesorgt.
Aber nun ist Husni Mubarak mit Kind und Kegel über alle Berge. Ob durch den Machtwechsel dieser Fall noch einmal eine neue Wende nimmt? Ich bleibe wachsam und spinne mein Garn weiter, sobald sich die Spindel wieder dreht. Im Unterschied zu den Schreibern in den Massenmedien habe ich ja die Geduld eines Engels und alle Zeit dieser und der anderen Welt.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Märchen (III)