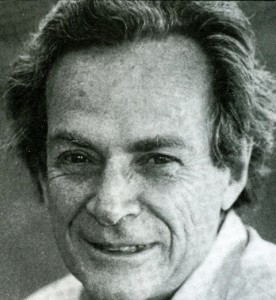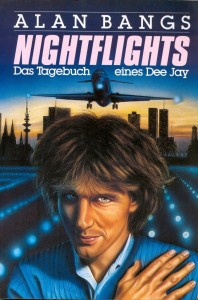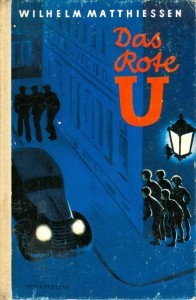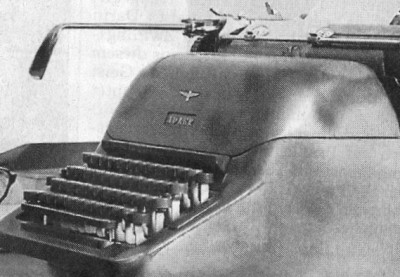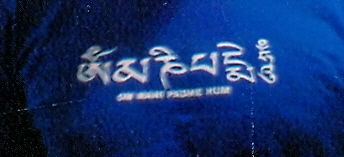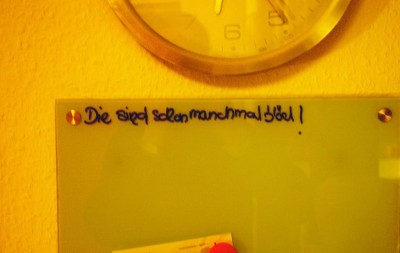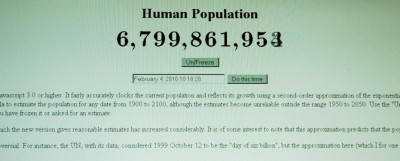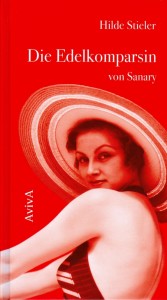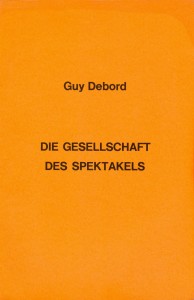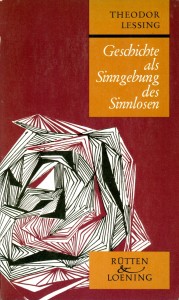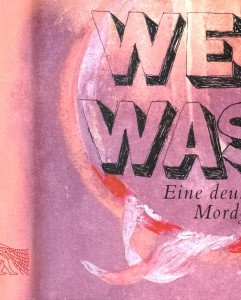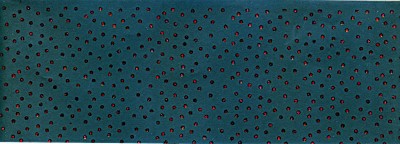Archive for the ‘Würfelwürfe’ Category
Thursday, 15. April 2010

Mehr als ein Vierteljahr ist nun ins Land gegangen, seit ich die Eröffnung meiner Firma – Manuel Hessling Antiquariat Revierflaneur – hier bekannt gab. Unvorhergesehene Widrigkeiten aller Art hemmten meine Unternehmungslust ein ums andere Mal. Erst jetzt, so scheint’s, kann ich endlich Nägel mit Köpfen machen.
Heute habe ich die ersten hundert Bücher aus dem Lager gezogen, sie abgestaubt, durchgesehen, auf versteckte Mängel geprüft und auf ihren Verkaufswert taxiert. Ich stellte eine bunte Mischung zusammen, ließ mich dabei vom Zufall bestimmen, suchte nicht nach besonders wertvollen Preziosen. Schließlich sollte es ja ein represäntativer Querschnitt sein, den ich da sozusagen als Kostprobe an den Internet-Vertrieb melden würde. Wenn ich meine komplexen Gefühlsregungen bei dieser Arbeit auf einen einfachen Begriff bringen müsste, so würde ich sagen: Es beschlichen mich „gemischte Gefühle“ – und diese halten auch noch an.
Einerseits bin ich froh, mich nun endlich zu diesem Schritt durchgerungen zu haben: mich nämlich von einem großen Teil meiner längst über jedes vernünftige Maß hinaus angeschwollenen Bibliothek zu trennen. Andererseits sind mit manchem Buch, das ich in der Hand und in meinem Herzen wäge, so viele intensive Erinnerungen verbunden, dass es mir manchmal erscheint, als würde mit dieser Trennung ein Stück meiner eigenen Geschichte ausradiert.
Dies gilt besonders für Bücher, die ich noch als Jugendlicher von meinem schmalen Taschengeld gekauft habe. Nach langem Zögern und Zagen habe ich mich damals speziell zu diesem Buch durchgerungen und dafür auf ein paar andere verzichtet, die mit ihm konkurrierten. So war es zum Beispiel mit dem kleinen Bildbändchen The Living Theater – Paradise Now. (Ein Bericht in Wort und Bild. Text Erika Billeter. Fotos Dölf Preisig. Bern München Wien: Rütten+Loening Verlag, 1969.) Das habe ich vermutlich 1972 in einem Modernen Antiquariat an der Rüttenscheider Straße gekauft, für 3,95 DM statt 9,80 DM. Wie beneidete ich damals die lebensfrohen Akteure der Theatertruppe von Julian Beck (1925-1985) und Judith Malina (*1926). Ich hätte am liebsten mit meinen 16 Jahren die Schule geschmissen und wäre aufgebrochen, um mich diesen spielfreudigen Hippies anzuschließen. Wenn ich heute in dem Büchlein blättere, das ich schon seit vielen Jahren nicht mehr in die Hand genommen habe, dann fühle ich mich sofort wieder in diese Jugendträume hineinversetzt.
Ich schreibe 18,00 Euro hinein und verabschiede mich von ihm mit einem wehmütigen Lächeln. Vielleicht ist das viel zu teuer? Aber es ist mir lieb und teuer. Billiger gebe ich’s nicht her. Wahrscheinlich werde ich mit diesem Unternehmen auf keinen gründen Zweig kommen. Aber warten wir es ab.
Posted in Bibliotheca Curiosa, Würfelwürfe | Comments Off on Antiquariat (II)
Tuesday, 13. April 2010

Vorgestern habe ich mir an der Seite meiner Gefährtin in der Essener Lichtburg den ersten Film des Modedesigners Tom Ford angeschaut. Es waren auffallend viele attraktive junge Männer in Begleitung älterer Herren im Kino. Das ist erfreulich, denn heute kann kein Produzent mehr auf seine Kosten kommen, wenn er ausschließlich ein cineastisch motiviertes Publikum anspricht. Die mimische Leistung des Hauptdarstellers, Colin Firth als George Falconer, hat A Single Man eine Oscar-Nominierung eingebracht. Das internationale Echo auf den Film, nach dem gleichnamigen Roman von Christopher Isherwood von 1964, war durchweg positiv, und auch hierzulande war das Urteil nahezu einhellig. Einen „traumwandlerisch schönen, traurigen Film“ nennt ihn Rainer Ganserma in der SZ. Ein „bravouröses Regiedebüt“ hat Peter Zander von der WELT gesehen und bescheinigt dem Regisseur, Drehbuchautor und Produzenten Ford eine verblüffende Stilsicherheit. Harald Peters von der gleichen Zeitung spricht von einem „eigenwilligen, wundervollen Werk“. Für die Kritikerin der ZEIT, Anke Leweke, ist A Single Man nicht nur ein Film, der „schön anzusehen ist“, „sondern auch ein schöner Film“. Michael Althen schließlich stellt Fords Debüt in der FAZ gar in die Tradition eines Klassikers wie Le feu follet von Louis Malle. Selbst im linken Freitag, von dem man am ehesten angenommen hätte, dass er sich mit dem Sujet und insbesondere mit dem auf Hochglanz polierten Milieu dieses Streifens schwertun würde, findet Matthias Dell nur lobende Worte und die überraschende Einsicht, der Film sei „auf subtile Weise […] politisch.“
Wenn sich alle Welt in einem Urteil dermaßen einig ist, dann kann die Versuchung für einen kämpferischen Geist unwiderstehlich werden, trotzig das gerade Gegenteil zu behaupten. So gab’s auch ein paar Zuschauer, genauer: ein Zuschauerpaar in der Lichtburg, das ein Viertelstündchen vor Schluss des Films das Kino verließ. Während ich mich noch fragte, welche Erwartungen hier enttäuscht worden waren, hatte die Frau an meiner Seite schon eine Erklärung parat: „Die konnten es bestimmt nicht länger aushalten und mussten dringend heim ins Bett!“
Da sind die Gründe, warum Ekkehard Knörer vom Perlentaucher den Filmgenuss wohl auch gern vorzeitig abgebrochen hätte, offenbar ganz anders gelagert. Gleich im ersten Absatz seiner Besprechung nennt er A Single Man unverblümt ein „Machwerk“. Was seinen Kolleginnen und Kollegen gerade als der besondere Vorzug des Films erschien, die Perfektion des Designs bis ins kleinste Detail, das nennt Knörer mit Bezug auf dessen Optik „fortgesetzte platte Redundanzproduktion“, während seine feinen Ohren „von der maximal minimal [sic] pathetisierenden Musik“ gepeinigt wurden, dass er sich fühlte „wie mit nassem Handtuch geprügelt“. Die ästhetische Konzeption nennt er eine der „streng gescheitelten Trauerkloßhaftigkeit“; und unterm Strich muss er feststellen, „dass im Leben eines durch und durch falschen Films eine echte Regung ein Ding der Unmöglichkeit ist.“ Wer dächte da nicht an Adornos bekannte Sentenz: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“? Und wenn man deren Kontext kennt, nämlich den 18. Aphorismus unter dem Titel Asyl für Obdachlose in Minima Moralia (Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Berlin u. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1951, S. 55-59), dann trifft diese Assoziation ins Herz der Diskussion über diesen Film, denn hier wie dort geht es nach meinem Dafürhalten ums Wohnen der Unbehausten in einer keinen Schutz mehr bietenden Welt.
Wenn es in A Single Man eine Szene gibt, an die sich jeder erinnert, dann ist es jene Rückblende, in der Literaturprofessor George Falconer (Colin Firth) „am Telefon vom Tod seines Freundes erfährt und ihm beschieden wird, dass die Familie auf seine Anwesenheit bei der Beerdigung keinen Wert lege – wie er versucht, die Fassung zu wahren, wie er seine versagende Stimme zur Disziplin zwingt und wie ihn nach dem Ende des Gesprächs dann die bleierne Gewissheit in den Sessel drückt und seine Augen überlaufen lässt, während es draußen in Strömen regnet, ist so erschütternd, dass es quasi alles beglaubigt, was den Film sonst nur an der Oberfläche zu bewegen scheint.“ So hat es Michael Althen empfunden. Und nun halten wir dagegen, was Ekkehard Knörer gesehen hat und wie er es bewertet: „Die Szene, in der George Falconer am Telefon vom Tod des geliebten Mannes erfährt, wird als schauspielerische Glanzleistung gepriesen. Aber auch und gerade an ihr ist alles ausgestellt. Tom Ford setzt seinen Hauptdarsteller ins perfekt eingerichtete Bild und lässt ihn wie ein gelehriges Tier im Zoo echtes Gefühl performieren. Der tut das, ringt virtuos um Fassung, aber gelangt übers Klischee einer solchen Situation kein Jota hinaus.“ Und darauf folgt besagter Satz vom durch und durch falschen Film. Was hat Knörer denn eigentlich sehen wollen? Einen Dokumentarfilm?
Ich für mein Teil habe den Film genossen. Und jedem, der sich bei diesem Genuss selbst im Wege steht, darf ich mein aufrichtiges Beileid aussprechen.
Posted in Flanerie, Homo laber, Kulturflanerie, Würfelwürfe | Comments Off on Filmkritik-Kritik (I)
Sunday, 11. April 2010

Über die Frage, wie zeitgemäße „Dichterlesungen“ in Buchhandlungen und auf anderen Bühnen heute auszusehen haben, wurde jüngst im Branchenmagazin buchreport kontrovers diskutiert.
Prof. Dr. Stephan Porombka (*1967), der an der Universität Hildesheim Kulturjournalismus und Literaturwissenschaft lehrt, eröffnete am 7. März die Debatte, als er forderte, dass sich die Vermittler von Literatur bewusster mit der Medienkonkurrenz auseinandersetzen müssten: „Es wird zunehmend wichtig, Literatur weniger im reinen Sinn zu denken und sich stattdessen stärker gegenüber den anderen Künsten und Medien zu öffnen, um vor allem auch ein jüngeres Publikum zu gewinnen.“ Porombka wendet sich sodann gegen die klassische Autorenlesung, weil sie einen veralteten Literaturbegriff repräsentiere, der – so wörtlich – „aus der Perspektive der Mediengesellschaft überholt ist, weil er nicht den gegenwärtigen Umgängen mit Texten entspricht.“ – Mal davon abgesehen, dass es den Plural von „Umgang“ in der hier gewählten Wortbedeutung nicht gibt: Was ist denn der gegenwärtige Umgang mit einem Text, zum Beispiel mit einer Erzählung wie Bartleby von Herman Melville? Liest man ihn nicht mehr Zeile für Zeile, von links nach rechts? Und was muss man anstellen, um bei einer öffentlichen Präsentation dieses Textes dem gegenwärtigen Umgang zu entsprechen? Im Background eine Lightshow abfackeln? Den Text als Rap intonieren? Da kann ich nur den Schreiber Bartleby zitieren: “I would prefer not to.”
So ließ der Widerspruch nicht lange auf sich warten. Der Leiter des Literaturhauses Hamburg, Dr. Rainer Moritz (*1958), hält in seiner Entgegnung vom 7. April gar nichts von Porombkas forschen Forderungen, und zwar gerade vor dem Hintergrund einer zunehmenden Konkurrenz in der hochtechnisierten Mediengesellschaft: „Wo die Literatur heute stärker denn je mit dem Internet, dem Film oder der Musik konkurriert, muss sie vor allem zeigen, dass sie ein Angebot macht, über das Internet, Film oder Musik nicht verfügen. Literarische Texte ernst zu nehmen und an ihre stille ästhetische Wirkung zu glauben heißt eben nicht, sie mit anderen Kunst- und Kommunikationstypen zu vermengen.“ Besser hätte ich es selbst nicht sagen können – und genau diesem Rezept bin ich bei meinen Literarischen Soireen stets treu geblieben, wenngleich ich im Verlauf eines Titanic-Abends mal ein Papiermodell des Luxusliners vorführte.
Porombka hatte, vermeintlich treffsicher, ein Schmähwort für die von ihm zum Anachronismus erklärte Veranstaltungsform gefunden. Er nannte sie „Wasserglaslesung“, weil neben dem Buch vor dem Autor meist nichts als ein Glas Wasser auf dem Lesepult steht – vorzugsweise kohlensäurefrei, damit der Rezitierende und seine Zuhörer nicht durch Rülpser vom reinen Textgenuss abgelenkt werden. Es bietet sich geradezu an, den Begriff als einen Ehrentitel aufzugreifen und in aller Unschuld offensiv für eine Reihe von bewusst schlichten Autorenlesungen zu verwenden, wie sie Moritz beschreibt, „wo es kein Brimborium, keine Musikbeschallung, keine Powerpoint-Präsentation, keine Weinverkostung gibt, allenfalls ein fundiertes Gespräch mit dem Autor, der zuvor seine Sätze auf die Zuhörer hat wirken lassen.“
Allerdings darf man nicht aus den Augen verlieren, dass der Verzicht auf das besagte Brimborium allein noch nicht zwingend eine gelungene Lesung nach sich zieht. Und ich muss sogar einräumen, dass der größere Teil der vielen Wasserglaslesungen, die ich in meinem langen Leser- und Buchhändlerleben aussitzen musste, zum Weglaufen war. Doch daran hätte multimedialer Hokuspokus auch nichts geändert, vielleicht allenfalls davon abgelenkt.
[Hier geht es zum ersten Artikel dieser Folge: Vorlesepein (I).]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Vorlesepein (II)
Saturday, 10. April 2010
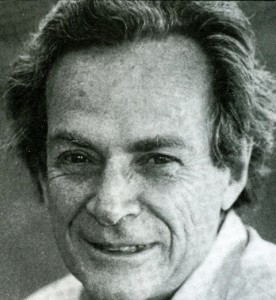
In den letzten Tagen habe ich vor dem Einschlafen ein äußerst unterhaltsames, vergnügliches, aufmunterndes Buch gelesen – das ich allerdings als Betthupferl nicht weiterempfehlen kann, denn es treibt einem die Müdigkeit aus. Sollte man zudem wie ich die Schlafstatt noch mit einer Bettgenossin teilen, so macht man sich durch gelegentliche unbezwingbare Lachanfälle unbeliebt. Die Rede ist von einer Sammlung autobiographischer Geschichten aus der Feder des US-amerikanischen Physikers Richard P. Feynman (1918-1988), die deutsch unter dem bezeichnenden Titel „Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman!“ erschienen ist. (A. d. Am. v. Hans-Joachim Metzger. München: Piper, 1987.)
Dabei hat Feynmans Erzählweise etwas an sich, was mich sonst auf die Palme bringen kann. Sie laufen nämlich in aller Regel darauf hinaus, dass uns Lesern keine andere Wahl bleibt, als Feynman unbedingt für den blitzgescheitesten, hinterlistigsten, witzigsten, unbeugsamsten und mutigsten Kerl aller Länder und Zeiten zu halten – kurzum für eins jener einsamen Genies, denen nur einer das Wasser reichen kann, nämlich ebenderselbe, und deren es in der besseren Gesellschaft des 20. Jahrhunderts mehr gibt als Einzelsocken in der Großwäscherei.
Tatsächlich war ich ungefähr bei Seite 80 nahe daran, das Buch wegen dieser nur notdürftig mit etwas Understatement gemilderten Posiererei aus der Hand zu legen. Doch dann beschloss ich, an Feynmans offenkundige Freude an der Selbstdarstellung für die restlichen 380 Seiten einfach keinen Anstoß mehr zu nehmen und mich ganz auf das zu konzentrieren, was er sonst noch, nämlich über den Rest der Welt zu sagen hat. Diesen Entschluss habe ich nicht bereut, denn er hat, was das betrifft, eine ganze Menge zu sagen. (Gegen Ende des Buches scheinen ihm übrigens selbst Gewissensbisse wegen seiner Protzerei gekommen zu sein, denn da treibt er das Understatement auf die Spitze, indem er zum Beispiel steif und fest behautet, dass der 1965 an ihn verliehene Nobelpreis für Physik ihm nur Ärger und Verdruss gebracht habe.)
Wenn ich die geistige Grundhaltung von Feynman auf einen einzigen Begriff bringen sollte, so würde ich sagen, er ist wo er geht und steht unorthodox. Wenn etwas stets und zu allen Zeiten auf diese Weise gemacht worden ist, und sei es mit den allerschönsten Erfolgen, so ist es für Feynman eine unabweisbare Herausforderung, es gerade auf eine völlig andere, womöglich entgegengesetzte Weise zu tun. Im schlimmsten Fall stellt sich heraus, dass es so nicht klappt, aber dann hat Feynman doch immer noch eine wertvolle Erfahrung gemacht. Wenn alle Welt behauptet, dass sich ein Tresor, der mit einer sechsstelligen Zahlenkombination verschlossen ist, nie und nimmer in einer halben Stunde öffnen lässt, dann führt Feynman einem staunenden Publikum ein ums andere Mal vor, dass er solche Tresore im Handumdrehen öffnet. (Wohlgemerkt handelte es sich dabei nicht um Geldschränke in irgendwelchen Banken, gefüllt mit schnödem Gold oder Geld, sondern um die Tresore in Los Alamos, die die Pläne für die ersten Atombomben enthielten, an deren Bau er mitwirkte.) Wenn er den Psychiatern der Musterungskommission Rede und Antwort stehen muss, um seine Tauglichkeit für die US-Army zu prüfen, antwortet er wahrheitsgemäß auf jede einzelne Frage, mit dem Ergebnis, dass er als „unnormal“ ausgesondert wird, und rekonstruiert dieses „Verhör“ zu unserer großen Freude Wort für Wort, damit wir nie vergessen, welch fragwürdige Größe die „psychische Normalität“ nach den Kategorien der Psychiatrie ist. Wenn er zu einem Kongress nach Japan eingeladen wird, verlässt er sofort die ausgetretenen Pfade des Wissenschaftstourismus und logiert gegen alle Widerstände nicht im Tagungshotel, sondern in einem Hotel im japanischen Stil, wo er nebenbei herausfindet, warum er bis dahin keinen Fisch gemocht hat und ihn nun ganz köstlich findet. Wenn alle Stammgäste einer Bar mit Oben-ohne-Tänzerinnen sich weigern, für den in Bedrängnis geratenen Besitzer einzutreten, weil sie um ihren guten Leumund fürchten oder sich einfach schämen, springt Feynman in die Bresche und kann nichts dabei finden, Nackttänzerinnen zu bewundern. Wenn Feynman in ein Gremium berufen wird, das die Freigabe neuer Mathematiklehrbücher zu verantworten hat, dann liest Feynman im Unterschied zu seinen Kollegen alle ihm vorgelegten Bücher gründlich von der ersten bis zur letzten Seite, findet sie überaus verbesserungsbedürftig und sorgt damit für einen Eklat. Und damit habe ich noch nichts über den Bongo-Trommler, den Aktzeichner, den Halluzinationsforscher, den Entzifferer eines Maya-Buches und über eine ganze Reihe weiterer Erscheinungsformen von Richard P. Feynman gesagt.
Da hat offenbar jemand in vollen Zügen ein sehr vielseitiges und unterhaltsames Leben gelebt. Und dazu passt auch, was Feynman kurz vor seinem Tod zum Besten gab: “I’d hate to die twice. It’s so boring.”
Posted in Eccentrics, Würfelwürfe | Comments Off on Einmal sterben reicht
Friday, 09. April 2010

Worauf ich seit bald zwanzig Jahren warte, das ist endlich eingetreten. Der kongeniale Tristram-Shandy-Übersetzer Michael Walter (*1951) hat nun auch Laurence Sternes zweites großes, kleineres Werk ins Deutsche übertragen: Eine empfindsame Reise durch Frankreich und Italien. Von Mr. Yorick (Berlin: Verlag Galiani, 2010).
Durch diesen Paukenschlag wurde ich erstmals auf den jungen Berliner Galiani-Verlag aufmerksam, der im vergangenen Herbst als Kiepenheuer&Witsch-Imprint von Wolfgang Hörner und Esther Kormann aus der Taufe gehoben wurde. Hörner hat selbst das Nachwort zu diesem Büchlein geschrieben, dem wir entnehmen, dass es schon mit der Übersetzung des Originaltitels – A Sentimental Journey trough France and Italy – ein Problem gab. Das Adjektiv “sentimental” war im Englischen ein Neologismus. Wie sollte man es ins Deutsche übertragen? Der bis heute meistgedruckte Übersetzer des Buches, Johann Joachim Christoph [nicht Christian, wie Hörner S. 328 fälschlich schreibt!] Bode (1730-1793), entlehnte hierfür das von Lessing gerade neu gebildete Wort „empfindsam“, das auf kurzem Weg bald zur Bezeichnung einer literarischen Bewegung herhalten durfte. Bodes Übersetzung wurde nicht nur viele Male neu aufgelegt, sondern auch von manchem vorgeblichen Neuübersetzer stillschweigend oder ausdrücklich zugrunde gelegt und lediglich modernisiert, wie Hörner in seiner Auflistung der überaus zahlreichen deutschsprachigen Ausgaben zwischen 1768 und 1963 vermerkt. Auch ich besitze eine solche Bode-Bearbeitung (Lawrence Sterne: Yoricks empfindsame Reise durch Frankreich und Italien. Übers. v. J. J. Bode. Bearb. u. Nachw. v. Franziska Meister. M. e. Titelill. u. 39 Federzeichn. v. Curth Georg Becker. Hamburg: Dr. Ernst Hauswedell & Co., o. J. [1946]). Sie kann ich gelegentlich zum Vergleich hinzuziehen, denn der Neuübersetzung geht naturgemäß der Ruf voraus, sexuelle Anspielungen des Autors deutlicher werden zu lassen als Bode und seine Zeitgenossen und Nachfolger in einer noch so viel „keuscheren“ Ära – und es könnte durchaus interessant sein, diese Differenz im Einzelfall nachzuvollziehen. Doch darüber ein anderes Mal. Heute will ich mich nur mit der materiellen Ausstattung dieses neuen Buches befassen.
Als in den Jahren 1983 bis 1991 im Zürcher Haffmans-Verlag die Erstausgabe der Walter’schen Tristram-Shandy-Übersetzung erschien, da imitierte diese Ausgabe sogar die Editionsweise des Originals. Jenes wie diese erschienen über einen Zeitraum von acht Jahren in neun Einzelbänden. Nun hätte man auch bei der Sentimental Journey ähnlich verfahren und die beiden ersten Teile des fragmentarisch geblieben Werkes in zwei separaten Bänden erscheinen lassen können, aber dann wäre die Ausgabe vermutlich zu teuer geworden. Was ich nicht bitter genug beklagen kann, ist ein anderer Mangel. Der Nachtwächter Bonaventura hat in einer frühen Blog-Rezension die Ausstattung des Buches gelobt und mit einer Einschränkung als „vollkommen“ bezeichnet. Wie gern würde ich mich diesem Lob anschließen, doch die Einschränkung bedeutet nun einmal das Schlimmste, was man einem Buch überhaupt antun kann: Es ist gelumbeckt!
Was das heißt, habe ich an anderer Stelle bereits einmal deutlich gemacht. Auf alle anderen offensichtlichen Vorzüge des Einbands, die Bonaventura aufzählt, könnte ich dankend verzichten: auf den flexiblen, bedruckten Leineneinband, auf die abgerundeten Ecken und schon erst recht auf das modisch gewordene Lesebändchen, das ohnehin bald ausfranst und schmuddelig wird – wenn das Buch nur fadengeheftet wäre! Manchmal ersehne ich die Zeiten der Interimsbroschur zurück, wo ein fadengeheftetet Buchblock bloß in etwas stärkeres Papier eingeschlagen war. Damit ging man zu einem Buchbinder seiner Wahl und ließ das Buch nach den eigenen Vorstellungen prachtvoll in Leinen, Leder oder Pergament für die Ewigkeit einfassen, ganz nach Gusto und Geldbeutel – und nur dann, wenn der Inhalt diesen Einsatz verlohnte. Dies wäre ja in diesem Falle durchaus angeraten, denn das Buch besticht durch eine exquisite Typographie, eine exzellente Übersetzung, solide Anmerkungen und ein informatives, illustriertes Nachwort, wie Bonaventura richtig anmerkt. Desto bedauerlicher, dass es für den entscheidenden Lebensfaden, an dem doch alles hängt, nicht gereicht hat.
Wo bleibt die Initiative zur Rettung der Buchkultur, die sich auf die Fahnen schreibt, das elendigliche Lumbecken wenigstens bei wertvollen Büchern zu bekämpfen und vor allem die Buchkäufer für den kleinen, aber entscheidenden Unterschied zwischen Lumbeck und Fadenheftung zu sensibilisieren? Sonst werden in hundert Jahren auch die wertvollsten Bücher aus unserer Ära nur noch eines sein: traurige Loseblattsammlungen!
[Titelbild: Federzeichnung v. Curth Georg Becker aus der erwähnten Ausgabe von Yoricks empfindsame Reise durch Frankreich und Italien, S. 122.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Sentimentale Reise, gelumbeckt
Wednesday, 07. April 2010

Gestern haben US-Außenministerin Hillary Clinton (*1947) und US-Verteidigungsminister Robert Gates (*1943) ein neues Strategiepapier der Obama-Regierung zum zukünftigen Umgang ihres Landes mit Atomwaffen vorgestellt. Diese 2010 Nuclear Posture Review (NPR) gilt vorläufig für die nächten fünf bis zehn Jahre und wurde allgemein als ein Fortschritt auf dem Weg zu einer globalen atomaren Abrüstung begrüßt, wobei die Meinungen wie üblich auseinandergingen, ob es sich hierbei nun um einen kleinen oder großen Fortschritt handelt.
Ich persönlich musste wieder einmal feststellen, dass mein eigenes Wissen über diese für die Zukunft der Menschheit doch so existenzbestimmende Frage lückenhaft bis falsch ist. Ich hatte bisher nämlich angenommen, dass die USA als freiheitlicher und friedliebender Staat Atomwaffen nur dann einsetzen würden, wenn ein feindlicher Aggressor sie zuvor mit Atomwaffen angegriffen hätte oder ein solcher Angriff unmittelbar bevorstünde und anders nicht abgewendet werden könnte.
Nun lese ich in dem gestern veröffentlichten Fact Sheet des U. S. Department of Defense Office of Public Affairs: “The United States will not use or threaten to use nuclear weapons against non-nuclear weapons states that are party to the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) and in compliance with their nuclear nonproliferation obligations.” Mit anderen Worten: Die USA hätten bisher auch Staaten mit Nuklearwaffen angreifen können, die solche Waffen nicht einmal selbst besitzen, geschweige denn sie gegen die USA zum Einsatz gebracht hätten oder dies wenigstens angedroht hätten. Und auch nach der neuen Selbstverpflichtungs-Erklärung schließen die USA nicht aus, Staaten mit Nuklearwaffen zu attackieren, die den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben haben, ganz gleich ob diese nun über solche Waffen verfügen oder nicht (#2.1 des Fact Sheet). Zurzeit sind dies allerdings nur die beiden erklärten Atommächte Indien und Pakistan sowie die beiden „vermutlichen“ Atommächte Israel und Nordkorea. Wenn ich es recht verstehe, dann könnten die USA somit selbst nach den fortschrittlichen neuen Regeln ein Atombömbchen auf meine Heimatstadt fallen lassen, wenn Deutschland unter Einhaltung der dreimonatigen Kündigungsfrist seine Zugehörigkeit zum Atomwaffensperrvertrag aufkündigen würde.
Aber keine Panik! Schließlich wollen die USA künftig nur unter „extremen Umständen“ und zur „Verteidigung ihrer vitalen Interessen“ zu diesem allerletzten Mittel greifen (#2.2 des Fact Sheet). Was das genau heißen würde, möchte ich mir vorläufig nicht ausmalen. Schließlich gibt es ja Szenarios, mit denen man weitaus wahrscheinlichere Katastrophen heraufbeschwören kann. Da ist z. B. noch immer die ungeklärte Frage, wie die mit Kernkraftwerken bestückten Staaten einen terroristischen Angriff dieser unzureichend gepanzerten Objekte durch gezielte Flugzeugabstürz oder panzerbrechende Waffen verhindern wollen. Fest steht wohl, dass selbst in Deutschland mindestens sieben Reaktoren gegen einen solchen Anschlag nicht ausreichend geschützt sind (Brunsbüttel, Philippsburg 1, Isar 1, Biblis A und B, Neckarwestheim 1 und Unterweser). Wie es im benachbarten Ausland aussieht, etwa in Tschechien oder im mit AKWs geradezu bepflasterten Frankreich? Ich will es lieber gar nicht wissen.
Einerseits soll man auch kleine Fortschritte begrüßen, in einer Welt, die zu Hoffnung so wenig Anlass gibt. Andererseits darf man sich nicht durch solche kleinen Fortschritte darüber hinwegtäuschen lassen, wie weit wir noch immer von einer langfristig stabilen Friedenssicherung auf diesem Planeten entfernt sind.
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Gleichgewicht des Schreckens
Sunday, 04. April 2010
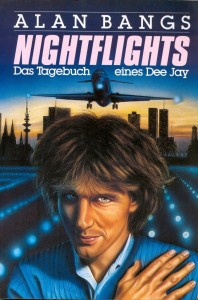
Gute Nachrichten für Alan-Bangs-Fans! Der Deutschlandfunk-Ableger DRadio Wissen hat den Meister der Popmusikansage – welch ein Euphemismus – zur Wiederbelebung seines legendären Nightflight gewinnen können.
In einer Preface-Sendung wurde Bangs von Nail Al Saidi und Julia Rosch in der „Redaktionskonferenz“ am 31. März 2010 zu seiner bewegten Geschichte am Mikrofon befragt. Man merkte dem zuletzt von den Sendern nahezu kaltgestellten Moderator an, wie sehr er den Augenblick dieses Comebacks herbeigesehnt hat. Und ich war erleichtert, ihn hier in alter Frische vernehmen zu können.
Was Bangs sagt, ist niemals nur so dahingesagt – und kommt ihm doch ganz entspannt über die Lippen. Da redet einer, der es nicht nötig hat, mit einem festen Konzept im Kopf durch die Sendung zu marschieren. Ein Gedanke ergibt sich organisch aus dem anderen.
Der Zuhörer wird mal zustimmen, mal anderer Meinung sein, das ist oft genug ja auch eine Frage des (Musik-)Geschmacks. Aber unterhaltsam sind diese nächtlichen Monologe immer gewesen. Das liegt zu einem guten Teil wohl auch daran, dass Bangs getrost darauf verzichten kann, seine Sendezeit mit langweiliger Faktenhuberei und degoutanten Skandalgeschichten zu füllen. In seinen besten Sendungen war die Musik schließlich nur der angenehme Ausgangpunkt für kluge Meditationen über Literatur und Kunst, die Liebe und das Leben, Ängste und Sehnsüchte, Versuchung und Verzweiflung, Glück und Unglück, Irrtum und Erlösung. Und es spricht einiges dafür, dass Bangs an diese schöne Tradition auf dem neuen Nightflight anknüpfen will. So hat er zum Beispiel angekündigt, in einer Sendung seine Begeisterung für Herman Melvilles Bartleby zu bekunden und zu erklären. (Damit rennt er bei mir natürlich offene Türen ein; vgl. meine XXIII. Literarische Soiree). Hoffentlich gewährt man ihm bei diesem Sender und in diesem Format die nötigen Freiräume, um seine unkonventionellen Spaziergänge durch die Popmusikgeschichte und -gegenwart ohne Fußfesseln und Scheren im Kopf unternehmen zu können.
Ab heute und künftig immer sonntags von 23:05 Uhr bis Mitternacht lauschen wir also neugierig bei DRadio Wissen auf Alan Bangs und seinen neuen Nightflight. Ich wünsche guten Start, weiten Flug und sichere Landung und werde hier sicher zu gegebener Zeit meine Meinung über das neue Hörfunk-Highlight kundtun.
[© Titelbild: Umschlagillustration von Lutz Kober zu Alan Bangs: Nightflights. Das Tagebuch eines Dee Jay. Düsseldorf u. Wien: Econ Verlag, 1985.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Hörfunk (IV)
Friday, 02. April 2010

Heute erfreut uns Google wieder einmal mit einem seiner lustigen Rätselbilder, die in unregelmäßigen Abständen die sechs bunten Buchstaben des Firmennamens aus chronikalischem Anlass verschönern.
Zum 2. April 2010 sehen wir also eine dunkelrote Blüte, der ein zwergenhaftes Mädchen im schulterfreien Abendkleid entspringt, zwei weiße Garnrollen und ein Nadelkissen mit sieben Stecknadeln.
Woran soll diese Kinderbuchillustration erinnern? Wenn wir mit dem Mauszeiger über das Bild fahren, werden wir schnell belehrt: „200ster Geburtstag von Hans Christian Andersen“ steht in dem ALT-Tag, das sich dann öffnet [s. Titelbild]. Klickt man auf das Bild, so erscheinen nacheinander noch vier weitere Illustrationen.
Nun weiß ich allerdings genau, dass der 200. Geburtstag des dänischen Märchendichters heute vor genau fünf Jahren gefeiert wurde. Ich selbst habe nämlich am 1. April 2005 eine Literarische Soiree zu seinen Ehren veranstaltet und mit meinen Gästen sozusagen in diesen Geburtstag reingefeiert.
Hans Christian Andersen wurde am 2. April 1805 (nicht 1810!) in Odense geboren, da beißt keine Maus einen Faden von ab. Google ist mit 100 Milliarden Dollar zurzeit die wertvollste Marke der Welt – und sollte nicht in der Lage sein, das korrekte Geburtsjahr eines weltberühmten Märchendichters zu ermitteln? Nun wurden die Andersen-Bilder nicht nur bei Google Deutschland, sondern auf allen Google-Homepages weltweit gezeigt – und natürlich auch bei Google Dänemark! Allerdings ist überall sonst die Datierung im ALT-Tag korrekt: „HC Andersens 205-års fødselsdag“ heißt es z. B. in Dänisch. Bloß die deutschen Google-Betreuer waren so bräsig, das Jubiläum um fünf Jahre abzurunden. Vielleicht mochten sie nicht glauben, dass ein so „unrunder“ Geburtstag wie der 205te solchen Aufwand rechtfertigte.
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Wednesday, 31. March 2010
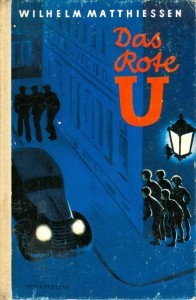
Als im Zeichen des Krebses Geborener des Jahrgangs ’56 war ich zur Einschulung Ostern 1962 noch nicht alte genug. Aber längst war ich begierig darauf, das Lesen zu lernen, damit ich endlich unabhängig würde von meinen Vorlesern, den Eltern und der Großmutter. Anfangs hielt mein Vater dem Drängen noch stand und erbat sich Geduld, denn es hieß nicht ganz zu Unrecht, dass es riskant sei, den Kleinen vor der Einschulung zu viel beizubringen, denn sie könnten sich dann im Unterricht leicht langweilen. Schließlich gab er doch nach und zeichnete eine Tabelle. In der linken Spalte standen in seiner gestochen scharfen Technikerschrift die Druckbuchstaben in der großen und kleinen Version, in der rechten Spalte daneben ein Gegenstand, der mit dem betreffenden Buchstaben anfing: A für Apfel, B für Birne und so weiter bis Z wie Zigarette.
Zunächst kam ich nur quälend langsam voran, aber dann ging es immer besser. Und ehe ich mich’s versah, las ich einfache Texte wie die Bildunterschriften in den beiden dicken Wilhelm-Busch-Bänden nahezu so schnell wie ein Großer, wenngleich mir manches „schwere Wort“ doch noch ein Rätsel blieb.
Wohl zu meinem achten Geburtstag 1964 schenkte mir mein Vater dann meinen ersten richtigen Roman. Es war ein Jugendbuch von Wilhelm Matthießen (1891-1965) mit einem geheimnisvollen Bild auf dem Einband und dem nicht minder geheimnisvollen Titel Das Rote U. Er selbst habe dieses Buch als Junge gelesen und sehr spannend gefunden – und jetzt sei er gespannt, wie es mir wohl gefiele.
Inzwischen weiß ich, dass gerade im besagten Jahr eine überarbeitete Neuauflage dieses Jugendbuch-Klassikers erschienen war, mit neuen, zeitgemäßeren Textzeichnungen von Irene Schreiber. Das Rote U erschien zuerst 1932 im Hermann Schaffstein Verlag in Köln, damals und bis zum 117. Tausend mit dem Titelbild und den Textzeichnungen von Fritz Loehr. Insbesondere die Kleidung auf diesen Bildern, die Schiebermützen und die knielangen Jungenhosen, aber auch die Formen der Autokarosserien und ein Polizist mit Helm entsprachen nicht mehr der Wirklichkeit Anfang der 1960er-Jahre. Anlässlich der Neuausgabe wird der Verlag für das Buch geworben haben, mein Vater erinnerte sich an seine Jugendlektüre – und so fand Das Rote U den Weg in mein Kinderzimmer. Ich war ebenso hingerissen von der Geschichte wie die abertausend Kinder in den dreißig Jahren zuvor. Und die Pointe, dass ausgerechnet der von allen verachtete Klassenprimus Ühl sich hinter dem geheimnisvollen Roten U verbarg, war sozusagen das Ü-Tüpfelchen dieses Krimis.
Dass sich hinter dem Verfasser dieses wunderbaren Lesevergnügens allerdings ein übler Nazi verbarg, ein überzeugter Antisemit und Kirchenhasser, Verfasser solcher Hetzschriften wie Israels Ritualmord an den Völkern und Der zurückbeschnittene Moses (beide 1939), das habe ich erst viel später erfahren und mein Vater wusste es vermutlich auch nicht. Natürlich ist Das Rote U immer noch ein stiller Bestseller, längst auch als Taschenbuch bei DTV verfügbar. Dass auf der Website dieses seriösen Verlages in der ausführlichen Vita die politischen Abwege des Wilhelm Matthießen mit keiner Silbe erwähnt werden, ist schon einigermaßen erstaunlich. Noch kurioser finde ich es aber, dass auf der Website des Schaffstein Verlages Matthießen zwar als einer von sechs Jugendbuch-Autoren aufgelistet wird. Klickt man aber seinen Namen an, so erscheint die Auskunft: „Sie sind nicht berechtigt, diesen Bereich zu sehen. – Sie müssen sich anmelden.“ Wie das mit dem Anmelden funktionieren soll, bleibt aber ein Rätsel. So fordert der allererste Krimi meiner Kindertage mehr als vier Jahrzehnte später erneut meine Neugier und meinen Spürsinn heraus. Wie überaus spannend!
[Zur ersten Folge dieser Serie geht es hier.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Erstlesealter (II)
Wednesday, 31. March 2010

Gestern noch, bei einem weiteren Besuch im Folkwang-Museum, fiel mein Blick vom neuen Eingangsportal über die Alfredstraße auf die zehn paarweise angeordneten Säulen in der kleinen Grünanlage neben dem Glückaufaus, deren Profile im schrägen Anschnitt gleich viele Buchstaben erkennen lassen: vier U, vier M, ein R, ein A. Diese unscheinbare Skulptur steht hier, fast versteckt oder immerhin doch gut getarnt, seit bald zwanzig Jahren. Hätte ich nicht aus verschiedenen Gründen ein besonderes Verhältnis zu ihr und ihrem Schöpfer, dann hätte ich sie auch gestern kaum wahrgenommen. Und selbst mir fiel bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal auf, dass die Buchstabenflächen auf den sechs kleineren Säulen heller sind als die auf den hohen. Aus der Distanz von mehr als hundert Metern glaubte ich zunächst, dass dieser Eindruck bloß durch einen zufälligen Schattenfall hervorgerufen worden sei. Oder ist dieser farbliche Unterschied vielmehr auf Witterungseinflüsse zurückzuführen?
Gerade lese ich zufällig in der Zeitung, dass Timm Ulrichs, von dem diese Umraum betitelte Skulptur stammt, heute seinen 70. Geburtstag feiert. Meine erste persönliche Begegnung mit diesem Künstler hätte um ein Haar am Nikolaustag 1972 stattgefunden, denn da trat Ulrichs im großen Saal des Folkwang-Museums auf, im Rahmen der legendären Veranstaltungsreihe Selbstdarstellung, die der damalige Geschäftsführer des Kunstrings Folkwang ins Leben gerufen hatte. Mich hatte wohl wieder einmal ein Migräneanfall aus der Bahn geworfen – und so entging mir dieses Ereignis, von dem mir aber Freunde berichteten. Was ich verpasst hatte, wurde mir spätestens klar, als ich im Jahr darauf den Sammelband mit den Protokollen dieser Reihe in Händen hielt. (Selbstdarstellung. Künstler über sich. Hrsg. v. Wulf Herzogenrath. Düsseldorf, Droste, 1973; über Timm Ulrichs S. 199-222.)
An Timm Ulrichs bewunderte ich von Anfang an, bewundere ich bis heute dreierlei: erstens seinen Ideenreichtum; zweitens seine Sorgfalt und Konsequenz bei der Verwirklichung; und drittens seinen speziellen, in seinen besten Kunststücken geradezu ontologischen Humor.
Dass er zudem ein überaus kämpferischer, für seine Überzeugungen mit allen Kräften eintretender Haudegen sein kann, das erfuhr ich anlässlich einer Jurysitzung, die ich als Zaungast verfolgen durfte. Beinahe wäre es zu dieser persönlichen Begegnung, 27 Jahre nach der ersten verpassten Gelegenheit, auch wieder nicht gekommen, denn diesmal war Ulrichs krank, lief mit tropfender Nase die präsentierten Bewerbermappen ab und schnäuzte sich alle paar Minuten – nein, nicht in Taschentücher, sondern in Klopapier, das er von einer aus den Toiletten des Hauses stiebitzten Rolle abriss.
Bei der großen Veranstaltung aus Anlass von Werner Ruhnaus 85. Geburtstag im Gelsenkirchener Musiktheater im Revier traf ich Timm Ulrichs dann am 14. April 2007 wieder, dort entstand auch das Titelfoto. Mit Ruhnau hat Ulrichs ja eins gemeinsam: Beide wollen in der Künstler-Nekropole Kassel beigesetzt werden. Für Timm Ulrichs war jede humane Lebensäußerung, vom Haarwuchs bis zur Sonnenbräune, Inspirationsquelle seiner künstlerischen Tätigkeit, warum sollte also sein Tod da eine Ausnahme machen? Ich frage mich allerdings, ob der Gedenkstein, den er bereits 1969 für seine Grabstelle angefertigt hat, durch die neueren Bestattungspläne seine „Gültigkeit“ verliert? Er trägt die Aufschrift: „Denken Sie immer daran, mich zu vergessen.“ Das Spiel mit Paradoxien war schon immer eins der Grundmotive der vergänglichen Kunst von Timm Ulrichs. Und ich werde darum gern immer daran denken, ihn zu vergessen. Aber noch lebt er ja, und hoffentlich lange, denn ich habe zurzeit verdammt viel anderes, das ich mit aller Gewalt vergessen muss.
Posted in Eccentrics, Würfelwürfe | Comments Off on Ich werde immer daran denken
Wednesday, 24. March 2010
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Verwechslung (II)
Tuesday, 23. March 2010

Ich bin nun zehn Jahre älter als mein Vater je geworden ist. Das ist eine einigermaßen befremdliche Vorstellung, denn streng genommen folgt ja aus ihr, dass ich nicht mehr zu einem so viel älteren, erfahreneren, weiseren Mann aufblicken müsste, als der er mir erinnerlich ist, wenn ihn eine Zauberhand etwa für einen Tag aus dem Paradies, in dem er unzweifelhaft jetzt wohnt und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt, in unser irdisches Jammertal zurückversetzen würde, sondern im Gegenteil ich diesem vergleichsweise jungen Spund die Welt erklären müsste, die sich in den seit seinem Tod vergangenen gut vierzig Jahren doch nicht wenig verändert hat.
In Sonderheit – welch schönes Wort! – seine Heimatstadt Essen würde ihn durch ihr vielfach gewandeltes Gesicht verblüffen und vielleicht auch erschrecken. Ich höre seine so liebe, so warme Stimme sagen: „Ach, das Hotel Essener Hof gibt es nicht mehr? Und was ist das da für eine Autounterführung vorm Ruhrkohlehaus? Hier stand doch früher die Stern-Brauerei, da roch es immer so unangenehm … und was ist das jetzt für ein Wolkenkratzer? Na, typisch, die Strommafia musste sich ja behaupten. Und diesen Gebäudekomplex nennt ihr also ,Rostlaube‘? Sehr passend. Das soll eine Universität sein? Da kann ich ja nur lachen. Ich jedenfalls würde da nicht studiert haben wollen. Und wo um alles in der Welt ist denn das schöne Althoff-Haus geblieben? Ach nee, Karstadt hieß das ja schon sechs Jahre lang, als ich so plötzlich abtauchen musste, oder besser: weggerissen wurde. Der Limbecker Platz ist jetzt also kein Platz mehr? Sondern ein untertunneltes Kaufzentrum? Sind die Essener den völlig verrückt geworden? Aber immerhin gibt es die Lichtburg ja noch. Gegenüber war Baedeker, wie heißt der Laden jetzt? Und sogar das Filmstudio neben dem Glückaufhaus ist noch da. In diesem Kino haben deine Mutter und ich, neun Monate vor deiner Geburt, den Film mit Spencer Tracy gesehen, von dem du deinen Vornamen hast: Manuel. Ach, lass uns doch mal zur Gruga fahren, wo deine Schwester auf der Rollschuhbahn ihre Kreise zog. Weißt du noch?“
Ja, ich weiß noch. Das war so laaangweilig! Ich bekomme schon Kopfschmerzen, wenn ich bloß daran denke. Und dieses Wehwehchen kann man ruhig Kotzschmerzen nennen, denn es drehte mir zuverlässig den Magen von zuunterst zuoberst. (Doch davon vielleicht später einmal.)
Nun mag man mich fraglos fragen können, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht in Essen, sondern beispielsweise in Hannover groß geworden wäre. Und wenn ich nicht 1956, sondern 1856 oder 1556 erstmals das Licht der Welt erblickt hätte. Und wenn ich nicht als Bub, sondern als Mädchen und nicht bei armen Leuten, sondern in einem wohlhabenden Hausstand und nicht mit kaputten Füßen, sondern kerngesund und nicht als Leuchte, sondern als trübe Funzel unter die Menschen gekommen wäre. Statt als unangepasster Bürger der BRD als angepasster Bürger der DDR? Aber was änderte das schon groß?
Hier stehe ich also, gehe ich also – bin wie ich bin und kann nicht anders.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Selbstbeschreibung (II)
Monday, 22. March 2010

… als die Zeitung von gestern. Ich weiß: Das hatten wir schon. Nun müssen wir aber noch hinzulernen, dass nichts näher liegt als die alte Zeitung aus Wien, zum Beispiel, der Wirkungsstätte von Karl Kraus. Von meinem findigen Massmedia-Navigator Conrad Kurzleb habe ich gelernt, dass man sich nimmer auf die überregionale Mainstreamjournaille verlassen soll. Oft wachsen die bundschillerndsten Sumpfdotterblümchen gerade auf den Glatzen der Provinzredakteure. Und so machte ich mir schon vor Jahr und Tag, neben zahllosen weiteren Zuträgern, meinen gutmütigen Wiener Freund Osram Gleißner gefügig, der mich seitdem in unregelmäßigen Intervallen mit den nach seinem maßgeblichen Dafürhalten spritzigsten Artikeln aus dem Kurier seiner Heimatstadt versorgt. Die schafft er notfalls auch durch Eis und Schnee heran, denn Osram hat sich auf ein sog. „Trafik-Rabatt-Abo“ verpflichtet. Und zwar „klebenslang“, wie er sagt, „da ich nicht weiß, wie das Kündjen funzioniert.“ Ich will ihm dann raten, einfach Hugo Portisch zu fragen, der sei ja bekannt dafür, komplizierte Vorgänge einfach zu erklären. Aber dann beiße ich mir jeweilen flugs auf die Zunge. Ich wäre ja schön blöd, mir durch diesen Tipp meine unregelmäßigen Zeitungsschnitzelzusendungen aus Wien zu verscherzen.
Bei Licht besehen ist der Kurier ja auch längst nichts anderes mehr als ein Produkt aus der Palette des WAZ-Konzerns direkt vor meiner Haustür. Und „Palette“ sollte man in diesem Zusammenhang besser in Anführungszeichen setzen, denn das Farbspektrum der unter diesem Dach versammelten Blätter reicht gerade einmal von hellocker bis mattbeige; was aber andererseits nicht ausschließen muss, dass gelegentlich ein dort erscheinender Artikel einen ganz eigenwilligen Farbreiz entfalten kann. Um nun schneller als erwartet auf den Punkt zu kommen: Mein Held des Tages heißt Peter Pisa und ist Kulturredakteur beim Wiener Kurier. Er hat sich einfallen lassen, oder sein Vorgesetzter hat ihn dazu gezwungen, am 29. Januar des Jahres Sándor Márais kleinen Roman Befreiung zu besprechen, der (aus dem Ungarischen und aus dem Nachlass übersetzt von Christina Kunze) kurz zuvor bei Piper erschienen ist.
Was dabei herauskam, darf ich getrost als staunenswert bezeichnen, ganz unabhängig davon, ob Márais Buch, der Anlass dieser Rezension, nun wirklich wert war, veröffentlicht zu werden. Schon der Einstieg ist eine Wucht: „Budapest wartet. Worauf warten die Menschen? Auf den Tod? Oder auf das Leben?“ – Und nur wenige Zeilen später erfahren wir, wie die Geschichte ausgeht: „Erzsébet tritt auf die Straße, vorbei an einem toten Soldaten der Roten Armee. Der hatte sie im Keller vergewaltigt. Er wirkte gar nicht böse. Hatte er gedacht, im Krieg vergewaltigen zu müssen? Erzsébet sagt auf der Straße: ,Es scheint, ich bin frei.‘ Niemand antwortet.“ Ist die Geschichte, an der Sándor Márai nach Auskunft des Rezensenten „gewiss nicht viel gefeilt“ hat, nun wert, von uns gelesen zu werden? Das Manuskript verstaute der Ungar, der sich dessen vermutlich auch nicht so recht sicher war, tief in einer Truhe in San Diego, bevor er am 22. Februar 1989 seinem Leben ein Ende setzte. Können wir Nachgeborenen uns nun ganz unvorbelastet an diesem literarischen Fund delektieren? Nein, denn „um sich über diesen Fund freuen zu können, musste nur noch der Schriftsteller wiederentdeckt werden. Das geschah Ende des 20. Jahrhunderts mit dem Roman Die Glut.“
In aller Unschuld spricht hier der Kulturredakteur des Kurier aus, was wir längst schon ahnten. Hätte es nicht 1998 das große Trara um Márais Roman Die Glut gegeben, wohl eines seiner schwächeren Werke, mit knapper Not dem Kitsch entkommend, dann würden keine gierigen Verlagsagenten in muffige Truhen hinabtauchen, auf der Suche nach einem Kassenknüller à la Kreuzung aus Márais Glut und dem zeitnah 2003 in der „Anderen Bibliothek“ erschienenen Dokument Eine Frau in Berlin von der Anonyma.
Das größte Rätsel der hier rezensierten Rezension bleibt aber ihr Titel: Leiden macht niemanden besser. (Ich gestehe, ich las erst falsch Leiden macht niemand besser. Also im Sinne von: „Die Leiderei kriegt niemand besser hin als Sándor Márai, diese melancholische Trauerfunzel.“ Aber da habe ich Pisa nun wirklich einmal Unrecht getan.) Macht denn Leiden nicht im Gegenteil immer besser? Ich immerhin hoffe doch sehr, dass mich das Leiden an dieser Buchbesprechung wenigstens ein kleines Stück weit optimiert hat.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Nichts ist älter (II)
Sunday, 21. March 2010
Posted in Godzilla, Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Popularität (II)
Sunday, 21. March 2010

[6] Wenn ich die fünf Punkte meines Pedifests vom November 2008 heute wieder lese, so muss ich schmunzeln über mein damals offenbar nicht nur ironisch gemeintes Vorhaben, mich mit einem solchen Kredo des „Selbsttransporttechnikverweigerers“ an die Spitze einer neuen politischen Avantgarde zu stellen. Es fehlte zur Vereinsmeierei dann ja nur noch die Ausgabe von Mitgliedsausweisen und die Bestellung eines Kassenwarts.
[7] Und wenn ich mich gedanklich zurückversetze in den Urzustand einer frühesten Euphorie durchs Schreiben, vermutlich also in mein sechzehntes Lebensjahr, dann verdankte ich auch damals schon diese Hochstimmung an der Schreibmaschine dem Abfassen von grundstürzenden, blutrünstigen, weltverbessernden Pamphleten, Unglaubensbekenntnissen, Manifesten.
[8] Der feine Nervenkitzel bei der Niederschrift, die zur jedesmaligen Übertreibung noch immer abgefeimterer Unverschämtheiten inspirierende Nickligkeit, die trotzige Gegenfrage auf den doch so billigen Einwand, dass ich mich mit meiner über jedes vernünftige Ziel hinausschießenden Radikalität außerhalb jeder sozialen Verträglichkeit stelle („Na, und?“), ohne darauf je eine plausible Antwort zu erhalten – das waren die prägenden Erfahrungen meiner Jugendzeit.
[9] Die hätten mich für die praktischeren Lebensertüchtigungen eines reiferen Erwachsenendaseins gänzlich unbrauchbar gemacht, wäre meinem lebensmüden Versagenskonzept (ich schrieb damals an einem provisorisch Scheiterhaufen betitelten Abgesang) nicht die Treffsicherheit meiner Abermillionen Spermatozoen und die Empfängnisbereitschaft von fünf Oocyten in die Quere gekommen. Der Rest war peripatetische Abgeklärtheit.
[10] Und dann? Dann verlässt unsereiner eben (oder gern auch uneben) die abgezirkelten Wandelhallen, die sich einem experimentierfreudigen Gespinsthirn über kurz oder lang freilich als Labyrinthe weit eher denn als Schubladensysteme offenbaren, um hinauszuschreiten in eine yottabytebreite und -hohe und -tiefe Webspaceweite, die einen Anfang vor einer Adler nicht kennt, wohl aber ein Ende im Zufall.
Posted in Flanerie, Würfelwürfe | Comments Off on Pedifest (II)
Saturday, 20. March 2010

Mein Bekenntnis zum Leben in dieser Unstadt namens „Revier“ gilt unverbrüchlich, trotz aller Anfeindungen selbst von Teilen meiner Nachkommenschaft, die mir verübeln, ihnen solch einen vermeintlich gesichts- und geschichtslosen Siedlungsraum zur Kulisse ihrer Kindheit und frühen Jugend aufgenötigt zu haben. Ich selbst fand es immer eher zweckdienlich, aus der Lokalität meiner Herkunft gerade keinen Stolz ableiten zu können. Die Städte, die hier zu einem großen Klumpatsch auf die hügelige Wald- und Wiesenlandschaft geschüttet wurden, gehen ineinander über und haben insofern nicht einmal eine Grenze. Wenn ich mit meinen Eltern Mitte der 1960er-Jahre aus dem Urlaub von der holländischen Nordseeküste heimkehrend in dieses Revier unter den grauen Himmel von Marxloh und Sterkrade abtauchte, dann wusste ich nie genau, ob ich nun noch in Oberhausen oder schon in Mülheim war.
So knüpfte sich mein Heimatgefühl immer schon einzig an den unmittelbaren Umkreis meiner jeweiligen Wohnstätten, Arbeitsplätze und Einkaufsgelegenheiten. Ich denke, man könnte mich in jede beliebige Stadt der Welt versetzen, ich würde es nirgends anders halten und mich nach einer Gewöhnungszeit von etwa einem halben Jahr dort heimisch fühlen. Und wozu soll denn übrigens auch sonst eine Stadtlandschaft gut sein, wenn nicht zur möglichst bequemen, möglichst unauffälligen Bereitstellung der fundamentalen Lebensgrundlagen? So wie ich im Traum nicht daran denke, meinen Schlafplatz in einem Museumssaal einzurichten, so wenig verlangt es mich danach, inmitten von Sehenswürdigkeiten beheimatet zu sein, die ohne Unterbrechung von einer Meute knipsender und juchzender Touristen heimgesucht werden. Venedig kann sehr kalt sein? Venedig markiert vielmehr schon lange den absoluten Minuspunkt sozialer Thermik.
Der Wartberg-Verlag in Gudensberg-Gleichen hat zwei erfolgreiche Buchreihen aufgelegt, die dem Bedürfnis der Menschen entgegenkommen, sich im gleichförmigen Strom der Zeit und im konturlosen Einerlei ihrer lokalen Herkunft doch in einer individuellen Besonderheit wiedererkennen zu können. Auf dass ich mich in meinem zufällig vor bald 54 Jahren begonnenen irdischen Dasein nicht ganz so einsam fühle, bietet mir der Wartberg-Verlag den Band Wir vom Jahrgang 1956 – Kindheit und Jugend an. Und damit ich weiß, dass ich als Kind und Jugendlicher in meiner Heimatstadt nicht ganz so einsam war, wie ich mich zeitweise fühlte, gibt es aus dem gleichen Verlag das Büchlein Aufgewachsen in Essen in den 60er und 70er Jahren. In diesen beiden reich illustrierten Bänden wird mir zum Gesamtpreis von 25,80 € das lauwarme Gefühl einer Gemeinschaftlichkeit angetragen, die sich allerdings bei näherer Einlassung eher als Wechselbad erweist. Vielleicht rührt diese Ambivalenz ja aber auch bloß daher, dass ich eben kein „waschechter Essener“ bin wie Walter Wandtke, der Journalist und Autor letztbesagten Büchleins, der laut Klappentext seit 20 Jahren das Essener Stadtgeschehen beobachtet und mich mitnehmen will „auf eine authentische Reise durch die Kindheit und Jugend der 60er und 70er Jahre“ in meiner Vaterstadt.
Wenn die persönliche Ursprungsstätte schon so gar nichts an außergewöhnlichen Besonderheiten aufzuweisen hat, dann müssen eben wohlfeile Wiedererkennungswerte über den Frust hinwegtrösten, aus einer Gegend zu stammen, die im internationalen Vergleich eher als No-Name-Produkt durchs Raster anspruchsvollerer Provenienzwettbewerbe fällt. „Essen – Die Stadt, in der wir aufgewachsen sind, ist so ganz anders als alle Städte dieser Welt!“ So verspricht es uns Essenern der Wartberg-Verlag auf der Rückseite seines „Aufgewachsen-in-Essen“-Buchs. Aber der gleiche Slogan steht mit zuverlässiger Regelmäßigkeit auch auf den übrigen Büchern der Reihe: „Aachen, Aschaffenburg, Bamberg, Bielefeld, Bochum, Bonn, Braunschweig, Bremen, Celle, Chemnitz, Darmstadt, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Freiburg, Fürth, Gelsenkirchen, Gera, Gießen, Göttingen, Halle, Hamburg, Hamm, Hannover, Heilbronn, Ingolstadt, Jena, Kaiserslautern, Karl-Marx-Stadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Krefeld, Leipzig, Lübeck, Ludwigshafen, Lüneburg, Mainz, Mannheim, München, Münster, Neuss, Nürnberg, Ost-Berlin, Paderborn, Pforzheim, Regensburg, Rostock, Schwerin, Solingen, Ulm, Velbert, West-Berlin, Wiesbaden, Wolfenbüttel, Wuppertal und Würzburg – die Stadt, in der wir aufgewachsen sind, ist so ganz anders als alle Städte dieser Welt.“
Mit gleichem Recht könnte man etwa auch sagen: Nichts ist gleichförmiger als die vermeintliche Differenz! Oder noch allgemeiner: Nichts ist trivialer als des Menschen sterbliches Streben nach Originalität.
[Titelbild: © Stadtbildstelle Essen, hier als Ausschnitt gescannt von dem besprochenen Band © Wartberg-Verlag.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Findling (II)
Saturday, 20. March 2010

Marcus von Hochstengel schätzt diese verregneten Wochenenden im Spätwinter nicht sehr, wenn er einerseits die Schnauze voll hat vom Indoorgolfen, andererseits aber die Trainingsbedingungen unter freiem Himmel an Kneippsches Wassertreten erinnern und der Trolley alle nasenlang im Morast steckenbleibt. Zudem hat er schlecht geschlafen wegen dieser schwelenden Steuersache, die noch längst nicht ausgestanden ist. Jetzt ist schon von tausendeinhundert Verdächtigen die Rede, die die Fahnder einen nach dem anderen unter die Lupe nehmen wollen. Eigentlich vertraut er ja dem Rat seines in fiskalischen Angelegenheiten wesentlich beschlageneren Bruders. Max meint, dass er sich notfalls auf seine tragisch verunglückte Frau zurückziehen soll. Aber dass er so eine Strafe vermutlich abwehren kann, ist ja nur die eine Seite der Medaille und auch eine saftige Steuernachzahlung kein Zuckerschlecken.
Immerhin steigt von Hochstengels Laune, wenn ihm wieder einfällt, dass er die bald sechsjährige Tochter nun endlich in einer Privatschule bei Luzern hat unterbringen können. Das verwöhnte Blag hat ihm in den vergangenen Wochen wahrlich den allerletzten Nerv geraubt. Gerade jetzt wieder vernimmt sein feines Ohr, dass Naomi beim Battlefield–Spielen im Salon auf ihrem Laptop reihenweise Heckenschützen des Vietcong eliminiert.
Aber die pinkfarbenen Koffer seines halbverwaisten Töchterchens stehen gepackt in der Empfangshalle. Spätestens in einer Stunde müsste Kurt mit dem Wagen zurück von der Waschanlage kommen und ihn erlösen. Dann bräche der Chaffeur mit Naomi Richtung Schweiz auf. Marcus von Hochstengel konnte noch nie so recht glauben, dass sich Karoline diesen Wechselbalg tatsächlich bei ihm eingefangen hatte. Weder die Segelohren noch die engstehenden Augen kamen bei seinen gräflichen Ahnen vor. Und schon gar nicht hatte Naomi diese hässlichen Ausrutscher ihrer Physiognomie von ihrer unseligen Mutter geerbt. Deren tadelloses, nahezu berückend schönes Äußeres war ja schließlich der einzige Grund gewesen, warum er Karoline Dorffmann vor den Traualtar geführt hatte.
Von Hochstengel beschließt, sich die Zeit bis zu Kurts Rückkehr mit einer Trainingsstunde in seiner Fitnesshalle zu vertreiben. Hinter seiner Tischtennisplatte ist eine Ballwurfmaschine aufgebaut, die wahlweise Konterbälle, Unterschnittbälle, hohe Abwehrbälle und Topspins servieren kann, von soft bis superhart. Marcus geht in Abwehrstellung und legt den Schalter um. Er hat diesmal nicht den Hauch einer Chance.
Dass es Naomis Idee gewesen sein sollte, das Magazin der Wurfmaschine zur Abwechslung mal mit Golfbällen zu befüllen, das konnte sich der herbeigerufene Hausarzt „eigentlich nicht vorstellen“. Die Reise nach Luzern wurde angesichts dieses tragischen Unglücksfalls zunächst einmal abgesagt.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Aus der Mitte (II)
Friday, 19. March 2010

Dieser Tage ist Nr. 74 von Das Schreibheft erschienen, ein Heft zu Ehren der Lyrikerin und Alfabetkünstlerin Inger Christensen (1935-2009).
Meine erste Begegnung mit dem einzigartigen Werk der Dänin ereignete sich vor über dreißig Jahren. Weil mir damals nur sehr wenig Geld zur Verfügung stand, kaufte ich gern aus den Ramschkisten. Es erwies sich, dass dort oft Bücher angeschwemmt wurden, die für durchschnittliche Leser offenbar „zu schwierig“ waren. So kommt es, dass seit dem 24. Oktober 1979 der schmale Roman Azorno in meinem Regal steht. Statt 6,00 DM erwarb ich ihn für nur 2,95 DM. Die Übersetzung von Hanns Grössel aus dem Jahr 1972 ist die erste deutsche Buchausgabe von Christensen überhaupt und sollte es für lange sechzehn Jahre auch bleiben. Sie erschien in der avangardistischen „Reihe Fischer“, die 1970 mit Daniil Charms Fälle aufgemacht hatte. Die großen Verlage leisteten sich damals noch solche ambitionierten Extravaganzen. So gab es seit 1968 die quietschgelbe „Reihe Hanser“, seit 1970 die „Sammlung Luchterhand“ in ihren Klarsichtfolienumschlägen, seit 1972 in schrillem Pink „Das Neue Buch“ im Rowohlt-Verlag und so fort.
Der Pappeinband von Azorno in komplementärem Lila und Grün ist so grell gestaltet, dass es fast in den Augen schmerzt [s. Titelbild]. Über die Arbeit an diesem Roman von 1967 hat sich die Autorin 1986 in einem Gespräch mit Jan Kjærstad so geäußert: „Die ersten Seiten sind extrem langsam geschrieben. Sie haben sehr lange gelegen. Dann war der Rest des Buches plötzlich in drei Wochen fertig, mit verschlossener Tür, kein Unterschied zwischen Tag und Nacht, wieder und wieder dieselbe Schubert-Platte gespielt, fast in einer Stimmung wie der Welt abhanden gekommen.“ (Eine Kombination von der Welt und mir selbst. Jan Kjærstad im Gespräch mit Inger Christensen. A. d. Norw. v. Angelika Gundlach; in: Schreibheft Nr. 74, März 2010. Essen: Rigodon Verlag, 2010, S. 133.) – Aber welche Schubert-Platte denn?
Viel später, am 1. November 2003, las ich auf meiner neunundneunzigsten Literarischen Soiree aus Inger Christensens großem Gedicht das von 1969, das soeben im Verlag Kleinheinrich erstmals in deutscher Übersetzung, wiederum von Hanns Grössel, erschienen war. (Auf der Rückseite des deutschen Azorno-Bändchens war der dänische Titel Det übrigens provisorisch noch mit Es eingedeutscht worden.) Und neulich erst fischte ich wieder ein Romänchen von Christensen aus dem Ramsch, Das gemalte Zimmer, im Original erschienen 1976, zwanzig Jahre später dann in deutscher Übersetzung, überflüssig zu sagen von wem. Dafür zahlte ich 3,95 €, statt der ursprünglich verlangten 22,80 DM. Bücher haben nicht nur ihre wechselvollen Schicksale, sondern auch ihre wandelbaren Preise.
Und so lautet der vorletzte Satz von Azorno: „Als der Park zugemacht werden sollte und der Springbrunnen zusammensank, so daß die Wasseroberfläche ruhig wurde, entstand einen Augenblick Stille, alles wurde still, doch nie völlig still, da das Geräusch der Bewegungen von den vielen Menschen rasch zunahm, da das Geräusch all dessen, was ich geschrieben hatte, rasch zunahm und meiner Erlebnisfreiheit Grenzen setzte, aber in der Stille dieses Augenblicks standen wir auf, hörte ich die ganze Zeit Batsebas Atem und küßte sie, in diesem Augenblick, als wir einander küßten, erlebten wir zum erstenmal in unserem Leben die milde Abendluft.“ (Azorno, a. a. O., S. 97.)
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Habent sua fata libelli (II)
Thursday, 18. March 2010

Heute sind 617 Tage nach Heute (I) vergangen, rund zwanzig Monate und zweieinhalb Wochen, oder etwas weniger als ein 32stel (schreibt man orthografisch richtig so?) meines bisherigen Lebens. Vor ein paar Tagen hielt ich noch für möglich, dass meine Tage gezählt sein könnten: Blut im Urin! Nach allerlei mehr oder weniger unangenehmen, mehr oder weniger interessanten Inspektionen meines Urogenitaltrakts beim Facharzt weiß ich nun: Meine Nieren sind bis auf ein paar harmlose Zysten ohne Befund, meine Prostata ist für mein Alter eher ungewöhnlich klein, meine Harnblase zeigt nicht die Spur einer gut- oder gar bösartigen Geschwulst. Für das Blut gibt es also keine rechte Erklärung, was ich einerseits beruhigend, aber andererseits doch auch nicht restlos zufriedenstellend finde. Wäre ich ein Tier, würde ich vermutlich an meiner blassrot gefärbten Pisse geschnuppert haben, leicht irritiert, um dann zur Tagesordnung überzugehen, etwas verstört für den Moment, sorglos für den Rest meiner Tage. Da ich aber ein Mensch bin, malte ich mir aus, wie schrecklich meine verbleibende, kurze Zukunft nun werden könnte, nachdem ich die niederschmetternde Diagnose erfahren haben würde: unmittelbar bevorstehendes Nierenversagen oder Prostatitis oder Blasenkrebs oder alles zusammen oder von jedem etwas, jedenfalls nur noch ein stetiges Abwärts ohne Hoffnung. Das ist nun mal die hässliche Kehrseite der Medaille, in deren Vorderseite ich die schöne Welt spiegeln kann, als ein beliebiges Exemplar des ersten vernunft- und phantasiebegabten Hirntiers auf Terra, mit der Begabung zum sprach- und schriftlichen Ausdruck. Pling!
Heute nutzte ich das erstmals frünglingshafte Wetter, das mir im Fall einer bitteren Diagnose sicher wie der blanke Hohn erschienen wäre, nun aber meine ohnedies gute Laune noch um einen weiteren Hub liftete, zu einer kleinen Exkursion mit Lola in den Wald und an den Bach, wo ich zahlreiche Fotos machte und dabei schon im Voraus litt, weil ich wusste, dass es schwer werden würde, mich für eins von ihnen zu entscheiden, als Titelbild für diesen Artikel über heute, den 18. März 2010. Anschließend schoss ich mich aus dem Grünen ins Graue, mitten hinein in die europäische Kulturmetropole des Jahres, die City von Essen, und dort zunächst in die Stadtbibliothek im Gildehofcenter, wo ich Bücher über Joseph Roth und Jan Vermeer zurückgab und jeweils zwei Bände aus der Robert-Walser- bzw. Hermann-Broch-Werkausgabe auslieh; dann in die Buchhandlung proust dicht nahebei, wo ich das vorbestellte und druckfrisch eingetroffene Buch Verirren von Kathrin Passig und Aleks Scholz abholte und mit der geistreichsten Buchhändlerin Westdeutschlands ein Pläuschchen hielt: über die Leipziger Buchmesse, die heute eröffnet; über Lenka Reinerová (1916-2008), die letzte Prager Autorin deutscher Sprache, die im stolzen Alter von 90 Jahren als „Jahrhundert-Zeugin“ neben Johannes Heesters und anderen Urgesteinen 2007 zur Buchmesse in Leipzig aufgetreten war, der einzigen, die Beate Scherzer bisher besucht hat, wobei Reinerová klargestellt habe, dass sie mitnichten die letzte noch lebende Zeitzeugin sei, die Franz Kafka (1883-1924) noch erlebt habe, wie aus den Lebensdaten beider doch unmittelbar erhelle, was so nicht ganz stimmt, denn die achtjährige Reinerová hätte durchaus an den vierzigjährigen Kafka noch eine Erinnerung bewahrt haben können. Knirsch!
Heute überschlugen sich wieder einmal die Ereignisse in meiner weitverzweigten Familie, aber das gehört nun einmal nicht hierher. Wenn ich davon berichten und darüber schreiben dürfte, wäre dieses Weblog vermutlich noch um einiges wertvoller als Zeugnis der Zeit. Klatsch!
Heute meldet die Zeitung vom Tage mir leider nichts, denn sie wurde mir nicht zugestellt. Oder, wenn sie mir zugestellt wurde, dann erreichte sie mich immerhin nicht. Jedenfalls fand ich sie nicht vor im Briefkasten neben der Haustür, noch im zusätzlich angebrachten Briefkasten im Carport der Vermieterin neben dem Haus. Und nachdem ich bei einer stark verschnupften Call-Center-Mitarbeiterin das Ausbleiben meiner Süddeutschen Zeitung reklamiert hatte, die mir deren Nachlieferung fest zusicherte, warte ich jetzt um vier Uhr nachmittags immer noch auf deren Eintreffen. Ob dies nun an der mangelhaften Zustellung liegt oder anderer Erklärungen bedarf, das weiß ich noch nicht, aber ich werde es zweifellos herausbekommen, denn meine Neugier ist ebenso phantasievoll wie hartnäckig. Immerhin versorgt mich die SZ ja auch online mit den wichtigsten Nachrichten vom Tage. Vielleicht sollte ich die monatlichen 43,90 € doch künftig einsparen? Raschel!
Heute werde ich in Robert Walsers Prosa aus der Berliner, Bieler und Berner Zeit stöbern, ein weiteres Mal mit Lola in den Wald gehen, dazu überirdisch schöne Musik hören, mit meinem jüngsten Sohn Tortellini a la Manuele essen und dann … Seufz!
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Wednesday, 17. March 2010

Hier stehe ich nun erstmals im Dunklen. So schön ich meinen Artikel vom Juli 2008 über die schlampige Simenon-Übersetzerin (1990) und den in diesem Einzelfall nicht minder schlampigen ZEIT-Kolumnisten (Januar 2008) immer noch finde – und so sehr es mich nach wie vor tröstet, dass mir immerhin ein vereinzelter elmore, und nun wohl für alle Ewigkeit, in meiner Indignation Gesellschaft leistet: Welche Fortsetzung ist zu diesem Klageschrei denkbar, der in einen klitzespitzen Juchzer mündete?
Die von mir dort monierten Zersetzungserscheinungen der Sprache in den Weblogs: das haarsträubende Kauderwelsch der dumpf schmatzenden, glucksend delirierenden Analphabeten aus der zweiten Reihe, das Gestotter und Gestammel, Gemecker und Gemümmel unberufener Tastenschinder – all diese zum Himmel stinkenden Unerfreulichkeiten, die den Ehrentitel „Satz“ nicht verdienen, haben sich erwartungsgemäß unterdessen noch immer weiter aufgesteilt. Man schaut nicht mehr drüber über diesen Mount Unflat, halb aus Nichtwollen, halb aus Nichtkönnen geschissen und geschmiert.
Lichtblicke? Einen Karl Kraus der Blogosphäre habe ich noch nicht entdeckt – was aber nicht viel heißen muss, denn der weltweite Netzraum von heute ist nicht annähernd so überschaubar wie der Zeitungsmarkt der österreichischen k. u. k. Monarchie vor hundert Jahren. Ich bin schon froh, wenn ich gelegentlich Weblogs aufspüre, die wenigstens die Standards der besseren Printmedien erfüllen, was Orthografie und Interpunktion, Grammatik und Syntax, Wortwahl und Stil betrifft – und die stammen dann leider meist von Nischennistern, Nerds und Geeks, deren Anliegen ich für so randständig halte, dass mich ihr rechtschaffenes Bestreben kaum mit dem sonstigen Tiefstand der Blogsprache versöhnen kann.
Aber was nicht ist, kann ja noch werden, und so will ich diese Rubrik vorläufig am Köcheln halten. Nach einem Winter, den selbst ich – der die meteorologischen Laiendiskurse meiner Mitmenschen an den Unterstellhäuschen der öffentlichen Personennahverkehrsmittel als ununterbietbar sinnfreien Neodadaismus erleidet und in Zeiten, da sich das Klima wandelt, Wettermäkeleien geschmacklos nennt – zuletzt doch als reichlich nervtötend empfand, passt es zudem sehr gut zum ersten frühlingshaften Tag des Jahres und seinen auf die Mauern der Stadt gespritzen Sonnenflecken, wenn ich die Hoffnung auf Lichtblicke auch in virtuellen Sphären, wenigstens für ein Weilchen noch … wachhalte.
Und einen ganz kleinen literarischen Lichtblick möchte ich zum Abschluss dieser Überbrückungshilfe doch noch beisteuern, wenngleich nicht aus einem Blog, sondern ganz konventionell aus einem Buch. Ich habe unterdessen entdeckt, dass besagter ZEIT-Kolumnist schon früher einmal über Georges Simenon geschrieben hat, über dessen Roman Betty, dann auch über Die grünen Fensterläden, was wohl seine bzw. seines Kumpanen Claus Philipp Lieblingsromane von diesem Autor sind. (Tod eines Schauspielers; in Franz Schuh: Schwere Vorwürfe, schmutzige Wäsche. Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2006, S. 170-179.) Soll ich es nun Zufall oder Vorsehung nennen, dass Schuh gerade in diesem Stückle auf die Rolle des Übersetzers zu sprechen kommt? Er zitiert zunächst eine Passage über den Nerz, den Bettys Gatte seiner Frau spendiert, um dann anzumerken: „Simenons Pelzmantelsatz, übersetzt von Raymond Regh, macht winke, winke mit dem Zaunpfahl.“ Lichttupfer auf einem Zaun habe ich fürs Titelbild leider nicht herzaubern können. Stattdessen liefere ich immerhin den Lichteinbruch ins Schlafzimmer meiner Mutter vor der Wohnungsauflösung.
Posted in Würfelwürfe | 1 Comment »
Tuesday, 16. March 2010

Erst vor ein paar Tagen habe ich mir im Rahmen einer Lesertypologie die Frage gestellt, woran es liegen mag, wenn Leser es nicht übers Herz bringen, ein einmal gekauftes und „angefangenes“ Buch vor der Zeit aus der Hand zu legen, es vielmehr bis zur letzten Seite auslesen, es sich bis zum bitteren Ende einer womöglich längst schon geahnten Enttäuschung einverleiben müssen. Am Geiz? Ich finde es, bei aller Scheu vor übereilten Verallgemeinerungen, in diesem Zusammenhang interessant anzumerken, dass nach meiner langjährigen sorgfältigen Beobachtung die Liebhaber dicker Bücher bei den zwanghaften „Auslesern“ überrepräsentiert sind.
Was ich völlig vergessen hatte und heute nur dank der selbstverordneten Revision älterer Blogbeiträge entdecke: Ich habe mich, was den bevorzugten Umfang des Lesestoffs angeht, hier vor Jahr und Tag schon einmal geäußert. Aber wie falsch, wie unwahr, oder mindestens doch: wie ungenau waren meine seinerzeitigen Ausführungen! Diesen Artikel würde ich am liebsten löschen, aber ich will ja zu meinen Schwächen und Fehlern stehen. Fast kommt es mir so vor, als würde man den Büchern, wollte man sie zuallererst nach dicken und dünnen unterscheiden, ähnliches Unrecht tun, als bewertete man Menschen nach ihrem Kontostand.
Ob mein Entschluss, Pynchons Against the Day in der deutschen Übersetzung gründlich zu lesen und zudem noch in meinem Weblog ausführlich zu kommentieren, ursprünglich aus diesem schwächelnden Artikel Wälzer (I) resultierte, wie das negative Ergebnis einer arithmetischen Gleichung? Ich fürchte es fast. Bekanntlich kam dieses bestenfalls manierierte, schlimmstenfalls hirnverbrannte Vorhaben vor fast einem Jahr zum Stillstand. Was wäre wohl daraus geworden, hätte ich mich stattdessen für die Exegese von Jonathan Littells Die Wohlgesinnten entschieden? Wir wissen es nicht und werden es nie erfahren.
Beide Bücher verstauben nun in meinen Regalen. Längst haben die emsigen Verlagsmaschinerien wieder eine Vielzahl dicker Romane in die Buchhandlungen geklotzt. Und wieder war ich hin- und hergerissen [s. Titelbild]. Soll ich mir nun das Haupt- und Lebenswerk von David Foster Wallace (1962-2008) gönnen, die endlich erschienene Übersetzung von Infinite Jest? Schließlich hatte ich ja anlässlich seines Todes von eigener Hand den bisher einzigen Nekrolog in diesem Weblog erscheinen lassen. Oder soll ich mich auf 2666 einlassen, das Meisterwerk des Chilenen Roberto Bolaño (1953-2003)?
Wie schon bei Pynchon und Littell zähle ich mal wieder die Wörter. Für Bolaño komme ich auf 390.000 und für Wallace (die „Anmerkungen und Errata“ mitgerechnet) auf 520.000 Wörter. Für Unendlicher Spaß spricht, dass ich hier das amerikanische Original immerhin zum Vergleich heranziehen kann; und tatsächlich habe ich mir schon im Januar vorigen Jahres, perfektionistisch wie ich bin, die Paperback-Ausgabe von Little, Brown and Company zugelegt. Für 2666 hingegen lässt sich anführen, dass mich dessen erstes Kapitel (von insgesamt fünf) bereits in einer Leseprobe erreicht und aufs Höchlichste entzückt hat. Wieder einmal eine schwere Entscheidung. Eins steht aber jetzt schon fest: Zu solch einem mikroskopischen Leseprotokoll wie bei Pynchons Gegen den Tag lasse ich mich nicht noch einmal verführen. Und sollte ich gar beider Bücher nach hundert Seiten überdrüssig werden, hindert mich nichts, sie in die staubige Stubenecke zu pfeffern. Fort mit Schaden! Nichts ist unersetzlicher als die über dürftiger Lektüre verschwendete Zeit.
Posted in Würfelwürfe | 1 Comment »
Monday, 15. March 2010

Die fatalen Generalisierungen – die Spießer, die Großkopferten, die Proleten, die Türken, die Glatzen, die Amis, die Muchels, die Männer, die Juden, die Ärzte etc. ad lib. et inf. – waren Angriffspunkt und Zweifelsfall meiner Zeitkritik im Juni 2008, als ich nur halb im Scherz auf der Suche nach der Wurzel allen Übels die gleichmacherische Begriffsbildung als möglichen Hauptübeltäter dingfest machen wollte. Wer mit vager Geste am gemütlichen Biertisch meint, „Dieda!“ in einen Topf werfen zu dürfen, der ist unter ungemütlicheren Umständen auch bereit, „Dieda!“ mit präzisem Fingerzeig ins Gas zu schicken [s. Titelbild, Selektion an der Rampe in Birkenau].
Dass dergleichen schreckliche Vereinfachungen und Vereinheitlichungen im Umgang mit den Mitmenschen überhaupt in Betracht kommen können, um dann eine für viele verführerisch bequeme Denkgewohnheit zu werden, setzt eine Hypertrophie der menschlichen Gemeinwesen voraus, ist eine Folge der Verstädterung. Wo man sich nicht mehr mit Namen kennt; wo man das passierende Gegenüber nurmehr im Ausnahmefall grüßt; wo das Erscheinungsbild der anderen im öffentlichen Raum das von anonymen Fremden ist – da bedarf es zur Orientierung eben solch grobschlächtiger Zusammenfassungen der wimmelnden Individuen unter beliebiges Akzidentia.
Der Begriff der Masse drängt sich hier in den Vordergrund. Wann immer ich mich diesem Begriff nähere, beschleicht mich das schlechte Gewissen, Elias Canettis theoretisches Hauptwerk Masse und Macht (1960) immer noch nicht gelesen zu haben. Seit fast dreißig Jahren steht dieses Buch in meinem Regal, sogar in einem vom Autor im Oktober 1973 signierten Exemplar. Vermutlich hat mir Canetti mit den Ausführungen über dessen Entstehungsgeschichte in seiner Autobiographie so viel Respekt eingeflößt, dass ich mich an diesen spröden Brocken nicht mehr wohlgemut herantraue. Zudem wären ja auch die anderen Klassiker zum Thema „Masse“ – von Gustave Le Bon (1895), Siegfried Kracauer (1927), José Ortega y Gasset (1930), Hermann Broch (1948) und David Riesman (1950) – noch einmal vorzunehmen und im Hinblick darauf abzuklopfen, ob sie für meine Fragestellung etwas hergeben: „In welchem Verhältnis steht das neuzeitliche Phänomen der Masse und dessen Wahrnehmung durch das Individuum zu des letzteren Bereitschaft, andere Individuen ihrer Einzigartigkeit zu entledigen und sie anonymisierend, typisierend und schließlich generalisierend diffusen Gruppen zuzuschlagen?“
Was für ein vertracktes Wort „Masse“ im Sprachgebrauch über das Soziale ist, das hat mir jüngst noch H. G. Adler deutlich gemacht, bei dem ich las: „Der Nationalsozialismus verwandelte den Menschen aus einer zur Autonomie berufenen und berufbaren Persönlichkeit bedenkenlos in einen behandelten Gegenstand. Darin war die nationalsozialistische Herrscherklasse unbedingte Anhängerin ihrer materialistisch denkenden und empfindenden Zeit, die schon vorher und auch außerhalb dieses Machtbereiches von Menschen und Völkern mit einem pseudokollektivistischen Ausdruck als von ,Masse‘ zu reden wagte. Das Phänomen ,Masse‘ als eine beliebige Vielzahl von Menschen psychologisch zu untersuchen, müssen wir uns versagen, aber wir weisen darauf hin, daß in dem Augenblick, wenn man von Menschen als ,Masse‘ zu reden beginnt, das menschliche Bewußtsein gestört ist, mag auch der aktuelle Zustand des Menschen zulassen, sich als ,Masse‘ bezeichnen und behandeln zu lassen, während die gleichen Menschen gegen den viel weniger beleidigenden Ausdruck ,Vieh‘ sich sofort verwahren würden.“ (Das geistige Antlitz der Zwangsgemeinschaft; in: H. G. Adler – Der Wahrheit verpflichtet. Hrsg. v. Jeremy Adler. Gerlingen: Bleicher Verlag, 1998, S. 121.) – Erstaunlich übrigens, dass im aktuellen Wikipedia-Artikel über „Masse (Soziologie)“ Wilhelm Reichs The Mass Psychology of Fascism (1933) keine Erwähnung findet.
Dass sich im Rassenwahn meiner Vorfahren die distanzierte „Zusammenfassung“ von Mitmenschen zum Zwecke ihrer Auslöschung vollzogen hat, also mit einer Konsequenz, die an Schrecklichkeit bisher nicht übertroffen wurde, nämlich bis zur Konzentration der Enteigneten im Lager und bis zum Hineinpressen der Entkleideten in die Kammern, das hat den Blick auf die dürftigen, scheinbar harmlosen Ursprünge des generalisierenden Taxierens leider nicht geschärft. Im Gegenteil! Wenn ich zwischen dem Holocaust und der Gleichmacherei der Rhetorik über die Hartz-IV-Empfänger, die Kinderlosen oder die Steuerbetrüger ad lib. et inf. einen Zusammenhang herstelle, dann ziehe ich mir leicht den Vorwurf zu, die Banalisierung des Bösen zu betreiben. Nichts liegt mir ferner.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Dieda (II)
Sunday, 14. March 2010

Am 22. April 2008 schrieb ich unter der Titelzeile Otto N. (I): „Den nächsten Spiegel kaufe ich frühestens in 26 Wochen. Bis dahin werde ich regelmäßig montags, unter der Headline ,Otto N.‘, von der ganz individuellen, originellen, exzentrischen Auswertung dieser ,Mittelmäßigkeit‘ zehren können. Nur 13 €-Cent als Vorabinvestition für jeden dieser Blog-Beiträge – da kann ich doch wahrlich nicht meckern! – Danke, Spiegel!“
Das ist nun auch schon wieder fast zwei Jahre her. Ich habe keineswegs allwöchentlich 26 Montagsglossen zu meinen individuellen, vielleicht gar individualistischen Abweichungen von Otto Normalverbrauchs Verhaltensunauffälligkeiten verfasst. Statt hier mit Otto N. (XXVII) einen dann fälligen oder längst überfälligen Schlussstrich unter die Auseinandersetzung mit dem Normdeutschen zu ziehen, kehre ich nun erstmals wieder zu diesem im weiteren Sinn demoskopisch-statistischen Thema zurück. Und tatsächlich gibt es einen aktuellen Anlass, mich erneut mit den Schrecknissen der Normalität auseinanderzusetzen. Axel Hacke berichtet in seiner jüngsten Glosse Das Beste aus aller Welt über einen Test, dem er sich unterzogen hat: „Auf der Internetseite der Grünen Jugend Kreis Gütersloh habe ich meinen ökologischen Fußabdruck errechnet. Der ökologische Fußabdruck ist die Fläche, die ein einzelner Mensch benötigt, um auf der Erde leben zu können. Also: Ein durchschnittlicher Deutscher braucht für seinen Lebensstandard 4,8 Hektar, ein Inder aber nur 0,7. Ich musste Fragen nach meiner persönlichen Lebensführung beantworten, wie viel ich also Auto fahre, ob ich Energiesparlampen benutze, wie groß meine Wohnung ist, dann dauerte es ein paar Sekunden, Ergebnis: ,Zur Deckung deines Lebensstils benötigst du 5,1 Hektar … Würden alle Menschen leben wie du, bräuchte die Menschheit 2,7 Erden. Du liegst im Bereich des deutschen Durchschnitts, aber weit entfernt von einem nachhaltigen Lebensstil.‘“ (Süddeutsche Zeitung Magazin Nr. 10 v. 12. März 2010, S. 50.)
Warum Hacke ausgerechnet den Online-Rechner der Grünen Jugend Kreis Gütersloh gewählt hat, um die Größe seines ökologischen Fußabdrucks zu ermitteln, das bleibt rätselhaft. Vielleicht um der Originalität halber? Ich komme unter dieser Adresse nach Beantwortung der 33 teils reichlich befremdlichen Fragen auf einen Anspruch von 2,5 globalen Hektaren (gha), und es wären 1,3 Planeten erforderlich, wenn man Kants Kategorischen Imperativ auf meine Lebensführung übertragen würde.
Wesentlich seriöser erscheint mir z. B. der Footprint-Rechner des österreichischen Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Dort werden die vier großen Lebensbereiche Wohnen, Ernährung, Mobilität und Konsum unterschieden und getrennt abgefragt. Im Gesamtergebnis komme ich diesmal auf 3,2 gha, wobei ich im Bereich Mobilität am besten abschneide (0,00 gha), immerhin noch unterdurchschnittliche Werte bei Wohnen und Ernährung erreiche (0,77 bzw. 0,81 gha) und lediglich beim Konsum über dem Durchschnitt liege (1,62 gha).
Dass ich aber bei aller vermeintlichen Beschränkung und radikalen Abweichung von der herrschenden Normalität dennoch einem Lebensstil fröne, zu dessen dauernder Befriedigung eine 1,8-fach größere Erde erförderlich wäre, wollten es mir alle 6,8 Milliarden Menschen auf der Welt gleichtun – das ist allerdings ernüchternd! Ich frage mich sogar, ob es unter den Existenzbedingungen einer deutschen Großstadt überhaupt möglich ist, meinen ökologischen Fußabdruck so weit zu reduzieren, dass er eins zu eins mit den maximalen Produktivitätskapazitäten unseres Globus zusammenpasst.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Otto N. (II)
Saturday, 13. March 2010

Anlässlich der Titelrevision (und -amputation um die überflüssige Datumsangabe) musste ich feststellen, dass ich viele Male eine (I) hinter einen Titel gesetzt habe, ohne irgendwann eine (II) darauf folgen zu lassen. Offenbar versprach ich mir von dem angeschnittenen Thema noch weitere nahrhafte und appetitliche Tortenstücke. Doch drängten sich allzu bald andere Themen in den Vordergrund und ich vergaß, dass ich da eine Fortsetzung angekündigt hatte, die ich bis heute schuldig geblieben bin. Nun will ich die Gelegenheit ergreifen, diese zwei Dutzend Artikel daraufhin zu überprüfen, ob sich auch aus der Distanz eine Fortführung ihres jeweiligen Themas lohnt – oder ob ich sie als Solitäre stehenlassen und dann konsequent die Nummerierung (I) löschen soll.
Und dies sind die Überschriften der Auftaktartikel, die noch darauf warten, durch adäquate Nachfolger zu bloggologischen Sequels veredelt zu werden: Otto N., Dieda, Wälzer, Lichtblicke, Heute, Habent sua fata libelli, Aus der Mitte, Findling, Webstalking, Pedifest, Popularität, Nichts ist älter, Selbstbeschreibung, Verwechslung, Erstlesealter, Vorlesepein, Robinsontag, Homo immobilis, Blickweiten, Abwege, Texttraum, Q’s Gequatsche, Manchmal und Lesertypologie. – Na, bin ich nicht fleißig?
In den kommenden Tagen werde ich mir diese potenziellen Rohrkrepierer einen nach dem anderen vorknöpfen und auf ihre konkrete Welthaltigkeit und abstrakte Sinnhaftigkeit hin abklopfen. Erweist sich deren Aussage im Einzelfall als ideelle Eintagsfliege, dann wird ihr Zickzackflug augenblicklich abgeklatscht und stillgelegt. Trägt aber der Gedankenflug aus dem usprünglichen Einfall über den inspirierten Urmoment hinaus, dann wäre ich doch der Letzte, einem solchen Sebstläufer den nötigen Entfaltungsraum vorzuenthalten. Dann mögen (II) ff. sehen, wo sie ihren Weg und ihr Ziel finden.
An diesem Beispiel wird vielleicht besonders gut nachvollziehbar, warum ich das Weblog als schriftliche Ausdrucksform so reizvoll finde. Es gestattet mir als work in progress zu jedem Zeitpunkt eine Wiederaufnahme alter Motive, fordert mich dazu heraus, mich immer wieder mit älteren Gedanken aus neuerer Sicht zu konfrontieren und sie fortzuspinnen, sooft sie über den Tag hinaus Lebenskraft behaupten.
Die Nummerierung – mal in Klammern, mal ohne, mal in römischen, mal in arabischen Zahlen – wurde bei Gelegenheit dieser Revision übrigens vereinheitlicht. Ab sofort sind Fortsetzungsartikel immer durch römische Zahlen in Klammern kenntlich gemacht. Und wenn meine Zeit es zulässt, werde ich demnächst am Ende jedes einzelnen Fortsetzungsartikels zu allen anderen Artikeln der Serie, älteren wie früheren, verlinken.
Posted in Langsamkeit, Würfelwürfe | Comments Off on (I) ff.
Thursday, 11. March 2010

Eine kleine Bemerkung in eigener Sache. Aus Gründen, die mir mittlerweile selbst nicht mehr einleuchten, habe ich die Titel meiner Webartikel in diesem Blog von Anfang an so aufgebaut: Wochentag, Komma, Tagesdatum, Monatsname, Jahreszahl, Doppelpunkt, Titel, ggf. Nummerierung (in Klammern oder ohne, in römischen oder arabischen Zahlen).
Schon nach der ersten Veröffentlichung eines Beitrags am 25. März 2008 war mir klar, dass ich hier eine Redundanz produzierte, denn unter meinem Titel Dienstag, 25. März 2008: Netzschach steht in kleiner Schrift, vom System automatisch generiert, noch einmal: Dienstag, 25. März 2008. (Zumindest wenn man den Artikel im Archiv aufruft; aber auch in der aktuellen Ansicht wird das Publikationsdatum angezeigt, allerdings ohne den Wochentag.)
Manchmal neige ich leider zu „Sturness“, und so trotzte ich allen behutsamen Nachfragen besorgter Freunde, warum ich denn und ob ich nicht. Das sei doch eigentlich nicht nötig, das mit dem Datum zu Anfang des Titels. – „Schon gut, schon gut!“ So endeten für gewöhnlich vonseiten der banausischen Mäkler an den Existenzgrundlagen meines Blogs diese Dispute, und dessen über alle Zweifel erhabener Schöpfer zog sich in seinen Schmollwinkel zurück.
Die bitteren Folgen solcher Halsstarrigkeit bekam ich alle Tage (und besonders an den Donnerstagen im September = 19 Buchstaben + 1 Leerzeichen) zu spüren, wenn nämlich für meine Titel nur noch wenig Platz blieb in dieser einen Titelzeile. Das zwang mich zu einer geradezu asketischen Verknappung beim traurigen Rest meiner Überschriften, eine Not, die ich mir lange genug als Tugend verkaufte. Jetzt ist aber Schluss mit diesen Sperenzchen!
Ab sofort verzichte ich auf die Datumsangabe in der Titelzeile und streiche sie auch rückwirkend aus den mittlerweile 550 „alten“ Artikeln. (Das kann trotz der praktischen QuickEdit-Funktion bei WordPress ein paar Tage dauern.) Ab sofort darf ich also auch längere Titel verwenden! Dabei fühle ich mich etwa so, als hätte ich zwei Jahre lang mit einem Knebel im Mund sprechen müssen, der jetzt in seiner monströsen Überflüssigkeit vor mir auf dem Tisch liegt. Ich muss mich nun wohl bezähmen, die neu gewonnene Freiheit nicht über Gebühr zu strapazieren.
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Wednesday, 10. March 2010

Menschenklassifikationen sind ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Es gibt teusendundein Kriterium der Klassifizierung, da sind der Phantasie des Menschensammlers wahrlich keine Grenzen gesetzt. Aus verständlichen Gründen interessiert mich besonders eine Typologie meiner Mitmenschen, nämlich die nach ihrem Verhalten als Leser.
Im Hinblick hierauf sind zunächst grundsätzlich Nichtleser von Lesern abzugrenzen, welch letztere dann etwa in Gelegenheits- und Vielleser geschieden werden können, oder in freiwillige und Zwangsleser. Bevor man in einem weiteren Schritt, was vielleicht am nächsten liegt, nach der Art der Lektüre fragt, z. B. die Gruppen der Krimileser, Leser historischer Sachbücher oder Gedichtleser bildet, gibt es aber noch einige andere Merkmale zur Unterscheidung, die die spezielle Art und Weise des Lesens betreffen. Hier gibt es eine Reihe von spezifischen Eigenarten, die mir bei meiner Beobachtung des Leserverhaltens in meiner weitläufigen Bekanntschaft und früher auch bei meinen Kunden immer wieder begegnet sind.
So gibt es gar nicht wenige Leser, die ein Buch grundsätzlich bis zur letzten Seite, also zu Ende lesen, es „auslesen“, wie man auch sagt, ganz gleich, ob es ihnen gefällt oder nicht. Diese Leser scheinen ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn sie die Lektüre mittendrin abbrechen. Vielleicht geben sie die Hoffnung nicht auf, dass das Buch doch noch eine überraschende Wendung zum Guten nimmt, unterhaltsamer wird oder tiefsinniger, ganz nach ihren jeweiligen Erwartungen. Ist es zum Beispiel ein Roman, dessen Handlung voller Widersprüche und logischer Fehler steckt, dann erhoffen sie sich einen genialen Clou, der im Nachhinein diesen ganzen Blödsinn plausibel werden lässt.
Ich habe immer schon vermutet, dass es sich bei diesem Typ in der Regel um einen auch sonst zu Sparsamkeit neigenden Menschen handelt, der schlecht verträgt, bei einem nur zur Hälfte konsumierten Produkt nicht ganz auf seine Kosten zu kommen. Interessanterweise bevorzugen nach meiner Beobachtung solche Leser dicke Bücher: je dicker, desto besser. (Ob der Umkehrschluss gilt, dass Liebhaber dicker Bücher grundsätzlich Geizkragen sind? So weit würde ich nicht gehen. Überhaupt sollte man, wenn man sich mit Klassifikationen und Typologien beschäftigt, immer auf der Hut sein vor leichtfertigen Verallgemeinerungen.)
Was nun mich selbst als Leser betrifft, so gebe hier gleich offen und ehrlich zu, dass ich mich keineswegs verpflichtet fühle, ein Buch auf Teufel komm raus zu Ende zu lesen, bloß weil ich einmal die Nase hineingesteckt habe. Ich gestehe weiter, dass ich in meinem langen und wechselvollen Leserleben weitaus mehr Bücher zu lesen begonnen, als zu Ende gelesen habe. Die Gründe, warum ich die Lektüre unterbreche, oft genug dann ganz abbreche, sind sehr vielfältig. Mal hält das jeweilige Buch nicht, was die Kritik versprach. Oder es mag zwar in seiner Art ganz ausgezeichnet sein, entspricht aber momentan nicht meinem Bedürfnis. Vielleicht passt es auch bloß atmosphärisch nicht zu meiner augenblicklichen Stimmung. Dann wieder geht mir ein scheinbar unbedeutendes Detail so sehr gegen den Strich, dass ich das Buch sofort aus der Hand legen muss, wenn es hart kommt mitten im Satz. Oder aber es ereignet sich in meinem wirklichen Leben eine Trivialität, die mich zunächst nur für Stunden oder Tage aus dem Lesen eines ganz passablen Buches herausreißt. Ich bin fest entschlossen, sobald die Gelegenheit wieder günstiger ist, zu diesem Buch zurückzukehren. Das Lesezeichen steckt an der richtigen Stelle zwischen den gelesenen und den ungelesenen Seiten. Und doch finde ich nicht mehr zurück in die Zusammenhänge der Geschichte. Mit diesem und jenem Namen vermag ich keine konkreten Vorstellungen mehr zu verbinden. Ich blättere zurück und versuche, den Faden wieder aufzunehmen, stoße auf Passagen, die mir nun völlig fremd erscheinen und so vorkommen, als hätte ich sie beim ersten Lesen irrtümlich überschlagen. Schließlich gebe ich auf und greife nach einem anderen Buch, auf dessen Beginn ich ohnehin eigentlich schon neugieriger war als auf die Fortsetzung des angebrochenen, das mir nun entsetzlich fade erscheint, wenn ich nur von Ferne daran schnuppere. So treu ich als Liebhaber von Menschen bin, so untreu bin ich als Genießer von Büchern.
[Wird fortgesetzt.]
Posted in Babel, Würfelwürfe | 1 Comment »
Monday, 08. March 2010
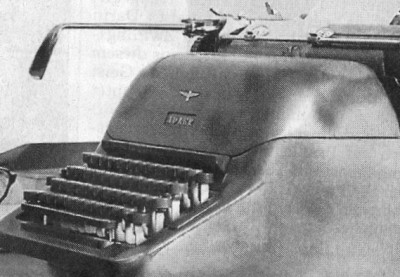
Manchmal zweifle ich, ob dieses Projekt, mein Weblog, nicht etwa bloß eine Ablenkung von etwas anderem ist, ein Platzfüller, ein Mittel, den Tag zu bestreiten. Manchmal frage ich mich, ob das Schreiben daran, seit nun bald zwei Jahren und nahezu täglich, auch nur wieder eine Sucht ist, oder mindestens eine Gewohnheit, jedenfalls eine zwanghafte Widerholung ohne Aussicht auf ein natürliches Ende, also ziellos wie das Rauchen von Zigaretten oder das Überfliegen der Tageszeitung. Manchmal spiele ich mit dem Gedanken, diese liebe Gewohnheit von heute auf morgen aufzugeben, wie ich schon so viele Gewohnheiten, liebe und weniger liebe, im Laufe meines unfassbar langen Lebens aufgegeben habe, um die Zeit, die dadurch frei wurde oder besser leer, mit etwas anderem zu füllen, das vielleicht weniger ziellos sein und ein natürliches Ende immerhin in Aussicht stellen könnte.
Manchmal denke ich an die weit, weit zurückliegende, lange, lange vergangene Zeit zurück, als ich noch auf einer mechanischen Schreibmaschine der Firma Adler tippte [s. Titelbild], deren einziger besonderer Service darin bestand, gelegentlich durch Umschaltung des Farbbandes ein Wort in roter Schrift schreiben zu können, ein Luxus, der sich aber bald erstens als entbehrlich und zweitens als unökonomisch herausstellte, weshalb ich nach der nahezu restlosen Abnutzung der schwarzen und der nahezu spurlosen Schonung der roten Hälfte des Farbbandes nun ein konventionell rein schwarzes Band kaufte, ohne rote Halbspur, denn das konnte man umdrehen, wenn die obere Hälfte abgenutzt war, es hielt also doppelt so lange vor und war zudem auch in der Anschaffung etwas billiger.
Manchmal erinnere ich mich in diesem Zusammenhang auch an die verschiedenen Techniken, die gegen das unvermeidliche Übel des Vertippens seitens der Schreibwaren- und -maschinenhersteller in Anschlag gebracht wurden, nachdem ja zunächst das Durchixen das Mittel der Wahl gewesen und lange geblieben war; aber diese urtümlichen Verhältnisse liegen ja geradezu im Paläolithikum der mechanisierten Schreibtechnik, und so bin ich jetzt gerade tatsächlich gerührt, dass im aktuellsten Rechtschreibduden das Verb durchixen noch vorkommt, als „ugs. für auf der Schreibmaschine mit dem Buchstaben x ungültig machen“. (Duden. Die deutsche Rechtschreibung. 24., völlig neu bearb. u. erw. Aufl. Mannheim ∙ Leipzig ∙ Wien ∙ Zürich: Dudenverlag, 2006, S. 341. – Genau zwölf Seiten vorher steht übrigens der „Doppelklick“.) Manchmal denke ich, dass die enormen technischen Erleichterungen des Korrekturvorgangs beim Schreiben – vom Tipp-Ex-Streifen über Tipp-Ex flüssig über das Korrekturband und die Speicherschreibmaschine mit Zeilendisplay – paradoxerweise der Sorgfalt der Schreibenden und damit der Qualität ihrer Ergebnisse eher abträglich waren. Manchmal bin ich insofern ganz froh, diese mühselige Schule der Berichtigung mit meist nicht ganz sauberem Ergebnis durchgemacht zu haben und hoffe, dass sie mich zu einer Schreibdisziplin erzogen hat, die zuletzt mein Geschriebenes veredelt – und zuallerletzt dem Leser das Lesen erleichtert.
Manchmal trauere ich aber gar jener Zeit nach, als die Fehler auf dem Papier noch untilgbare Spuren hinterließen. Dann hieß es eben einfach: Auf ein Neues! Und manchmal, um endlich zu einem vorlufigen Schluss zu kommen, hoffe ich, dass die Spuren, die ich auf der Oberfläche (des Papiers, der Monitore) hinterlasse, zwar oberflächlich nahezu fehlerfrei sein mögen, sich aber irgengendwann, genauer betrachtet, als ein einziger großer Fehler erweisen, allerdings mit keinem noch so deckfähigen Liquid Paper zu tilgen.
Posted in Dingwelt, Langsamkeit, Würfelwürfe | 2 Comments »
Sunday, 07. March 2010

Immer wieder zieht es mich zu den negativen Kraftzentren meines Denkens zurück, deren es freilich noch einige mehr gibt als die klassische Zwillingsgestalt des Bösen im Zwanzigsten Jahrhundert: Auschwitz und Hirsohima. Wenn ich wie unlängst durch einen unangemessenen Beifall für eine Nichtigkeit aufgeschreckt bin, muss ich geradezu triebhaft in die entgegengesetzte Richtung laufen. So machte ich dieser Tage endlich mit meinem längst gehegten Vorsatz Ernst, mich dem großen Werk von H. G. Adler (1910-1988) anzunähern.
Dieser wahrhaft unentbehrliche Zeitzeuge der Shoah hat in seinem in der dritten Person verfassten Nachruf bei Lebzeiten (1970) zu seinem Vornamen erklärt: „H. G. steht für Hans Günther, dies die Namen zweier jung verstorbener Brüder der Mutter, die alle drei zu verleugnen er nie wünschte, ohne doch noch diese Namen voll zu führen, nachdem Adolf Eichmanns Vertreter für das ,Protektorat Böhmen und Mähren‘ in den Jahren 1939 bis 1945 eben so geheißen hatte.“ (H. G. Adler – Der Wahrheit verpflichtet. Interviews, Gedichte, Essays. Hrsg. v. Jeremy Adler. Gerlingen: Bleicher Verlag, 1998, S. 8.)
H. G. Adler war als Jude seit Anfang 1942 im Ghetto Theresienstadt interniert, wurde im Oktober 1944 für zwei Wochen nach Auschwitz verbracht und sodann bis Kriegsende als Zwangsarbeiter in Buchenwald interniert. Schon in seiner Zeit in Theresienstadt plante Adler, seine Beobachtungen im Lager für die Nachwelt festzuhalten und machte sich erste Notizen zu einer wissenschaftlichen Abhandlung. Die Objektivierung seiner Wahrnehmungen erleichterte ihm nach eigenem Bekenntnis entscheidend das seelische Überleben in der Hölle der Lager. Gleich nach seiner Befreiung machte er sich an die Arbeit und verfasste sein Hauptwerk Theresienstadt 1941-1945 (Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft. Geschichte, Soziologie, Psychologie. Tübingen: Mohr / Siebeck, 1955).
Dieses Buch ist viel mehr als nur ein Buch über das Wesen der Konzentrations-, Arbeits- und Vernichtungslager, und es leistet auch mehr als die Analyse dieser künftig immer bestehenden Option der Entmündigung, Entwürdigung und Entseelung des Menschen, deren Methoden und Techniken. Es erlaubt, zwar auf sehr schmerzvolle Weise, einen tiefen Blick in die Abgründe der conditio humana, eine sowohl präzise als auch differenzierte Gesamtschau menschlicher und unmenschlicher Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Man lese nur die Kurzbeschreibungen der 14 „Charaktere nach Typen“, die der hellsichtige Beobachter H. G. Adler, „bei allen Vorbehalten gegen schemtische Einteilungen“, in Theresienstadt unterscheiden konnte: „Gebrochene, Ängstliche, Betäubte, Gedankenlose, Pessimisten, Realisten, Optimisten, Illusionisten, Aktive, Brutale, Opportunisten, Willensstarke, Helfer, Gütige.“ (H. G. Adler: Theresienstadt. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft. M. e. Nachw. v. Jeremy Adler. Göttingen: Wallstein Verlag, 2005, S. 669 ff.)
In seinem bereits erwähnten Nachruf bei Lebzeiten beklagte sich Adler unverhohlen darüber, dass ein beträchtlicher Teil seines Werkes, gerade viele erzählende Schriften und die meisten seiner zahllosen Gedichte, trotz seiner hartnäckigen Bemühungen um einen Verlag unveröffentlicht geblieben waren. Dies war auch unmittelbar vor seinem Tod nicht anders, als Jürgen Serke „die Mißachtung dieses universalen Geistes“ einen Skandal nannte, „für den die deutschen Verlage verantwortlich zeichnen. Ein Skandal, in dem die anerkannten Größen der Nachkriegsliteratur, die immer wieder auf Adlers künstlerische Einzigartigkeit hingewiesen haben, wie Dummköpfe dastehen […].“ (Jürgen Serke: Böhmische Dörfer. Wanderungen durch eine verlassene literarische Landschaft. Wien / Hamburg: Paul Zsolnay Verlag, 1987, S. 327.) Immerhin erschien zwei Jahre später der Roman Die unsichtbare Wand aus dem Nachlass, der 35 Jahre auf diese Veröffentlichung gewartet hatte. – Ich werde in näherer Zukunft einige Lesezeit darauf verwenden, H. G. Adler genauer kennenzulernen. Und ich werde über diese Begegnung gelegentlich hier berichten.
[Titelbild: H. G. Adler 1969; aus: Serke, a. a. O., S. 343.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on H. G.
Friday, 05. March 2010
Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Thursday, 04. March 2010

Ich liebe gute Interviews, ganz gleich in welcher Form: live, im Fernsehen, im Rundfunk, gedruckt in Zeitschriften oder Büchern, auch im Internet als Audio- oder Videopodcast. Leider sind gute Interviews sehr selten; und sehr gute Interviews gibt es beinahe nicht, so rar sind sie. Um dem Leser eine Enttäuschung zu ersparen, gestehe ich zweierlei gleich vornweg, hier im ersten meiner obligatorischen fünf Absätze: Dieser Eintrag handelt nicht von einem wirklich guten Interview. Und schon gar nicht verrate ich, welche sehr guten oder auch nur guten Interviews mir in meinem langen Hörer-Seher-Leser-Leben bisher begegnet sind. Solche Best-of-Listen sind schließlich ein kleines Vermögen wert. Und wenn ich schon hier in meinem Weblog meine Beobachtungsgabe, Fabulierfreude und Spekulationslust, meinen kritischen Verstand und meine emsige Kreativität zum Nulltarif verschleudere, dann geht mein Altruismus doch nicht so weit, auch die Früchte meiner Erfahrung und Sammelwut für lau auf dem Marktplatz des globalen Dorfes unter die Leute zu bringen.
Damit ich ein Interview gut nenne, muss eine ganze Reihe von Forderungen erfüllt sein. Jede einzelne Frage sollte sowohl den Interviewten als auch den Leser insofern überraschen, als sie sich möglichst weit von den immergleichen Standardmotiven entfernt. Wer einen Regisseur nach den nüchternen Fakten seines Films befragt, nach den Tücken der Finanzierung und den Pannen bei den Dreharbeiten, sollte den Beruf wechseln. Das Interview ist eine literarische Technik, die darauf abzielt, mehr über eine Person ans Licht zu bringen, als diese über sich selbst weiß. Insofern haftet dem Interview etwas von einer Geburt, einer Vergewaltigung oder einer Vivisektion an, je nachdem. Im Idealfall ist nach dem strapaziösen Zwiegespräch deutlich geworden, dass auch auf diese ausgefragte Persönlichkeit das weise Selbstbekenntnis zutrifft: „Ich bin kein ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch.“ (Conrad Ferdinand Meyer: Huttens letzte Tage. Leipzig: Haessel, 1872, S. 1.) Daraus erhellt, dass ich niemals mit einem Interview zufrieden sein kann, das mir die befragte Person rundweg sympathisch – oder vollkommen unsympathisch erscheinen lässt. Beide Bilder können nur falsch sein. Und ich erwarte nun einmal von einem Interview, dass es mir einen Menschen näherbringt, indem es ihn wahrer zeigt, als er sich aus eigenem Entschluss geben will oder kann.
Dennoch ist ein schlechtes Interview manchmal lesenswert; nämlich dann, wenn die Überzeichnung des Objekts, seine Selbststilisierung in the public eye so gnadenlos danebengeht, dass es schon wieder Spaß macht, dergleichen Wort für Wort und Satz für Satz zu verkosten. Von einem solchen Fall ist hier zu berichten. Ich meine das Interview, das Eva Karcher neulich für die SZ mit Hans Ulrich Obrist geführt hat.
Obrist (*1968) ist Hercooles. In sechs Spalten der Wochenendbeilage führt er eiskalt vor, was er ist und weiß und kann, nämlich nahezu alles. Nun ist die eitle Manie, sein Licht nicht untern Scheffel zu stellen, sondern im Gegenteil das erschreckte Publikum damit zu blenden, gerade bei jenen Semi-Prominenten weit verbreitet, die zwar Schlüsselpositionen in Politik, Wirtschaft und Kultur innehaben, aber qua Funktion notgedrungen eher im Verborgenen werkeln und im Hintergrund stehen müssen. Hierzu zählen, um jedes der drei Ressorts mit einem Beispiel zu illustrieren: Ghostwriter, Großerben und Kuratoren. Hans Ulrich Obrist gilt als einer der wirkmächtigsten Kuratoren der Gegenwart. Die SZ nennt ihn den „populärsten Kunstvermittler der Szene“, meint aber vermutlich: den in der Szene populärsten Kunstvermittler. Um seine Popularität nun auch über diese Szene hinaus zu erweitern, stapelte er seine angeborenen und erworbenen Qualitäten so hoch, dass wir dahinter den Menschen gar nicht mehr sehen können. Als gebürtigem Schweizer ward ihm Englisch, Französisch, Italienisch, Schwyzerdütsch und Deutsch sozusagen in die Wiege gelegt, im Gymnasium lernte er dazu en passant noch Spanisch und Russisch. Jetzt steht Portugiesisch auf seinem Stundenplan, weil er momentan von Brasilien „fasziniert“ ist. (Dieses Ekelwort Faszination wäre bald mal einen eigenen Beitrag wert.) Überhaupt folgt Obrist der Obsession, permanent zu lernen, „aber nicht als Zwang, sondern als Impuls“. Damit er sein tägliches Pensum schafft, hat er sich eine strenge Zeitdiät auferlegt: „Früher hatte ich den ,Da Vinci‘-Rhythmus. Wie Leonardo da Vinci […] war ich drei Stunden wach, dann folgten 15 Minuten Schlaf. So war ich zwar nie müde, aber auf Dauer ist es unmöglich, dabei ein soziales Wesen zu bleiben.“ Dann war er eine Zeitlang Espresso-Junkie. Und wofür das alles? Um immer noch größere Ausstellungen mit immer noch spektakuläreren Exponaten in immer noch außergewöhnlicherem Rahmen zu realisieren. Es verwundert nicht, dass dem Kurator zur Benennung seiner Leistungsshows nur ein Begriff aus der Welt des Sports einfallen kann: Marathon. Seine atemlos hechelnde Ausstellungsmacherei versteht er, ausgerechnet, als „Protest gegen den zunehmenden kollektiven Gedächtnisverlust“. Dass vielleicht gerade das überdrehte Spektakel, für das Obrist den Zulieferer spielt, erst besagte Amnesie verursacht, die er beklagt, das scheint ihm nicht in den Sinn zu kommen.
Übrigens interviewt der Interviewte auch selbst, neben Künstlern zuletzt Architekten, Musiker, Komponisten und Wissenschaftler. Nun sind Choreographen, Tänzer und Schriftsteller „an der Reihe“. Leider bleibt ihm in der ganzen Hektik keine Zeit, uns zu erklären, warum er diese Kreativen interviewt, zumal er offenbar nicht nur Kaffee soff wie Balzac, sondern auch korrespondierte wie Voltaire: „Ich habe ein riesiges Archiv unzähliger Briefwechsel und 2000 Stunden Interviews.“ Immer ist nur von Quantitäten die Rede, selbst bei einem so noblen Akt wie dem Buchkauf: „Jeden Tag ein Buch kaufen, das ist ein wichtiges [!] Ritual.“ Zu dieser bei Licht besehen ebenso eitlen wie langweiligen Kraftmeierei passt, dass Obrist Auskünfte über sein Privatleben, um die ihn doch niemand gebeten hat, verweigert und sich (von Marco Anelli) für den Zeitungsabdruck dieses außer Peinlichkeiten aber auch wirklich gar nichts offenbarenden Interviews im Profil ablichten lässt. (Eva Karcher: Hans Ulrich Obrist über Kunst; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 48 v. 27./28. Februar 2010, S. V2/8.)
Posted in Homo laber, Würfelwürfe | Comments Off on Hercooles
Wednesday, 03. March 2010

Ab und zu ist es angebracht, sich seiner Vergänglichkeit wieder einmal bewusst zu werden und die Sterblichkeit dieser fleischlichen Hülle, die uns alle egalisiert, nüchtern und scharf wahrzunehmen. Die Zeit, die uns unsere Späße mit frohem Herzen und bei bester Gesundheit zu genießen einräumt, hat eben nur den einen Nachteil, endlich zu sein. Tröstlich ist da bloß, dass der Unterschied zwischen einem nach menschlichem Maß langen zu einem kurzen Leben kaum das Wesentliche ist. Auch hier dürfte Qualität, nicht Quantität das entscheidende Kriterium sein.
Übrigens kann ja die gewaltsame Verkürzung des Lebenswegs auch eine Befreiung bedeuten, wenn nämlich leidvoller Schmerz oder unleidliches Gleichmaß dieses Leben vergällte. Und dies kann nicht nur so sein, rechtbesehen ist es vielleicht sogar der üblichste Ausweg. Wann liest man denn in den Todesanzeigen schon einmal, dass ein Hingegangener lebenssatt hinüberglitt, friedlich im Schlafe verschied?
Ich werde in diesem Sommer 54 Jahre alt, so ich denn so alt werde. Würde es mich bekümmern, wenn nicht? Welche alten Rechnungen hätte ich noch offen? Was bliebe mir noch, dringend zu tun? Braucht mich die Welt? Habe ich ihr noch etwas zu geben, was nur ich allein ihr zu geben vermag? Wie stünden jene da, die mir am nächsten stehen, wenn sie auf meine Anwesenheit hinfort verzichten müssten? Kommt aus solchen Erwägungen der dringende Impuls, dem Tod mit allen Kräften zu widerstehen? Ich fürchte: Nein!
Unser Überlebenswille ist somit vermutlich nicht viel mehr als ein triebhafter Reflex, nichts ausgemacht Menschliches. Menschlicher wäre da schon die Einsicht, wie wenig an jedem von uns gelegen ist, angesichts des Übermaßes unserer Vorhandenheit. Und unser Lebenswunsch wäre insofern bloß eine romantische Reminiszenz aus der Zeit, als man noch annehmen konnte, niemand andres als gerade ich sei fähig, die Dinge zu tun, die gerade ich tun kann.
Und übrigens: Warum soll ich das Nein zum Abschluss des dritten Absatzes eigentlich fürchten? Ist die Negation der vorangestellten Frage nicht vielmehr der Schlüssel zu einer Freiheit, die alle Furcht hinter sich lässt?
Posted in Memento, Würfelwürfe | 2 Comments »
Wednesday, 03. March 2010
Posted in Roth, Werke, Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Tuesday, 02. March 2010

Im Deutschlandfunk befragte heute Michael Langer den Schweizer Soziologen Jean Ziegler (*1934) zu seinem letzten Buch, Der Hass auf den Westen (München: Bertelsmann, 2009). Gleich eingangs des eineinhalbstündigen Dialogs in der Reihe Zwischentöne entspinnt sich eine kuriose Haspelei, die ich vom Band abgeschrieben habe:
Ziegler: „Wir sind jetzt 5,7 Milliarden Menschen auf dieser Welt …“ – Langer: „Herr Ziegler, noch mehr: 6,7!“ – Ziegler: „Nein, 5,7 sind wir jetzt.“ – Langer: „5,7?“ – Ziegler: „Entschuldigung, dass ich jetzt mit Ihnen … dass ich Ihnen widerspreche. Das sollte man nicht tun, oder?“ – Langer: „Ja … doch, doch! Weiter!“
Leser dieses Blogs wissen, dass Ziegler irrt und vor ein paar Tagen sogar bereits 6,8 Milliarden erreicht wurden. Kaum ist das Gespräch zwei Minuten alt, muss sich der ausgewiesene Fachmann für globale Bevölkerungspolitik, Weltwirtschaft, Neokolonialismus und das Elend der Dritten Welt von einem einfachen Rundfunkjournalisten belehren lassen – und nimmt diese Lehre nicht einmal an! Da Ziegler anschließend hauptsächlich mit Zahlen argumentiert, müssen sein Sachverstand und seine Urteilskraft in der Wahrnehmung eines unbefangenen Hörers durch diesen doch nicht gerade unerheblichen Lapsus schwer diskreditiert sein.
Wenig später macht Ziegler uns darauf aufmerksam, dass „alle fünf Sekunden ein Kind unter zehn Jahren stirbt. Wenn wir anderthalb Stunden reden, werden es über 720 Kinder sein, die verhungert sein werden.“ Auch diese Rechnung irritiert jeden halbwegs fitten Kopfrechner. Wenn alle fünf Sekunden ein Kind stirbt, dann sind das zwölf Kinder pro Minute und in 90 Minuten 1080 Kinder. Nun gut, Ziegler sagt über 720 Kinder, insofern ist seine Behauptung nicht falsch, sondern nur grob ungenau.
Aber es ist vermutlich geschmacklos, die Pedanterie hier zu weit zu treiben. Tatsache ist jedenfalls, dass knapp ein Fünftel der Todesfälle auf der Erde auf Hunger zurückzuführen sind und dass vermutlich mehr als zwei Drittel dieser Hungeropfer Kinder sind. Gleichzeitig kann aber doch Jean Ziegler nicht übersehen, dass die Zahl der Geburten, die gleichzeitig in den anderthalb Stunden seines Radiotalks zu verzeichnen sind, die der verhungernden Kinder um das zwanzigfache übertrifft. Man kann wohl kaum vermeiden, über solche Zahlen zu diskutieren, ohne sich den Vorwurf des Zynismus zuzuziehen. Zweifellos ist der moralische Furor, mit dem Ziegler „die strukturelle Gewalt der kannibalischen Weltordnung“ verflucht, sympathischer als solch morbide Arithmetik. Wenn er sich darauf beschränkt hätte, Immanuel Kant zu zitieren und die multinationalen Konzerne anzuklagen, könnten wir seiner Verzweiflung nur beipflichten. Da er aber mit Zahlen jongliert, und zwar mit Zahlen, die augenscheinlich zu groß für ihn sind, verspielt er seinen intellektuellen Kredit. Das ist bedauernswert, wo doch sein Thema auch uns sehr am Herzen liegt – aber nicht nur dort.
[Titelbild von A. Paul Weber: Das Ende (1939/40)]
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | 1 Comment »
Friday, 26. February 2010
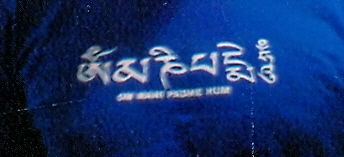
Als Deef Pirmasens im Blog Gefühlskonserve Anfang des Monats ein kleines Bömbchen hochgehen ließ, indem er die noch gerade minderjährige Debütantin Helene Hegemann überführte, für ihren soeben bei Ullstein erschienenen, in den Feuilletons mehrheitlich hochgelobten Roman Axolotl Roadkill ganze Passagen aus dem Roman Strobo von Airen abgeschrieben zu haben, der vorab in dessen Weblog und 2009 im kleinen Berliner Verlag SuKuLTuR erschienen war, erwog ich für einen kurzen Moment, diesem für den Springer-Konzern einigermaßen peinlichen Vorgang einen kleinen Seitenhieb zu widmen.
Bald darauf sorgte das Skandalon für ein reichlich verspätetes Silvesterfeuerwerk in allen Medien von Twitter bis zur Harald-Schmidt-Show, als feierten die Kulturmultiplikatoren nicht jahreszeitgemäß feuchtfröhlichen Karneval, sondern gierten längst schon in der furztrockenen Sauregurkenzeit des Hochsommers nach Überbrückungshilfe aus den Darkrooms der digitalen Boheme. Auf meiner spitzen Zunge schmeckte diese Brühe bald so fad, dass ich die Lust an der mittlerweile volljährig gewordenen Hegemann und ihrem geklonten Schwanzlurch verlor und mich prickelnderen Zeiterscheinungen zuwandte.
Wieder ein paar Tage später, der kürzeste Monat des Jahres zog sich über Gebühr in die Länge, erstaunten mich dann doch die bunten Blüten, die in diesem sturmumtosten Wasserglas schwammen. Durs Grünbein „„plagiiert““ in der FAZ Gottfried Benn und führt Uwe Wittstock von der WELT wie einen tumben Tanzbären an der Nase herum.
Es wird aus diesem nichtigen Anlass landauf, landab über das Urheberrecht diskutiert, als sollte es erst noch eingeführt werden. Kein Mensch scheint mehr zu wissen, wo es anfängt und aufhört. Und ganz nebenbei wird im Namen Bert Brechts geistiger Diebstahl zur kreativen Handlung umgewidmet, unter der Voraussetzung, dass der Verlag stellvertretend für seine Autorin bekannt macht, wen sie wo beklaut hat – und ganz egal, wann. Mit der Bekanntmachung darf man jedenfalls getrost warten, bis der Fall durch Zufall ruchbar geworden ist, schon erst recht, da in diesem Falle ja die Täterin im Stande kindlicher Unschuld und das professionelle Lektorat chronisch überlastet war.
Hauptsache, das Werk rechtfertigt dank seiner genialischen Originalität diese blindwütigen Regelverstöße. Dies zu behaupten ist nun freilich mit Verweis auf die Lobeshymnen aus der Zeit vor dem Ruchbarwerden des Plagiats eine leichte Übung für die gut geölte Marketingabteilung. Und weil da alle Instrumente der Absatzförderung so geschmeidig ineinandergriffen, ward schließlich doch noch mein Interesse geweckt und ich legte ein Dossier an, um bald einmal, aber doch nicht allzu bald das Büchelchen der scheinfrommen Helene und seine Wirkungsgeschichte zum Thema einer Fassadendemontage zu machen.
[Fortsetzung folgt nicht vor Ende März.]
Posted in Homo laber, Würfelwürfe | Comments Off on Kritikremix
Thursday, 25. February 2010

Ich bin noch ganz verdattert. Was ist passiert? Seit nahezu zwei Jahren blogge ich jetzt hier still und heimlich vor mich hin und habe mich längst daran gewöhnt, dass meine Anklagen, Stimmungsbilder, Strafpredigten, Jammerarien und Lobeshymnen kaum einmal Resonanz finden; und wenn, dann kommt sie von ein paar versprengten Sympathisanten, die mir noch aus der Zeit meiner Westropolis-Hospitanz verbunden sind und mich gelegentlich aufmuntern zu müssen meinen.
Und jetzt das! Auf eine eher beiläufig hererzählte Episode aus meinem destabilisierten Alltag hin geht unvermittelt ein warmer Regen durchweg freundlicher Kommentare nieder, von Hansi, Hoshi, amo, saba, Mata, Ole, Paco, ch, Horst, JanDob, Julian, Brandbarth, Gerd, Leo, jules nut, Bernd das Brot, Oliver, docmed, mailo, Brent und Andi – lauter Menschen, die sich hier bisher noch nie haben vernehmen lassen. (Oder doch höchstens ganz selten einmal.)
Was hat das kleine Geschichtchen bloß an sich, dass es plötzlich einen solchen Applaus auslöst und seine Leser gar – das Wort ist nicht von mir – zu einer gründlichen Exegese veranlasst? Zu Pfennigfuchsereien garadezu? Oder gibt es vielleicht in der Blogosphäre irgendwelche Multiplikations-Mechanismen, die eine Flüsterpropaganda nach dem Schneeballprinzip in Gang setzen? Der Vorgang ist mir jedenfalls einigermaßen unheimlich.
Schon ertappe ich mich bei dem offenbar von schierer Eitelkeit erkitzelten Einfall, hier künftig in schöner Regelmäßigkeit ähnliche Alltäglichkeiten unter die Lupe zu nehmen, wie etwa: Was mir unlängst vor den Altglascontainern widerfuhr; Traurige Beobachtungen am Rande des diesjährigen Karnevalszugs; Wie mich die Zeuginnen Jehovas zum allerletzten Mal besuchten; „Würden Sie vielleicht eine Obdachlosenzeitung erstehen, der Herr?“; Stammgäste bei Starbucks usw. Aus dem Stegreif würden mir wohl zwei Dutzend ähnlich ergiebige Geschichtchen einfallen.
Aber will ich das? Ich weiß nicht so recht. Erfolg war mir immer schon verdächtig. Komplimente korrumpieren ja leicht. Immerhin mag ein wenig Zuspruch alle paar Jahre vielleicht noch hingehen. Und wenn er überhandnimmt, ist es mir bekanntlich ein Leichtes, die Gäste schleunigst wieder aus dem Haus zu ekeln. Vielleicht darf ich das Experiment wagen. Die neue Kategorie soll also Alltäglichkeiten heißen.
Posted in Alltäglichkeiten | 6 Comments »
Tuesday, 23. February 2010

Gestern Vormittag vorm Backwarenstand. Ich stehe links, in der Mitte eine ältere Dame, die sich gerade eine sehr spezielle Auswahl von Teilchen zusammenstellen lässt. Ich spüre, dass ich ungeduldig werde, nicht weil ich in Eile bin, sondern einfach vom Zuhören: „Und dann bitte noch zwei Quarktaschen. Oder nein, geben sie mir doch besser drei! Aber nicht die zerdrückte, lieber die links daneben. Nein, von mir aus gesehen links.“ Und so weiter in der Manier einer einsamen Frau, die für den Rest des jungen Tages keinen Gesprächspartner mehr findet. Dass die Backwaren seit heute vor dem Supermarkt verkauft werden, hat seinen Grund offensichtlich darin, dass der Verkaufsstand im Geschäft komplett neu aufgestellt wird. Handwerker tragen die Einzelteile des alten Standes hinaus und werfen sie krachend in einen Container. Im Hintergrund schrillt eine Säge. Zudem liegt ein feiner Nieselregen in der Luft. Jede dieser kleinen Unannehmlichkeiten ist, für sich genommen, gewiss keine Katastrophe, alle zusammen aber lassen es nicht unbedingt als wünschenswert erscheinen, vor diesem Backwarenstand Wurzeln zu schlagen. „Momentchen,“ höre ich die ältere Dame sagen, „das müsste ich passend haben.“ Dann lässt sie mit ungelenken Fingern neun Euro und 78 Cent auf den Zahlteller klappern, gestückelt in 19 einzelne Münzen. Ein Zwei-Cent-Stück fällt zu Boden, ich bin ganz Kavalier und klaube es aus dem Matsch. Misstrauisch nimmt sie es entgegen, als hätte sie befürchtet, ich könnte mich damit aus dem Staub machen. Gleichzeitig höre ich die Brotverkäuferin sagen: „Es sind aber Neuneuroneunundsiebzig! Hätten Sie vielleicht noch einen Cent für mich?“ Sofort greife ich nach meiner Geldbörse, damit dieses grausame Spiel endlich ein Ende hat. Aber ich muss feststellen, dass sich in meinem Münzfach nur ein einziges Zwei-Euro-Stück befindet. Auch die ältere Dame hat bei der Suche in ihrem Portemonnaie und in den Taschen ihres Mantels offenbar keinen Erfolg. Da kommt ihr ein älterer Herr zu Hilfe, den ich jetzt erst bemerke. Er hatte wohl zuvor auf der, von uns aus gesehen, rechten Seite des Backwarenstandes gewartet. „Sie erlauben, dass ich ihnen diesen Glückscent zum Geschenk mache?“
Die überschwängliche Begeisterung, mit der die ältere Dame dieses Präsent von ihrem Altersgefährten entgegennahm, gab mir einen kleinen Stich. Zugleich beschäftigte mich die Frage, ob dieser spendable Kavalier bereits um Backwaren angestanden hatte, als ich hinzukam; oder ob er erst nach mir an der Reihe war. Möglicherweise hatte die zwischen uns stehende Teilchenkäuferin mir den Blick auf ihn verstellt. Vor dieser provisorischen Verkaufsstelle hatte sich in der Kürze der Zeit noch keine Gewohnheitsregel etablieren können, ob sich die Warteschlange nun nach rechts oder links zu bilden hätte. Ich kam aus Richtung der Bushaltestelle und stand darum links. Dass der ältere Herr hingegen rechts stand, konnte vielleicht darauf hindeuten, dass er mit dem Auto unterwegs war, denn rechts vom Standort, eben von diesem soeben erst aufgebauten Backwarenstand, befindet sich der Parkplatz des Supermarkts, der ungefähr die gleiche Fläche in Anspruch nimmt wie der Supermarkt selbst.
Bevor ich diese Erwägungen zu einem für mich eindeutigen Ergebnis hätte führen können, hatte die Backwarenverkäuferin gegen mich entschieden, indem sie sich dem älteren Herrn zuwandte: „Und was darf’s denn für Sie sein?“
Bevor er antwortete, schaute er kurz zu mir herüber, wie mir schien aber nicht mit einem fragenden, sondern eher mit einem triumphierenden Blick. Es war einer dieser Augenblicke, in denen eine kleine Ewigkeit Platz findet und die sich uns einbrennen, als läge in ihnen eine Weisheit verborgen, die weit über die in Sekunden oder in Jahren messbare Zeit hinausreicht. Er sah mich nicht so an, als wollte er sich vergewissern, ob er wirklich vor mir an der Reihe sei; und noch nicht einmal so, als wollte er prüfen, ob ich mich mit diesem Verlauf der Ereignisse abfinden würde, obwohl ich vielleicht davon ausginge, dass die Reihe eigentlich an mir sei. Er schaute vielmehr drein, als wollte er sagen: ,Pass mal auf, Du Trottel. Ich weiß zwar besser als Du selbst, dass ich nach Dir gekommen bin. Aber Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich die Gunst des Augenblicks verstreichen lasse, in dem mich die Verkäuferin zuerst angesprochen hat.‘ Und ehe ich mich’s versah, hatte er schon das Wort ergriffen. „Ich hätte gern … ich wollte eigentlich … aber ich hörte ja gerade … dass ihre Brotschneide-Maschine ja leider … wegen dem Umbau, tja … sehr ärgerlich.“ An Stelle der drei Pünktchen muss man sich jeweils eine so lange Pause vorstellen, wie man in einer solchen Situation eben noch für möglich hält. Offenbar litt die Backwarenverkäuferin genauso wie ich, denn nachdem sie kurz „Jasoisses“ gesagt hatte und darauf seitens des älteren Herrn erst einmal gar nichts mehr kam, wandte sie sich sichtbar erleichtert mir zu: „Und bei Ihnen?“ Wie aus der Pistole geschossen stieß ich hervor: „Nur drei Brötchen. Ich hab’s auch passend.“ Und sie steckte meine drei Brötchen schon in die Tüte, als der ältere Herr, ich ahnte es ja, seiner Entrüstung Ausdruck verlieh: „Das glaube ich jetzt nicht! Wieso sind Sie denn jetzt dran. Ich war doch noch längst nicht fertig.“ – „Und deshalb sind ja auch schon wieder dran. Ich wusste, was ich wollte und hab’s auch schon.“ Hier schwenkte ich mit der Linken die Brötchentüte und legte mit der Rechten abgezählte 81 Cent auf den Teller. Und nach einem verständnisinnigen Blickwechsel mit der Verkäuferin fügte ich hinzu: „Ich dachte, wir nutzen die Zeit, bis sie mit Ihren Überlegungen zu Rande gekommen sind.“ – „Das ist ja wohl eine Unverschämtheit! Meinen Sie etwa, weil ich auf meine alten Tage nicht mehr ganz so schnell bin, können Sie sich hier alles erlauben? Entschuldigung, dass ich noch lebe!“ – „Aber keine Ursache. Das stört mich nur mäßig.“ Und weg war ich.
Bin ich nun hiermit zu weit gegangen? Hätte ich dem Motto folgen sollen, das da heißt: Der Klügere gibt nach? Hätte ich bis zum fernen Ende weiter mit Engelsgeduld die schikanöse Slowmotion-Darbietung dieses offenbar unter Langeweile leidenden Rentners auf der Suche nach Streit ertragen müssen? Nun weiß ich nicht, was Dr. Dr. Rainer Erlinger im SZ-Magazin auf diese Gewissensfrage antworten würde. Ich werde ihn allerdings auch nicht fragen. Ich bin nämlich nach diesem kleinen Zwischenfall völlig im Reinen mit meinem Gewissen. So einer bin ich!
Posted in Alltäglichkeiten | 34 Comments »
Monday, 22. February 2010
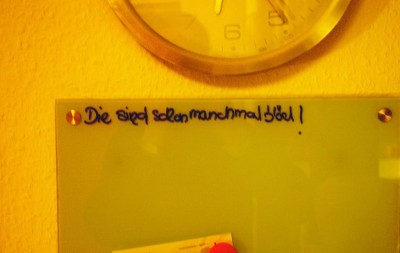
Ich weiß ja, dass ich gegen ein journalistisches Tabu verstoße, wenn ich aus unschuldigen, aber vielsagenden Personennamen Profit für meine polemischen Attacken schlage. Das Argument gegen solch billige Häme lautet, für seinen Namen könne ja keiner was. Prinzipiell halte ich mich auch an dieses Gebot und würde zum Beispiel niemals der Versuchung erliegen, auf Ludwig Hohl das lateinische Sprichwort nomen est omen zu münzen. Aber gelegentlich, sehr selten gestatte ich mir eine solche Namendeutung dann doch einmal und legitimiere mich hierzu mit dem Hinweis, dass die Bezüge zwischen dem Namen und der Person nicht offenkundig waren, sondern erst mit viel Phantasie und noch mehr Spürsinn ans Licht gebracht werden mussten. – „Eine Hillebille,“ so weiß die deutschsprachige Wikipedia, „ist ein Schlagbrett aus Hartholz, welches […] als primitives Signalgerät diente, wahrscheinlich aber auch als Rhythmusinstrument verwendet wurde. Sie wurde freischwebend an einem Lederriemen aufgehängt und man brachte sie durch Schlagen mit einem Klöppel zum Tönen. Auf diese Weise konnten Nachrichten von Ort zu Ort übertragen werden.“ Und ein schlauer Wanderfuchs klärt mich auf: „Bis in das 20. Jahrhundert diente die Hillebille den Holzfällern und Köhlern im Harz als Alarminstrument und zum Übermitteln von Nachrichten.“
Der studierte Politologe, Soziologe, Historiker, Philosoph und Islamwissenschaftler Sven (nicht Jens, wie die Zeitung fälschlich schreibt) Hillenkamp (*1971), ehemaliger ZEIT-Redakteur und jetzt als freier Autor in Berlin und Stockholm lebend, beschreibt in der heutigen SZ die Befindlichkeit des freien Menschen in der freien Welt und in einer Gegenwart der unbegrenzten Möglichkeiten. Seine Pointe liegt auf der Hand, jede andere wäre ja auch langweilig und unverkäuflich: Nie waren wir so unfrei wie heute, unter diesen paradoxerweise doch grenzenlos freizügigen Bedingungen. (Sven Hillenkamp: Müde geworden vor der Zeit; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 43 v. 22. Februar 2009, S. 9.) Beim Lesen dieses Zweispalters auf der ersten Feuilletonseite stellte sich bei mir der typische Feuerwerk-Effekt ein: viele bunte Lichter, mancher laute Knall – und im Hintergrund ein dumpfes Donnergrollen. Mich stört an solchen Einlassungen zum Zeitgeist regelmäßig, dass sie ihren Bezugsrahmen und ihre Adressaten nicht klar benennen. Wo genau sollen wir jenen „freien Menschen“ ausmachen, über den Hillenkamp so viel zu wissen vorgibt und mitteilen zu müssen meint? In den Industrieländern der Ersten Welt? Und dort dann in der tonangebenden upper class? Vielleicht können wir es uns mit der Ortung leichter machen und die Zielgruppe eingrenzen, indem wir sie als die kleine aber feine Minderheit der SZ-Leserschaft hierzulande identifizieren, die kaum ein halbes Prozent der Bevölkerung ausmacht. (Vielleicht würde der große Rest, erhielte er Kenntnis von Hillenkamps Zeitgeistdiagnosen, müde lächelnd zur tristen Tagesarbeit zurückkehren, so er denn noch eine hat, mit dem lakonischen Kommentar: „Eure Sorgen möchte ich haben.“)
Hillenkamp, der im vergangenen Jahr bereits den Tod der Liebe verkündet hat, und zwar gleich in Buchstärke, knöpft sich also jetzt die Freiheit vor, von der ja aufgewecktere Geister gerade in den letzten Dekaden immer nachdrücklicher behaupten, dass es sie nie gegeben habe. Der vielgebildete Alarmist mit seinem primitiven Signalgerät weiß nichts von diesen Bedenken und kommt mir vor wie der Rufer in der Wüste mit der Botschaft, dass der Wald brenne. Hillenkamp schreibt: „Einst war alles Prestige ans Sein geknüpft: den Adel, die edle Herkunft. Dann ans Haben, den Besitz. Jetzt ist es ans Tun gebunden: die außerordentliche Leistung, das künstlerische Werk sowie – die jüngste Entwicklung – ans Leiden.“ Die jüngste Entwicklung? Gab es da nicht vor gut zwei Jahrtausenden eine Erscheinung, bei der sich das Prestige in besonderem Maße eben ans Leiden knüpfte, an einen qualvollen Tod am Kreuz nämlich? Und die mit ihrem Vorbild durch viele Jahrhunderte eine zahllose Gefolgschaft mobilisierte, Märtyrer für den Glauben, die durch ihr schmerzvolles Opfer ebenfalls Prestige im höchsten Maße erlangten? „Alle Zusammenhänge,“ so Hillenkamp, „in die der Mensch sich begeben kann, drohen permanent mit Kündigung. Aus dem Unternehmen, dem Team, der Kunstgalerie, der Mannschaft, der Liebesbeziehung kann das Individuum jederzeit entlassen werden.“ Auch diese Risiken bestehen schon seit einer guten Weile, nämlich seit der Abschaffung der Sklaverei und der Einführung der bürgerlichen Ehe samt Scheidungsrecht. Dass die Freiheit nur um den Preis geringerer Sicherheit erhältlich ist, das dürfte doch wohl eine angestaubte Binsenwahrheit sein, die zu finden es keiner akademischen Ausbildung bedarf.
Besonders am Herzen liegt dem studierten Kritiker des Zeitalters der unendlichen Freiheit „der junge Mensch“, der in diesem Zwangsvakuum nicht weiß, was er werden soll. Er schämt sich, „in seiner Zukunft nichts zu sein. Seine Angst ist unerträglich. Er lebt auf das Nichts hin, ist bereits das Nichts. Jeden jungen Menschen trifft heute dieser Schock – und er hält ihn fest, bis es keine Zukunft mehr gibt.“ Hier bleibt offen, ob Hillenkamp, traurig genug, die individuelle Zukunft des jungen Menschen meint – oder unser aller Zukunft, gar die Zukunft des Sonnensystems? Zuzutrauen wäre es ihm, schreckt er ja auch sonst nicht vor Absolutsetzungen und Superlativen zurück.
Bevor nun auch meine Angst unerträglich wird, nämlich davor, dass solcherart „Apokalyptik aus dem Kaffeesatz“ Schule macht, wende ich mich lieber ab und danke artig, dass mich diese Kostproben hinreichend gewarnt haben vor des Autors Schmöker über den Tod der Liebe. Da lese ich lieber noch mal Günther Anders’ Notizen zur Geschichte des Fühlens, Lieben gestern. Dieses Büchlein hat nun auch bald schon wieder ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel, dürfte aber selbst beim zweiten Lesen noch auf jeder Seite mehr Erkenntnisgewinn erzeugen als ein ganzes Billyregal voller brandaktueller Zeitseelenausdeutungen via Hillebille.
Posted in Homo laber, Würfelwürfe | Comments Off on Hillebille
Sunday, 21. February 2010

Ich werde jetzt nicht bei Adam und Erika anfangen und erzählen, wo und wann und wie ich Q kennengelernt habe. Vielleicht später einmal. Auch eine umständliche Beschreibung seiner Äußer- und Innerlichkeiten erspare ich mir und der Leserin. Q spricht für sich, und da er dies ohne Unterlass tut, dürfte dies fürs Erste nicht nur reichen, sondern immer ein Schlag mehr als genug sein, um sich ein Bild von diesem Quatschkopf zu machen. Weil ich aber weiß, wie hungrig die Einbildungskraft des Lesers danach giert, sich das Erscheinungsbild des Helden mit ein paar starken Strichen wenigstens näherungsweise auszumalen, gebe ich hier einen der zahlreichen Schnappschüsse preis, die ich von Q im Laufe der Jahre ohne sein Wissen gemacht habe [Titelfoto v. Revierflaneur / Osnabrück 1998].
Anfang des Monats rief Q nach längerer Pause wieder einmal an. Er meldet sich grundsätzlich nicht mit Namen, sondern stets mit der hirnverbrannten Floskel: „Altes Haus! Schräger Sims? Ganz genau: Ich bin’s!“ Sprüche dieser sinnfreien Art hat er noch etliche auf Lager. Ich habe ihn mal gefragt, woher er die eigentlich hat. Das seien volkstümlich Redensarten, die seine Tante häufig im Munde geführt habe. Ich mag das nicht so recht glauben, denn ich habe dergleichen nie jemals anderswoher als aus Q’s Munde vernommen. Und auch gelegentliche Googelei führte zu nichts. Eher schon traue ich besagter Tante zu, dass sie sich den Nonsense aus den Rippen geschnitten und ihrem Neffen als altehrwürdige Sprichwortfolklore verkauft hat. Diese Tante muss es nämlich sehr im Unterschied zu Q fausdick nicht nur hinter den Ohren gehabt haben, nach allem, was ich mir aus Q’s Berichten über sie und über seine „irreguläre Kindheit“ (Q’s Worte) mit viel Phantasie und Spucke zusammenleimen konnte. Er habe, so Q zur Abwechslung wieder einmal, einen „mittelschweren Verdacht“.
Wenn er so anfängt, mache ich mich darauf gefasst, entweder mit einer neuen Ausgeburt seiner Paranoia oder mit dem aktuellen Auswuchs seiner Hypochondrie Bekanntschaft schließen zu müssen. Ich ließ mich also mit einem kaum unterdrückten Seufzer, die Sprechmuschel des Hörers immerhin leicht vom Munde abgewandt, auf meine preußischblaue Chaiselongue sinken und fragte zaghaft: „Und der wäre?“ – „Einiges deutet darauf hin, dass dem Eskalatismus allmählich die Puste wegbleibt.“ So Q. „Tatsächlich?“ Ich sprang wie elektrisiert von der Sitzliege. „Wäre das nicht ein Widerspruch in sich?“
Ich müsste nun, damit meine Erregung verständlich wird, weit ausholen und diese Privatideologie, die sich Q seit frühester Jugend zusammengezimmert hat, in all ihren Voraussetzungen und Schlussfolgerungen, aber auch in den methodischen Vorgehensweisen ihrer Selbstvergewisserung vorstellen. (Q spricht, was letztere betrifft – gern von „szenischen Versuchsanordungen“.) Hier muss der Hinweise genügen, dass Q allen Fortschritt in der menschlichen Geschichte als zwangsläufige exponentielle Entwicklung interpretiert, ganz gleich, ob er die Zunahme der Weltbevölkerung, die Abnahme der fossilen Brennstoffe, die Kapitalkonzentration, den Schwund der Tier- und Pflanzenarten, das Aussterben der Sprachen, das Verkümmern der kulturellen Vielfalt, die Abstumpfung der individuellen Sensibilität oder die Erosion der Kreativität durch passiven Konsumismus in den Blick nimmt. Wohlgemerkt, solche Begriffe würde Q niemals verwenden, sie sind ihm vermutlich größtenteils sogar unverständlich. Q sagt sattdessen etwa: „Guck dir doch bloß an, was an Filmen gemacht wird. Immer schärferer Sex und immer härtere Gewalt für die Männer, immer seichterer Gefühlskitsch und immer grellerer Skandalklamauk für die Frauen. Stimmt nicht total, aber zu neunzig Prozent. Der Trend wird vielleicht jetzt erst deutlich. Aber es gab sie schon immer, die alte Sehnsucht des Tieres, das vor ein paar tausend Jahren in uns eingesperrt wurde und endlich wieder freigelassen werden will. Je länger es vom Ausbruch träumt, desto gefährlicher wird es.“
Ich gebe zu, dass mich anfangs Q’s Unkereien ziemlich beunruhigt haben, so grobschlächtig sein Denken auch sein mochte. Das mag auch an dem Tonfall liegen, in dem er seine Gedankengänge mitteilt und in dem immer etwas mitklingt, das ich einmal anderswo sein „Drohvibrato“ genannt habe. (Inzwischen bin ich daran gewöhnt und bleibe selbst dann verhältnismäßig gelassen, wenn Q mir von den grenzwertigeren seiner szenischen Versuchsanordungen Bericht erstattet.) Heute aber war ich wirklich nahezu fassungslos, denn die Ankündigung eines Bruchs in dem erklärten Urprinzip ewiger Eskalation hatte es noch nie gegeben, sie schien mir zudem auch deshalb sensationell, weil Q sie in einem absolut leidenschaftslosen Tonfall vortrug. Q spürte wohl meine Irritation und wiederholte seine Vermutung noch einmal in anderen Worten: „Wenn ich nicht irre, scheint der Eskalatismus neuerdings zu schwächeln.“
[Wird fortgesetzt.]
Posted in Questionnaire, Würfelwürfe | Comments Off on Q’s Gequatsche (I)
Thursday, 18. February 2010

Im Zoo von Münster lebt ein Gorilla namens N’Kwango (* 1996). So stark er ist, hat er doch ein weiches Herz. Wenn Fatima (* 1973) traurig ist, schmilzt N’Kwangos Herz hinter dem hammerharten Brustkasten und er versucht, sie zu trösten. Das sieht dann so aus. Warum Fatima traurig ist, wissen wir nicht, können da nur mutmaßen. Vielleicht, weil sie den Tod ihrer Schwester Gana (1998-2010) nicht verkraftet hat?
Wenn man in Essen ungewöhnliche Begegnungen mit Tieren haben will, geht man ins Folkwang-Museum. Die Zeiten, als es im Essener Grugapark noch einen Affenfelsen, ein Seehundbecken und ein imposantes Aquarium samt Terrarium gab, sind längst Geschichte. Noch nicht ganz so lange zurück liegt aber die Folkwang-Ausstellung Das fotografierte Tier. Und unvergessen ist mein Eindruck von der privaten Führung, die mein alter Freund Jürgen Lechtreck als Kurator dieses modernen „Bestariums im Rahmen und hinter Glas“ für mich und meinen ältesten Sohn im Dezember 2005 veranstaltet hat.
Heute habe ich mir den gerade eröffneten Neubau des Museum Folkwang [siehe hierzu die Kommentare] angeschaut. Ein großformatiges, zwanzigseitiges Heft Eröffnung des Neubaus wird am Empfang kostenlos ausgegeben. Darin und in allen anderen Verlautbarungen, die mir bisher zu Gesicht gekommen sind, ist die adjektivische Dopplung „hell und licht“ besonders beliebt zur Beschreibung der Qualitäten dieses Bauwerks von David Chipperfield. Und was sieht man an den teuren Wänden, in den edlen Hallen? Die Zusammenstellung von Werkgruppen und Installationen der Gegenwartskunst schien mir etwas willkürlich. Immerhin war ich froh, Gerhard Richters Wolkenbild Nr. 265 endlich einmal wiederzusehen. Es hängt jetzt in Augenhöhe des Betrachters, somit viel tiefer als früher, wo es in dem großen Saal mit dem Calder-Mobile unerreichbar entrückt schien – wie Wolken ja üblicherweise auch zu sein pflegen. Hier nun kommt es mir kleiner vor als in meiner Erinnerung. Soll das so bleiben? Bitte nicht!
Eine angenehme Überraschung boten hingegen die drei kleinen Ausstellungen Raumeroberungen (mit Plakaten von Günther Kieser, Holger Matthies und Gunter Rambow), Wünsche und Erwerbungen (mit zeitgenössischen Zeichnungen) und insbesondere die imponierende Zusammenstellung von Porträts unter dem Titel Fotografie und Individuum. Wieder einmal konnte man sich überzeugen, welch großartige Sammlung Ute Eskildsen hier in den vergangen drei Jahrzehnten zusammengetragen hat. Ich wäre sofort bereit gewesen, einen Katalog mit den Fotos dieser Teilausstellung zu erwerben, musste aber mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass es einen solchen nicht gibt. – Somit ist ein Besuch dieser Ausstellung (bis zum 4. April) nicht nur empfehlenswert, sondern dringend geboten: Go to Folkwang! (Eintritt 5 Euro.)
Auch heute entdeckte ich übrigens wieder ungewöhnliche Tierfotos, diesmal im Rahmen verschiedener Serien mit Schausteller-Porträts. Unvergleichlich schienen mir die Farbfotos mit nigerianischen Hyänenführern von Pieter Hugo [Titelbild aus seinem Bildband The Hyena & Other Men © Pestel Verlag]. Hatte ich nicht eine dieser Hyänen auch im Eröffnungsprospekt gesehen? Ich blätterte und suchte und kam zu dem Ergebnis, dass ich mich da wohl von ganz oberflächlichen Ähnlichkeiten hatte täuschen lassen. Übrigens sind Hyänen ja im Allgemeinen viel harmloser, als ihr schlechter Ruf uns glauben machen will.
Posted in Kulturflanerie | 2 Comments »
Tuesday, 16. February 2010

Neben der sechsbändigen Joseph-Roth-Werkausgabe, der Ausgabe seiner Briefe von Hermann Kesten, den Roth-Biographien von David Bronsen und Wilhelm von Sternberg und dem prachtvollen Bildband von Heinz Lunzer und Victoria Lunzer-Talos (Joseph Roth. Leben und Wek in Bildern. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1994), den ich immer wieder von vorn bis hinten durchblättern muss, allein schon deshalb, weil ein Namenregister fehlt, müssen in diesen Tagen einer neu erwachten Roth-Begeisterung auch die Erinnerungen seines Freundes Soma Morgenstern (1890-1976) stets zur Hand sein, die mich wie schon bei der ersten Lektüre vor neun Jahren auch jetzt wieder mit mancher überaus prägnanten Anekdote beglücken (Joseph Roths Flucht und Ende. Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag, 1998).
Soeben stolpere ich dort über die Porträts zweier sehr gegensätzlicher Männer der Feder, die nebeneinander zu halten gerade deshalb reizvoll sein könnte. Mit dem ersten macht uns Morgenstern in der Redaktion der Frankfurter Zeitung bekannt, wo er 1927 als Nachfolger von Heinrich Hauser einen festen Bureau-Posten bezogen hatte. Seine Nachbarn waren dort der berühmte Siegfried Kracauer – und eben unser erster Charakterkopf, der heute vergessene Rudolf Geck (1868-1936), welcher intern nur „der alte Geck“ genannt wurde und von 1907 bis 1924 das Amt des Feuilletonchefs bekleidete. In seiner Einarbeitungszeit spürt Morgenstern, dass ihm Geck, der das Geschäft wie im Schlaf beherrscht, bei der Erledigung der täglichen Post einiges an Routine voraus hat. Während sich der Neuling noch mit der Lektüre herumplagt, steht „der alte Geck“ auf ein Pläuschchen vor seinem Schreibtisch und lenkt ihn von der Arbeit ab. Morgenstern leidet still, denn es steht ihm nicht zu, seinen Chef aus dem Büro zu weisen. Der ergreift schließlich das Wort zu folgender Grundsatzerklärung: „Lieber Herr Dr. Morgenstern, ich sehe mit Freuden, wie sie von Woche zu Woche schneller mit dem Posteinlauf fertig werden, obwohl ich ihren noch schnelleren Fortschritt, so gut ich es zuwege bringen konnte, verhindert habe. Aber ich bin, wie sie vielleicht schon gemerkt haben, ein unentwegter Schwätzer. Das war ich schon in meinen jüngsten Jahren. Ich habe auch dem Umstand, der stadtbekannt ist, schon Rechnung getragen. Als alter Schwätzer habe ich dafür gesorgt, daß alle Welt das erfahre. Ich habe eine Grabinschrift für mich entworfen und in sauberer Handschrift aufgeschrieben: Hier ruht Geck, | Ein Dichter. | Geh weg, | Sonst spricht er.“ (Morgenstern, a. a. O., S. 90 f.)
Während Joseph Roth den „alten Geck“ früher kennengelernt hatte als sein Freund, machte er die Bekanntschaft eines geradezu gegensätzlichen Unikums jener Zeit, aber eines ebenfalls heute nahezu Verschollenen, erst durch Morgensterns Vermittlung: die des hebräischen Lyrikers Abraham Sonne (1883-1950). In seinen Erinnerungen spannt Soma Morgenstern den Leser auf die Folter, wenn er den Namen zunächst gesprächsweise im Herbst 1937 in Wien aufscheinen lässt. Im dortigen Hotel Bristol [Titelbild] erörtert er mit Joseph Roth und Stefan Zweig die Appeasement-Politik von Arthur Neville Chamberlain. Morgenstern beruft sich auf einen Freund in Wien, der ein paar Jahre als Sekretär von Dr. Chaim Weizmann in London gelebt habe und viel von der Großpolitik Englands verstehe. Dieser Dr. Sonne habe gesagt, Chamberlain werde Europa Stück um Stück an Hitler ausliefern (ebd., S. 144). Bei einer späteren Gelegenheit streiten Zweig, Roth und Morgenstern über die Frage, ob England stillhalten werde, sollte Hitler den Anschluss Österreichs wagen. Dr. Sonne, der mittlerweile am Jüdischen Pädagogischen Institut lehre, habe dies verneint, so Morgenstern. „,Wer ist dieser Sonne, von dem ihr schon wieder redet?‘ fragte Roth. – ,Er war einmal ein hebräischer Dichter, hat aber das Dichten schon im Weltkrieg aufgegeben. Er stammt aus Przemyśl, Galizien.‘“ (Ebd., S. 162.) Auch Morgensterns Buch verzichtet auf ein Namenregister, weshalb man etwas stöbern, blättern und suchen muss, bis man endlich mit Dr. Abraham Sonne persönliche Bekanntschaft schließen darf. Dort erzählt er seinen Besuchern, dem nun schon gut eingeführten Trio, eine Geschichte zu der Frage, ob es außer Stefan Zweig auf der Welt noch einen zweiten Menschen gebe, der seinen Pazifismus so weit treibe, sich zu weigern ein Gewehr auch nur zu berühren. Man lese diese Geschichte selbst bei Morgenstern nach auf S. 182 f., sie hat mit dem eigentlichen Gegenstand dieses Beitrags nichts zu tun.
Dieser „eigentliche Gegenstand“ könnte als das Verhältnis von extremer Gesprächigkeit und extremer Verschwiegenheit identifiziert werden. Vielleicht sind dies ja nur zwei Seiten ein und derselben Medaille. Irre ich mich, oder erwirbt man nicht den Ruf eines Weisen auf sowohl kürzerem als auch bequemerem Wege, wenn man möglichst wenig von sich gibt? Und zieht man sich nicht als Vielreder und Vielschreiber sehr leicht den Vorwurf zu, ein Großmaul, eine Plaudertasche, ein Quatschkopf zu sein? Dies schien mir immer schon eine große Ungerechtigkeit und zudem ein albernes Missverständnis, wie übrigens auch das vielleicht blödeste aller Sprichworte: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich bin im Übrigen ebenso weit davon entfernt, mich mit Sonne vergleichen zu wollen, wie mit der Schwatzhaftigkeit eines Geck konkurrieren zu können. Wenn ich etwas mit ihnen teile, dann das Schicksal, nur ganz kurz und blass aus meinem Inkognito aufzutauchen – um schon wieder so gut wie weg zu sein.
Dr. Abraham Sonne, den man bei Wikipedia unter seinem hebräischen Namen Avraham Ben Yitzhak findet, ist einem größeren Leserkreis durch jenes Sonne überschriebene Kapitel im dritten Band von Elias Canettis großer Autobiographie, Das Augenspiel, bekannt geworden. (Elias Canetti: Das autobiographische Werk. Frankfurt am Main: Zweitausendeins, o. J. [2001], S. 801-818.) Die wenigen Gedichte aus den Jahren 1903 bis 1910, die von Sonne auf uns gekommen sind, hat Wayne Myers aus dem Hebräischen ins Englische übersetzt. Er nennt Avraham Ben Yitzhak “the great poet of silence”. Und Naomi Dison Kaplan kann in ihrem Essay The Silence of Avraham Ben Yitzhak sein literarisches Gesamtwerk der Nachkriegszeit in einem einzigen Satz abhandeln: “From about the First World War he maintained a self-imposed literary silence and published nothing except a few anonymous articles in the Viennese Jewish press, and an essay on the Yiddish writer, Mendele Mocher Sefarim, which appeared in Der Jude.”
Posted in Roth, Würfelwürfe | 3 Comments »
Sunday, 14. February 2010

In der bahnbrechenden Roth-Biographie des Amerikaners David Bronsen heißt es über die erste Revier-Stippvisite von Joseph Roth: „Im Frühjahr 1926, auf der Rückreise von einer Redaktionskonferenz in Frankfurt, machte Roth einen Abstecher nach dem Ruhrgebiet, ehe er seine Reise nach Paris fortsetzte. Die Reportagen, die daraus entstanden, stehen in krassem Gegensatz zu denen über Südfrankreich, dessen heilsamer Einfluß ihn nicht losließ. […] Das Temperament des Berichterstatters nahm vieles mit Unwillen auf. ,Dunst, Rauch, Staub‘ stoßen ihn ab. Nachdem er den organisch gewachsenen französischen Midi gepriesen hat, klagt er über die ,Enge‘ und ,die Kälte‘ des Ruhrgebietes, die ihm zur Qual werden. Er reibt sich an der Grobheit des Arbeiterlebens und der primitiven Anspruchslosigkeit der sozialen und kulturellen Einrichtungen. […] In Frankreich feierte er den Sieg der Natur. Hier schildert er den trostlosen Sieg über die Natur.“ (David Bronsen: Joseph Roth. Eine Biographie. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1974, S. 277 f.) In der Frankfurter Zeitung, bei der Roth damals unter Vertrag stand, erscheinen die Artikel Tübsal einer Straßenbahn im Ruhrgebiet und Der Rauch verbindet Städte (am 9. und 18. März 1926; in: Werke 2, S. 544-549) sowie, mit etwas Verzögerung, weshalb man es in der streng chronologisch geordneten Werkausgabe leicht übersieht, ein so luzides wie zynisches Resümee seines Aufenthaltes an der Ruhr unter dem Titel Privatleben des Arbeiters (am 10. April 1926; ebd., S. 552-556). Diesem trostlosen Fazit hat die Zeitung eine „redaktionelle Bemerkung“ vorangestellt, die Bronsen zitiert: „Wir bringen diese Eindrücke von einer Reise durch das Ruhrgebiet, Eindrücke aus dem Alltag des Arbeiters, die uns um so wertvoller erscheinen, als sie unabhängig von jeder programmatischen Forderung entstanden sind. Es versteht sich von selber, daß mit den folgenden Betrachtungen prinzipielle Fragen nur aufgeworfen, aber nicht grundsätzlich beantwortet sein sollen. Es sind Impressionen, gesehen durch ein Temperament.“ (Bronsen, a. a. O., S. 278.)
Bei seinem Aufenthalt in Essen logierte Joseph Roth im Hotel Kaiserhof [Titelbild], wie wir dem Absendevermerk eines auf den 11. Februar 1926 datierten Briefes an Bernhard von Brentano entnehmen können. Darin klagt Roth: „Ich reise jetzt einige Wochen herum. Aber ohne Geld. Es ist furchtbar, so zu fahren, ich bin verzweifelt, kann meine kostspieligen Bedürfnisse nicht aufgeben und die Zeitung spart und spart erbärmlich. Es macht mir keine Freude mehr, man hat mir nicht einmal einen Vorschuß für März gegeben, ich habe keinen Vertrag, ich bin ganz trostlos.“ (Joseph Roth: Briefe 1911-1939. Hrsg. u. eingel. v. Hermann Kesten. Köln / Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1970, S. 78.) Das Verhältnis zu seinem langjährigen Auftraggeber, der Frankfurter Zeitung, ist schon seit einer Weile gespannt und wird es bleiben. Im Sommer 1930 löst Roth das Verhältnis und schließt einen Vertrag mit den Münchner Neuesten Nachrichten. Auch in anderen Zeitungen erscheinen nun vermehrt seine Feuilletons.
Ab Anfang Mai 1931 bringt die Kölnische Zeitung eine längere Folge von Reiseimpressionen, aus Magdeburg, Leipzig und schließlich erneut aus dem Ruhrgebiet, beginnend in Duisburg mit Der Hafen von Ruhrort, In andern Kneipen und Gustav (24. Mai und 7. Juni; in: Werke 3, S. 320-329). Darauf folgen die Ankunft in Essen, Abend in Essen, Die Bar erster und zweiter Klasse, Die andere Bar, Der Morgen aber, Ein Ingenieur mit Namen K. und Ein Arbeiter mit Namen M. (7., 14. u. 21. Juni 1926; ebd., S. 330-346).
Wilhelm von Sternburg hat in seiner jüngst erschienen Biographie Zweifel angemeldet, ob Joseph Roth in der ersten Jahreshälfte 1931 tatsächlich eine zweite Reise ins Ruhrgebiet gemacht hat: „Am 3. Mai 1931 erscheint in der Kölnischen Zeitung der erste von 15 Artikeln, in denen er von einer Reise berichtet, die ihn nach Magdeburg, Leipzig und in das Ruhrgebiet geführt haben soll, und in denen er feuilletonistisch über Gustav den Kneipenwirt oder einen Ausflug am Sonntag plaudert. Die Daten der überlieferten Briefe geben keinerlei Ansatzpunkte, dass Roth diese Reise gemacht hat. Vielleicht schrieb er sie alle im Pariser Hotelzimmer.“ (Wilhelm von Sternberg: Joseph Roth. Eine Biographie. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2009, S. 393.) Ich habe eine andere Vermutung. Am 7. April 1926 hatte der Feuilletonchef der Frankfurter Zeitung, Benno Reifenberg (1892-1970), an Joseph Roth in Paris geschrieben: „Ich habe Ihnen für vielerlei zu danken […], für Ihre weitere Arbeit aus dem Ruhrgebiet Persönliches Leben des Arbeiters [sic] und jetzt für Ihren Bericht von den Schlachtfeldern […].“ (Gemeint ist Roths Bericht St. Quentin, Perronne, die Maisonette, erschienen in der Frankfurter Zeitung v. 2. Mai 1926.) Nach diesen einleitenden Komplimenten kommt Reifenberg bald zum eigentlichen Anlass seines Briefes: „Lieber Herr Roth, ich muß wohl nicht sagen, daß Ihr Ausscheiden aus unserer Zeitung für mich den schwersten Schlag bedeutet, den ich in diesen Anfangsjahren erleben könnte. Ich habe einfach auf Sie gerechnet. Ich brauche die Mitarbeit von Menschen meiner Generation, mit denen ich mich ohne weiteres verstehe, mit denen ich Ideen teile, die uns ohne weiteres selbstverständlich sind. Es wäre nach meiner Überzeugung eine verlorene Schlacht, wenn Ihr Name plötzlich in Berliner Blättern auftauchen müßte. Ich habe das deutlich dem Verlag mitgeteilt und nun bitte ich mir zu glauben, daß der Verlag nicht sehr viel anders als ich denkt und daß ihm sehr darum zu tun ist, mit Ihnen ein gutes Einvernehmen zu pflegen.“ (Briefe 1911-1939, a. a. O., S. 83 f.) Dank dieser Intervention konnte ein vollkommener Bruch mit der Frankfurter Zeitung vorläufig noch verhindert werden. Es kann aber gut sein, dass durch diese vorübergehende Verstimmung die Veröffentlichung weiterer, bereits vorbereiteter oder gar ausformulierter Ruhrgebiets-Artikel ins Stocken geriet und dann ganz unterblieb. Schließlich hatte ja ihr Verfasser nicht einmal einen Vertrag, wie er im oben zitierten Brief aus dem Essener Kaiserhof beklagte. Fünf Jahre später kam der viel beschäftigte Journalist dann auf die Idee, diese liegengebliebenen Blätter der Kölnischen Zeitung als brandneu zu verkaufen. Tatsächlich enthalten alle zehn Artikel keinen einzigen Hinweis, der eine eindeutige Datierung zuließe. Klang nicht übrigens auch die oben zitierte „redaktionelle Vorbemerkung“ von 1926 eher nach der Ankündigung einer längeren Folge von Artikeln? Dass daraufhin nur drei Texte erschienen, musste die Erwartungen enttäuschen, die durch die Ankündigung geweckt worden waren.
Ich vermute, dass die insgesamt 13 Revier-Feuilletons von Joseph Roth zusammengehören, nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich. Sollten gründlichere Recherchen zu diesem Gegenstand und in diese Richtung meine Annahme bestätigen, dann wäre es vorstellbar und wünschenswert, diese Kleine Reise ins Revier von Joseph Roth aus dem Frühjahr 1926 als kommentierten Separatdruck neu herauszubringen.
Posted in Flanerie, Roth, Würfelwürfe | 1 Comment »
Friday, 12. February 2010

Seit ich die produktive Zeit meiner Tage ganz überwiegend mit dem Verfassen von Texten verbringe, seit knapp drei Jahren also hat sich bei mir ein neuer Traumtyp eingestellt.
Diese Textträume, wie ich sie nennen will, suchen mich in unregelmäßigen Abständen heim, und zwar immer in den Morgenstunden an der Grenze zum Erwachen. Ich bin mir sogar bewusst, dass ich träume, beschließe aber, den Traum noch nicht durch vollständiges Hinüberwechseln in den Wachzustand zu beenden, weil ich gern wissen möchte, wie er ausgeht, wenn ich ihn sich selbst überlasse. Darin verbirgt sich allerdings ein Widerspruch, denn gleichzeitig bin ich mir dessen bewusst, dass ich selbst es bin, oder besser: dass es etwas in mir selbst ist, dass den Traum in allen Einzelheiten verfertigt.
Dies mag schon befremdlich genug klingen. Was mich aber wirklich immer wieder erstaunt und anfangs sogar beunruhigt hat, ist etwas anderes. In diesen Träumen spielt die Sprache – die ausformulierte Sprache in wörtlicher Rede, in gelesenen Texten, aus dem Radio oder in Büchern – die entscheidende Rolle. Und die sprachlichen Äußerungen, mit denen ich in diesen Textträumen konfrontiert bin, richtiger: mit denen ich mich selbst konfrontiere, ohne mir einer schöpferischen Leistung bewusst zu werden, sind so wohlgesetzt, teils syntaktisch erstaunlich kompliziert und doch fehlerfrei gebaut, dass ich den Zweifel nicht ganz abweisen kann, ob sie wirklich von mir allein stammen. Hinzu kommt, dass ich, ihr Träumer, von ihrem eigentlichen Inhalt oft genug selbst überrascht bin.
Der jüngste Texttraum liegt unmittelbar zurück und ich habe ihn noch in sehr frischer Erinnerung. Als gutes Beispiel will ich ihn hier möglichst genau wiedergeben. Ich befinde mich mit einem etwa 30jährigen, blonden, gut aussehenden Mann im Halbdunkel eines kleinen Häuschens, von dem ich annehme, dass es auf dem Lande gelegen ist. Ich erinnere mich, dass er irgendwann den geografischen Namen Västerbotten erwähnt, weshalb ich ihn für einen Skandinavier halte und vermute, dass wir uns in Schweden befinden. Es ist Winter, durch ein beschlagenes Fenster hinter dem Mann ist eine Schneelandschaft zu erahnen. Ich habe das Gefühl, dass noch weitere Personen sich mit uns in diesem schwach beleuchteten, aber gemütlichen Zimmer befinden, die eher zu mir gehören. Die Art, wie der Mann spricht, lässt darauf schließen, dass er uns auf eine Frage antwortet. Vielleicht sind wir Reporter, die ihn interviewen? Vielleicht sind wir aber auch neue Freunde, denen er bedeutsame Episoden aus seinem Leben erzählt, damit wir ihn besser kennenlernen. Der Mann spricht in kurzen, klaren Sätzen, nicht laut, nicht leise, nicht tonlos, aber auch nicht dramatisierend. Vielleicht könnte man seinen Tonfall am ehesten als beherrscht bezeichnen, und zwar durchaus in dem Sinne, dass er seine Stimme mit Macht beherrschen muss, weil sie sonst ausbrechen könnte. Von Anfang an habe ich, während ich ihm zuhöre, das Gefühl, dass das, was er uns erzählt, auf etwas Ungutes hinauslaufen wird. Und ich bin ganz sicher, dass ich ihn unter keinen Umständen unterbrechen darf. Dies erzeugt in mir ein deutliches, aber nicht unerträgliches Gefühl von Ausgeliefertsein. Vermutlich ist es die Neugier, die ich gleichzeitig empfinde, die mir die Lage des stummen Zuhörers dennoch halbwegs erträglich macht. Zugleich weiß ich ja, siehe oben, dass ich dies nur träume. „Nein,“ sagt der blonde Mann, „ich bin nicht gern in diesem Haus. Es ist nicht etwa deshalb, weil an dem Haus selbst etwas zu beanstanden wäre. Es ist günstig gelegen. Es hat für einen bescheidenen Menschen wie mich genug Komfort. Und dennoch kehre ich nur hierher zurück, wenn es nicht vermeidbar ist. Die Heizung hat ihre Mucken, gewiss. Auch das Regenrohr verstopft im Herbst, und das Wasser pläddert anschließend gegen die Fenster, was ganz schön an die Nerven gehen kann. Aber damit lässt sich ja schließlich leben. Es hat einen anderen Grund, warum ich dieses Haus meiner Kindheit meide. Es sind die Erinnerungen, die dann wach werden. Sie stecken in jedem Winkel, kriechen aus jeder Ritze. Jedes Astloch raunt mir diese alten Geschichten ins Ohr.“ (Ich muss hier kurz unterbrechen, um meine Begeisterung für dieses Sprachbild zum Ausdruck zu bringen. Darauf wäre ich im Wachzustand kaum gekommen. Übrigens fiel im Traum an dieser Stelle seiner Ausführungen mein Blick tatsächlich auf ein Astloch in der Tischplatte vor mir, zwischen uns, und es schien mir, dass es die Form und Färbung eines zum O geformten Mundes hatte.) „Meine Mutter arbeitete in der Stadt. Und im Winter waren mein Vater und mein Onkel daheim und hatten nichts zu tun. Deswegen ertrage ich es nur mit Mühe und nur für kurze Zeit, mich in diesem Haus aufzuhalten. Ich bereue jetzt wieder, mich auf den Vorschlag eingelassen zu haben, hierher zu kommen. Es ist ja so, dass mein Onkel mit mir hier Dinge getan hat, die mir nicht gefielen. Und es ist so, dass diese Dinge mir immer unerträglicher wurden. Ich ertrug es schließlich nicht mehr und bin, obwohl ich mich so sehr schämte, zu meinem Vater gegangen. Aber mein Vater hat mich nicht vor seinem älteren Bruder in Schutz genommen. Das ist der Grund. Das ist alles. – Gehen wir!“
Ich beschließe, dass der Texttraum damit beendet ist, knipse ihn geradezu aus wie einen Film im Fernsehen und bin augenblicklich hellwach. Ich erzähle ihn meiner Gefährtin, damit ich ihn besser im Kopf behalte. Zweierlei fiel mir zu diesem speziellen Fall spontan ein, was als Quelle oder Material gedient haben könnte. Einmal die Autobiographie von Per Olof Enquist, die ich im Juni vorigen Jahres gelesen habe. Enquist stammt aus Västerbotton und hat in Ein anderes Leben ausführlich über seine problematische Kindheit gesprochen und über das Verhältnis zu seinem früh verstorbenen Vater. (Dass mein sehr starker Eindruck von diesem Buch hier keinen Wiederhall gefunden hat, ist einzig mit meiner umzugsbedingten Zwangspause beim Bloggen zu erklären.) Zweitens der Film Das Fest des Dänen Thomas Vinterberg, den ich 2005 gesehen habe und in dem es um Kindesmissbrauch durch den Vater geht. – Ich verspüre ansonsten nicht das Bedürfnis, meine Textträume zu interpretieren, zu deuten. Das erschiene mir fast wie die Beschädigung von etwas sehr Zartem, Verletzlichem, als wollte man einer Blüte die einzelnen Blätter ausrupfen.
Posted in Rêverie, Würfelwürfe | Comments Off on Texttraum (I)
Thursday, 11. February 2010

Gerade erweist sich wieder einmal, dass das Ruhrgebiet bei aller blühenden Pracht diverser bildender und darstellender Künste literarisch nahezu nichts zu bieten hat. Im über 200 Seiten starken Programmheft für das erste Halbjahr der Kulturhauptstadt Europas entfallen auf die Sparte „Sprache erfahren“ gerade einmal sechs, dazu noch mühsam gefüllte Seiten (vgl. Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010. Buch zwei. Essen: RUHR.2010 GmbH, 2010, S. 116-121). Dieses unfreiwillige Selbstbekenntnis zum sekundären Analphabetismus einer Fünfmillionen-Metropole werde ich vielleicht gelegentlich, wenn ich in soliderer Stimmung bin, genauer unter die Lupe nehmen.
Hätte man ehrlich sein wollen, dann wäre noch am ehesten ein Programmschwerpunkt mit jenen schreibenden Revierflüchtlingen zu bestreiten gewesen, die bis auf ihre Abstammung und damit immerhin ihre früheste Prägung kaum etwas mit der Region verbindet, also mit Nachkriegsautoren wie Helmut Salzinger, Nicolas Born, Brigitte Kronauer oder Ralf Rothmann. Aber mit welchen Inhalten hätte man eine solche Revue der Fortgegangenen füllen können? Mit der Ausnahme von Rothmanns Frühwerk hat diese Herkunft, mit der man nirgends Eindruck schinden kann, kaum einen Niederschlag bei ihnen gefunden. Und auch über die Gründe ihres Weggehens haben sie, soweit ich weiß, nichts Nennenswertes zu Papier gebracht, vermutlich einfach deshalb, weil es jedem Außenstehenden unmittelbar verständlich ist und keiner besonderen Erklärung bedarf, wenn man als kulturell interessierter, weltoffener, sensibler und erfahrungshungriger junger Schriftsteller aus dieser Gegend nur fliehen kann. Und den Zurückgebliebenen muss man es nicht erklären, weil die es gar nicht merken, nicht wissen wollen und nicht verstehen würden. Niemand hat ja die Fortgegangenen je vermisst.
Wenn man sich die wenigen Sammlungen literarischer Zeugnisse aus dem bzw. über das Ruhrgebiet anschaut, dann fällt auf, dass es sich ganz überwiegend um nüchterne Berichte von eilig Durchreisenden handelt, so etwa in einer Textsammlung über meine Heimatstadt, Essen in alten und neuen Reisebeschreibungen (ausgew. v. Klaus Rosing. Düsseldorf: Droste, 1989). Indirekt spiegelt sich dies auch im Titel der von Dirk Hallenberger liebevoll zusammengetragenen Reportagesammlung über das Ruhrgebiet wider: Heimspiele und Stippvisiten. Schaut man sich die Auswahl genauer an, dann bestätigt sich schnell die Vermutung, dass die „Stippvisiten“ deutlich in der Überzahl sind, während mit „Heimspiele“ wohl bloß der lokalen Affinität zum Fußball eine kleine Reverenz erwiesen werden soll. Gerade aus dieser Beobachtung hätte ja ein in Sachen Literatur etwas ambitionierteres Team im Kulturhauptstadt-Büro den ispirierenden Funken schlagen können. Schließlich sind die touristischen Heerscharen, die das Großevent Kulturhauptstadt an die Ruhr locken soll, ebenfalls nur auf Stippvisite.
Und was hatten sie so zu berichtet, die großen Durchreisenden der 1920er-Jahre? – Alfred Kerr: „Die Einwohner sind nicht von überflüssiger Heiterkeit. Machen Wege nicht zum Spaß – sondern anscheinend immer zu irgendeinem sachlichen Ziel. (So sieht es für den hereinschneienden Gast aus.)“ (Es sei wie es wolle, es war doch so schön! Berlin: S. Fischer, 1928; hier zit. nach Rosing, a. a. O., S. 126.) – Egon Erwin Kisch: „Bei Tag sieht man Menschen, die von der Macht des Gußstahls zertrümmert und vom Atem der Kohle vergiftet sind.“ (Der rasende Reporter. Berlin: E. Reiß, 1925; hier zit. nach Hallenberger, a. a. O., S. 21.) – Und deutlicher als alle anderen Joseph Roth: „Es ist […] nicht anzunehmen, daß schon viele Vergnügungsreisende den Essener Bahnhof verlassen haben, um ihre Laune zu heben oder ihre Ferien zu würzen.“ (Ankunft in Essen; in: Kölnische Zeitung v. 7. Juni 1931; hier zit. nach Werke 3: Das journalistische Werk 1929-1939. Hrsg. u. m. e. Nachw. v. Klaus Westermann. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1991, S. 330.)
Und damit komme ich zur Klimax meiner heutigen Reviermelancholie – und zum mich selbst überraschenden Umschlag aus der Tristesse in die Euphorie. So viele Jahre habe ich nach einem Epiker gesucht, der dieser nichtigen Landschaft, dieser ungestalten Stadtwüste, dieser profillosen Gemeinschaft und dieser unkultivierten Ödnis des Ruhrgebiets, wie es im vorigen Jahrhundert war, sprachlich gerecht geworden wäre. Noch vor ein paar Tagen hätte ich im Brustton der Überzeugung behauptet, dass es diesen Schreiber nicht gab. Jetzt bin ich eines Besseren belehrt. Joseph Roth hat, wenn ich es richtig übersehe, das Revier zweimal besucht, Anfang 1926 und fünf Jahre später, im Frühling 1931. Seine Eindrücke von den beiden „Stippvisiten“ hat er in zehn Feuilleton-Artikeln für die Frankfurter Zeitung bzw. die Kölnische Zeitung festgehalten (vgl. Joseph Roth: Werke 2, S. 544-549 u. Werke 3, S. 320-346). Und diese auf den ersten Blick unscheinbaren und weitgehend unbekannten „Reiseimpressionen“ – welch harmloses Wort! – sind nun wahrlich auf den zweiten das Kraftvollste und Ätzendste, das Bohrendste und Bitterste, das Hell- und Weitsichtigste, was ich je über meine Heimat gelesen habe. Von diesem freudigen Schreck muss ich mich erst einmal erholen. Ich hätte eine szenische Lesung aus diesen Texten arrangieren können, die an allen 365 Tagen des Kulturhauptstadtjahres an einem anderen Revierort zur Aufführung hätte kommen können. Das wäre was gewesen. Aber, ach! Zu spät …
Posted in Flanerie, Kulturflanerie, Roth, Würfelwürfe | Comments Off on Roth im Revier (I)
Monday, 08. February 2010

Am 30. Januar las ich zur Feier des 50. Geburtstags einer guten Freundin in Düsseldorf-Flingern Gedichte von Johannes Bobrowski (1917-1965) und kurze Prosastücke von Hermann Harry Schmitz (1880-1913), Edgar Allan Poe (1809-1849) und Joseph Roth (1894-1939). Erst nachdem ich das Programm zusammengestellt hatte, wurde mir bewusst, was allen vier Autoren gemeinsam ist: Keiner von ihnen hat das Alter der Jubilarin erreicht.
In den Kalendern und natürlich auch im Internet, so zum Beispiel auf der Startseite von Wikipedia, werden wir alltäglich daran erinnert, wer heute vor wieviel Jahren geboren wurde oder gestorben ist. Und wenn ich wissen will, welche Geburts- und Sterbefälle prominenter Menschen auf meinen Geburtstag fallen, ist die Antwort auf diese Frage auch nur einen Mausklick weit entfernt.
Dabei wäre es doch viel interessanter, beim Frühstück daran erinnert zu werden, welche Heldinnen und Helden der Vergangenheit ich heute wieder „überholt“ habe, weil sie auf den Tag genau in dem Alter, das ich jetzt erreicht habe, das Zeitliche gesegnet haben. Ein solcher Datenservice müsste natürlich für jeden Menschen je nach seinem Geburtstag individuell eingerichtet werden, aber das wäre mit den heutigen technischen Mitteln kaum ein Problem. Die Grundlage eines solchen Geburtstags-Sterbetags-Vergleichsrechners wäre ein Datenstamm, bei dem das erreichte Alter aller verstorbenen Berühmtheiten exakt ein Lebenstagen ausgedrückt ist. Damit ist die einfache Vergleichbarkeit mit meiner eigenen Lebenszeit (und der jedes anderen Interessenten) gewährleistet.
Praktischerweise rechnet man dazu alle Daten zunächst in das Julianische Datum (JD) um. Mein Geburtstag fiel auf das JD 2.435.666, heute haben wir das JD 2.455.236. Die Differenz dieser beiden Zahlen beträgt 19.570, das ist somit die Summe meiner bisherigen Lebenstage. Maria Callas (1923-1977), um eine beliebige bekannte Vergleichsperson zu wählen, deren Sterbealter ich noch nicht erreicht habe, wurde am 2. Dezember 1923 geboren (JD 2.423.756), starb am 16. September 1977 (JD 2.443.403) und erreichte somit ein Alter von 19.647 Tagen. Am Sonntag, dem 25. April dieses Jahres werde ich mich auf den Tag genau im Alter von Maria Callas am Tage ihres Todes befinden und sie dann „altersmäßig“ überholen.
Ich stelle mir vor, dass es manchen griesgrämigen Zeitgenossen allmorgendlich erfreuen würde zu erfahren, welche berühmten Menschen er, was das Lebensalter betrifft, heute wieder hinter sich lässt. Ist ein solcher „Vitalitätsrechner“ nicht vielleicht eine pfiffige Internet-Geschäftsidee, mit der ich viel Geld verdienen könnte? Oder gibt es diesen Rechner schon längst? In meiner Vorstellung besteht er aus einem achtstelligen Eingabefenster für das individuelle Geburtsdatum nach Tag, Monat und Jahr; darunter zeigt er sodann die siebenstellige Zahl für den Julianischen Geburtstag an; in der dritten Zeile erscheint das aktuelle Alter in Tagen. Und schließlich werden alle Prominenten mit ihren Geburts- und Sterbedaten aufgezählt, die zum Tag der Abfrage exakt dieses Alter erreicht haben.
Posted in Memento, Time Machine, Würfelwürfe | Comments Off on Überlebt
Sunday, 07. February 2010

Die Berlinale feiert 60. Geburtstag, wie übrigens auch der gerade nach Berlin umgezogene Suhrkamp-Verlag. Das Filmfestival hat Werner Herzog zum Präsidenten gemacht. Ist das eine Nachricht? Vielleicht lautet die Nachricht doch eher: Werner Herzog hat sich zum Jury-Präsidenten der Berlinale machen lassen. Aber ich muss noch grundsätzlicher werden. Für mich persönlich lautet die Nachricht zuallererst einmal: Werner Herzog lebt noch.
Mindestens scheint es so. Ein Mann dieses Namens hat aus Anlass seiner Bestallung längliche Interviews gegeben, so in der SZ (Jörg Häntzschel: Die Hornisse; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 28 v. 4. Februar 2010, S. 3) und in der ZEIT. Dort fragt ihn Katja Nicodemus nach seiner neuen Heimatstadt Los Angeles. Werner Herzog: „Los Angeles ist ja eine Stadt, in der man nicht zu Fuß gehen kann. Sie machen sich verdächtig. Die Polizei fährt langsam neben Ihnen her und fragt, was Sie da tun. Nur wenn Sie einen Hund ausführen oder joggen, dann fallen Sie nicht auf. Aber zu Fuß gehe ich eigentlich nur, wenn ein existenzieller Grund dahinter ist.“ (Herr der Schmerzen; in: DIE ZEIT Nr. 6 v. 4. Februar 2010, S. 45.) Das ist ziemlich genau die Situation, die Günther Anders Anno Domini 1941 in Kalifornien erlebt und 15 Jahre später mit nicht zu überbietendem Sarkasmus geschildert hat. (In: Die Antiquiertheit des Menschen. Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. München: C. H. Beck, 1956, S. 172-174; vgl. auch hier.)
Herzog nimmt aber längst keinen Anstoß mehr daran, dass an seinem Wohnort die natürliche Fortbewegung per pedes nurmehr in Tarnkleidung oder in Begleitung eines alibi animal möglich ist. Dabei sollte man ja gerade von ihm eine gesteigerte Empfindlichkeit gegen die Verkümmerung der natürlichen Körpermotorik erwarten, hat er doch vor vielen Jahren einmal bei seinem Marsch in 22 Tagen von München nach Paris vorgeführt, dass das Wissen des Menschen von den Füßen kommt und nicht von den Rädern. So fragt Katja Nicodemus auch ganz keck: „Früher sagten Sie, dass sich nur dem Fußgänger die Welt eröffne. Das ist hier wohl vorbei.“ Der schlecht versteckte Vorwurf gegen jemanden, der längst seine Jugendideale verraten hat, kommt bei Herzog nicht an. Los Angeles lässt es eben nicht zu.
Und trotzdem lebt der Regisseur gern dort: „Für mich ist Los Angeles die amerikanische Stadt mit der größten Substanz. Ich meine natürlich nicht die reine Oberfläche, den Glitz [!] und Glamour von Hollywood. Aber alle wichtigen Trends des vergangenen Jahrhunderts kommen aus Kalifornien […]“ – und dann zählt Werner Herzog auf, was er für die wichtigen Trends des vergangenen Jahrhunderts hält. Hier fasst er nun also den Wert der Jahre 1901 bis 2000 zusammen, über die er sich offenbar ein altersweises Urteil zutraut. Nebenbei bemerkt: Werner Herzog wurde erst im Jahre 1963 erwachsen. Aber man kann sich Geschichtskenntnisse ja auch auf dem ersten oder zweiten Bildungsweg aneignen. Der deutsche Filmemacher kommt also für besagte hundert Jahre auf genau acht wichtige Trends. Für deren sechs meint er den Ursprung in Kalifornien verorten zu können; und von diesen seien immerhin vier ernst zu nehmen.
Nun bitte ich meine Leser, vorsorglich die Schuhe selbst auszuziehen, es sich bequem zu machen, noch einmal tief durchzuatmen und sodann Werner Herzogs ultimative Trendshow des Zwanzigsten Jahrhunderts made in California zur Kenntnis zu nehmen. Es sind dies „[1] die kollektiven Träume im Kino weltweit. [2] Die Tatsache, dass Homosexuelle als integraler Bestandteil einer Gesellschaft anerkannt werden. [3] Die Computertechnologie. [4] Die großen Internetinnovationen. Und im Übrigen auch die Dummheiten wie [5] Hippie und [6] New Age. Es gibt nur zwei Ausnahmen. [7] Die grüne Bewegung kommt eher aus Skandinavien. Und der [8] islamische Fundamentalismus kommt auch nicht aus Kalifornien.“ Wow! Da bin ich tatsächlich sprachlos.
Posted in Flanerie, Würfelwürfe | Comments Off on 20th Century Trends
Thursday, 04. February 2010
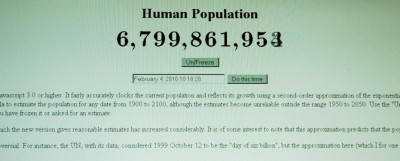
Demnächst, sehr bald klappen wieder einmal die letzten acht Ziffern der Weltbevölkerungsuhr von 9 auf 0 um, aus der 7 auf Platz zwei wird eine 8 und wir zählen dann 6,8 Milliarden Menschen hienieden. Ähnlich rasant läuft die Uhr der Staatsverschuldung in den USA oder in Deutschland. Solche ratternden Zählwerke versuchen, Entwicklungen fühlbar zu machen, die als statische Ziffernfolgen gänzlich unbegreifbar bleiben. Ehrlicher ist es übrigens, wenn die aktuelle Bevölkerungszahl als Differenz zwischen Geburten und Todesfällen dargestellt wird, wie zum Beispiel hier. Da gibt es dann ein noch schneller laufendes Zählwerk für die durch Geburten zum Bestand hinzukommenden Menschen, ein deutlich langsameres Zählwerk der durch Tod fortfallenden Menschen und schließlich die hieraus sich errechnende aktuelle Bestandszahl, so wie sie jetzt in der schlichteren Animation gezeigt wird.
Dennoch fehlt eine Zahl. – Zwischen Juni 1988 und November 1995 plauderten Alexander Kluge und Heiner Müller vor laufender Kamera über das Allgemeinste und das Privateste, sie kamen dabei von Hölzchen auf Stöckchen, von der Fernbedienung in der Hand von Müllers Töchterchen im Handumdrehen zur Apokalypse. In einem dieser Gespräche, Die Welt ist nicht schlecht, sondern voll, stellt Kluge fest, „dass die Summe der Toten und dieses Lager der Lebendigen konstant bleiben über lange Perioden. Und würde je das Lager der Lebendigen das Lager der Toten an Zahlen übertrumpfen …“ – Müller: „Und das ist jetzt der Fall!“ – Kluge: „… dann habe ich Armageddon.“ – Müller: „Dann wird’s gefährlich.“ – Kluge: „Dann ist die Katastrophe.“ – Müller: „Ja, ich glaube schon.“ – Kluge: „Weil gewissermaßen der Rat, das Gewicht der Toten gibt sozusagen die Plätze … befestigt, verankert die Plätze der Lebenden.“ – Müller: „Ja, ja.“ Es fehlt die Zahl der Toten seit der Entstehung von Homo sapiens, seit der Vertreibung aus dem Garten Eden: die Zahl der Gräber auf dem Friedhof aller Zeiten seit Menschengedenken.
Heiner Müller meinte also, der Zeitpunkt sei gekommen, da aktuell mehr Menschen quicklebendig auf der Welt herumlaufen als mausetot unter der Erde liegen; somit stehe der Weltuntergang unmittelbar bevor, wenn man der antiken Prophezeiung glauben wolle. Dies ist offenkundiger Nonsens. Vielmehr haben Berechnungen ergeben, dass die Zahl aller auf unserem Globus jemals geborenen Menschen seit 50.000 v. Chr. schätzungsweise 110 Milliarden beträgt. Der Anteil der jetzt lebenden von allen je geborenen Menschen beträgt also nur etwa 6,2 Prozent. Müller ist vermutlich einer Mitte der 1970er-Jahre verbreiteten Falschmeldung aufgesessen, welche besagte, dass damals 75 Prozent aller je geborenen Menschen auf der Welt lebten. Eine wohl unbestreitbare Tatsache ist vielmehr, dass der kritische Punkt einer Übereinstimmung beider Zahlen niemals erreicht werden kann.
Nun muss ja ein moderner Dramatiker kein Fachmann für Globaldemografie sein. Auch wollen wir dem offenbar schwerstabhängigen Zigarrenqualmer nicht verübeln, wenn er im Nebel seiner Havanna keinen ganz klaren Blick mehr auf die Tatsachen hat. Und dann ist hier noch die bekannte Neigung mancher Hirntiere in Rechnung zu stellen, in der Agonie zu Hiobsbotschaft und Kassandrageschrei ihre Zuflucht zu nehmen vor der offenbar unerträglichen Vorstellung, die Welt könne auch ohne sie weiter ihre Bahnen ziehen. Aber wenn ich einmal über eine solche krasse Verkennung der Tatsachen gestolpert bin, dann ist mein Misstrauen geweckt und ich lasse mich nicht mehr so leicht vom bloßen großen Namen ins Bockshorn jagen.
Was ich jedoch Heiner Müller weit weniger verzeihen kann als seine naive Weltuntergangs-Prognose aus dem Kaffeesatz der Orestie, das ist die Kindesmisshandlung, die er zu Beginn des gleichen Gesprächs schildert: „Es ist zum Beispiel eine Frage, was passiert mit Kindern, die die Welt primär kennenlernen durch Abbildung, Fernsehen. Meine Tochter ist vierzehn Monate alt, die steht schon mit dem Gerät [der Fernbedienung] da vor dem Fernseher und kann das bedienen. Sie weiß nicht genau wie, aber irgendwas schafft sie immer. […] Und sie drückt dann auf den Knopf, und dann ist was anderes da auf dem Bildschirm, das hat sie schon verstanden. Aber sie lernt die Welt, die Außenwelt, wesentlich kennen über den Bildschirm. Was heißt das, was passiert da, wenn die Kinder die virtuelle Realität kennenlernen vor der sogenannten wirklichen? Gibt’s dann überhaupt noch einen Unterschied? Und was heißt das, wenn diese Unterschiede verschwinden?“ – Das ist eine Apokalypse im Kleinen.
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Ist’s der Fall?
Wednesday, 03. February 2010

Die Hannoversche Allgemeine nannte das Unternehmen „ein Kulturversandhaus“. Diese Titulierung passt insofern noch immer, als die Kultur unter diesem Label zunehmend versandet. In besseren Zeiten spuckte Zweitausendeins etwas von jenem Sand aus, der das Getriebe einer stumpf vor sich hin polternden Kulturmaschinerie ins Stocken geraten lässt. Das nannte man damals die subversive Kraft des Kreativen. Lutz Reinecke aka Kroth, der Gründer dieses „Neckermann für Intellektuelle“, konnte im September vorigen Jahres den 40. Geburtstag seines aus den Wimmelanzeigen von Pardon entschlüpften Erfolgsrezepts nicht verstreichen lassen, ohne en passant seine Stammkunden in den Stores und seine Merkheft-Abonnenten um „nur“ 3,90 Euro anzuschnorren für diesen Rückblick auf vier Jahrzehnte Versandgeschichte.
Der 9/11-Mystagoge Mathias Bröckers hat also die Geschichte aufgeschrieben: Wie ein merkwürdiger kleiner Versand die Kulturlandschaft veränderte (in: Zweitausendeins. Der Versand. 40 Jahre danach. Frankfurt am Main: Zweitausendeins, 2009, S. 5-82). Merkwürdig war und ist Zweitausendeins ja tatsächlich, weil überaus zwittrig, nicht Fleisch nicht Fisch. Der Laden nennt sich noch immer Versand, reüssiert aber dann doch als ambitionierter Verlag und bildet sich darauf nicht wenig ein, um aber in seinen Selbstverlautbarungen ständig damit zu kokettieren, kackfrech und zugleich wieder durch ein Augenzwinkern relativiert, dass es ihm eigentlich doch bloß um Umsatz, Kohle, Moneten gehe – ganz genauso wie den lieben Kunden, den Bestellern und Ladenbesuchern, die sich ja schließlich auch ein Loch in den Bauch freuten, wenn sie statt 998 Euro nur noch 9,80 Euro für nahezu die gleichen zig Regalmeter allerintellektuellsten Lesestoffs latzen müssen.
In besagter Festschrift des Verlages auf sich selbst wird man selbstkritische Einsichten oder auch nur versteckte Hinweise auf die Widersprüchlichkeit einer solchen Unternehmung naturgemäß vergeblich suchen. Dass es dennoch gelegentlich knirschte im Gebälk, das ließ sich freilich nicht ganz verschweigen. Bröckers berichtet, wie seit 1980 Eva Kroth immer mehr Einfluss auf die Programmgestaltung gewann und Titel aus den Bereichen Ökologie, Feminismus, Selbsthilfe und Esoterik einen breiteren Raum im Sortiment einnahmen. „Einen zu breiten, wie die beiden ,Sub-Verleger‘ bei Zweitausendeins fanden – Jörg Schröder mit seinem März Verlag und der ehemalige Zeit-Redakteur Uwe Nettelbeck mit seinem gleichnamigen Verlag. Beide trennen sich in der Folge in ungütlichen Gerichtsverfahren von ihrem Dachverlag. Neben Intrigen, Eitelkeiten und dem üblichen Alpha-Männchen-Gehacke, das sowohl Nettelbeck (in seiner Zeitschrift Die Republik) und Schröder (in seiner Reihe Schröder erzählt) später ausführlich aus ihrer Sicht geschildert haben, ging es im Kern natürlich um Geld. Jörg Schröder sah sich spätestens nach dem Bestsellererfolg von Bernward Vespers Reise als der innovative literarische Macher und fühlte sich mit seiner prozentualen Beteiligung an den März-Titeln unterbezahlt. – Und Uwe Nettelbeck, von dem der Tipp zu den geheimen Deutschland-Berichten der SoPaDe 1934-1940 stammte, die dann auch 1980 in sieben Bänden bei Nettelbeck/Zweitausendeins herauskamen, wollte allein für diesen Hinweis ein reguläres Autorenhonorar, obwohl das doch eigentlich den unbekannten Verfassern zugestanden hätte. Man einigte sich schließlich auf einen reduzierten Prozentsatz, und Lutz Kroth verpflichtete sich, die übrigen Prozente zu spenden – nicht etwa an die SPD, sondern an eine gegenwärtige ,Widerstandsorganisation‘: an Greenpeace. Nachdem die Deutschland-Berichte zu einem unerwarteten Verlaufserfolg geworden waren, wollte Nettelbeck diese Klausel ändern, weil Zweitausendeins mit der Greenpeace-Spende – nach dem Motto ,Tue Gutes und rede darüber‘ – Werbung betrieb: Greenpeace konnte mit dem Spendenscheck über 94.000 DM einen Teil der 250.000 DM teuren ,Sirius‘ finanzieren, des zweiten Aktionsschiffes der Umweltaktivisten. Als die Änderung der Klausel nicht zustande kam, endete Nettelbecks Kooperation mit Zweitausendeins. Lutz Kroth fühlte sich dennoch weiterhin an die Spendenklausel gebunden. So gingen etwa noch im Frühjahr 1990 rund 8000 DM an ein Frankfurter Frauenhaus.“ (Ebd., S. 59 f.)
Ich zitiere hier so ausführlich, weil diese Passage vielleicht die aufschlussreichste in dem kleinen Heftchen ist – und die beiden Zerwürfnisse wahrscheinlich die Highlights der langen Verlagsgeschichte, jedenfalls für jeden wirklich an Aufklärung interessierten Branchenbeobachter. Auffällig ist, dass Bröckers den „Fall SoPaDe“ so detailliert darstellt, während er den „Fall März“ in einem einzigen Satz abfertigt. Dabei bedankt sich Bröckers in den Credits (S. 82) ausdrücklich auch bei Jörg Schröder „für Auskünfte und Unterstützung“. Bei Uwe Nettelbeck muss er sich nicht bedanken, der ist bekanntlich seit zwei Jahren tot und kann sich nicht mehr wehren. Thomas Steinfeld schrieb anlässlich seines Todes: „Wäre Uwe Nettelbeck weniger gebildet und vor allem weniger anspruchsvoll gewesen, so hätten der Verlag und die Buchhandelskette ,Zweitausendeins‘ sein Einfall sein können.“ (Süddeutsche Zeitung Nr. 19 v. 24. Januar 2007, Seite 11.)
Wenn man nachliest, wie Jörg Schröder den Bruch mit Zweitausendeins „ausführlich“ und „aus seiner Sicht“ geschildert hat, nämlich hauptsächlich in den Heften 4 bis 6 und 26 ff seines work in progress (1991/1996-97), dann muss man bezweifeln, dass er unterschreiben würde, auch ihm sei es damals „im Kern um Geld“ gegangen. Und dass diese Präferenz „natürlich“ sei, vernimmt man als unschuldiger Leser mit Befremden in der bestellten Lob-Arie auf einen Verlag, dem die Natur doch nach eigenem Bekenntnis stets mehr am Herzen liegt als der schnöde Mammon. Ich lasse mich überraschen, ob Schröder & Kalender in der mit Spannung erwarteten 14. Folge der Schwarzen Serie von Schröder erzählt, die dem Vernehmen nach in diesen Tagen unter dem Titel Das Äussere des Inneren erscheinen soll, auf die Selbstbeweihräucherung des Frankfurter Kulturversands eingehen wird, die uns nicht stören müsste, wenn sie nicht zugleich eine Vernebelung der wahren Sachverhalte und eigentlichen Zusammenhänge darstellte.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on 2001+8 = pfft
Wednesday, 27. January 2010

In diesen unfreundlichen Wintertagen, da man keine schlafenden Hunde weckt, um sie vor die Tür zu jagen, möchte ich dennoch dem Flanieren nicht ganz entsagen und muss ja auch keineswegs auf meine geliebte Streunerei verzichten. Dank Internet kann ich schließlich, ohne mir Frostbeulen zuzuziehen oder über Nässe zu klagen, in der warmen Stube das weltumspannende Datennetz nach geheimen Zusammenhängen durchstöbern. An jedem Satzende bietet sich mir dabei die Möglichkeit, verschiedene Richtungen einzuschlagen. Hier zum Beispiel könnte ich nun über unfreiwillige Reime in Prosatexten nachdenken. Welche Beispiele gibt es dazu etwa bei Swift, Wieland oder Balzac? Bilde ich mir das nur ein, oder hat sich lange vor mir jemand mit genau diesem abwegigen philologischen Gegenstand befasst? Wie googelt man nach solch einer Abstrusität?
Das Abzweigen unterwegs ist ja ein leichtes Unterfangen, wenngleich es nicht selten in Irren führt, aber gerade Irrtümer bieten ja oft genug Gelegenheiten zu unverhofften Einsichten. Viel mühevoller gestaltet sich meist das Aufbrechen. Der erste Schritt ist ein erbarmungsloser Knochenjob, wovon nicht nur die Morgenmuffel unter den Schreibknechten ein Klageliedchen zu singen haben. Darum verwahre ich in der langschwänzigen Lesezeichenliste meines Browsers allerlei Appetizer, die mir den Schlaf aus den Augen treiben sollen.
Heute früh zum Beispiel stöberte ich zur Abwechslung wieder einmal in Letters of Note, dem traumhaften Briefe-Blog von Shaun Usher. Unterm 13. Oktober 2009 entdeckte ich dort das seltsame Briefkunst-Event eines Künstlers aus Albany (NY), der Anfang der 1970er-Jahre rund 500 prominente und weniger prominente Leute um ihre Beteiligung an dieser skymail genannten Aktion bat. G. C. Haymes schrieb: „guten morgen, hiermit werden sie eingeladen, sich an skymail zu beteiligen (erstes event). skymail ist ein künstlerisches event, bei welchem ausgewählte künstler aus verschiedenen bereichen eingeladen sind, den himmel zu beschreiben. ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn sie sich die zeit nähmen, die beigefügte karte auszufüllen & in einen briefkasten zu werfen (das porto wurde vorausbezahlt). – ich suche momentan einen schauplatz für das event. sie werden über den zeitpunkt & ort der ausstellung unterrichtet. – ich danke ihnen vielmals. – genießen sie den himmel – g c haymes – koordinator skymail (erstes event)“. [Übers. a. d. Am. v. M. H.] Auf der Website von Haymes ist dokumentiert, wer die annähernd 500 bedeutenden Leute waren, die zu dieser großangelegten Himmelsbeschreibung eingeladen wurden – und man kann dort alle 28 Antworten nachlesen, die über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren in Albany eingingen, unter ihnen immerhin auch welche von Sam Peckinpah, Gary Snyder und John Cage! Shaun Usher hat lediglich zwei Antwortkarten ausgewählt: eine sehr bemühte vom weltbekannten Science-Fiction-Schreiber Isaac Asimov und eine überaus unfreundliche von Jerzy Kosiński, ohne Unterschrift und mit folgendem Wortlaut: „Imbezillogramm – Lieber Idiot: Hast Du nicht irgendwas Besseres zu tun? Der Himmel ist tatsächlich eine Grenze für anmaßende Idioten wie Dich.“ [Übers. a. d. Am. v. M. H.]
Wer war noch mal dieser Jerzy Kosiński (1933-1981)? Und wo ist er mir, vor vielen Jahren, erstmals über den Weg gelaufen? Ich las den englischsprachigen Wikipedia-Artikel über ihn und verfing mich in allerlei merkwürdigen Abwegigkeiten seiner Vita. So fällt auf sein dem Vernehmen nach bestes Werk, den autobiographischen Roman The Painted Bird, insofern ein Schatten, als Kosiński darin schildert, wie er als kleiner Judenjunge im besetzen Polen vor den Deutschen über die Dörfer floh und zahlreiche Abenteuer erlebte. Tatsächlich aber kam er während der ganzen Zeit der Nazi-Okkupation bei polnischen Katholiken unter und überlebte dank eines gefälschten Taufzeugnisses. Seine späteren Romane wiesen dermaßen auffällige Stilunterschiede auf, dass Kritiker nicht glauben wollten, diese Werke könnten aus ein und derselben Feder stammen. Die Plagiatsvorwürfe gegen ihn wollten bis zu seinem gewaltsamen Tod nicht verstummen. Am polnischen Nationalfeiertag, dem 3. Mai 1991 legte sich Jerzy Kosiński in seinem Appartement in der West 57th Street in Manhattan in die Badewanne, nahm eine tödliche Dosis Barbiturate und zog sich sicherheitshalber noch eine Plastiktüte über den Kopf. Seine zweite Ehefrau, Katherina „Kiki“ von Fraunhofer, fand am nächsten Tag neben der Leiche einen Zettel mit einer kurzen Nachricht ihres Gatten: “I am going to put myself to sleep now for a bit longer than usual. Call it Eternity.” Was hatte er da bloß getan? Etwas Besseres als den Himmel zu beschreiben?
Und jetzt weiß ich auch wieder, wo mir der polnisch-amerikanische Schriftsteller zum ersten Mal begegnete: in Ed Sanders‘ Buch über die Manson-Morde! Um ein Haar wäre Jerzy Kosiński nämlich bereits schon viel früher, in der Nacht vom 8. auf den 9. August 1969 in Los Angeles (CA), eines gewaltsamen Todes gestorben, damals aber nicht von eigener Hand. „Der Romancier Jerzy Kosinski und seine Frau sollten am 7. August in der Polanski-Villa in Los Angeles eintreffen; sie wollten dort bis zu Romans Rückkehr [aus Polen] zu seinem Geburtstag [am 18. August] und bis zur Ankunft von Sharons Baby bleiben. Doch Kosinskis Gepäck war auf dem Weg von Europa nach New York verlorengegangen, und anstatt gleich nach Los Angeles zu fliegen, blieben sie in New York und warteten dort auf ihre Koffer. Das hat ihnen wahrscheinlich das Leben gerettet […].“ (Ed Sanders: The Family. Die Geschichte von Charles Manson und seiner Strand-Buggy-Streitmacht. A. d. Am. v. Edwin Ortmann. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1972, S. 230.)
Posted in Memento, Würfelwürfe | Comments Off on Abwege (I)
Monday, 25. January 2010
Posted in Flanerie, Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Müßiggang A-Z
Saturday, 23. January 2010

Gestern Abend fand nun in der Essener Lichtburg die Buchvorstellung mit Herta Müller statt, die ursprünglich für den 13. Oktober vorigen Jahres angekündigt worden war, als noch niemand wusste, dass die deutschsprachige Schriftstellerin aus Rumänien den Nobelpreis für Literatur zugesprochen bekommen würde.
Große Erwartungen hatte ich nicht in diese Veranstaltung gesetzt, das gebe ich frank und frei zu. Herta Müller habe ich sehr früh wahrgenommen, als nämlich ihr erstes Buch Niederungen im Orwell-Jahr 1984 in einer ungekürzten Ausgabe bei Rotbuch erschien, zwei Jahre nachdem der Bukarester Verlag Kriterion nur eine gekürzte Fassung hatte herausbringen dürfen oder wollen. Da begegnete mir bei einer Leseprobe in der Buchhandlung, in der ich arbeitete, eine eigenwillige Sprache, und auch das Thema hatte es zweifellos in sich, wenn man darauf vertrauen konnte, was der Klappentext versprach. Ich weiß noch, dass ich Müllers Niederungen in der Linken hielt, und in der Rechten ein anderes Buch aus dem Rotbuch-Verlag dagegen abwog, denn eines nur konnte oder wollte ich mir an diesem Tag leisten. Das andere erhielt den Vorzug. Es waren die gleichzeitig erschienene Erzählung von Karin Reschke, Dieser Tage über Nacht. Warum ich so entschied und nicht anders? Ich weiß es nicht. Der Preis kann jedenfalls nicht den Ausschlag gegeben haben, beide Bücher kosteten, eins wie das andere, dreizehn Deutsche Mark. Reschkes Buch habe ich damals nach ein paar Seiten enttäuscht aus der Hand gelegt. Und Herta Müller wurde anschließend unverdientermaßen von meinem Unterbewusstsein in Mithaftung genommen, weil ich ganz unsinnigerweise auch ihren Namen mit der Frustration verband, die mir doch allein Karin Reschke bereitet hatte. Erst als ich mich Mitte September mit der Shortlist des fünften Deutschen Buchpreises beschäftigte, also genau 25 Jahre nach meiner ersten Begegnung, trat Herta Müller wieder in deutlicheren Konturen vor mich hin und weckte mein Interesse. Ich las die vier Seiten in den Leseproben, die ab dem 23. August in den Buchhandlungen auslagen, den Anfang von Atemschaukel, einem Buch, das sich Roman nannte. Diesmal prüfte ich den Text nicht, um Gewissheit zu finden, ob es sich für mich lohnen könnte, es zu kaufen und zu lesen. Diesmal beschäftigte mich allein die Frage, ob ich anhand dieser knappen Kostprobe die Chancen würde abschätzen können, die dieser Roman in der Konkurrenz um den Preis hatte. Ich kam, wie übrigens auch bei den übrigen fünf Titeln der Shortlist, zu einem negativen Befund. Vielleicht wäre ich aber für Atemschaukel eingesprungen, wenn ich statt der kurzen Textprobe das ganze Buch gekannt hätte.
Dass der Essener Auftritt von Herta Müller nun nicht vor den üblichen fünfzig bis hundert Verdächtigen, den hartnäckig an widerspenstiger bis avantgardistischer Literatur interessierten Stammgästen der Heldenbar im Grillo-Theater stattfand, sondern vor über tausend unbescholtenen Bildungsbürgern in Deutschlands größtem Kinosaal, das ist dem undurchschaubaren Ratschluss jenes Clübchens grauer Herren in Stockholm zu verdanken, die sich in der Vergangenheit bekanntlich weniger durch glasklare und nachvollziehbare Kriterien ihrer Entscheidungsfindung hervorgetan haben, als vielmehr durch den Wackelgang jenes blinden Huhns, das alle Jubeljahre auch mal ein Korn findet. Dass dieser Auftritt schließlich zu einem ganz außergewöhnlichen Ereignis gedieh, ist einem ähnlich orientierungslosen Glücksgriff des Schicksals geschuldet. Und nun ist der Zeitpunkt gekommen, da ich den Gesprächspartner der Nobelpreisträgerin all jenen vorstellen muss, die in diesem Augenblick den Namen Norbert Wehr zum ersten Mal lesen. Diesen meist etwas griesgrämig dreinblickenden, leicht magenkrank wirkenden Mann Mitte fünfzig kenne ich nun wohl schon seit 35 Jahren persönlich. Meine intensiveren Begegnungen mit ihm datieren aus der Zeit vor seiner Herausgeberschaft der Literaturzeitschrift Schreibheft. Also aus einer Zeit, an die er sich vermutlich weit weniger gut erinnert als ich. Seine Verdienste um die Art Literatur, die ohne Leute wie ihn nicht von verschwindend wenigen, sondern von gar keinen Lesern gelesen würde, sind unbestreitbar und allgemein anerkannt. Er ist für mich eins der treffendsten Beispiele für einen Menschenschlag, den die Enttäuschung seiner ersten großen Liebe zu einer noch größeren Liebe geläutert und befähigt hat. Wehr, der wenig schreibt und auch im mündlichen Verkehr ein bis zur Sprachlosigkeit wortkarger Mensch ist, fördert vielleicht gerade durch seine Zurückhaltung im Orchester der Plaudertaschen Stimmen zu Tage, die sonst gar kein Gehör fänden.
Genau dies geschah gestern auf der Bühne der Lichtburg, unter einer großen Leinwand, wo sich die beiden krähenhaften Helden des Abends an zwei schlichten Tischchen im rechten Winkel gegenübersaßen. Norbert Wehr fasste in einem einleitenden Vortrag, der genau in dem Moment abbrach, als meine Aufmerksamkeit zu ermüden drohte, die historischen und persönlichen Voraussetzungen des Romans Atemwende zusammen. Und ehe ich mich versah, war Herta Müller in ihr Element versetzt und schöpfte aus dem Vollen ihrer Erinnerungen an die Zeit, als sie Oskar Pastior über sein Leben als Zwangsarbeiter in Krivoi Rog und Gorlowka befragte, an die gemeinsame Reise in die Ukraine in Begleitung von Ernest Wichner. Herta Müller sprach über ihr Verhältnis zur Mutter, die doch auch Zeitzeugin und traumatisiertes Opfer der Zwangsarbeitslager war und doch nicht darüber sprechen konnte. Sie erzählte in diesen knapp neunzig Minuten so viel und so viel Erhellendes über die Entstehungsbedingungen ihres Romans, dass ich jenes Buch, so kraftvoll es sein mag, ohne Zögern für das Erlebnis dieser Erzählung hingegeben hätte. Und warum konnte sich dieses Naturereignis eines Werkstattberichts ohne störende Zwischenfragen so frei entfalten, dass es fast an ein Wunder grenzte? Weil der Gesprächspartner, den wir hier getrost als solchen in Anführungszeichen setzen können, durch größtmögliche Zurückhaltung glänzte.
Dass vermutlich kaum einer der eintausendzweihundertfünfzig Zuhörer so recht begriff, was ihm hier geschah, spricht wohl noch zusätzlich für die außergewöhnliche Seltenheit des Ereignisses. Dass die lokale Presse nicht mehr abzuliefern imstande war als eine holprige Pflichtberichterstattung, war nicht anders zu erwarten. – Ob ich mich nun auf die Schaukel setzen und dieses Buch lesen werde? Vorläufig warte ich ab. Vielleicht befeuert der Nobelpreis ausnahmsweise einmal den Träger (hier: die Trägerin) dazu, sich selbst zu übertreffen, statt sich wie üblich auf diesem allerhöchsten Lorbeer zur letzten Ruhe zu betten.
Posted in Provinzglossen, Würfelwürfe | Comments Off on Hungerengel
Wednesday, 20. January 2010

Vergangene Woche starb in Berlin kurz vor Vollendung ihres 69sten Lebensjahrs die linke Essayistin Katharina Rutschky, die einer größeren Öffentlichkeit Ende der 1970er-Jahre durch das von ihr herausgegebene Quellenbuch zur „Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung“ bekannt wurde. Dessen Titel, Schwarze Pädagogik, ging danach in den allgemeinen Wortschatz ein zur Bezeichnung eines durch Jahrhunderte geübten Erziehungsstils, der es sich nicht zur vornehmsten Aufgabe machte, die natürlichen Anlagen des Kindes durch liebevolle Zuwendung nach Möglichkeit zu fördern, sondern ihm stattdessen mit einem großen Arsenal physischer und psychischer Strafwerkzeuge Disziplin, Fleiß und Gehorsam anzudressieren. (Rutschky selbst war übrigens kinderlos, und ihre Tätigkeit als Lehrerin beschränkte sich auf junge Erwachsene im zweiten Bildungsweg. Ich überlasse es dem Leser, ob er dieses praktische Defizit bei der Parteinahme in pädagogischen Diskursen für einen Vor- oder Nachteil halten will.)
Mir war Katharina Rutschky in den 1980er-Jahren als gelegentliche Beiträgerin zu Wagenbachs Freibeuter aufgefallen. Aus traurigem Anlass habe ich in den vergangenen Tagen ihre kurzen, aber hoch konzentrierten Geschichtsbetrachtungen zur Pädagogik noch einmal durchgesehen und bin dabei auch auf einen Text gestoßen, der mich heute naturgemäß sehr interessiert: Die kleine und die große Pause. Eine Anleitung zum Nichtstun oder: Gibt es Grenzen der pädagogischen Vergesellschaftung? (in: Freibeuter. Vierteljahresschrift f. Kultur u. Politik. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 1987, Heft 33, S. 31-42.) Dass sie bei „Ausflügen in den real existierenden Feminismus“ bereits vor zehn Jahren mit Alice Schwarzers neuem Spießertum im gefälschten Gewand der Aufklärung abgerechnet hat, spricht sehr für die geistige Unabhängigkeit dieser Feministin der ersten Stunde, wenngleich ich skeptisch bin, ob sie bei den betroffenen Akteurinnen damit mehr erreicht hat als die Verurteilung als Ketzerin und Nestbeschmutzerin. (Emma und ihre Schwestern. München: Carl Hanser Verlag, 1999.)
Völlig übersehen hatte ich aber bisher, dass Katharina Rutschky auch Autorin eines ganz außergewöhnlichen Buchs über bellende Zweibeiner ist: Der Stadthund. (Von Menschen an der Leine. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 2001.) Ausnahmsweise zitiere ich hier mal den Klappentext: „Wohl wenige Themen sind so sehr geeignet, die Menschheit in zwei Parteien zu spalten, wie die Frage, ob man in der Großstadt einen Hund halten soll. Katharina Rutschky, streitbare Publizistin aus Berlin, ist bekennende Hundehalterin. Mit ihrem Cockerspaniel namens Kupfer flaniert [!] sie täglich durch die Straßen der Hauptstadt. – Eines der geistreichsten und unterhaltsamsten Tierbücher seit langem! Pflichtlektüre für Hundehasser und Hundeliebhaber!“ Naja, die Hundehasser wird man wohl kaum zur Lektüre verpflichten können, ebensowenig wie die Emma-Abonnentinnen zum Lesen des vorgenannten Buches. Andererseits muss man auch nicht wie ich selbst auf den Hund gekommen sein, um großen Gewinn aus diesen Reflexionen einer langjährigen Stadthundehalterin ziehen zu können, und zwar längst nicht nur über die doch sehr speziellen Fragen der Erziehung, Ernährung und Pflege solcher Vierbeiner.
Im Rahmen meines Flaneurblogs ist besonders das 8. Kapitel, „An einem Tag wie jeder andere“, von Interesse. Hier beschreibt Rutschky, wie sie sich in Begleitung von Kupfer – dessen Vorgänger Nickel heiß – durch die Stadtlandschaft bewegt, welche Begegnungen mit Hunden, Fahrrädern, Hundehaltern und Hundelosen dabei vorkommen, welche Verbote dabei zu befolgen sind – oder auch bewusst übertreten werden können, und was dann passiert. Wer dergleichen nie erlebt hat, bekommt einen guten Eindruck davon, wie das Spazierengehen in Gesellschaft des Tieres nicht nur einen völlig anderen Charakter bekommt, andere Prioritäten gesetzt werden und die Wahrnehmung der Wege sich schärft, wohingegen die Fixierung des Ziels gelegentlich in Vergessenheit gerät. Der Leser bekommt auch eine Ahnung davon, wie sich das Zeitempfinden verändert: „Allmählich wird meine Zeit knapp; wenn man als privilegierter Heimarbeiter nämlich nicht über ein hoch entwickeltes Pflichtgefühl verfügt, kann einen jeder Hund mit seiner unerschöpflichen Lust am Streunen und Herumziehen zum Vertrödeln vieler kostbarer Arbeitszeit animieren. Die vorhin erwähnte Regel […], die besagt, dass der Hund unter allen Umständen einen täglichen Anspruch auf sechzig Minuten Ausgang hat, Erde und Wasser inklusive, dient also auch dem Schutz des Menschen vor Verführung. Ich habe mir angewöhnt, nie ohne Armbanduhr mit Kupfer loszuziehen.“ (Ebd., S. 143 f.) Erde und Wasser inklusive? Das heißt, dieser Cockerspaniel will nicht nur auf Pflaster laufen; und Kupfer liebt es, im Wasser zu tollen.
Die wichtigste Erkenntnis lautet darum: Wenn man seinem Hund Gutes tut, tut man in aller Regel auch sich selbst etwas Gutes! Tierhaltung bringt die Rückkehr zu einem „animalischen Egoismus“ mit sich. Vor unseren beiden letzten Umzügen war zum Beispiel die artgerechte Wohnlage für unsere Lola durchaus ein wesentliches Kriterium bei der Wohnungssuche. Dass wir dennoch bis vor einem halben Jahr keinen Wald in fußläufig erreichbarer Nähe hatten und uns mit einem mickrigen Park begnügen mussten, war ein echtes Manko für unseren Hund, aber auch für uns selbst. Indem wir nun die Interessen unserer Hündin in unsere Erwägungen einbezogen, schlossen wir gewisse Objekte von vornherein aus und fanden so schließlich ein neues Heim, das nicht nur hundgerecht, sondern auch uns Menschentieren überaus gemäß ist.
Posted in Bibliotheca Curiosa, Flanerie | Comments Off on Unangeleint
Sunday, 17. January 2010

Die Empfehlung, man solle keiner Statistik vertrauen, die man nicht selbst gefälscht hat, gilt seit Mitte des vorigen Jahrhunderts als fester Bestandteil des Skeptizismus gegenüber den durch Zahlen scheinbar unbezweifelbar gemachten Tatsachenbehauptungen über unsere unüberschaubar vielfältige und sich dazu noch rasend schnell verändernde Welt. Wer den Satz zuerst gedacht, ausgesprochen oder niedergeschrieben hat, das liegt weiterhin im Dunklen, doch deutet einiges darauf hin, dass er im Duell der Titanen moderner Massenmanipulation geboren wurde: Winston Churchill und Joseph Goebbels hatten im Zweiten Weltkrieg die Aufgabe, die Kampfmoral ihrer jeweiligen Völker durch überzeugende Erfolgszahlen hochzuhalten. Da lag ein solcher Satz zur sardonischen Diskreditierung des Gegners geradezu in der bleihaltigen Luft. Gegenüber statistischen Darstellungen der Wirklichkeit ist jedenfalls ein gesundes Misstrauen grundsätzlich am Platze. Die technischen Möglichkeiten zur Verzerrung der Realität im Interesse einer Beeinflussung des Betrachters sind so vielfältig, wie sie nur sein können, wenn sich der erfindungsreiche Menschengeist vor die Aufgabe gestellt sieht, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Aber ebenso wahr ist, dass das trockene Zahlenwerk plötzlich eine entzückende Inspirationskraft entfalten kann, wenn die Statistiker und Infografiker von der Leine interessengeleiterter Auftraggeber gelassen und nur so, zu „Erbauung und Belehrung“, aber mit Esprit und gutem Willen tätig werden dürfen. Zum Jahreswechsel sind gleich zwei handliche Bücher erschienen, die sich, wenngleich auf sehr unterschiedliche Weise, genau dies zur Aufgabe gemacht haben.
Die Welt in Zahlen 2010 von der Wirtschaftszeitschrift brand eins hat ihren Ursprung in einer ständigen Rubrik des seit zehn Jahren monatlich erscheinenden Magazins. Zwei kleine Schönheitsfehler will ich gleich eingangs monieren, um mich sodann den vielen Vorzügen des Buches zuzuwenden. Schon die Rubrik hat sich einen stilistischen Tick zu eigen gemacht, der nun auch im Buch gehäuft auftritt und einem mit der Zeit ganz gehörig auf den Wecker fallen kann: Bandwurmartige Bezeichnungen der nachfolgenden Zahlenwerte werden in voller Länge wiederholt. Ein Beispiel gefällig? „Durchschnittliche Verweildauer bei der Online-Nutzung in Deutschland im Jahr 1998, in Minuten pro Tag: 77 – Durchschnittliche Verweildauer bei der Online-Nutzung in Deutschland im Jahr 2001, in Minuten pro Tag: 107 – Durchschnittliche Verweildauer bei der Online-Nutzung in Deutschland im Jahr 2008, in Minuten pro Tag: 120.“ (brand eins: Die Welt in Zahlen 2010. Statista. Hamburg: brand eins Verlag, 2009, S. 112.) Muss das sein? Die unnötige Verweildauer beim Lesen dieses doch sonst so interessanten Buches hätte sich durch Vermeidung solcher Mätzchen reduzieren lassen. Der zweite Wermutstropfen ist der Preis von 22 Euro für ein Taschenbuch von 250 Seiten.
Dies waren die beiden Wermutstropfen, nun folgt Ambrosia. Ich hätte nicht gedacht, dass Hunde in der Rangfolge der häufigsten Haustiere erst an dritter Stelle kommen, nämlich nach Katzen und Kleintieren. Auch erstaunt mich, welches die beiden mit Abstand häufigsten Farben neu zugelassener Autos im Jahre 2007 waren, nämlich Grau und Schwarz. Dass auf jeden dritten Deutschen eine zugelassene Handfeuerwaffe kommt, jagt mir einen gehörigen Schrecken ein. Seit ich weiß, welches die bei Frauen häufigste aller Operationsarten in deutschen Krankenhäusern ist, nämlich die Rekonstruktion der Geschlechtsorgane nach Dammriss bei der Geburt, frage ich mich, ob die Ausbildung unserer Hebammen reformbedürftig ist. Dass mir kein einziges der zehn umsatzstärksten verschreibungspflichtigen Medikamente wenigstens dem Namen nach bekannt ist, wundert mich ebenso wie der Umstand, dass auf Platz eins dieser Liste mit Risperdal ein Mittel gegen Psychosen steht. Soll es mich mit Mitleid erfüllen, dass 774 Millionen Menschen auf der Welt dieses Buch allen schon deshalb nicht lesen können, weil sie Analphabeten sind? Oder soll ich sie vielmehr beneiden, weil ihnen damit erspart bleibt, die vielen traurigen, erschreckenden und wütend machenden Zahlen in diesem Buch zur Kenntnis nehmen zu müssen? Übrigens hat auch hierzulande jeder fünfte Schüler mittlerweile Probleme mit dem Lösen einfachster Rechenaufgaben. Nach den vier Kapiteln „Was Wirtschaft treibt“, „Was Unternehmern nützt“, „20 Jahre Wiedervereinigung“ und „Was Menschen bewegt“ folgen als besonderes Schmankerl noch einige Seiten mit Prognosen über „Deutschland 2050“. Da werden ein paar Trends des ersten Jahrzehnts in diesem neuen Jahrtausend für die nächsten vierzig Jahre ohne Rücksicht auf Plausibilität extrapoliert. Demnach hätte zum Beispiel die SPD kein einziges Parteimitglied mehr und die Kinopreise lägen bei 9,44 Euro – die allerdings niemand bezahlen würde, denn die Zahl der Kinobesucher betrüge 0,0 Millionen.
Die große Jahresschau – Alles, was 2010 wichtig ist heißt das zweite Buch zur Lage von Welt und Nation. Auch in diesem Fall haben die Autoren, Matthias Stolz und Ole Häntzschel, ihre ersten Meriten mit einer Zeitschriftenrubrik erworben, mit der „Deutschlandkarte“ im ZEITmagazin. Und auch dieses Buch hat leider eine kleine Macke, es verzichtet auf Seitenzahlen. So muss man der Verlagsankündigung glauben, die uns 240 Seiten verspricht. Oder nachzählen, um bestätigt zu finden, dass das Versprechen gehalten wird. Es freut mich schon, dass das Buch nur 12,95 Euro kostet, geradezu begeistert bin ich aber, dass es – ein Taschenbuch! – fadengeheftet ist. Aber das sind Äußerlichkeiten. Der Content, wie man in Neusprech sagt, ist tatsächlich hinreißend. Im Vorwort erklären die Autoren knapp und deutlich, was sie mit diesem Buch versucht haben: „Das wahre Schmuddelkind journalistischer Texte ist die Infografik. Sie leidet von allen Zutaten, die zur journalistischen Veröffentlichung gehören, unter dem schlechtesten Ruf. […] Wir dachten, es sei Zeit, sie einmal aus ihrem Schattendasein zu befreien. Wetten, auch die Infografik hat eine humorvolle und unterhaltsame Seite?“ (Matthias Stolz / Ole Häntzschel: Die große Jahresschau – Alles, was 2010 wichtig ist. München: Knaur, 2010, S. 6 f.)
Naturgemäß kann ich in spröden Worten die mit den visuellen Möglichkeiten der Infografik virtuos spielende Umsetzung von Statistiken nur sehr unzulänglich beschreiben. Ich muss stattdessen auf eine Leseprobe verweisen, die der Verlag freundlicherweise ins Internet gestellt hat – und auf die Großzügigkeit dieses Verlages vertrauen, der es mir hoffentlich nicht übel nimmt, wenn ich eine besonders schöne Grafik hier als Titelbild verwende. Die zunächst etwas überanstrengt wirkende These, dass der sonntägliche Kirchgang in den letzten Jahrzehnten vom Schlachtenbummel auf den Fußballplatz abgelöst wurde, ist wohl noch nie so überzeugend (und dabei tatsächlich auch humorvoll) veranschaulicht worden. Ich bin bekanntlich weder dem einen noch dem anderen Ritual verfallen. Beten und jubeln sind mir gleichermaßen fremd. Aber ich bin noch längst nicht fertig mit der Frage, warum um Himmels Willen eine so schnelle Trendwende von der Kontemplation in die Exaltation erfolgen konnte.
[Titelbild aus dem zuletzt besprochenen Buch, S. 24/25: „Kirche gegen Bundesliga“. – © Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München.]
Posted in Bibliotheca Curiosa, Godzilla, Verzeichnisse | Comments Off on Welt, Zahl und Bild
Thursday, 14. January 2010

Ich habe es immer schon reizvoll gefunden, den Kram, den ich überall mit mir herumtrage, möglichst überschaubar zu halten. Ich meine damit das Zeug, das ich außer meiner Kleidung noch ablege, wenn ich zum Beispiel in die Badewanne steige oder mich zu Bett begebe. Zu diesen wenigen Dingen, so schlicht sie einem anderen auch erscheinen mögen, habe ich eine schon nahezu erotische Beziehung, wenn ich ausnahmsweise die mit Erotik im engeren Verständnis eigentlich gemeinte sinnlich-geistige Anziehung zu einem Menschen einmal auch auf tote Gegenstände übertragen darf. Seit ich keinen Ehering mehr trage, sind dies genau vier Dinge, die ich insofern als meine ständigen Begleiter bezeichnen kann und die ich heute in extenso vorstellen will.
Da wäre zunächst mein Schlüsselbund, bestehend aus einem einfachen Schlüsselring, einem Briefkastenschlüssel und sechs Sicherheitsschlüsseln, die sich zu drei Paaren ordnen lassen. Zwei Schlüssel gehören zu Haus- und Wohnungstür meiner Wohnung, zwei zum Lagerraum meines Versandantiquariats und zwei schließlich zu den Räumlichkeiten, in denen ich seit einiger Zeit einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehe. Die vier Schlüssel mit runder Grifffläche – sagt man so? – habe ich zur besseren Unterscheidung mit farbigen Markierungsringen versehen, die beiden anderen erkenne ich an den aufgeprägten Herstellernamen. Früher trug ich meine Schlüssel zeitweise auch in Lederetuis bei mir, aber die Praxis hat mich gelehrt, dass die nun für den Rest meiner Tage gefundene Lösung die praktikabelste ist, weil die Handhabung der Schlüssel beim Aufschließen der Türen den geringsten Zeitaufwand kostet und auch mit einer Hand immer problemlos möglich ist, wenn die andere anderweitig benötigt wird. Mein Schlüsselbund trage ich stets in der rechten Hosentasche bei mir. Da es immerhin 95 Gramm wiegt, spüre ich beim Verlassen der Räume sofort, wenn es sich dort nicht befindet und ich somit Gefahr laufe, mich auszuschließen.
Zweitens meine Armbanduhr. Es handelt sich um eine Quartzuhr des auf Werbeuhren spezialisierten Herstellers WTC aus der Schweiz vom Typ excellence No. 8811. Vermutlich habe ich sie einmal als Dreingabe zu einem Zeitungsabonnement erhalten, was aber schon sehr lange her sein muss, denn ich kann mich nicht mehr an Einzelheiten erinnern. Die Uhr hat drei Zeiger für Sekunden, Minuten und Stunden, die beiden letzten sind Leuchtzeiger, ob mit Tritium oder Superluminova als Leuchtmasse versehen kann ich nicht sagen. Ab Werk war die Uhr mit einem schwarzen Lederarmband ausgestattet, das ich aber durch ein Metallarmband ersetzt habe. Lederarmbänder werden nach ein, zwei Jahren unansehnlich und brüchig, färben oft in den Sommermonaten durch den Körperschweiß ab, fallen schließlich ganz auseinander, kurz: sind verschleißanfällig, während sich mein Metallarmband als geradezu unverwüstlich erwiesen hat. Das Zifferblatt ist erfreulicherweise schlicht weiß, ohne Stunden- und Minutenstriche, ohne Zahlen, ohne Firmennamen. Lediglich auf dem Gehäuserand sind die Zahlen von 5 bis 60 für die Sekunden in Fünferschritten eingraviert und entsprechen somit auch den Stundenschritten. Eine Datumsanzeige gibt es nicht, was mich ebenfalls für diese Uhr einnimmt, denn ich möchte mein Gehirn nicht von der Aufgabe entbinden, täglich das korrekte Datum und den Wochentag abrufbar zu halten. Mit solchen tückischen Bequemlichkeiten fängt sie ja an, die allmähliche Verabschiedung unserer Geisteskräfte, die schließlich in Demenz mündet. Die Uhr geht zuverlässig genau und muss nicht aufgezogen werden, da sie batteriebetrieben ist. Gerade vor ein paar Tagen war die Batterie wieder einmal leer und musste erneuert werden, was einiges Geschick erfordert. Diese spezielle Knopfzelle kostet zurzeit sechs Euro beim Uhrmacher und hält die Uhr wohl mehrere Jahre am Laufen. Meine Uhr bringt mit Armband 65 Gramm auf die Waage.
Seit meinem fünfzehnten Lebensjahr bin ich kurzsichtig und auf eine Brille angewiesen. Somit ist dies der dritte Gegenstand, den ich ständig am Leib trage. Zum Lesen nahm ich meine Brille bis vor ein paar Jahren immer ab, dann ließ ich mich dazu überreden, es einmal mit den neuen Gleitsichtgläsern zu probieren. Ich gewöhnte mich schnell daran, musste aber nach einiger Zeit feststellen, dass die Augen sich wohl etwas verschlechtert hatten. Jedenfalls klappte es mit dem Lesen durch die Brille nicht mehr so richtig und ich setzte sie dazu ab oder schob sie auf die Nasenspitze, was auf Dauer doch etwas lästig wurde. Also beschloss ich eine Neuanschaffung, obwohl das alte Gestell so alt noch gar nicht war. Der Zufall wollte es, dass mir gleichzeitig ein paar alte Fotos in die Hände fielen, auf denen ich als Achtzehnjähriger mit meiner damaligen kreisrunden Nickelbrille zu sehen war. ,So eine hätte ich gern wieder‘, dachte ich in einer nostalgischen Anwandlung, musste aber bald feststellen, dass die gegenwärtige Brillenmode ganz andere Modelle favorisiert: schmal und rechteckig! Im Sommer vorigen Jahres war ich für ein paar Tage in Berlin und entdeckte bei einer Kreuzberger Brillenwerkstatt tatsächlich eine kreisrunde Brille nach meinem Geschmack. Allerdings sollte sie ein kleines Vermögen kosten und ich konnte mich zu dieser Investition nicht so bald durchringen. Wenig später sah ich bei einem Optiker in meiner Heimatstadt ein nahezu rundes Modell im Fenster liegen, das nur ein Drittel kostete und noch schlichter war. Es ist aus Titan, heißt Key West 1 und wiegt mit Gläsern genau zwanzig Gramm.
Zuletzt zu meinem größten, schwersten und in gewisser Weise auch wertvollsten Begleiter, meiner Geldbörse. Dieses Modell habe ich vor ein paar Jahren an einem Stand des hiesigen Weihnachtsmarktes entdeckt. Das schwarze Lederportemonnaie ist mit seinen Fächern und Taschen ideal für meine Bedürfnisse geeignet, passt bequem in dir rechte Gesäßtasche meiner Hosen und ist so strapazierfähig, dass ich es nur alle zwei, drei Jahre durch ein neues Exemplar ersetzen muss. Die Fächer für die Kreditkarten reichen aus für meine beiden EC-Karten, meine Krankenkassenkarte, den Ausweis der Stadtbibliothek, den Organspenderausweis und die Abo-Servicecard der Süddeutschen Zeitung. Weitere, ausklappbare Hüllen mit Klarsichtfenstern enthalten meinen Personal- und meinen Schwerbehindertenausweis mit dem Beiblatt des Versorgungsamtes, welch letztere Dokumente ich immer bei mir tragen muss, um die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen zu dürfen. Sodann gibt es natürlich ein Fach für Münzgeld, das sogar mit einem kleinen Extra-Täschchen für den Einkaufswagen-Chip versehen ist, sowie zwei Fächer für Banknoten, von denen ich nur das vordere für Geldscheine nutze, während ich im hinteren Kassenbons und Quittungen sammle. Auch ein paar meiner Visitenkarten finden hinter meinem Personalausweis noch Platz. Je nach Füllung wiegt mein Geldbeutel um 200 Gramm. – Das wär’s an persönlichen Habseligkeiten, was man an mir fände, wenn ich irgendwo unterwegs das Zeitliche segnete.
Posted in Dingwelt, Würfelwürfe | 2 Comments »
Tuesday, 12. January 2010

Dass die neuen und neuesten Medien geradezu unvermeidlich, quasi aus ihrer technischen Zurichtung heraus zu einer Beschleunigung von Wahrnehmung und Kommunikation zwingen; dass die mit ihrer Hilfe fabrizierten und transportierten Mitteilungen immer kürzer und immer flüchtiger, ihr Rhythmus immer stakkatohafter, ihr Inhalt infolge davon immer dünner, „oberflächlicher“ werden müsse – das habe ich immer schon bezweifelt. Ein solcher Fatalismus befreit den einzelnen Menschen, der heute und in diesem Zusammenhang „User“ genannt wird, von der Verantwortung für den individuellen Gebrauch der Werkzeuge, die ihm die Technik liefert. Dass eine Mitteilungsmöglichkeit wie das Weblog im Internet dazu verführt, fehlerhafte, gedankenlose, hässliche und überflüssige Beiträge zu veröffentlichen, ist nicht zu bestreiten; ebensowenig aber, dass jeder, der dieser Verführung nicht widersteht – was ja sehr wohl möglich wäre –, die persönliche Verantwortung für das Ergebnis trägt.
Als ich vor fast drei Jahren mit der Bloggerei begann, stellte ich an mein Geschriebenes die gleichen Ansprüche, an denen ich mich bei meinen gedruckten Texten, ja selbst bei meiner Produktion für die Schublade orientiert hatte. Offenbar hielten meine Kollegen bei Westropolis solche Ansprüche für völlig inadäquat diesem Medium gegenüber und machten sich das Leben viel leichter als ich. Ihre größtenteils schludrige Ex-und-hopp-Arbeitsweise deklarierten sie als trés chique und zeitgemäß, so sie sich denn überhaupt noch einen Rest von journalistischem Qualitätsbewusstsein bewahrt hatten; und ihre Leser waren offenbar nichts besseres gewöhnt. Mit einer von ihnen geriet ich darob bald so über Kreuz, dass für beide von uns zweien kein Platz mehr an Bord war. Interessanterweise hat sie mittlerweile aber auch längst diesen dümpelnden Seelenverkäufer verlassen und sogar ihr eigenes Blog nahezu aufgegeben, weil ihr wohl selbst der minimale Arbeitsaufwand ihres Schluderbloggens noch viel zu groß war. Für Menschen wie sie wurde Twitter erfunden – und wir ernsthaften Blogger dürfen hoffen, dass irgendwann alle zu artikulierteren Mitteilungen unfähigen Texter in dieses ebenso unverbindliche wie anspruchslose Reich des Gezwitschers abgezogen sein werden.
Eine noch kleine, aber desto feinere Elite der internationalen Bloggerszene hat sich längst zu qualitativen Idealen bekannt und verweigert sich konsequent der besinnungslosen Hektik, mit der im Internet aus tausend Rohren mit feuchter Munition auf Spatzen geschossen wird. So hat Todd Sieling ein Slow-Blog-Manifesto veröffentlicht, das ich hier in meiner eigenen (freien) Übersetzung wiedergebe:
[I] Slow-Blogging bedeutet Verweigerung von Unmittelbarkeit. Es beruht auf der Einsicht, dass nicht alles Lesenswerte schnell geschrieben wurde, dass viele Gedanken am besten erst in ausgegorenem Zustand aufgetischt werden sollten und dass es ihnen gut bekommt, wenn dies in wohltemperierter Stimmung geschieht. [II] Slow-Blogging ist wie Zungenreden, als ob die Pixel den Worten eine kostbare und außergewöhnliche Form verliehen. Es setzt die Bereitschaft voraus, Geschehnisse unkommentiert zu lassen. Seine Gangart ist gemessen, sein gemächliches Schreiten lässt sich nicht durch Ereignisse stören, die alles andere als echte Notfälle sind; und möglicherweise nicht einmal durch solche, denn Langsamkeit ist nicht die angemessene Geschwindigkeit für die meisten Notfälle. Im Notfall werden stattdessen Orte bevorzugt, an denen ein beruhigendes Tempo den Tageslauf bestimmt. Solche lauschigen Orte dienen uns in dieser Lage am besten. [III] Slow-Blogging kehrt jenen Auflösungsprozess um, an dessen Ende nurmehr Einzeiler und verknappte Phrasen stehen, welche doch meist nur unsere Ideen im frühesten Zustand ihres Entstehens widerspiegeln. Dabei leuchten Gedankenblitze auf und verblassen wieder, um ihren Platz im Hintergrund von etwas Größerem einzunehmen. Slow-Blogging kritzelt keine Gedanken auf das ätherische und ewigwährende Transparent, die noch keinen bleibenden Wert in Gestalt zeitloser Ideen erlangt haben. [IV] Slow-Blogging lässt sich darauf ein, die alltäglichen Empörungen und Begeisterungen mit Schweigen zu übergehen, die doch keinen anderen Zweck erfüllen, als die Leere einzelner Augenblicke auszufüllen, durch ein Umherhüpfen zwischen Banalitäten, Herzschmerzschmalz und Apokalypsekitsch-Psychose, und dies alles bloß in den Lücken zwischen den Schlagzeilen. Was immer du in einem bestimmten Augenblick in der vergangenen Woche sagen wolltest, du kannst es auch noch im kommenden Monat oder im nächsten Jahr sagen und wirst dann nur als desto geistreicher erscheinen. [V] Slow-Blogging ist die Antwort auf PageRank und dessen Ablehnung. PageRank: dieses hässlich-hübsche Monstrum, das sich hinter den vielfach gefältelten Vorhängen von Google verbirgt und über Ansehen und Relevanz der Suchergebnisse entscheidet. Blogge zeitig und reichlich, dann wird Google es dir danken. Konditioniere dein kreatives Selbst auf die geheimnisvolle Frequenz, und du wirst von Google gehätschelt; du wirst dort erscheinen, wo jeder hinblickt – bei den ersten paar Seiten der Suchergebnisse. Folgst du aber deiner eigenen Gangart, so wirst du deine Werke niemals wiederfinden. Verweigere dich dem PageRank, und schon verschwinden deine Werke. Wie von einem Strudel werden sie in die Abgründe unspezifischer Ergebnisse hinabgesaugt. Sein verzerrtes Ideal vom Gemeinwohl hat PageRank zu einem furchteinflößenden Gegner der Gemeinschaft gemacht, der eine Gangart vorgibt, die jede doch so nötige Reflektion unmöglich macht; nötig nämlich für einen Fortschritt über den Tag hinaus und hin zu einem Testament. [VI] Slow-Blogging ist die Wiedereinsetzung der Maschine als Medium menschlicher Äußerungen, statt wie zuletzt nur noch deren Peitsche und Container zu sein. Damit wird das Hamsterrad freiwillig angehalten, das mit Lichtgeschwindigkeit rotiert, wie’s die Regeln des effektiven Bloggens vorschreiben. So werden künftig asynchrone Zeitverhältnisse eingesetzt – worauf wir nicht mehr schneller und immer noch schneller drauflostippen, um mit dem Computer Schritt zu halten; worauf das Tempo der Regeneration nicht die gleiche Gangart erzwingt wie der Konsum; und worauf gute und schlechte Werke in ihrer je eigenen Zeit geschaffen werden.
Solche zaghaften Deklarationen gegen den übermächtigen Trend der Beschleunigung machen mir Mut. Es weiß zwar noch kaum einer, aber wir Slowblogger sind tatsächlich die Speerspitze eines ganz neuen, revolutionären Verhältnisses zur Kreativität in den Neuen Medien.
Posted in Langsamkeit, Würfelwürfe | 3 Comments »
Monday, 11. January 2010

Am Samstag war das Wetter tatsächlich so ruppig, dass wir die Fahrt mit Bus und Bahn zur Zeche Zollverein nicht riskierten. Im Radio war zu hören, dass zahlreiche Schaulustige am frühen Nachmittag noch gar nicht aufs Gelände kamen. Höchste Sicherheitsstufe für die prominenten Gäste des Open-Air-Festaktes! Während das Schneetreiben kein Ende nehmen wollte, verging uns die Vorfreude auf eine Expedition nach Katernberg mehr und mehr. Hin würde man ja noch irgendwie gelangen, aber dann dort mit der Angst im Nacken rumzulaufen, dass wir spät in der Nacht nicht mehr heimkämen, das schien uns doch auf unsere alten Tage etwas zu strapaziös.
Mit desto besserer Laune machten wir uns dann heute auf den Weg. Es hatte endlich aufgehört zu schneien, und auch der scharfe Wind hatte sich gelegt. An der U-Bahn-Haltestelle Martinstraße warteten wir eine Viertelstunde, bis die Kulturlinie 107 schließlich kam, die ja laut Ankündigung im 7,5-Minuten-Takt verkehren sollte. Wir konnten uns so gerade noch reinquetschen und hatten bis Zollverein dann warme Stehplätze. Festzuhalten brauchte man sich nicht, denn zum Umfallen fehlte es entschieden am nötigen Raum. Aber es ist ja erfreulich, dass die Kulturhauptstadt RUHR.2010 gleich auf Anhieb solchen Zuspruch findet! Die frustrierten Gesichter der Zusteigewilligen an den diversen Haltestellen auf der Fahrt in den Essener Norden waren bilderbuchreif, die Türen blieben zu. Gern hätte ich ein paar Fotos gemacht, aber ich traute mich nicht, in dem Gedränge meine Kamera aus der Tasche zu holen. Die Mäkeleien mancher Fahrgäste, die dieses Chaos nun wieder typisch für den Essener ÖPNV fanden, ließen wir nahezu unkommentiert. Als aber eine besonders zickige Dame wissen wollte, warum man denn nicht einfach mal doppelt so viele Straßenbahnen eingesetzt habe, konnte ich meinen frechen Schnabel nicht mehr halten: „Ganz einfach: Weil die dafür nötigen Straßenbahnfahrer noch in der Ausbildung sind.“
Am Eingang zum Zollverein-Gelände wurden wir dann mit den bei der Vorbereitung so sehr entbehrten Programm-Foldern zum Kulturfest „Glück Auf 2010!“ geradezu überschüttet. Mittlerweile hatten wir aber längst eingesehen, dass wir selbst beim besten Willen keinen auch nur halbwegs vollständiges Bild von diesem gigantischen Programm würden gewinnen können. So beschränkten wir uns darauf, wenigstens eine große Attraktion, das heute neu eröffnete Ruhrmuseum, genauer in Augenschein zu nehmen und uns anschließend nur noch vom Zufall treiben zu lassen. Wir reihten uns in eine lange Schlange ein, und als wir den Eingang erreicht hatten, hieß es, wir müssten im Vorraum unsere Garderobe abgeben und würden dann eine Plakette mit einer Nummer erhalten. Wir taten wie befohlen, meine Plakette hatte die Nummer 4647. Nun betraten wir das große gläserne Zelt, eher eine Art Gewächshaus, das eigens für die Eröffnung des Ruhrmuseums vor der Kohlenwäsche aufgebaut worden war. Dort musizierte auf einer kreisrunden Bühne ein Jazztrio und man konnte an langen Tischen Platz nehmen und Kuchen essen oder an Stehtischen Bier trinken. Eine weitere Schlange lud uns dazu ein, ihr vorläufiges Ende zu bilden, aber wir stellten verwundert fest, dass wir zu einer kleinen Minderheit gehörten, die sich brav ihrer Garderobe entledigt hatten. Die überwiegende Mehrheit der Besucher standen dort in Mänteln, Jacken und Mützen. Da wir jetzt schon mit den Zähnen klapperten, gingen wir zurück in den Vorraum und erbaten unsere Garderobe, die wir von der wirklich sehr verständnisvollen Gardrobiere nun auch anstandslos zurückbekamen. Sie wisse auch nicht, was das solle. Nachdem wir diese kleinen Hemmnisse überwunden hatten, gelangten wir schließlich auf die berühmte lange Rolltreppe [s. Titelbild], die uns auf die Eingangsebene in 24 Meter Höhe beförderte. Die verschiedenen Etagen des Museums sind nämlich nicht wie sonst üblich durchnummeriert, sondern mit ihren Meter-Höhen bezeichnet. Die 17 m-Ebene trägt den Titel „Gegenwart“, die 12 m-Ebene heißt „Gedächtnis“ und die 6 m-Ebene „Geschichte“. Wir hatten sehr schnell erkannt, dass die Dimensionen dieser neuen Ausstellung viel zu riesenhaft sind, als dass man sie bei einem einzigen Tagesbesuch ausmessen könnte. Also begnügten wir uns damit, hier und da auf allen Ebenen ein paar Stippvisiten zu machen und einen allerersten Gesamteindruck zu gewinnen. Um es rundheraus zu bekennen: Wir waren auf Anhieb vollauf begeistert von dieser Präsentation! Erstens ist die Kulisse, die das Industriegebäude mit seinen unverändert belassenen „Innereien“ dieser Ausstellung bietet, schon für sich ein sinnliches Faszinosum erster Güte. Wie es nun aber zweitens den Ausstellungsmachern gelungen ist, die so vielgestaltigen und teils geradezu filigranen Exponate vor diesem grobschlächtigen Hintergrund zur Geltung zu bringen, das ist ein kleines Wunder.
Auf der 17 m-Ebene entdeckte ich auch bald meinen vorläufig Favoriten, den Ausstellungsteil „Zeitzeichen“: Quadratische Glasvitrinen in weißen Säulen beherbergen 30 Objekte der kollektiven Erinnerung und 30 Objekte der Naturzeit. In besonderer Erinnerung geblieben sind mir der selbstgebastelte Adventskalender aus Streichholzschachteln und die präparierte Staublunge eines Bergmanns. Ich bedauere sehr, dass nicht alle 60 Exponate dieses Bereichs im ansonsten reichhaltigen, prachtvollen und lesenswerten Katalog reproduziert und kommentiert werden. (Vgl. Ruhr Museum. Natur. Kultur. Geschichte. Hrsg. v. Ulrich Borsdorf u. Heinrich Theodor Grütter. Essen: Klartext Verlag, 2010, S. 158-169.) Gerade die Beliebigkeit der Auswahl führt zu wunderbaren Interferenzen der disparaten Gegenstände in der Phantasie des Betrachters. Ich könnte mir vorstellen, dass die Vitrinen in größerem zeitlichen Abstand mit anderen Inhalten befüllt werden, damit so diese wunderbare Museumsbühne immer wieder einmal neu bespielt wird und zu neuen Entdeckungen einlädt.
Vorläufiges Fazit: Das Ruhrmuseum – das sich übrigens leider, einem modischen Manierismus folgend, offiziell Ruhr Museum schreibt – lohnt sicher mehr als nur einen Besuch. Zur Eröffnung war der Eintritt frei, zukünftig hat der Erwachsene 6 Euro zu zahlen, für die ihm aber weitaus mehr geboten wird als in … nein, das sage ich jetzt nicht.
Posted in Kulturflanerie | Comments Off on Ruhrmuseum
Friday, 08. January 2010

Am bevorstehenden Wochenende steigt also die große Eröffnungsparty auf Zollverein – vorausgesetzt, das Wetter macht den Organisatoren keinen dicken Strich durch die Rechnung. Ich reagiere ja üblicherweise allergisch, wenn ich bei Kulturveranstaltungen, zum Beispiel bei Museumsbesuchen vor abstrakten Ödnissen à la Homage to the Square, benachbarte Kunstkenner das Modewort „spannend“ raunen höre. Aber in diesem Falle ist Höchstspannung wirklich der passende Ausdruck zur Bezeichnung unserer Stimmung, in Erwartung dieses Mega-Events. Schon jetzt wird deutlich, dass das Kulturhauptstadtjahr im Revier polemisch von zwei großen Chören in den Weblog-Kommentarspalten begleitet werden wird: dem Chor der Nörgler und dem der Schönredner.
Die Nörgler fragen sich, warum eine solche Veranstaltung ausgerechnet in der kalten Jahreszeit stattfinden muss, und dann noch größtenteils im Freien. Gibt es denn keine ausreichend großen Hallen? Offenbar nicht. Da sieht man mal wieder, was passiert, wenn man am falschen Ende spart und der Fußballverein Rot-Weiß Essen immer noch kein neues, überdachtes Stadion hat. Und offenbar hatten die Krawattenträger in den klimatisierten Planungsbüros nicht genug Phantasie, sich einen harschen Wintertag auszumalen, als sie die Weichen für diesen Wahnsinn stellten. Jetzt sollen sich doch die Herren und Damen Köhler und Barroso morgen den Po verkühlen, da waren die Kumpel im Pütt ganz andere Verhältnisse gewöhnt. Aber dass noch nicht mal genug Streusalz eingekauft wurde zum Kulturhauptstadtwinter, das ist mal wieder typisch! – So stänkern die Nörgler.
Die Schönredner geben zu bedenken, dass in unserer Hemisphäre schließlich jedes Jahr mit der kalten Jahreszeit beginnt und auch im Kulturhauptstadt-Jahr der Januar nicht in den Hochsommer fällt. In den vergangenen Jahren fielen die Winter allesamt außergewöhnlich mild aus. Dass jetzt ausgerechnet zum Eröffnungswochenende bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen sollen, ist zwar nicht nett vom Petrus. Aber vielleicht wird diese Massenveranstaltung ja gerade deshalb besonders gut gelingen, weil sich ein Teil jener Massen durch die Wetterprognosen abschrecken lässt und den wetterfesten Fans das Gedränge im befürchteten „Polackenflachrennen“ dadurch erspart bleibt. Außerdem gibt es doch genügend Gelegenheiten, sich ins Warme zu flüchten. Die Hallen 2, 5, 9 und 12, das SAANA-Haus, Salzlager und Mischanlage Kokerei, Oktogon, PACT Zollverein öffnen allesamt am späten Nachmittag ihre Pforten und werden gewiss nicht ganz ungeheizt sein. – So frohlocken die Schönredner.
Was mich betrifft, so weigere ich mich hartnäckig und konsequent, ungelegte Eier zu kommentieren. Die Veranstaltung findet morgen und übermorgen statt, bis dahin halte ich mich zurück. Anfang der Woche werde ich dann von meinen Erfahrungen und Erlebnissen berichten, so ich denn zum Zollverein-Gelände durchkomme und nicht unterwegs in einer Schneeverwehung steckenbleibe.
Eins muss ich aber doch schon vorab loswerden. Die Verteilung des Programmheftes zum Eröffnungsfest ließ doch sehr zu wünschen übrig! Meine erste Anlaufstelle war gestern die Touristikzentrale der Essen Marketing Gesellschaft (EMG) am Essener Handelshof. Dort las ich auf einem Zettel an der verschlossenen Tür sinngemäß: ,Die Touristikzentrale ist vom 21. Dezember 2009 bis zum 10. Januar 2010 wegen Umbau geschlossen. Im Foyer des Hotels Maritim nebenan gibt es in dieser Zeit einen Infotisch mit individueller Beratung.‘ Das Programm erhielt ich dort allerdings auch nicht, sondern nur den Tipp, es sei der WAZ beigelegt. Ausnahmsweise kaufte ich mir also zähneknirschend dieses Blatt, aber die 1,20 € hätte ich mir sparen können. Das volle Programm nennt sich vollmundig die äußerst dürftige Kurzübersicht, die dort auf einer einzigen Seite abgedruckt ist. Dabei gibt es doch im Internet ein 26-seitiges, farbenfrohes Programmheft als PDF zum Download, das keine Wünsche offen lässt. Sollte das tatsächlich nicht in gedruckter Form erhältlich sein? Da ich ohnehin noch einen Gang zur benachbarten Stadtbibliothek vor mir hatte, vertraute ich darauf, dass in dieser Kultureinrichtung wohl gewiss ein großer Tisch mit allen Prospekten und Broschüren zur Kulturhauptstadt RUHR.2010 auf mich warten würde. Wieder Fehlanzeige! „Eigentlich ein Armutszeugnis,“ bekannte ein freundlicher Bibliotheksmitarbeiter. Ob nun seitens der Bibliothek oder des Kulturhauptstadt-Büros, das ließen wir höflich offen. Ich bin gespannt, ob die Programmhefte morgen wenigstens vor Ort auf Zollverein ausliegen.
Posted in Kulturflanerie | 1 Comment »
Wednesday, 06. January 2010

Da ich mittlerweile auch langsam ins Sachdochmalschnell-Alter hinüberrutsche, also in jene gerade für einen Schreibwerker verstörende Übergangsphase, in der man sich die gelegentlichen Wortfindungsstörungen noch mit allerlei kurzfristigen Irritationen und Ablenkungen plausibel zu machen versucht, interessieren mich alle Arten von Gedächtnisausfällen, sowohl akute wie chronische Amnesien, Verwechslungen, Fehlleistungen, bis hin zu Berichten über katastrophales Totalversagen des Gedächtnisses, sowie die gegen dergleichen aufgebauten Eselsbrücken, Hirntrainingsprogramme und logopädischen Therapien. So ist zu erklären, warum ich in den vergangenen Tagen die Autobiographie eines Autors mit wachsender Anteilnahme gelesen habe, der mich als Dramatiker und Satiriker bisher wenig bis gar nicht interessiert hat: Balthasar von Sławomir Mrożek. (A. d. Poln. v. Marta Kijowska. Zürich: Diogenes Verlag, 2007.)
Der Pole Mrożek (* 1930) erlitt am Vormittag des 15. Mai 2002 an seinem Schreibtisch in Krakau einen Gehirnschlag, der zu einem völligen Verlust seiner Sprache führte. Die Aphasie war so total, dass er sogar seinen eigenen Namen ablegte und sich seither mit Bezug auf einen bedeutsamen Traum Balthasar nennt: „Im Dezember 2003 hielt ich mich kurz in Paris auf. Wir wohnten in einem geräumigen Appartement im vierten Stock eines Hauses an der Rue Guynemer, gegenüber des Jardin du Luxembourg. Diese Umstände können wichtig sein im Hinblick auf den Traum, den ich damals hatte. – Ich träumte, daß mein Vor- und Familienname auf einem amtlichen Schreiben auf polnisch gedruckt waren. Die Buchstaben, an die ich mich sehr genau erinnere, stammten von einem Computerdrucker. Gleichzeitig hörte ich eine Stimme, die quasi aus dem Nichts kam. Die Stimme sagte, daß ich bald eine weite Auslandsreise antreten würde. Das beigefügte Dokument würde ich mitnehmen und nach meiner Ankunft den dortigen Behörden vorlegen. Sie würden daraufhin jede meiner Forderung[en] erfüllen, unter der Bedingung, daß ich nie wieder meinen echten Vor- und Nachnamen benutzte. Mein neuer Name sollte Balthasar lauten. – Als ich aufwachte, stand ich stark unter dem Eindruck dieses Traums. Balthasar… Ich war noch nie ein Enthusiast meines Familiennamens gewesen. Er begleitete mich immer als eine langweilige Notwendigkeit. Später, als ich anfing zu schreiben, behielt ich ihn aus Rücksicht auf meinen Vater. Bis zu dem Moment, in dem ich von der Aphasie heimgesucht wurde.“ (Ebd., S. 363 f.) Mit der Unterstützung seiner Logopädin, Beata Mikołajko, gelang es Mrożek, seine Sprachbeherrschung und damit auch sein verbalisierbares Gedächtnis zurückzuerobern, wenngleich nur in seiner Muttersprache, dem Polnischen. Die Sprachen seiner verschiedenen Exile, in Frankreich und zuletzt in Mexiko, blieben unrettbar verloren.
Die Autobiographie, die mit diesem traurigen Ereignis endet, ist zunächst Teil der Therapie und genügt sich insofern selbst. Erst in zweiter Linie zielt das Buch auf ein Leserinteresse, und ob es ernsthaft eine ästhetische oder politische Relevanz beansprucht, bleibt sogar fraglich. Die wenigen Kritiken, die in Deutschland nach dem Erscheinen von Balthasar zu lesen waren, gehen sehr rücksichtsvoll mit dem Autor um, nennen ihn den auch international erfolgreichsten Dramatiker Polens nach dem Zweiten Weltkrieg und erwähnen, dass auch seine absurden Satiren in Kurzprosa über den Alltag unter einem totalitären Regime zu ihrer Zeit viel besprochen und gepriesen waren. Das klingt stellenweise fast so, als hätte Sławomir Mrożek durchaus Chancen gehabt, den Nobelpreis für Literatur wieder einmal nach Polen zu holen, wären ihm nicht 1980 Czesław Miłosz und 1996 Wisława Szymborska zuvorgekommen. Auch werden Dramatiker bekanntlich selten prämiert, nach Beckett 1969 waren Harold Pinter und Dario Fo die einzigen, die den Nobelpreis zugesprochen bekamen. Aber was folgt daraus? Allenfalls, dass es nicht viel bedeutet hätte, Mrożek in Stockholm im Frack zu sehen.
Nun also hat er im Alter noch einmal etwas ganz anderes versucht. Der Gegenstand seines Spottes, die Wurzel seiner Verbitterung, der Quell seiner Ängste: die stalinistische Diktatur, sie existiert ja schließlich längst nicht mehr. Insofern war sein literarisches Aufbegehren in den vier Jahrzehnten von 1950 bis 1990 längst gegenstandslos geworden. Tatsächlich kam seine literarische Produktivität Anfang der 1990er-Jahre vollständig zum Erliegen. Und dann löscht der Hirnschlag auch die Erinnerung, soweit sie sich im Sprachzentrum abgelagert hatte, vollständig aus, der Speicherinhalt ist gelöscht. Aber Balthasar, wie das Wesen jetzt heißt, gibt nicht auf. In jahrelanger mühseliger Anstrengung erobert es sich immerhin eine verständliche, zusammenhängende, erzählbare Geschichte von der eigenen Person zurück.
Die Erzählung verblüfft durch akribische Schilderungen konkreter Situationen, Begegnungen, Erlebnisse, die wie durch ein Vergrößerungsglas und in Zeitlupe betrachtet werden. Und noch etwas fällt auf: Die frühesten Kindheitserinnerungen erscheinen am deutlichsten vor dem inneren Auge des Lesers, während die Präzision und Ausführlichkeit immer mehr abnimmt, je näher die Gegenwart rückt. Bekanntlich ist das Leben für das subjektive Zeitempfinden ja mit Erreichen des Erwachsenenalters zur Hälfte abgelaufen, ganz gleich, welch biblisches Alter man immer erreicht. Dieser Gesetzmäßigkeit scheint die Darstellungsweise des Buches Rechnung zu tragen, das sich ja ausdrücklich Autobiographie nennt und insofern den Anspruch erhebt, ein ganzes Leben in wohl bedachten Proportionen abzubilden. Eben habe ich ein paar von Mrożeks Satiren gelesen (aus: Striptease. A. d. Poln. v. Ludwig Zimmerer. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1965). Ich sehe auch, dass er eine Schach-Geschichte geschrieben hat, ein Thema, das mich prinzipiell interessiert. Aber ich habe ausreichenden Grund zu der Annahme, dass Balthasar das einzige seiner Werke ist, das in fünfzig Jahren noch verdient, gelesen zu werden. Das Thema Kommunismus hat keine Zukunft mehr, das Thema Aphasie hingegen ist mächtig im Kommen.
[Titelbild aus dem besprochenen Buch: Der kleine Sławomir Mrożek mit seinem Hund Mars.]
Posted in Memento | Comments Off on Balthasar
Friday, 01. January 2010

Kalendarisch beginnt heute also das Kulturhauptstadt-Jahr in der Stadt Essen und im Ruhrgebiet. Offiziell gibt es am Samstag, 9. und Sonntag, 10. Januar 2010 zum Auftakt ein erstes Mega-Event auf Zollverein. Neben dem offiziellen Eröffnungs-Festakt mit über tausend prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und der Einweihung des Ruhrmuseums findet für die 100.000 geschätzten “einfachen” Besucher an diesem Wochenende ein geradezu erdrückendes Veranstaltungsaprogramm in den Hallen und auf dem Außengelände statt.
Ich habe lange darüber nachgedacht, welche Beobachtungsposition ich gegenüber diesem Spektakel in meiner Heimatstadt und -region beziehen soll. Als ich vor zwei Jahren notgedrungen über eine berufliche Neuorientierung nachdenken musste, habe ich für ein Weilchen erwogen, das Angebot befristeter Stellen im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt abzugrasen. Mir wurde aber nur allzu bald klar, dass ich aus verschiedenen Gründen (nicht jung, nicht billig, nicht flexibel, nicht mobil) auf diesem Felde völlig chancenlos war. Auch mein kritisches Engagement als Blogger bei Westropolis 2007/08 zielte anfangs auf dieses Hauptthema, die Kommentierung der Vorbereitung und Durchführung des Kulturhauptstadt-Jahres 2010 im Ruhrgebiet. Aus dieser Zeit ist mir nicht viel mehr als mein Nickname ,Revierflaneur‘ geblieben. Schon in dieser frühen Phase der Projektmodellierung durch die RUHR.2010 GmbH und das Kulturhauptstadt-Büro unter Dr. h.c. Fritz Pleitgen und Prof. Dr. Oliver Scheytt wuchsen sich aber meine Störgefühle gegenüber der Seelenlosigkeit und Kommerzialität des ganzen Unternehmens zu so starken Vorbehalten aus, dass ich beschloss, mich vorläufig wieder in eine größtmögliche Distanz zu begeben, zumal ich auf meine Kritik hin immer wieder den Satz hörte: „Nun warte doch erst mal ab!“
Wie es mir in die Wiege gelegt ist, geradezu naturgemäß erwuchs meine Abneigung gegen das Unternehmen aus dem kakophonen Sprachgedöns, das es allenthalben umrankte, überwucherte, verstellte, ursprünglich wohl, um dessen Ärmlichkeiten und Widersprüche notdürftig zu verhüllen. Meine Erfahrungen in der Marketing- und Kommunikationsbranche haben mich zusätzlich skeptisch gemacht für die Ergebnisse jener obligatorischen Brainstormings in den Agenturen, die sich bei näherer Betrachtung oft genug bloß als Sturm im Wasserglas erweisen – und ihr Ergebnis bestenfalls als heiße, öfter noch als lauwarme Luft.
„Mythos Ruhr begreifen!“ – „Metropole gestalten!“ – „Bilder entdecken!“ – „Theater wagen!“ – „Musik leben!“ – „Sprache erfahren!“ – „Kreativwirtschaft stärken!“ – „Feste feiern!“ – „Europa bewegen!“ So lautet zum Beispiel eine dieser unsäglichen Schlagwortkaskaden, bei denen sich mir die Nackenhaare sträuben und ich den Stoßseufzer gen Himmel schicken möchte, dass er uns doch vor solchen Quatschköpfen beschützen möge. Sinn der Übung war wohl, Ordnung ins Chaos des unüberschaubaren Angebots zu bringen. Aber schon die Beliebigkeit, mit der diese Wortpaare zusammengestellt wurden, macht diese Absicht zunichte. „Mythos Ruhr erleben!“ – „Metropole entdecken!“ – „Bilder wagen!“ – „Theater leben!“ – „Musik gestalten!“ – „Kreativwirtschaft bewegen!“ –„Europa stärken!“ Das passt mindestens genauso gut, vielleicht besser. Einzig dass man Feste feiert, ist aus den Begriffen selbst heraus evident und passt deshalb nicht zu den übrigen, gewollt originell wirkenden Kombinationen. Und was bleibt? „Sprache begreifen!“ Damit hätten die schwächlichen Kreativwirtschaftler besser mal beginnen sollen.
Nun denn, jetzt geht der Rummel los, und die Zeit des Abwartens und der vornehmen Zurückhaltung hat damit für mich ihr Ende. Meine Beobachtungsposition ist die der größtmöglichen Unabhängigkeit. Ich bin mit den Verantwortlichen auf keine noch so indirekte Weise verbandelt und verbinde nicht das geringste wirtschaftliche Interesse mit meiner Anteilnahme an den Veranstaltungen, über die ich berichten und urteilen werde. Mit gutem Willen werde ich mich bemühen, meine hier vorab eingestandenen Vorurteile selbstkritisch unter Kontrolle zu halten und es dem Urteil des Lesers überlassen zu entscheiden, ob mir dies von Fall zu Fall gelungen ist. – Für die Beiträge zum Thema Kulturhauptstadt 2010 habe ich eine eigene Rubrik, eingerichtet: „Kulturflanerie 2010“.
[Das Titelbild zeigt den Titel des Ruhr-Museum-Folders zur Eröffnung. Gestaltung Uwe Loesch, Foto (Ausschnitt) Rainer Rothenberg.]
Posted in Kulturflanerie | Comments Off on Kulturflanerie
Thursday, 31. December 2009

Ein Blick in die Zukunft zum Jahreswechsel. Dass ich das kommende Jahr überlebe, scheint mir heute wenig wahrscheinlich. Ich habe da so ein unbestimmtes Vernichtungsgefühl. Vielleicht geht das vielen anderen Menschen ähnlich? So wie sie aussehen, möchte man’s nicht rundweg in Abrede stellen. Mundwinkel, die aufwärts weisen, werden immer rarer.
Am letzten Tag der Nullerjahre verspricht uns die Bundesregierung, alles zu tun, um Wachstum zu schaffen, wie ich gerade in den Nachrichten höre. Sie bemüht sich also darum, den Motor der Klimaschädigung auf noch höhere Touren zu bringen. Der Gipfel in Kopenhagen war ein Desaster? Na, dann wenden wir uns wieder der Arbeitsmarktpolitik zu!
Wir kommen zum Sport. Schumi sitzt bald wieder hinterm Steuer, Deutschland atmet auf. Wenn er dann mal alt in seinem Liegestuhl rumschaukelt, dann wird die Welt eine andere sein. Oder wenn er in seinem Schaukelstuhl rumliegt? Aber egal.
Wir kommen zum Wetter. Der Jahreszeit entsprechend trüb, feucht, kalt, deprimierend. Es kann nur besser werden. Doch ist das überhaupt noch ein Thema? Alle reden vom Wetter, wir nicht. Wir reden ab sofort nur noch vom Klima. Man sagt dann künftig nicht mehr: Scheißwetter wieder heute! Sondern: Scheißklima wieder heuer!
Und zuletzt die Lottozahlen für Zweitausendzehn: zwölf, dreiundzwanzig, neunundzwanzig, fünfunddreißig, dreiundvierzig, siebenundvierzig. Zusatzzahl: zwei. Superzahl: sieben.
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Tuesday, 29. December 2009
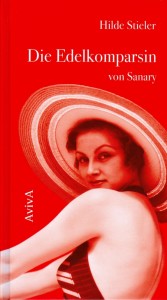
Zu Hans Siemsen haben mir die jüngst erschienenen Lebenserinnerungen von Hilde Stieler (1879-1965) kaum neue Einsichten gebracht. Immerhin habe ich das Buch mit einigem Interesse gelesen, weil es mit „Herzblut“ geschrieben ist – nämlich mit der Leidenschaftlichkeit einer teils glücklich, teils unglücklich liebenden Frau. Allerdings enttäuschte es meine Erwartungen auch noch in einer weiteren Hinsicht, hatte ich mir doch lebendige Charakterbilder der zahllosen deutschen Emigranten in Sanary-sur-Mer erhofft, im günstigsten Fall auch tiefere Einblicke in die sozialen Netzwerke unterm Druck der drohenden Zwangs-Repatriierung, KZ-Internierung, gar Vernichtung. Aber so lang die Namenliste der erwähnten Flüchtlinge im Register auch ist, nach den erhofften Porträts sucht man vergeblich.
Der Herausgeber Manfred Flügge reproduziert im Anhang des Buches die bekannte Gedenktafel in Sanary-sur-Mer, auf der die Namen von 36 prominenten deutschen und österreichischen Schriftstellern verewigt sind, die dort Zuflucht vor der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft suchten und für eine Weile auch fanden. Von diesen Exilanten kommen bei Hilde Stieler nur Lion Feuchtwanger, die Familie Mann, das Ehepaar Werfel, Annette Kolb und Julius Meier-Graefe vor, und selbst diese wenigen werden gleichsam nur en passant erwähnt.
Flügge, der unter anderem auch als Verfasser der ersten, viel beachteten Marta-Feuchtwanger-Biographie hervorgetreten ist, kommt in seinem Nachwort auf diesen beklagenswerten Mangel auch kurz zu sprechen: „Warum die Feuchtwangers praktisch nicht vorkommen, insbesondere Marta Feuchtwanger nicht, die mit Hilde Stieler im Mai 1940 in Hyères interniert war, ist rätselhaft und mag mit Animositäten erklärt werden, vielleicht aber auch damit, dass Stieler und Klossowski doch relativ isoliert lebten, was vor allem seinem Temperament entsprach.“ (Manfred Flügge: Nur eine Freundin bedeutender Leute? Anmerkungen zu Hilde Stieler; in: Hilde Stieler: Die Edelkomparsin von Sanary. A. d. Frz. u. hrsg. v. dems. Berlin: AvivA Verlag, 2009, S. 311.)
Übrigens weckt auch der deutsche Titel des Buches, das im Original Les confessions d’Annouchka überschrieben ist, insofern falsche Erwartungen, als nur der zweite Teil, Auf nach Frankreich!, die Zeit in der Emigration behandelt; und nimmt man die Zeit in Sanary in den Blick, dann bleiben gar bloß gut hundert Seiten übrig. Als „Edelkomparsin“, also als Filmstatistin in der Rolle einer Dame der besseren Gesellschaft, ist Hilde Stieler nach eigenem Bekenntnis nur wenige Male vor die Kamera getreten, und das war in ihrer Münchener Zeit, lange vor Sanary. (Vgl. ebd., S. 137 ff.) Zu diesen Irritationen kommt dann noch die fesche Dame auf dem Titelbild, bei deren Anblick man eher an Rimini 1952 als als Sanary 1932 denkt und die mit der Autorin so gar keine Ähnlichkeit hat. Da drängt sich schon die Frage auf, welche Leserschaft das Buch in solcher Verpackung eigentlich ansprechen will.
Der Berliner AvivA-Verlag, 1997 von der Literaturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin Britta Jürgs gegründet, hat sich nach eigenem Bekenntnis vorgenommen, Porträts und Biografien zu Frauen aus Kunst- und Kulturgeschichte verschiedener Epochen neu aufzulegen, die trotz herausragender und innovativer Arbeiten zu Unrecht in Vergessenheit gerieten: „AvivA-Bücher erweitern die Weltkarte im Kopf um herausragende Frauen in Kunst und Literatur.“ Ich muss gestehen, dass ich gar keine Weltkarte im Kopf habe, dafür allerdings ein durch dreißig Jahre kritischer Lektüre geschärftes Urteilsvermögen. Und das sagt mir in diesem speziellen Fall, dass die Edelkomparsin Hilde Stieler nicht ganz zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Auf der Gedenktafel in Sanary-sur-Mer, neben Namen wie Joseph Roth, Arthur Koestler und Franz Hessel, hat der ihre jedenfalls nichts zu suchen.
[Titelbild: Umschlagfoto des besprochenen Buches aus dem AvivA-Verlag Berlin © H. Armstrong Roberts / Classic Stock / Corbig. – Umschlaggestaltung Britta Jürgs.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Hilde Stieler (II)
Tuesday, 29. December 2009

Allzu oft kommt es nicht mehr vor, gut sechs Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs, dass die komplette Autobiographie eines Zeitzeugen aus der kulturellen Avantgarde der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Manuskript entdeckt wird, aus einem entlegenen Archiv oder Nachlass plötzlich ans Licht kommt. Zudem wird im Einzelfall zu prüfen sein, ob das dort Mitgeteilte verlässlich den sonst bekannten Tatsachen entspricht – und ob es dem gesicherten Wissen dieser Epoche neue, wesentliche Einsichten hinzuzufügen vermag. In der Welt meldete der Literaturwissenschaftler Manfred Flügge vor zweieinhalb Jahren einen solchen Fund: „Im Archiv der Stadt Sanary fand sich vor wenigen Wochen ein nachgelassenes Manuskript von Hilde Stieler. Dieser Lebensroman in französischer Sprache, der die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts umspannt, nennt sich Les confessions d’Annouchka; auf den 320 Seiten sind die Namen nur leicht verschlüsselt. Es geht nicht nur um alle Mitglieder der Familie Klossowski [den Schriftsteller Pierre, dessen Bruder, den Maler Balthasar, gen. Balthus, und deren Vater Erich Klossowski, langjähriger Lebensgefährte der Autorin], auch viele Berühmtheiten kommen vor, Walter Rathenau, Stefan George, Einstein, die Brüder Mann, Renée Sintenis, Bertha Zuckerkandl, die junge Alma Mahler und der junge Franz Werfel […] und immer wieder Rilke. Wir erfahren auch einiges über das Leben der Künstlerszene in Sanary[-sur-Mer an der Côte d’Azur], zu der auch der englische Autor Aldous Huxley gehörte sowie eine junge Deutsche, die später als die englische Autorin Sibylle Bedford berühmt wurde.“ (Manfred Flügge: Balthus’ vergessener Vater; in: Welt online v. 22. August 2007.)
Schon im Rahmen meiner Hans-Siemsen-Recherchen mussten mich diese Memoiren in romanhafter Form interessieren, zumal es sehr wahrscheinlich zu einem Zusammentreffen Siemsens mit Hilde Stieler gekommen sein dürfte, denn „[Erich] Klossowski und [Hilde] Stieler lebten, malten und schrieben im „L’Enclos“, dem Privathaus der Familie Jean Cavet, einem verwunschenen Ort mit Büschen und Bäumen und einem ummauerten Park, damals am östlichen Stadtrand gelegen und mit Ausblick ins Hinterland, heute wie eine Insel im kleinen Häusermeer.“ (Flügge, l. c.) In eben dieser Wohnanlage hatten auch Hans Siemsen und sein Geliebter Walter Dickhaut vorübergehend Unterkunft gefunden, wie ich von Prof. Gernot Lucas (Konstanz), einem regelmäßigen Besucher von Sanary-sur-Mer, erfahren hatte. Mittlerweile ist das Buch in deutscher Übersetzung erschienen – und ein Blick in den Namensindex bringt die Enttäuschung: Siemsen kommt nicht drin vor. (Hilde Stieler: Die Edelkomparsin von Sanary. Übers. [a. d. Frz.] u. hrsg. v. Manfred Flügge. Berlin: AvivA Verlag, 2009.)
Immerhin schildert Stieler, wie sie die Herberge bei der Familie Cavet Anfang der 1930er-Jahre für sich und Klossowski anmietete: „Sehr schnell fand ich etwas Passendes: drei Zimmer in der hübschen kleinen Villa de l’Enclos, mitten im Ort und nicht weit vom Meer gelegen. Klossowski hatte dort eine Art Atelier, das heißt ein recht großes Zimmer im ersten Stock, während sich mein ,Reich‘, Schlafzimmer mit Küche, im Erdgeschoss befand. Meist kam Klossowski nur zum Essen herunter und nachts stieg ich manchmal zu ihm hinauf. Dieses Leben war ganz nach unserem Geschmack, denn trotz unserer Liebesfreundschaft brauchten wir beide eine gewisse Unabhängigkeit, vor allem für unsere Arbeit.“ (Ebd., S. 197.) – Und in ihrem Tagebuch vom Sommer 1944 schreibt Stieler unterm Datum vom 24. August: „Der sympathische Besitzer der Villa de l’Enclos [Jean Cavet] wird zum Bürgermeister von Sanary gewählt. Robert [Henri de Witt, Stielers zweiter Ehemann] will ihm unsere Heirat melden und man wird das Aufgebot veröffentlichen. Das Bürgermeisteramt nimmt mich unter seinen Schutz.“ (Ebd., S. 283.)
Etwas interessanter ist, was Manfred Flügge in seinem Nachwort über die Villa de l’Enclos berichtet. Da Erich Klossowski im Gegensatz zu seinen berühmten Söhnen heute nahezu vergessen ist, befragte er die noch lebenden Zeitzeugen vor Ort: „Marcelle und Louis Cavet erinnerten sich daran, dass er ein sehr diskreter Mensch war, meist schwarz gekleidet, mit einem Seidentuch um den Hals. Er lebte in der Villa de l’Enclos wie in einem Märchenhaus, begierig auf Zeitungen, oder er saß in der Küchenecke vor dem Radio und hörte Nachrichten. Das Anwesen ist ein wahrhaft magischer Ort, ein dreieckiger Park hinter Mauern, mit vielen Büschen und Bäumen, die das zweistöckige Landhaus fast verdecken, aber schattige Plätze schaffen, damals am Rande des Ortes, mit Ausblick aufs Hinterland, in dem sofort die Felder begannen. […] Nur wenige hundert Meter entfernt warfen die Alliierten 1944 Bomben ab. Ein ganzes Viertel des Nachbarortes Six-Fours wurde dabei zerstört. Die Bucht war von den Deutschen stark befestigt worden und wurde hart umkämpft. Ein Wunder, dass sich die Zerstörungen in Sanary selbst in Grenzen hielten.“ (Ebd., S. 311.) Da weilte Hans Siemsen längst nicht mehr in Sanary. Er verließ den Ort gemeinsam mit Walter Dickhaut Anfang 1941 und entkam über Marseille und Lissabon nach New York. Es würde sich wohl lohnen, selbst einmal an die Côte d’Azur zu fahren und die auskunftfreudigen Geschwister Cavet zu Siemsen zu befragen. Aber erstens spreche ich kein Französisch, zweitens fehlen mir für eine solche Auslandsreise die Mittel und drittens lehne ich Fahrten in solche Ferne, gleich ob per Auto, Flugzeug oder Bahn, prinzipiell ab, wenn sie nicht absolut unvermeidbar sind.
Da ich Die Edelkomparsin von Sanary nun schon einmal gelesen habe, werde ich eine ausführliche Würdigung des Buches einem zweiten Beitrag unter diesem Titel vorbehalten.
[Das Titelbild ist dem besprochenen Band (S. 196) entnommen. Es zeigt Erich Klossowski vor der Villa de’Enclos. Foto: Hilde Stieler. Privatarchiv Manfred Flügge.]
Posted in Eccentrics, Siemsen, Würfelwürfe | 1 Comment »
Friday, 25. December 2009

Das Los der Pause in unserer Zeit ist ihre Entwertung zur Störung. Wo das Ideal die optimale Verwertung der Zeit im Produktionsvorgang ist, muss die Pause als Zeitverlust erscheinen. Die Räder sollen sich ununterbrochen drehen, die starken Arme müssen für die unentwegte Zirkulation des Räderwerks sorgen, einem diesem ewigen Kreislauf entgegenstehender Wille muss von vornherein böswillige Absicht gegen den heiligen Zweck der ganzen Maschinerie unterstellt werden. Dennoch sind Pausen unvermeidlich, wenn etwa die Maschine geschmiert werden muss, wenn der Mensch Kraft schöpfen soll für ein mit neuem Schwung wiederaufgenommenes Schaffen. Diese Pausen sind aber sozusagen nicht ganz echt, sie sind in ihrem auf die Produktion bezogenen Regenerationszweck Teil derselben, auch sie müssen deshalb optimal genutzt werden.
Die echte Pause hingegen beginnt da, wo jede Zweckmäßigkeit ihren Sinn verliert. Sie ist vollkommen nutzlos. Zugleich hat die echte Pause kein inneres Maß und kein vorbestimmtes Ziel. Die abgesteckten, zu festgesetzter Stunde beginnenden, verordneten Pausen, wie die Schulpause zwischen den Stundenblöcken und die Brotzeit in der Fabrik, sind so gesehen bloß Attrappen der wahren Pause. (Die Schule trainiert somit, noch vor allem fachlichen Geschick und stofflichen Wissen, zuallererst den Rhythmus von Schaffen und Erschlaffen ein, der dem Produktionsfaktor Mensch dann lebenslang in Fleisch und Blut verwurzelt bleibt.)
[Pause.]
Eine echte Pause beginnt erst, wenn ihr Ende völlig offen ist. In einer solchen Pause lebe ich seit etlichen Monaten, was die zeitliche Bindung an eine gewerbsmäßige Produktion betrifft. Naiv ist, oder korrumpiert von den üblichen Bildern der Beschäftigung, wer diesen Zustand mit Untätigkeit verwechselt. Im Gegenteil bin ich, unterm Gesichtspunkt der Qualität meines Tuns, noch nie so folgenreich werktätig gewesen wie in jüngster Vergangenheit. Allerdings bemisst sich dieser Reichtum nicht in Euro verdienten Geldes, wie auch der hierfür eingesetzte Aufwand nicht in Stunden abzumessen ist.
„Und? Was machst Du jetzt so?“ Das fragten mich entfernte Bekannte, die von meiner neuen Lebenssituation vom Hörensagen wussten. „Ich habe jetzt erst mal eine Denkpause eingelegt.“ Das war für eine Zeit meine Lieblingsantwort. Mir gefiel daran, dass sie zwei Interpretationen zuließ: eine Pause zum Nachdenken – und eine Pause vom Denken. An die zweite Möglichkeit dachte zwar niemand außer mir. Und doch war es gerade diese Variante, die ich immer mitdenken wollte. Mein Nichtstun sollte tatsächlich ein absolutes sein. Wenn ich früher, in Zeiten meiner „Vollbeschäftigung“, in meinen wenigen Pausen doch immerhin noch gedacht, vor- und nachgedacht hatte, so suchte ich nun den Zustand absoluter Gedankenlosigkeit wie ein verlorenes Paradies.
[Der Pausenfüller ist ein Podcast von Claudia Wehrle und Oliver Glaap mit dem Titel Vom Verschwinden der Pause, zuerst gesendet im Hessischen Rundfunk am 18. Dezember 2009.]
Posted in Flanerie, Würfelwürfe | 1 Comment »
Wednesday, 23. December 2009

Einer der vielen Romane, die ich immer schon mal schreiben wollte, ist jener von dem spröden Mann, der mit seiner Hündin in einem maroden Häuschen am Waldrand lebt und seinen Unterhalt mit der Reparatur defekter Elektrogeräte bestreitet. Seine Kunden wissen nichts über seine Herkunft und seine Vergangenheit, wer immer versucht hat, ihn danach auszufragen, stieß auf hartnäckiges Schweigen. Allenfalls murmelte er sich etwas in den Bart von der Art, das sei doch wenig interessant und er müsse nun auch sogleich wieder an seine Arbeit.
Nur die ältesten Bewohner der Kleinstadt, in der sich dies zuträgt, können sich noch daran erinnern, dass das Haus in grauer Vorzeit leer gestanden hat, dass schon darüber nachgedacht worden war, ob man es nicht einfach abreißen könne. Doch dann sei plötzlich der jetzige Bewohner auf der Bildfläche erschienen und habe anhand einiger alter Urkunden bewiesen, dass er und niemand sonst rechtmäßiger Besitzer des Hauses sei. Er gedenke, es so weit wieder herzurichten, dass er darin wohnen könne und bis auf Weiteres an Ort und Stelle sein Auskommen zu suchen.
Nachdem sich die Aufregung über diesen plötzlichen Neubürger und sein befremdlich scheues Gebaren gelegt hatte, wandte sich der Klatsch wieder anderen Gegenständen zu. Nur einmal flammte das Interesse wieder auf, als man plötzlich gewahr wurde, dass der Elektriker neuerdings einen Hund sein Eigen nannte. Es handelte sich um einen Mischling unbestimmbarer Provenienz, dem Vernehmen nach ein weibliches Tier, das nie bellte, seinem Herrchen aufs Wort folgte und aus überaus treu dreinblickenden dunkelbraunen Augen in die Welt schaute.
Nach dieser kurzen Vorgeschichte fokussieren sich Auge und Ohr des Erzählers ganz auf den Mann und seine Hündin. Wir erfahren, wie sich ihr Alltag im Haus am Waldrand gestaltet, wie sie ihre Mahlzeiten miteinander einnehmen, ihren üblichen Geschäften nachgehen und welche seltenen Ereignisse diese Routine unterbrechen: der Besuch eines Kunden etwa oder ein Einkaufsgang auf den Marktplatz des Städtchens. Vor allem aber werden wir Zeugen der angeregten Unterhaltungen, die die Hündin mit ihrem Halter pflegt. Jawohl, in dieser Reihenfolge muss man es wohl sagen, denn es wird bald deutlich, wer der eigentliche Herr, nein: die Herrin im Hause des Elektrikers ist.
Bevor wir noch recht Gelegenheit haben, uns mit der phantastischen Unwahrscheinlichkeit dieser Konstellation abzufinden oder gar anzufreunden, ereignet sich eine Katastrophe. Bei einem nächtlichen Gewitter schlägt ein Blitz in das Haus ein, es gerät in Brand und … (Bis hierher und nicht weiter.)
Posted in Märchen, Würfelwürfe | Comments Off on Unschreibbare Romane (III)
Sunday, 20. December 2009

Natürlich würde sich niemand mit solchen Studien beschäftigen. Fast schmerzlich nannte er die Vorstellung, dass auch er von Odradek überlebt werden könnte. So kam es dann auch, und was für ein Nachleben das Gebilde hatte.
Ulrich Holbein, der ein Lebensbild des ,Versicherungsangestellten, Unfallschützers, Büromenschen, Albtraumfabeldichters, Hungerkünstlers, Himmelsstürmers und Longsellers‘ achtzehn Jahre später in sein Narratorium aufnahm, hat 1990 die markantesten Zitate aus den zahlreichen Deutungen dieses laut Walter Benjamin „sonderbarsten Bastard[s], den die Vorwelt bei Kafka mit der Schuld gezeugt hat“ dankenswerterweise seiner Studie Samthase, Odradek und Hydra vorangestellt.
Dankenswerterweise deshalb, weil neben den Zitaten der bekannten Kafka-Philologen wie Malcolm Pasley, Heinz Politzer und Wilhelm Emrich auch eins aus Günther Anders’ Kafka Pro und Contra aufscheint, von einem meiner persönlichen Hausväter also. Der sagt (laut Holbein): „Da beschreibt er z. B. ein Objekt ,Od<d>radek‘, dessen Funktion gerade darin zu bestehen scheint, daß es keine Funktion hat.“ – Ich habe mich nun gefragt, warum in diesem Zitat der Name des Numinosen mit einem zweiten – oder, wie der besserwisserische Karl Valentin korrigieren würde: dritten – „d“ geschrieben wird, und zwar mit einem in spitze Klammern gesetzten.
Ich habe den Satz, um dieser Frage auf den Grund zu gehen, bei Anders selbst nachgelesen, in der Sammlung seiner Schriften zur Kunst und Literatur unter dem Titel Mensch ohne Welt von 1984. Aber dort steht das Wort mit seinen sieben Buchstaben ganz so wie in Franz Kafkas schmaler Prosasammlung Ein Landarzt 1919. Anders’ Kafka-Essay erschien im Original 1951 bei C. H. Beck, vielleicht hat Stern da ja falsch „Oddradek“ geschrieben? Und Holbein hat den Fehler nicht stillschweigend korrigieren wollen, sondern das überzählige „d“ eingeklammert, damit man sieht, dass Anders dieser Fehler unterlaufen ist? Aber das wäre dann kein ganz korrektes Verfahren. Vielmehr hätte Holbein das Wort falsch belassen und ein „[sic]“ oder „[!]“ dahintersetzten müssen. Und übrigens möchte ich darauf aufmerksam machen, dass er nicht die Erstausgabe von Kafka Pro und Contra aus dem Jahr 1951, sondern die vierte Auflage von 1972 zitiert. Aber das heißt nicht viel, denn schon damals leisteten sich selbst so angesehene und seriöse Verlage wie C. H. Beck in München nur noch selten den Luxus, bei Neuauflagen wiederum einen Korrektor dranzusetzen, um solche Fehler nachträglich noch zu korrigieren.
Es mag manchem als krankhafte Pedanterie erscheinen, dass ich die nur vermeintliche oder tatsächliche Falschschreibung eines Namens aus zweiter bzw. dritter Hand zum alleinigen Gegenstand eines Artikels in meinem Weblog mache. Wer sich aber ins Bewusstsein ruft, dass es kein ganz gewöhnliches Wort ist, dem diese Falschschreibung zustößt, und dass der Mann, dem diese unterlief (oder auch nicht), lange im englischsprachigen Raum gelebt hat und ihm insofern das Wort „odd“ und seine Bedeutung vertraut gewesen sein dürfte, der wird vielleicht weniger hart über meine Penetranz in dieser Angelegenheit urteilen.
Posted in Babel, Godzilla, Würfelwürfe | 1 Comment »
Saturday, 19. December 2009
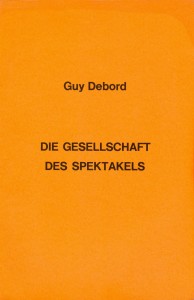
Zurück zum Thema. Der Clou beim Pas de deux von Alice Schwarzer und Esther Vilar zum Thema Benachteilung oder Privilegierung der Frau? war, dass als Kontrahent der Frauenrechtlerin nicht, wie zu erwarten, ein Mann antrat, sondern eine Geschlechtsgenossin, die damit demonstrativ aus der weiblichen Solidargemeinschaft ausscherte und gegen das Bild der unterdrückten Frau ihren „dressierten Mann“ stellte.
Solche irritierenden Mauersprünge waren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 1975 noch möglich. Heute ist die Abbildung von kontroversen Meinungsbildern in den Massenmedien völlig statisch geworden. Allenfalls die Entlarvung engelsgleicher Stars als schmutzstarrende Übeltäterinnen vermag noch zu irritieren. Mittlerweile gehören aber längst auch solche privaten Entgleisungen zum Image-Portfolio eines Weltstars und tragen zu dessen wünschenswertem Facettenreichtum bei. Die koksende Anorektikerin Kate Moss und der unter seniler Satyriasis leidende Silvio Berlusconi haben allemal mehr Chancen, sich in den Schlagzeilen und an der Macht zu halten als eine fade Sharon Stone, die ein Skandälchen höchstens unfreiwillig hinbekommt, oder ein farbloser Rudolf Scharping, dem sein Swimmingpool-Geplansche mit Kristina Gräfin Pilati-Borggreve wohl letzten Endes deshalb zum Verhängnis wurde, weil es so schrecklich stutzerhaft inszeniert war.
Das Spektakel als Präservativ über der katastrophalen Wirklichkeit ist also heute für keine Überraschung mehr gut. Es platzt nicht, es reißt nicht, es hält dicht. Es verhindert mit hundertprozentiger Zuverlässigkeit jeden Durchblick auf die Hintergründe und Zusammenhänge, nicht etwa wie in früheren Zeiten durch Lüge, Verstellung und Ablenkung, sondern allein durch overflow. Diesen Betäubungseffekt durch Übersättigung gab es zwar in der älteren Buchzeit auch schon. Es heißt ja, dass vielleicht die gelehrten Zeitgenossen Goethes die letzten Menschen waren, die mit viel Fleiß bei optimalen Studienvoraussetzungen noch einen universalen Überblick über das Wissen ihrer Zeit erwerben konnten. Danach musste die aufgeklärte Wissbegier vor der schieren Masse des Materials kapitulieren. Immerhin erlaubte die Ordnung der Wissenschaften seither aber noch eine systematische Spezialisierung und der Fortschritt konnte durch die akademische Vernetzung der Spezialisten weiterhin seinen (wie wir uns jetzt langsam mal eingestehen könnten: verhängnisvollen) Lauf nehmen. In der Turbozentrifuge der modernen Medien hingegen wird alles zu einem einzigen indifferenten Brei vermischt, facts & fiction, reason & emotion, past & future, dream & reality.
Das Tagwerk des unverdrossenen Beschreibers, der im Nichtstun kein Auskommen findet und zum Sinn keinen Einlass, beschränkt sich also aufs Arrangieren flüchtiger Impressionen, aus dem Augenblick und für den Augenblick. Eben wird in Kopenhagen wieder einmal eine „letzte Hoffnung“ zu Grabe getragen. Für den Klimagipfel mussten am Tagungsort, dem Bella-Center, 1.200 Kilometer Stromkabel verlegt werden, die nach dem erfolglosen Ende der Veranstaltung wieder aus den Wänden gerissen werden müssen. Dieses Bild genügt mir zum Thema.
Pessimismus ist noch die froheste Geisteshaltung, die ohne Heuchelei oder Selbstverleugnung möglich ist. Daraus ein Buch schneidern? Vielleicht. Aber warum? Das Weblog passt doch viel besser zu dieser Kurzweil.
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Buchwesen (III)
Tuesday, 15. December 2009

Ich werde im Folgenden umstrittene Themen, die die Zeitgenossen vorübergehend oder dauerhaft anziehen wie die Mücken das Licht und sie scharenweise zu ambitionierten Kommentaren in den Weblogs hinreißen, buchverdächtig nennen. Denn wenn Menschen, die meist durch jahrzehntelangen passiven Medienkonsum nahezu sprach- und völlig schriftlos geworden sind, nun in großer Zahl ihren Frust in die Tastatur hämmern, dann wäre man ein schlechter Menschenkenner und noch schlechterer Kaufmann, wenn man hier nicht einen potenziellen Bestseller witterte.
Üblicherweise werden heiße Kontroversen in den Verlagshäusern nach dem Pro-und-kontra-Schema polarisiert. Das hat den Vorteil, beide einander feindlich gegenüberstehenden Zielgruppen „abschöpfen“ zu können, wenngleich der Zynismus selten so weit geht, dass beide Bücher im gleichen Verlag erscheinen. Sehr schön gelang dies beispielsweise Mitte der 1970er-Jahre mit dem Tandem Alice Schwarzer und Esther Vilar. Die Feministin und die Anti-Feministin trafen in den gerade erst im BRD-Fernsehen populär werdenden Talkshows aufeinander und führten vor, wie telegen Unversöhnlichkeit sich präsentieren kann. Damals konnte man nur vermuten, dass solche öffentlich ausgetragenen Lagerkämpfe bloß die Fronten verhärteten und so gut wie nie zu einem Erkenntnisfortschritt hüben wie drüben führten, geschweige denn zu einem Kompromiss. Heute ist man, was das betrifft, nicht mehr auf Spekulationen angewiesen. Unter jedem kontrovers kommentierten Blogartikel kann man bis zum Überdruss nachlesen, dass sowohl die Kontras als auch ihre Gegner, die Pros sich im Besitz der alleingültigen Wahrheit wähnen und davon desto fester überzeugt sind, je länger das Hickhack dauert.
Ganz nebenbei wird bei dieser Betrachtung auch der alte aufklärerische Optimismus endgültig zu Schanden, dass das öffentliche Streitgespräch zu einem friedlichen Ausgleich der Gegensätze führen könne, auf dem Wege über ein wechselseitiges Verständnis der Kontrahenten füreinander. Dies mag in den gepflegten Kreisen gut versorgter Intellektueller vorstellbar sein. Dass Otto Normalzerstörer aber, was die Streitkultur betrifft, ganz anders gebaut ist und jeden seiner Standpunkte mit Zähnen und Klauen verteidigt, als ginge es um die nackte Existenz, das hatten Zivilisationsskeptiker zwar schon immer geahnt, jetzt aber ist es dank Internet unumstößlich bewiesen.
Alberto Manguel hat einmal in seiner Geschichte des Lesens bemerkt, und Jacque Bonnet hat es soeben in seinen Bekenntnissen eines Bibliomanen in Erinnerung gerufen, dass es wohl so gut wie kein Buch gebe, in dem nicht wenigstens ein interessanter Satz stehe. Dem kann ich nur beipflichten, wobei ich, damit kein Missverständnis aufkommt, sicherheitshalber hinzufügen möchte: Gerade die dümmsten Sätze können in einem klugen Kopf zu den interessantesten Einsichten führen.
Und genau so verhält es sich mit den borniertesten und stursten Hahnenkämpfen in den Weblogs unserer Tage. So stieß ich beim unten erwähnten taz-Artikel von Heiko Werning auf folgenden Kommentar eines Klimaskeptikers (leicht gekürzt und stellenweise stillschweigend korrigiert): „Jetzt möchte ich mal hören, ob ich das richtig verstehe. Die Katastrophenbefürworter sagen, weil sich um die Erde ein Mantel von Treibhausgasen legt, heizt sich die Erde von innen heraus auf. Hab ich das soweit richtig verstanden? Wieso ziehe ich mir eigentlich Textilien an? Müsste ich mich nach dieser Theorie nicht auch von innen her aufheizen? Meine Körperwärme kann nicht nach außen abfließen. Demzufolge müsste ich doch immer heißer werden? Und kommen wir mal abseits jeglicher Beweise zu folgendem. Ich bin 43 Jahre und kann mich noch gut an meine Kindheit erinnern. Und an die schönen Sommer die es damals gab, wenn wir als Kinder den ganzen Sommer draußen barfuß durch die Natur getobt sind, draußen im Garten übernachtet haben. Und wie sang Rudi Carrell damals ,Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer wie er früher einmal war?‘ Und jetzt schauen wir uns unsere Sommer heute an. Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ich achte also sehr genau auf das Wetter. In den letzten Jahren war meine wichtigste Bekleidung beim Fahren meine Regencombi. Als junge Bengels sind wir im Sommer, weil es warm war, noch mit kurzen Hosen gefahren. Sogar nachts. In den letzten Jahren bin ich die ganzen Motorradsaisons nur mit langen Unterhosen drunter gefahren und [habe] vor allem immer die Regenkombi wenigstens mitgenommen. Bis auf ein paar wenige sehr warme Tage, nur kaltes Scheißwetter im Sommer! Und dann höre ich die ganze Zeit: globale Erwärmung. Jetzt könnte ich als Motorradfahrer ja sagen, wo ist denn die globale Erwärmung wenn man sie braucht? Jetzt aber mal im Ernst. Ich brauche keine Tabellen oder Diagramme, um zu erkennen, dass anscheinend die Erwärmung ausfällt. Eher das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Und wenn einer weiter oben fragt, wo denn der ganze Schnee bleibt? 50 Grad [minus] in Sibirien, Schneestürme mit 20 Toten in den USA – also für mich klingt das nicht gerade nach globaler Erwärmung. Und komm mir jetzt keiner von diesen Untergangsfetischisten damit, ich bildete mir das alles bloß ein. Abseits aller Doktoren und Professoren und IPCC und dem ganzen Geschisse: Leiden die alle unter Alzheimer? So, musste ich mal loswerden! Schönen Tag noch.“
[Wird fortgesetzt.]
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Buchwesen (II)
Sunday, 13. December 2009
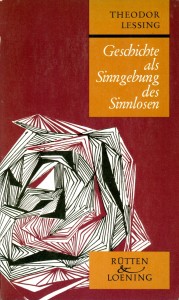
Bücher können auf zweierlei Weise entstanden sein. Im ersten Fall hatte der Verfasser das ganz persönliche Bedürfnis, etwas von sich und seiner Sicht der Welt auszudrücken, und sei’s nur für sich selbst. Im zweiten Fall hat er das Pferd genau von der andren Seite her aufgezäumt und darüber nachgedacht, was die Welt noch für ein Buch brauchen könnte, um dann zu probieren, ob er genau dieses Buch hinbekommt. Der Einfachheit halber wollen wir Bücher vom Typ I hier Elfenbeinbreviere nennen, Bücher vom Typ II hingegen Reparaturanleitungen. Damit mich der Leser nun nicht vorderhand ins gerade heute immer größer werdende Heer der terrible simplificateurs einreiht, füge ich ausdrücklich hinzu, dass beide Formen kaum je absolut rein vorkommen, vielmehr in jedem Buch der einen gewöhnlich auch etwas von der anderen Form enthalten ist.
Damit deutlich wird, was ich meine, will ich ein paar Beispiele für den zweiten Buchtyp nennen. Nehmen wir zum Beispiel die zahllosen Ratgeber für Fragen des Alltags, von 1000 ganz legalen Steuertricks bis zum Nichtraucher durch Selbsthypnose. Sie helfen der jeweils angesprochenen Zielgruppe, ein Defizit auszugleichen, hier: mangelnde Kenntnisse des aktuellen Steuerrechts – oder einen Defekt zu reparieren, hier: die Nikotinabhängigkeit. Die Bedürfnisse der Adressaten liegen somit offen zu Tage und man kann aus der Höhe der jeweils verkauften Auflage ohne Umwege auf die Verbreitung und Bedeutung des behandelten gesellschaftlichen Problems schließen. Umgekehrt gibt es in den auf Reparaturanleitungen spezialisierten Verlagen längst Trendscouts, die nach neu auftretenden oder noch nicht ausreichend versorgten Defekten forschen, um die Betroffenen mit den passenden Handreichungen versorgen zu können. Und wenn die Flöhe mal gar nicht husten, wird rasch ein neuer Defekt erfunden und mit allen Mitteln als neue Seuche propagiert. So gibt es ja etwa den gut begründeten Verdacht, dass das weitverbreitete Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) bloß ein gesellschaftliches Konstrukt ist.
Nicht ganz so offensichtlich ist für den ungeschulten Blick, dass auch der gesamte Bereich der populär-politischen Literatur zum Typ II gehört. Meist geht es den Lesern solcher Bücher darum, ihren politischen Standpunkt mit schlagkräftigen Argumenten wieder und wieder bestätigt zu finden. Die Leser von Kohl-Biographien sind in den seltensten Fällen Wähler Oskar Lafontaines, et vice versa. Weil in der rauen Wirklichkeit gesellschaftlicher Diskurse die eigene feste Überzeugung immer wieder durch Gegenargumente ramponiert wird, bedarf es des politischen Sachbuchs als Reparaturhilfe. Aus Sicht der Verlage besonders erfolgversprechend sind dabei Argumentationshilfen gegen vorherrschende Meinungen, zumal dann, wenn diese Meinungen die individuellen Denk- und Lebensgewohnheiten der avisierten Zielgruppe in Frage stellen.
Auch dazu ein konkretes Beispiel: Wer seinen Lebenszweck darauf abgerichtet hat, beruflich erfolgreich zu sein und sich zur Belohnung in seiner Freizeit etwas dafür leisten zu können, dem schmeckt es nicht, wenn ihm Mahner gegen ungebremstes Wirtschaftswachstum, gegen blindwütigen Konsumismus, gegen schonungslosen Verbrauch unersetzlicher Naturressourcen in die sonst so fein abgeschmeckte Suppe spucken. Zur Stärkung des Selbstbewusstseins solcher angefressenen Endzeityuppies gibt es seit einigen Jahren in der westlichen Welt ein buntes Häufchen neoliberaler Zukunftsoptimisten, die hierzulande um die Achse des Guten rotieren.
Gerade machte diese Clique wieder lautstark auf sich aufmerksam und erlaubte es dem abgeklärten Betrachter, die aktuellen Frontverläufe zwischen den vorurteilsbewehrten Meinungsfestungen eingehend zu studieren. Auslöser des Konflikts und der Polemiken, die er nach sich zog, war ein Datenklau von Hackern beim Climatic Research Unit (CRU) an der University of East Anglia in Großbritannien, bei dem über tausend private E-Mails der Klimaforscher sowie tausende weiterer Dokumente dieser Einrichtung aus dem Zeitraum 1996 bis heute erbeutet und frei einsehbar ins Netz gestellt wurden. Nun glauben die sogenannten „Klimaskeptiker“ (richtiger: die Skeptiker eines menschgemachten Klimawandels, speziell der globalen Erwärmung), in diesen E-Mails einen unumstößlichen Beweis für den großen Betrug der Klimaforscher gefunden zu haben. Als Heiko Werning gestern in der taz das voreilige Triumphgeheul der Klimaskeptiker mit einem sachlichen Artikel über den ganz unspektakulären Inhalt der vermeintlich entlarvenden E-Mails zu dämpfen versuchte, brach eine wahre Flut hämischer Kommentare über ihn herein. Werning hatte besonders das Gespann Maxeiner und Miersch aufs Korn genommen, das gemeinsam mit Henryk M. Broder für das „Politische Netzwerk“ Achse des Guten verantwortlich zeichnet. Diese beiden Herren sind einem größeren Publikum durch ihr Lexikon der Öko-Irrtümer bekannt geworden, in dem sie laut Untertitel „überraschende Fakten zu Energie, Gentechnik, Gesundheit, Klima, Ozon, Wald und vielen anderen Umweltthemen“ zusammengetragen haben. Dieses zuerst 1998 erschienene Elaborat aus der langen Reihe der Irrtümer-Bücher beim Eichborn-Verlag repräsentiert eine Sondersparte der Typ-II-Bücher. Mittels dieser partytauglichen Argumentationshilfen sollen solche Menschen mit Gesprächsstoff für mancherlei gesellige Zusammenkünfte versorgt werden, die aus eigenem Bestand schreckliche Langweiler wären und sich nach fleißigem Studium nun bei jeder Gelegenheit als neunmalkluge Besserwisser wichtigtun können, indem sie uns in tausendundeinem Fall darüber aufklären, dass sich alles ganz anders verhält, als wir vorurteilsbeladenen Banausen immer meinten.
[Wird fortgesetzt.]
Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | 1 Comment »
Thursday, 10. December 2009

Neuerdings werde ich häufiger darauf angesprochen, dass in meinem Weblog selten kommentiert wird. Wenn ich darauf erwidere, dass dies mich nicht weiter störe, dann ernte ich skeptische Blicke, oft garniert mit einem halb spöttischen, halb mitleidsvollen Schmunzeln, das wohl sagen will: ,Ach, lieber Fuchs, du musst die Trauben wohl sauer nennen, die dir zu hoch hängen.‘ Drum hier eine knappe Bemerkung, warum ich nach Kommentaren nicht giere und mir eine Kommentarflut sogar lästig wäre.
In meiner Zeit als Blogger bei Westropolis (April 2007 bis August 2008) konnte ich mich über einen Mangel an Kommentaren nicht beklagen. Zeitweise war ich dort sogar der meistkommentierte Stammautor, vor professionellen Journalisten wie Bernd Berke und prominenten TV-Starlets wie Else Buschheuer. Ich will nicht leugnen, dass dieser vorübergehende Kommentar-Hype zunächst meiner Eitelkeit schmeichelte. Es dauerte allerdings nicht allzu lange, bis mir drei große Gefahren dämmerten, die diese unerwartete Resonanz mit sich brachte.
Erstens ertappte ich mich dabei, dass ich meine Texte immer mehr darauf abstellte, möglichst viele Kommentare einzuheimsen. Ich hatte schnell raus, dass es eine Handvoll zuverlässig wirksamer Maschen gibt, dieses Ziel zu erreichen. Meine Lieblingsmasche war, provokative Meinungen zu aktuellen Ereignissen und Themen zu formulieren und dadurch die Leserschaft in mindestens zwei Lager zu spalten, die sich in den Kommentaren dann heftig befehden durften. Sobald das Kommentarfeuer zu erlöschen drohte, fachte ich es wieder an, indem ich selbst als Kommentator das Wort ergriff und gezielt „nachlegte“. Dies führte allerdings dazu, dass mir öfter mal die Pferde durchgingen und ich mich zu Äußerungen hinreißen ließ, die mir nachträglich leid taten, weil sie meinem Image schadeten. Ich wollte mich ja schließlich als ein durch nichts aus der Ruhe zu bringender Stoiker präsentieren. Stattdessen war ich bei manchen bald als cholerischer Haudrauf verschrien.
Zweitens stellte sich bei genauerer Analyse heraus, dass vielleicht zwei Dutzend Stammgäste neun Zehntel aller Kommentare bei Westropolis verfassten. Wenn man sich vor Augen führt, dass es sich hier immerhin um das Kulturblog der größten Regionalzeitung Deutschlands handelt (Wochenendauflage ca. 580.000 Exemplare), dann ist diese Resonanz geradezu lächerlich schwach. Nun mögen ja auf jeden lauten und regelmäßigen Kommentator viele hundert stille Leser kommen. Aber gerade dieses Zahlenverhältnis bewiese dann q. e. d.: dass Kommentarzahlen für die Wirkung und Reichweite eines Weblogs wenig Aussagekraft haben.
Drittens hatten die Administratoren bei Westropolis, wie in wohl allen großen Blogs der etablierten Printmedien, zeitweise viel damit zu tun, die Kommentare inhaltlich zu überwachen, um Verstöße gegen die guten Sitten, Beleidigungen, rechtsradikale Propaganda usw. zu löschen. Diese Eingriffe standen zudem immer unter Zensurverdacht, denn da der Leser nicht überprüfen konnte, was da gelöscht wurde, wenn er zu spät kam, konnte er sich kein eigenes Urteil darüber bilden, ob die Löschung berechtigt gewesen war. Dieser große Aufwand stand übrigens in keinem rechten Verhältnis zum inhaltlichen Wert der meisten unverfänglichen Diskussionen und Stellungnahmen in den Kommentaren. Ich identifizierte als Lieblingsthemen der Kommentatoren: Wichtigtuerei und Selbstdarstellung sowie Komplimente und Beileidsbekundungen an die Adresse beliebter Autorinnen, die das Kulturblog als Plattform für ihre persönliche Imagepflege missbrauchten. – Fazit: Die Trauben sind in aller Regel tatsächlich sauer. Ich bin somit heilfroh, in meinem Revierflaneur-Blog frei schalten und walten zu können. Jeder erstmals kommentierende Leser muss erst von mir freigeschaltet werden. Kommentare, die ich nichtssagend finde, lösche ich kommentarlos. Und glücklicherweise ist das Aufkommen so schwach, dass ich damit kaum Zeit verschwenden muss.
Posted in Würfelwürfe | 1 Comment »
Thursday, 10. December 2009

Heldenhaft der Kampf der kleinen aber feinen Buchhandlungen gegen die banausischen, in vielerlei Hinsicht immer tiefer sinkenden Großflächen à la Thalia, Mayersche, Hugendubel, sie sind nicht genug zu loben. Manchmal weiß ich aber keine Antwort mehr auf die Frage, wie bei aller unterstellten, nahezu grenzenlosen Bereitschaft zur Selbstausbeutung der Inhaber solcher Schmuckkästchen, bei aller Professionalität und Investitionsbereitschaft nicht nur von Geld und Zeit, sondern auch von Hirn und vor allem Herz per Saldo noch was übrig bleibt zur Bestreitung bescheidener Lebenshaltungskosten.
Gestern war ich zu Gast bei einer Lesung in der Essener Buchhandlung proust. Michael Maar las aus seiner viel gelobten Essaysammlung Proust Pharao (Berlin: Berenberg Verlag, 2009). Zwanzig interessierte Zuhörer waren bereit, hierfür acht Euro Eintritt zu bezahlen, einige kauften anschließend das vorgestellte Buch zum Preis von 19 Euro. Maar, der von Berlin aus eigens mit dem Auto angereist war, las eine knappe Stunde. Anschließend erfüllte er Signierwünsche. Fragen aus dem Publikum wurden nur wenige gestellt. Ich erinnere mich blass an die Frage eines bekennenden „Nicht-Proustianers“, die sich mit der Quantität der Recherche befasste und einen leichten Trend ins Banausische hatte, wovon sich der Autor aber nicht zu einer Hochnäsigkeit hinreißen ließ. Die Buchhändler reichten zu allem Überfluss gar noch einen großen Teller Madeleines herum.
Die Frage drängt sich auf: Wie geht das? Fahrtkosten des Autors hin und zurück, und wenn Maar nicht um zehn Uhr abends noch die Heimreise antreten wollte, kam eine Hotelübernachtung hinzu. An Personalkosten fallen mindestens anderthalb Überstunden für zwei Buchhändler und eine Auszubildende an, für die gleiche Zeit Heizkosten und Beleuchtung im Geschäft. Dazu noch Autorenhonorar? Und was, wenn nun statt zwanzig nur zwei Zuhörer erschienen wären? Wie man es dreht und wendet, solche schönen Abende können für sich betrachtet nur ein Verlustgeschäft sein, sie rentieren sich hoffentlich indirekt über den fabelhaft guten Ruf, den sich dadurch eine Buchhandlung wie proust erwirbt, und zwar insbesondere bei der wertvollsten Kundschaft, den Viellesern. Die werden damit zu treuen Stammkunden und kaufen vielleicht sogar das eine oder andere Buch zusätzlich, damit das Schmuckkästchen nicht in wirtschaftliche Bedrängnis gerät.
Eine ganz ähnliche Entwicklung gibt es ja übrigens bei den Kinos. Auch dort verdanken die Cineasten es wenigen Idealisten, wenn es heute überhaupt in den Großstädten neben den öden MegamaxX-Alptraumfabriken noch Lichtspielhäuser gibt, die ihrem Namen Ehre machen: durch ein anregendes Programm, ein gediegenes Interieur und einen bewussten Umgang mit der Tradition. Um am Standort Essen zu bleiben: Hier eröffnet in wenigen Tagen nach acht Jahren Zwangspause das Filmstudio am Glückaufhaus wieder seine Tore. Hauptsächlich dem unermüdlichen Einsatz der leidenschaftlichen Kinobetreiber Marianne Menze und Hanns-Peter Hüster und der Spendenbereitschaft geschichtsbewusster Essener Filmfreunde ist es zu verdanken, dass das älteste Kino des Ruhrgebiets seinen Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. Herzlichen Glückwunsch!
Diesen wie jenen Einsatz sollte jeder belohnen, der dessen Ergebnis zu schätzen weiß: Buch- bzw. Filmgenuss vom Feinsten. Und das geschieht auf kürzestem und wirksamstem Weg durch Besuch und Kauf. Ich werbe hier sonst nie, für nichts und niemanden – diesmal mache ich die berühmte Ausnahme, die die Regel bestätigt: Bücherfreunde, kauft bei proust! Filmfreunde, besucht die Essener Filmkunsttheater Galerie Cinema, Lichtburg, Eulenspiegel, Astra und Filmstudio!
[Titelfoto: Proust-Leser Kamillus Dreimüller bei proust in Essen; Foto: Heinrich Funke.]
Posted in Flanerie, Würfelwürfe | 2 Comments »
Monday, 07. December 2009

Manche haben mir gelegentlich Steine in den Weg gelegt. Früher habe ich einmal Steine übers Wasser hüpfen lassen. Manche Steine erinnerten mich an etwas, an ein Gehirn, Herz, Nieren, oder an einen unbekannten Tierknochen. Steine zu sammeln schien mir immer zu schwer. Ich wollte mich nicht noch damit belasten, vermeintlich unansehnlichen Steinen Unrecht zu tun. Eins, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein, aber warum vier? Auch Steine haben dem Versmaß zu gehorchen, das ist das Mindeste, was von Steinen zu verlangen ist.
Die meisten Steine haben mehr Vorzüge als Nachteile. Sie sind viel dauerhafter als ein menschliches Gefühl, als Heimweh, Durst oder Langeweile. Wenn du einen Stein fortwirfst, hast du ihn bald vergessen. Nicht aber der, den er trifft. Ein Stein in der Faust gibt ein Empfinden von Sicherheit, zugleich kühlt er das erhitzte Gemüt, worauf es dann selten wirklich zum Totschlag kommt. So ist das steinige Wesen eigentlich ein friedvolles.
Einen Stein aus der Hand zu legen ist eine zu wenig gewürdigte Geste. Man müsste sie bildlich darstellen, nicht bloß aufschreiben. Vielleicht würde sich ein Mosaik anbieten. Jede einzelne Mauer war einmal ein Vielerlei abgelegter Steine, etwas Zerstreutes, und wird wieder dazu werden, mach dir nichts vor. Es ist ja auch keine Katastrophe, wie viele oft meinen, dieser Niedergang, diese Auflösung, dieser Zusammenbruch. Schon der Neubau trägt auch die Ruine in sich. So wird die ganze Welt zuletzt barrierefrei sein.
Hinkelsteine, Edelsteine, Nierensteine. So schwer dir ein Stein auf der Seele liegen kann, so wohl wird dir, wenn dir ein Stein vom Herzen fällt. Auch der Stein des Anstoßes ist nicht feindlich, genau betrachtet. Wie sollten wirklich neue Gedanken ins Rollen kommen ohne Anstößigkeiten?
Und schließlich kannst du dir auf Steine mancherlei Reime machen. Damit lasse ich dich aber jetzt alleine. Ich mache keine.
[Dieses 500ste Steinchen zu meinem Blogbau schenke ich Michaela Coerdt zum 50sten Geburtstag.]
Posted in Würfelwürfe | 5 Comments »
Sunday, 06. December 2009

Nach langer Pause befasse ich mich wieder einmal mit Hans Siemsen (1891-1961), wenngleich zunächst zwangsweise. Ich hatte Dirk Ruder von der Zeitschrift Gigi versprochen, meinen Siemsen-Artikel vom Frühjahr (in No. 60, S. 36-39) noch in diesem Jahr mit einer zweiten Folge abzuschließen. Von Heft zu Heft musste ich ihn vertrösten, der Umzug hatte mich (und meine Bibliothek, ohne die ich den Text kaum seriös hätte abfassen können) völlig aus der Bahn geworfen. Zuletzt setzte mir Ruder die Pistole auf die Brust: „Langsam wird es schwierig, unseren Lesern (und auch unserem Herausgeber gegenüber) zu erklären, warum der zweite Teil des Siemsen-Textes seit vier Heften auf sich warten lässt, aber ich zähle nach wie vor auf Sie.“ Ich wäre ja ein rechter Schuft, wenn ich solch treue Engelsgeduld nicht mit Fleiß entlohnte.
Hans Siemsens zweite Lebenshälfte, die mit dem 30. Januar 1933 beginnt, ist ja das traurige Kapitel eines Entwurzelten, dessen Schicksal kaum dadurch leichter wird, dass er es mit unzähligen Leidensgefährten teilt. Seine späte Liebesgeschichte mit dem zwanzig Jahre jüngeren Walter Dickhaut erhält dadurch von vornherein einen bitteren Beigeschmack. Die Tragik, dass ihnen zwar im Frühjahr 1941 endlich die gemeinsame Flucht von Lissabon aus über den Atlantik gelingt, sie dann aber doch im Hafen von New York auseinandergerissen werden, ist schon filmreif. Ich stelle mir vor, dass sich Siemsen vor Eifersucht verzehrt hat in der Sommerhitze des Big Apple, während sein junger Freund in Havanne Bananen pflückte.
Bei der Niederschrift fällt mir sogar noch unerwartet eine kleine Pointe ein. Bei der legendären Zusammenkunft des Siemsen-Freundeskreises in seinem Berliner Atelier im März 1933, die Asta Nielsen 1945 in ihrer Autobiographie Den tiende Muse erwähnt und Hans Siemsen in einem seiner allerletzten Zeitungsartikel 1950 ausführlich schildert, war auch Joachim Ringelnatz zugegen. Nachdem der Stummfilmstar vom Besuch im Propagandaministerium berichtet hatte, wo Joseph Goebbels sie erfolglos für seine Filmprojekte zu gewinnen versuchte, meldete sich „Ringel“ zu Wort. Er habe dieser Tage ein Gedicht gemacht, ob er es mal aufsagen solle? Dann zitiert Siemsen dieses Gedicht, von dem er „nur den ersten und den letzten Vers behalten“ habe. (Hans Siemsen: „Ringel, du hast wieder recht“; in: Frankfurter Rundschau v. 28. Januar 1950; erneut in ders.: Nein! Langsam! Langsam! Berlin: Verlag das Arsenal, 2008, S. 152-154.)
Zwischenzeitlich habe ich mir eine Gesamtausgabe von Ringelnatzens Gedichten zugelegt und heute erstmals die vollständige Fassung des Gedichtes nachgelesen. Es heißt So ist es uns ergangen und hat genau drei Verse. Der mittlere, von Siemsen vergessene lautet so: „Vergiß es nicht! Nur damit du lernst | Zu dem seltsamen Rätsel »Geschick«. – | Warum wird, je weiter du dich entfernst, | Desto größer der Blick?“ (Joachim Ringelnatz: Die Gedichte. Hrsg. v. Fritz & Katinka Eycken m. Jakob Winter. Frankfurt am Main: Haffmans Verlag bei Zweitausendeins, S. 710.) Dass Siemsen tatsächlich aus dem Gedächtnis zitiert, muss man glauben und glaubt es leicht, weil ihm beim Memorieren der anderen beiden Verse ein paar kleine Fehlerchen unterlaufen. – Daraus ließ sich was Hübsches machen …
Bei dieser Gelegenheit muss ich noch nachtragen, dass es einen weiteren Anlass gibt, Dirk Ruder dankbar zu sein. Ende April überraschte er mich mit einer Aufzeichnung von Siemsens Stimme. In der CD-Reihe „stimmen des 20. jahrhunderts“, die von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben wird, befindet sich auf der CD 1945 – Kapitulation und Wiederaufbau als Track 12 ein dreiminütiger Mitschnitt der BBC-Sendung „Stimme Amerikas“. Ein Pfarrer Silesius begrüßt darin die militärische Niederlage des Dritten Reiches und ermutigt seine deutschen Landsleute zum Wiederaufbau. In den „Daten zu Leben und Werk“, die Michael Föster im ersten Band seiner Siemsen-Werkausgabe zusammengestellt hat, heißt es unterm Jahr 1941: „Schreibt für die Voice of America – u. a. Propaganda-Predigten unter dem Pseudonym ,Pfarrer Silesius‘.“ (Hans Siemsen: Schriften I. Verbotene Liebe u. a. Geschichten. Hrsg. v. Michael Föster. Essen: Torso-Verlag, 1986, S. 257.)
Posted in Siemsen | 3 Comments »
Saturday, 05. December 2009

Heute war ich mit Heinrich und Christiane zu Gast an der Westfälischen Wilhelmsuniversität (WWU) in Münster, um mir zwei – im weitesten Sinne – theologische Vorlesungen anzuhören. William J. Hoye (* 1940) las im Schloss [s. Titelbild] über Kreationismus, Neuen Atheismus und die Frage nach der Existenz Gottes. Danach ging’s quer über das Universitätsgelände zu Arnold Angenendt (* 1934) ins Audimax in der Johannisstraße, der in seiner Vorlesungsreihe über Liturgie und Messe einen Vortrag hielt, den er unter dem Titel Opferfanatismus? Martyrium und Selbstmordattentat schon einmal vor einem Jahr in Köln zum Besten gegeben hatte.
Noch vor Jahresfrist wäre mir meine Zeit für ein solches „Wahrnehmungsexperiment“ zu schade gewesen. Einmal habe ich grundsätzliche Vorbehalte gegen akademische Gelehrsamkeit, noch grundsätzlicher: gegen Schule(n) ganz generell. Sodann sträubt sich mir das Fell, wenn ich Frömmigkeit gleich welcher Art nur von Weitem wittere. Und schließlich gilt die Wilhelmsuniversität am Bischofssitz Münster nicht eben als Hort der Aufklärung. Wenn ich diesmal all meine Vorbehalte überwand und mich auf das Abenteuer einließ, dann geschah das wohl hauptsächlich meinem Freund Heinrich zuliebe, der seit vielen Jahren das Angebot „Studium im Alter“ an der WWU nutzt und mir davon viel erzählt hat. Freundschaft bedeutet ja auch, sich jenen Interessen und Neigungen der Freunde gegenüber aufgeschlossen zu zeigen, die nicht von vornherein zu den Schnittflächen oder Berührungspunkten gehören.
Nach Hoyes Referat über den kosmologischen Gottesbeweis, speziell über den von Gottfried Wilhelm Leibniz, tat es mir fast leid, meine Vorurteile bestätigt zu sehen. Der Vortragende war mir schon vorab als „etwas trocken“ angekündigt worden. Wenn es nur das gewesen wäre! Dafür, dass sich Hoye doch mit einem kaum umstrittenen, in alle Richtungen ausgedachten theologischen Standardthema befasste, wirkte er in manchen, zu vielen Details unsicher. Auf die einzige Zwischenfrage aus dem Auditorium, warum man nicht Gott mit dem unendlichen Universum gleichsetzen könne, auf dass alle Eigenschaften Gottes erfüllt seien, kam zunächst eine ausweichende Antwort, dann der Hinweis, dies sei exakt der Gottesbegriff des Marxismus. (Wenn schon, dann doch wohl eher des dialektischen Materialismus, oder?) Sehr aufschlussreich für den Bildungshorizont von Hoye war für mich sein skizzenhaftes Porträt von Bertrand Russell, mit dessen Aufsatzsammlung Warum ich kein Christ bin er sich wohl nur befasst hat, weil sie von modernen Atheisten immer wieder mit Respekt zitiert wird. Russell habe mit Alfred North Whitehead das Grundlagenwerk zur modernen Logik verfasst, die Principia Mathematica, ein, wie Hoye weiß, „unlesbares Buch“. Dass er die Probe aufs Exempel gemacht hat, nähme ich ihm nicht ab, selbst wenn er es behauptete. Merkwürdigerweise fiel ihm noch ein, dass dieser Russell auch gegen den Vietnamkrieg angegangen sei, aber das dämmerte ihm nur noch sehr von ferne und ich konnte mich nicht bezähmen, ihm mit ein paar knappen Informationen zum berühmten Vietnam-Tribunal der Jahre 1966/67 beizuspringen. Ich war damals zehn Jahre alt und müsste nichts über das Tribunal wissen; der Amerikaner Hoye hingegen war in einem Alter, in dem aufgeschlossene Zeitgenossen am wohl umstrittensten Ereignis der Weltpolitik jener Zeit wachen Anteil nahmen. Nicht so offenbar Hoye, der da gerade sein Theologiestudium an der Universität Straßburg aufgenommen hatte, um Gottesbeweise auswendig zu lernen.
Ein Viertelstündchen blieb uns zur Umsiedelung ins Audimax. Ich erwog schon, die Zeit des Vortrags besser zu einem Bummel durch die Antiquariate in Münster zu nutzen und meine Begleiter bei Liturgie und Messe (Folge 7) allein zu lassen. Aber warum sollte ich meine Erfahrung mit Hoye auf Angenendt übertragen? Das wäre nicht fair gewesen. Um es gleich vorwegzuschicken: Meine Geduld mit der Theologie in Münster wurde reich belohnt. Arnold Angenendt erwies sich als herzhafter Rhetoriker, dessen überraschenden, stellenweise auch provozierenden Thesen und Beweisführungen man mühelos folgen konnte; als ein Redner mit Herz und Hirn, Humor und Verve! Was er über die Bedeutung des Opfers in der Menschheitsgeschichte zu erzählen hatte, war mir zwar nicht ganz unbekannt, die konkreten Beispiele hingegen waren es teilweise schon. Ich blieb insofern kritisch auf der Hut, als ich die Drastik dieser blutrünstigen Exempel insgeheim der Effekthascherei verdächtigte. Aber man darf ja getrost einmal die Mittel entschuldigen, wenn sie vom Zweck geheiligt werden, der in diesem Falle zunächst mal nur darin bestand, Zweifel zu säen an vielleicht allzu leichtfertig gewonnenen Urteilen. Angenendt geht es um nicht weniger als um das Verhältnis der monotheistischen Religionen zur Gewalt. Wie ich jetzt weiß, hat er vor zwei Jahren ein Buch mit dem Titel Toleranz und Gewalt erscheinen lassen, das den Weg des Christentums zwischen den Polen Bibel und Schwert nachzeichnet (Münster: Aschendorff, 2007.) Selbst die linke taz kommt nicht umhin, dieser „beeindruckenden Studie“ Anerkennung zu zollen: „Wer über das Verhältnis von eifernder Kreuzzugsmentalität und christlicher Friedensbotschaft, von inquisitorischer Strenge und religiöser Toleranz substanziell mitreden will, kommt künftig um Angenendts Buch nicht herum.“ (Robert Misik: Taufe oder Tod; in: taz v. 5. Januar 2008.)
Ich habe eigentlich nicht mehr für nötig gehalten, Karlheinz Deschners monumentale Kriminalgeschichte des Christentums (1986 ff.) zu lesen. Zu erdrückend erschienen mir schon bei oberflächlicher Betrachtung die Indizien für die Hauptthese, dass das Christentum als größte der Weltreligionen als eine Krankheit zu bewerten ist, vielleicht als eine Kinderkrankheit der Menschheit auf dem Wege zu Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit, viel wahrscheinlicher aber als eine Krankheit zum Tode, die so hartnäckige Schäden verursacht hat, dass eine Umkehr auf dem Weg in den Abgrund selbst bei besserer Einsicht nun unmöglich scheint. Nun aber halte ich es immerhin für nötig, die Faktenlage noch einmal einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Vielleicht kann es tatsächlich sinnvoll sein, Deschner und Angenendt parallel zu studieren.
Posted in Godzilla | Comments Off on Opfer
Thursday, 03. December 2009

Neulich hat irgendein Denkwanst in seinem Pfuijetöngchen gefaselt, das für Empörung sorgende Sarrazin-Interview sei ja „übrigens“ nicht in der seriösen Weltpresse, sondern in irgendeiner exotischen Literaturzeitschrift erschienen, die kaum ein Mensch liest. Ich kann aus dem Gedächtnis nicht mehr rekonstruieren, was der brave Mann damit eigentlich beweisen wollte. Dass ein Blatt von Rang solch hetzerische Ergüsse nie und nimmer verbreitet hätte? Dass ein Blatt mit Stil den Erzeuger dieser Entgleisungen vor sich selbst geschützt und den Abdruck vornehm lächelnd abgeleht hätte? Oder gar, dass an der wortwörtlichen Authentizität der Sarrazinschen Aussagen zu zweifeln sei, weil dieses entlegene Periodikum keine über jeden Zweifel erhabene Provenienz bedeute? (Na, letzteres wohl kaum, denn man hat meines Wissens nicht davon gehört, dass sich das immer noch amtierende Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank nur von einem Jota seiner Einlassungen distanziert hätte. Warum auch? Dieser Mann meint was er sagt. Darum lohnt es sich, ihn zu interviewen. Es werden ja viel zu viele Windbeutel ausgefragt, die kaum was zu sagen haben und dieses wenige noch nicht mal wirklich ernst meinen. Doch das bloß am Rande.)
Die Zeitschrift Lettre International, deren Name durch ein paar griffige und für viele Menschen in diesem unserem weichgespülten Lande provozierende Sätze Sarrazins kurzzeitig in jene Massenmedien geriet, zu denen sie nun selbst so gar nicht gehört, hat von diesem Strohfeuer leider wenig gehabt, weil das Blutblatt am anderen Ende der Erfolgsleiter, die Bildzeitung, dreist genug war, ungefragt nahezu das komplette Interview, das Lettre-Herausgeber Frank Berberich geführt hatte, bei Bild online kostenlos zugänglich zu machen. Daraufhin trafen sich Bild-Chefredakteur Kai Diekmann und Berberichs Anwalt Johannes „Jony“ Eisenberg vorm Landgericht Berlin wieder. Ich könnte jetzt an diesem „Fall Sarrazin“ und seinen Folgen in den Medien und Gerichtssälen unserer Republik wieder einmal exemplifizieren, wie weit unsere „Offene Gesellschaft“ (Karl Popper) mittlerweile, zumindest in ihrer öffentlichen Selbstdarstellung, zu einem Marionettentheater verkommen ist: Der Bild-Boss ist nebenbei taz-Gesellschafter und führt auf seinem Blog das Inventar seiner „Überzeugungen“ per Panoramakameraschwenk durch sein Chefbüro vor. Die taz schmeißt Geld für ein mehrstöckiges Wandbild zum Fenster raus, das sich mit Diekmanns bestem Stück befasst. Da ließe sich doch was draus machen. Aber warum sollte ich? Da für einen nicht unbeträchtlichen Teil der Intelligenz hierzulande dieses Theater offenbar immer noch einen gewissen Unterhaltungswert hat, will ich nicht den Spielverderber spielen – zumal dieser nicht unbeträchtliche Teil ohnehin keinen Anteil nimmt an dem, was ich hier mache. Und das ist auch gut so!
Wie gut meine vornehme Zurückhaltung mir steht, das kann man zum Beispiel ex negativo dem reichlich unglücklichen Bild ablesen, das Berberich vom Lettre bot, als er nicht so recht wusste, ob er Bild verklagen oder dankbar sein sollte für die nie zuvor genossene Prominenz, die ihm das Boulevardblatt für ein paar Tage verschaffte. Noch schlimmer: Er verdankte es genau den ungebärdigsten und unkorrektesten Äußerungen von Sarrazin, wenn eine riesige Zahl von Lesern zum ersten Mal bewusst wahrnahm, dass es eine Zeitschrift namens Lettre gibt – und zwar bereits seit einem Vierteljahrhundert. Worüber aber beschwert sich Berberich in den Interviews, die er zwei Berliner Gazetten (V. i. S. d. P. und tip) gegeben hat? Erstens darüber, dass der „viel umfassendere Kontext“ nicht gewürdigt wurde, in dem das Sarrazin-Interview erschien: „Das Interview war nur ein Text von insgesamt mehr als vierzig.“ Zweitens darüber, dass sich selbst die Redakteure der Berliner Rundfunksender nur mit dem sattsam bekannten halben Dutzend inkriminierter „Stellen“ befassen wollten und sich weigerten, das Interview in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Drittens, dass ihn Bild online bestohlen hat, indem dort das Interview aus Lettre eingescannt und ohne Einwilligung komplett veröffentlicht wurde. Viertens die Doppelmoral und Heuchelei von Bild, wenn Sarrazins Äußerungen einerseits als übelster Rassismus bezeichnet und diese Äußerungen dann zitatweise über Bild online verbreitet werden, um den Traffic auf die Springer-Website zu erhöhen. Fünftens, dass sich an diesem Vorgang zeigt, wie die Alphabetisierung von Journalisten rapide abnimmt und stattdessen in den Redaktionen nicht nur der Revolverblätter reflexhaft drauf los skandalisiert wird, koste es was es wolle.
All diese fünf unbestreitbaren Tatsachen können mich nicht überraschen; bestätigen meine Sicht der Dinge, die dessen nicht bedarf; sind so aufregend wie die Nachricht, dass man im Regen nass wird.
Klar, manche konkreten Beispiele haben immer wieder einen gewissen Reiz. Ein Beispiel. Sarrazin hatte wörtlich gesagt: Eine große Zahl von Türken hat keine produktive Funktion, außer für den Obst- und Gemüsehandel.“ Dazu fällt dem Magazin stern – das es tatsächlich immer noch gibt, wie ich bei dieser Gelegenheit erfahre – folgendes ein: „Was Sarrazin ausgerechnet gegen die Obst- und Gemüsehändler hat, ist schleierhaft.“ (Ich hoffe, dass mein Leser zu würdigen weiß, wie ich in einem solchen Nullsummenspiel doch noch auf meinen kleinen Profit komme.)
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Sarrazin bei Lettre
Friday, 27. November 2009

Seit Langem schon ersehne ich eine einfache technische Lösung für folgendes Problem. Die besten Einfälle kommen mir unterwegs. Offenbar hat das Gehen genau jene altbekannte fördernde Wirkung auf den Fluss meiner Gedanken, die schon die alten Peripatetiker so zu schätzen wussten. (Ich weiß, ich weiß, die unmittelbare Ableitung ihres Namens vom griechischen Wort für „umherwandeln“ gilt längst als widerlegt. Man kann diese Art etymologischer Spielverderberei auch zu weit treiben. Bücher à la 1000 verbreitete Irrtümer über … gehen mir längst schon ganz entschieden auf den Keks. Da feiert die Besserwisserei fröhliche Urstände, Hänschen Schlau kann sich auf der Party seines Chefs nach Strich und Faden unbeliebt machen und die Umstehenden gähnen sich ‘nen Wangenkrampf.)
Papier und Bleistift trage ich für den dringendsten Fall der Fälle zwar auf allen meinen Wegen bei mir, aber das Hervorkramen des Schreibzeugs und das Suchen nach einer geeigneten Schreibunterlage, zumal wenn meine Hände mit Schirm- und Taschentragen ausgelastet sind, ist mir in den übrigen neunundneunzig Fällen geistreicher Eingebungen doch zu umständlich. Darum habe ich mir schon vor Jahr und Tag einen handlichen Digital Voice Recorder zugelegt. Gewöhnliche Zeitgenossen hätten dergleichen gar nicht nötig, da längst jedes handelsübliche Handy über Aufzeichnungsmöglichkeiten für Schrift und Stimme verfügt. Da ich aber, wie hier gelegentlich eingestanden, kein Funktelefon mein eigen nenne, war diese Spezialanschaffung nötig. Leider erwies sich das von mir erworbene Aufnahmegerät PA-VR10E als dermaßen kompliziert in der Handhabung, dass ich es bisher noch nie zur Anwendung gebracht habe. Bevor ich es nun aber auf einen Rechtsstreit mit der Firma Sharpe ankommen lasse, gestehe ich umstandslos, dass die Schuld allein bei mir liegt, weil ich zwar ein fleißiger Leser bin, aber mit einer Ausnahme: Bedienungsanleitungen.
Und so ist zu beklagen, dass in den vergangenen Jahren eine Unzahl mindestens talentierter, gelegentlich vielleicht sogar genialer Ideen dem restlosen Vergessen anheim fielen. Dies ist allein schon schlimm genug, für mich als den Verursacher und – durch entgangenen Ruhm – Hauptbetroffenen ebenso wie für den Rest der Menschheit, der vielleicht auch etwas davon gehabt hätte. Noch schlimmer, nämlich geradezu unerträglich waren aber jene Vergessensfälle, bei denen der Schatten einer Ahnung in meinem Gedächtnis zurückblieb, gerade deutlich genug, um seinen Konturen ablesen zu können, dass es sich bei dem Vergessenen um eine wahre Kostbarkeit gehandelt haben musste.
Ein Beispiel aus aktuellem Anlass. Einmal, vor etwa vier Jahren, fischte ich aus dem Wühltisch der Buchabteilung eines hiesigen Kaufhauses ein schmales Bändchen heraus, dessen Autor mir nichts sagte, dessen Umschlag mich nicht sonderlich ansprach, dessen Titel mich aber berührte. Ich schlug es willkürlich auf und las mich sofort fest. Es ging um Golf, um ein Duell zwischen dem Ich-Erzähler und seinem Lehrer, um eine schöne Frau, die beide mit ihrem Spiel zu beeindrucken suchten. Die Geschichte war so komisch, dass ich laut lachen musste. Was war denn das für ein Roman? Im Klappentext die üblichen, übertrieben hymnischen Zitate aus nicht genau nachgewiesenen Rezensionen, von der „außergewöhnlichen Aura“ war die Rede, die den Texten des Autors durch seine „radikale Selbstironie“ verliehen werde. Ich wollte das Bändchen zum Ramschpreis von 3,50 € erstehen, aber um die Kasse ringelte sich eine lange Warteschlange und ich hatte eine Verabredung, bei der ich mich unter gar keinen Umständen verspäten durfte. So legte ich das Buch zurück auf den Wühltisch, vergrub es sicherheitshalber unter der Dutzendware, die hier sonst noch feilgeboten wurde und beschloss, später wiederzukommen.
Später hieß dann allerdings ganze vier Tage später, denn in diesen vier Tagen ereigneten sich etliche unvorhergesehene private Katastrophen, die mich keine Minute ruhen ließen. Als ich wieder Atem schöpfen konnte, fiel mir zuallererst das Buch auf dem Wühltisch ein. Zu meiner großen Enttäuschung stellte sich heraus, dass es mir ein anderer Kunde weggeschnappt haben musste. Alle Bemühungen, es durch Recherchen in Verlagsverzeichnissen und Bibliographien zu ermitteln, schlugen fehl. Auch meine Erinnerung an die Umschlaggestaltung [s. Titelbild] war zu blass, um bei einem der befragten Buchhändler einen Geistesblitz des Wiedererkennens auszulösen. Ich erinnerte mich sogar an ein Detail aus der Kurzvita des Autors, das ich ebenfalls dem Klappentext entnommen hatte: Er war verhältnismäßig jung bei einem Verkehrsunfall zu Tode gekommen. Nein, es war nicht Rolf Dieter Brinkmann. Auch nicht Jörg Fauser. – Vor wenigen Tagen, durch einen unwahrscheinlichen Zufall, habe ich das Buch nun wiederentdeckt. Es ist tatsächlich grandios! Vielleicht so grandios wie tausend andere verlorene und vergessene Gedankengüter, die mir im Unterschied zu diesem auf immer entzogen bleiben.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Verloren
Monday, 23. November 2009

Dass die Informationsflut in einem durch Landflucht der Intelligenz, Zensur und Papierknappheit ausgedörrten Land als vom Himmel der Demokratie gesandter Segen empfunden wird, das konnten wir im Westen Deutschlands nach 1945 erfahren, und nach 1989 noch einmal in dessen Osten. Dass diese Flut aber auch zu einem Problem werden kann, wenn nämlich jede Übersicht verlorengeht und das ununterscheidbare Einerlei von „Fakten, Fakten, Fakten“ (Helmut Markwort vom Magazin Focus) keinen klaren Gedanken mehr ermöglicht, schon erst recht keine Meinungsbildung zur Vorbereitung einer Handlungsentscheidung, das ist den kritischen Beobachtern der Entwicklung unserer Informationsgesellschaft auch nicht verborgen geblieben.
Mein Bedürfnis als Empfänger und Nutzer von Informationen ist in dieser Situation, mit einem qualitativ hochwertigen Input versorgt zu werden. Er muss mein jeweiliges Erkenntnis- oder Erlebnisinteresse so schnell, so gründlich und so richtig wie möglich befriedigen. (Die Unterscheidung von Erkenntnis und Erlebnis führe ich hier mit Bedacht ein, um bewusst zu halten, dass in den medialen Kanälen ja nicht nur Information, sondern auch Unterhaltung transportiert wird, wobei beides – Stichwort: Infotainment – ineinander übergehen kann.) Um diesem Anspruch zu genügen, gilt es seitens des Lieferanten eine ganze Reihe hergebrachter Kriterien zu erfüllen, von denen einige präzise bestimmt sind (zum Beispiel die Rechtschreibung oder die Überprüfbarkeit von Tatsachenbehauptungen durch nachvollziehbare Quellenangaben), andere immerhin noch mit Vorbehalt von Ermessensspielräumen einigermaßen verbindlich bewertet werden können (wie etwa ein dem Thema adäquater Stil oder eine transparente Struktur des Textes). Als Leser habe ich mit der Zeit verschiedene Methoden zur schnellen Abschätzung der Qualität von Texten entwickelt. So weiß ich, dass ich einer Nachricht in der Süddeutschen Zeitung eher vertrauen kann als einer in BILD. Ich weiß, dass mein persönliches Unterhaltungsbedürfnis im Deutschlandfunk besser befriedigt wird als bei Radio Essen. Und im Internet vertraue ich einem Artikel in Wikipedia eher als einer anonymen Meinung in einem Webforum.
Und jetzt wird’s langsam spannend. Denn in den beiden ersten Fällen (Presse und Rundfunk) leite ich meine Einschätzung aus einer allgemeinen Bewertung der jeweiligen Quelle ab. Das funktioniert im Internet noch bei Wikipedia, wo mich fachkundige Urteile und eigene Erfahrungen mittlerweile dazu gebracht haben, auf die Nutzung meiner Printlexika nahezu ganz zu verzichten. Aber die große bunte Welt der Foren ist so unübersichtlich und unspezifisch, dass eine Orientierung auf gewohnte Weise unmöglich ist. Hier muss ich mich auf mein eigenes, notwendig flüchtiges Urteil verlassen, indem ich beispielsweise schon aus der Artikulationsfähigkeit eines Autors darauf schließe, wes Geistes Kind er ist. Dass sich hier Fehlbewertungen einschleichen können, sei unbenommen. Aber man wird sehr viel Zeit (und möglicherweise sogar Geld) verlieren, wenn man jedem sekundären Analphabeten vertraut, der im Schutze seiner Anonymität Unsinn stammelt, etwa ein todsicheres Lottosystem zu verkaufen sucht. Solche kriminellen Angebote sollten im Internet sogar ganz unterbunden werden, wenn es denn irgend möglich ist, denn die Meinungsfreiheit findet eben genau da Grenzen, wo sie zu verbrecherischen Zwecken missbraucht wird.
Dies alles rufe ich in Erinnerung, weil ich in den letzten Tagen gleich zweimal über vermutlich gut gemeinte Freiheitskredos gestolpert bin, deren Naivität mich zu energischem Widerspruch reizt. So schreibt ein unbekannter Freund von Wiki-Waste im Kommentar zu meinem Beitrag über das Relevanz-Gebot bei Wikipedia: „Selbst der primitivste Artikel bei Wiki-Waste ist besser als der Artikel, den es gar nicht gibt. Jeder Wiki-Waste-Artikel ist der beste Wiki-Waste-Artikel zum jeweiligen Thema. Und zwar so lange, bis dieser Artikel von jemandem noch besser gemacht wird. (So ähnlich wie Persil.)“ Wenn dies so wäre, könnte man auch sagen: ,Jede Aussage zu etwas ist besser als keine Aussage. Auch eine falsche Aussage ist besser als keine. Und zwar deshalb, weil sie ja berichtigt werden kann.‘ Wenn das so ist, dann würde ich in einem Wiki-Artikel über Arsen erläutern, dass es sich beim Giftverdacht gegen diese Substanz um ein reines Vorurteil handelt. Die bis zur Korrektur des Artikels angefallenen Leichen hätte dann unser anonymer Freiheitskämpfer zu verantworten. Prinzipell und ernsthaft will ich zu der gegenwärtigen Relevanz-Diskussion um Wikipedia aber noch sagen, dass dieses Schmuckstück im Internet seine mühsam errungene Reputation und Glaubwürdigkeit augenblicklich wieder verlieren würde, wenn es Artikel wie die in Wiki-Waste aufbewahrten zuließe.
Ich hätte hierüber nicht erneut geschrieben, wenn mir nicht eine zweite Textstelle zum gleichen Thema, diesmal aus vermeintlich seriöserer Quelle, den Anlass dazu gegeben hätte. Dort heißt es: „Mehr ist mehr – es gibt kein Zuviel an Information. – Es waren einst Institutionen wie die Kirche, die der Macht den Vorrang vor individueller Informiertheit gaben und bei der Erfindung des Buchdrucks vor einer Flut unüberprüfter Information warnten. Auf der anderen Seite standen Pamphletisten, Enzyklopädisten und Journalisten, die bewiesen, dass mehr Informationen zu mehr Freiheit führen – sowohl für den Einzelnen wie auch für die Gesellschaft. Daran hat sich bis heute nichts geändert.“ Nachzulesen ist dieser historische Beweis für die Legitimation zur massenhaften Erzeugung und weltweiten Verbreitung von Datenmüll in einem Internet-Manifest, das 15 Webautoren Anfang September in einem neuen Netzpolitikwiki online gestellt haben. Ich kann auch solch holzschnittartige Argumentationen bloß mit gleicher Münze heimzahlen, zu mehr gebricht es mir an Zeit und guter Laune. Darum dies hier: Mundus vult decipi, „die Welt will betrogen sein“, wie schon der Kardinal Carlo Caraffa Mitte des 16. Jahrhunderts treffend bemerkte. In dieser nicht allzu fernen Zeit besorgten die Betrügerei noch die Mächtigen, heuer hat man es aller Welt selbst überlassen, sich gegenseitig zu betrügen und sich in den Netzen der Unübersichtlichkeit zu verfangen, im World Wide Web. Daran hat sich also doch etwas geändert. (Bezeichnend übrigens, dass einer der wenigen beredten Kritiker des Manifests ein Blogger ist, der sich das Ringen um klare und verständliche Sprache zur Aufgabe gemacht hat.)
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Sunday, 22. November 2009

Noch ein letztes Mal zu Silvia Bovenschen. Im erwähnten TV-Interview fragt Denis Scheck die Autorin nach dem literarischen Initiationserlebnis ihrer Jugendzeit, so wie etwa ihm selbst Arno Schmidt klargemacht habe, dass Sprache noch etwas anderes könne als nur Informationen transportieren. Bovenschen verweigert die Antwort mit der etwas kruden Erklärung, in ihrem Falle seien das in verschiedenen Lebensaltern ganz unterschiedliche Bücher gewesen. Es hätte sie doch wirklich nicht viel Mühe gekostet, ein paar Beispiele für diese verschiedenen Lebensalter und die zugehörigen Bücher preiszugeben und so die Neugier des Fragers und seines Publikums mindestens durch eine Geste guten Willens wenn nicht zu stillen, so doch zu beschwichtigen. So aber wirkt die etwas brüske Verweigerung wie eine Geheimniskrämerei. Zur Not könnte man sie sich noch damit erklären, dass vielleicht mit den Initiationserlebnissen von Silvia Bovenschen in einem solchen Interview kein Staat zu machen ist, weil sie beispielsweise zu wenig originell oder erklärungsbedürftig sind.
Gerade bei Interviewfragen, die unbeantwortet bleiben, kann ich der albernen Versuchung nicht widerstehen, mir auszumalen, welche Antwort ich an der Stelle des Befragten denn gegeben hätte. Ich müsste dann im Vorschulalter, bei Wilhelm Busch, Karl May und, horribile dictu, Wilhelm Matthießens Das rote U beginnen und nach einer langen Liste untereinander völlig unverträglicher Namen und Werke vorläufig bei Alfred Polgar, Victor Auburtin und Franz Hessel enden. Ob diese Begegnungen mit ganzen Heerscharen von Vorgängern aber jede für sich als „Initiationserlebnisse“ zu bezeichnen wären, halte ich für mehr als fragwürdig. Inspirationsquellen, das träfe es schon eher.
Denn initiiert wird man doch, bei Licht betrachtet, in seinem Leben nur wenige Male, wenn nicht gar nur einmal. Der klassische Fall ist der Übertritt von der Jugend ins Erwachsenenalter, wenn wir uns von vorwiegend Nehmenden zu Gebenden wandeln; oder eben von Lesenden zu Schreibenden. Dann hätte ich klar und deutlich Franz Kafka nennen müssen, speziell den Roman Amerika, der heute unter dem Titel Der Verschollene gehandelt wird.
Ich setze jetzt mal die Brille ab und wechsele die Brennweite. In der gestrigen ZEIT berichten Florian Illies und Stefan Koldehoff von dem hässlichen Streit, der zwischen dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar und dem Staat Israel über die Besitzansprüche an Manuskripten Franz Kafkas entbrannt ist. Dieser Streit interessiert mich nicht sonderlich, denn von Kafka ist alles Erhaltene veröffentlicht, kein Autor des 20. Jahrhunderts ist so ausgeforscht wie Kafka. Insofern ist es relativ gleichgültig, wo diese Manuskripte aufbewahrt werden, wenn es nur kein Archiv auf schwankem Grunde ist wie in Köln.
Aber am Rande dieses Artikels wird eine Seite aus einem Dokument faksimiliert, die meine Aufmerksamkeit fesselt. Es handelt sich um eine Inventarliste des Archivs von Kafkas Freund Max Brod, das heute in einer Zürcher Bank verwahrt wird, in einem Schließfach mit der Nummer 6588. Dort sind auch „Fotokopien von Briefen Theodor Lessings an Max Brod (insgesamt 5 Briefe 1922-1933)“ aufgelistet, von deren Existenz ich bis heute nichts wusste (vgl. ZEIT Nr. 48 v. 19. November 2009, S. 48). Theodor Lessing ist im Unterschied zu Kafka ein noch immer verschollener und vergessener Autor, trotz der Bemühungen seines Biographen Rainer Marwedel und mehrerer Verlage, von Rütten & Loening über Matthes & Seitz bis hin zum Superbia-Verlag, die mit viel Fleiß und Idealismus trachteten, sein so außergewöhnliches wie vielseitiges Werk nach dem Krieg wieder bekannt zu machen. Lessings Korrespondenz ist teilweise im Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien e. V. in Potsdam aufbewahrt. Ich vermute, dass die fünf Briefe an Max Brod den Theodor-Lessing-Forschern bislang unbekannt waren. Bin ich vielleicht der Erste, der nun beiläufig auf sie aufmerksam wird? Und wem könnte dieses Wissen nützen? – Ich setze die Brille wieder auf und gehe mit D. P. in den Wald, wo ich diesen Zufallsfund augenblicklich vergesse. Auf einer Bank [s. Titelbild] geht mir stattdessen ein Satz aus einem Brief Kafkas an Max Brod durch den Kopf, den ich im gleichen Artikel gelesen habe: „Ich kenne andeutungsweise die Schrecken der Einsamkeit, nicht so sehr der einsamen Einsamkeit, als der Einsamkeit unter Menschen.“
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Blickweiten (I)
Saturday, 21. November 2009

Erst nach Beendigung meines Wer–Weiß–Was–Lektüreberichts entdeckte ich das Interview, das Silvia Bovenschen dem womöglich momentan gewieftesten Literaturpropagandisten unterm Tarnkäppchen der Kritik in Feuilleton, Funk und Fernsehen, Denis Scheck (* 1964), auf der Frankfurter Buchmesse gewährt hat und das man nun in voller Länge online anhören, -sehen und -staunen kann.
Zu Beginn gleich ein Gutes, was über dieses Gespräch zu sagen ist: Es ist lang! Das ist insofern erfreulich, weil es den nötigen Raum lässt für allerlei Randständiges, das nicht unmittelbar und schnurgerade auf die Frage abzielt, ob sich die Neunzehneurofünfundneunzig für das vorgestellte Buch denn nun lohnen oder nicht. Und gerade diese Nebensächlichkeiten an der Peripherie sind die unerwarteten Tinten- oder meinetwegen – schließlich geht es ja um einen Krimi – Blutkleckse, die das zuvor gemachte Bild vom Buch und mehr noch von seiner Autorin um ein paar überraschende Akzente bereichern. Gerade auf der Buchmesse werden ja unzählbare, unerträgliche, unnötige Un-Gespräche geführt, zwei- bis vierminütige Small Talks, die im ganz wörtlichen Sinne im Vorbeigehen entstanden sind, aber auch insofern, als sie nur ein Aneinandervorbeireden dokumentieren, im Rhythmus eines gut gelaunten, scharf beschleunigten Aneinandervorbeifragens und -antwortens.
Hier aber findet die Autorin fast eine halbe Stunde lang Zeit und Gelegenheit, etwas über das Interieur ihres Elternhauses zu erzählen, über grottenschlechte Impressionisten an den Wänden und über die unterschiedlichen Bücherstapel auf den Nachttischen von Mama und Papa Bovenschen, hie Proust und Daphne du Maurier traulich vereint, dort zwei Stapel über die Kunst der Hethiter [s. Titelbild], worin sie die katholische und die protestantische Variante des Bildungsbürgertums repräsentiert sieht; und schließlich findet sie Zeit zu einer längeren declaration of human faults, die ich gern einmal als kleine Kostprobe in ganzer Länge wiedergeben will.
Scheck hatte gefragt, ob wir wirklich so dämlich und beschränkt seien wie die Menschen in Bovenschens Roman, wofür sie dort von den vier Außerirdischen zu Recht verworfen werden, worauf die Autorin erwidert: „Na ja, wenn ich mir das so anschaue, was in einigen Weltgegenden und zuweilen auch bei uns so passiert, denke ich, mit dieser Gattung kann nicht sonderlich viel los sein, und dann kommt es mir auch so vor, als wären wir eher so eine ,Panne der Evolution‘ als die ,Krönung‘ irgendeiner ,Schöpfung‘ … und ich denke, diese Schwärze ist auch in mir. Also, ich will das nicht leugnen: Ich habe die pessimistischsten Annahmen über die Natur des Menschen. – Aber ich habe natürlich auch … ich habe eine Liebe zu vielen Dingen, ich habe eine Liebe zu vielen Menschen, ich finde, dass es so etwas gibt wie Schönheit. Und das besteht unversöhnt in mir, nebeneinander, ich will da auch nichts versöhnen, und vielleicht geht all mein Schreiben darauf hinaus, und das literarische Schreiben gönnt mir im Unterschied zum theoretischen oder essayistischen die Möglichkeit, das nebeneinanderher laufen zu lassen, also da nicht ,einerseits – andererseits‘ sagen zu müssen oder ,dialektischerweise‘ oder irgendsowas, ja? Sondern ich kann das nebeneinander hart stellen, und dann kann sich jeder das heraussuchen, wozu er neigt. Also ich kann das in mir nicht versöhnen – das ist eine private Antwort, die ich ihnen da gerne gebe – und will es inzwischen auch nicht mehr in mir versöhnen.“ (Denis Scheck: Interview mit Silvia Bovenschen vom 16. Oktober 2009 © ARD.)
Ganz werde ich den Verdacht nicht los, als sei diese Melancholie, die hier beschrieben ist, schon dem Kind Silvia Bovenschen einverleibt gewesen. Über dieses, so Bovenschen wörtlich, „eklige“ Kind sagt sie rückblickend einen Satz, der in seiner Unbarmherzigkeit kaum zu überbieten ist und der im angeregten Geplaudere über ein anregendes Buch am Rande einer maßlosen Messe wohl unterging, weshalb ich ihn hier für die Ewigkeit retten möchte. Sie sagt den Satz: „Ich hätte mich nicht gehabt haben mögen.“
[Titelbild von Noumenon v. 13. Juli 2007: “A rather close up photograph of Eflatunpinar’s main part. Eflatunpinar is a Hittite site found in modern Beyşehir district of Konya/Turkey.” GNU Free Documentation License.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Unversöhnt
Wednesday, 18. November 2009

Mein liebstes Nachschlagewerk zum Allgemeinwissen, die gemeinnützige Wikipedia, sammelt wieder einmal Spenden. Wer dem Aufruf folgt, darf auch gern einen Kommentar hinterlassen: „Haben Sie einen Gedanken, den Sie der Welt mitteilen möchten? Sie können bis zu 200 Zeichen eingeben.“ Wikimedia Deutschland freut sich über Spenden in jeder Höhe, die Beträge von 25, 50, 75 und 100 € sind voreingestellt, es darf aber auch gern ein bisschen mehr sein.
Schaut man sich die Kommentarliste im Spendenticker etwas genauer an, dann stolpert man immer wieder einmal über einen vermeintlichen Knauser, der gerade eben 1 € locker macht. Tatsächlich dient diese eher symbolische „Spende“ aber nur als Eintrittsgeld für jene kritischen Zeitgenossen, die die Gelegenheit nutzen, ihren Frust über die gegenwärtige Entwicklung bei Wikipedia abzuladen. So schreibt heute ein anonymer Spender, es gehe dort neuerdings zu „wie bei Aschenputtel: Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Relevanz bei Wikipedia, Platz für Irrelevanz bei Wiki-Waste.“
Wiki-Waste? Diese streitbare Website im Wiki-Format versteht sich als eine Art Schrottplatz für alles, was aus der deutschsprachigen Wikipedia rausgeschmissen wurde. Gut, das klingt zunächst in meinen Ohren sympathisch, bin ich doch jeder Verschrobenheit und Fliegenbeinzählerei gegenüber prinzipiell aufgeschlossen. Allerdings hat mir die Wikipedia gegenüber den meist bierernsten Print-Enzyklopädien gerade deshalb imponiert, weil sie eben auch abgelegenste Forschungsgegenstände respektiert und zudem ein weites Herz hat für jede Art von Scherz, Satire und Ironie, vorausgesetzt, dass eine tiefere Bedeutung dabei nicht ganz aus dem Blick gerät. So findet sich dort selbstverständlich ein ausführlicher Artikel über die putzigen Nasenschreitlinge (lat. Rhinogradentia), und wer nach der berühmten Steinlaus (lat. Petrophaga loriori) sucht, beißt ebenfalls nicht auf Granit. Um was für Artikel handelt es sich nun aber, die nach dem Urteil der empörten Streiter wider die Zensur bei Wikipedia vor die Tür gesetzt wurden? Wer das unbedingt wissen will, der wird nun bei Wiki-Waste fündig. Ob er dort glücklich wird oder wenigstens fröhlich, das möchte ich allerdings bezweifeln.
Ein paar Kostproben gefällig? Dem Rotstift zum Opfer fiel beispielsweise der Artikel über das „Pallindrom“, einfach deshalb, weil es sich „Palindrom“ schreibt, da beißt nun mal keine Steinlaus den Faden von ab. Kymbrisch ist eine Sprache? Nein, aber Kymrisch ist eine Sprache. Interessanter wird’s schon, wenn ansonsten unbekannte Personen oder Körperschaften durch einen beauftragten oder selbst erstellten Wikipedia-Artikel auf sich aufmerksam zu machen versuchen, aus Eitelkeit oder Geschäftsinteresse Popularität vortäuschen oder erlangen wollen oder gar sich selbst oder ihre Produkte auf diesem Wege kostenlos zu bewerben trachten. Eine ganze Reihe von gelöschten Beiträgen in Wiki-Waste riecht verdächtig nach dieser Sorte Schleichwerbung, z. B. die über Zenvo Automotive, den „Tapgitarristen“ Mathias Sorof oder den Engelberger Klosterbrotverfeinerer Heinrich Hess, dessen Nachfahren meinetwegen emsige Genealogen sein mögen, aber wen juckt’s?
Ins Straucheln komme ich aber mit meinen Vorbehalten gegen den Eifer der Wikiwastianer, wenn ich einen so rührend emsigen Artikel wie den über Akashlina lese. Der Autor ist erkennbar kompetent und der behandelte Gegenstand kann bei der Fülle der Belegstellen unmöglich gänzlich irrelevat sein. So wird sich doch wohl in Dreiteufelsnamen jemand finden, der den Text und auch das Gedicht von [s. Titelbild] Jibanananda Das (1899-1954) in verständliches Deutsch überträgt, oder?
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Tuesday, 17. November 2009

Worüber ich einmal gebloggt habe, das vergesse ich so schnell nicht. Vor ein paar Tagen tauchte der Name der kubanischen Bloggerin Yoani Sánchez (* 1975) wieder in den Medien auf (vgl. Peter Burghardt: Neue Angst. Kubas berühmteste Bloggerin wird entführt, beleidigt, geschlagen; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 262 v. 13. November 2009, S. 15). Im Mai vorigen Jahres hatte ich über Sánchez berichtet, weil sie vom US-amerikanischen TIME magazine auf seine „Liste der 100 einflussreichsten Leute der Welt“ gesetzt worden war.
Das Castro-Regime macht der couragierten Kritikerin im eigenen Lande nach wie vor mit allen Mitteln das Leben schwer. Neulich beschrieb sie in einem Interview, welche Mühen es sie kostet, überhaupt einen Beitrag in ihrem eigenen Blog zu publizieren: „Grundlegend ist, dass ich wegen der langsamen Internet-Verbindungen auf Kuba vor allem offline arbeite. Weil ich zu Hause legal keinen Internet-Zugang haben darf, schreibe ich Texte auf meinem PC, speichere sie auf einem USB-Stick und stelle sie dann in einem der öffentlich zugänglichen Internet-Cafés online – und das möglichst schnell, weil es für mich ziemlich teuer ist. Am Anfang konnte ich den Blog noch selbst verwalten. Ende März vergangenen Jahres wurden von der Regierung aber Filter installiert, die das unmöglich machten.“ (Ole Schulz: „Die Revolution ist gestorben“. Interview mit Yoani Sánchez; in: Focus Nr. 14 / 2009 und online.)
Vor ihrem Haus treiben sich immer wieder finstere Gestalten herum, die sie einschüchtern wollen. Am Freitag, dem 6. November 2009 kam es nun zu einem massiven Übergriff, bei dem Sánchez um ihr Leben fürchtete. Unbekannte Täter wollten sie daran hindern, an einer Anti-Gewalt-Demonstration teilzunemen, die an diesem Tag in Havanna stattfand. Sie zerrten sie und ihren Begleiter Orlando Luis Pardo in ein Auto. Was dort geschah, beschreibt das Entführungsopfer auf ihrem Blog so: „Im Auto war schon Orlando, unbeweglich gemacht durch einen Karategriff, der ihn mit dem Kopf am Boden festhielt. Einer setzte sein Knie auf meine Brust, der andere schlug mir vom Vordersitz aus in die Nierengegend und auf den Kopf, damit ich den Mund öffnete und das Papier freigäbe. In einem Augenblick hatte ich den Eindruck, ich würde nie mehr aus jenem Auto herauskommen. ,Bis hierher haben wir es dir durchgehen lassen, Yoani. Jetzt ist Schluss mit deinen Mätzchen,‘ sagte der, der neben dem Fahrer saß, wobei er meinen Kopf an den Haaren hochzog. Auf dem Rücksitz lief ein seltsames Schauspiel ab: Meine Beine nach oben gestreckt, mein Gesicht gerötet vom Blutdruck und am ganzen Körper Schmerzen, auf der anderen Seite befand sich Orlando, in Schach gehalten von einem professionellen Schläger. In einem Akt der Verzweiflung schaffte ich es, diesen Mann durch seine Hose hindurch an den Hoden zu packen. Ich krallte meine Nägel hinein, da ich glaubte, er würde meine Brust bis zum letzten Seufzer abquetschen. ,Bring mich schon um‘ rief ich ihm zu, mit dem letzten Atemzug, der mir blieb, und derjenige, der vorne mitfuhr, riet dem Jüngeren: ,Lass sie atmen!‘“ (Nach der deutschen Übersetzung von Iris Wißmüller aus Yoani Sánchez‘ Blog Generation Y.)
Schließlich wurden beide mit körperlichen und seelischen Verletzungen wieder freigelassen. Offenbar hat die internationale Popularität der Freiheitskämpferin die Auftraggeber dieses Kidnappings dann doch vor der letzten Konsequenz zurückschrecken lassen.
Der Mut und die unverbrüchliche Treue zu den eigenen Überzeugungen, die mit wachsendem Druck von außen eher noch erstarken, müssen das Herz jedes freiheitsliebenden Menschen erfreuen. Kaum war der erste Schreck überwunden, da meldete sich Yoani Sánchez im Web zurück. Und wieder applaudierten ihre zahllosen anonymen Sypathisanten in Kuba und aus aller Welt in den Kommentaren des Internet, machten ihr Mut und feuerten sie an. Dieser Aufstand begeistert nicht nur durch seine Gewaltfreiheit, sondern auch durch seinen Humor. Im Handumdrehen wurde das Verbrechen in einem Comic dargestellt; und der Lebensgefährte der Bloggerin, der Journalist Reinaldo Escobar (* 1947), fordert einen mutmaßlichen Agenten des kubanischen Staatssicherheitsdiensten namens „Rodney“ [s. Titelbild] zum Duell – aber ganz unblutig, nur mit Worten.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Lass‘ sie atmen
Monday, 16. November 2009

Na, um das gleich vorauszuschicken: Nachdem ich das Buch aus der Hand gelegt hatte, blieb leider, leider doch eine kleine Enttäuschung, wie nach einer verpassten Chance. Der ganz großartige Wurf ist Silvia Bovenschen mit ihrem in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlichen Kriminalroman Wer Weiß Was leider dann doch nicht gelungen.
Vielleicht liegt das daran, dass sie dem Buch zu viel aufgebürdet hat. Es sollte Rätsel sein („Wer hat’s getan?“), Milieustudie und Gesellschaftskritik, Vielfältigkeitsprüfung einer begabten Charakterzeichnerin und intelligente Parodie auf die Gattung. Es sollte uns das alte Thema von Schuld und Freiheit des Willens, Sühne und Vergebung noch einmal in vollem Ernst nahebringen, um es fast im gleichen Atemzuge durch den Kakao zu ziehen. Und es sollte dies alles in einem streng berechneten, um kein Wort verlegenen und doch kein Wort verschwendenden, wahrhaft meisterlichen Tonfall tun.
Vielleicht ist es symptomatisch, dass der ansonsten sorgsam lektorierte Roman zum Ende hin dann doch ein paar Fehlerchen aufweist (ein überzähliges „sie“ auf S. 256, Z. 22; „im panisch verschlechtertem [!] Zustand“, S. 262, Z. 8/9; „Gott sein [!] Dank“, S. 270, Z. 32), gipfelnd in dem schrecklich falschen Satz: „Diese Frau, überlegte sie jetzt, die in ihrem strengen schwarzen Kostüm vor mir sitzt, sorgsam gekleidet und gepflegt, doch nur, um eine textile und kosmetische Sperre zwischen ihr [!] leibliches [!] Sein und das [!] der anderen zu errichten, macht den Eindruck“ usw. – Ich vermute mal, an der Stelle von „zwischen etwas errichten“, was ja unbedingt den Dativ nach sich ziehen muss – „zwischen ihrem leiblichen Sein und dem der anderen zu errichten“ – hat hier ursprünglich ein anderes Verb gestanden, z. B. „zu setzen“ oder „zu stellen“.
Das ist freilich nur eine dumme Kleinigkeit, aber sie deutet doch darauf hin, dass Autorin und Verlag zuletzt unter Zeitdruck gearbeitet haben. Ich möchte mir, weil ich anfänglich so positiv voreingenommen für Wer Weiß Was war, mit gutem Willen ausmalen, was aus dem Buch hätte werden können, wenn die Autorin die Courage und Geduld aufgebracht hätte, ihren Verlag gegen alle Abmachungen zu vertrösten, um noch ein Vierteljährchen auf die Fertigstellung und den letzten Schliff zu verwenden.
Aber so funktioniert der Literaturbetrieb bekanntlich nicht. Da wird knapp kalkuliert, mit der Zeit – und leider auch mit den Mitteln für die Ausstattung. Dieses Buch ist, was den materiellen Aspekt betrifft, wieder ein trauriges Beispiel für billiges Blendwerk. Gegen Pappdeckel als Einbandmaterial will ich ja gar nichts sagen, aber dass die Fadenheftung wie so oft nicht dransitzt, das schmerzt. Schon nach meiner ersten, wahrlich schonenden Lektüre ist das Buch schiefgelesen und wird auch so bleiben, wie jeder Kenner weiß. Aber die Laien sind in der überwältigenden Überzahl und lassen sich von den völlig überflüssigen Lesebändchen beeindrucken. (In diesem Fall ist’s gar ein goldenes.) Ach, das ist so traurig und steht in eklatantem Missverhältnis zur – bei allen kleinen Einschränkungen – hohen Qualität des Inhalts. Was kann man da nur tun? Was weiß ich!
[Titelbild: Porträtfoto Silvia Bovenschen von Jürgen Bauer im Umschlag ihres vorletzten Buches Verschwunden. © S. Fischer Verlag.]
Posted in Würfelwürfe | 1 Comment »
Monday, 16. November 2009

Heute las ich zum zweiten Mal bei „Generationen betrachten“ in Oberhausen. Knapp zwanzig Zuhörer, darunter nur drei oder vier Männer. Die Kundenzahlen in den Buchhandlungen, wo zwei Drittel der Romanleser Leserinnen sind, weisen in die gleiche Richtung: Die kulturelle Schwindsucht breitet sich vom maskulinen Rand des Humanen her aus. Auch insofern bin ich mal wieder eine der Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Etwas mulmig ist mir dabei schon vor diesen Damenkränzchen.
Immerhin freut mich, dass ich es offenbar nicht allen recht machen konnte, sonst hätte ich an mir selbst zweifeln müssen: Vier Besucherinnen verabschiedeten sich unter vernehmbaren Missfallenskundgebungen in der Pause. Ich würde zu viel reden und zu wenig lesen, sowas stelle man sich doch nicht unter „Vorleseabend“ vor. Und dafür acht Euro Eintritt! Das passte nun allerdings so zauberhaft zu Johann Peter Hebels Kalendergeschichte vom Seltsamen Spazierritt, die ich eingangs zum Besten gegeben hatte, dass ich mit einem Schmunzeln zur Tagesordnung übergehen und meinen letzten Programmpunkt, Hans Carl Artmanns zotige Geschichte How much, schatzi?, vom Leder ziehen konnte.
Ich hatte die Veranstaltung unter den Titel „Glück im Unglück“ gestellt, als mir noch kein Schimmer aufgegangen war, was ich lesen würde. Tatsächlich verlegte ich mich bei der Textauswahl dann auf meine brandaktuellen Favoriten respektive Neuentdeckungen: Emmanuel Bove (durch Harald Wiesers Vermittlung in Menschen und Masken), Gisela Elsners Schrauben-Text (leicht gekürzt) und Was ist denn? von Raymond Carver. Gern hätte ich auch aus dem Krimi der Bovenschen gelesen, aber welches der fünfzig kurzen Kapitelchen hätte ich da auswählen sollen? Nein, dieser Roman wirkt nur als ein Ganzes. Immerhin habe ich die distinguierte Dame ausführlich vorgestellt und hoffe, dass es mir gelungen ist, die eine oder andere Zuhörerin für Silvia Bovenschen in toto zu interessieren.
Auf der Hinfahrt mit Bus und Bahn kämpfte ich immer noch gegen eine hartnäckige Art von Kopfschmerz, die mich schon seit zwei Tagen belästigte, vermutlich witterungsbedingt, denn nach ein paar winterlich kalten Tagen hatte es sich plötzlich wieder erwärmt. Nachdem ich mein Gepäck im Veranstaltungsraum an der Goebenstraße abgeladen hatte, blieb noch etwas Zeit und ich ging an die frische Luft. Nur wenige Schritte entfernt entdeckte ich den Altmarkt mit seiner Siegessäule. In stiller Zwiesprache mit der freundlichen Nike über mir [s. Titelbild] löste sich mein Kopfgrimmen in Rauch auf und verschwand mit den vorbeiziehenden Wolken hinterm Horizont.
Wie üblich trug mich dann mein frei assoziiertes Geplauder durch den Abend wie ein gut aufgepumptes Schlauchboot. Anschließend auf der ungemütlichen Heimfahrt, mit Besoffenen und streitlustigen Raufbolden in einem Abteil, graue Melancholie. Auch das wie üblich. Alles Sinnen und Trachten liegt ja dazwischen: hier der goldene Kranz der Siegesgöttin weit über unseren wehen Häupten, dort das lakritzig-klebrige Pech, von Aasvögeln erbrochen, in der Gosse zu unseren wunden Füßen.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Glück und Pech
Sunday, 15. November 2009

Die „linke Wochenzeitung“ (Selbsttitulierung) Jungle World, die sich 1997 nach einem Redakteursputsch in der Jungen Welt ausgründete, gehört zu jenen sich als „kritisch-undogmatisch-antiimperialistisch-linksliberal-unorthodox“ verstehenden Medien, die ich regelmäßig, wenngleich nur sporadisch lese, um mich über den jeweils aktuellen Zustand der Debattenkultur in Deutschland zu unterrichten.
Heute stolperte ich dort zufällig in einer Einlassung des Aachener Politikwissenschaftlers Dr. Richard Gebhardt (* 1970) zur neuesten Provokation des Kölner Kardinals Joachim Meisner (* 1933) über ein bemerkenswertes Statement zu einem Thema, das mich andernorts auch einmal beschäftigt hat: Passt das von Gerhard Richter gestaltete Südquerhausfenster im Kölner Dom zu einem christlichen Sakralbau? Gebhardt schreibt dazu: „Das von Gerhard Richter geschaffene Domfenster war nicht nach dem Geschmack des Erzbischofs. Es passe eher in eine Moschee, meinte er. […] Der Kölner Kardinal ist ein Wiederholungstäter. Empörte Proteste werden ihn auch fortan nicht beeindrucken. Vielleicht aber der Umstand, dass ein Blick auf das von Richter gestaltete Fenster wöchentlich mehr Menschen in den Dom lockt als alle Predigten des Erzbischofs im ganzen Jahr.“
Mal abgesehen davon, dass ich nie verstehen werde, warum ein kritischer Geist bei einem Heimspiel seine begrenzten Kräfte darauf verschwendet, seine gleichgesinnten Leser zu beifälligem Kopfnicken zu veranlassen, immer wieder und wieder den billigen Konsens beschwörend, der in diesem Falle heißt, dass der Herr Meisner ein so makelloses Feindbild abgibt, wie man’s schon lange nicht mehr hatte; abgesehen auch davon, dass das Missfallen des Kardinals nicht auf ästhetische Bewertungen gründete, also mitnichten, wie Gebhardt schreibt, ein Geschmacksurteil war, sondern vielmehr ein theologisch hergeleitetes; und schließlich auch abgesehen von der durchaus bezweifelbaren, erkennbar schadenfrohen Annahme, Meisner sei durch den Zulauf zu beeindrucken, den das von ihm ungeliebte Fenster im Gegensatz zu seinen Predigten findet, denn man könnte zum Beispiel fragen, ob sich dieser Zulauf nicht zu einem beträchtlichen Teil dem Protest des Kardinals gegen dieses Glasfenster verdankt – abgesehen also von all diesen Unschärfen und Oberflächlichkeiten in Gebhardts Argumentation interessiert mich vor allem die Frage: Was bedeutet das Fenster?
Dass es nichts darstellt, in dem bunten Mosaik aus 10.512 farbigen Glasquadraten kein gegenständliches Motiv erkennbar ist und auch keine abstrakte Form, wie zum Beispiel ein Kreuz oder ein Muster, das sieht jeder Betrachter auf den ersten Blick. Ergäbe sich etwa ein Ornament, so wäre die Gedankenverbindung des Kardinals halbwegs verständlich, der hier aus unerfindlichen Gründen eine Nähe zur Gestaltung islamischer Moscheen zu erkennen meint. Allerdings hat schon Nicola Kuhn seinerzeit im Tagesspiegel mit Recht darauf hingewiesen, Meisner offenbare mit dieser Assoziation „seine Ahnungslosigkeit, was christliche Kunstgeschichte betrifft. Nicht nur im Islam, auch hier gibt es das Ornament seit jeher. Die vom Kardinal offenbar bevorzugte Gegenständlichkeit ist eine Variante der Kirchenfensterkunst. Zugleich watscht er die Muslime und die maurische Formensprache ab. Als sei ornamentale Kunst beliebiger als figürliche Glasmalerei – und weniger wert.“
Aber wir können das Ornament getrost abhaken, hier ist keins zu erkennen. Nun könnte sich hinter der Anordnung ja dennoch eine Regelmäßigkeit verbergen, wenn etwa jede Farbe einer Zahl oder einem Buchstaben entspräche und sich aus der Zahlenfolge ein Code ergäbe, zum Beispiel für das menschliche Genom. Aber der Künstler hat deutlich gemacht, dass dem nicht so sei und die Anordnung rein zufällig. Er habe lediglich dort eingegriffen, wo sich zufällig doch erkennbare Muster einstellten, zum Beispiel habe sich durch eine Häufung von weißen Quadraten in einer Ecke eine Eins ergeben. Den Vorwurf, sein Werk passe besser in eine Moschee, wies Richter befremdet zurück. Er habe keine Beziehung zum Islam und hätte niemals einen solchen Auftrag angenommen. Richter gab zu, dass seine Fenstergestaltung nicht katholisch sei. „,Aber wie sähe eine katholische Gestaltung aus, die nicht plagiatorisch die Historie beschwört und nicht kunstgewerblich ist?‘, fragte er. Auch wenn er im Domfenster den Zufall als überwältigende Macht darstelle und nicht als göttliche Vorsehung, befinde sich das Fenster dennoch im sakralen Rahmen am richtigen Platz. Richter erklärte, er fühle sich als Spross des Christentums, der ,ohne den Glauben an eine höhere Macht oder etwas Unbegreifliches‘ nicht leben könne.“ (Welt online v. 31. August 2007.) – Vielleicht glaubt ja Richter eben an den Zufall als an die höhere Macht? Wie gelangte aber dann sein Glasbild in den Dom zu Köln? Doch nicht etwa durch Vorsehung?
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Im Jungle
Monday, 09. November 2009

Gute Interviews können auf zweierlei Weise zustande kommen. Der Königsweg führt naturgemäß über die minutiöse Vorbereitung des Interviewers auf seinen Gesprächspartner, getreu dem alten Satz von Hesiod folgend, dass vor den Erfolg die Götter den Schweiß gesetzt haben. Sodann gehört der Mut dazu, Fragen zu stellen, die den Interviewten aus der Fassung bringen oder ihn, sofern es sich um einen Prominenten handelt, doch mindestens dazu verleiten, mehr von sich preiszugeben als das längst allseits vertraute Bild, das er sich mit der Unterstützung seiner Imageberater zugelegt hat. Wenn dann noch souveräne Spontaneität in der unmittelbaren Gesprächssituation hinzukommt, und zwar idealerweise auf beiden Seiten, beim Frager und beim Befragten, dann entsteht eins jener kleinen Kunstwerke, die über den Tag hinaus eine ästhetische Geltung behaupten. (Wer Beispiele solcher meisterhaft geführten Interviews sucht, der wird auf der Website des in dieser Hinsicht Maßstäbe setzenden André Müller fündig.)
Die andere, ferner liegende, darum im Ergebnis jedoch nicht weniger beachtliche „Herstellungstechnik“ eines lesenswerten Interviews geht gerade von den entgegengesetzten Voraussetzungen aus. Hier stolpert der Fragensteller seinem bedauernswerten Opfer vor die Füße wie, bestenfalls, ein harmloser Banause, im schlimmeren Falle aber wie ein gemeingefährlicher Ignorant. Das Wenige, was er über sein Gegenüber in Erfahrung gebracht hat, stammt aus der Wikipedia, wovon er noch die Hälfte vergessen, die andere Hälfte falsch verstanden hat. Was einem solchen Interviewer an Kenntnissen mangelt, sucht er meist durch Keckheit auszugleichen. Oft finden wir diese Konstellation, wenn ein junger Nachwuchsjournalist auf einen Intellektuellen im Greisenalter losgelassen wird. Das Aneinandervorbeireden kann in solchen Scheindialogen zu grotesken Verzerrungen führen, auf dass das Ergebnis schon wieder reizvoll ist. Wenn dann noch eins unserer aufstrebenden Lifestyle-Magazine den Mut oder die Instinktlosigkeit besitzt, ein solchermaßen entgleistes Gespräch zu publizieren, dann kann auch dies, wo nicht für bare Münze, so doch für wahre Kunst genommen werden. (Wie kommt es nur, aber oft erinnern mich Interviews der beschriebenen Machart an die Bilder von Otto Dix.)
Jüngst haben Sacha Batthyany und Mikael Krogerus für die Zürcher Zeitungsbeilage Das Magazin (# 45 v. 6. November 2009) an der Bar des Hotels Kempinski in Berlin ein Interview mit dem ungarischen Literatur-Nobelpreisträger Imre Kertész geführt, der heute seinen achtzigsten Geburtstag feiert. Gleich schon zu Beginn ihres Fragespiels unterläuft den beiden „Recherche-Journalisten“ der erste Schnitzer: Sie werfen das Konzentrationslager Buchenwald und das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in einen Topf. „Sie waren 15, als Sie über Auschwitz nach Buchenwald deportiert wurden. Wussten Sie, wo Sie hinkommen werden?“ – „Nein. Neunzig Prozent der ungarischen Juden hatten keine Ahnung von den Konzentrationslagern.“ – „Wann haben Sie verstanden, was das [also Buchenwald] für eine Art Lager war?“ – „Bei der Ankunft haben wir noch nichts verstanden. Auch die Erwachsenen nicht. Sie ahnten überhaupt nicht, was passieren würde. Nicht mal bei der Selektion verstanden sie, was der Arzt mit ihnen machte. […]“ Kertész spricht also in seiner Antwort von seiner Ankunft in Auschwitz, da war er übrigens erst 14 ½ Jahre alt. Noch wird nicht ganz klar, dass Frager und Antworter aneinander vorbeireden. Später fragen die beiden dann: „Werden Sie nicht jeden Tag durch Ihre KZ-Tätowierungen an diese Zeit erinnert?“ Und nun erkennt Kertész, dass seine jugendlichen Gesprächspartner augenscheinlich ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben: „Ich hatte eine Nummer, eingenäht in meine Uniform, aber keine Tätowierung. Tätowiert wurde man nur in Auschwitz, nicht in Buchenwald, da müssen Sie besser recherchieren.“ Und dann spürt er, wie oberflächlich das Interesse dieser jungen Leute ist: „Hören Sie, was ist so interessant daran, über so ekelhafte Themen zu sprechen? Mit jungen Leuten würde ich viel lieber über etwas Schönes sprechen. Über Kunst oder schöne Frauen.“ Dazu fällt den „jungen Leuten“ nichts besseres ein, als den alten Mann der Verdrängung zu bezichtigen: „Ist es unangenehm, darüber zu sprechen?“ Das fragen sie allen Ernstes jenen Schriftsteller, der es wie kaum ein anderer seiner Leidensgefährten verstanden hat, alles ans Licht zu bringen, was er in der Hölle des Konzentrationslagers erleben musste. (Und später entblöden sie sich nicht, Kertész als Ignoranten vorzuführen, der den Namen Heidi Klum noch nie gehört hat: „Sie wollten doch über schöne Frauen reden.“)
Dann wird es interessant. Ninck und Batthayany befragen Kertész zu seiner Meinung über andere Bücher „über diese Zeit“. Er rühmt Celans Todesfuge, „die wunderbaren Essays von Jean Améry“, Ist das ein Mensch? von Primo Levi (den sie falsch Levy schreiben) und das schmale Werk des Polen Tadeusz Borowski. „Doch der Rest ist Kitsch […]. Das Lagerleben als Story, das geht nicht.“ Und was mit den Filmen sei? Mit dem berühmtesten Film zum KZ-Thema, Schindler’s List? Und jetzt macht der große Schriftsteller die beiden naiven jungen Männer für einen Moment sprachlos: „Schindler’s List? Der schlimmste Film von allen. Das ist alles scheissfalsch, ich kann das nicht anders sagen. […] Der Ausgangspunkt ist falsch. Dieses positive Denken. Spielberg erzählt die Geschichte aus dem Blick eines Siegers. Am Ende laufen die Leute in einer Reihe und singen, als ob die Menschheit gesiegt hätte. Der Ausgangspunkt eines KZ-Films kann nur der Verlust sein, die Niederlage der europäischen Kulturzivilisation. Das ist die Wahrheit: Holocaust-Erlebnisse sind universelle Erlebnisse. Der Holocaust ist kein deutsch-jüdischer Krieg, wer das denkt, der kommt zu nichts. Der Holocaust ist ein universelles Versagen aller zivilisatorischen Werte, und lange Zeit dachte ich, wir hätten daraus etwas gelernt. Aber ich lag falsch.“
Ja, wir lagen falsch. Und noch in diesem läppisch missglückten Interview wird genau dies deutlich.
[Titelbild: Zwei unbekannte Häftlinge blicken im Januar 1945 durch den Stacheldrahtzaun des Konzentrationslagers Auschwitz. – Laurence Rees: Die Nazis. München / Zürich: Diana Verlag, 1997, S. 190. – © Novosti.]
Posted in Würfelwürfe | 1 Comment »
Saturday, 07. November 2009

Ich noch nicht, denn ich bin gerade einmal auf Seite 147 angelangt, habe somit noch nicht die Hälfte des wunderbaren Kriminalromans gelesen, der mich seit Anfang des Monats bei Laune hält. (Bettlektüre.) Ich habe zwar schon ein paar Ideen, wer der Mörder sein könnte, oder auch die Mörderin, wie ich mich beeile ausdrücklich zu ergänzen, denn ich habe „die feministische Sprachreform vollzogen“, die auf Seite 10 in Erinnerung gerufen wird. Zwar könnte ich mich trotzdem bewusst von solchen formalen Zwängen distanzieren, aber nach dem, was die Autorin an anderer Stelle über den beliebten „Verstoß gegen die political correctness“ geschrieben hat – „er war einmal witzig, als das Korrekte im Übermaß verordnet wurde, aber jetzt, wo es das Bemühen darum kaum noch gibt, spricht der Verstoß gegen die Verstoßer“ (Verschwunden. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2008, S. 33) – bin ich verunsichert, ob mein Trotz gegen die feministische Sprachreform doch schon wieder chauvinistisch ist.
Die Autorin ist mir nicht erst durch dieses Buch aufgefallen. Schon durch die durchweg hymnischen Besprechungen ihrer Betrachtungen zur Idiosynkrasie, Über-Empfindlichkeit, war ich auf sie aufmerksam geworden (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000). Als dann vor drei Jahren ihre Notizen über das Unvermeidliche erschienen, Älter werden, da machte ich das Buch meiner Gefährtin zum Geschenk, die es mit Gewinn gelesen hat und darauf Wert legt, dass dies kein Buch über das Alter sei, sondern eben, wie der Titel ja ausdrücklich sagt, ein Buch übers Älterwerden (Frankfurt am Main: S. Fischer, 2006). Ich selbst habe aus Gründen, die zu erklären mich jetzt überfordern würde, beide nicht sehr umfänglichen, aber auf den ersten Blick hochkonzentrierten Bücher nicht gelesen. Aber sie stehen auf dem langen Bord meiner demnächst zu lesenden Bücher weit vorn und sind neuerdings noch ein gutes Stück weiter vorgerückt – weil nämlich Wer Weiß Was, das jüngste Buch der Autorin, mich schon nach den ersten Seiten im Sturm erobert hat (Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2009).
An Silvia Bovenschen (* 1946), von der hier – Liebhaber der höchsten Humorkunst werden es längst erkannt haben – die Rede ist, berückt mich allerhand: ihr Feinsinn; die grazile Technik; der erkennbare Fleiß beim Feilen an Details; nicht zuletzt die nie schlummernden Selbstzweifel, die sie davor bewahren, sich von den Fliehkräften ihrer beachtlichen Originalität aus der Bahn tragen zu lassen. Mancher Leser, der über die Liste der „Figuren“ auf den Seiten 7 und 8 des Kriminalromans stolpert und sich fragt, ob er sich einen Roman mit dreißig namentlich genannten Personen zumuten will, nicht gerechnet die beiden Tiere und vier nicht näher spezifizierte Wesen, die auf die überwiegend unglaubwürdig klingenden Namen Ertzuj, Iopö, Jkln und Kurt hören sollen … mancher von diesem Entree abgeschreckte Leser mag das Buch also gleich wieder aus der Hand legen, womit er sich freilich um einen Hochgenuss brächte, soviel kann ich schon nach 147 Seiten sagen. Auch der Schutzumschlag ist bestimmt nicht jedermanns Sache, ich mochte ihn selbst dann nicht, als ich herausgefunden hatte, dass seine Urheberin Sarah Schumann (* 1933) mit der Autorin die Wohnung teilt und eine international renommierte Künstlerin im Gefolge des Surrealismus ist. (Darf man so sagen?)
Dass ich hier auf eine Goldader gestoßen bin, dringend nun auch die älteren Bücher der Silvia Bovenschen lesen muss und jene, die noch nicht zu meiner Bibliothek gehörten, beschaffen – das wurde mir noch zusätzlich bestätigt, als ich bei der Recherche nach Informationen über die Autorin und ihr Werk auf so sympathische Internetseiten stieß wie die Website und das Blog von Jürgen Bräunlein, der ein sehr aufschlussreiches Portrait von Silvia Bovenschen geschrieben hat; oder das erstaunliche Monnier Beach Blog der Buchhandlung Reul in Kevelaar, wo eine Appetit machende Rezension von Verschwunden verschwände, wenn ich sie nicht hier ans Licht zerrte.
Und nun nehme ich, wie der als schweigsam und sanft bekannte Bibliothekar Simon Menzel in Bovenschens Buch, meine Brille ab und reibe mir die Augen, als sei plötzlich nach diesem gewollten Ausbruch eine tiefe Müdigkeit über mich gekommen.
[Schluss folgt zum Schluss. – Titelbild: Porträtfoto Silvia Bovenschen von Jürgen Bauer im Umschlag des besprochenen Buches. © S. Fischer Verlag.]
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Thursday, 05. November 2009

In den 1970er-Jahren, als es zum guten Ton gehörte, wenigstens näherungsweise Bescheid zu wissen, wenn die Rede vom Strukturalismus war, machte ich mich daran, das bekannteste Werk seines Hauptvertreters zu lesen, Traurige Tropen von Claude Lévi-Strauss.
Was ich an Neugier und gutem Willen zu viel hatte, mangelte mir nur zu oft an Ausdauer. Und so legte ich auch dieses wichtige Buch nach einem knappen Drittel aus der Hand, um mich einer anderen „Pflichtlektüre“ zuzuwenden.
Heute, dreißig Jahre später, blätterte ich zum ersten Mal wieder darin und zäumte das Pferd diesmal von hinten auf. Ich las die letzte Seiten des letzten Kapitels, das in der deutschen Übersetzung mit dem Titel „Die Rückkehr“ überschrieben ist und war erschüttert über die luzide Prophetie, die dieser Ethnologe und Philosoph hier in einer erbarmungslos unmissverständlichen Sprache zu Papier gebracht hat:
„Die Welt hat ohne den Menschen begonnen und wird ohne ihn enden. Die Institutionen, die Sitten und Gebräuche, die ich mein Leben lang gesammelt und zu verstehen versucht habe, sind die vergänglichen Blüten einer Schöpfung, im Verhältnis zu der sie keinen Sinn besitzen; sie erlauben bestenfalls der Menschheit, ihre Rolle im Rahmen dieser Schöpfung zu spielen. Abgesehen davon, daß diese Rolle dem Menschen keinen unabhängigen Platz verschafft und daß sein überdies zum Scheitern verurteiltes Bemühen darin besteht, sich vergeblich gegen den universellen Verfall zu wehren, erscheint der Mensch selbst als Maschine – vollkommener vielleicht als die übrigen –, die an der Auflösung einer ursprünglichen Ordnung arbeitet und damit die organisierte Materie in einen Zustand der Trägheit versetzt, der eines Tages endgültig sein wird. Seitdem der Mensch zu atmen und sich zu erhalten begonnen hat, seit der Entdeckung des Feuers bis zur Erfindung der atomaren Vorrichtungen, hat er – außer wenn er sich fortgepflanzt hat – nichts anderes getan als Millionen von Strukturen zerstört, die niemals mehr integriert werden können. Ohne Zweifel hat er Städte gebaut und Felder bestellt; doch handelt es sich auch hier nur um Maschinen, die dazu bestimmt sind, Trägheit zu produzieren, und zwar in einem Tempo, das in keinem Verhältnis zur Menge an Organisation steht, das die gebauten Städte und die bestellten Felder implizieren. Was die Schöpfungen des menschlichen Geistes betrifft, so besitzen sie Sinn nur in bezug auf ihn, und sie werden im Chaos untergehen, sobald dieser Geist verschwunden sein wird. […]“ (Claude Lévi-Strauss: Traurige Tropen. A. d. Frz. v. Suzanne Heintz. Köln / Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1970, S. 366 f.)
Ich zitiere den Schluss nicht bis zum Ende, das nicht zu ertragen ist. Am vergangenen Wochenende ist Claude Lévi-Strauss im Alter von hundert Jahren in Paris gestorben.
[Titelbild: Umschlaggestaltung für das zitierte Buch von Hannes Jähn (1934-1987).]
Posted in Oikos | Comments Off on Entropologie
Tuesday, 03. November 2009
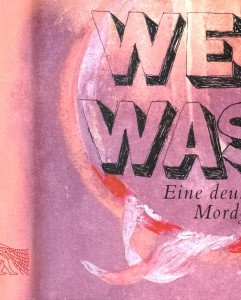
Fragt man mich nach meinen Lieblingsbüchern oder, noch schlimmer, meinem einen allerliebsten Lieblingsbuch, dann verweigere ich prinzipiell die Antwort und liefere ersatzweise eine Beschreibung dessen, was Bücher an sich haben müssen, um sich aus der Vielzahl der Bücher, die ich lesend prüfe, als besonders beglückende hervorzuheben. Im Regelfall ist Lesen für mich eine, wenngleich meist angenehme, Art von Arbeit, nach der ich, wenn ich sie abgeschlossen, das betreffende Buch also bis zum Ende gelesen oder aber als ungenießbar aus der Hand gelegt habe, ein Gefühl der Erleichterung verspüre: Geschafft! Ganz selten aber fällt mir ein Buch zu, bei dem ich schon nach wenigen Seiten den irrationalen Wunsch verspüre, dass es nie zu einem Ende kommen möge. Ich drossele dann sofort mein Lesetempo, lese jeweils nur eine kleine Portion, gönne mir pro Tag bloß ein paar Seiten und finde ein außergewöhnliches Vergnügen darin, wann immer ich ein solches Buch wieder zur Hand nehme, mir zunächst die beim vorigen Mal gelesenen Seiten erneut zu Gemüte zu führen, wobei ich, auch das macht ja die besondere Qualität dieses Buches aus, stets überrascht bin, dass ich beim ersten Lesen längst nicht alle Feinheiten seiner Machart durchschaut noch alle Einzelheiten seines Inhalts angemessen gewürdigt habe.
Lange, zu lange musste ich zuletzt auf diese ebenso beglückende wie seltene Erfahrung warten. Ich war schon geneigt zu glauben, meine Ansprüche seien mittlerweile zu hoch, um noch einmal in den Genuss eines Buches kommen zu können, das die beschriebene Wirkung auf mich haben würde. Seit ein paar Tagen nun lebe ich mit einer Lektüre wie im Rausch.
Das Buch, das ich lese, ist ein Kriminalroman. Ich habe vor etlichen Jahren eine Phase durchlesen, in der ich Krimis im Dutzend verschlang. Einige wenige – von der Highsmith, von Boileau und Narcejac, von Patrick Quentin – hinterließen aus verschiedenen Gründen einen bleibenden Eindruck. Etlichen bei meinen Freunden beliebten, von ihnen vielfach gelobten Autoren dieses Genres versuchte ich mich mehrfach anzunähern, ohne etwa mit Georges Simenon, Raymond Chandler, Friedrich Glauser oder Boris Akunin so recht warm werden zu können.
Auf jene Krimileser, denen es darum ging, im Verlauf der Handlung möglichst frühzeitig den Täter zu erraten, sah ich mit leichter Geringschätzung herab. Literaturgenuss ist doch kein Ratespiel! Ein Kriminalroman soll bekanntlich vor allem spannend sein. Was das betrifft hielt ich es aber eher mit Krimis, bei denen ich mit einem längst bekannten Täter zittern musste, der mit allen Mitteln seiner Entlarvung zu entgehen versucht. Wie er da immer weiter in die Enge getrieben wird und in hoffnungslosen Situationen, in denen der Leser längst alles verloren glaubt, trotzdem noch einen Ausweg findet, wenngleich natürlich nur für ein weiteres kurzes Weilchen – das konnte, wenn es vom Autor meisterlich betrieben wurde, schon einen unvergleichlichen Genuss bereiten.
In dem Kriminalroman, der mir jetzt den so lange entbehrten Hochgenuss bereitet, steht nun aber die Frage nach dem Täter, genauer: der Identität des Mörders, steht jenes konventionelle Whodunit überraschenderweise im Vordergrund.
[Wird fortgesetzt und aufgeklärt.]
Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »
Monday, 02. November 2009
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Fadenschein
Sunday, 01. November 2009

Dreizehn Jahre und drei Monate hatten wir auf Rufweite zu diesem Edeka-Laden gewohnt und regelmäßig dort eingekauft.
Doch nein, das ist nicht ganz richtig! Als wir in den Stadtwald zogen, war das Grundstück in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, auf dem der Laden dann bald stand, für ein Weilchen noch ein ungepflegtes Brachland, „Kleppes Feld“ genannt, wo ein Altwarenhändler sein Geschäft betrieb. Für Lebensmitteleinkäufe mussten wir die Hauptstraße bergauf zum Stadtwaldplatz, wo ebenfalls ein Edeka-Laden residierte, oder bergab zum Stiftplatz, wo die Konkurrenz mit niedrigeren Preisen lockte, unter oft wechselnden Firmennamen wie co-op, Depot und vielleicht noch weiteren, die ich längst vergessen habe. (Heute gibt es dort einen Getränkemarkt.)
Dann ergriffen wir die Flucht vor dem Dauerlärm der Hauptstraße, den wir zwar bewusst kaum mehr wahrnahmen, der uns aber dennoch an die nervliche Substanz ging. Nahezu fünf lange Jahre betraten wir „unseren“ Edeka-Laden nicht mehr, weil wir in einem anderen Stadtteil wohnten, wo wir stattdessen Stammkunden bei einem Kaiser’s wurden. Wir gewöhnten uns an ein geringfügig anderes Angebot, an unbedeutend abweichende Preise: hierfür ein paar Cent mehr, dafür ein paar Cent weniger. Und wir vergaßen die Gesichter der Kassiererinnen, die uns so viele Jahre lang nahezu Tag für Tag unser Haushaltsgeld abgenommen hatten, um uns an andere Kassiererinnen zu gewöhnen, die dies mit der gleichen freundlichen Selbstverständlichkeit taten.
Nun sind wir wieder zurückgezogen in die Nähe des Edeka-Ladens der Jahre 1991 bis 2004. Und es ist eine merkwürdige Erfahrung, wie die Zeit hier scheinbar stehengeblieben ist. Die Einrichtung wurde modernisiert, das schon. Manche Produkte wurden aus dem Programm genommen, andere kamen hinzu. Beim dritten, spätestens vierten Besuch hat man sich wieder orientiert. Hinter den Kassen nehme ich die altbekannten Gesichter wahr, wenige neue, was vermuten lässt, dass auch Kassiererinnen ausgeschieden sind, aber an die erinnere ich mich nicht mehr.
Und nun das Erstaunliche: Ich selbst werde nicht wiedererkannt, von keiner einzigen der Kassiererinnen. Habe ich mich etwa äußerlich so sehr verändert? Oder ist diese Asymmetrie der Wahrnehmung ganz natürlich, aus den verschiedenen Rollen von Personal und Kundschaft erklärlich? Vielleicht habe ich ja auch ein ausgesprochenes Inkognito-Gesicht, das im Gedächtnis meiner Mitmenschen kaum Spuren hinterlässt, ein Gesicht wie Noface in dem gleichnamigen, meisterlichen Roman von W. E. Richartz. Diese Erfahrung verunsichert mich. Aber warum? (Und es verunsichert mich zusätzlich, dass ich auch auf diese letzte Frage keine Antwort weiß.)
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Noface
Saturday, 31. October 2009

Vielleicht war es auch der Geist von Raymond Federman, der mich Anfang des Monats aus dem Tritt gebracht hat.
Federman starb am 6. Oktober früh um 6:15 Uhr im Alter von 81 Jahren im kalifornischen San Diego an Krebs. Seine Tochter Simone, die ihn in der langen Zeit seiner Erkrankung begleitet hatte, war auch in der Stunde seines Todes bei ihm. Über fast alles, was das Menschenleben ausmacht, wenn das Nebensächliche von ihm abgestreift wird, zum Beispiel in einem Augenblick höchster Todesangst, hat Raymond Federman geschrieben, als Erzähler und als Dichter. Für den letzten Augenblick vor dem Ende hat er seinen Wunsch in ein Gedicht gekleidet, Am Ende, in meiner Übersetzung:
Manche sterben heroisch
auf dem Schlachtfeld
andere aufbegehrend
mit einem Sprung von der Klippe
viele jedoch sterben
unerwartet
im Schlaf
ohne es zu erleben
während eine Vielzahl
in Angst und Feigheit dahingeht
auf den Krankhausstationen
sehr wenige scheiden
schmalos dahin
ohne sich zu sträuben
Ich hingegen wünsche mir zu sterben
gerade so eben
ohne Begeisterung
Man muss wissen, dass Raymond Federman dem Tod vor sehr langer Zeit, Mitte Juli 1942 in Paris im allerletzten Augenblick von der Schippe gesprungen ist, als 14-jähriger Judenjunge, den seine beherzte Mutter vor den Nazischergen in einem Schrank versteckte.
Ich weiß, dass Raymond Federman über diese klaustrophobe Erfahrung ein Buch geschrieben hat, The Voice in the Closet – La voix dans le cabinet de débarras – Die Stimme im Schrank. Ein einziger Satz. Diesen 75 Seiten langen Satz las Simone ihrem Vater in der Nacht seines Todes noch einmal vor, in einem Atemzug. Sie kam bis Seite 61, dann
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Am Ende
Saturday, 31. October 2009

Vor dem Zweiten Weltkrieg hatten die taktischen Scharmützel zwischen den Geschlechtern noch Stil. Eben lese ich an entlegenem Ort den Anfang einer kleinen Geschichte, die das Missverstehen, das Missverstehenwollen und Missverstehenmüssen von Männern und Frauen, diese uralte Geschichte seit Adam und Eva, zum Thema hat. Hier beginnt die Geschichte so:
„,Liebling, würde es dich sehr kränken, wenn ich stürbe?‘ fragte einmal Herr Vopalka seine entzückende Frau, so unerhört geistreich, wie nur Ehemänner fragen können. – ,Ja‘, antwortete sie ohne Ueberzeugung und widmete ihre volle Aufmerksamkeit ihrer eleganten Toilette, in der sie sich vor dem Spiegel mit kritischem, aber zufriedenem Blick betrachtete. – Dann setzte sie sich vor dem Spiegel auf einen kleinen Hocker, der eher einem Polster als einer Sitzgelegenheit glich und betrachtete, ein wenig den Rock hebend, ihre langen schlanken, in elegantes Spinnweb holzbrauner Strümpfe gekleideten Beine. – ,Was würde dich am meisten traurig machen?‘ bohrte der Gatte, mit der Ehemännern eigenen, unermüdlichen Gründlichkeit weiter. – ,Das ich ein Jahr lang schwarze Strümpfe tragen müsste, die mir wahrscheinlich nicht stehen würden,‘ sagte ganz aufrichtig Madame, bei dieser Vorstellung einigen Missmut in Augen und Stimme. – Sie hatte ihrer Ueberzeugung nach die Wahrheit gesagt und damit einen Fehler gemacht. Die Männer sind schon so, dass sie an Lügen glauben, je angenehmer die Lüge, desto fester, und dass sie die Wahrheit verwerfen, oder sie als einen Witz betrachten, den die von ihnen geliebte Frau gemacht hat. – Der Gatte, Herr Vopalka, lachte ein glückliches Lachen […].“
Die rabenschwarze, zyanbittre Story heißt Die schwarzen Strümpfe und stammt von Zdena Jindrova, einer Tschechin vermutlich, über die in den mir zugänglichen Literaturgeschichten (und selbst im Internet, das doch sonst immer alles weiß und kennt) nichts herauszufinden ist. Sie erschien am 15. August 1938 in der Pariser Tageszeitung, dem Blatt der deutschen Emigranten in Frankreich, auf Seite 4 der Sonntagsbeilage (3. Jg., Nr. 763). Da ich sonst nicht viel über dieses merkwürdige Stück Kurzprosa herausgefunden habe, teile ich hier immerhin noch mit, dass in diesem letzten Friedensjahr vor Beginn der großen Schlächterei der 15. August kein Sonntag, sondern ein Montag war. Vielleicht hängt diese Unstimmigkeit damit zusammen, dass am 15. August in katholischen Ländern und also auch in Frankreich Mariä Himmelfahrt gefeiert wird.
Aus dem so viel undelikateren Jahr 2009 werfe ich für einen Moment einen sehnsuchtsvollen Blick zurück in eine Epoche, als Frauen noch schreiben durften, wie „die Männer“ schon so sind – und Männer dies lasen, mit einem Schmunzeln oder voller Abscheu, je nach Façon. Dann fällt mir ein, dass solcherlei Plaudereien der feinen Gesellschaft am Abgrund stattfanden. Noch war die Hauptstadt der Liebe frei; aber nicht mehr lange, und gänzlich humorlose Männer würden auf den Plan treten, die zwar auch an Lügen glaubten, aber nicht an die Lügen ihrer neckischen Gattinnen auf dem Schminkschemel, sondern an die Lügen eines brutalen Surmâle. Und für undeutsche Schminkereien und Seidenstrümpfe gleich welcher Farbe würde es dann keinen Platz mehr geben.
So wird jede noch so wohlige nostalgische Träumerei über die zynischen Idyllen der Vorkriegszeit, gar jeder Vorkriegszeit, durch den ungetrübten Blick auf die Folgen zuschanden.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Vopalka lacht
Tuesday, 27. October 2009

… melancholisch macht:
Der Anblick via Livestream vom nahezu leeren Plenarsaal im Berliner Reichstag, in einer Sitzungspause. Die immerzu tropfenden Regenrinnen an den Bushaltestellen meiner Vaterstadt im Herbst, diese offensichtliche Fehlkonstruktion zu Lasten des Steuerzahlers, und die über diesen kleinen Skandal lamentierenden älteren Herrschaften. Prousts Augen. Alte Straßenbahncarnets, undatierbar, als Lesezeichen in meinen Büchern, jeweils an der Stelle, wo ich offenbar das Lesen aufgegeben habe, und scheinbar mit Recht.
Verrottete Minigolfanlagen; noch schlimmer, wenn sie sich Kleingolfanlagen nennen. Ältere Ehepaare auf Wanderschaft im winterlichen Wald, nicht neben-, sondern hintereinander staksend mit ihren rückenfreundlichen Trockenskiern. Zwecklos gewordene Unterstellmöglichkeiten an aufgegebenen Bahnstrecken im Hochsommer.
Plattgefahrene Igel, Tauben, Frösche, Kastanien, Eicheln, Pizza- und Zigarettenschachteln, Ameisen pp. Und was mag das einmal gewesen sein?
Missverständnisse resp. Missverhältnisse, wie zum Beispiel kleine Kinder von Eltern, die besser deren Großeltern sein sollten.
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Was mich …
Monday, 26. October 2009
Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Sunday, 25. October 2009
Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Saturday, 24. October 2009
Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.
Thursday, 08. October 2009
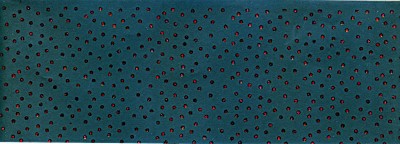
Gestern habe ich tatsächlich die allerletzten Bücherkisten ausgepackt und ihren Inhalt in die Lagerregale verfüllt. Ja, dieser Ausdruck, wie aus einer Großmolkerei mit Massentierhaltung, passt ganz gut zu der viehischen Plackerei, der ich mich in den vergangenen Tagen ausgesetzt sah.
Viele Male musste ich mir Gewalt antun, wenn ein Buch meine Aufmerksamkeit erheischte, das ich schon seit Jahren nicht mehr in Händen gehalten und gar schon nahzu vergessen hatte. Nur zu gern hätte ich der Zeit nachgesonnen, als ich es für meine Bibliothek erwählte, den Gründen auf der Spur, die es für mich eingenommen hatten; zu gern hätte ich mir die Frage gestellt, ob ich es gelesen und mit welchem Ergebnis aus der Hand gelegt haben mochte. Aber der unbarmherzige Scherge, den ich mir selbst in den Nacken gesetzt hatte, ließ keinen Müßiggang zu. Hier galt es einzig und allein zu prüfen, ob der Platz auf den Brettern für das in den Kisten reichen würde. Also rief er mir ein ums andere Mal sein Kommando ins Gewissen, wenn ich in Nachdenklichkeit zu versinken drohte: ,Weiter, weiter! Auspacken, einräumen! Zum Träumen ist später noch Zeit genug.‘
Wie Schneeflocken tanzten die Bücher vor mir im Neonlicht des Archivs. Die Masse, die ich zwar geahnt hatte, überwältigte mich dann doch. Das war zweifellos nicht mehr gesund. So viele Bücher! Wie hatte ich es nur so weit kommen lassen können? Als mein zweiter Sohn die letzte Sackkarrenladung abgesetzt hatte, meinte er in seiner unnachahmlich trockenen Art: „Nun habe ich aber fürs Erste wirklich genug von deinen Büchern, Vater.“ Dieser Überdruss war ihm und allen anderen, die mir in den letzten Wochen und Monaten wissentlich oder unfreiwillig geholfen hatten, meine Bibliothek erstmals seit vielen Jahren wieder an einem Orte zusammenzuführen, wahrlich nicht zu verdenken. Ich danke euch von Herzen …
In der vergangenen Nacht träumte ich, dass ich aus dem Fenster eines Sanatoriums in eine dunkle Winterlandschaft hinausspähte, weil ich jemanden erwartete, der mich hier besuchen wollte. Es schneite auch in diesem Traum, aber die Schneeflocken waren blutrot. Das wunderte mich zwar nicht weiter, aber ich machte mir Sorgen, mein Besucher könnte sich auf seiner Wanderschaft die Kleidung ruinieren.
(Übrigens vermisse ich jetzt, obwohl ich wirklich alle Kisten ausgepackt habe, immer noch einige Bücher, die ich bei dieser Herkulestat fest gehofft hatte endlich wiederzufinden.)
Posted in Bibliotheca Curiosa, Rêverie, Würfelwürfe | Comments Off on Blutregen
Tuesday, 06. October 2009

Das letzte Vierteljahr sollte diesmal das beste werden, wozu nicht viel gehört. Denn das erste war bestimmt von der Suche nach einer neuen Bleibe, das zweite von den Umzugsvorbereitungen und das dritte vom Umzug selbst. Nun müsste es mir doch eigentlich vergönnt sein, zur Abwechslung auch mal ganz schlicht und einfach zu wohnen.
Stattdessen fühle ich mich aber noch immer seelisch wie wundgescheuert von den Strapazen der vergangenen Monate. So kann ich beispielsweise den ständig lauernden Verdacht nicht mehr loswerden, irgendetwas ganz Entscheidendes vergessen zu haben, das unbedingt noch zu tun ist und nicht mehr nachgeholt werden kann, wenn ich es im richtigen Moment zu tun verabsäume. Manchmal, wenn ich neulich nachts wach lag und mich die langweiligste Lektüre nicht in den Schlaf schieben konnte, fürchtete ich, dass der Umzug einen bleibenden Schaden an oder in mir angerichtet haben könnte.
Vielleicht bin ich ja dispositionell ein extrem immobiler Mensch? Vielleicht wäre es mir am liebsten, an einem Ort geboren zu sein, mein liebes langes Leben am gleichen Platze hinzubringen und ebendort auch zu sterben? Vielleicht geht’s wider meine Natur, wenn die zufälligen äußeren Umstände mir alle paar Jahre einen Wohnungswechsel aufnötigen? Dafür spräche ja zum Beispiel auch, dass ich mich selbst zu kleinsten Reisen nur mit allergrößter Kraftanstrengung aufraffen kann und unterwegs die meiste Zeit übellaunig, kränklich und unglücklich bin.
Ich weiß schon: „Reisen bildet.“ So sagt man jedenfalls. Aber man sagt ja manches, das sich bei genauerer Betrachtung als vollkommener Blödsinn erweist: „Der erste Eindruck ist der beste.“ – „Wer rastet, der rostet.“ – „Was lange währt, wird endlich gut.“ Für diese und manch andere Redensarten habe ich im wirklichen Leben mindestens ebensoviele Gegenbeispiele wie Bestätigungen gefunden. So kenne ich manche Globetrotter, deren Verstand nach all der Weltenbummelei kaum über ihre eigene Nasenspitze hinausreicht, von Bildung ganz zu schweigen. Der Übergang vom Nomadentum zur Sesshaftigkeit war der größte Schritt des streunenden Affen auf dem Weg zum Dr. phil. Und wenn am Eingang zum dritten nachchristlichen Jahrtausend die Zweibeiner regelmäßig ihre trauten vier Wände verlassen und als hochtourige Touristen durch die Weltgeschichte preschen, dann ist das keineswegs die Krönung des Fortschritts, sondern ein atavistischer Rückfall in unbehauste Zeiten, als es noch keinen „Lieferservice für alles“ gab.
Pascal war bekanntlich der Ansicht, „daß alles Unglück der Menschen einem entstammt, nämlich daß sie unfähig sind, allein in ihrem Zimmer bleiben zu können. Kein Mensch, der genug zum Leben hat, würde sich, wenn er es nur verstünde, zufrieden zu Haus zu bleiben, aufmachen, um die Meere zu befahren oder eine Festung zu belagern.“ (Blaise Pascal: Über die Religion und über einige andere Gegenstände – Pensées. A. d. Frz. v. Ewald Wasmuth. Heidelberg: Lambert Schneider, 1978, S. 77.) Bei mir war’s von Kind auf gerade umgekehrt. Meine Mutter drangsalierte mich, ich solle doch bei dem schönen Wetter hinausgehen auf die Straße, mit meinen Altersgenossen spielen, statt mich immer hinter Büchern zu verkriechen. Wenn ich so weitermachte, würde ich ja ein rechter Eigenbrötler, ein Stubenhocker gar, den niemand zum Freund haben wolle! – So nahm das Elend schließlich auch mit mir seinen Lauf.
[Wird gelegentlich vielleicht fortgesetzt.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Homo immobilis (I)
Saturday, 03. October 2009

Heute auf den Tag genau vor 350 Jahren strandete ein Seemann und Abenteurer als offenbar einziger Überlebender auf einer unbewohnten und entlegenen Insel im Mündungsgebiet des Orinoco. Sein Name: Robinson Crusoe.
Aber diese Geschichte ist „nur“ erfunden, nämlich von einem Mann namens Daniel Defoe (~1660-1731), der gerade erst in der wirklichen Welt erschien, als sich der angebliche Schiffbruch zutrug. Dieser Daniel Foe, so sein eigentlicher Name, war der Sohn eines Kerzenziehers, ein durch Leichtsinn und politische Abenteuer hoch verschuldeter Bankrotteur, der diesen und viele weitere Romane schrieb, um mit den übrigens eher dürftigen Erträgen seiner Vielschreiberei seine zahlreichen Gläubiger halbwegs bei Laune zu halten. Auch sein – neben The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders (1722) – erfolgreichstes Werk, eben The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe (1719), machte ihn nicht reich, wohl aber seine Verleger: Neben der Bibel ist es angeblich das auf der Welt am meisten verbreitete Buch. (Vgl. Georg Bremer: Der Mann, der Robinson war; in: Die Zeit Nr. 30 v. 18. Juli 1986, S. 54.)
Angeregt wurde Defoe zu seinem Abenteuerroman durch die Lebensgeschichte des schottischen Seemanns Alexander Selkirk (1676-1721), der als Segelmeister auf der Cinque-ports, einem britischen Kaperschiff auf Beutefahrt im Südpazifik, mit seinem Kapitän in Streit geriet und im Oktober 1704 auf Más-a-tierra, einer der Juan-Fernandez-Inseln, ausgesetzt wurde. „Während Defoe seinen Robinson 28 Jahre, zwei Monate und 19 Tage auf seiner Insel verbringen läßt, braucht Selkirk ,nur‘ vier Jahre und vier Monate auszuharren.“ (Ebd.) Anfang Februar 1709 erlösen ihn zwei englische Schiffe aus seiner Isolation. Am 3. Dezember 1713 erscheint in Nr. 26 der Zeitschrift The Englishman ein ausführlicher Bericht über Selkirks Insel-Eremitage, den Defoe höchstwahrscheinlich kannte. (Vgl. Der wahre Robinson oder Das Walten der Vorsehung. Leben und Abenteuer des Alexander Selkirk. Zusammengestellt u. hrsg. v. Nikolaus Stingl. Nördlingen: Robinson Verlag Brunner & Lorch, 1980, S. 140-145.) Einiges spricht sogar dafür, dass Defoe dem Vorbild für seinen Robinson einmal persönlich begegnet ist.
Heute hat Lothar Müller in der SZ dankenswerterweise auf dieses von den zunehmend alberner werdenden Google-Doodle-Moglern natürlich nicht erkannte Jubiläum hingewiesen und seine Bedeutung hervorgehoben, sollte doch „der Jahrestag des 30. September 1659 als Feiertag in der Geschichte der Romankunst begangen werden. Er ist in der Epoche der Heraufkunft des Romans das Gegenstück zu jenem 16. Juni 1904, der seit dem Ulysses von James Joyce als Tag der Unabhängigkeitserklärung des Romans der Moderne gefeiert wird.“ (Lothar Müller: „Hier kam ich am 30. September 1659 an Land“; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 225 v. 30. September 2009, S. 14.)
Übrigens war der 30. September des Jahres 1659 ein Dienstag; und seine Nacht wurde vom Vollmond erhellt.
[Wird fortgesetzt. – Das Titelbild zeigt eine Illustration Ludwig Richters zu Joachim Heinrich Campes Robinson der Jüngere.]
Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Robinsontag (I)
Wednesday, 30. September 2009
Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.